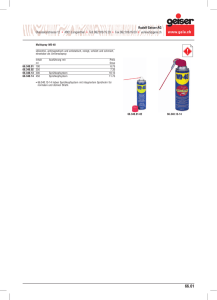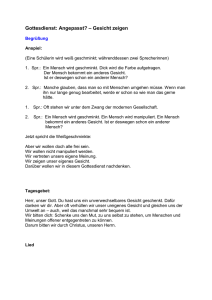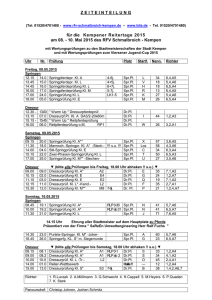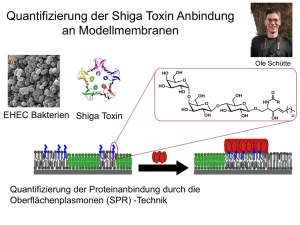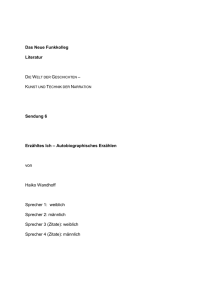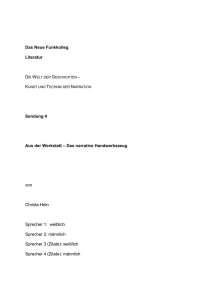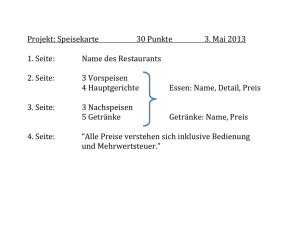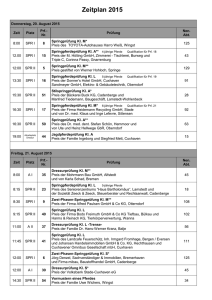SWR2 Essay
Werbung
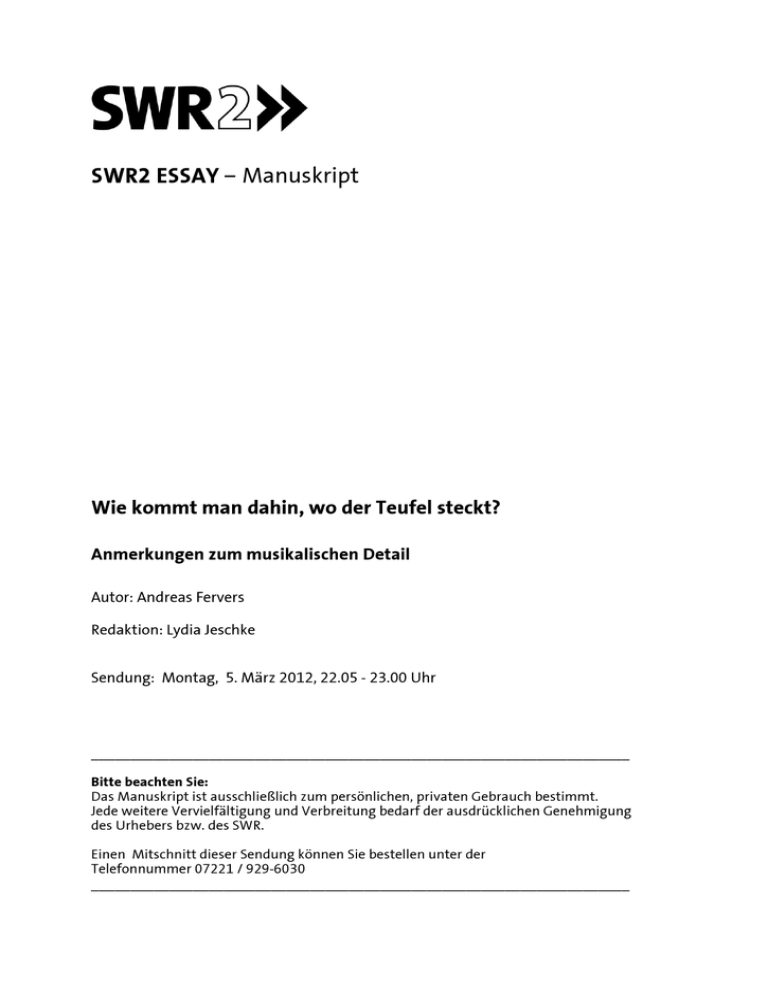
Wie kommt man dahin, wo der Teufel steckt? Anmerkungen zum musikalischen Detail Spr.1 Donaueschingen, Mitte Oktober 2011. Wie jedes Jahr findet in der Kleinstadt im Schwarzwald eines der weltweit bedeutendsten Festivals für zeitgenössische Musik statt. Die Menschen sind unterwegs, Kommunikation wird groß geschrieben - nicht nur zwischen und bei den Konzertsälen, in denen Neues instrumental aufgeführt wird; auch in Kirchen, Museen, im Schlosspark, auf dem Sportplatz des örtlichen Gymnasiums; nicht nur real, nach Belieben auch virtuell im Internet. Nach wie vor kommen wohl die meisten Besucher wegen der Uraufführungen von Instrumental- und Vokalmusik, es gibt aber eine Fülle neuer, ergänzender Konzertformen und Angebote, die das Erscheinungsbild der Musiktage in den letzten Jahren erheblich verändert haben. Eines dieser Angebote spielt in diesem Kontext aber eine Sonderrolle, weil es seinen festen Ort bei diesem Festival hat, solange man zurück denken kann, genauer gesagt seit 1965: Eine umfangreiche Ausstellung aller größeren Musikverlage, die sich im Bereich der zeitgenössischen Musik engagieren. Hier kann man in Ruhe stöbern, sich über Neuerscheinungen informieren - und natürlich einen Blick auf Partituren der in diesem Jahr aufgeführten Komponisten werfen, sich ein Bild von ihrer sonstigen Musik, mitunter von ihrem gesamten Oeuvre machen. Vorausgesetzt, man bewältigt den Transfer von der Schrift zur Klangvorstellung. Denn die ganz große Mehrzahl der Partituren, die man hier aufschlägt ist von sehr hoher Komplexität, schwer vorstellbar nur mit Hilfe des Schriftbildes, versehen mit einer Unmenge von Details, deren Verhältnis zum wirklichen Klang, ihre Rolle für die Form des Stückes sich kaum aus dem Notentext herauslesen lässt. Der hohe Grad der Differenzierung der Textur lässt sich unschwer erkennen; wie aber wirken all diese Details im Kontext, diese vielen außergewöhnlichen Spieltechniken, die minimalen Tonhöhenunterschiede, die artikulatorischen, rhythmischen und dynamischen Feinheiten? Fügen sie sich zu einem stimmigen Ganzen? Würde man hier überhaupt von Details reden, oder eher von Nuancen, von Feinheiten, Abschattierungen? Ist das, was man hier als textliches, geschriebenes Detail identifiziert auch eines, das man in der klingenden Musik so nennen würde? 2 Die Situation an diesen 3 Tagen in Donaueschingen hat etwas sehr Bildhaftes: Die neue Musik scheint allgegenwärtig, die Stadt wird zu einer Art Ökotop der zeitgenössischen Musik und der unerhörten Klänge. Die Türen des Elfenbeinturms werden weit geöffnet, das Labor wird besuchbar, man verlässt die Domäne der Studierstube und der Schrift zu Gunsten der unmittelbaren Kommunikation, man kann sich diese Welt flanierend zwischen den Knoten eines beeindruckenden Netzes von Angeboten erschließen. Hier muss man nicht nur geistig sondern auch physisch mobil sein, wenn man alles angemessen nutzen will. Der wie eh und je notierten Musik aber scheinen hier gewisse Grenzen gezogen zu sein. Dort, wo es um deren innere Substanz geht, um die Genauigkeit der Formulierung, um Klarheit in Stil und Aussage, kommt die Liebe zum Detail ins Spiel. Was aber heißt das für den Hörer: es geht um Genauigkeit und Klarheit; und vor allem: wie nahe kommt man heran ans musikalische Detail, unter welchen Umständen und unter welchen Voraussetzungen? Wie ist es überhaupt als substantielle Einheit zu fassen? Irgendwie hat die Notenausstellung in Donaueschingen etwas Heroisches an sich: Eine Fülle schwer entzifferbarer Schriftzeichen, für Viele nur unverständliche Hieroglyphen, handgeschrieben oder gedruckt, Berge komplexester Partituren, - all dies verbleibt wie eh und je bei den Donauhallen, in direkter Nachbarschaft des zentralen Veranstaltungsortes. Beharrlich zeigt die Ausstellung die andere, schwierige, sperrige Seite der zeitgenössischen Musik, in der Hoffnung, dass sich Interessenten finden, die all dies geduldig durch buchstabieren. Spr.2 ‚In der Zeit davor, die Habermas als Epoche der repräsentativen Öffentlichkeit beschreibt, hatte die Kunst vor allem als Kulisse, Machtsymbol, Statussymbol, Dekoration und Zutat von Ritualen fungiert. Doch mit dem Übergang von der repräsentativen zur bürgerlichen Öffentlichkeit wurde die Kunst zum höchsten Gut. Die Kunst verlieh geistigen Adel statt Adel durch Geburt. Die Kunst war das Medium einer vorgestellten metaphysischen Kommunikation mit etwas Ewigem. Die Kunst war Quelle bürgerlichen Selbstbewusstseins. Um daraus zu schöpfen, brauchte man neue Kulturtechniken, die uns bis heute erhalten sind. So war diese Zeit etwa eine Schule des konzentrierten Musikhörens, verstanden als körperliche Disziplin des Stillsitzens und soziale Disziplin des Schweigens. Und die Kunst hinterließ architektonische Spuren im Zentrum der europäischen Städte, Kulturtempel wie Opernhäuser, Theater, Konzerthäuser, Museen, ohne die uns noch heute eine Stadt nicht als Stadt erschiene, sondern als amorphes Konglomerat. 3 Jetzt aber symbolisieren die alten Gebäude im Stadtzentrum keine kulturelle Mitte mehr. Wenn ich in die Oper gehe, bin ich nicht am Puls der Öffentlichkeit, vielmehr suche ich eine Nische auf. Das Stadion von Greuther Fürth ist auch eine Nische, und Gleiches gilt für Einkaufszentren, Kneipen, Automobilmessen, Fernsehformate oder Swinger Clubs. An die Stelle eines gemeinsamen kulturellen Kristallisationskerns sind zahllose Andockmöglichkeiten für ebenso zahlreiche Interessen, Idiosynkrasien und Obsessionen getreten. Die Kunst ist eine Andockmöglichkeit für gelegentlich auftretenden Bedarf.’ Spr.1 Einigermaßen kulturpessimistisch mutet der Vortrag des Soziologen Gerhard Schulze beim 6. kulturpolitischen Bundeskongress zunächst an: Marginalisierung der Kunst und ihre Auflösung als normative Instanz sind für ihn zwei Tendenzen, die sowohl die Gegenwart als auch die weitere gesellschaftliche Entwicklung charakterisieren. Seine Hoffnung setzt er nicht zuletzt auf die Potentiale, die sich durch Digitalisierung und neue Medien ergeben. Er sieht hier ganz neue Freiräume für Begegnungen, ohne die Bürde bildungsbürgerlicher Normierung; die Bevölkerung des 21. Jahrhunderts sieht er selbstbestimmt, selbst denkend, zur Reflexivität herausgefordert und geübt in kommunikativer Vernunft. Diese Hypothese zeugt von einem erstaunlichen Vertrauen in die Lernfähigkeit und die kommunikative und kreative Kompetenz der Bevölkerung. Die zahlreichen Studien, die sich thematisch mit diesen Fragen befassen, sprechen eine sehr unterschiedliche Sprache. Einerseits stagniert die aktive Mitwirkung selbst bei so populären Angeboten wie Wikipedia und youtube bei ca. 3% der Bevölkerung. Trotz Mobilität und Multioptionalität wird das Internet auch wenig für die Nutzung klassischer Medieninhalte verwendet, persönliche und soziale Kommunikation stehen nach wie vor mit deutlichem Abstand an erster Stelle. Andererseits wird die These von der Marginalisierung der Kunst durchaus bestätigt, offensichtlich gibt es einen anhaltenden Trend zum sogenannten ‚Kulturflaneur’: Lediglich 3% der Bevölkerung besuchen mehr als 3 Klassikkonzerte im Jahr. Insofern kann man Schulzes Hypothese von der Kunst als Angebot für 'gelegentlich auftretenden Bedarf' nachvollziehen. Stellt sich die Frage aber nicht eigentlich ganz anders: Welche Kommunikationsformen sind denn der Sache angemessen? Welche Art des Umgangs verschafft uns mehr als einen oberflächlichen Eindruck, welche Nähe zum Werk kann man in welchem Nutzungskontext, mit welchen Mitteln und mit welchem persönlichen Einsatz herstellen? Zweifellos sind im Rahmen der Digitalisierung, mit Hilfe der ungeheuren Potentiale der neuen Medien neue Kunst4 formen entstanden, die vor allem durch die Betonung spielerischer Elemente frischen Wind gebracht haben; es ist anzunehmen und zu hoffen, dass sich das auch fortsetzen wird. Gehört aber zur Rezeption von Kunst – egal, ob digital oder analog - nicht eine gewisse Übung und Beharrlichkeit, die sich zumindest auch in der von Schulze mit einer gewissen Süffisanz belächelten ‚Disziplin des Schweigens und Stillsitzens’ zeigt? Oder anders herum gefragt: Ist die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts auf einem Weg, der die Rezeption von Kunst - und damit langfristig auch die Kunst selbst - fundamental verändert? Kommen wir den Werken weniger nahe als früher? Wie weit sind wir bereit, uns auf Details einzulassen? Verlieren wir auch ein Stück weit den Zugang zu dem Glück, das sich einstellt mit dem Erlebnis des Details, eine Dimension, die über die Schiene des Erlebnismarktes wohl kaum erreichbar ist? Die heikle und schwierige Frage nach der Form, die der tatsächliche Dialog mit der Kunst annimmt, hat Schulze in seiner Vision umgangen. Spr.3 ‚Mir fiel plötzlich ein, dass es auch ein Gedicht von Celan gibt, in dem von Rabbi Löw die Rede ist. Ich suchte das Gedicht heraus, las darin und fand zwei Zeilen, die nur aus Punkten bestanden: „EINEM DER VOR DER TÜR STAND, eines Abends: ihm tat ich mein Wort auf-: zum Kielkropf sah ich ihn trotten, zum halbschürigen, dem im kotigen Stiefel des Kriegsknechts geborenen Bruder, dem mit dem blutigen Gottesgemächt, dem schilpenden Menschlein Rabbi, knirschte ich, Rabbi Löw: 5 Diesem beschneide das Wort, diesem schreib das lebendige Nichts ins Gemüt Diesem Spreize die zwei Krüppelfinger zum heilbringenden Spruch, Diesem. ............. Wirf auch die Abendtür zu, Rabbi .............. Reiß die Morgentür auf, Ra- - Musik 1: Anton Webern: Bagatellen für Streichquartett op.9, Nr.3 (23“) Juilliard String Quartett Sony SM 3K 45845 ‚Die beiden langen, punktierten Zeilen erinnerten mich sofort wieder an jene Frage: Was sind die Punkte? Natürlich zählte ich sie sofort: Ich zählte sie so oft, bis ich ganz sicher war, mich nicht verzählt zu haben: Die erste Reihe enthält 13 Punkte, die zweite 14. In diesen zwei Zeilen liegt etwas Nichtausgesprochenes. Auch in der letzten Zeile wird etwas nicht ausgesprochen. Dort fehlen die drei Buchstaben „b“ „b“ „i“ des Wortes „Rabbi“. Ich zählte alle Buchstaben, Bindestriche und Doppelpunkte, addierte sie, subtrahierte dann eine bestimmte Zahl von einer anderen und vergaß bei all dem, wie die Zeit verging. Mitternacht war schon längst vorbei. Meine Besessenheit hatte nichts mit der Jagd nach Sinn zu tun. Vielmehr ähnelte sie der Leidenschaft einer Anagramm-Dichterin.’ (28“) Musik 2: Webern op.9,2 (s.o.) ‚Irgendwann wurde es draußen wieder hell. Ich öffnete „die Morgentür“ und sah auf den Zettel, auf den ich die Wörter „PRAG“, „RABBI“, „LÖW“ und „GOLEM“ geschrieben hatte. 6 Daneben standen einige mathematische Rechenversuche. Auf einmal vermischten sich in meinem Blick die Zahlen und die Buchstaben, als wären sie Ideogramme. Weil ich die Ziffern eng nebeneinander geschrieben hatte, sah die Anzahl der Punkte in der ersten Reihe, 13, als geschriebene Zahl aus wie der große Buchstabe „B“. Die zweite Punktreihe hatte 14 Punkte, also 13 plus 1. Die geschriebene Zahl „1“ ähnelte unübersehbar dem Buchstaben „I“. Die beiden Punktreihen stellten also die drei Buchstaben „B“ „B“ „I“ dar, die im letzten Wort des Gedichtes fehlten. Ich übersetzte die 13 Punkte in den Buchstaben „B“ zurück, die 14 Punkte in ein „B“ und ein „I“ und gab sie dem Wort „Rabbi“ wieder, so dass das Wort vollständig wurde.’ Yoko Tawada, Rabbi Löw und 27 Punkte Spr.1 ‚Meine Besessenheit hatte nichts mit der Jagd nach Sinn zu tun.’ In Celans Lyrik ist zweifellos auch das unscheinbarste Detail mit Sinn aufgeladen. Und Yoko Tawada liest extrem genau, begibt sich zunächst nicht auf die Suche nach Sinn, sondern nach Details, auch wenn es nur der Unterschied von 13 und 14 Punkten ist. Und dann nimmt sie sich die Freiheit, sich weite Assoziationsräume zu erschließen. Die Suche nach Sinn, das wäre die nahe liegende, schulmäßige Interpretation. Tawada aber nimmt unscheinbare Details in den Blick, im Vertrauen darauf, dass der poetische Funke von dort her überspringen wird. Von Ferne erinnert das an Goethe: ‚… und nichts zu suchen, das war mein Sinn.’ Buchstaben, Zahlen, Satzzeichen: Zweifellos sind das Elemente der Schrift. Würde man sie auch Details nennen? Und in der Musik: Pausen, Artikulationszeichen, dynamische Angaben? Sind sie in gleichem Sinn Elemente der Schrift wie des Klangs? Spr.3 ‚Manche glauben, die Länge eines Wortes an der Anzahl der Buchstaben messen zu können. Das „Leben“ ist fünf Buchstaben lang, während die „Krankenversicherung“ neunzehn Buchstaben lang ist. Dabei hat ein geschriebenes Wort nicht die gleiche Länge wie ein gesprochenes. „Sch“ von „schreiben“ sind drei Buchstaben aber nur ein Zischen im Mund und dieses Zischen dauert nicht länger als beim „s“ von „studieren“. Dennoch kommt einem die Zeit für das Studium kürzer vor als die zum Schreiben. Wie kann man das Studium genau so lang machen wie die Schreibzeit? Es nützt nicht, länger zu studieren. Du versuchst, das Studium zu verlängern, indem du das Wort „studieren“ mit „sch“ schreibst. Durch das Studium gewinnt 7 man die Fähigkeit, etwas falsch zu machen. Alles, was neu ist, erscheint zuerst falsch. Und die Freunde lachen dich aus, ohne zu merken, dass sie dadurch zu Sprachpolizisten werden.’ Yoko Tawada, Sprachpolizei und Spielpolyglotte Spr.1 Redet Yoko Tawada von Details, wenn es um Buchstaben und ihre Anzahl geht? In der Musik stellt sich die Frage ähnlich, z.B. wenn es um geschriebene Töne geht. Ähnlich wie die Buchstaben sind diese zählbar, und ähnlich wie Buchstaben können sie zu Klängen verschmelzen, in denen der einzelne Ton nicht mehr auszumachen ist. Es sei denn, er fällt deutlich als ein falscher auf. Durch die Abweichung von der Erwartung kommt eine Beziehung ins Spiel, ein Element wird auf ein schon vorhandenes Bild bezogen. Es ist hier also eine Differenz, die das Element erkennbar macht, man könnte auch sagen, dass man es erst durch die Abweichung von der Erwartung als Teil eines größeren Zusammenhangs erlebt. Das Falsche und das Neue liegen für Yoko Tawada eng beisammen, sie öffnen ihr die Tür zur Wahrnehmung von Details, die dem quasi routinierten Leser und Sprecher verschlossen bleiben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich hier um Wortbedeutung, Grammatik, Sprachklang oder Ähnliches handelt. Spr. 3 ‚Vieles bei der Sprache ist geheimnisvoll. Man kann alles in Frage stellen, aber keiner zweifelt daran, dass ein Elefant ein Substantiv ist. Das ist ein Rätsel mit einem langen Rüssel. Es gibt viele Adjektive, die auf „ant“ enden, wie z.B. signifikant, redundant, elegant oder arrogant. Dennoch weiß man, dass ein Elefant niemals ein Adjektiv sein kann.’ Yoko Tawada, Sprachpolizei und Spielpolyglotte Musik 3: Joseph Haydn: Klaviersonate Nr.56, D-Dur, 2.Satz: Allegro Vivace (2’13“) Glenn Gould CBS M2K 36947 Spr.1 Französisch ‚la taille’: Die Ausdehnung, die Größe, der Umfang, der Schnitt, das Behauen… Ein Wort mit vielen Bedeutungen, abgeleitet ursprünglich von dem lateinischen ‚taliare – spalten’ bzw. ‚talea – das abgeschnittene Stück’. Dagegen ist die Vorsilbe ‚dé’ sehr klar über8 setzbar: auseinander, oder herab. Im Wort ‚Detail’ steckt also schon der Gedanke einer Beziehung eines kleineren Teils zu einem größeren Ganzen. Es gibt also nicht das Detail, sondern immer nur ein Detail von etwas, genauso wenig, wie es das Neue oder Falsche ohne einen Kontext gibt. Sind diese Kontexte immer klar abgegrenzt und real, wie bei einem Bild, einer Skulptur oder einem Musikstück, oder können es auch unabgeschlossene Systeme wie die Sprache oder ein Idiom sein? Neue und falsche Sätze oder Ausdrücke kann man nur als Abweichung von Regeln oder von einem Konsens bzw. gemeinsamer Erfahrung bilden. Wie kommt man in der Musik zu einer Vorstellung vom Ganzen, oder zu einer Erwartung, die man durch Fehler und Neues enttäuschen könnte? Nur, wenn man das ganze Stück kennt? Wenn man in einem Stil zu Hause ist? Auf welche Erfahrung muss man zurückgreifen können? Es gibt Musik, die sehr reich ist an Details, aber auch solche, die das Kontinuierliche und Flächige so stark betont, dass kaum einmal eine Einzelheit heraustritt. Und es gibt solche, die sich in einem Sinn additiv-linear entfaltet, dass ein Bild nur peu à peu entsteht, durch Aneinanderreihung von Elementen. Wo ist dann der Übergang von der Einzelheit zum Gesamtbild; und wenn dies einmal vor dem inneren Ohr des Hörers entstanden ist, nimmt man das, was man vorher als Detail erlebt hat, auch später noch als solches wahr? Gibt es dann noch so etwas wie die viel beschworenen und viel gescholtenen ‚schönen Stellen’? Musik 4: Steve Reich: Music for Pieces of Wood (Ausschnitt) Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Schlagzeuger SWR-Eigenproduktion Es liegt nahe, dass Adorno das Verhältnis des Details zum Ganzen als ein dialektisches sieht. Umso mehr erstaunt es, wie sehr er sich für das Detail engagiert, wie wichtig ihm die Einzelheit für ein wirklich berührendes Kunsterlebnis ist. Das mag mit seiner skeptischen Sicht auf den musikalischen Serialismus der Nachkriegszeit zusammenhängen, der die Determination durch eine Grundstruktur auf allen Ebenen, bis hin zur winzigsten Kleinigkeit propagierte. Spr.2 ‚Kunst kann vom Angerührtwerden, dem Augenblick der Bezauberung als dem Element der Elevation nicht radikal getrennt werden: sonst verlöre sie sich ins Gleichgültige. Jenes Moment, wie sehr auch Funktion des Ganzen, ist aber wesentlich partikular: das Ganze bietet der 9 ästhetischen Erfahrung nie in jener Unmittelbarkeit sich dar, ohne die solche Erfahrung überhaupt nicht sich konstituiert.’ Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie Spr.1 Adorno bricht eine Lanze für die ‚schönen Stellen’, nicht unbedingt, und nicht ohne das Gleichgewicht durch das Verhältnis zum Ganzen aus den Augen zu verlieren. Aber einzig das Moment der Selbständigkeit der Details hebt für ihn Kunstwerke ab vom Schematischen, das für ihn das Gegenbild zur Kunst darstellt: Wer mit den Ohren nach schönen Stellen jagt, ist ein Dilettant; wer sie aber gar nicht erst wahrzunehmen vermag, ist taub. Als Philosoph, der nicht nur über Kunst redet, sondern sie auch sehr genau im Detail kennt, setzt Adorno hier aber auch Dinge stillschweigend voraus: Was versetzt jemanden in die Lage, passend und unpassend, originell und klischeehaft zu unterscheiden? Um welche Qualitäten geht es bei den ‚schönen Stellen’, wann, warum, für wen heben sie sich wohltuend heraus? Details können übersehen werden; das hängt nicht nur von der Erfahrung sondern auch von der momentanen Verfassung eines Hörers ab. Ist das Verhältnis von Kontext und Detail wirklich immer so eindeutig zu erkennen, die Grenze zwischen sinnvoll und überflüssig immer so klar? Mit der Verfassung ändert sich die Toleranzbreite, mit der Erfahrung Stilbewusstsein und Geschmack; diese Veränderungen verlaufen wohl kaum einsinnig-linear. Spr. 2 ‚Zum Ende möchte ich noch anmerken, was Lehmann gewiß vertraut ist, aber von ihm nicht eigentlich ausgesprochen ward: daß, bei allem Widerwillen gegen poetisierende Wörter, der bloße Gebrauch solcher Wörter allein noch nicht notwendig das Gedicht degradiert. So wie in der Musik nie der einzelne Ton banal ist, sondern immer erst die Konstellation, so macht auch in der Dichtung gerade nicht der Ton die Musik, sondern die Melodie, obwohl ich zugestehen würde, daß die Idiosynkrasie gegen poetisierende Wörter der jüngeren Vergangenheit durchaus etwas von der Gewalt eines Tabuverbotes hat. Aber während die Nachtigall gewiß zum abscheulichen Requisit entwürdigt ward, bleibt das Wort eben dessen fähig, was Lehmann so schön Rettung nennt, wofern es wirklich so nahe angeschaut wird, bis es, nach der unvergänglichen Prägung von Karl Kraus, fremd zurückblickt.’ Theodor W. Adorno, Noten zur Literatur 10 Spr.1 Und wie macht man das in der Musik? Blickt da auch etwas fremd zurück, wenn man es nur lange genug anschaut? Gibt es hier auch diesen virtuos-verfremdenden Zugriff, wie ihn Yoko Tawada beim Umgang mit der Sprache demonstriert? Manchmal schaut gar nichts zurück; brauchen wir dann überhaupt die Rettung vor dem abscheulichen Requisit? Mit Recht verweist Adorno darauf, dass die Melodie und nicht der Ton die Musik macht. Wird dadurch das Problem der ‚schönen Stellen’ nicht in erster Linie eines der richtigen Balance? Spr.3 ‚Gleichgewicht Vorbekundung Man möchte meinen, es waltet hinter allem und zu jeder Zeit eine vorzeitig bestellte Harmonie, ein Gleichgewicht, ein ihr vorbestimmter Raum. Es mag wohl so scheinen, als sei alles zusammengebrochen, zerstreut in winzige Partikel, die sich nicht wieder zusammenfügen lassen und sich gegenseitig befeinden. Es scheint wohl auch, daß wir heutzutage gezwungen sind, in den Beschränkungen einer unnatürlichen, dumm ausgedachten, wilden, positiven, disjunktiven Synthese zu existieren und dabei die Zähne zusammenzubeißen. Doch nein, wenn man genauer hinschaut, dann werden all diese Teilchen nur im notwendigen fröhlichen Abstand voneinander gehalten (manchmal freilich in furchterregender und manchmal auch in zwangsläufig zur gegenseitigen Vernichtung führender Nähe), sie werden von ebendieser Harmonie, die gewöhnlich tastende Hände an gewöhnlichen Orten niemals zu fassen bekommen, in ihren Fingern gehalten. Schauen muß man, einfach und ehrlich schauen, und nicht automatisch bauen auf einen ein für alle Mal auferlegten, gleichsam angeworfenen und zur juvenilen Begeisterung mancher Personen sich sozusagen selbst zerstörenden Prozeß. Parallel zu dieser Sache läuft irgendeine andere – und alles ist im Gleichgewicht. Auf einer Bahnstation, sagen wir Werbilki, steigt eine betagte Frau in einem langen, aus der Form geratenen Mantel, mit Filzstiefeln und Kopftuch, einen Beutel in der Hand, in den Zug Richtung Moskau, zur gleichen Zeit steigt jedoch eine ebensolche Betagte mit ebensolchen Filzstiefeln, mit Mantel und Beutel in Moskau in den Zug Richtung Werbilki – und alles ist im Gleichgewicht. 11 Da gehen Unmassen von Menschen und Tieren zugrunde, da ist Hunger und Seuche und Verderben, doch als Antwort wird ein Prophet geboren und eine grandiose Kunde von Erlösung – und alles ist im Gleichgewicht. Oder etwas ganz anderes. Da spricht man in Paris kluge und starke Worte, doch dafür ist in Saransk der Frühling vor der Zeit da und die Kartoffeln werden zwei Wochen früher als gewöhnlich gepflanzt – und alles ist im Gleichgewicht. Oder es fliegt ein Engel vorbei im Bezirk von Sachara, doch als Antwort geschehen tiefgreifende Veränderungen in der Struktur der Sprachentstehung bei den kleinsten mit Schuppen bedeckten Wesen – und alles ist im Gleichgewicht.’ Dmitri Alexandrowitsch Prigow, Berechnungen und Bestimmungen. Stratifikations- und Konvertierungstexte Musik 5: György Ligeti: Ramifications for string orchestra (Ausschnitt) Stuttgarter Kammerorchester Leitung: Dennis Russell Davies LC 07989 Col legno Spr.1 ‚Einfach und ehrlich anschauen’: ein Problem für die flüchtigste aller Künste. Kaum, dass etwas erklungen, erkannt ist, steht es der Anschauung nicht mehr zur Verfügung; das ist der entscheidende Unterschied z.B. zur Malerei und zur Skulptur. Es ist der Erinnerung überantwortet, und auch nur diese kann den Moment einordnen und beziehen auf andere Momente im Stück, auf andere Musik, andere Stile und Genres. Aber es gibt auch noch diejenigen, die mit der Musik arbeiten: Die Komponisten, die sie schriftlich formulieren, die Spieler und Interpreten, die Herausgeber, die Arrangeure und die, die die Musik übersetzen, sie uminstrumentieren für andere Formationen. Haben sie alle als Leser von Musik ein anderes Verhältnis zum Detail als diejenigen, die sie nur hören? Oder profitieren sie nur von dem, was die Psychologie den IKEA-Effekt nennt: the more labor you put into it, the more you value it - je mehr Arbeit du hineinsteckst, desto mehr schätzt du es? Interpreten entwickeln durch ihre Beschäftigung einen sehr persönlichen Blick auf die Musik, im Allgemeinen und auf jedes Stück im Besonderen; als Spieler rücken sie Details in ein be12 stimmtes Licht, kommen um die Frage nach deren Bedeutung gar nicht herum, wenn sie ihre Aufgabe ernst nehmen. Was man eigentlich als eine Frage der Professionalität betrachten sollte, sieht das größte deutsche Musiklexikon, das auf dem Markt zu haben ist, als Aspekt der Lebensentwicklung. Spr.2 ‚Typen, schwer in psychologische Systeme einzuordnen, sind deutlich erkennbar. Flüssige Tempi übertreibt gern die begabte Jugend (Weber, Mendelssohn, Wagner in Dresden, Weingartner); liebevoll ausgespielte Details sind ein Kennzeichen der Altersreife, verschleppte Tempi deuten fast immer auf mangelnde Musikalität.’ Dirigieren. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, S. 17570 Spr. 1 Immerhin scheint es einen gewissen Konsens zu geben, dass die Beschäftigung mit Detailfragen immer auch etwas mit Arbeit und Handwerk zu tun hat, dass man sich diese Ebene der Musik nur erschließen kann mit einem entsprechenden Einsatz und auch mit einer gewissen Gründlichkeit. Wird Detailbewusstsein damit zu einer Art deutscher Tugend? Spr.2 ‚Wo diese Gefühlsspannung nachläßt und das Gesamterleben karg und nüchtern wird, wird auch der eigentlich produktive Prozeß erlahmen, werden nur die mehr ordnenden, sozusagen administrativen Leistungen, die bei allem Gestalten unentbehrlich bleiben, fortgeführt werden können, etwa das Bessern und Bosseln am technischen Detail (beim Komponieren z. B. vielfach auch das Instrumentieren) oder, bestenfalls, die ruhig abwägende Planung des Formgerüsts.’ Ausdruck. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, S. 4014-15 Spr.1 Unangemessen wäre es zu behaupten, dass sich diese Arbeit immer und ausschließlich an den Umgang mit der Schrift bindet; es gibt Stile und Musikkulturen, die äußerst detailbewusst sind, und die ausschließlich auf Improvisation und mündlicher Überlieferung beruhen. Ist auch deren Genauigkeit auf Planung und Gründlichkeit zurückzuführen? 13 Musik 6: trad.: Raga Bairagi Bhairavi (Pakistanische Musik) (Ausschnitt) Ustad Nazim Ali Khan, Sarangi Ershad Hussain, Tabla Ustad Bary Fateh Ali Khan, Vocals and Harmonium Mustaq Ali, Tanpura Ghulam Sabir, Tanpura Sultan Fateh Ali, Svarmandal CD: The Music of Islam, Volume 13 Celestail Harmonies 13153-2 Spr.3 ‚Warum übersetzt Pasolini 1942 das kurze in italienischer Sprache geschrieben Gedicht „Acque di Casarsa“? – Vielleicht, um den Titel zu verändern. Aus „Acque di Casarsa“ wird im übersetzten Gedicht „Dedica“. Die Veränderung ist groß, eine vollkommene Veränderung. Liest man genau, so bleibt in dieser vollkommenen Veränderung etwas gleich, nämlich die Silben ‚di’ und ‚ca’. ‚Acque di Casarsa’, ‚Acque di Ca’ wird zu ‚De di Ca’: Anders gesagt: ‚di Ca’ wird zu ‚dica’. ‚Dica’, so wie es enthalten ist in ‚Dedica’, meint soviel wie sagen. Die Übersetzung, die der junge Pasolini hier versucht hat, von ihm selbst wohl unbemerkt, ist eine Übersetzung ins Sagen. Von ‚di Casarsa’ zu ‚dedicare’. Von den Feuerhäusern und der Asche zum Sagen, Sprechen. Das Wort ‚acqua’ in der ersten Zeile des Gedichts kehrt in der Dialektübersetzung wieder, verändert. Aus ‚acqua’ ist ‚aga’ geworden. Was hat sich verändert? Anders ist, daß dieses ‚aga’ fast nur aus ‚a’ besteht – um es auszusprechen, braucht man den Mund und die Lippen nicht zu schließen: aga. Um ‚acqua’ zu sagen, muß man den Mund kurz verschließen und ein Art von ‚u’, einen Anflug von ‚u’ in der Aussprache zulassen: acqua. ‚Aga’ hingegen ist fast reines ‚a’, rhythmisiert und angeschoben vom ‚g’. „Fontana di aga dal me pais.“ Der ganze Vers spricht in a-Lauten. Was ist dieses ‘a’? Pasolini berichtet in seinem zwischen Juni 1946 und Dezember 1947 geschriebene ‚roten Heft’ über die Zeit, in der die ersten friulanischen Gedichte entstanden:“ Ich erinnere mich an die ersten Februartage des Jahres 1943… ich machte mich daran, mein Casarsa wiederzuentdecken, in das nach den Farben des Winters das Grün zurückgekehrt war. Ich hegte in mir eine Unzahl zärtlicher Absichten, Gedanken an Freundschaften und an Alleinsein… ich entdeckte von neuem die vertrauten abendlichen Gerüche von Rauch, von Polenta und kalter 14 Luft, den Tonfall der Sprache, ihre offenen vokale, ihre Zischlaute, die an den geheimen, nicht in Worte fassbaren Sinn rührten, der sich in jener Welt verbarg.“ Peter Waterhouse, a - Versuch über Pier Paolo Pasolini Spr.1 Hier berührt sich Peter Waterhouses fanatisch genaue Art des Lesens mit den Emotionen und Assoziationen Pasolinis, dem Geheimnis, den Farben und Gerüchen, der Zärtlichkeit, dem Tonfall der Sprache. Man ist versucht anzunehmen, dass es diese Emotionen ohne die Genauigkeit - sei es die sprachliche, sei es die er Empfindung - nicht gäbe. Es gibt wohl kaum Lesarten, die soviel Liebe zum Detail brauchen wie das Übersetzen. Auch die kleinste Einzelheit, sei sie grammatischer, rhythmischer, klanglicher, stilistischer oder welcher Art auch immer, ist von Bedeutung. Ohne eine leidenschaftliche Versenkung in Details gibt es keine gute Übersetzung. Und es ist äußert aufschlussreich, z.B. von einem Gedicht mehrere Übersetzungen zu lesen: Die quasi unendlichen Möglichkeiten, wie einzelne Aspekte sich zu sinnvollen Konstellationen fügen können, vermitteln ein eindrückliches Bild von der Offenheit und Unabgeschlossenheit jedes kunstvollen Textes. Kann man Musik übersetzen? Ist Interpretation von Musik etwas Vergleichbares, Übersetzung von Schrift in Klang? Auch für das Instrumentieren muss man nicht nur sein Handwerk beherrschen, die Instrumente und ihre Möglichkeiten genau kennen, ein Gespür für die Bandbreite ihrer Farben und ihre assoziativen Dimensionen haben. Auch hier gelingt eine Übertragung nur, wenn man genau liest, jedes Detail mit Leben füllt. Als französischsprachiger Komponist zieht Michael Jarrell den Begriff des Orchestrierens dem des Instrumentierens vor. Das betont die Vorstellung vom orchestralen Klangkörper als einer individuellen und charakteristischen Ganzheit, nimmt den Blick weg vom einzelnen Instrument. Auch hier ist also eine Balance zu schaffen zwischen Details und Gesamtbild, es reicht nicht, die Noten des Klaviertextes sozusagen 1:1 - Detail zu Detail - auf andere, einzelne Instrumente zu übertragen. Musik 7: Claude Debussy: Klavier-Etude ‚Pour les sonorités opposées’ a: Claude Debussy, Klavier-Etüde ‘Pour les sonorités opposées’ Samson François 06646 EMI CLASSICS 1258262 15 (insges. ca. 2’) b: Claude Debussy/Michael Jarrell, Trois Etudes de Debussy (‘Pour les sonorités opposées’). Orchestre de la Suisse Romande Leitung: Pascal Rophé In: Michael Jarrell ‘…prisme/incidences…’ AEON, AECD 0752 Spr.1 Die Bedeutungsverschiebung von ‚Instrumentieren’ zu ‚Orchestrieren’ lenkt den Blick auf eine produktive Umkehrung der Thematik: Es ist nicht nur die Frage, wie sich Details vom Gesamtbild abheben, sondern mindestens genauso, inwieweit das Gesamtbild über ein Zusammenspiel von Details hinausgeht. Ein anderes Beispiel für die Übersetzung von Musik ist die Choreographie. Es ist, abgesehen vom Grundrhythmus der Musik, kaum möglich, eine direkte Beziehung von musikalischen zu tänzerischen Details herzustellen, körperliche und musikalische Bewegung sind als Ausdrucksmomente sehr weit entfernt voneinander. Und doch hat man ein sicheres Gefühl für die Angemessenheit der tänzerischen Bewegung und die Stimmigkeit des choreographischen Bildes. In Musik und Dichtung ist eine ähnliche Frage die nach dem Tonfall. Kann man diesen schon durch ein gelungenes Zusammenspiel von Einzelheiten erklären? Auch das Gespür für den richtigen Tonfall ist ja eher eine intuitive Größe, sowohl von seiner Entstehung als von der Rezeption her. Nur in ganz bestimmten Konstellationen entfaltet das Zusammenspiel von Details den Glanz eines charakteristischen Tonfalls, das Gelingen ist sehr an den Instinkt von Komponist und Autor bzw. Hörer und Leser gebunden. Diese Art von Instinkt und Sensibilität braucht vor allem Erfahrung, und das heißt in erster Linie: Vergleich. Spr.3 ‚Lockung Hörst du nicht die Bäume rauschen Draußen durch die stille Rund’? Lockt’s dich nicht hinabzulauschen Von dem Söller in den Grund, Wo die vielen Bäche gehen Wunderbar im Mondenschein Und die stillen Schlösser sehen 16 In den Fluß vom hohen Stein. Kennst du noch die irren Lieder Aus der alten schönen Zeit? Sie erwachen alle wieder Nachts in Waldeseinsamkeit, Wenn die Bäume träumend lauschen Und der Flieder duftet schwül Und im Fluß die Nixen rauschen – Komm herab, hier ist’s so kühl.’ Spr.1 Schon der Titel ‚Lockung’ kommt in Eichendorffs Gedicht dunkel daher. Die Stimmung ist still und düster. Der trochäische Vers signalisiert Abwärtsbewegung, und abwärts ist die Grundbewegung des ganzen Gedichts. Von Beginn an ist zu ahnen, dass Lockung hier auch Todessehnsucht bedeutet und wenig überraschend kommt am Schluss die Aufforderung, sich in den kühlen Fluss zu begeben. ‚Komm herab’ heißt es: die Stimme der Lockung entfaltet ihre hypnotische Wirkung von der Tiefe her. Ganz anders bei Brentano. Das Szenario ist fast identisch; ganz ähnlich eröffnet auch er sein Gedicht mit der Frage nach dem Hören. Diese ist aber nicht rhetorisch wie bei Eichendorff, da durch Kommasetzungen und Interpunktion Raum geschaffen wird zum Nachdenken. Trotz der trochäischen Verse herrscht eine Aufwärtsbewegung vor: der Ton ist beschwörend, der Klang der Sprache sirenenhaft hell, geradezu euphorisch. Der Traum steht hier nicht für Todessehnsucht, sondern für Lebensenergie. Bei Eichendorff raunt das Unheil, Brentano stammelt vor Glück. Spr.3 ‚Hörst du, wie die Brunnen rauschen? Hörst du, wie die Grille zirpt? Stille, stille, laß uns lauschen, selig, wer in Träumen stirbt; selig, wen die Wolken wiegen, Wem der Mond ein Schlaflied singt; O! wie selig kann der fliegen, 17 Dem der Traum die Flügel schwingt, Daß an blauer Himmelsdecke Sterne er wie Blumen pflückt: Schlafe, träume, flieg, ich wecke Bald dich auf und bin beglückt.’ Spr.1 Wie fasst man den Unterschied im Tonfall der beiden Gedichte, wenn nicht durch das geduldige Aufdecken der Details und ihr komplexes Zusammenspiel? Warum bleibt dann aber oftmals gerade durch die Nennung der Details das unangenehme Gefühl, an der Sache vorbei zu reden? Musik 8: Morton Feldman: Coptic Light (Anfang) Radio-Sinfonieorchester des SWR Leitung: Rupert Huber In: Rückblick Moderne, Orchestermusik im 20. Jahrhundert. Darin CD 1 LC 07989 Col legno 18