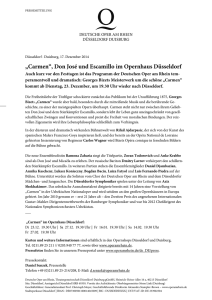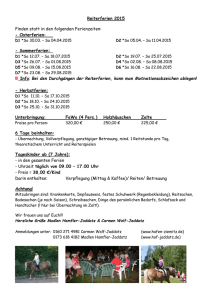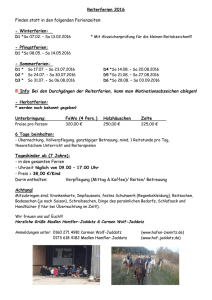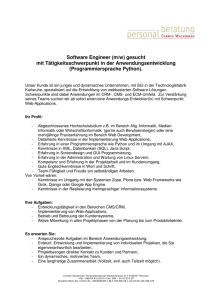PDF - Alle Noten
Werbung

W o l f ga n g F u h r m a n n Bizet Carmen Weitere Bände der Reihe O P E R N F Ü H R E R K O M P A K T : Daniel Brandenburg Verdi Rigoletto Detlef Giese Verdi Aida Michael Horst Puccini Tosca Michael Horst Puccini Turandot Wolfgang Jansen und Gregor Herzfeld Bernstein West Side Story Malte Krasting Mozart Così fan tutte Silke Leopold Verdi La Traviata Robert Maschka Beethoven Fidelio Robert Maschka Mozart Die Zauberflöte Robert Maschka Wagner Tristan und Isolde Volker Mertens Wagner Der Ring des Nibelungen Volker Mertens Wagner Parsifal Clemens Prokop Mozart Don Giovanni Olaf Matthias Roth Donizetti Lucia di Lammermoor Olaf Matthias Roth Puccini La Bohème Marianne Zelger-Vogt und Heinz Kern Strauss Der Rosenkavalier Wolfgang Fuhrmann unterrichtet Musikwissenschaft an der Universität Wien. Seine Forschung gilt dem Mittelalter und der Renaissance ebenso wie der bürgerlichen Musikkultur des 18. und 19. Jahrhunderts. Zuletzt veröffentlichte er gemeinsam mit Melanie Wald Ahnung und Erinnerung. Die Dramaturgie der Leitmotive bei Richard Wagner. OPERNFÜHRER KOMPAKT W o l f ga n g F u h r m a n n Bizet Carmen Für Leser, die es genau wissen wollen: Alle Zitatnachweise und wissen­schaftlichen Anmerkungen zu diesem Text finden Sie als pdf unter: https://www.baerenreiter.com/extras/BVK2209. Auch als eBook erhältlich: epub: ISBN 978-3-7618-7075-4 epdf: ISBN 978-3-7618-7074-7 Das eBook enthält alle Nachweise und Anmerkungen. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. © 2016 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel Gemeinschaftsausgabe der Verlage Bärenreiter, Kassel, und Seemann Henschel GmbH & Co. KG, Leipzig Umschlaggestaltung: Carmen Klaucke unter Verwendung eines Fotos der Tänzerin Tamara Rojo (© Nigel Norrington / ArenaPAL) Lektorat: Jutta Schmoll-Barthel Innengestaltung: Dorothea Willerding Satz: EDV + Grafik, Christina Eiling, Kaufungen Korrektur: Daniel Lettgen, Köln Notensatz: Tatjana Waßmann, Winnigstedt Druck und Bindung: BELTZ Bad Langensalza GmbH, Bad Langensalza ISBN 978-3-7618-2209-8 (Bärenreiter) ISBN 978-3-89487-923-5 (Henschel) www.baerenreiter.com www.henschel-verlag.de Inhalt Einleitung: Mythos Carmen 7 Bizets Leben und Werk im Spiegel der Zeit 13 Entstehung und Sujet Die Handlung 37 Die Figurenkonstellation 41 25 Die musikalische und dramaturgische Gestaltung 43 Sprechen, Singen, Tanzen 43 Spanienmode und Exotismus 47 Erotik, Fatalismus, Tod 50 Realismus, Verismo und Lakonie 51 Streifzug durch die Partitur 54 Mutmaßungen über Carmen 110 »Carmen« auf der Bühne und im Film 112 Rezeption der Uraufführung und internationale ­Verbreitung 112 Die populärste Oper der Welt ? 119 »Carmen«: eine Interpretations­ geschichte 120 Carmen im Film 127 Anhang132 Literatur 132 Ausgewählte Discografie und Videografie 134 Abbil­dungsnachweis 135 Dank 135 Einleitung: Mythos Carmen Carmen ist eine verhängnisvoll-verführerische »Zigeunerin« und Schmugglerin im Andalusien des frühen 19. Jahrhunderts. Nein! Carmen ist eine abenteuerlustige afroamerikanische Angestellte einer Fallschirmfabrik während des Zweiten Weltkriegs. Nein: Carmen ist eine aufstrebende Tänzerin in einem Flamenco-Theater zwischen Realität und Illusion. Nein; Carmen ist eine selbstbewusste Arbeiterin in einer südafrikanischen Township nach dem Ende der Apartheid … Die Liste ließe sich fortsetzen. Carmen, die Protagonistin der Novelle von Prosper Mérimée und der Oper von Georges Bizet, hat im 20. Jahrhundert vielfältige Resonanz gefunden – in der Musicaladaption Carmen Jones (1943, verfilmt 1954) ebenso wie im Mittelteil von Carlos Sauras Flamenco-Filmtrilogie (Carmen, 1983) und in der nach Südafrika transponierten U-Carmen e-Khayelitsha (Carmen in Khayelitsha, Regie: Mark Dornford-May, 2004). Aber damit nicht genug: Carmen hat den großen Theatermacher Peter Brook zu seiner radikal konzentrierten Version La Tragédie de Carmen angeregt und Beyoncé Knowles zu ihrer für MTV produzierten Carmen: A Hip Hopera. Auch jenseits von Musiktheater (und Ballett) ist Carmen in Stumm- und Tonfilm präsent und wurde in den unterschiedlichsten Versionen von Pola Negri, Rita Hayworth, Maruschka Detmers und Paz Vega verkörpert. Nicht zuletzt ist sie eine der wenigen fiktiven Figuren, denen ein reales Denkmal errichtet wurde: In Stein gehauen steht sie in Sevilla vor La Maestranza, der berühmten Stierkampfarena, dort, wo sie, zumindest gemäß der Opern-Version, von Don José, ihrem ehemaligen Liebhaber, ermordet worden ist. Insofern zählt Georges Bizets 1875 uraufgeführte Oper nicht nur – neben Giuseppe Verdis La traviata und Wolfgang Amadé Mozarts Die Zauberflöte – zu den beliebtesten Opern der Welt, sondern bildet auch die Grundlage eines modernen Mythos. Zumindest scheint es, als ob auf die Gestalt der Carmen das zuträfe, was nach dem griechischen Philosophen Saloustios das Wesen des Mythos ausmacht: »Mythos ist, was niemals war 7 und immer ist.« Blickt man auf andere Mythen der europäischen Kulturgeschichte der Neuzeit – Don Quixote, Don Juan, Faust –, so ist dieser der weitaus jüngste. Aber in Carmen und ihrer verhängnisvollen Affäre mit Don José spiegelt sich mehr als nur eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, und so wichtig der historische Kontext auch ist, so kann er hier wie auch sonst nicht die dauerhafte Lebendigkeit eines Werks erklären. Auch wenn die Gestalt der Carmen in Prosper Mérimées gleichnamiger Novelle bereits 1845 Gestalt annahm, ist es in erster Linie Bizets Musik, die diesen Mythos begründete – ohne seine Carmen-Version, die 1875 an der Opéra-Comique in Paris ihre Uraufführung erlebte, wäre die von Mérimée (teilweise nach einem realen Vorbild) erschaffene Figur niemals so bekannt geworden. Die scheinbar unproblematische Popularität von Bizets Melodien sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass seine Version dieses Mythos immer noch die gültige und wohl auch (neben Mérimées Novelle) die künstlerisch bedeutendste ist. Bizets Carmen ist kein Wunschkonzert in Kostümen, sondern ein Musikdrama, in dem jede Note die Handlung vorantreibt. Aber es ist eben auch diese Handlung, die die Faszination des Sujets ausmacht. Was das Publikum der Opéra-Comique bei der Uraufführung 1875 so schockierte und Carmen zunächst zu einem Misserfolg machte, das war die Erhebung von Deklassierten und Minderprivilegierten zu Hauptfiguren einer Geschichte: Eine Arbeiterin in einer Tabakfabrik und ein desertierter Soldat, das waren schon an sich Protagonisten unterhalb jenes Milieus, das das vorwiegend kleinbürgerliche Comique-Publikum auf der Bühne dargestellt finden wollte (vgl. S. 28 f.). Don José, dem sich in Micaëla und der durch sie repräsentierten bürgerlichen »Mutterkultur« ein Ausweg zu öffnen scheint, wählt stattdessen sein Verderben. Heillos in seinen Amour fou verstrickt, richtet er sich sozial zugrunde und ersticht Carmen schließlich auf offener Bühne. Nicht minder schockierend als dieser allen Konventionen der Opéra-Comique widersprechende blutige Schluss war die Titelfigur: eine »Zigeunerin« (siehe Kasten S. 10) mitsamt allen damit verbundenen Klischees, die auch noch als Schmugglerin arbeitet und ihre Liebhaber auf Zeit selbst aussucht. Damit kommen wir zu dem zweiten großen Skandalon der Oper: der offenen Darstellung von Verführung, sexuellem Begehren und einer Vorstellung von Liebe, die weder auf Dauer gründet noch auf Sympathie und echter Zuneigung: »die Liebe, die in ihren Mitteln der Krieg, in ihrem Grund der Todhass der Geschlechter ist«, wie Friedrich Nietzsche über Carmen schrieb. Wie beides zusammengehört – das Unterschichtenmilieu und die Entzauberung der Liebe zum Begehren ohne Zuneigung –, das hat am 8 klarsten der eigentlich musikferne Sigmund Freud ausgesprochen, der Carmen als einzige Oper außer jenen von Mozart zu hören pflegte. 1883 schrieb Freud an seine Verlobte Martha Bernays über die Gedanken, die ihm – der während seiner vierjährigen Es ist klar, wer hier die Oberhand hat: Verlobungszeit sexuell abstinent lebte – Elı̄na Garanča (Carmen) und Jonas Kaufmann (Don José) in der Münch­ während einer Vorstellung von Carmen ner Inszenierung von Lina Wertmüller durch den Kopf gegangen waren: »Das Ge(2010). sindel lebt sich aus und wir entbehren …« 9 »Zigeuner« Der Begriff »Zigeuner« ist keine Selbstbezeichnung für jene ethnischen Gruppen, die sich selbst vielmehr Roma, Sinti und anders nennen. Die Herkunft des Begriffs ist unbekannt; wie vergleichbare Bezeichnungen aus anderen europäischen Sprachen (»gitanos«, »gypsies«, »bohémiens«) benennt er eine Ethnie und ist zugleich in negativer, herabwürdigender Absicht zum Synonym für eine unstete, ortlos schweifende und durch Dieb­ stahl und andere Verbrechen gekennzeichnete Lebensführung geworden. Seit dem 19. Jahrhundert tritt dieser negativen rassistischen eine positive, aber verklärende Bewertung, die »Zigeunerromantik«, zur Seite, die die so Bezeichneten als Verkörperung eines romantischen Freiheitsideals, einer ungehemmten Lebens- und Liebenslust und vor allem auch einer urtüm­ lichen Musikalität betrachtet. Das alles sind Klischees, die in der Oper und der Operette immer wieder fröhliche Urständ feiern. Diese Verklärung hinderte die Nationalsozialisten nicht daran, die »Zigeuner« in § 6 der Ersten Verordnung zum »Blutschutzgesetz« von 1935 neben »Juden« und »Negern« als »rassegefährdend« zu betrachten. Wäh­ rend des Zweiten Weltkriegs starben allein etwa 21 000 Sinti und Roma im »Zigeunerlager Auschwitz«, dem Abschnitt B II e des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Dass nicht jeder aus der Geschichte gelernt hat, zei­ gen die antiziganistischen Reden des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy 2010, denen eine Räumung von rund 50 illegalen Roma-Lagern und die Ausweisung ihrer Bewohner aus Frankreich folgte, die vom restlichen Europa ohne größeren Widerstand zur Kenntnis genommen wurde. In Mérimées Erzählung Carmen ist von »bohémiens« und daneben mit korrekten Eigenbezeichnungen von »rom(a)« und »calé« (die »Schwar­ zen«) die Rede; in Bizets Oper werden die Ausdrücke »bohémiens« und »zingara« gebraucht. Die Bezeichnung »Zigeuner« wird in diesem Buch aber aus folgenden Gründen beibehalten: Erstens ginge eine scheinbar »politisch korrekte« Übersetzung mit »Roma« oder »Calé« in Wahrheit an der Sache vorbei, denn das Klischeebild der Zigeuner im 19. Jahrhundert, wie es sich in Carmen zeigt, beruht ja auf einer kulturellen Konstruktion, die die Lebenswirklichkeit verzerrte. Zweitens würde damit auch die his­ torische Realität verfälscht, in der Wort und Begriff zusammengehörten. Gewiss besteht zwischen Mérimées Novelle, Bizets Oper und den Verbre­ chen der Nationalsozialisten kein direkter Zusammenhang. Aber Novelle und Oper partizipieren an den erwähnten rassistischen Diskursen und kul­ turellen Klischees, die im 20. und noch im 21. Jahrhundert so bestürzende Folgen haben sollten. 10 Ungewohnt unterwürfig und hausfraulich benimmt sich Carmen (Dorothy Dandridge) gegenüber Joe (Harry Belafonte) im rein afroamerikanisch besetzten Musical »Carmen Jones« (1954). 11 Freud bringt jenes Milieu bürgerlicher Triebsublimierung auf den Punkt, in dem seine psychoanalytischen Konzepte gedeihen konnten. Aber was macht die anhaltende Faszination dieser Figurenkonstellation auch heute, nach der sexuellen Revolution der 68er, aus? Die Transformation in das Studentenmilieu in Jean-Luc Godards Prénom Carmen oder die Übersetzung der »Zigeuner« in das afroamerikanische Milieu in Carmen Jones und Beyoncés Hip Hopera bzw. in die Township der schwarzen Südafrikaner in U-Carmen zeigt auf, dass die hier verhandelten Themen sozialer Ungleichheit und rassistischer Ausgrenzung bis heute nichts an Virulenz verloren haben. Dass sich die Geschichte von Carmen über die radikalen Wandlungen, die das Verhältnis zwischen den Geschlechtern in den vergangenen 140 Jahren erfahren hat, ihre Faszination bewahren konnte, legt außerdem nahe, dass uns hier etwas über das Verhältnis von Mann und Frau, von Begehren und Verführung, von Besitzanspruch und Freiheitsdrang in Beziehungen erzählt wird, das seine Aktualität nicht verloren hat. Es ist eben nicht einfach so, dass die bürgerlich-patriarchalische Ordnung, die Carmen durcheinandergebracht hat, durch ihren Tod nun wiederhergestellt wäre, wie es allzu einfache Lesarten nahegelegt haben. Die Verunsicherung der moralischen Ordnung ist nachhaltig, und in den leeren Schlussoktaven in Fis-Dur hallen noch die letzten Worte Don Josés nach. Auch sie wurden von Nietzsche bewundert: »Ich weiss keinen Fall, wo der tragische Witz, der das Wesen der Liebe macht, so streng sich ausdrückte, so schrecklich zur Formel würde, wie im letzten Schrei Don José’s, mit dem das Werk schliesst: ›Ja! Ich habe sie getödtet, / ich – meine ange­ betete Carmen!‹ – Eine solche Auffassung der Liebe (die einzige, die des ­Philosophen würdig ist –) ist selten: sie hebt ein Kunstwerk unter Tausenden heraus.« Carmen ist immer aktuell, wie es einem »kanonisierten« Werk oder auch einem Mythos zukommt, weil man in dieser Oper die elementaren Fragen danach, was Liebe und Begehren bedeutet, in künstlerisch einmalig präziser Form gestellt findet – und weil Bizet und seine Librettisten Henri Meilhac und Ludovic Halévy uns selbst überlassen, die ­Antworten zu finden. Bizet begnügt sich wie alle großen Dramatiker damit, das Geschehen vorzuführen. Dadurch wird das Stück so offen für die unter­ schiedlichsten Lesarten. So sehr Carmen den Bedingungen ihrer Ent­ stehungszeit, auch ihren Ideologien verpflichtet ist, so wenig lässt sie sich darauf reduzieren. Immer wieder fordert sie Sänger, Musiker, Regisseure, Dirigenten und das Publikum dazu heraus, sie neu zu verstehen und mit Wirklichkeit zu erfüllen. 12 Spanienmode und Exotismus Es ist allbekannt: Der Komponist, der die spanischste aller französischen Opern schrieb, hat niemals einen Fuß über die Pyrenäen gesetzt. Weniger bekannt ist: Er hatte das auch gar nicht nötig. Bizet musste nicht nach Spanien kommen, Spanien war längst zu ihm gekommen. Napoleons Eroberung Spaniens (1808–1813) hatte den Beginn einer nicht nur politischen ImmiCarmen unterläuft die gesellschaftliche Ordnung, wie sie durch den Soldaten gration von der Iberischen Halbinsel nach José repräsentiert wird, und verspricht Frankreich zur Folge. Spanische Künstunaussprechliche und unvernünftige ler, Tänzer, Musiker bevölkerten seit den Lust: Julia Migenes und Placído Do­ mingo in Francesco Rosis Film (1984). 1820er-Jahren Paris; und umgekehrt wählten Künstler wie Édouard Manet, Edgar Degas oder Gustave Doré und Literaten wie Alfred de Musset, Victor Hugo oder eben Prosper Mérimée mit Vorliebe Spanien und die Spanier zum Gegenstand ihrer Bilder, ihrer Texte oder Essays (siehe auch den Kasten über Prosper Mérimée S. 26). »Spanische« Musik war in Paris ein so beliebter Konsumgegenstand wie »ungarische« Musik in Wien, sie überschwemmte die Salons und Theater, Tänze wie Fandango und Bolero wurden auf den Bühnen und Bällen getanzt. Fernando Sor, Manuel García und Sebastián Iradier zählten zu den wichtigsten Produzenten solcher Musik – die beiden Letzteren sollten für Carmen besonders bedeutsam werden. Auch auf der Bühne der OpéraComique war Spanien lange vor Carmen präsent: Fromental Halévy komponierte einen Guitarrero (1841), Adolphe Adam einen Toréador (1849) und Jules Massenet Don César de Bazan (1872). Bizets Carmen war also keine Pio­ nierleistung, sondern knüpfte an weit­ verbreitete Salon- und Theaterklänge an. Zwei Stücke aus diesem Salonrepertoire hat Bizet in künstlerisch stark modifizierter Gestalt in die Partitur zu Carmen eingebaut: Sebastián Iradiers El Arreglito für Carmens Habanera und Manuel Garcías Arie »Cuerpo bueno« für den Entr’acte zum 4. Akt. Beide orientieren sich an po47 pulären musikalischen Formen, Garcías Arie ist die Nachahmung eines Polo, »ein traditioneller andalusischer Gesang in schnellem Dreiertakt mit melismatischen Passagen« (Ralph P. Locke), Iradiers Lied eben eine Habanera – das Vorbild ist also eine gerade nicht spanische, sondern kubanische, aus Havanna stammende Tanzform, die wiederum einen hybridisierten »Rückimport« des europäischen Kontratanzes darstellt. Andere spanische Formen, für die es offenbar keine konkreten Vorbilder gab, sind die Séguedille des 2. Akts oder die Bolero-Rhythmen der Strophen von Escamillos Lied. Das musikalische Spanien, dem Bizet in Paris auf Schritt und Tritt begegnen konnte, war ein Spanien der Salons und der kommerziellen Verbreitung. Wer ihm die »Authentizität« absprechen will, gerät in die Gefahr, romantisierender Ursprungssehnsucht zu frönen. Hier wie stets geht es um ein gemeinsam geteiltes, kulturelles Phantasma, das heißt: eine geteilte Vorstellung darüber, was musikalisch (tänzerisch, modisch usw.) »spanisch« ist – wenn man will: ein Klischee. Doch wer maßt sich an zu sagen, dass eine von Spaniern komponierte und aufgeführte Musik nicht spanisch sei? Ob sie nun von realer spanischer (oder lateinamerikanischer) Musik inspiriert waren oder nicht: Wichtig war, durch die federnden Rhythmen, in sich kreisenden Harmoniefolgen und kurzatmigen melodischen Floskeln ein faszinierendes, fremdes, »exotisches« Anderes zu beschwören – also jene Haltung, die man »Exotismus« nennt. Diese Lust auf das Andere ist ein zentrales Motiv nicht nur von Carmen, sondern auch des gesamten 19. Jahrhunderts. Gerade zur Zeit des Kolonialismus, als im Zeichen von Zivilisation und Vernunft Menschen versklavt, kommerziell ausgebeutet und getötet wurden, hat die Kultur Europas dieses Andere, den Fremden, die Fremde, das Fremde, eben nicht nur als einen bloßen Fremd-Körper gesehen, an dem sich die westliche Überlegenheit erweisen kann, sondern immer auch als etwas sinnlich Verwirrendes und Verlockendes, als etwas existenziell Herausforderndes. Die Bedrohung, die das Andere für das eigene Selbstverständnis darstellt, kann auch als lustvoll erlebt werden – gerade aus der sicheren Distanz des Zuschauerraums in einem Opernhaus. Carmen hat gleich mehrere solcher, matrjoschkahaft ineinander geschachtelter »Anderer« zu bieten. Sie haben zu tun mit dem Gegensatz zwischen dem »rationalen« Norden und dem »irrationalen« Süden, der einen wesentlichen Bestandteil der imaginären Geografie Europas ausmacht. Denn Spanien galt im 19. Jahrhundert als das »Andere« Frankreichs – sonnenverbrannter, heißblütiger, leidenschaftlicher, düsterer, 48 katholischer, weniger »zivilisiert«, gleichsam ein Stück Mittelalter. »Spanien«, schrieb Victor Hugo in der Vorrede zu seinem Gedichtzyklus Les Orientales, »ist immer noch der Orient; Spanien ist halb Afrika; Afrika ist halb Asien.« Noch Nietzsche sprach von der »afrikanischen Heiterkeit« der Carmen-Partitur. Aber innerhalb Spaniens war wiederum Andalusien das Andere, nämlich Südliche (wie an dem Unbehagen Josés, des baskischen Navarresen, gegenüber den Andalusierinnen deutlich wird). Die Zigeuner wiederum sind, indem sie noch einmal die selbst hier noch geltenden Regeln des Zusammenlebens umgehen, das Andere Andalusiens. Carmen schließlich verkörpert sogar unter den Zigeunern das Andere: Denn sie ist eine Frau. Dieses zur Potenz erhobene Andere findet seine Verdichtung zur musikalischen Formel im sogenannten Schicksalsmotiv, das das ungewöhnliche, also »fremde« Intervall einer übermäßigen Sekunde (cis-b, gis-f) umschreibt (Notenbeispiel 1a und 1b). Beispiel 1a Andante moderato Beispiel 1b Allegro moderato ( = 92) Dieses mit Carmen und der verhängnisvollen Leidenschaft Josés zu ihr assoziierte Motiv (siehe Kasten »Leitmotivik«, S. 55) wird im Allgemeinen als Teil einer »Zigeunertonleiter« angesehen, also einer Mollskala mit erhöhter Quart und Septime (im gegebenen Ausschnitt also d-e-f-gis-a-b-cis-d). Ob Bizet diese Tonleiter, die vor allem durch Liszts »ungarische« Stücke popularisiert wurde, allerdings unter dem Namen »Zigeunertonleiter« gekannt und deswegen verwendet hat, ist nicht belegt. Jedenfalls hebt sich der expressive Exotismus dieses Motivs deutlich von der übrigen »spanischen« Musik der Partitur ab. 49 Rasse, Klasse und Gender dreifach als Außenseiterin gebrandmarkt wird – Zigeunerin, Proletarierin, Frau –, wird sie »realistisch«. So besteht der Realismus von Carmen in der Objektivität ihrer lakonischen Formknappheit; Bizets Eklektizismus setzt Musik durch ihre ständige Relativierung wie unter Anführungszeichen, selbst und gerade ein scheinbar so unmittelbar Empfindung verströmendes Stück wie Josés Blumenarie. Diese realistische Objektivität hat etwas geradezu grausam Genaues, fast wie in einem Laborexperiment sind die Figuren auf ihren Tonfall festgelegt wie die Akteure bei Mérimée (oder Zola) durch ihre Abstammung und ihr Milieu. Streifzug durch die Partitur Nr. 1 Prélude , Nr. 2 Scène et Chœur »Sur la place« [Nr. 2a Scène et Pantomime »Attention! Chut!«], Nr. 3 Chœur des gamins »Avec la garde«: Andalusische Langeweile Festlich, fast zirkushaft schmetternd beginnt das Prélude – noch schmetternder wird sein Klang, wenn die von Bizet geforderten Cornets à piston (trompetenähnliche Ventilhörner) gespielt werden. Dieser Klang ist merkwürdigerweise thematisch einer Nebenfigur des Stücks zugeordnet: dem Torero Escamillo. Das Prélude zitiert in den rahmenden Außenteilen die Quadrille der Stierkämpfer im letzten Akt, im Mittelteil das berühmte Torerolied. Die Musik gleicht einem Paso doble, der traditionellen Stierkampfmusik, und die unvermittelten, blockhaft ­nebeneinandergesetzten Harmoniewechsel – A-Dur, D-Dur, A-Dur, C-Dur – allein der ersten 16 Takte erinnern an die Art und Weise, wie im Paso doble die Gitarre einen harmonischen Schwerpunkt an den anderen reiht. Warum beginnt Bizet sein Werk auf diese Weise? Zwei verschiedene Deutungen bieten sich an. Der scheinbar periphere dramatische Bezug gilt vielmehr dem Hauptschauplatz – dem andalusischen Spanien, das von Bizet musikalisch imaginiert wird. Dieses Spanien erwacht nun einmal im 4. Akt, beim Stierkampf, zum vollen Leben. Die andere Erklärung ist befremdlicher, aber faszinierend. Die Oper beginnt mit der Musik zum Stierkampf, weil sie, wie dieser, einen Kampf auf Leben und Tod darstellt. Die Parallelen im letzten Akt zwischen der Tötung Carmens und der Tötung des Stiers sind überdeutlich. In dieser Sichtweise läuft die Begegnung zwischen José und Carmen von Anfang an auf die Katastrophe zu, und die Szenen, die sie durchleben, sind ritualisiert wie die Stationen eines Stierkampfs. Freilich, eindeutig sind 54 »Leitmotivik« Das einprägsame Gebilde vom Ende des Vorspiels (Notenbeispiel 1a, S. 49) kehrt im Lauf der Oper immer wieder und wird mit der fatalen Leidenschaft von Carmen und Don José verbunden. Es annonciert, in spielerischer Ver­ kleinerung, Carmens Auftritt im 1. Akt (Notenbeispiel 1b), dann untermalt es breit und düster wie im Prélude ihre erste Begegnung mit José. Darüber hinaus erscheint es mitten in Josés Duett mit Micaëla, am Höhepunkt des Streits zwischen José und Carmen in der Kneipe von Lillas Pastia, als Vor­ ahnung des Todes im Kartentrio, schließlich im Finalduett. Dort finden wir es, wie im Vorspiel, mit der festlichen Stierkampfmusik assoziiert, nun aber in einem denkbar ernsten Kontrast. Der Ausdruckscharakter des Motivs changiert vom Flirt über die Leidenschaft bis hin zur tödlichen Ausweglosigkeit, es gravitiert sozusagen zum Tode hin. Entsprechend hat man es als »Carmen-Motiv«, »Schicksals­ motiv«, »Todesmotiv« etikettiert. Ob es sich dabei um ein »Erinnerungs­ motiv« oder ein »Leitmotiv« handele und was eigentlich der Unterschied zwischen beiden wäre, ist weniger wichtig als seine Funktion im Lauf des Dramas. Eingangs, in seiner spielerischen, aber katzenhaft geschmeidigen Verkürzung, mit Carmen assoziiert, gewinnt es im Lauf der Oper ein Gewicht, das die tödliche Obsession des Soldaten mit der Zigeunerin charakterisiert. Zugleich steht es für das Diktat des »Schicksals«, dem sich Carmen aus freiem Willen unterwirft. Auch wenn es ein gesellschaftlich konstruiertes Schicksal aus männlichen Herrschafts- und Besitzansprüchen ist, nimmt sie es als von außen verhängt hin, ja beschwört es geradezu herauf. Vielleicht kann man sagen, dass sich in seinen verschiedenen Meta­morphosen so et­ was widerspiegelt wie das gegenseitige Missverhältnis im Liebesverständ­ nis zwischen Carmen und José, oder, wie Dahlhaus sagen würde: die dunkle Mitte der Sprachlosigkeit zwischen den beiden (vgl. S. 53). Insofern ist das »Schicksalsmotiv«, wie wir es nennen wollen, ein »objektives« Motiv. Damit nimmt es in dieser Oper eine Sonderstellung ein, auch wenn Bizet mit einigen anderen wiederkehrenden Ideen arbei­ tet – Escamillos Torerolied ist eines davon. Die Geigenmelodie vom Ende der Nr. 6 kehrt in Nr. 8 wieder, das Orchester zitiert am Ende des 1. Akts aus dem Streitchor Nr. 8 und aus Carmens Habanera, und Micaëla beschwört im Finale des 3. Akts die »Stimme der Mutter« aus ihrem Duett mit Don José (Nr. 7). (In Guirauds Rezitativen werden diese Beziehungsgeflechte noch weiter ausgebaut.) Keines dieser Gebilde erreicht jedoch die dramatische Wandlungsfähigkeit und Eindringlichkeit des Schicksalsmotivs. 55 die Rollen nicht verteilt, und so manches spricht für die These Stephen Huebners, Carmen sei in dieser Oper der Torero und José der zunehmend die Selbstkontrolle verlierende, tödlich gereizte Stier. Im Prélude führt Bizet zwei schlichte rhythmische Zellen ein, die für die »spanischen« Teile der Partitur bedeutungsvoll werden sollen und oft auf derselben Tonhöhe erklingen (siehe Notenbeispiel 2 a und 2b): eine Achtel, die von zwei Sechzehnteln gefolgt wird, der als Daktylus bezeichnete Rhythmus lang-kurz-kurz also (so gleich die ersten Töne des Stücks in Geigen und Holzbläsern), und zwei Sechzehntel auf gutem Taktteil, gefolgt von einer Achtel, also einen Anapäst: kurz-kurz-lang (dieses Motiv führt die Rückleitung vom Mittelteil des A-Teils in das Hauptthema vor). Diesen Mikro-Rhythmen ist etwas Federndes, aber auch Entspanntes ­eigen. Beispiel 2a Motiv a (»Daktylus«): oder etc. oder etc. Allegro giocoso ( = 116) Beispiel 2b Motiv b (»Anapäst«): So unauffällig und anonym diese beiden rhythmischen Zellen anmuten, sie sorgen für den charakteristisch leichten und beweglichen Rhythmus gerade der Genre-Szenen der Musik, für ihr »andalusisches« Flair oder Kolorit. Man denke an die Nr. 1 oder den Chor der Straßenjungen (Nr. 2), dann etwa an den Chor der Zigarrenarbeiterinnen (Nr. 4), an Nr. 17, Nr. 25 (»À deux cuartos!«, hier auf Achtel und Viertel vergrößert) und den unmittelbar anschließenden Auftritt der Stierkämpfer. Mit eigentlichen, wieder56 erkennbaren und bedeutungstragenden Motiven, wie sie in der Ouvertüre vorgestellt wurden (siehe Kasten »Leitmotivik«, S. 55), haben sie freilich nichts zu tun. Nach dem (vermeintlichen) Schlussakkord in A-Dur und einer Generalpause kippt die festliche Stimmung des Prélude in ein düsteres Tremolo der Streicher in d-Moll, der Mollsubdominante, über dem sich ein gewundenes Motiv vorstellt, dem zwei tiefe Schläge folgen (vgl. Noten­ beispiel 1a, S. 49). Verunsichernd wie das übermäßige Intervall ist die tonartliche Instabilität des Abschnitts: Führen die ersten drei Auftritte von d-Moll nach F-Dur, so die nächsten von f-Moll nach As-Dur. Damit sind wichtige Tonartenbereiche der Oper und vor allem auch die das Verhältnis zwischen Carmen und José charakterisierende Tritonusspannung (d-as/ gis) umschrieben. Das chromatisch Unbestimmte der Harmonik und die sich steigernde Dringlichkeit des Themas, das zuletzt in der Offenheit ­eines verminderten Septakkords abreißt, deuten an, dass es so südländischfestlich wie zuvor nicht in der ganzen Oper zugehen wird. Wie die meisten Opern des 19. Jahrhunderts beginnt auch Carmen mit einem Tableau des Schauplatzes, gewissermaßen dem Äquivalent zur filmischen Totalen vor dem Einsetzen der Handlung. Freilich, und das macht die erste Provokation der Oper aus, beginnt sie mit einem Bild der Langeweile. Ein gleichsam auf der Stelle tretender Rhythmus und schier unendliche Girlanden in Violinen und Flöten zögern den Eintritt der Grundtonart fast ins Unendliche hinaus, als würde sich jeder in der Hitze des Tages scheuen, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Nur um »die Zeit totzuschlagen« (»pour tuer le temps«), beobachten die gelang­weilten Soldaten die Passanten und lästern über sie. Der Chor ist von Bizet sozusagen in musikalisches Flaneurtum verwandelt worden: Die erste gesungene Phrase: »Sur la place, chacun passe« schlägt einen schlendernden Rhythmus an, der nicht zu schnell genommen werden sollte. Erst nach 23 Takten wird diese vage schlendernde Bewegung etwas konziser zusammengefasst (»Drôles de gens que ces gens là!«), womit endlich der TonikaAkkord erreicht und schließlich sogar kadenziert wird. (In diesen beiden Vokalphrasen erkennen wir die beiden »andalusischen« rhythmischen Zellen wieder, siehe Notenbeispiel 3 a + b, S. 59.) Dies ist eine Oper, die die Vertreter der bürgerlichen Ordnung nicht ernst nimmt – vor allem nicht das Militär, eigentlich den Hüter dieser Ordnung. Micaëla jedenfalls merkt sofort, dass die galante Einladung der Soldaten, mit ihnen auf José zu warten, von nicht ganz anständigen Absichten begleitet ist; lachend wiederholt sie deren marschartige Phrase (die erste, die sich überhaupt zu so etwas wie militärischem Duktus aufge57 Steckbrief: Micaëla – eine Ehrenrettung Oft wird sie als naiv, kleinbürgerlich, bieder abgetan. In der Tat entspricht Micaëlas Erscheinung – blauer Rock, schulterlange Zöpfe – genau dem weiblichen Ideal des Navarresen José, wie es bei Mérimée steht. Und gewiss steht sie für die Welt und die Werte von Josés Mutter, deren Botin sie ist und auf deren Wunsch hin sie José heiraten soll. Tatsächlich spricht Josés Ziehschwester mit der Stimme der Mutter, wenn sie im Duett (Nr. 7) deren Botschaft an ihren Sohn wiedergibt (»Et tu lui diras«) – mit derselben Me­ lodie, mit der sie zwei Akte später José vergeblich zu beschwören versucht, zu seiner Mutter zurückzukehren (Nr. 24). Bis zuletzt definiert sie sich über diese »mütterlichen« Bindungen von Herkunft und Moral, denen sich José zunehmend entfremdet. Damit bildete Micaëla die perfekte (und einzige) Identifikationsfigur für das Stammpublikum der Opéra-Comique, für das ja das Einfädeln einer Ehe ein Anlass war, das Theater zu besuchen. In »kritischen« Inszenierungen wird sie dementsprechend gerne als spießiges Dummchen dargestellt, wenn nicht gar als matronenhafter ­Mutterersatz. Aber Micaëla, auch wenn sie musikalisch direkt der traditionel­ len opéra comique entsprungen zu sein scheint, ist keineswegs bloß eine ländlich-sittliche Pomeranze. Wenn sie auftritt – so früh freilich, dass sie nach den Gesetzen der Operndramaturgie nur eine Nebenfigur sein kann –, dann hat sie sich allein ins unmoralische Sevilla gewagt, um José einen Brief und einen Kuss seiner Mutter zu überreichen. Die pseudo-galanten Avancen der Soldaten durchschaut sie rasch und weiß sich ihrer geschickt und sogar mit Witz zu entziehen. Überhaupt ist dieses 17-jährige Mädchen stets im Freien unterwegs, während in der Oper des 19. Jahrhunderts die »guten« Frauen fast immer im geschützten häuslichen Bereich präsentiert werden. Im 3. Akt wagt sie sich sogar ins nächtliche Gebirge unter die Verbrecher, um José zum Guten zu bewegen. In ihrem Gebet bittet sie den Herrn um Mut dafür, und im c-Moll-Mittelteil versichert sie sich selbst mit entschlossenen Auftakten, sogar gegen die gefährliche Frau, die ihr den Geliebten gestohlen hat, die Stimme erheben zu wollen (übrigens ihr einziges Eingeständnis ihrer Gefühle für José). Ganz so entschlossen geht der Mittelteil zwar nicht weiter, und rasch flüchtet sie sich wieder ins Gebet. Aber sie bezwingt ihre Angst, und das ist heldenhafter, als hätte sie keine. 58 Oben: Nachdem sie anfangs versucht hatte, als blonde Carmen zu reüssieren, hat Elı̄na Garanča nun zur Perücke gegriffen – hier in einer Produktion der New Yorker Metropolitan Opera von 2009. Unten: Ildebrando D’Arcangelo als Escamillo und Garanča als Carmen in der Inszenierung von Lina Wertmüller an der Bayerischen Staatsoper (2010). 67 Oben: Den diskreten Charme des Proletariats entfaltet Béatrice Uria-Monzon in Calixto Bieitos Regie am Teatro Liceu in Barcelona (2011). Unten: In Martin Kušejs Inszenierung am Pariser Théâtre du Châtelet (2007) ist die Schieflage der gesellschaftlichen Ordnung von Anfang an unübersehbar. 68 bewahrt hat. Carmen aufzuführen ist auch im 21. Jahrhundert weit mehr als eine sichere Bank für Open-Air-Festivals; im Gegensatz zu den meisten anderen Opern des 19. Jahrhunderts sind hier die Sympathien nicht klar verteilt, die Charaktere keine Identifikationsfiguren, und die Handlung in ihrer Mischung aus Humor, Ironie, Eros und Tragik, aus »niederer« und »hoher« Kultur, ist immer noch beunruhigend. Letztlich aber steht und fällt das Stück mit seiner Titelpartie. Und so wollen wir am Schluss dieses allzu kurzen Überblicks den Dirigenten Désiré-Émile Inghelbrecht zitieren: »Wenn ich sie gelegentlich flüchtig erblickt, wenn ich sie sogar zuweilen gehört habe, so bin ich doch, leider, nie der wahren Carmencita begegnet! Die Sängerinnen nehmen diese Rolle, eine der schwierigsten und komplexesten des Repertoires, viel zu unbedacht in Angriff. Der Großteil setzt die Heldin Mérimées unbedacht mit den Mädchen von Bruant [Aristide Bruant: Kabarettsänger und Nachtklubbesitzer, verewigt durch das Werbeplakat seines Freundes Henri Toulouse-Lautrec] gleich. Die anderen achten im Gegenteil sehr darauf, nicht vulgär zu wirken, sie sind der Ansicht, dass eine große Hauptrolle der Oper niemals dazu führen darf, ihre Zurückhaltung abzulegen. Und wieder andere erahnen wohl vage die Rolle und die richtige Art, sie auszuführen, besitzen aber nicht die musikalischen oder stimmlichen Qualitäten, um sie auszuführen.« Carmen im Film Ein letzter Superlativ muss erlaubt sein: Carmen ist die meistverfilmte Oper der Welt. Auch dort, wo sich Filmemacher von Meilhac / Halévys Geschichte und Bizets Musik ab- und Mérimées »Original« zugewandt haben – wie etwa in Charles Vidors nur mit großer Freude am »camp« zu genießenden Rita-Hayworth-Spektakel The Loves of Carmen (USA 1948) oder in Vicente Arandas Carmen mit Paz Vega (Spanien 2003) –, ist es doch die Popularität der Oper, die »Carmen« überhaupt zu einem Namen macht, mit dem das Publikum etwas verbindet. Und gerade in der Frühzeit des Films war die Berufung auf Mérimée eher eine Schutzbehauptung, um keine Tantiemen zahlen zu müssen. Eine 2006 veröffentlichte Filmografie zählt 82 Carmen-Filme; dazu kommen weitere 32 Verfilmungen einer Bühnenversion der Oper. Sie reichen von Thomas Alva Edisons 21-sekündiger Tanzszene Carmencita (USA 1894) über die erste – aus zwölf »phonoscènes« der berühmtesten Nummern bestehende – Lang-Verfilmung durch Alice Guy-Blaché 127 (Frankreich 1906) bis hin zu dem Beyoncé-Knowles-Vehikel Carmen: A HipHopera (USA 2001) und zu U-Carmen e-Khayelitsha (Südafrika 2005). Das Paradox, dass Carmen in der Ära des Stummfilms besondere Popularität erlangte, wurde schon oben anhand von Geraldine Farrars Verkörperung der Rolle gestreift (Regie: Cecil B. DeMille, USA 1915). Mit dem Engagement des Met-Stars und mit einer Musik von Hugo Riesenfeld, die in freiem Anschluss an Bizets und Guirauds »Leitmotivtechnik« die Themen der Oper verarbeitete, versuchte man das kulturelle und soziale Kapital des Unterhaltungsmediums Film zu erhöhen. (Vermutlich wurde der Film genau aus diesem Grund sogleich von Charlie Chaplin parodiert.) Gleichsam als Gegenmodell zu dieser »Nobilitierung« des Unterschichtendramas produzierte Raoul Walsh seinen (ersten) Carmen-Film im selben Jahr 1915 – typisch für die engen Konkurrenzverhältnisse und Plagiate des frühen Films – mit Theda Bara, der Begründerin des Ausdrucks »Vamp«. Und die Version von Ernst Lubitsch (Deutschland 1918) mit Pola Negri setzte in gleicher Weise auf die Attraktion einer als Femme fatale zu ihrer eigenen Marke gewordenen Darsteller-Sängerin. Von dem Klischee einer übererotisierten und durch zahlreiche Affä­ ren auch im Privatleben »authentischen« Verführerin lebte die erwähnte Produktion mit Rita Hayworth ebenso wie Carmen, la de la Ronda (­Spanien 1959) mit Sara Montiel; und natürlich gab es später auch pornografische Versionen auf unterschiedlichem Niveau und für unterschiedliche Ziel­ publika. Die berühmteste und wohl auch bedeutendste Carmen-Version zwischen der Stummfilmzeit und den 1980er-Jahren ist freilich Otto Premingers Carmen Jones (USA 1954), eine freie Adaption der MusicalFassung von Bizets Oper durch Oscar Hammerstein II. mit Dorothy Dandridge, die für diese Rolle als erste Afroamerikanerin (obgleich in der Singstimme gedoubelt durch Marilyn Horne) einen Oscar erhielt, und Harry Belafonte als Air-Force-Pilot Joe. Die Geschichte, die mit ausschließlich afro­amerikanischen Darstellern in die USA während des Zweiten Weltkriegs übersetzt wird, transponiert die ethnischen und sozialen Spannungen innerhalb des ursprünglichen Plots: Die guten, bürgerlichen, »weißen« Figuren (Joe und seine Verlobte Cindy Lou) und die bösen, unsittlichen, »schwarzen« (Carmen und ihre Freundinnen) werden konfrontiert, wobei die Figur der Carmen freilich noch weiter entschärft wird. Dem Film, der in seiner Entstehungszeit als engagiertes Plädoyer gegen die Rassentrennung verstanden wurde, konnte somit von neueren Interpreten ein struktureller Rassismus vorgeworfen werden – und die Adaption der Chanson bohème als »Beat Out Dat Rhythm on a Drum«, die allerdings nicht von Carmen, sondern von Frankie (= Frasquita) gesungen wird, wobei Pearl 128