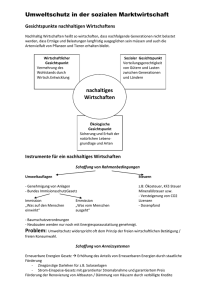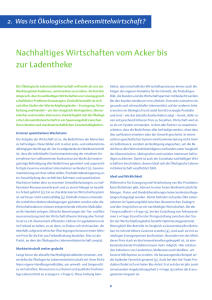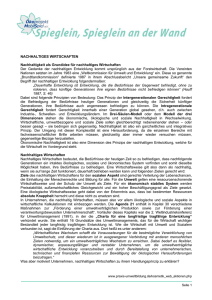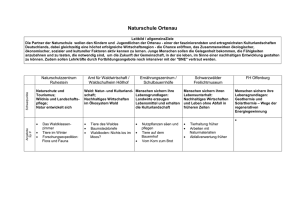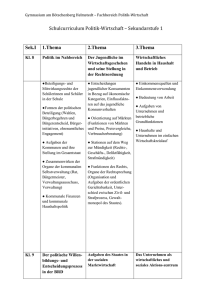Verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften
Werbung

Professor Dr. Gerd Mutz Juni 2015 Verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften. Relevanz volkswirtschaftlicher, wirtschaftssoziologischer und wirtschaftsethischer Ansätze 1. Allgemeine Überlegungen ............................................................... 1 2. Volkswirtschaftliches Denken im Deutungsrahmen der Neoklassik ....... 4 2.1 Mikroökonomische Grundlagen ................................................... 5 2.2 Kritische Einschätzung des mikroökonomischen Modells ................ 8 2.3 Relevanz der neoklassischen Mikroökonomie für verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften ....................................................... 12 2.4 Makroökonomische Grundlagen ................................................ 14 2.5 Kritische Einschätzung der neoklassischen Wachstumsorientierung 18 2.6 Impulse durch neue Ansätze zu verantwortlichem und nachhaltigem Wirtschaften ................................................................................ 22 3. Wirtschaften aus wirtschaftssoziologischer Perspektive .................... 37 3.1 Wirtschaften in der Zweiten Moderne ........................................ 38 3.2 Systemtheoretischer Ansatz ..................................................... 47 3.3 Soziologische Schnittstellen und Unterschiede ............................ 49 4. Wirtschaftsethische Ansätze ......................................................... 50 4.1 Wo ist der Ort für Moral und Ethik? ........................................... 51 4.2 Das Verantwortungsprinzip: Gültigkeit und Reichweite von Moral . 55 1. Allgemeine Überlegungen Wirtschaftliches Handeln beschreibt Austauschprozesse Wirtschaften bedeutet seinem Wesen nach, dass der Natur etwas entnommen und durch den Einsatz von Arbeitskraft (Produktion) zu einem Produkt umgewandelt wird; die Nutzung des Produkts ist nie vollständig in dem Sinne, dass gar nichts übrig bleibt: Es entstehen immer „Abfälle“, die der Natur zurückgegeben werden und die von ihr wiederum „einverleibt“ werden müssen. Wirtschaftliches Handeln kann folglich als Austauschprozess zwischen der sozialen und ökologischen Umwelt beschrieben werden, bei dem durch Arbeiten Transformationen dahingehend stattfinden, dass etwas hergestellt wird, das Menschen nutzen können. Die beiden Enden des Wirtschaftsprozesses können so beschrieben werden, dass einerseits ökologische und soziale Ressourcen (Arbeitskraft, Natur) genutzt werden und andererseits ökologische und soziale Belastungen entstehen. Wirtschaftliches Handeln findet innerhalb gesellschaftlicher Strukturen statt. Soziale und ökologische Ressourcen fallen unter die „Gesetze“ des Marktes Das Besondere an Marktgesellschaften ist, dass alle Güter und Dienstleistungen zu Waren werden und somit unter die „Gesetze“ des Marktes fallen: Ist ein Preis gering, wird viel nachgefragt, ist ein Preis hoch, dann wird die Nutzung eingeschränkt. Es ist der Preis, über den die Nutzung von sozialen und ökologischen Ressourcen gesteuert werden kann. Kostet es wenig, bspw. Energie der Natur zu entnehmen oder wird die Förderung öffentlich bezuschusst, dann werden wirtschaftliche Akteure ohne Sorge um eine Endlichkeit von Ressourcen so viel wie möglich verbrauchen. Das gleiche gilt für ökologische und soziale Belastungen: Kostet es nichts, Abfälle zu entsorgen oder wird die Entsorgung durch die Öffentlichkeit bezahlt, dann werden sich die Wirtschaftsakteure bspw. wenig Gedanken über Recycling machen. Bei diesen Überlegungen wird schon deutlich, 1 dass es nicht nur um den Markt oder um marktwirtschaftliches Handeln geht, sondern auch die Frage von Bedeutung ist, ob und in welcher Form die Gesellschaft – in Nationalstaaten vertreten durch politische Akteure und den Staat – Marktprozesse steuert und auf die Interessen der Akteure einwirkt, d.h. wie bspw. Ressourcennutzung und Entsorgung gesetzlich reguliert wird. Rolle des Privateigentums Bedeutsam für ein verantwortliches nachhaltiges Wirtschaften ist ein weiterer Sachverhalt, nämlich in welcher Weise Marktgesellschaften organisiert sind: Es muss eine staatliche Eigentumsordnung geben, die reguliert, „wem was“ gehört: Wer hat Eigentum am Boden, der Arbeitskraft, den Produktionsmitteln, den Gewinnen usw. – und welche Eigentumsformen werden ermöglicht (etwa öffentliches, gemeinschaftliches privates Eigentum), und wie werden sie voneinander abgegrenzt? Marktwirtschaften mit einer Eigentumsordnung, die dem Privateigentum den Vorzug gibt, werden als kapitalistische Marktwirtschaften bezeichnet. Die Eigentumsordnung in Deutschland „gewährleistet“ Eigentum (Art. 14 (1) GG), verknüpft dieses Recht auf Privateigentum aber mit „Schranken“, die in weiteren Gesetzen bestimmt werden, und dem bedeutsamen Zusatz: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ (Art. 14 (1) GG) Die Einschränkungen zur Garantie des Privateigentums sind im Hinblick auf wirtschaftliches Handeln so konzipiert, dass die Verantwortung der Wirtschaftsakteure für bspw. soziale und ökologische Belastungen oder Nutzungsschäden nicht sehr weit reicht. Nachvollziehbar ist, dass alles, was außerhalb des Kerngeschäfts liegt, von den wirtschaftlichen Akteuren nicht verantwortet wird; unverständlich ist allerdings, dass Unternehmen auch nicht für die Folgen wirtschaftlichen Handelns im Kerngeschäft verantwortlich sind. Es gibt zwar Einschränkungen im Hinblick auf eine proklamierte Sozialstaatlichkeit („Die Bundesrepublik Deutschland ist 2 ein demokratischer und sozialer Bundesstaat“, Art. 20 (1) GG), aber keine vergleichbaren Festlegungen im Hinblick auf Nachhaltigkeit oder aber nur auf ökologische Ziele. Marktsignale, Stärke politischer, wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure und Eigentumsordnung Nun kann zusammengefasst werden: Die Wirtschaft reagiert aufgrund der Warenförmigkeit von Ressourcen prinzipiell nur auf Marktsignale, also dann, wenn sich soziale und ökologische Belastungen oder Nutzungsschäden in Preisen niederschlagen. Preise können durch gesetzliche Regelungen oder zivilgesellschaftlichen Druck beeinflusst werden; es spielt auch das Kräfteverhältnis zwischen wirtschaftlichen und politischen Akteuren eine Rolle. Schließlich ist es eine Frage der Eigentumsordnung, wie Verantwortungsfragen geregelt sind und ob es überhaupt eine Verpflichtung gibt, eine nachhaltige Entwicklung zu befördern. Begrenzte Wirkung sozialer und moralischer Appelle Demnach sind soziale oder moralische Appelle für unternehmerisches Handeln prinzipiell irrelevant; solange es keine gesetzlichen Regulierungen und/ oder profitmindernde Belastungen (Kosten) gibt, werden Unternehmen keine Verantwortung für ihr Kerngeschäft übernehmen bzw. ihr wirtschaftliches Handeln nicht auf Nachhaltigkeitsziele ausrichten. Verantwortung von Politik und Staat In Deutschland sind überwiegend die Politik und damit staatliche Institutionen für die Vermeidung oder „Reparatur“ sozialer und ökologischer Schäden zuständig – herangezogen wird das Steueraufkommen der BürgerInnen. Interessant ist, dass es für soziale Belastungen und soziale Folgen wirtschaftlichen Handelns einen wirtschaftspolitischen Rahmen gibt: 3 die soziale Marktwirtschaft. Analog dazu gibt es empirisch keine praktischen, sondern nur theoretische Ansätze (etwa für eine ökosoziale Marktwirtschaft). D.h. nicht nur aus Sicht wirtschaftlicher Akteure, sondern auch aus Sicht der meisten politischen Akteure gilt es als legitim, ökologische Belastungen und Schäden zu sozialisieren. In dieser Hinsicht sind offensichtlich wirtschaftliche und politische Denkweisen weitestgehend übereinstimmend und es ist nicht zu erwarten, dass sich dies in nächster Zeit verändert. Dies kann bedeuten, dass mit der dominanten Form wirtschaftlichen Handelns gerade jene infrastrukturellen Voraussetzungen aufgebraucht und zerstört werden, die einst Grundlage für die enorme Reichtumsproduktion kapitalistischer Markwirtschaften waren. Im Folgenden werden die traditionellen Erklärungsmuster der Volkswirtschaftslehre, der Wirtschaftssoziologie und der Wirtschaftsethik herangezogen um nachzuzeichnen, wie diese wissenschaftlichen Disziplinen Wirtschaftsabläufe erklären und welche Haltung sie zu Chancen und Möglichkeiten für eine nachhaltige verantwortungsvolle Wirtschaftsweise einnehmen. 2. Volkswirtschaftliches Denken im Deutungsrahmen der Neoklassik Zentrale Dimensionen der Mikroökonomie sind methodischer Individualismus und die Überzeugung, dass sich wirtschaftliches Handeln durch Modelltechniken erklären lässt; letztlich geht es um Fragen, die die Existenz von Märkten betreffen (zu den folgenden Ausführungen können einschlägige volkswirtschaftliche Lehrbücher herangezogen werden, etwa von Paul A. Samuelson oder Peter Bofinger). 4 2.1 Mikroökonomische Grundlagen 2.1.1 Methodischer Individualismus Im Zentrum steht das Individuum Kerngedanke des methodischen Individualismus ist, das ein (singulär gedachtes) Individuum Mittel- und einziger Bezugspunkt wirtschaftlichen Handelns ist. Nur Individuen sind Entscheidungsträger, Kollektive haben keine eigenständige Qualität, sie stellen vielmehr die Summe der einzelnen Entscheidungsträger dar; folglich werden Wirtschaftsstrukturen (und damit wirtschaftliche Institutionen) aus den individuellen Handlungen erklärt. Der methodische Individualismus versucht, theoretische Aussagen über individuelle Motive des Wirtschaftens, individuelles Verhalten oder Handeln zu formulieren. Bedeutsam sind dabei folgende Elemente wirtschaftlichen Handelns: Nutzenmaximierung Wirtschaftliches Handeln, so die Behauptung der VertreterInnen der Neoklassik, also der seit Jahrzehnten herrschenden Interpretation ökonomischer Prozesse, ist darauf ausgerichtet, den Nutzen, der einer Ware zugeschrieben wird, zu steigern; im Unterschied zu der vorher gültigen Werttheorie der ökonomischen Klassik gibt es nach diesen keinen Wert einer Ware an sich, sondern nur eine individuelle Zuschreibung. Dies wird durch die Figur des homo oeconomicus sehr treffend zum Ausdruck gebracht: Wirtschaftliches Handeln bedeutet immer eigennütziges Handeln. “It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our own necessities but 5 of their advantages.” (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith 1776, p.27.) Autonome, souveräne, rationale Individuen Es wird unterstellt, dass das Individuum, unabhängig von jedweder sozialen Beziehung im Hinblick auf wirtschaftliches Handeln autonom ist und somit unabhängige Entscheidungen trifft. Es gibt im Hinblick auf Nutzenentscheidungen keine übergeordneten Individuen, die einzelnen handeln souverän (Konsumentensouveränität). Sie entscheiden „vernünftig“ und berechnend (Rationalverhalten). Weil alle Individuen in wirtschaftlichen Prozessen nur ihre eigenen Interessen verfolgen, stehen logischerweise wirtschaftende Menschen in Konkurrenz zueinander. Knappheit der Waren und vollkommene Information Neben diesen Verhaltensannahmen arbeitet die herrschende Wirtschaftstheorie mit Strukturannahmen: Behauptet wird, dass alle Güter und Dienstleistungen knapp seien und es wird angenommen, dass es eine vollkommene Information gibt, die für alle Marktakteure gleichermaßen verfügbar ist. Diese Verhaltens- und Strukturannahmen sind Grundlage des sog. Ökonomischen Modells, das die Funktionsweise von Marktwirtschaften erklärt; Modelltechniken sollen die Komplexität wirtschaftlicher Vorgänge reduzieren und in vereinfachter Form darstellen. Modelle brauchen Annahmen, also sog. „Axiome“ – hier sind es die genannten Verhaltensund Strukturannahmen. 6 Abb.: Ökonomisches Modell 2.1.2 Was sind Märkte? Die „unsichtbare Hand“ Nach herrschender wirtschaftswissenschaftlicher Auffassung können Märkte mikroökomomisch erklärt werden, d.h. wie jede andere gesellschaftliche Struktur werden gemäß dem Methodischen Individualismus auch Märkte handlungstheoretisch interpretiert: Demnach gelten sie als eine spontane Ordnung des Zusammenwirkens Nutzen kalkulierender Individuen. Die Individuen wiederum orientieren sich ausschließlich an den oben skizzierten ökonomischen Prinzipien. Der Markt ist ein Koordinations- und Allokationsmechanismus, der beschreibt, wie Angebots- und Nachfrage7 pläne der Individuen – orientiert am Preis – in Übereinstimmung gebracht werden; daraus bildet sich dann die Menge der Waren, die ver- und gekauft werden. Der Preis wiederum bildet sich aus den Angebots- und Nachfrageplänen der Individuen; ökonomisch-mathematisch formuliert ist der Preis also eine Funktion von Angebot und Nachfrage. „Markträumung“, also tatsächlicher Kauf und Verkauf in Übereinstimmung von Nachfrage und Angebot, geschieht durch das Wirken eines gedachten „Auktionators“ bzw. durch die „unsichtbare Hand“. Die Idee ist folglich, dass Märkte in der Lage sind, Angebots- und Nachfragepläne so aufeinander abzustimmen, das gleichsam jedes Individuum zum Zuge kommt, es also grundsätzlich möglich ist, dass es zwischen diesen beiden Größen ein Gleichgewicht geben kann, von dem angenommen wird, dass es stabil ist. Dieses Gleichgewicht ist pareto-optimal (nach Vilfredo Pareto): Es kann niemand besser gestellt werden ohne ein anderes Individuum schlechter zu stellen. 2.2 Kritische Einschätzung des mikroökonomischen Modells Methodischer Individualismus ist ein Werturteil der Ökonomie Es ist außerhalb der (neo-)klassischen Ökonomie unstrittig und aus der Alltagssicht unmittelbar einleuchtend, dass das „Annahmesystem“ aus Verhaltens- und Strukturannahmen empirisch nicht gesättigt ist, d.h. schlicht lebensweltfremd ist. Bei dem methodischen Individualismus handelt es sich um ein Werturteil der Ökonomie, das sich aus dem politischen Liberalismus entwickelt hat: Erst im Liberalismus entstand die Idee eines eigenständigen Individuums, das sich aus allen vorgegebenen (v.a. feudalistischen) Bezügen lösen und eigenständig agieren kann. Bis dahin galt überwiegend die Gemeinschaft als Bezugspunkt gesellschaftlichen (und auch wirtschaftlichen) Handelns. Schließlich entwickelte sich aus dem politischen Denksystem, nach dem der Bürger unabhängig vom Adel seine 8 Geschicke selbst in die Hand nehmen kann, ein ökonomischer Liberalismus. Aus Sicht der übrigen Gesellschaftswissenschaften, insbesondere der (Wirtschafts-)Soziologie ist unstrittig, dass es das Individuum nicht gibt – allenfalls Individuen – und dass Menschen miteinander vernetzt und voneinander abhängig sind. Sie sind eingebettet in spezifische Lebensweisen, Kulturen und Formen des Miteinanders. Fühlen, Denken und Handeln sind Teil gesellschaftlicher Strukturen, geprägt von kulturspezifischen Werten, Normen und Regeln. Wirtschaftliches Handeln ist nichts weiter als eine Sonderform allgemeinen gesellschaftlichen Handelns, das wiederum immer Kommunikation voraussetzt. Somit ist Kommunikation – in welcher Form auch immer – genuiner Bestandteil allen wirtschaftlichen Handelns. Auch wenn Individuen (im politischen oder wirtschaftlichen Sinne) nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung streben, so bleiben sie voneinander abhängig und es gibt in diesem Sinne kein autonomes Individuum oder autonomes Handeln. Dies bedeutet aber auch, dass es notwendige (zumindest) interpersonelle Machtbeziehungen zwischen den Individuen gibt, die konstitutiv für jegliches gesellschaftliches und auch wirtschaftliches Handeln sind – und es ist naheliegend anzunehmen, dass wirtschaftliche Entscheidungen in Machtbeziehungen eingebunden, d.h. von ihnen abhängig sind. Wirtschaftliches Handeln ist weder immer nur eigennützig noch überwiegend rational oder konkurrierend Dabei wird von Geistes-, Human- und Gesellschaftswissenschaften durchaus eingeräumt, dass es interessengeleitete, eigennützige Kommunikation (Handeln) gibt; sie scheint aber nach der Mehrzahl der Studien eine Sonderform zu sein, die sich erst im Verlaufe des Zusammenlebens in bestimmten gesellschaftlichen Strukturen – wie der Struktur kapitalistischer Marktwirtschaften – entwickelt. Gesellschaftliches, auch wirtschaftliches 9 Handeln, ist überwiegend kooperativ und/ oder auf eine Gemeinschaft ausgerichtet. Individuen sind nicht „von Natur aus“ eigennützig. Nutzenund Profitmaximierung sind mögliche, aber nicht notwendige Handlungsorientierungen wirtschaftlichen Handelns. Das gleiche gilt für Rationalität als eine besondere Denk- und Handlungsform, die sich bekanntlich erst in den aufkeimenden marktwirtschaftlichen Strukturen des späten Mittelalters allmählich durchsetzte. Kalkulierendes, rechenhaftes Verhalten entsteht erst, wenn es gesellschaftlich – hier aus wirtschaftlichen Gründen – notwendig ist. Und da sich Menschen an der gesellschaftlichen Umgebung orientieren, handeln sie in diesen Rahmungen vorbewusst, nach eingeübten Routinen und kulturellen Überlieferungen (weil diese helfen, andauernde Handlungsunsicherheiten zu überwinden). Auch Konkurrenzverhalten ist eine Sonderform wirtschaftlichen Handelns; andere kooperative Verhaltensformen sind nicht nur denkbar, sondern auch in vielen Bereichen wirtschaftlichen Handelns gesellschaftlich verankert. Märkte sind politisch, sozial und kulturell konstituierte Organisationsprinzipien Im Hinblick auf die strukturellen Annahmen wirtschaftswissenschaftlicher Theorien ist insbesondere auf das individualistische Konstrukt von Märkten einzugehen. Sie sind weder historisch noch wie behauptet logisches Resultat spontaner Einzelhandlungen, sondern der gesellschaftlichen Arbeitsteilung (zwischen Individuen, Unternehmen, Regionen usw.) geschuldet: Spezialisierungen erfordern Märkte, weil sich Menschen nicht ganzheitlich versorgen können. Der Markt ist ein Organisationsprinzip oder, soziologisch formuliert (Max Weber), ein Ort, an dem Interessen aufeinander treffen. Diese Interessen werden vom Markt in einer Weise koordiniert, die als effizient bezeichnet wird – zumindest gibt es gute Gründe für die An10 nahme, dass hierarchische Planung, etwa seitens staatlicher Institutionen, weniger effizient ist. Strukturell ist jedoch auch zu beachten, dass Märkte nicht einfach immer dort entstanden sind, wo sie wirtschaftlich sinnvoll gewesen wären. Vielmehr ist historisch belegt, dass Märkte insbesondere politisch, aber auch sozial und kulturell konstituiert sind: So wurden etwa Marktgemeinden politisch beschlossen und auch heute entscheidet in vielen Weltregionen die Politik, welche Güter und Dienstleistungen über den Markt gehandelt werden; darüber hinaus waren/ sind soziale Gegebenheiten oder kulturelle Traditionen mitentscheidend dafür, ob sich ökonomisches Denken und Handeln durchsetzt und entsprechende Marktstrukturen entstehen. Märkte gewährleisten keine soziale Gerechtigkeit und befördern gesellschaftliche Ungleichheit Im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit bzw. gesellschaftliche Ungleichheit sind drei bedeutsame Sachverhalte zu benennen: Märkte sind erstens keine sozialen Organisationen, die allen Menschen offenstehen. Vielmehr gilt ein sog. „Ausschlussprinzip“, d.h. am Marktgeschehen nehmen nur die Individuen teil, die in der Lage sind, einen Preis zu zahlen; nur sie können kaufrelevante Nachfragepläne formulieren. Menschen, die zwar einen Bedarf an Gütern und Dienstleistungen haben, aber keine kaufrelevante Nachfrage entfalten können, bleiben von der Versorgung über Märkte ausgeschlossen. Zweitens sind stabile und insbesondere gleichgewichtige Märkte eine Ausnahme – vielmehr ist von einem andauernden auf Ungleichgewichte bezogenen wirtschaftlichen Handeln auszugehen; und selbst wenn drittens Märkte pareto-optimal funktionieren würden, ist die damit stattfindende Verteilung nicht unbedingt gerecht. Vielmehr gilt, dass Märkte permanent soziale Ungleichheit erzeugen, und zwar einmal zwischen Marktakteuren und Nicht-Marktakteuren (siehe oben: Exklusion) 11 und zum anderen zwischen den Marktakteuren, weil durch Markthandlungen Machtungleichgewichte verstärkt werden. 2.3 Relevanz der neoklassischen Mikroökonomie für verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften „Anderes“ Wirtschaften erfordert anderes wirtschaftliches Verhalten Das Konstrukt der Mikroökonomie, die sich als Fundierung der Makroökonomie versteht, ist weder historisch noch logisch schlüssig. Es werden erstens, um das Funktionieren von Marktwirtschaften zu erklären, Verhaltensannahmen formuliert, die allenfalls empirische Sonderfälle sein können, nicht aber das gesellschaftliche und insbesondere wirtschaftliche Handeln im Allgemeinen abbilden. Die mikrotheoretische Wirtschaftswissenschaft erweist sich insbesondere dann als eine kapitalistische Marktwirtschaften verteidigende Ideologie, wo sie behauptet, autonomes, eigennütziges, rationales oder Konkurrenzverhalten seien natürliche Konstanten und damit menschliches Normalverhalten. Dies ist für Überlegungen zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Wirtschaften relevant, weil ein „anderes“ Wirtschaften auch ein anderes wirtschaftliches Verhalten erfordert. Sicher ist es richtig, dass sich in kapitalistischen Markwirtschaften sukzessive derartige Verhaltensweisen entwickeln und dass sie gleichsam zu einer Voraussetzung werden, wirtschaftlich erfolgreich zu sein – Länder, in denen sich kapitalistisch-marktwirtschaftliche Strukturen erst seit den späten 1980er Jahren durchgesetzt haben, zeigen diese Verhaltensänderungen bei den Menschen sehr eindringlich. Dennoch gilt dies nicht allgemeinverbindlich, denn auch in den Ländern, in denen liberale Kapitalismusformen vorherrschen, wie bspw. in den angelsächsischen Ländern, finden wir Altruismus, kooperatives und Gemeinschaftshandeln sowie ein hohes Maß an Irrationalitäten, und zwar durchaus auch in den wirtschaftlichen und nicht nur in den sozialen Nahbereichen. 12 Märkte stellen nicht unbedingt die beste Alternative dar Zweitens zeigen die kritischen Überlegungen zur Existenz von Märkten, dass die Wirtschaftswissenschaft weder historisch noch begrifflich oder logisch zum Ausdruck bringen kann, worüber sie redet. Unabhängig davon, dass in der herrschenden Volkswirtschaftslehre immer davon ausgegangen wird, dass Wirtschaften identisch ist mit Markwirtschaften und andere Organisations- und Allokationsformen nur Ausnahmen darstellen, muss konstatiert werden, dass eine sehr merkwürdige Auffassung darüber herrscht, was Märkte eigentlich sind und wie sie – nur unter sehr strengen, unrealistischen Verhaltens- und Strukturannahmen – dem Modell nach funktionieren. Bezieht man andere (zum Teil neuere) wissenschaftliche Überlegungen zur Historie, zum Begriff oder zur Logik von Märkten mit ein, so wird sehr deutlich, dass man es nicht dem Markt „überlassen“ kann, nachhaltige und verantwortungsvolle Verhaltensweisen sowie entsprechende Strukturen zu entwickeln. Es zeigt sich vielmehr, dass sich letztlich nur wenige Güter und Dienstleistungen für eine marktwirtschaftliche Organisation und Allokation eignen, wenn man Verantwortung und Nachhaltigkeit als Zielgröße nimmt. Mitnichten ist es aber im Gegensatz zur marktwirtschaftlichen Ordnung unbedingt angezeigt, Güter und Dienstleistungen nun einer politischen Organisation und Allokation zu überlassen – auch hier hat die Historie gezeigt, dass dies nur für sehr wenige, sog. „Öffentliche Güter“ zielführend ist. Folglich ist es notwendig, andere Organisations- und Allokationsformen, wie etwa das gemeinschaftliche Entscheiden von BürgerInnen über Commons, in Betracht zu ziehen. Dass dies nicht nur logisch denkbare, sondern empirisch bereits erprobte Formen des Wirtschaftens sein können, hat sich in den letzten Jahren gezeigt – und somit sollten die Diskussionen um verantwortungsvolles nachhaltiges Wirtschaften offen sein für solche Überlegungen. Dies ist auch deshalb notwendig, weil makroökonomische Analysen (und auch die Empirie!) zeigen, dass kapitalistische 13 Markwirtschaften nicht zu stabilen oder gar gleichgewichtigen Zuständen tendieren, sondern extrem krisenhaft sind. 2.4 Makroökonomische Grundlagen Im Folgenden werden makroökonomische Deutungs- und Erklärungsmuster skizziert, die sich auf das Zustandekommen gesamtwirtschaftlicher Größen sowie auf gesamtwirtschaftliche Prozesse beziehen; im Hinblick auf verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften sind insbesondere die inzwischen vielfältigen Debatten zur Bedeutung wirtschaftlichen Wachstums wichtig. Die Grundidee der Makroökonomie ist, dass sie es auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene mit Aggregatgrößen zu tun hat, also Größen, die sich wie oben erläutert aus den Nachfrage- und Angebotsplänen der Individuen bilden. Dabei stellen etwa die Möglichkeiten der Produktion einer Volkswirtschaft (darin eingebettet sind etwa technische oder andere Wissenspotenziale) sowie Konsum und Einkommen zentrale Parameter dar. Die schon erwähnte „unsichtbare Hand“ des sich selbst regulierenden Marktes gewährleistet eine Übereinstimmung von geplantem aggregierten Angebot und geplanter aggregierter Nachfrage. Im „Gleichgewicht“ werden alle wirtschaftlichen Interessen der Individuen und auch der Gesellschaft „bedient“, was bedeutet, dass es zu einer „bestmöglichen“ Bedürfnisbefriedigung und Güterversorgung kommt. Das BIP als Wohlstandsmaß Das Maß für die wirtschaftliche Entwicklung stellt das Bruttosozialprodukt (BSP) oder Bruttoinlandsprodukt (BIP) dar, das durch die sog. „Volkswirt14 schaftliche Gesamtrechnung“ (VGR) ermittelt wird: Sie ist eine gesamtwirtschaftliche Statistik, die das Wirtschaftsgeschehen einer bestimmten Periode quantitativ abbildet. Die VGR resultiert aus der kreislauftheoretischen Erkenntnis der Physiokraten (François Quesnay), wonach Ausgaben nicht nur einen Verbrauch darstellen, sondern an anderer Stelle als Einnahmen erscheinen, die wiederum Ausgaben ermöglichen. Waren die VGR bzw. das BIP und daraus abgeleitet das Wirtschaftswachstum bis in das frühe 20. Jahrhundert lediglich eine technische Größe zur Messung des Verbrauchs und zur Erstellung einer Übersicht über Einnahmen und Ausgaben sowie eine Planungsziffer, verselbständigt(e) sich das Wirtschaftswachstum zu einer ideologischen Größe: Heute bildet es die Grundlage des Vergleichs zwischen Wirtschaftszweigen, Regionen, Nationen usw. und es wird stilisiert zu einem Wohlstandsmaß, also gleichgesetzt mit dem Wohlergehen der Menschen. 2.4.1 Wachstumszwang und Wachstumsdrang Das makroökonomische Modell bekommt seine Dynamik durch die in der Mikroökonomie formulierten Verhaltens- und Strukturannahmen: Die Logik der Konkurrenz zwingt zu einzelwirtschaftlichen Strategien der Vorteilssuche. Sind die Erwartungen im Hinblick auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung positiv, so ist es sinnvoll, das Geschäftsfeld zu erweitern und zu investieren. Da anzunehmen ist, dass andere Unternehmen ähnlich denken und gleiches tun würden, kann nicht riskiert werden, eine als sinnvoll erachtete Investition zu unterlassen. Unternehmen müssen „bei Strafe des eigenen Untergangs“ (Karl Marx) investieren und versuchen, sich beständig auszudehnen. Der Umfang der Investitionen richtet sich nach den zu erwartenden Profiten – und umgekehrt: Es werden möglichst hohe Profite angestrebt, um bei Bedarf investieren zu können. Je höher die Akkumulationsrate, desto mehr Wachstum und desto besser die Ver15 wertung des eingesetzten Kapitals. Sofern für Investitionen fremdes Kapital eingesetzt wird (Bankkredite oder durch Gewährung von Teilhabe), ist nachvollziehbar, dass auch die Kapitalgeber eine Rendite erwarten. Man kann folglich von einem unmittelbar aus der Marktlogik folgenden „Wachstumszwang“ sprechen, der ergänzt wird durch einen „Wachstumsdrang“: Die Menschen selbst, ebenfalls geprägt durch diese Marklogik, erwarten einen immer höheren Konsum und eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Wachstumszwang und Wachstumsdrang sind systemimmanent (Hans Christoph Binswanger); sie begründen die enorme Dynamik und die Reichtumsproduktion dieser besonderen Wirtschaftsweise. Ein flankierendes zusätzliches Argument lautet, dass durch die Geldschöpfung der Banken (die durch eine „Kreditschöpfung“ möglich wird) eine „reale Wertschöpfung“ entsteht, was ein stetiges Wachstumspotential darstellt. Somit wird die verfügbare Geldmenge, welche eine bedeutsame Dimension des realisierbaren Wachstums ausmacht, nicht etwa von den Zentral- sondern von den Privatbanken gesteuert (eine Überlegung, die sich nicht nur bei Hans Christoph Binswanger, sondern bereits bei Irving Fisher in den 1930er Jahren findet). 2.4.2 Gesellschaftliche Folgen einzelwirtschaftlicher Logik Kapitalistische Marktwirtschaften stecken in einem grundlegenden Dilemma: Es mag ein Sachverhalt oder ein wirtschaftliches Handeln einzelwirtschaftlich – also aus der Sicht des autonomen Individuums – rational sein, die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft können aber sehr negativ sein. So werden etwa die oben skizzierten einzelwirtschaftlichen Wettbewerbsvorteile teilweise durch Investitionen in sogenannten „arbeitssparenden technischen Fortschritt“ erzeugt, was eine Steigerung der Arbeitsproduktivität bedeutet: Es können mehr Güter oder Dienstleistungen mit 16 einem gleichen Erwerbsarbeitsvolumen produziert werden oder es kann ein gleichbleibender Output mit einem geringeren Erwerbsarbeitsvolumen erzeugt werden. Wenn dabei das Wachstum der Wirtschaft zu gering ausfällt, bedeutet dies stagnierende oder gar sinkende Beschäftigung (je nach Höhe der „Beschäftigungsschwelle“). Folge dieses einzelwirtschaftlichen Strebens nach Wettbewerbsvorteilen durch Produktivitätssteigerungen ist auch in diesem Falle ein Wachstumszwang, weil Beschäftigungsverluste drohen. Um diesen gesamtwirtschaftlich unerwünschten Folgen von Produktivitätssteigerungen zu begegnen, versucht bspw. der Staat, eine eigene Wachstumspolitik zu betreiben (etwa durch ein „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“ (2009)). Eine andere Möglichkeit ist die Ausdehnung marktwirtschaftlicher Tätigkeiten entweder durch Erweiterung der Märkte in andere Länder hinein (Tendenz zur Globalisierung) oder durch die Vermarktlichung von immer mehr Gütern und Dienstleistungen. So werden etwa Tätigkeitsfelder, die zuvor in den Haushalten erbracht wurden, in das Marktgeschehen integriert. Sie werden zu Waren. Beispiel: Wirtschaftskrise - Zyklen Ein weiteres Beispiel: Wenn sich die Wirtschaft auf einem Wachstumspfad bewegt, dann bedeutet dies eine steigende Nachfrage, die wiederum weitere Investitionen interessant macht, weil höhere Gewinne erwartet werden können. Für jeden Einzelnen ist es rational zu investieren; gesamtwirtschaftlich steigt die Akkumulationsrate und auch die Einkommen, was ja durchaus erwünscht ist. In Wachstumsphasen ist es aber nicht nur interessant in die „reale“ Welt, also in Unternehmen zu investieren, sondern auch auf den Finanzmärkten. In der Folge steigen die Kurse und es werden Spekulationen attraktiv, also z.B. das Wetten auf weiterhin steigende Kurse. Wenn nun eine kritische Menge von Investoren ihr Geld abzieht (auf andere Finanzmärkte geht oder um Gewinne zu realisieren usw.) oder 17 Spekulationen gegen einen weiteren Aufschwung zunehmen – dann bricht das System (bekanntlich) zusammen und es kommt zu einer Wirtschaftsund/ oder Finanzkrise. Derartige Krisen hat es immer gegeben (zur Erinnerung: „Tulpenkrise“ in den 1630er Jahren) und diese Prozesse sind der kapitalistischen Marktwirtschaft immanent. Kapitalistische Marktwirtschaften steuern nicht auf ein Gleichgewicht zu, sondern befinden sich permanent in einem Ungleichgewicht, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Diese zyklischen „Ausschläge“ sind nicht auf Fehlverhalten Einzelner oder Systemversagen zurückzuführen, sie sind logische Konsequenz systemkonformen Verhaltens und Funktionierens. Es sind also nicht (etwa die politischen) Eingriffe von außen, die Krisen verursachen, sondern das kapitalistisch-marktwirtschaftliche System selbst. 2.5 Kritische Einschätzung der neoklassischen Wachstumsorientierung 2.5.1 Die Studie des Club of Rome Die Debatten um die Bedeutung des Wirtschaftswachstums für Gesellschaft und (Mit-)Umwelt haben erst relativ spät eingesetzt. Der Beginn erster breiter Diskussionen kann in dem Jahr 1972 gesehen werden: Die Autoren Donella und Dennis L. Meadows sowie deren Mitarbeiter des Jay W. Forresters Instituts für Systemdynamik veröffentlichten die Studie des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ (The Limits to Growth) zur Zukunft der Weltwirtschaft. Mit einem systemanalytischen Ansatz und Computersimulationen wurden verschiedene Szenarien entwickelt, die darstellen, wie sich Gesellschaften zukünftig entwickeln, wenn das Wachstum der Weltbevölkerung und Industrialisierungsprozesse, die zu einer 18 Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen und Umweltverschmutzung führen, unverändert anhalten: Es spricht vieles dafür, dass der Verbrauch natürlicher Ressourcen und die Belastung der Umwelt größer sind als die Erde in der Lage ist, sich zu regenerieren. Prognostiziert wurde das Erreichen von absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre. Vor diesem Hintergrund setzte eine breite ökologische Debatte um Ressourcenverbrauch und Umweltbelastungen ein, die bis heute anhält. Inzwischen spricht man von „planetarischen“ Grenzen des Wachstums oder auch zugespitzt von „Peak Everything“. Folgen des ungebremsten Wirtschaftswachstums für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, soziales Kapital oder im Hinblick auf soziale Gerechtigkeit wurden erst später diskutiert. So besagt etwa das Sozialargument, dass ab einem bestimmten Niveau Wirtschaftswachstum nicht zu einem Zuwachs an Lebenszufriedenheit führt – im Gegenteil: Es wird argumentiert, dass die sozialen Kosten (insbes. durch soziale Probleme, soziale Ungleichheit, soziale Unsicherheit – etwa in Form psychosozialer Erkrankungen) zunehmen und damit die Anforderungen an die sozialen Sicherungssysteme steigen, was wiederum die nationalen Haushalte belastet. Auch das logische Argument, das besagt, dass es immer höhere absolute Zuwächse erfordert, um ein gleichbleibende prozentuales Wachstum zu erzielen, wurde später formuliert: Hohe absolute Zuwächse können in entwickelten, frühindustrialisierten Ländern kaum mehr erwirtschaftet werden, weshalb der prozentuale Zuwachs – das Wirtschaftswachstum – immer geringer wird. Man kann dies gut in den spätindustrialisierten Ländern, wie etwa der VR China oder in Brasilien beobachten, deren Wachstumsraten bei über 10% lagen, was bei einem geringeren Ausgangsniveau relativ leicht zu erzielen ist. Steigt jedoch der Sockel, auf dem 10% Wachstum erfolgen sollen, steigt damit jährlich auch die absolute Größe. 19 Wichtig ist zu notieren, dass es in der etablierten akademischen Volkswirtschaft (schon gar nicht in der Betriebswirtschaft) kaum Reaktionen auf die Club of Rome-Studie gab. 2.5.2 Aktuelle Diskussionen zur Beschränkung des Wachstums In den Diskussionen um eine Beschränkung des Wachstums werden derzeit unterschiedliche Strategien diskutiert. Entkopplungsstrategie Die Entkopplungsstrategie vertraut darauf, dass man zukünftig über technische Neuerungen verfügt, die ein Wachstum ohne zusätzlichen Ressourcenverbrauch oder zusätzliche Belastungen ermöglichen. Ein Gegenargument dazu ist ein soziales, es lautet: Es geht nicht um die Existenz neuer Techniken, sondern es kommt auf die Verwendung von Techniken an, die sich bei Effizienzsteigerungen verändern, was, wie die Energieökonomie zeigt, wiederum zu „Reboundeffekten“ führen kann: Ein geringerer Verbrauch von Energie im Mobilitätssektor führt zu einer Ausdehnung der Mobilität (ein Haushalt hat nun zwei Autos); eine neue Kühltruhe wird aus Effizienzgründen gekauft, die alte wird im Partykeller weiter betrieben; der Röhrenfernseher wird entsorgt und durch zwei Flachbildschirme ersetzt usw. Ist der Reboundeffekt über 100%, d.h. wenn mehr Energie als zuvor verbraucht wird, spricht man von Backfire. So ist etwa die Energiebilanz bei Biogasanlagen ebenfalls negativ, weil entweder hier oder in anderen Weltregionen Anbauflächen für andere Lebensmittel knapp werden und sich verteuern. Eine Entkopplung wäre allenfalls denkbar bei sozialen Innovationen und bei gleichzeitigen Veränderungen der Konsummuster. 20 Mentalitätsstrategie Die Grundannahme der Mentalitätsstrategie (prominent: Meinhard Miegel) ist, dass der materielle Wohlstand die Einstellungen und Mentalitäten der Menschen verändert hat. Erst daraus resultieren, so die Argumentation, stetige Konsumsteigerung aus Gewohnheit, Eitelkeit, Selbstdarstellung, Konkurrenz – und all dies erfordert immer mehr Wachstum. Notwendig seien eine Mentalitätsänderung (Mäßigung, Nutzungsintensivierung, Entkopplung von Moden usw.) und eine radikale Veränderung der Konsummuster. Resilienzstrategie Ausgangsüberlegung der Resilienzstrategie ist, dass alle ökologischen Maßnahmen bereits zu spät kommen, um die gravierenden Folgen etwa der Erderwärmung zu verhindern. Notwendig seien deshalb eine Steigerung der individuellen und gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit und die Entwicklung neuer Resilienzmuster. Dies kann Verzicht bedeuten (als „Befreiung von Überflüssigem“ (Nico Paech)) oder es müssen Maßnahmen zur Verlängerung der Nutzungsdauer ergriffen werden („Repair-Cafe“ usw.); es kann auch heißen, Tausch oder Teilen (Car-Sharing) zu fördern sowie Subsistenz- und Eigenarbeit zu stärken. Dazu braucht es eine Änderung gesetzlicher Regelungen, z.B. im Hinblick auf geplante Obsoleszenz (bei der Herstellung werden technische Schwachstellen eingebaut um die Nutzungsdauer künstlich zu verkürzen). Resilienzstrategien erfordern nicht nur individuelle, sondern insbesondere auch gesellschaftliche Einsichten, also kollektive Lernprozesse, die wiederum kaum steuerbar sind. Transparenzstrategie Die Überlegungen im Rahmen der Transparenzstrategie gehen dahin, dass die „wirklichen“ sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Kosten des 21 Wachstums bzw. der marktwirtschaftlichen Entwicklung sichtbar und transparent gemacht werden müssen. Auf gesellschaftlicher Ebene bedeutet dies, die Entwicklung „neuer“ Kriterien, Indices usw., um Wohlstand oder gesellschaftliche Entwicklung oder weiter gehend Lebenszufriedenheit (GNH, Gross National Happiness) zu messen. Auf unternehmerischer Ebene bedeutet dies eine transparente Analyse und Bewertung (Bilanzierung) aller Dimensionen unternehmerischen Handelns (z.B. Triple Bottom Line) sowie die Entwicklung entsprechender Kriterien (z.B. Entwicklung von ISO-Normen, Kriterien der Gemeinwohlökonomie usw.). Erwartet wird, dass die „Erkenntnisse“ aus diesen Analysen zu einem Umsteuern und Verhaltensänderungen führen. Wichtig bei den Überlegungen zu unterschiedlichen Strategien verantwortlichen und nachhaltigen Wirtschaftens ist eine offene, unvoreingenommene Debatte um die notwendige „Eingriffstiefe“: Es gilt zu klären, was systemimmanent und ohne grundlegende Änderungen kapitalistischmarktwirtschaftlicher Strukturen funktionieren würde oder welche systemtransformierenden Maßnahmen notwendig wären. Im ersten Fall würde es sich um eher „oberflächliche“ Maßnahmen handeln (die aber durchaus langfristig systemtransformierend sein könnten); im zweiten Fall bräuchte es radikalere Umbrüche und/ oder kollektive Lernprozesse (deren gesellschaftlicher Ausgang unsicher wäre). 2.6 Impulse durch neue Ansätze zu verantwortlichem und nachhaltigem Wirtschaften Erste wachstumskritische Ansätze hatten einen dualwirtschaftlichen Charakter Nur wenige Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler entwickelten in den 1980er und folgenden Jahren auf der Grundlage des Berichts des Club of 22 Rome „alternative“ Ansätze. Erste solche Überlegungen bündelten sich zu dualwirtschaftlich orientieren Konzepten (prominent in Deutschland: Joseph Huber, und in Frankreich: André Gorz): Dualwirtschaft beschreibt die Möglichkeit der Entwicklung einer selbstorganisierten „Alternativökonomie“ neben der Waren produzierenden kapitalistischen Marktwirtschaft. Diese Alternativökonomie kenne zwar auch Lohnarbeit, sei jedoch bedarfs(nicht profit-)orientiert und selbstverwaltet. Interessant ist, dass sich diese Diskussionen weitestgehend neben den sich schnell etablierenden, inzwischen weltweit geführten Debatten um „ökologische Nachhaltigkeit“ entwickelten (1992 Rio – Agenda 21, 2001 Weltsozialforum Porto Alegre, 2002 World Summit Johannesburg, 2005 UN Dekade Nachhaltige Bildung); und sie nahmen auch eine besondere Richtung: Sie mündeten in Diskussionen um die „Zukunft der Arbeit“ (in Deutschland geführt von Ulrich Beck, in den USA von Jeremy Rifkin), der Entwicklung des Dritten Sektors sowie der Eigen- und Bürgerarbeit – die überwiegend von Sozial-, nicht jedoch von Wirtschaftswissenschaftlern geführt wurden. Dies ist ein Grund, warum bis in die 2000er Jahre hinein keine theoretisch gesättigte, grundsätzliche Kritik an der kapitalistischen Marktwirtschaft herausgearbeitet wurde und sich auch keine Diskussionen um verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften entwickelten. Die Wachstumskritik des Club of Rome wurde erst wieder in den letzten 20 Jahren aufgegriffen und in unterschiedliche Überlegungen zu einem verantwortlichen und nachhaltigen Wirtschaften integriert. 2.6.1 Erweiterungen zum Ansatz der Dualwirtschaft: Solidarische/ Lokale Ökonomie/ Social Business Mit unterschiedlichen Akzenten fand der Ansatz der Dualwirtschaft eine Erweiterung im Hinblick auf eine solidarische oder lokale Ökonomie (für 23 Deutschland bspw.: Elmar Altvater, Karl Birkhölzer, Burghard Flieger, Tilo Klöck); auch der Ansatz des Social Business (Muhammad Yunus) kann dazu gezählt werden. Die Begrifflichkeiten werden leider – auch von vielen Autoren dieser Richtung – nicht präzise gebraucht. Im Deutschen wird selten zwischen solidarischer und lokaler Ökonomie unterschieden, und in der englischsprachigen Literatur bereitet die Abgrenzung zwischen "solidarity" und "social" Schwierigkeiten. Solidarische Zielsetzung und Stärkung der lokalen ökonomischen Struktur Allgemein kann gesagt werden, dass zu dieser Gruppe alle Ansätze zählen, die wirtschaftliches Handeln und wirtschaftliche Strukturen mit einer sozialen Zielsetzung verknüpfen, die auf ein solidarisches Handeln, solidarische Organisationsformen (Genossenschaften) oder Maßnahmen zur Stärkung der lokalen/ regionalen ökonomischen Struktur zielen (dazu gehören auch die Lokal- oder Regionalwährungen, die sich vereinzelt durchgesetzt haben; theoretisch begründet insbesondere von Margit Kennedy). Allen Ansätzen ist gemeinsam, dass sie globalisierungskritisch sind (und deshalb das Gemeinwesen im Auge haben) und ein kooperatives wirtschaftliches Verhalten von Einzelpersonen oder Unternehmen neben der dominanten privat-kapitalistischen Wirtschaftsform für möglich halten; auch die Unternehmensorganisation wird dabei kritisch hinterfragt und es werden Vorschläge zu einer weiteren Entwicklung des Genossenschaftswesens (Susanne Elsen) oder von Stiftungen gemacht. Gemeinwesenökonomie und gesellschaftliche und ökonomische Integration Die weitergehende Idee ist, dass in den Bereichen solidarischer und lokaler Ökonomien Absprachen notwendig sind, d.h. eine Kommunikation der Menschen darüber, was und wie sie produzieren und konsumieren. Wenn dies geschieht, sind die Menschen nicht nur in einem ökonomischen Sinne wirtschaftliche Akteure, sondern WirtschaftsbürgerInnen, die über die rein 24 ökonomischen Prozesse hinaus eine soziale Beziehung zueinander haben und am Gemeinwesen teilhaben. Im besten Fall dient dies der sozialen Integration und dem sozialen Zusammenhalt, und damit weisen die meisten Ansätze zu einer solidarischen und lokalen Ökonomie auch einen Gemeinwesenaspekt auf: In den Bereichen, in denen Markt und Staat dabei „versagen“, gesellschaftliche und ökonomische Integration zu gewährleisten, beginnen die Überlegungen zu einer Gemeinwesenökonomie. Diskussionen um „Commons“ Diese Überlegungen wiederum verweisen oft auf die sehr alten Diskussionen um die sog. „Commons“ bzw. Gemeingüter (im streng ökonomischen Sinne vergleichbar mit „Öffentlichen Gütern“; siehe die mit dem Nobelpreis (2009) ausgezeichnete Elinor Ostrom aus den USA und verbreitet in Deutschland insbesondere von Silke Helfrich). Die aktuellen Diskussionen beziehen sich auf die bis zur frühen Industrialisierung vorhandenen „Allmenden“ (All+Gemeinde), die einen gemeinschaftlichen Zugang zu sowie Kontrolle und Nutzung von Gütern und Dienstleistungen institutionalisierten. In genau diesem Sinne sei es denkbar, so die VertreterInnen der Commons-Idee, weitere Bereiche aus Natur, Gesellschaft und Kultur mit einzubeziehen. Genannt werden zunächst alle für das menschliche Leben wichtigen natürlichen Ressourcen, aber auch öffentlich verfügbare Güter (Spielplätze, Museen) und Immaterielles wie kulturelle Bräuche und Wissen (aktuelle Beispiele: Urheberschutz, Copyleft-Prinzip usw.). In diesem Sinne sind Commons überall oder wissenschaftlich präziser formuliert: Eine Vielzahl von Gütern und Dienstleistungen ließen sich als Commons organisieren. Tragik der Allmende VertreterInnen dieses Ansatzes müssen sich mit einer fundamentalen Kritik neoklassischer Denkweise auseinandersetzen: Wenn ein Gut frei ver25 fügbar ist, dann wird ein rational handelndes Individuum zum Zwecke der Nutzenmaximierung immer mehr davon nehmen, als es den eigentlichen Bedürfnissen entspricht bzw. diesem Individuum „zusteht“ (Tragik der Allmende). Diese Argumentation ist leicht instrumentalisierbar um Gemeinschaftseigentum abzulehnen bzw. die Sinnhaftigkeit von Privatisierungsprozessen zu begründen. Die Gegenargumente wiederum lauten, dass es nicht um „herrenloses Niemandsland“ gehe, sondern um geregelten Umgang mit Gemeinschaftseigentum. Notwendigkeit eines Gemeinschaftsgütermanagements und neuer Koordinierungs- und Steuerungsformen Damit ist man in den Debatten aber bei einem entscheidenden Punkt, mit dem sich auch die Forschungen von Elinor Ostrom beschäftigt hat: Während der Markt durch die „unsichtbare Hand“ und der Staat (im besten Fall) mit demokratischen, kompromissorientierten Abstimmungsverfahren eine Allokation von Gütern und Dienstleistungen gewährleistet, so sind dies im Falle der Commons konsensorientierte Diskursverfahren, die Regeln des Zugangs sowie der Kontrolle und Nutzung von Gemeinschaftseigentum erzeugen. Es sind weder der homo oeconomicus noch der homo politicus, sondern die Figur des homo civicus, die handlungsleitend ist. Auch Commons erfordern einen sozialen Prozess des Sichverständigens über Art der Zugänge, Notwendigkeiten der Regulierungen und der Nutzungsformen, es braucht also ein sog. „Commoning“. Bei diesen Aushandlungsprozessen müssen zwingend lokale/ regionale Bedingungen beachtet werden und es geht um die Besonderheiten der Güter und Dienstleistungen selbst: Sind sie knapp? Müssen Nutzung oder Teilhabe einen Preis haben? Wie effizient und stabil kann eine Teilhabegemeinschaft sein, gibt es dafür eine kritische Größe? Wie werden kooperatives Handeln und Reziprozität organisiert? Wer ist für welche Bereiche in welcher Hinsicht verantwortlich? Bislang gibt es wenig Erfahrungen mit 26 einem Gemeinschaftsgütermanagement, weil die Organisation von Produktion und Konsum immer nur in der Dichotomie „Markt oder Staat“ gedacht wurde und die Institution Gesellschaft, die BürgerInnen selbst, nicht berücksichtigt wurden – bis heute taucht eine solche Alternative in keinem ökonomischen Lehrbuch auf. Die Praxis ist hingegen fortschrittlicher, zum Beispiel, wenn BürgerInnen die lokale/ regionale Ressourcenversorgung von privaten Unternehmen zurückkaufen und in eigener Regie betreiben oder Wissensverwendung bspw. über das Internet als ein Sharing von gesellschaftlichen Ressourcen begriffen wird. Ob diese vielfältigen Versuche in der Praxis gelingen, wird davon abhängen, ob sich mit der Zeit sinnvolle, treuhänderische Koordinierungs- und Steuerungsformen entwickeln (siehe dazu weiter unten, Teil 3). Potenziale und Gefahren der Sharing Economy Die Sharing Economy ist zwar verwandt mit der Idee der Gemeinwesenökonomie oder dem Commonsgedanken, ist aber nicht identisch. Gemeinsam ist diesen Ansätzen die Vorstellung, dass die Nutzung von Gütern und Dienstleistungen eigentumsunabhängig geschehen kann (so z.B. die Idee von Jeremy Rifkin). Es sind jedoch eine Reihe unterschiedlicher Überlegungen, die den Konzepten zugrunde liegen. So hat etwa Martin Weitzmann schon in den 1980er Jahren darauf hingewiesen, dass mehrfache Nutzung effizienter und dem Wohlstand förderlich ist – hier handelt es sich also um einen ökonomischen, nicht um einen solidarischen Zugang. Dann kommt es noch entscheidend darauf an, wie Güter und Dienstleistungen mit den betreffenden Personen in Verbindung miteinander stehen: Teilt eine Privatperson ihre Wohnung mit einer anderen Privatperson, dann sind es zwei Privateigentümer, die eine Sache teilen und dies hat mit einem kooperativen, gemeinschaftlichen Gedanken nichts zu tun – es geht um eine Minimierung der Kosten, nicht um eine gesellschaftliche Veränderung. Wenn 27 dazwischen eine Internet-Plattform geschaltet wird, hat eine weitere Person einen Nutzen, nämlich die Plattform-Betreiber, die selbst nicht einmal Besitzer einer Sache sein müssen (Plattform-Kapitalismus, siehe Uber, Couch-Surfing, Airbnb). Hier entwickelt sich eine neue digitalisierte Ökonomie, die im Gewand des alten marktwirtschaftlichen Kapitalismus daherkommt und sich gleichzeitig den rahmenden Regeln einer Marktgesellschaft entzieht (Besteuerung, Versicherung, Mindeststandards usw.). Damit hat sich ein immer größer werdendes kommerzielles Segment des Teilens und Mit-Nutzens entwickelt, was mit der ursprünglichen kooperativen, Ressourcen schonenden oder sozialintegrativen Idee nichts zu tun hat – im Gegenteil: Viele sehen schon eine „Totalkommerzialisierung“ unterschiedlichster Lebensbereiche und ein Verdrängen der ursprünglichen Ideen der Gemeinwesenökonomie und der Commons. Mit dieser Entwicklung wird im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften aber auch deutlich, dass es gar nicht primär um das Teilen bzw. gemeinschaftliches Nutzen von Gütern und Dienstleistungen geht, sondern immer noch um die Frage nach der Organisation wirtschaftlichen Handelns und wirtschaftlicher Strukturen sowie einer Kultur des Wirtschaftens. Sofern die zu teilenden bzw. gemeinschaftlich zu nutzenden Güter und Dienstleistungen in Privat- und nicht im Gemeinschaftseigentum sind, wird sich nichts daran ändern, dass das Profit-/ Nutzenmotiv die Handlungsweisen steuert; solange der Markt solche privaten Güter und Dienstleistungen alloziiert, wird sich die Handlungsfigur des homo oeconomicus nicht „zivilisieren“ lassen. Nur eine Sharing Economy, die zugleich eine Collaborative Economy und Community Economy ist, wird im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften neue Akzente setzen. Social Business Das Modell des Social Business (Yunus 2010) hat sich aus Projekten der Vergabe von Mikrokrediten an mittellose Personen in ländlichen Regionen 28 Indiens entwickelt. Mit Hilfe von Mikrokrediten konnten sich diese Menschen eine eigenständige Lebensgrundlage schaffen. Das Modell bezieht sich auf die Gerechtigkeitstheorie von Amartya Sen und fordert eine strikte Bedarfsorientierung und soziale Ausrichtung wirtschaftlichen Handelns. 2.6.2 Reproduktionsökonomie/ Feministische Ökonomie/ Care Ökonomie/ Haushaltsökonomie Nicht-monetäre informelle Arbeit als produktiver Faktor Auch die Ansätze zu einer Reproduktionsökonomie / Feministische Ökonomie/ Care Ökonomie/ Haushaltsökonomie (prominent in Deutschland: Adelheid Biesecker, Netzwerk vorsorgendes Wirtschaften) bleiben im Denkrahmen der Dualwirtschaft. Die meisten Ansätze entstammen der Arbeitssoziologie und hier vor allem Überlegungen, die darauf hinweisen, dass auch reproduktive Arbeit, die nicht monetär vergütet wird, wirtschaftlich produktiv ist und für die Lebensqualität der Menschen mit entscheidend ist. Aus diesem Blickwinkel wird die Art und Weise, wie heute gesamtgesellschaftliche wirtschaftliche Entwicklung gemessen wird (nämlich in Form des Bruttosozialprodukts), kritisiert. Das Bruttosozialprodukt misst bekanntlich nur einen Teil des gesellschaftlich relevanten wirtschaftlichen Handelns. Aber auch Reproduktionsarbeiten stellen wirtschaftliches Handeln dar. Dies wird in dem neuerlich sehr häufig diskutierten Konzept der „Pluralen Ökonomie“ aufgegriffen, die grundsätzlich unterschiedliche Formen wirtschaftlichen Handelns – auch jenseits des Marktes – berücksichtigt wissen will. 29 Bürgerschaftliches Engagement, Eigenarbeit, ver- und vorsorgendes (reproduktives) Arbeiten In der Arbeitssoziologie wurden schon in den 1980er Jahren diese Überlegungen weiter differenziert. Es galt nicht mehr nur die „zwei Gesichter der Arbeit“ (Joseph Huber) im Blick zu haben, sondern „das Ganze der Arbeit“ (Adelheid Biesecker): bürgerschaftliches Engagement, Eigenarbeit, verund vorsorgendes (reproduktives) Arbeiten. Überschneidungen dieser Arbeitsformen wurden als „Mischarbeit“ bezeichnet (Sebastian Brandl, Eckart Hildebrandt), das spannungsreiche Verhältnis dieser Arbeiten zu der Erwerbsarbeit als „Triade der Arbeit“ (Gerd Mutz). Die genannten Autoren haben ihre theoretischen Ansätze schon damals – noch unsystematisch – mit Überlegungen zu einer sozialen bzw. wirtschaftlichen Nachhaltigkeit verknüpft. 2.6.3 Ansätze zu einer ökologischen Ökonomie Überlegungen zu einer umweltbezogenen oder die Umwelt berücksichtigenden Ökonomie haben bereits in den 1980er Jahren eingesetzt. Sie sind im Hinblick auf Zielsetzung und Methodik äußerst heterogen; zudem kommen die VertreterInnen dieser Richtung aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen und sind je nachdem eher politisch, soziologisch, wirtschaftlich oder technisch-naturwissenschaftlich ausgerichtet (siehe bspw. Holger Rogall). Sehr hilfreich ist eine Publikation von Frank Adler und Ulrich Schatschneider aus dem Jahr 2010, die einen sehr guten Überblick über die unterschiedlichen Ansätze gibt und versucht, das diffuse Feld zu strukturieren. 30 Strukturierung der Umweltökonomie notwendig Demnach ließen sich drei große Richtungen unterscheiden: eine Ökologische Ökonomie mit einem fundamentalen Systemwechsel, mit einer Modernisierung im System und einem Phasenwechsel mit offenem Ausgang. Den Überlegungen, die mit einem fundamentalen Systemwechsel verknüpft sind, ist gemeinsam, dass sie das heutige Wirtschaftssystem als unfähig ansehen, die von ihr verursachten ökologischen Krisen zu bewältigen. Demnach müsse das System des Wirtschaftens grundlegend verändert werden. Ansätze, die eine Modernisierung im System erfordern, gehen davon aus, dass ökologische Probleme innerhalb des kapitalistischmarktwirtschaftlichen Systems gelöst werden können. Zu dieser Gruppe gehört prominent der Green New Deal, aber auch die oben bereits erwähnten Ansätze zu einer Green Economy oder einer ökosozialen Marktwirtschaft, die in den derzeitigen politischen Diskussion immer mehr an Bedeutung gewinnen. Nach Ansicht der VertreterInnen dieser Richtung liegt der Schlüssel für die Lösung ökologischer Probleme auf technologischen Neuerungen und Innovationen. Bei den Modellen des „Phasenwechsels mit offenem Ausgang“ gehe es um einen grundlegenden Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse; diese Veränderungen sollten demnach tief greifend sein und das gesamte System der Gesellschaft und der Wirtschaft umfassen, aber nicht so radikal sein wie etwa die bereits o.g. Postwachstumsansätze, die einen fundamentalen Systemwechsel erfordern. 31 2.6.4 Living Economy/ Gemeinwohlökonomie/ Kooperative Ökonomie/ Humanomics/ Demokratische Bedarfswirtschaft Wirtschaftliches Handeln muss dem Gemeinwohl dienen In der Gruppe Living Economy, Gemeinwohlökonomie (derzeit prominent in der Öffentlichkeit: Christian Felber), kooperative Ökonomie, Humanomics (Uwe Jean Heuser) oder Demokratische Bedarfswirtschaft lassen sich die Überlegungen zusammenfassen, die davon ausgehen, dass wirtschaftliches Handeln dem Gemeinwohl der Menschen dienen müsse und dass ein solches Wirtschaften nicht etwa rationales und eigennutzorientiertes Handeln nach dem Leitbild des homo oeconomicus erfordert, sondern in hohem Maße Kooperation und Vertrauen („put people before profits“). Das heutige Wirtschaften sei demnach ein den menschlichen Bedürfnissen entgegengesetztes System, das dazu führe, dass die Menschen so handeln müssten, wie sie es eigentlich nicht wollten. Stattdessen könnte sich ein neues Wirtschaftssystem etwa an der Kooperation zwischen Unternehmen und Stakeholdern orientieren. Bedeutung der Verhaltensökonomie Ein interessanter Hintergrund dieser Überlegungen bildet die in den letzten Jahren sich verstärkt durchsetzende Verhaltensökonomie (auch Neuroökonomie), zu der inzwischen unzählige Publikationen entstanden sind (bspw. aktuell sehr beachtet: Dan Ariely). Gemeinsam ist den vielen VertreterInnen, dass sie das in den Wirtschaftswissenschaften vorherrschende Leitbild des homo oeconomicus in Frage stellen; betont wird vielmehr, dass auch Gefühle (Angst, Vertrauen, Gier usw.), Irrationalitäten oder das Verhalten anderer bei einer wirtschaftlichen Entscheidung eine große Rolle spielen. Viele Ansätze der Verhaltensökonomie kommen aus dem Bereich der experimentellen Psychologie, die etwa mit spieltheoretischer Methodik 32 nachweisen kann, dass den Menschen in vielen Fällen ein kooperatives Verhalten näher liegt als ein konkurrierendes. Suche nach normativ–ethischen Grundlagen für „nachhaltiges Wirtschaften“ Viele der hier in diesem Kapitel vorgestellten Überlegungen zu einer „alternativen Ökonomie“ oder zu einem nachhaltigen Wirtschaften sind diffus und sich überlappend, und sie beschäftigen sich oft nur mit Ausschnitten wirtschaftlichen Handelns oder mit einem Teil wirtschaftlicher Strukturen. Diese Unübersichtlichkeit ist aber vielleicht kein Mangel, sondern bezeichnet eine Chance, wirtschaftliches Handeln und wirtschaftliche Strukturen aus verschiedenen Perspektiven und inter- bzw. transdisziplinär zu betrachten – was ja gerade die Kritiker einer „autistischen Ökonomie“ einfordern. Ökonomisches Geschehen und gesellschaftliche Verflochtenheit mit der Ökonomie sind zu komplex geworden und die einfachen Antworten der herrschenden ökonomischen Wissenschaft sind schon zu lange zu simpel und oft schlicht: falsch. Gemeinsam ist all diesen Ansätzen eine Skepsis im Hinblick auf Funktionsweise und Folgen kapitalistischen Wirtschaftens sowie die Vermutung, dass diese Form der Marktwirtschaften dem gesellschaftlichen Zusammenhalt, der Teilhabe und der sozialen Gerechtigkeit nicht dienlich ist und dass die natürlichen Lebensgrundlagen in einer Weise beansprucht werden, dass sie sich nicht regenerieren können – und damit letztlich die Grundlage allen Wirtschaftens und Lebens abhandenkommt. „Alternativ“ökonomische Ansätze nachhaltigen Wirtschaften suchen – freilich aus unterschiedlichen Perspektiven und mit differenten Implikationen – nach anderen normativ-ethischen Begründungen für wirtschaftliches Handeln und erforschen wirtschaftliche Strukturen im Hinblick auf ihre Lebensdienlichkeit. Sie skizzieren eine ethisch-kulturelle Neuorientierung, indem sie das 33 (Markt-)Wirtschaften mit Prinzipien verknüpfen, die bislang nur außerhalb des Wirtschaftssystems verortet wurden (etwa: Gerechtigkeit, Solidarität oder Verantwortung usw.). Es ist insbesondere der Grad der Radikalität, in dem sich die Ansätze unterscheiden. Die wohl meisten Ansätze zu einem nachhaltigen Wirtschaften versuchen mit Vehemenz innerhalb des marktwirtschftlich kapitalistischen Systems – oder daneben – ein anderes, nachhaltiges Wirtschaften zu denken; andere sind der Ansicht, dass es sinnvoll ist, nach nicht-kapitalistischen Pfaden von Markwirtschaften zu suchen; und wiederum andere meinen, dass radikal auch die marktwirtschaftliche Entwicklung in Frage zu stellen ist. Das Thema nachhaltiges Wirtschaften erzwingt geradezu, grundsätzlich in Frage zu stellen, ob es nicht nur im Hinblick auf Ressourcennutzung und Folgen wirtschaftlichen Handelns, sondern auch im Hinblick auf die Bedürfnisse der Menschen andere Formen des Wirtschaftens braucht – wie tief greifend auch immer. Müssen alle Güter und Dienstleistungen als Waren über den Markt koordiniert werden? In wessen Eigentum befinden sich gesellschaftlich notwendige Ressourcen? usw. Derartige Themen wiederum führen zu Fragen gesellschaftlicher Steuerung und Regulierung – wirtschaftsethische und -soziologische Überlegungen können erste Antworten geben. 2.6.5 Postwachstumsökonomie/ Prosperity without Growth/ Glücksökonomie (Happiness Economics) Wirtschaftswachstum und Naturbelastung Die Problematik des Wirtschaftswachstums ist – über 30 Jahre nach dem Bericht des Club of Rome – inzwischen von der akademischen Wissenschaft aufgegriffen worden (prominent: Tim Jackson, und in Deutschland: 34 Meinhard Miegel oder Nico Paech). Eine Grundproblematik wird darin gesehen, dass kapitalistisches Wirtschaften in der derzeitigen Verfasstheit Wirtschaftswachstum braucht, um weiter zu bestehen; Wirtschaftswachstum bedeutet aber steigender Ressourcenverbrauch und mehr Belastung der natürlichen Umwelt. Eine andere Schwierigkeit wird darin gesehen, dass Wirtschaftswachstum nicht unbedingt einhergeht mit einem wachsenden Wohlstand oder einer höheren Lebenszufriedenheit. Diese Zusammenhänge haben auch außerhalb der Wissenschaften, nämlich in der Politik, Aufmerksamkeit gefunden und so wurde bspw. in Deutschland eine Enquete-Kommission "Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität" begründet um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Wirtschaftswachstums zu bemessen, ganzheitliche Wohlstands- oder Entwicklungsindikatoren zu entwickeln und Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung von Wachstum und Naturbelastung aufzuzeigen. Internationale Debatten nehmen zu Diese Kommission folgt internationalen Debatten, etwa einem Think Tank in Großbritannien (Redefining Prosperity Project der Sustainable Development Commission) oder der bekannten und hochrangig besetzten „Stiglitz Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress” (neben Joseph E. Stiglitz gehören dazu: Amartya Sen und JeanPaul Fitoussi). „Weiche“ Ansätze zur Wachstumsproblematik Die (negative) Bedeutung des Wirtschaftswachstums für das ökologische Umfeld und Lösungsmöglichkeiten werden unterschiedlich im Hinblick auf eine notwendige Reformtiefe diskutiert. Eine eher „weiche“ Variante von Ansätzen hält es für ausreichend, das Maß Bruttosozialprodukt um weitere neue Indices zu ergänzen oder einzelne Indices zu ersetzen (so bspw. die Kommission der Europäischen 35 Gemeinschaften). So wird etwa durch die Hereinnahme von Human- und Sozialindices versucht, einem Begriff von Wohlergehen oder Wohlstand als Maß für gesellschaftliche Entwicklung näherzukommen (Hans Diefenbacher, Roland Zieschank). In der Zwischenzeit sind neuartige Indices entwickelt worden, die jedoch kaum noch überschaubar oder systematisierbar sind: Sozialkapital-Index, Human Development Index, Umweltindex, Global Peace Index, Shadow Economy Index, Happy Planet Index, Human Development Index, Environmental Sustainability Index usw. In ökologischer Hinsicht ist sicher der „ökologische Fußabdruck“ eine Messung, die am weitesten geht und sehr umfassend ist. Technizistische Ansätze zur Wachstumsproblematik mittlerer Reichweite Vertreter eines nachhaltigen Wachstums, einer Green Economy, des Green New Deal oder einer ökosozialen Marktwirtschaft „glauben“ an die Möglichkeit, Wirtschaftswachstum und Naturzerstörung entkoppeln zu können (Entkopplungsansatz, siehe weiter unten, Kapitel 3). Die Idee ist, dass es ein Wirtschaftswachstum ohne Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen geben könnte. Man vertraut dabei überwiegend auf technische Entwicklungen, die bspw. Effizienzsteigerungen erlauben. Diskussionen zu einer Postwachstumsökonomie gehen am weitesten Die meisten Vertreter einer Postwachstumsökonomie plädieren für eine Form des nachhaltigen Wirtschaftens, die mit dem bisher erreichten Wohlstand auskommt oder diesen gar einschränkt. Kerngedanke ist, dass kapitalistisches Wirtschaften in der derzeitigen Form grundsätzlich in Frage zu stellen ist, bspw. im Hinblick auf Konsumismus, Gewinnstreben oder Dominanz der Privatökonomie. Im Zentrum stehen dabei Fragen wie: Welche Bereiche des Wirtschaftens sollten marktvermittelt sein und welche könnten nicht-marktvermittelt sein, was zu einem „Ausbremsen“ von Privatisierungsprozessen führen könnte; welches Wirtschaftshandeln lässt sich besser im Non-Profit-Sektor organisieren, welches sollte aus Effizienzgründen im For-Profit-Sektor verbleiben? 36 Die Rede ist etwa von einem Wandel zu einer „robusten Makroökonomie“ mit geringeren Arbeitszeiten und Produktivitätszuwächsen sowie einer größeren Bedeutung öffentlicher Güter (Tim Jackson) oder von der Notwendigkeit von Suffizienz und kulturellem Wandel, der Reduktion von Erwerbsarbeit und einem Mehr an Eigenarbeiten, der Entkommerzialisierung und De-Globalisierung sowie neuartigen Wertschöpfungsnetzen (Nico Paech). Außerdem geht es um eine gerechtere Verteilung des vorhandenen Wohlstands, was wiederum Potenziale „alternativen“ Wirtschaftens freisetzen würde. Hier verknüpfen sich die Überlegungen mit dem Social Business-Ansatz und den Gerechtigkeitsvorstellungen von Amartya Sen. Der Verzicht auf ständiges Wachstum und der Umbau des Wirtschaftssystems würde – so die Mehrzahl der AutorInnen – nicht nur den Ressourcenverbrauch und Emissionen reduzieren (so ja schon im Bericht des Club of Rome formuliert), sondern auch dazu beisteuern, Finanz- und Wirtschaftskrisen zu verhindern. 3. Wirtschaften aus wirtschaftssoziologischer Perspektive Reflexive Modernisierung und Systemtheorie Aus der soziologischen Wissenschaft sollen hier zwei theoretische Ansätze aus Deutschland herangezogen werden, die zur Erklärung von Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsprozessen relevant sind. Dies ist zum einen die Theorie der „Reflexiven Modernisierung“ oder "Zweiten Moderne“, die sich mit dem Namen des Münchner Soziologen Ulrich Beck verbindet, und zum anderen die soziologische Systemtheorie, die von dem Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann entwickelt wurde. Diese beiden Gesellschaftstheorien stehen, was ihre Ausgangsannahmen, Methodik und Aussagen anbelan37 gen, „gegeneinander“, aber auf den gesellschaftlichen Bereich der Wirtschaft angewandt, also wirtschaftssoziologisch rekapituliert, können sie an einigen Stellen zu ergänzenden Einsichten führen. 3.1 Wirtschaften in der Zweiten Moderne Was ist eine Zweite Moderne? Der Begriff der Zweiten Moderne erschließt sich mit dem Begriff der Ersten Moderne, womit die üblichen linear gedachten Modernisierungsprozesse gemeint sind: Aufklärung und Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, Herausbildung von Nationalstaaten und Großbürokratien, fordistisch geprägte wachstumsorientierte Industriegesellschaften, Aufbau wohlfahrtsstaatlicher Institutionen und eindeutige Links-Rechts-Koordinaten im politischen Sinne. Die Zweite Moderne ist demgegenüber mehr geprägt von den (ungewollten) Nebenfolgen moderner Entwicklungen (siehe oben in der Sprache der Wirtschaftswissenschaft: externe Effekte), die zum Motor der Entwicklung werden. Globalisierungsprozesse und digitale Techniken führen zu einer Auflösung bislang eindeutiger industriell geprägter Machtzentren (Pluralisierung) sowie zu einer Abnahme nationalstaatlicher Souveränität – zu Gunsten sub- und mikropolitischer Formen, die oft eine zivilgesellschaftliche Prägung aufweisen. Soziale Integration und sozialer Zusammenhalt sind gefährdet, weil sich Prekarisierungsprozesse durch den Abbau vor- und nachsorgender Sozialleistungen intensivieren. Schließlich kommt es zu einer Steigerung von Individualisierungsprozessen: Individuen sind mehr denn je gezwungen, ihre eigene Geschichte zu schreiben. Im Grunde ist die Zweite Moderne eine Radikalisierung der in der Ersten Moderne angelegten gesellschaftlichen Prozesse – jene wirken in gesteigerter Form und die Nebenfolgen bestimmen den weiteren Gang der Geschichte (positives Beispiel: Atomunfälle = Nebenwirkungen und Auslöser 38 für eine Politikveränderung). Die Zweite Moderne ist folglich Resultat einer reflexiven Wirkung der Ersten Moderne („Selbsttransformation“): Die Nebenfolgen der Ersten Moderne wirken dergestalt zurück, dass die Gemengelage unübersichtlich wird (Jürgen Habermas) und gesellschaftliche Vorgänge als „verworren“ erscheinen (Anthony Giddens). Je stärker die Wirkungen der Nebenfolgen, desto stärker die Erosion der gesellschaftlichen (und ökologischen!) Grundlagen von Modernisierungsprozessen. Die reflexive Moderne ist eben keine reflektierte Moderne, denn sie lernt nicht unbedingt aus den nicht intendierten Nebenfolgen. Im Folgenden gilt es, den Deutungsrahmen der Zweiten Moderne auf Fragen verantwortlichen und nachhaltigen wirtschaftlichen Handelns anzuwenden. Dazu werden im Hinblick auf unsere Thematik verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften zwei bedeutsame Dimensionen herausgegriffen: Zum ersten Globalisierungs- und Individualisierungsprozesse, zum zweiten Entgrenzungsprozesse zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. 3.1.1 Globalisierung und Individualisierung Ende des „Rheinischen Kapitalismus“ Mit dem Ende des (gemütlichen) „Rheinischen Kapitalismus“ (Michel Albert) kann man nicht mehr von einer relativ homogenen deutschen Wirtschaft sprechen, deren Macht darauf begründet ist, dass deutsche Unternehmen, Banken und Politik horizontal und vertikal tief miteinander verflochten sind. Der Sonderweg von deutscher Industrie, Banken und Politik mit allenfalls bilateralen Abkommen zwischen Nationalstaaten garantierte für lange Zeit eine enge, nationale Aufeinanderbezogenheit mit verlässlichen Gesetzgebungen und Regulierungen. Es gab im Sinne der Ersten Moderne Institutionen, die unhinterfragtes Wachstumsstreben honorierten und es ermöglichten, Nebenfolgen wirtschaftlichen Handelns relativ gut 39 abzuschätzen; soziale Verwerfungen wurden durch eine wachsende sozialstaatliche Verantwortung abgefedert. Globalisierung steigert die Unsicherheiten wirtschaftlicher Aktivitäten Inzwischen ist Deutschland vielmehr geprägt von wirtschaftlich starken mittelständischen und Großunternehmen, die relativ unabhängig von nationalen Verbindungen global agieren. Globale Orientierung meint, dass nationale politische Regulierungen zunehmend als Fesseln erscheinen und schließlich auf Druck der Wirtschaft sukzessive zurückgenommen werden (etwa seit Beginn der 2000er Jahre). Es beginnen die Jahrzehnte der Deregulierung und des Rückzug des Staats und zugleich der Privatisierung von immer mehr Lebensbereichen. Wirtschaftliche Globalisierung bedeutet, dass sich der Möglichkeitsraum für wirtschaftliche Aktivitäten vervielfacht und sich die Wirtschaftsbeziehungen in einer Weise intensivieren, dass die Abhängigkeiten zwischen den Wirtschafts- und anderen Akteuren in bislang unbekanntem Ausmaß steigen. Unternehmen stoßen in Weltregionen vor, in denen sie selten Institutionen vorfinden, die einen geregelten wirtschaftlichen Ablauf gewährleisten oder sie stoßen auf Institutionen, die ihre wirtschaftliche Absichten behindern. Die Folge ist, dass Gewissheiten und Verlässlichkeiten, die auf bisherige Erfahrung und Routinen gründen, an Bedeutung verlieren und die Risiken wirtschaftlichen Handelns steigen; dies begründet die besondere Form der Unsicherheiten wirtschaftlicher Aktivitäten im globalen Raum. Möglichkeit und Zwang zugleich Neue Märkte ermöglichen einerseits das immer wieder „Neuerfinden“ individueller Strategien zur Markterschließung und eigenständiger Wirtschaftsgestaltung. Andererseits müssen neue Märkte gegenüber Wettbewerbsgefährdungen „verteidigt“ werden und Unternehmen stehen unter dem ständigen Zwang, innovativ zu sein und auf das gesellschaftliche Um40 feld einzuwirken. Dies tun sie in der Weise, dass sie sich selbst eine wirtschaftliche, politische und soziale Umgebung für das eigene wirtschaftliche Handeln schaffen, d.h. Unternehmen passen sich nicht etwa den Gegebenheiten auf den neuen Märkten an, sondern sie selbst sind vielfach „institution builder“, also Institutionen schaffende Akteure. Dieser Prozess kann als wirtschaftliche Individualisierung bezeichnet werden. Diese Situation wird von vielen Unternehmen ausgenutzt, indem sie sich an neuen Standorten günstige Bedingungen der Ressourcennutzung verschaffen. Ökologischer Raubbau und unzumutbare ausbeuterische Arbeitsbedingungen sind oft die Folge und immer wieder werden solche Fälle bekannt. Andererseits können Unternehmen in individualisierten Wirtschaftszusammenhängen aber auch verantwortlich und nachhaltig mit dem gesellschaftlichen Umfeld umgehen und somit etwa die natürlichen und sozialen Potenziale einer Region fördern. Dies kann durch CSR- und Nachhaltigkeitsprogramme unterstützt werden – sie wären gleichsam eine Möglichkeiten schaffende Strategie Wirtschaftsbeziehungen und das gesellschaftliche Umfeld zu gestalten. Diskurswandel: Soziales und natürliches Kapital wird zunehmend auch von der Wirtschaft kommuniziert Wirtschaftliche Individualisierung hat wiederum zur Folge, dass Wirtschaft und Gesellschaft immer weniger als getrennte und voneinander (relativ) unabhängige gesellschaftliche Sphären gedacht werden können. Diese Diagnose manifestiert sich etwa durch einen Diskurswandel in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft im Hinblick auf die Verortung wirtschaftlichen und insbesondere unternehmerischen Handelns: Während sich die 1980er und 1990er Jahre dadurch charakterisieren lassen, dass die Wirtschaft und Unternehmen ihren Wirkungskreis jenseits und unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Umfeld sahen (Entbettung wirtschaftlichen Handelns; Richard Swedberg, Mark Granovetter 1992), gelangt nun wieder ins Be41 wusstsein, dass Gesellschaft und Natur die Voraussetzung für wirtschaftliches und unternehmerisches Handeln darstellen. Um es deutlich zu machen: Wirtschaftliches Handeln und wirtschaftliche Strukturen waren immer schon eingebettet in gesellschaftliche und natürliche Zusammenhänge (siehe oben), aber es gehörte lange Zeit zum Selbstbildnis von Wirtschaft und Unternehmen, sich selbst gemäß den (neo-)klassischen Modellen als souverän und autark zu modellieren – was auch der Grund war für die fortwährenden Forderungen an die Politik, gesetzliche „Fesseln“ zu lockern. „Subjektivierung der Wirtschaft“ und „Re-Entry der Natur“ Inzwischen spricht man in Wirtschaftskreisen immer häufiger von der Bedeutung sozialen und natürlichen Kapitals und darüber, wie notwendig es sei, dieses zu erhalten; dies scheint nicht nur aus ökologischen und sozialen Überlegungen heraus sinnvoll zu sein, sondern es wird auch einzelwirtschaftlich als rational betrachtet, auf eine Reproduktion dieser Kapitalien hinzuwirken. In der gleichen Weise, wie man von einem Prozess der „Subjektivierung von Arbeit“ sprechen kann (siehe etwa: Hildegard Maria Nickel, Manfred Moldaschl, G. Günter Voß), kann man von einer „Subjektivierung der Wirtschaft“ bzw. des wirtschaftlichen Handelns sprechen und von einem „Re-Entry der Natur“ in das wirtschaftliche Geschehen. Im Deutungsrahmen der Zweiten Moderne kann argumentiert werden, dass es sich bei den oben erwähnten Entbettungsdiskursen um typische Denkmuster bzw. Ideologien der Ersten Moderne handelt: Wirtschaftsakteure und Wirtschaftsprozesse werden als fortschrittlich bezeichnet, wenn sie der Wirtschaftstheorie möglichst nahe kommen. Auf die Spitze getrieben führt der Versuch, immer autonomer und unabhängiger zu werden, dazu, dass die Nebenfolgen der Nichtbeachtung des Sozialen und der Natur größer werden und sich dadurch die Zweite Moderne entwickelt. In der Zweiten Moderne werden das Soziale und die Natur und letztlich die Sub42 jektivität in einem neoliberalen Sinne „domestiziert“ (entlehnt: Gabriele Michalitsch). Die Erste Moderne entfesselte den homo oeconomicus, die Zweite Moderne domestiziert den homo politicus, homo socialis oder sogar den homo civicus, indem sie diese Figuren dem Verwertungskalkül des Kapitals subsumiert. Zumindest deuten Entgrenzungsprozesse, wie sie nachstehend beschrieben werden, und die zunehmenden Verantwortungsund Nachhaltigkeitsdiskurse auch in Wirtschaftskreisen darauf hin. 3.1.2 Entgrenzungsprozesse zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft Entgrenzung ist ein soziologischer Begriff, der zum Ausdruck bringt, dass sich bisherige gesellschaftliche Grenzen (graduell unterschiedlich) auflösen und sich Strukturen oder Ordnungen herausbilden, deren Bedeutung im Entstehungsprozess oft noch nicht klar erkennbar ist (Ulrich Beck, Christoph Lau). Entgrenzung ist ein relationaler Begriff Entgrenzung ist ein relationaler Begriff, der sich auf die Beziehung von (mindestens) zwei gesellschaftlichen Bereichen bezieht. Nur von der Entgrenzung der Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft zu sprechen, ohne den Bezugspunkt und eine (Wirk-)Richtung anzugeben, wäre deshalb ungenau. Entgrenzung der Wirtschaft Wenn im Folgenden Entgrenzung in dieser Form gedeutet wird, dann bezeichnet Entgrenzung der Wirtschaft eine Ausweitung der Warenförmigkeit auf Güter und Dienstleistungen, die bislang nicht der wirtschaftlichen Logik unterlagen. Entgrenzung wäre dann das „Übergreifen“ der ökonomischen Vernunft oder des ökonomischen Rationalitätsprinzips auf andere, 43 nichtwirtschaftliche Bereiche, etwa auf die Lebenswelt der Menschen oder auf die Politik. Negativ gedeutet kann gemeint sein, dass etwa freundschaftliche oder selbst familiäre Beziehungen durch ökonomische Deutungsmuster beeinflusst oder gar geprägt und auch überformt werden. Positiv interpretiert kann Entgrenzung auch ein Element wirtschaftlicher Verantwortung und Nachhaltigkeit sein: Wenn global agierende Unternehmen bspw. auf neuen Märkten auf die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen einwirken, dann beeinflussen wirtschaftliche Überlegungen, nämlich die Arbeitsfähigkeit der Menschen zu erhalten, das soziale Umfeld. Entgrenzung der Zivilgesellschaft Analog bezeichnet Entgrenzung der Zivilgesellschaft eine Ausweitung der bürgerschaftlichen Logik auf Sachverhalte und Bereiche, die bislang außerhalb des zivilgesellschaftlichen Denkens lagen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn zivilgesellschaftliche Akteure Kinderarbeit in sich entwickelnden Ländern skandalisieren und in dieser Weise zu einem wirtschaftlichen Thema machen, wodurch Unternehmen gezwungen werden, diesen Sachverhalt in ihrem betriebswirtschaftlichen Risk Management aufzunehmen. Reflexivwerden der Ersten Moderne Oft wird mit Entgrenzung nur eine Wirkrichtung beschrieben, es können jedoch auch wechselseitige Beziehungen entstehen, wenn etwa zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure einen wechselseitigen Dialog oder einen Runden Tisch vereinbaren – dann werden beidseitig Grenzen überschritten. In diesen Fällen kann von einem „Reflexivwerden“ der Ersten Moderne gesprochen werden, denn Unternehmen beziehen in dieser Weise mit ein, dass es zu nicht vorhersehbaren Nebenfolgen wirtschaftlichen Handelns 44 kommen könnte, die es gilt, durch die Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Akteuren reflexiv „einzuholen“, also in die eigenen Entscheidungen mit einzubeziehen. Dies kann, siehe oben, als Domestizierung gedeutet werden, es kann aber auch vorsichtig formuliert werden, dass im Hinblick auf das für die Wirtschaft so wichtige soziale und natürliche Kapital ein kollektiver Lernprozess stattgefunden hat, der zu einem reflexiven Umgang mit sozialen und natürlichen Ressourcen führt. Politik im Übergang von der Ersten zur Zweiten Moderne Während sich, wie hier bereits angedeutet, zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften durchaus neue Institutionen herausbilden, gilt dies für Politik und Staat nicht. Hier kann man eher die These von einer Begrenzung, aber nicht von einer Entgrenzung vertreten. Zwar scheinen Politik und Staat ihre Zuständigkeiten durch Gesetze und andere Regulierungen beständig auszudehnen; aber im Bereich verantwortlichen oder nachhaltigen Wirtschaftens sind (nicht nur in Deutschland) Politik und Staat bisher auffällig abstinent. Nationale Politik bzw. Nationalstaaten sind offensichtlich immer weniger gewillt und in der Lage, die durch kapitalistisch-marktwirtschaftliches Handeln produzierten Nebenfolgen („externe Effekte“, siehe oben) globalisierten Wirtschaftens zu bearbeiten oder gar Lösungen anzubieten. „Basisinstitutionen“ (Ulrich Beck) der industriegesellschaftlich geprägten Ersten Moderne wie der steuernde Nationalstaat (oder gar der Wohlfahrtsstaat), werden brüchig. Hier wären Analysen bedeutsam, die im Hinblick auf eine heraufziehende Zweite Moderne sagen könnten, welche Dimensionen alter Institutionen überdauern (Kontinuität) und welche neuen Institutionen entstehen (Wandel). Vorsichtig kann man vermuten, dass das „Basisprinzip“ Staatlichkeit sicherlich überdauern wird, aber angesichts sich zuspitzender sozialer und ökologischer Risiken einem enormen Veränderungsdruck ausge45 setzt ist (Institutionenkrise). Folge ist zunächst einmal, dass externe Effekte staatlicherseits immer weniger bearbeitet werden und dass sich zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft ein neues Feld auftut, auf dem sich die oben genannten Formen von Mikro- und Subpolitik weiter entfalten. Die Frage ist, wie sich Politik diesem Wandel der Staatlichkeit stellt: Denkbar ist das „Bastaprinzip“, sich nämlich vermeintlicher Kernzuständigkeiten zu erinnern und insbesondere auch gegen zivilgesellschaftliche Akteure Wirtschaftsinteressen durchzusetzen (so etwa bei TTIP); möglich wäre aber auch das zu tun, was wir in entwicklungspolitischen Arenen schon häufig vorfinden, sich nämlich als steuernden Staat zu verstehen und „einzuklinken“ in kooperative und partizipative Diskurse; Politik kann sich aber auch weiter zurückziehen und hoheitliche Zuständigkeiten und Regulierungen aufgeben, wie bspw. die nationale Gerichtsbarkeit bei Auseinandersetzungen mit internationalen Konzernen („Privatisierung des Rechts“). Fakt ist, dass im Globalisierungsprozess neue globale Verpflichtungsnetzwerke entstehen, die von den weltweit agierenden Unternehmen gesteuert werden; es sind aber auch dialogische Formen zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft entstanden, die im Hinblick auf verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften positiv gewirkt haben - gesellschaftliche Entgrenzungsprozesse könnten, wie oben skizziert, diesen Weg in eine Zweite Moderne begünstigen, wenn entsprechende kollektive Lernprozesse stattfinden und neue Kooperations- oder wenigstens Beteiligungsformen gefunden werden – mit oder ohne staatliche Beteiligung. 46 3.2 Systemtheoretischer Ansatz Skizze der soziologischen Systemtheorie Von der Systemtheorie (Niklas Luhmann) sollen hier, wie auch bei der Theorie Zweite Moderne, nur das Grundgerüst und einige Dimensionen skizziert werden, die für das Thema verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften relevant sind. Die Systemtheorie beschreibt Modernisierung als einen beständigen Ausdifferenzierungsprozess in Teilsysteme: Wirtschaft, Politik, Recht usw. Diese Teilsysteme funktionieren nach ihren jeweiligen Eigenlogiken (Autopoesis), sie steuern sich selbst nach eigenen Regeln und können deshalb als geschlossen bezeichnet werden. Sie sind zugleich aber auch offen, um „Schwingungen“ von außen (aus dem Gesamtsystem = „Umwelt“ der jeweiligen Teilsysteme) aufzunehmen und nach ihrer Logik zu verarbeiten (Resonanz- oder Reflexionsfähigkeit eines Systems). Teilsysteme können Themen also nur dann aufnehmen, wenn sie in ihre jeweilige Logik übersetzt werden können. So können etwa ökologische Gefährdungen nur dann vom Teilsystem Wirtschaft bearbeitet werden, wenn sie sich in Preisen ausdrücken lassen (siehe weiter oben), weil das Teilsystem Wirtschaft auf dieses Signal reagiert. So gesehen lässt sich eine hohe Übereinstimmung der soziologischen Systemtheorie mit den traditionellen Wirtschaftstheorien feststellen. Teilsysteme können sich nun im Modernisierungsprozess ausdifferenzieren, wenn die Anforderungen von außen die Komplexität des Systems übersteigen. Beispielhaft kann man von einer Ausdifferenzierung der Kapitalbeschaffung sprechen – Triebkräfte dieser Ausdifferenzierung waren Globalisierungsprozesse und eine extreme Liberalisierung der Kapitalmärkte (Deregulierungen), die die bisherigen Formen der Kapitalbeschaffung für Firmen durch Hausbanken obsolet machte. Das Teilsystem Wirtschaft konnte die neuen Anforderungen nicht mehr „bewältigen“. Folge 47 dieser Ausdifferenzierung sind neue Teilmärkte mit hochkomplexen Finanzprodukten und Finanzströmen (etwa Kapital-, Finanz-, Währungsmärkte), die wiederum nach eigenen Logiken funktionieren. Die Reflexionsfähigkeit des ökonomischen Systems ist eingeschränkt Im Hinblick auf verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften kann nun folgendermaßen argumentiert werden: Insbesondere unter globalen Bedingungen wird deutlich, dass das System Wirtschaft wegen erhöhter Komplexität die Fähigkeit verloren hat, seinen gesellschaftlichen Kontext (soziale und natürliche Umwelt) als Bedingung seiner Möglichkeit zu sehen. Die daraus resultierende Frage ist, wie die Reflexionsfähigkeit des ökonomischen Systems erhöht werden kann und wie sich dadurch Fähigkeiten zur Selbststeuerung entwickeln könnten. Der Anreiz, sich mit Verantwortungs- und Nachhaltigkeitsthemen zu beschäftigen, bestünde für das Teilsystem Wirtschaft also dann, wenn es Komplexität notwendigerweise reduzieren muss. Wenn man verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften mit der Diagnose verknüpft, dass derzeit Moral bzw. Ethik eine Renaissance erleben, so kann ihr enormer Bedeutungszuwachs nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Wirtschaft als eine Reaktion auf die (einseitige) Zunahme von (Markt-)Komplexität interpretiert werden. Die „Sinnressourcen“ Verantwortung und Nachhaltigkeit reduzieren Komplexität Die Ideen von Verantwortung und Nachhaltigkeit haben zweifellos einen moralischen Kern, weshalb sie durchaus als „Sinnressource“ bezeichnet werden können; im Hinblick auf die Frage der Implementierung von Moral – „Wie kommt die Moral in die Wirtschaft?“, siehe unten – sind Überlegungen zur Verfahrens- und Institutionenethik interessant. Hier kann festge48 halten werden, dass solche Sinnressourcen Komplexität reduzierende Wirkung entfalten könnten. Steuerungsmodi zur Selbststeuerung sind notwendig Nicht nur auf globaler Ebene würde dies wiederum Steuerungsmodi erfordern, welche die Selbststeuerung stärken. So könnte mit systemtheoretischen Überlegungen auch begründet werden, weshalb sich neben der (abnehmenden) politischen Kontextsteuerung durch staatliche Institutionen zunehmend Dialogformen entwickeln, bei denen zivilgesellschaftliche Organisationen eine herausragende Rolle spielen (etwa: MultistakeholderDialoge). Dies wiederum würde aber eine Form der Zivilisierung marktwirtschaftlicher und unternehmerischer Aktivitäten durch die Beteiligung der BürgerInnen bedeuten (siehe dazu ausführlich in Teil 4). 3.3 Soziologische Schnittstellen und Unterschiede Werden die beiden skizzierten soziologischen Ansätze – Reflexive Modernisierung und Systemtheorie – wirtschaftssoziologisch im Hinblick auf verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften reinterpretiert, dann gibt es trotz der durchaus sehr unterschiedlichen Theoriekonstruktionen Schnittstellen. Vereinfacht formuliert: Die Theorie der Reflexiven Modernisierung erklärt mit den Begriffen Individualisierung und Entgrenzung in hervorragender Weise, wie sich durch gesteigerte Unsicherheiten in Globalisierungsprozessen wirtschaftliche Individualisierungsprozesse durchsetzen. Unternehmen werden vielfach zu „institution builder“, die sich ihre eigenen Regeln setzen. Durch eine Steigerung nicht-intendierter Nebenfolgen kommt es zu einer verstärkten Erosion der sozialen und ökologischen Grundlagen von Modernisierungsprozessen. Zugleich kann man von einer Subjektivierung der Wirtschaft und einem Re-Entry der Natur sprechen, was einer neolibe49 ralen Domestizierung gleichkommt. Sie erklärt Verantwortungsdiffusionen durch den Wandel bzw. Umbau wichtiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Institutionen und begründet die Bedeutsamkeit, zivilgesellschaftliche Interessen zu artikulieren. Die Systemtheorie erklärt sehr deutlich, warum die Wirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft nicht versteht, was sie eigentlich verstehen sollte, nämlich, dass sie durch verantwortliche und nachhaltige Wirtschaftsweisen ihre eigene Basis des Wirtschaftens sichern könnte; dass sie folglich zur Aufrechterhaltung ihrer eigenen Logiken in einer globalisierten Welt Sinnressourcen wie Verantwortung braucht, um ihr eigenes Überleben zu sichern: Dies könnten ethisch-moralische Themen im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung sein. Beide Theorien laufen auf die Problematik von Steuerung und Koordinierung hinaus – hier treffen sie sich. Ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Ansätzen sollte jedoch nicht übersehen werden: Während es der Theorie der Reflexiven Modernisierung darum geht, Veränderungen zwischen Erster und Zweiter Moderne herauszuarbeiten und neue Wege in eine Zweite Moderne zu verstehen, verharrt die Systemtheorie im Gehäuse gesellschaftlicher Ausdifferenzierungsprozesse und fragt dementsprechend nach Möglichkeiten der Aufrechterhaltung bekannter Logiken, die für das Teilsystem Wirtschaft bei Niklas Luhmann heißen: Haben oder Nicht-Haben. In diesem Sinne liest sich die Systemtheorie streckenweise wie eine soziologische Variante klassischer Wirtschaftstheorien. 4. Wirtschaftsethische Ansätze 50 Zu den theoretischen Zugängen, die ein besseres Verständnis der Prozesse verantwortlichen und nachhaltigen Wirtschaftens ermöglichen, gehören nicht nur rein wirtschaftliche und wirtschaftssoziologische Überlegungen, sondern auch wirtschaftsethische. Schließlich bildete diese Disziplin für eine lange Zeit die Klammer zwischen rein wirtschaftlichem und rein philosophischem Denken; da sich die Wirtschaftssoziologie erst in letzten 20 Jahren (wieder) etablierte, nahm für eine lange Zeit die Wirtschaftsethik einen bedeutenden Raum ein. Wie in den vorangegangenen Teil gilt es, hier nur eine knappe Skizze grundsätzlicher Überlegungen vorzulegen. 4.1 Wo ist der Ort für Moral und Ethik? Zwei-Welten-These Aus der Perspektive der meisten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien oder Ansätze sind Wirtschaft und Ethik zwei grundverschiedene Welten und sie stellen deshalb einen nicht aufhebbaren Widerspruch dar. Wie immer kommt es auf die Perspektive an: Radikale Kritiker kapitalistischer Marktwirtschaften bezeichnen diese Form des Wirtschaftens – etwa im Hinblick auf Gerechtigkeit und Verantwortung – als prinzipiell unmoralisch; radikale Befürworter – prominent: Milton Friedman – setzen sich vehement für eine prinzipielle Abstinenz von moralischen Maßstäben ein und lehnen ethische Überlegungen ab: "The business of business is business." Oder: "The social responsibility of business is to increase its profits." Adam Smith und Bernard Mandevilles Bienenfabel Zur Legitimierung der Zwei-Welten-These wird häufig der Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaft, Adam Smith, selbst Moraltheoretiker, herangezogen. Seine Überlegung war, dass wirtschaftliche Akteure durchaus (nur) ihre persönlichen Interessen verfolgen sollten, denn die „un51 sichtbare Hand“ des Marktes würde die Einzelinteressen zum Wohle aller koordinieren. Der „Wohlstand der Nationen“ beruhe letztlich auf egoistischem Verhalten. Demnach könnten Forderungen nach einem moralischen Verhalten in der Wirtschaft zurückgewiesen werden und Fragen nach einer ethischen Ökonomie wären obsolet. Diese Sichtweise ist, historisch, empirisch und theoretisch gesehen, nicht selbstverständlich. Denn zu Lebzeiten Adam Smiths war wirtschaftliches Handeln durchaus (noch) überwiegend sozial und moralisch und vor allen Dingen kulturell eingebettet. Historisch gesehen gibt es also eine lange Tradition der wechselseitigen Bedingtheit von Moral und Ökonomie auf der Makroebene oder die Vorstellung von einem „guten“ unternehmerischen Verhalten auf der Mikroebene (der ehrbare Kaufmann). Und auch im 21. Jahrhundert gilt dies noch für viele Kulturen: Bekanntlich spielen gerade in sog. Entwicklungsund auch in den erfolgreichen Schwellenländern soziale, moralische und kulturelle Dimensionen wirtschaftlichen Handelns eine (große) Rolle. Auch waren Smiths‘ moraltheoretische Überlegungen durchaus nicht selbstverständlich. Er knüpfte an die damals (1714) von Bernard Mandeville publizierte Schrift „Die Bienenfabel: oder private Laster, öffentliche Vorteile“ an, die provokant behauptete, persönliche Laster seien die eigentliche Quelle des Gemeinwohls. Diese Überlegungen, wie auch die späteren von Adam Smith, stellten das damalige Denken schlicht auf den Kopf, denn bisher war man davon ausgegangen, dass Menschen Gemeinschaftswesen sind, die ihr Handeln auf das Wohl der Gemeinschaft ausrichten, also zumindest tendenziell kooperativ, wenn auch nicht immer altruistisch sind. Zumindest war man der Überzeugung, dass gesamtgesellschaftliches Wohlergehen nur dann möglich ist, wenn alle ihren Beitrag dazu leisten. 52 Ethik in der Wirtschaft, in der Marktwirtschaft oder in der kapitalistischen Marktwirtschaft Für die aktuellen Debatten kann konstatiert werden, dass Wirtschaft und Ethik sehr wohl viel näher beieinander liegen als Marktwirtschaft und Ethik oder gar kapitalistische Marktwirtschaft und Ethik. Wirtschaftliches Handeln oder auch marktwirtschaftliches Handeln können durchaus mit moralischen Prinzipien vereinbar sein, möglicherweise aber nicht bestimmte Varianten wirtschaftlichen oder marktwirtschaftlichen Handelns. Es kommt auf die Organisation wirtschaftlichen Handelns an, auf spezifische Prägungen und natürlich auf die sich herausbildenden Wirtschaftsstrukturen. Die Begriffe „Soziale Marktwirtschaft“, „Korporatistische Marktwirtschaft“, „Liberale Marktwirtschaft“ oder „Kapitalistische Marktwirtschaft“ usw. weisen darauf hin. Es gilt folglich zu beachten, wovon genau die Rede ist, ob es um ethische Prinzipien in der Wirtschaft, in der Marktwirtschaft oder in der kapitalistischen Marktwirtschaft geht. In vielen wirtschaftsethischen Abhandlungen wird der jeweils besondere Charakter von Wirtschaften selten bedacht. Konstitutionelle Ökonomik/ Integrative Wirtschaftsethik Wirtschaft und Ethik werden in den wichtigen wirtschaftsethischen Theorien unterschiedlich konzipiert. So kann etwa mit dem Wirtschaftsethiker Karl Homann aus Sicht einer Konstitutionellen Ökonomik argumentiert werden, dass ethische Prinzipien in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Marktwirtschaft zu verorten sind. Was dann innerhalb der Rahmenbedingungen im Marktgeschehen passiert, wäre dann moralfrei. So stellen etwa die demokratischen Abstimmungsverfahren parlamentarischer Demokratien eine solche Rahmenbedingung dar. Es kann geschlussfolgert werden, dass etwa die Abwesenheit gesetzlicher Rahmenbedingungen im Hinblick auf verantwortliches und nachhaltiges Verhalten politisch 53 legitimiert ist, weil der Wählerwille genau dies zum Ausdruck gebracht hat. Peter Ulrich argumentiert hingegen mit seinem Konzept der integrativen Wirtschaftsethik diskurstheoretisch und republikanisch. Nach seiner Überzeugung ist die Öffentlichkeit mündiger BürgerInnen Bezugspunkt von Ethik. Dies rechtfertigt, zivilgesellschaftliche Akteure in die Wirtschaftsprozesse zu integrieren. Ort der Ethik? Wo ist folglich der gesellschaftliche Ort der Ethik? Nach Karl Homann kann Ethik nur außerhalb der Wirtschaft sein, und dann wäre sie bestenfalls auch demokratisch legitimiert; nach Peter Ulrich müssen wirtschaftliche Vorgehensweisen und Strukturen von innen her verändert werden. Eine zweite Frage ist, wie ethische Richtigkeitsvermutungen oder Werturteile erzeugt werden. Im ersten Fall würde man auf parlamentarische Prozeduren vertrauen; im zweiten Fall ist zu argumentieren, dass das genau das Problem darstellt, weil der Wählerwille in einer Parteiendemokratie nicht wirklich zum Ausdruck kommt. Wir sprechen inzwischen zu Recht von einer „Krise der repräsentativen Demokratie“ und davon, dass wir uns in einer „Postdemokratie“ oder „post-parlamentarischen Ära“ befinden (John Keane), in der plebiszitäre Elemente eine sehr viel größere Rolle spielen sowie auch außerparlamentarische Einfluss- und Kontrollmechanismen – die eben sehr viel häufiger zivilgesellschaftlich organisiert werden. 54 4.2 Das Verantwortungsprinzip: Gültigkeit und Reichweite von Moral Wer ist verantwortlich? – „Organisierte Unverantwortlichkeit“ Beim Verantwortungsprinzip als einer ethischen Leitidee wirtschaftlichen Handelns geht es um die zentrale Frage, ob Organisationen (Unternehmen) und/ oder Akteure der Wirtschaft für das, was sie tun, verantwortlich sind oder ob dieser gesellschaftliche Bereich Sonderrechte genießt, weil wirtschaftlichem Handeln ein höherer Stellenwert beigemessen wird als anderen gesellschaftlichen Handlungsformen. Während sich normale BürgerInnen für ihr Handeln – auch in einem juristischen Sinne – rechtfertigen müssen, gilt dies für Organisationen und Akteure der Wirtschaft nur eingeschränkt. Wenn man von dieser Perspektive her denkt, ist es eigentlich nicht nachvollziehbar, warum es sich als selbstverständlich durchgesetzt hat, dass Organisationen und Akteure der Wirtschaft nicht verantwortlich sind. Wenn wir von Organisationen und Akteuren der Wirtschaft sprechen, ist noch nicht präzisiert, wer genau verantwortlich sein könnte: Sind es die Unternehmen als eine rechtlich selbständig agierende Einheit? Sind es bei Kapitalgesellschaften die Eigentümer (Shareholder) oder die Manager? Kann Verantwortung einzelnen Personen in einzelnen Abteilungen zugeschrieben werden? In Anlehnung an Karl Homanns Auffassung wären all diese Fragen zu verneinen, denn solange sich Organisationen und Akteure der Wirtschaft im Rahmen des geltenden Rechts verhalten, wäre Unverantwortlichkeit aus dieser Perspektive ein moralisches, weil gesetzliches Verhalten. So „schiebt“ man die Verantwortung für die Verantwortung der Organisationen und Akteure der Wirtschaft auf die Politik, denn diese müsste, siehe oben, eben entsprechende Gesetze beschließen. Festzuhalten ist, dass offensichtlich weder Wirtschaft noch Politik ein Interesse daran haben. Ver55 treterInnen der konstitutionellen Ökonomik versuchen vielmehr im „Spiel der Marktkräfte“ zu argumentieren und „schieben“ die Verantwortung an die Konsumenten weiter – so sind diese selbst verantwortlich dafür, wenn sie ungesunde Lebensmittel oder Waren aus Kinderarbeit kaufen. Nicht wenige sprechen angesichts solcher Sachverhalte von einer „organisierten Unverantwortlichkeit (Ulrich Beck) oder einem „Age of Irresponsibility“ (Tim Jackson). Zur Erinnerung: Es geht hier ohnehin um den Kernbereich wirtschaftlichen Handelns, nicht darum, ob sich Unternehmen außerhalb für soziale oder ökologische Belange engagieren; es geht also nicht um Corporate Citizenship. Der Kernbereich umfasst allerdings den gesamten Produktionsprozess, also die gesamte Wertschöpfungskette von der Gewinnung und der Bearbeitung der Rohstoffe (auch im Ausland), die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen zu konkreten Arbeitsbedingungen (auch bei Vergabe an Subunternehmen) sowie die Folgen des Konsums (Rücknahme von „Abfällen“) was bekanntlich unter „gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen“ (CSR) subsumiert wird. „Ethik in der Weltgesellschaft“ - dünne und dichte Moral An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass sich die Frage nach Verantwortlichkeit im Zeichen der Globalisierung als Frage nach einer „Ethik in der Weltgesellschaft“ stellt, es also um Überlegungen zu Gültigkeit und Reichweite von Moral geht. Gelten derartige moralische Prinzipien universell, d.h. für alle Menschen in allen Gesellschaften und Kulturen oder nur innerhalb des engen nationalstaatlichen Rahmens? Wenn Unternehmen global agieren, argumentieren sie erstaunlicherweise mit der angeblichen Notwendigkeit, dass es gelte, kulturelle Vielfalt anzuerkennen, d.h., dass es ausreiche, jeweils gemäß nationalstaatlicher Richtlinien zu handeln. Das Argument zivilgesellschaftlicher Akteure geht hingegen in eine andere 56 Richtung, denn sie fragen sich, warum Menschenrechte, etwa in Form des Verbots von Kinderarbeit, nicht etwa auch bei deutschen Firmen in Bangladesch gelten sollten. Dies wiederum ist von einer „höheren Warte“ aus gar nicht zu entscheiden, denn es handelt sich um ein ethisches Dilemma: Allgemeine ethische Prinzipien sind ebenso gerechtfertigt wie die Anerkennung kultureller Vielfalt. In einer globalisierten Gesellschaft stellen sich die Fragen nach einer universalen Ethik anders als auf nationaler Ebene. In der Philosophie wird Universalismus als „Dünne Moral“ in einer wie auch immer gedachten Weltgemeinschaft bezeichnet, während man von einer „Dichten Moral“ spricht, welche Gültigkeit nur innerhalb einer Kultur beansprucht (Michael Walzer). Walzers Unterscheidung von dichter und dünner Moral ist deswegen von Belang, weil es keine dem Bild der nationalen Kultur entsprechende umfassende Gemeinschaft der Menschheit gibt, aus der sich eine Ethik des Weltgemeinwohls ableiten ließe – und damit eng verknüpft: Wäre ein globales Recht etwa für alle wirtschaftenden Akteure vorstellbar? Exkurs: Religion als moralische Ressource Bei den Debatten um Wirtschaft und Ethik spielen Religionen oder präziser formuliert religiöse Deutungssysteme eine zunehmende Rolle, denn Regeln, Normen oder Werte sind nicht unabhängig von den Vorstellungen der Menschen über den Sinn des Lebens, das Sein in der Welt und das Verhältnis der Geschöpfe untereinander. Religion kann in Anlehnung an Jürgen Habermas als eine moralische Ressource verstanden werden, also gleichsam als eine Instanz für Werturteile der Form „gut – böse“ oder „richtig – falsch“ – die, wie oben im Rahmen der Systemtheorie dargelegt, komplexitätsreduzierend wirken. 57 In der westlichen Welt spielen christliche Grundüberzeugungen und die Soziallehren der Kirchen eine große Rolle; in anderen Weltregionen haben sich davon teils verschiedene Werturteile und Richtigkeitsauffassungen entwickelt. Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, dass Wirtschafts- und Ethikprinzipien unterschiedlich beurteilt werden und dass etwa konkrete Leitlinien für Verantwortlichkeit oder Gerechtigkeit (z.B. Sozial- und Umweltstandards) kontrovers diskutiert werden. Dies ist im Hinblick auf verantwortliches und nachhaltiges Wirtschaften durchaus erwünscht, wenn es dafür Diskursarenen mit gleichberechtigten Zugangsund Artikulationsmöglichkeiten gibt – dies sind zentrale Steuerungs- und Koordinierungsprobleme. 58