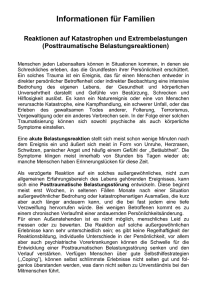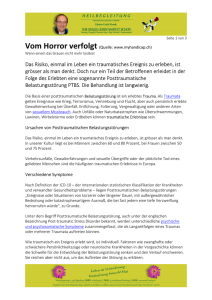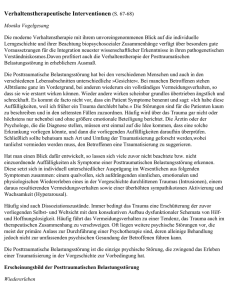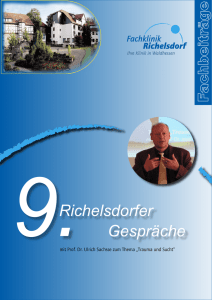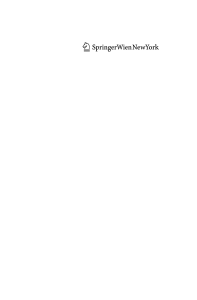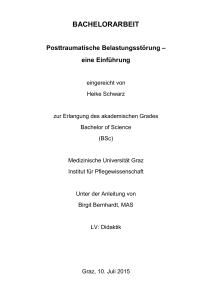Skript Prof. Dr. med. U. Schnyder
Werbung

Prof. Dr. med. Ulrich Schnyder 07.04.2011 Traumatische Erfahrungen und ihre Folgen Vorlesungsüberblick: Als „railway spine“ wurde Mitte des 19. Jahrhunderts ein Syndrom mit kognitiven und psycho-somatischen Beeinträchtigungen bezeichnet, das in der Folge von Eisenbahnunfällen beobachtet wurde. Die „railway spine“ gilt als eine der ersten wissenschaftlichen Beschreibungen der posttraumatischen Belastungsstörung. Seit Beginn der 1980er Jahre erlebte die Traumaforschung einen regelrechten Boom, der bis heute unvermindert anhält. Individuelle Traumata sind beispielsweise Folter und Kriegserlebnisse, schwere Unfälle, Überfälle und Geiselnahmen, aber auch sexuelle Übergriffe wie Vergewaltigung oder Inzest. Kollektive Traumata entstehen durch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Lawinenunglücke, Erdbeben oder Wirbelstürme, sowie durch menschlich verursachte Ereignisse wie Flugzeugabstürze und Grossbrände. All diesen Ereignissen ist gemeinsam, dass sie Gefühle von intensiver Angst, Schrecken oder Hilflosigkeit auslösen. Entsprechende Krankheitsbilder wurden im DSM zunächst als „gross stress reaction“ und im DSM-II als „transient situational disturbance“ bezeichnet. Mit dem Erscheinen des DSM-III im Jahre 1980 wurde der Begriff „post-traumatic stress disorder“, auf Deutsch „posttraumatische Belastungsstörung“, eingeführt. Über die Hälfte aller Menschen machen im Verlauf ihres Lebens mindestens einmal eine traumatische Erfahrung. In Abhängigkeit von der Art des Traumas und einer ganzen Reihe weiterer prä-, peri- und posttraumatischer Variablen entwickeln insgesamt etwa 10% der von einem traumatischen Ereignis betroffenen Menschen eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Lebenszeitprävalenz der posttraumatischen Belastungsstörung liegt international bei etwa 8%, in Europa eher tiefer. Die posttraumatische Belastungsstörung ist durch Symptome des Wiedererlebens gekennzeichnet, die sich tagsüber in Form von sich aufdrängenden, traumabezogenen Erinnerungen, Tagträumen oder Flashbacks manifestieren, und nachts als Albträume erscheinen können. Im Kontrast dazu stehen Vermeidungssymptome: emotionale Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit der Umgebung und anderen Menschen gegenüber, aktive Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Manchmal können wichtige Aspekte des traumatischen Erlebnisses nicht mehr (vollständig) erinnert werden. Diese Symptome werden begleitet von einem Zustand vegetativer Übererregtheit mit Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz, oder erhöhter Schreckhaftigkeit. Eine Reihe von prätraumatischen Variablen erhöhen das Risko, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken: Neben dem weiblichen Geschlecht sind hier jüngeres Alter, unterdurchschnittliche Intelligenz und niedriger sozioökonomischer Status zu nennen, aber auch frühere traumatische Erfahrungen und psychische Störungen in der persönlichen Biographie und in der Familienanamnese. Ob sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt oder nicht, hängt schliesslich in erheblichem Ausmass davon ab, ob der Betroffene nach der traumatischen Exposition Umstände vorfindet, die einer raschen psychosozialen Erholung förderlich sind. Besonders wichtig ist hier das Ausmass der sozialen Unterstützung und der Schutz vor zusätzlichen Belastungen. Wenn das Trauma mit einer körperlichen Verletzung verbunden war, können körperliche Funktionseinschränkungen oder anhaltende Schmerzen eine entscheidende Rolle spielen. Heute liegen für die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung verschiedene spezifische und gut evaluierte Therapiemanuale mit hohen Effektstärken vor. Auch wurden in den letzten Jahren umfassende Therapie-Richtlinien publiziert. Insgesamt sind die Effektstärken für Psychotherapie höher als für medikamentöse Behandlungen, weshalb posttraumatische Belastungsstörungen primär psychotherapeutisch behandelt werden sollten. Im klinischen Alltag erfolgt die Behandlung in der Regel als individuell angepasste Kombination psychotherapeutischer, pharmakotherapeutischer, körperorientierter, soziotherapeutischer und anderer Interventionen. Die kognitive Verhaltenstherapie (englisch cognitive-behavioral therapy, CBT) versteht die posttraumatische Belastungsstörung mit Hilfe der Lerntheorie: Ein Trauma wirkt als aversiver Stimulus, der eine konditionierte emotionale Reaktion hervorruft (klassische Konditionierung). Die Reaktion generalisiert über den ursprünglichen Stimulus hinaus, Verhaltens- und Gefühls-Vermeidung verstärken die Reaktion (operante Konditionierung). Angst und intrusive Symptome werden so zu unabhängigen aversiven Stimuli. Wiederholte therapeutische Exposition mit objektiv harmlosen konditionierten Stimuli, einschliesslich der traumatischen Gedächtnisinhalte, führt zur Extinktion der Angstreaktionen. CBT setzt neben der Exposition eine Reihe ergänzender Techniken ein, wie z.B. die systematische Desensibilisierung, StressImpfungstraining, kognitive Restrukturierung, Selbstbehauptungstraining und Entspannungsübungen. CBT wird normalerweise als Kurzzeit-Therapie durchgeführt: 812 Sitzungen in einer Frequenz von 1-2 Sitzungen pro Woche. CBT und insbesondere Expositionstherapie weist momentan den überzeugendsten Wirksamkeitsnachweis bei der Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen auf. Für die Prolonged Exposure (PE) nach Edna Foa liegen zur Zeit mit Abstand am meisten methodisch gute, randomisierte und kontrollierte Studien vor, welche die Wirksamkeit bei einer Vielzahl von Traumapopulationen belegen. Dieses Verfahren wird deshalb heute als der Goldstandard in der Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung angesehen. Bei der Prolonged Exposure wird die imaginative Konfrontation mit dem Trauma in allen Sinnesmodalitäten über 4-8 Sitzungen wiederholt, bis die Angst während der Exposition merklich abnimmt. Die Therapiesitzung wird auf Tonband aufgenommen, und die Patienten erhalten die Aufgabe, sich diese Aufzeichnung zu Hause täglich anzuhören. Bei stärker kognitiv ausgerichteten Ansätzen wie z.B. bei der Cognitive Processing Therapy (CPT) nach Patricia Resick wird die Konfrontation mit dem Trauma auf die schlimmsten Momente (hot spots) und auf 2-3 Wiederholungen beschränkt. Während der Konfrontation werden Methoden zur kognitiven Umstrukturierung (z.B. sokratischer Dialog) angewendet. Neben der Habituation an die Angst ist das Ziel dieses Verfahrens eine Modifikation dysfunktionaler Bewertungen nicht-angstbezogener kognitiv-affektiver Aspekte des Traumas (z.B. Schuldgefühle). Nicht selten ist zusätzlich und in Ergänzung zur psychotherapeutischen Behandlung der Einsatz von Psychopharmaka erforderlich. Bei der medikamentösen Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung stehen die Antidepressiva ganz im Vordergrund: Serotoninspezifische Antidepressiva (selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI), gelten als Medikamente erster Wahl. Bei ungenügender Wirkung können in einem zweiten Schritt trizyklische Antidepressiva eingesetzt werden. Benzodiazepine wirken nur auf die Arousal-Symptomatik, nicht aber auf die Wiedererlebens- oder Vermeidungssymptome. Zudem beeinträchtigen sie die kognitive Leistungsfähigkeit. Sie sollten deshalb, wenn überhaupt, nur vorübergehend zur Behandlung ausgeprägter Schlafstörungen eingesetzt werden. Leider werden Benzodiazepine nach wie vor, insbesondere von Hausärzten, sehr häufig verschrieben, obschon bekannt ist, dass Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen besonders anfällig für die Entwicklung einer Substanzabhängigkeit sind. Für Neuroleptika gibt es bei der Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen keine spezifische Indikation. Korrespondenzadresse: Prof. Dr. med. Ulrich Schnyder Immediate Past President, International Federation for Psychotherapy IFP Immediate Past President, International Society for Traumatic Stress Studies ISTSS Past President, European Society for Traumatic Stress Studies ESTSS Klinikdirektor Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Universitätsspital Culmannstrasse 8 CH-8091 Zürich Schweiz phone +41 44 255 52 51 fax +41 44 255 44 08 email [email protected] web www.psychiatrie.usz.ch Donnerstag, 7. April 2011 Traumatische Erfahrungen und ihre Folgen Prof. Dr. med. Ulrich Schnyder Professor für Poliklinische Psychiatrie und Psychotherapie Medizinizsche Fakultät der Universität Zürich