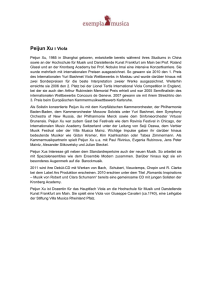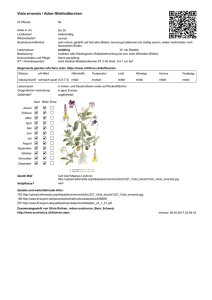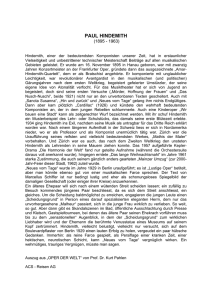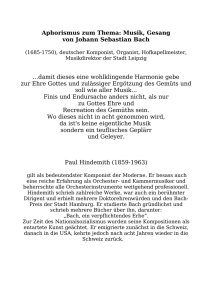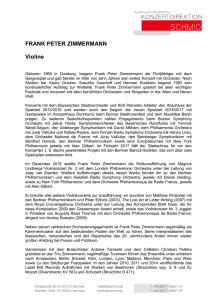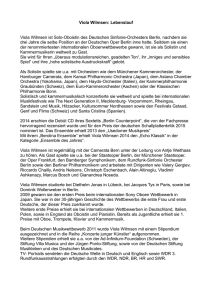Portrait Tabea Zimmermann 3 | 4 8. und 10
Werbung

Portrait Tabea Zimmermann 3 | 4 8. und 10. Februar 2007 Inhalt Donnerstag 8. Februar 2007 20:00 2 Portrait Tabea Zimmermann 3 Viola verklärt Samstag 10. Februar 2007 20:00 14 Portrait Tabea Zimmermann 4 Elegie Tabea Zimmermann 23 Ein Portrait von Johannes Hirschler Biografien 28 Impressum 32 1 Donnerstag 8. Februar 2007 20:00 Portrait Tabea Zimmermann 3 Viola verklärt Arcanto Quartett Antje Weithaas Violine Daniel Sepec Violine Tabea Zimmermann Viola Jean-Guihen Queyras Violoncello Antoine Tamestit Viola Danjulo Ishizaka Violoncello Paul Hindemith 1895–1963 Streichquartett Nr. 5 op. 32 (1923) Lebhafte Halbe Sehr langsam, aber immer fließend Kleiner Marsch Passacaglia Wolfgang Amadeus Mozart 1756–1791 Streichquartett D-Dur KV 575 (1789) Allegretto Andante Menuetto. Allegretto – Trio Allegretto Pause George Benjamin *1960 Viola, Viola (1997) für zwei Violen Arnold Schönberg 1874–1951 Verklärte Nacht op. 4 (1899) Sextett für zwei Violinen, zwei Violen und zwei Violoncelli Sehr langsam – Breiter – Schwer betont – Sehr breit und langsam – Sehr ruhig 2 Paul Hindemith, Foto um 1930 Viola verklärt Paul Hindemith: Streichquartett Nr. 5 op. 32 Ob im Duo, im Quartett oder in anderen Partnerschaften, ob melancholisch-sehnsuchtsvoll oder angriffslustig und schroff, leidenschaftlich oder geheimnisvoll: Die Bratsche, häufig gegängeltes und belächeltes Schattengewächs der Streicherfamilie, vermag sich mit ihrer charakterstarken Ausdruckskraft in vielen Posen in Szene zu setzen und dabei eine gute Figur zu machen. Zu jenen Musikern, die – nebst Geige, Klavier und einer Handvoll Blasinstrumenten – das Spiel auf der Bratsche auf das Virtuoseste beherrschten, gehörte Paul Hindemith. Und auch als Musikschöpfer hat er das Alt-Instrument nie aus den Augen verloren, vielmehr mit wunderbaren Kompositionen bedacht. Der Wermutstropfen: Seine Werke sind – der Kölner Konzertzyklus mit Tabea Zimmermann einmal ausgenommen – leider nur selten zu hören. Eine Erklärung fällt schwer. Vermutlich hat die polemische Sicht der Zeitgenossen auf den in der Nähe von Frankfurt am Main geborenen Komponisten dazu beigetragen. Als expressionistischen Rebellen, der mit Foxtrott, motorischem Drive und Dissonanzen die Musik der 1920er-Jahre auf- 3 mischte, sahen ihn die Konservativen. Jene dagegen, die sich als Avantgardisten einstuften, taten ihn schon bald als Ewig-Gestrigen ab, als einen, dessen Werken der Ruch handwerklicher Trockenheit und Lehrmeisterhaftigkeit anhaftete. Doch während derlei Dispute häufig dazu führen, das Andenken an einen Künstler wachzuhalten, sind Hindemith und sein kompositorisches Schaffen aus dem musikalischen Bewusstsein der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden, der Vergessenheit anheimgefallen. Wie das Gros seiner Werke resultierten auch die insgesamt sieben Streichquartette aus Hindemiths intensiver Musizierpraxis als Geiger und Bratscher in verschiedenen Kammermusikformationen. Das fünfte Streichquartett op. 32 verfasste er im Herbst 1923 – in zeitlicher Nähe zu seinen skandalträchtigen Operneinaktern Mörder, Hoffnung der Frauen und Das Nusch-Nuschi sowie der Suite 1922 für Klavier – für das im Vorjahr gegründete Amar Quartett, dem Hindemith selbst als Bratscher angehörte und das außer dem klassischen Repertoire auch Werke von Schönberg und Bartók aufführte. Die Mitglieder des Amar Quartetts: Mauritz Frank (Cello), Walter Caspar (Violine), Paul Hindemith (Viola) und Liceo Amar (Violine). Zeichnung von Rudolf W. Heinisch 4 Und was sich schon in Hindemiths viertem Streichquartett angedeutet hatte, manifestierte sich im fünften: die Abkehr von Gefühlsüberschwang und üppiger Chromatik à la Wagner und Strauss sowie die Besinnung auf Klarheit, Objektivität im Ausdruck und eine gewisse Strenge, auf – so der Musikkritiker Paul Bekker – eine »antimetaphysische« Musik ohne Schnörkel, klanglich geschärft und von unmittelbarer Eingängigkeit. Mal ergreifend zart, mit in sich ruhenden Melodien und sachten, jeglicher Erdenschwere enthobenen Harmonien – wie im langsamen, zweiten Satz des Quartetts, der mit seiner Gleichzeitigkeit von geradem und ungeradem Takt ein typisches Merkmal des Hindemith’schen Komponierens jener Zeit aufweist. Mal von mitreißender Vitalität und Musizierfreude – wie im scherzohaft-kecken, monothematisch angelegten Kleinen Marsch, der aufgrund seiner Achteltriolen weniger zum Marschieren denn zum Hasten verführt, aus dem Pianissimo heraus stetig anschwillt, plötzlich in sich zusammenbricht und wieder ins Pianissimo zurücksinkt. Motiviert wurde Hindemiths Abkehr vom spätromantischen Ausdrucksgestus unter anderem durch die Beschäftigung mit Form- und Gestaltungsprinzipien des Barock. Kein Wunder, dass sich das fünfte Quartett überwiegend als lineares Gefüge präsentiert, das zwar an markanten Zäsuren sowie am Satzende durchweg den Einklang oder tonalen Zusammenklang sucht, durch seinen Dissonanzenreichtum der Tonalität jedoch allenthalben den gesicherten Boden entzieht. In fast allen Sätzen lässt sich Kontrapunktisches, lassen sich Imitationen und Kanonisches finden, am ausgeprägtesten in den Rahmensätzen. So verarbeitet Hindemith im Kopfsatz zwei Themen – ein rhythmisch profiliertes und ein »sehr zartes« und gesangliches, ja beinahe romantisch anmutendes – zunächst jeweils für sich als Fuge mit kunstvoller Engführung, Umkehrung und Verkürzung und amalgamiert sie gegen Ende zu einer grandiosen, im Ausdruck fast aggressiven und für die Interpreten technisch höchst anspruchsvollen Doppelfuge. Das umfangreiche Finale schlüpft dann in ein weiteres barockes Gewand: in eine gleichermaßen friedvolle wie expressive und beseelte Passacaglia mit 27 Variationen, bei der über dem prägnanten, als Basso ostinato mehrfach unverändert wiederholten, achttaktigen Thema des Cellos die übrigen Stimmen ihre eigenen Gedanken formulieren. Schließlich gipfeln die Variationen in einem dreistimmigen Fugato, in dem Hindemith außer dem variierten Ostinato vom Beginn des Satzes auch das rhythmisch betonte Thema des Kopfsatzes aufgreift. Der Kreis hat sich geschlossen. 5 Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquartett D-Dur KV 575 Widmungen sind eine schöne Sache. Eine charmante Art, auf sich aufmerksam zu machen, sich in Erinnerung zu rufen. Nicht selten vermögen sie Ehre, Ruhm und Ansehen zu mehren. Und mit viel Glück gibt es dafür als Gegenleistung das eine oder andere Geschenk. Auf finanziellen Lohn aber – prosaisch ausgedrückt: Geld – hofft der Widmende meist vergeblich. Gerade daran aber mangelte es Wolfgang Amadeus Mozart, der seit seiner selbst provozierten Entlassung aus dem Salzburger Hofdienst sein Brot als freischaffender Musiker in Wien verdienen musste. Denn ob aufgrund der Türkenkriege, die das Publikum zum Sparen zwangen, oder aus anderen Gründen: Seine Kompositionen verkauften sich immer schlechter, Konzertverpflichtungen wurden immer rarer, und auch finanzkräftige Klavierschüler waren Mangelware. Die Ersparnisse aus den goldenen Anfangsjahren seiner Wiener Zeit waren, da Mozart gerne gut lebte und zudem überaus großzügig war, längst aufgebraucht. In den späten 1780ern, also nur wenige Jahre vor seinem frühen Tod, hatte sich Mozarts finanzielle Lage derart zugespitzt, dass er seinem Logenbruder, dem Textilhändler Michael Puchberg, verzweifelt schrieb: »Meine Laage ist so, dass ich unumgänglich genöthigt bin, Geld aufzunehmen – aber Gott, wem soll ich mich vertrauen? Niemandem als ihnen, mein Bester! [...] Wenn Sie werthester Br: mir in dieser meiner Laage nicht helfen, so verliere ich meine Ehre und Credit.« Und es sollte beileibe nicht bei diesem einen Brief bleiben. So besehen verwundert es nicht, dass Mozart sein Vorhaben, dem Cello spielenden Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. eine Serie von sechs Streichquartetten zu widmen, kurzerhand kippte. Denn was nutzten ihm etwaige Sympathiebezeugungen und ein bisschen mehr Ruhm, wenn sein Magen knurrte und er keinen Gulden in der Tasche hatte. Ihm ging es vielmehr darum, »Geld in die Hände zu bekommen«. Und so verkaufte er – »um ein Spottgeld«, wie er Puchberg klagte – die bereits zu Ende geführten ersten drei Quartette, darunter auch das 1789 entstandene Streichquartett KV 575, dem Wiener Musikverlag Artaria. »Die mühsame Arbeit«, von der im Brief an Puchberg die Rede ist, und die Sorgen, die Mozart zu jener Zeit bedrückten, merkt man dem ersten »Preußischen Quartett« allerdings mitnichten an: Trotz der – vor allem im vierten Satz – kontrapunktischen Durchgestaltung verströmt es einen duftigen Charme und ist, besonders in den Mittelsätzen, von einem lyrisch-melodischen Schmelz, dem sich anders als bei den zuvor entstandenen und Mozarts väterlichem Freund Haydn gewidmeten Quartetten auch die motivisch-thematische Arbeit unterordnet. Und noch eines ist auffällig: die demokratische Behandlung der einzelnen Instrumente. Allen voran die Aufwertung der Bratsche, deren Part Mozart häufig selbst übernahm, und des Cellos, Lieblingsinstrument von Friedrich Wilhelm II., die in diesem Quartett anders als zu jener Zeit üblich als gleichberechtigte Partner im Viererteam melodisch exponiert zu Wort kommen. 6 George Benjamin: Viola, Viola Es bedarf keineswegs vieler Instrumente, um große musikalische Wirkung, ja mehr noch, Konzerthallen füllendes Klangvolumen zu erzielen. Selbst mit einer noch bescheideneren, dazu höchst ungewöhnlichen Besetzung, dem Bratschen-Duo, ist derlei zu erreichen. Just darin bestand der Reiz des Auftrags, den der japanische Komponist Tōru Takemitsu kurz vor seinem Tod seinem Kollegen George Benjamin erteilte. Der 1960 in London geborene Musiker erhielt seine Ausbildung unter anderem bei Olivier Messiaen sowie bei Pierre Boulez am IRCAM in Paris. Mit seinem bei den Londoner Proms aufgeführten Orchesterwerk Ringed by the Flat Horizon war er 1980 über Nacht bekannt geworden. Aus Takemitsus Anregung ging das zehnminütige Bravourstück Viola, Viola hervor, das im September 1997 von Yuri Bashmet und Nobuko Imai bei den Einweihungsfeierlichkeiten der neuen Tokyo Opera City Concert Hall uraufgeführt wurde. »Ich wollte den Eindruck von fast orchestraler Tiefe und klanglicher Vielfalt heraufbeschwören«, so George Benjamin. »Zuerst sind die beiden Viola-Stimmen virtuell ineinander verflochten – zahlreiche Elemente springen so schnell hin und her, dass das Ohr Schwierigkeiten hat zu erkennen, wer gerade spielt. Dadurch wird ein größeres Aufgebot an Instrumenten suggeriert, jedes davon definiert durch Motivik, Tempo, Dynamik und vor allem Register. Erst bei der Annäherung an das kantable Zentrum des Werks beginnen unabhängige Linien zu erblühen. Die enthaltenen Harmonien sollten so klangvoll wie möglich sein, während das musikalische Gefüge in vier oder mehr Stimmen über längere Zeiträume aufrechterhalten wird.« 7 Das Stück bringt eine erhitzte Konversation zwischen zwei Gleichgesinnten in Gang, gespickt mit technischen Schwierigkeiten und raffinierten Spieltechniken, keiner strikten Form verpflichtet, bisweilen frei fließend und aneinanderreihend, dann wieder im strengen Kanon geordnet. Ein bis in seine feinsten Verästelungen linear wie horizontal sorgsam ausgearbeitetes Klanggewebe von unglaublicher Energie und Klangfülle, das Benjamin – von der Kontrapunktik über ChromatischSpätromantisches bis zur Spektral-Musik jeglichen Stilen offen, aber wie Hindemith serielle Techniken meidend – mit teils duftigen, teils emphatisch leidenschaftlichen Melodielinien versehen hat und in dem Stille und mystisches Irrlichtern ebenso ihren Platz haben wie schroffe Dissonanzen oder vehementes Sichereifern und Aufbegehren. Gegen Ende der Komposition folgen die Spannungspausen immer dichter aufeinander, täuschen den Schluss vor, den Benjamin aber lustvoll und genüsslich hinausschiebt. George Benjamin in der Kölner Philharmonie, 2002 8 Arnold Schönberg: Verklärte Nacht op. 4 Ihre Kindheit war nicht nur heiterer Sonnenschein. Und das ist beileibe nicht die einzige Parallele, die sich zwischen Hindemith und dem gut zwanzig Jahre älteren, gebürtigen Wiener Arnold Schönberg ziehen lässt. Im nationalsozialistischen Deutschland war die Aufführung ihrer Kompositionen verboten, beide emigrierten während des Zweiten Weltkriegs in die USA, und im Alter litten sie darunter, dass ihre Werke nur marginal Beachtung und Anerkennung fanden. Auch ihre musikalische Entwicklung weist Gemeinsames auf. Beide Komponisten waren auf der Suche nach zeitgemäßen, prägnanten musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten und entwickelten eigene, wenngleich in Opposition zueinander stehende Tonsysteme: Hindemith sein auf einem hierarchisch geordneten Verwandtschaftsgrad der zwölf Töne basierendes, unter dem Titel Unterweisung im Tonsatz publiziertes Modell und Schönberg seine die freie Atonalität systematisierende Methode mit zwölf gleichwertigen, »nur aufeinander bezogenen Tönen«. Und noch eine Gemeinsamkeit gilt es festzuhalten: Beider Frühwerke wurzeln in der von Mahler, Wagner und Strauss beeinflussten Spätromantik. Die bedeutendste Komposition aus Schönbergs früher Phase und das erste Instrumentalwerk, das der Komponist mit einer Opuszahl versah, ist das anno 1899 auf ein Gedicht von Richard Dehmel entstandene Streichsextett Verklärte Nacht op. 4. Schon die Kritik der Uraufführung attestierte dem Stück für zwei Violinen, zwei Bratschen und zwei Violoncelli »manches Ergreifende, Rührende, manches, das den Hörer mit unwiderstehlicher Gewalt bezwingt, sich ihm in Herz und Sinne drängt«. Freilich soll nicht verschwiegen werden, dass es auch Vorbehalte gab. Nicht ohne Grund kam die Komposition erst drei Jahre nach ihrer Fertigstellung erstmals zu einer Aufführung. Stein des Anstoßes war zum einen das Sujet des Gedichts, das – in der Literatur schon bald en vogue – Tabu-Themen wie sexuelle Selbstbestimmung und gegen die Konvention verstoßenden Eros in den Fokus rückte. Aber auch die Tatsache, dass Schönberg – angeregt durch Bedřich Smetanas zweites Streichquartett – hier die Programmmusik und die Gestaltungsprinzipien der zu jener Zeit äußerst populären sinfonischen Dichtung – allen voran die Einsätzigkeit – auf die Kammermusik übertrug, erhitzte die Gemüter. Diesem Bruch mit der Tradition entspricht die progressive formale, stilistische und harmonische Gestaltung der schwelgerischen, mal leidenschaftlich aufblühenden, mal zärtlich verhaltenen, dann wieder mystisch oder unheilvoll irrlichternden Komposition. Formal folgt Schönberg in der Verklärten Nacht, deren Partitur gespickt ist mit stetig wechselnden Tempo-Angaben, dynamischen Abstufungen und Hinweisen auf spieltechnische Raffinessen wie das Spiel am Griffbrett oder mit Dämpfer, den fünf Strophen der literarischen Vorlage: Der erste, dritte und fünfte Abschnitt der Komposition schildern den Spaziergang zweier Liebender durch die Natur und die Stille der vom Mondlicht beschienenen Nacht. Aus dem jeweils zu Beginn dieser Abschnitte ruhig abwärts schreitenden, in eine orgelpunktartige Begleitung von halben Noten eingebetteten Hauptmotiv, das häufig in mehreren Stimmen gleichzeitig erklingt, spinnt Schönberg nach Brahms’ »Technik der entwickelnden Variation« in dichter motivischer Arbeit weitreichende Zusammenhänge. Im zweiten Abschnitt zeichnen vier teils miteinander verwandte Themen in immer neu sich aufbauender Steigerung und mehrfach kontrapunktischer 9 Verarbeitung das Geständnis der Frau nach, die dem von ihr geliebten Mann eröffnet, dass sie das Kind eines anderen erwartet. Die Antwort des Mannes, der sich bedingungslos zu ihr bekennt und ihr verspricht, das Kind als sein eigenes anzunehmen, ist dem vierten Abschnitt vorbehalten. Eine wunderbare Cellokantilene, gedämpfte Flageolettklänge, die laut Schönberg die »Schönheit des Mondlichts« unterm schimmernden Weltall versinnbildlichen, und ein aufwärts strebender Kanon der ersten Violine und des ersten Cellos entkrampfen die zuvor dramatisch zugespitzte, aufs Äußerste gespannte Situation. Und obwohl als einsätziges Werk konzipiert, sind die fünf Abschnitte nicht nur charakterlich, sondern auch durch Pausen, dynamische und agogische Kontraste sowie durch ungewöhnliche, die Tonalität verschleiernde Akkorde voneinander getrennt. Womit wir bei einem weiteren Aspekt des Werkes angelangt sind: der Harmonik. Die Musik ist durchtränkt von schillernder Chromatik. Stufenweise Rückungen und das Hinauszögern, ja Ausbleiben der gewohnten Kadenzformeln treiben die emotionale Spannung bis an die Grenze des Möglichen, rauben dem Hörer schier den Atem. Tonale Zentren sind aufgelöst, die Tonalität aus den Angeln gehoben. Fast allen Themen ist ein prägnanter Beginn und oft ein offenes Ende gemein, und zudem unterscheidet sich die Tonalität der Melodie häufig von dem sie umgebenden Stimmengeflecht. Der erste Abschnitt der Verklärten Nacht verbleibt im Wesentlichen in der Haupttonart d-Moll. Die Themen des Monologs der Frau dagegen entfernen sich peu à peu davon, werden zunehmend chromatischer. Die harmonische und rhythmische Instabilität gewinnt immer mehr Raum. Auch im dritten Abschnitt tragen die chromatischen Fortschreitungen den Sieg davon. Erst der Monolog des Mannes drängt auf Ruhe, auf größere harmonische Beständigkeit und bevorzugt D-Dur, wenn auch mit Ausweichungen. Im letzten Abschnitt der Komposition, in dem das Material der vorigen Abschnitte wie in einer Art Coda in reicher Textur noch einmal zusammengefasst und miteinander verzahnt ist, kehrt die Ruhe des Anfangs zurück, jedoch ohne die dort lastende Schwere. Wie die ersten zwölf Takte des Sextetts enthalten auch die letzten fünf keine harmoniefremden Töne. Zart und im vierfachen Piano setzt sich helles D-Dur durch. »Die Nacht«, so Schönberg, ist »in eine verklärte Nacht verwandelt.« Ulrike Heckenmüller 10 Arnold Schönberg um 1900 11 12 Richard Dehmel 1863 – 1920 Verklärte Nacht Zwei Menschen gehn durch kahlen, kalten Hain; der Mond läuft mit, sie schaun hinein. Der Mond läuft über hohe Eichen; kein Wölkchen trübt das Himmelslicht, in das die schwarzen Zacken reichen. Die Stimme eines Weibes spricht: Ich trag ein Kind, und nit von Dir, ich geh in Sünde neben Dir. Ich hab mich schwer an mir vergangen. Ich glaubte nicht mehr an ein Glück und hatte doch ein schwer Verlangen nach Lebensinhalt, nach Mutterglück und Pflicht; da hab ich mich erfrecht, da ließ ich schaudernd mein Geschlecht von einem fremden Mann umfangen, und hab mich noch dafür gesegnet. Nun hat das Leben sich gerächt: nun bin ich Dir, o Dir, begegnet. Sie geht mit ungelenkem Schritt. Sie schaut empor; der Mond läuft mit. Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht. Die Stimme eines Mannes spricht: Das Kind, das Du empfangen hast, sei Deiner Seele keine Last, o sieh, wie klar das Weltall schimmert! Es ist ein Glanz um alles her; Du treibst mit mir auf kaltem Meer, doch eine eigne Wärme flimmert von Dir in mich, von mir in Dich. Die wird das fremde Kind verklären, Du wirst es mir, von mir gebären; Du hast den Glanz in mich gebracht, Du hast mich selbst zum Kind gemacht. Er fasst sie um die starken Hüften. Ihr Atem küsst sich in den Lüften. Zwei Menschen gehn durch hohe, helle Nacht. Aus: »Weib und Welt« (1896) 13 Samstag 10. Februar 2007 20:00 Portrait Tabea Zimmermann 4 Elegie Tabea Zimmermann Viola Kirill Gerstein Klavier Igor Strawinsky 1882–1971 Elégie (1944) für Viola solo Dmitrij Schostakowitsch 1906–1975 Sonate für Viola und Klavier op. 147 (1975) Moderato Allegretto Adagio Pause György Ligeti 1923–2006 Sonate für Viola solo (1991–94) Hora Lungǎ. Lento rubato (ma ritmico) Loop. Molto vivace, ritmico – with swing Facsar. Andante cantabile ed espressivo, with swing Presto con sordino. So schnell wie möglich Lamento. Tempo giusto, intenso e barbaro Chaconne chromatique. Vivace appassionato (molto ritmico e feroce) Ferruccio Busoni 1866–1924 Aus: Elegien für Klavier (1907) Nach der Wendung Erscheinung Berceuse Paul Hindemith 1895–1963 Sonate für Viola und Klavier op. 25, 4 (1922) Sehr lebhaft. Markiert und kraftvoll Sehr langsame Viertel Finale. Lebhafte Viertel 14 Elegie »Die Bratschen, man sieht sie nicht, man hört sie nicht, aber der himmlische Vater ernährt sie doch« – nun, hier und da kursieren zwar noch Bratschenwitze, sie muten jedoch reichlich anachronistisch an und können Solistinnen wie Tabea Zimmermann allenfalls ein müdes Lächeln abringen; denn mittlerweile hat sich die Viola gegenüber ihrer kleinen Schwester, der Violine, nachdrücklich emanzipiert – was aber nicht heißt, dass sie der Geige in klanglicher Hinsicht nacheifern würde. Vielmehr ist es gerade das Dunkle, Warme und Elegische einerseits und das Spröde und latent Kratzbürstige andererseits, das im Zuge der Moderne und der mit ihr einhergehenden starken Fokussierung existenzieller Dimensionen einen völlig neuen Stellenwert erhielt. Da verwundert es nicht, dass das heutige Konzert ausschließlich Werke des 20. Jahrhunderts vereint. Und wenn Paul Hindemith die diesbezügliche Bedeutung der Viola in seiner Vortragsanweisung »Tonschönheit ist Nebensache« (im vierten Satz der Sonate op. 25, 1) auch pointiert zuspitzte, so steht dahinter eben ein Wandel des Klangideals und mithin des Schönheitsbegriffs, der den charakteristischen Klangqualitäten der Viola entgegenkam. Igor Strawinsky, 1954 in Rom Igor Strawinsky: Elégie »Tonschönheit« war auch in Igor Strawinskys 1944 komponierter Elégie eher nebensächlich, sollte das Werk – ein Auftrag des Bratschers Germain Prévost – doch an Alphonse Onnou, den 1940 verstorbenen Gründer des Pro Arte Quartetts, erinnern. Die Form ist dreiteilig: Dem einleitenden Trauergesang folgt eine langsame Fuge, die wiederum in eine Variation des Trauergesangs einmündet – wobei die 15 solcherart »gedämpfte« Stimmung noch dadurch unterstrichen wird, dass die Viola das ganze Stück hindurch mit Dämpfer zu spielen ist. Indes, auf struktureller Ebene begegnete Strawinsky dem semantischen Feld der »Klage« mit kühler, beinahe kristalliner Konstruktivität. So lässt die durchweg zweistimmige Disposition der Elégie zwar auch an die Partiten für Violine solo von Johann Sebastian Bach denken, die Polyphonie zumal des Mittelteils geriet freilich derart komplex, dass Strawinsky sie in einem seiner Entwürfe auf zwei Systeme notierte – vermutlich, um das Verhältnis der beiden Stimmen zueinander optisch zu verdeutlichen. Für zwei Instrumente war das Werk jedenfalls keineswegs vorgesehen; fernab herkömmlicher Virtuosität fordert es die ganze Konzentration und Ausdruckskraft der Solistin. Dmitrij Schostakowitsch: Sonate für Viola und Klavier op. 147 Auch in der Duo-Sonate, der wohl intimsten Gattung der Kammermusik, stand die Viola lange im Schatten der Violine – wo sich aber, statt vertraulichem Zwiegespräch der Instrumente, Konflikte und (existenzielle) Krisen in den Vordergrund drängen, schlägt ihre Stunde. Ob der russische Komponist Dmitrij Schostakowitsch es ahnte, dass die Sonate op. 147 sein letztes Werk werden sollte, sei dahingestellt, wohl aber setzte er sich in ihr, wie in seinem späten Schaffen überhaupt, unmissverständlich mit dem Tod auseinander. »Ich befinde mich jetzt im Krankenhaus. Ich habe Ärger mit meinem Herzen und mit den Lungen. Meine rechte Hand schreibt nur mit großer Mühe. Obgleich es sehr schwierig war, habe ich die Sonate für Viola und Klavier doch zu Ende bringen können«, bemerkte er vier Wochen vor seinem Tod (9. August 1975). Uraufgeführt wurde die Sonate dann in Gedenken an Schostakowitsch am 1. Oktober 1975 von Fjodor Druschinin, dem Bratscher des Beethoven-Quartetts, und dem Pianisten Swjatoslaw Richter. Begonnen hatte Schostakowitschs langer Leidensweg bereits knapp zehn Jahre vorher: Im Mai 1966 erlitt er einen schweren Herzinfarkt, dessen Folgen sich auch in seinem Schaffen widerspiegelten. Zwar verspürte er Anfang 1967 wieder kreative Impulse, stilistisch leitete er aber einen tiefgreifenden Wandel zu Reduktion und Mstislav Rostropowitsch und Dmitrij Schostakowitsch beim Partiturstudium 16 Konzentration der musikalischen Mittel ein – was sich klanglich in fahler Leuchtkraft und strukturell im wachsenden Einfluss der (allerdings nicht streng gehandhabten) Zwölftontechnik niederschlug. Während der Ruhm Schostakowitschs, der wie kaum ein anderer Komponist dem politischen Klima seiner Zeit (vor allem unter Stalin) unterworfen war, in den 1960er und 70er Jahren stetig wuchs, wandte er sich im Gegenzug zwangsläufig mehr und mehr von der Welt ab. Am stärksten zum Ausdruck kam dies womöglich in dem 1974 entstandenen 15. Streichquartett, das er – als Zeichen von Abschied, Trauer und Resignation – lediglich aus ineinander fließenden Adagios formierte. Aber auch in der Sonate op. 147 sind Satzstrukturen und thematisches Material extrem karg gehalten und deuten mithin auf Rückzug und Selbstauflösung. Ganz aus gespannter Ruhe entfaltet sich der Kopfsatz (Moderato), der sich rhapsodisch zu leidenschaftlichem und dramatischem Aufbegehren steigert. Vor allem der äußerst zarte, zerbrechliche Anfang gemahnt an Alban Bergs Violinkonzert Dem Andenken eines Engels. Und will man Fjodor Druschinin, der mit Schostakowitsch bis zuletzt in engem Kontakt stand, glauben, dann bezeichnete dieser das Moderato gar als »Novelle«. Zudem seien die Schmerzen seiner rechten Hand gleichsam in die Texturen des Satzes eingewoben. Dagegen mutet der kontrastierende Mittelsatz eher tänzerisch und phasenweise geradezu folkloristisch an. In dieses scherzoartige Allegretto sind im Sinne eines Rückblicks Passagen aus der Oper Der Spieler (nach Gogol) eingegangen, deren Komposition Schostakowitsch 1942 abgebrochen hatte. Noch weit markanter ist indes die assoziative Anlehnung, die das finale Adagio prägt, scheint doch das Thema des ersten Satzes aus Beethovens »Mondscheinsonate« durch. Das Adagio sei »zur Erinnerung an Beethoven« geschrieben, so Schostakowitsch, Druschinin solle sich aber nicht befangen fühlen, »die Musik ist hell, hell und klar«. Dieser Einschätzung des Komponisten zum Trotz überwiegt in den weit gespannten, sich bogenförmig immer mehr in sich selbst zurückziehenden Linien der Viola die Düsternis, ja, im Verein mit dem schattenhaften Anklang an die »Mondscheinsonate« drängt sich der Eindruck einer halluzinatorischen Reise auf, die schließlich ersterbend ausläuft – ein in seiner Intensität ergreifendes Lebewohl, das freilich gänzlich ohne Pathos auskommt. 17 György Ligeti, 1989 György Ligeti: Sonate für Viola solo Pathos war auch dem kürzlich verstorbenen ungarischen Komponisten György Ligeti fremd, der zu den herausragenden Künstlerpersönlichkeiten der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zählt. Für seine zwischen 1991 und 1994 in Etappen entstandene Sonate für Viola solo wurde er von der Solistin des heutigen Konzerts inspiriert: »Ich hörte vor Jahren Tabea Zimmermanns Spiel auf der C-Saite und war davon begeistert; dieser Klang führte mich später zur Konzeption der Sonate.« Ganz der »wunderbar und herb klingenden C-Saite« des Instruments ist denn auch der erste Satz (Hora Lungǎ) gewidmet, der auf eine Gattung rumänischer Volkslieder aus dem Maramures-Gebiet im Norden des Karpatenbogens bezogen ist. Solcherart verweist Ligeti auf seine musikalischen Wurzeln, trat er doch, bevor er 1956 nach Deutschland übersiedelte, zunächst – nach dem Studium an der Budapester Musikhochschule – als Volksmusikforscher in die Fußstapfen seines Landsmanns (und Vorbilds) Béla Bartók. Indes, lediglich imitiert werden die Volkslieder gerade nicht. Vielmehr griff Ligeti die für sie charakteristische Aneinanderreihung »stereotyper melodischer Wendungen und Figuren« sowie eine »zwischen lydisch und mixolydisch schillernde« Obertonreihe auf. Wie stark sich darüber hinaus volksmusikalische Einflüsse und künstlerische Überhöhung in Ligetis Sonate durchdringen, lässt sich an seiner folgenden Erläuterung ermessen: »Nun wären Obertöne auf der C-Saite kinderleicht auszuführen (und sie kommen auch vor, doch nur als ›Fußnoten‹). Indessen habe ich mir vorgestellt, die Bratsche hätte eine um eine Quinte tiefere, real nicht vorhandene F-Saite, und deren fünfter, siebter und elfter Oberton wären dann die im temperierten System ›falsch‹ klingenden Naturtöne. Da die F-Saite imaginär ist, bitte ich den Bratschenspieler, die Intonationsabweichungen bewusst zu greifen. Das klingende Ergebnis ist dann eigenartig fremd.« Insgesamt besteht die Sonate aus sechs Sätzen, die, »oberflächlich betrachtet«, eine Serie von »Charakterstücken« konstituieren und »trotz ihrer Virtuosität formal recht einfach sind«. Einen Sinn, so Ligeti weiter, erhalte diese Art von Musik aber nur auf einer abstrakteren, übertragenen Ebene – wobei er damit auf die komplexe, 18 punktuell durchaus auch humorvoll gemeinte Überblendung heterogener Assoziationsfelder anspielt. Dieser Ansatz, mit dem er weite geistige Räume bis hin zu Kindheitserinnerungen erschließt und spitzfindig miteinander verknüpft, ist für sein musikalisches Denken überhaupt kennzeichnend und kommt zumal in seinen späteren Werken, so eben auch in der Sonate für Viola solo, zum Tragen: »Für mich als zehn- bis elfjährigen Buben bedeutete die ungarische Übertragung von ›Alice in Wonderland‹ ein Grunderlebnis. Lewis Carroll ist aber nur eine der vielen Konnotationsschichten. Unmittelbar streichertechnisch (insbesondere hinsichtlich der komplexen Mehrfachgriffe) bilden die drei Solosonaten für Violine von Bach nicht nur die Grundlage der instrumentalen Konzeption, sondern – vor allem die C-DurSonate – das nie erreichbare Ideal.« Ferruccio Busoni: Elegien für Klavier Stand Busoni als Komponist eher im Schatten des gefeierten Klaviervirtuosen und (mitunter scharfzüngigen) Musiktheoretikers, so hat das Interesse an seinen Kompositionen in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen – was sich nicht zuletzt in Neuinszenierungen seiner Opern Die Brautwahl und Doktor Faustus niederschlug. Dass der Komponist nicht vom Virtuosen und Theoretiker zu trennen ist, zeigt sich zumal im umfangreichen Schaffen Busonis für »sein« Instrument, das Klavier. Auf ihm experimentierte er mit neuen Techniken und Klängen, die in andere Gattungen, wenn überhaupt, erst viel später eingingen. Bereits in seiner Kindheit schrieb er fast 80 Klavierstücke, von denen die meisten allerdings ungedruckt blieben. Und der Kreis schließt sich mit den Sieben kurzen Stücken zur Pflege des polyphonen Spiels und den Prélude et Etude en Arpèges von 1923. Diese Titel deuten bereits an, dass Busoni mit dem Klavierspiel auch pädagogische Zwecke verfolgte: So notierte er 1898 dezidierte Übungsregeln für Klavierspieler, worunter sich neben konkreten technischen Anleitungen auch der folgende visionäre Hinweis findet: »Nimm von vornherein an, dass auf dem Klavier alles möglich ist, selbst wo es dir unmöglich scheint, oder wirklich ist.« Ferruccio Busoni am Klavier Paul Hindemith (Viola), Alice Ehlers (Klavier) und Rudolf Hindemith (Cello) bei einem Konzert in der Hochschule für Musik, Berlin 1927 Dies korrespondiert wiederum eng mit Busonis musiktheoretischen Einlassungen, deren berühmteste und umstrittenste der 1906 verfasste Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst ist: »Frei ist die Tonkunst geboren und frei zu werden ihre Bestimmung«, lautet das Credo dieser Schrift, auf die der konservativ eingestellte Komponist Hans Pfitzner mit dem polemischen und nationalistisch eingefärbten Pamphlet Futuristengefahr – bei Gelegenheit von Busoni’s Ästhetik reagierte. Janusköpfig zwischen Vergangenheit und Zukunft stehen die ein Jahr nach dem Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst komponierten Elegien für Klavier, in denen das Fundament der funktionalen Harmonik zumindest partiell stark gelockert erscheint. Ursprünglich enthielt der Elegien-Band fünf Stücke, denen Busoni zunächst noch ein – geradezu programmatisch Nach der Wendung überschriebenes – Präludium voranstellte. Später fügte er noch die Klavierfassung seiner Berceuse von 1909 als siebtes Stück hinzu. Wie eng die Elegien mit anderen Werken Busonis verbunden sind, kann allein daraus geschlossen werden, dass Nach der Wendung als einziges Stück nicht als Bearbeitung einer früheren oder als Vorstufe einer späteren Komposition zu erkennen ist. So kehrt die dritte Elegie (das Choralvorspiel Meine Seele bangt und hofft zu Dir) in der Fantasia Contrappuntistica wieder, während die vierte (Turandots Frauengemach. Intermezzo) eine Bearbeitung des fünften Satzes der Orchester-Suite aus der Musik zu Gozzis Turandot darstellt. Busoni selbst sah in der sechsten Elegie (Erscheinung. Notturno) »wohl das merkwürdigste« Stück der Sammlung. In der Tat fällt es durch harmonische und tonale Extravaganzen auf, die freilich in die Form eines Lisztschen Virtuosenstücks gekleidet sind – worin sich Busonis Zwitterstellung zwischen »romantischem« Virtuosentum und seinem auch theoretisch verfochtenen Aufbruch in die Moderne offenbart. 20 Paul Hindemith: Sonate für Viola und Klavier op. 25, 4 Busoni war einerseits selbst Anfeindungen ausgesetzt, konnte andererseits aber auch kräftig austeilen – wie nicht nur seiner Erwiderung auf Pfitzners Futuristengefahr, sondern auch Äußerungen über andere Tonkünstler, so über Paul Hindemith, zu entnehmen ist: »der komponiert mit derselben Selbstverständlichkeit, wie ein Hund bellt und ein Hahn kräht […], was ich bedaure ist das Wesen, das man von dem komponierenden Bratschisten macht und das ihn in dem Glauben an seine erreichte Meisterschaft bekräftigt: womit ich eigentlich es besser mit ihm meine als seine Anstauner.« Nun, Busoni wollte die Bezeichnung »komponierender Bratschist« gewiss abschätzig verstanden wissen, für sich genommen verkörperte Hindemith dies jedoch in bestem Sinne: Zum einen spielte er die Viola im 1921 gegründeten Amar Quartett, das sich gezielt der zeitgenössischen Musik widmete und bei den (im gleichen Jahr ins Leben gerufenen) Donaueschinger Musiktagen mitwirkte; und zum anderen schrieb er Herausragendes für Bratsche alleine und Bratsche mit Klavier sowie Konzerte – was zumal Tabea Zimmermann motiviert, sich gerade für Paul Hindemith und sein Schaffen immer wieder einzusetzen. Zu den Werken mit Klavierbegleitung gehört die Sonate op. 25 Nr. 4, die 1922 entstand – zu einer Zeit, als Hindemiths vormals expressionistischer Ansatz, realisiert etwa in seiner Oper Mörder, Hoffnung der Frauen (1919), allmählich in einer linearen, gleichsam »versachlichten« Schreibweise aufging. Dies betraf freilich nicht Hindemith allein, sondern war Ausdruck eines neuen – unter dem Schlagwort »Neue Sachlichkeit« subsumierten – Lebensgefühls im Zeichen von Kino, Jazz, Sport, 21 Zerstreuungen jeglicher Art, Faszination für Maschinen und vor allem hektischer Betriebsamkeit. So schilderte Hindemith 1922 in einem Brief stichpunktartig seine Geschäftigkeit: »Viel Orchester, sehr viele Konzerte, sehr viele Reisen. Und furchtbar viel komponiert […] chronischer Arbeitsfimmel.« Auf Hindemiths legendäres Komponiertempo mochte Busoni im Übrigen mit seiner oben zitierten Bemerkung ebenfalls angespielt haben. Nun spiegelt sich das Phänomen der Schnelllebigkeit in Vortragsanweisungen wie Rasendes Zeitmaß (Sonate op. 25, 1) oder Prestissimo (Streichquartett op. 16) wider, dennoch sind Hindemiths Werke keineswegs nur Momentaufnahmen oder Blitzlichter des Zeitgeistes. Sie sind zwar – wie jede Musik – Ausdruck ihrer Zeit, im Gegenzug aber ebenso, aufgrund ihrer kompositorischen Meisterschaft, von zeitloser Gültigkeit. Uneingeschränkt steht dafür auch die Sonate op. 25 Nr. 4: mit der von gleißender Emphase flankierten Balance zwischen stoischem Fortschreiten und scheinbar ziellosem Kreisen im Kopfsatz, mit dem fast träumerisch-introvertierten Innehalten im langsamen Mittelsatz und dem jähen Erwachen im Finale, in dessen nervösem, sprunghaftem Gestus das (alles überrollende) Räderwerk der »Moderne« eindringlich aufscheint. Egbert Hiller 22 Tabea Zimmermann Ein Portrait von Johannes Hirschler Gerne deutet man bei bedeutenden Malern, Schriftstellern und Musikern jeden Lebensmoment als unausweichlichen Schritt auf dem langen Weg zur Entfaltung des Genies – und übersieht dabei, wie viele glückliche Umstände zusammenkommen müssen, damit eine außergewöhnliche Begabung auch genährt wird und sich entfalten kann.Tabea Zimmermann beginnt mit drei Jahren Bratsche zu spielen. Ein ungewöhnlicher Einstieg. Viele Bratschistinnen und Bratscher spielen zunächst Geige und steigen irgendwann um auf das Alt-Instrument der Streicherfamilie. Nicht so Tabea Zimmermann, die 1966 als viertes Kind in eine musisch veranlagte Familie im badischen Lahr geboren wird. Die älteren Geschwister spielen jedes ein Instrument. Klavier, Geige und Cello sind schon vergeben, aber die Dreijährige will auch mitspielen. »Meine älteren Geschwister mussten jeden Tag üben. Da habe ich mir eben auch ein Notenpult genommen, zwei Kochlöffel aus der Küche geholt und eine Viertelstunde mitgeübt«. Das hält sie, starrköpfig wie sie ist, ein halbes Jahr durch, bis die Eltern den Geigenlehrer der älteren Schwester ansprechen, Dieter Mantel an der Musikschule Lahr. »Er hatte die Vision, dass auch Kinder mit Bratsche beginnen könnten«, erinnert sich Tabea Zimmermann. »Ich bekam eine Achtelgeige mit Bratschensaiten, das muss jämmerlich gequietscht haben«. Jetzt kann sie mitspielen im Geschwisterverbund, vor allem Streichtrio mit den Schwestern. Sie hat ihre Nische, in der sie sich in Ruhe entwickeln kann: »Als jüngeres Geschwisterkind bekommt man eine Menge mit, ohne aktiv daran zu arbeiten. Man will es den älteren zeigen und fühlt sich angespornt. Ich hatte wahnsinniges Glück, bei der Bratsche zu landen. Junge Bratscher gab es gar nicht, und wo immer ich hinkam, war ich die süße Kleine.« 23 Zehn Jahre bleibt Tabea Zimmermann bei Dieter Mantel: »Noch heute ist er für mich mein wichtigster Lehrer. Er hat uns Kindern die Lebendigkeit und das Spontane an der Musik mitgegeben, und auch das Verständnis für Kammermusik.« Mit dreizehn geht sie an die Freiburger Musikhochschule, das Gymnasium wird sie nicht beenden. Bei Ulrich Koch an der Hochschule erwirbt sie sich Repertoire, eine stabile Technik und die Fähigkeiten zum Auftreten. In ihrer Freiburger Zeit spielt sie auch zum ersten und bislang einzigen Mal die Viola d’amore, für eine Aufführung der Johannes-Passion. »Das hat mein Verständnis von Bratschentechnik völlig umgekrempelt. Ich hatte bis dahin immer mit Schulterstütze gespielt, und das geht auf der Viola d’amore nicht. Da musste ich ohne auskommen und merkte mit einem Mal, was mir das auf der Bratsche für Möglichkeiten bot.« Von Freiburg geht sie für ein kurzes und intensives Aufbaustudium ans Salzburger Mozarteum zu Sándor Végh, sie nimmt an Wettbewerben teil und konzertiert. »Mit sechzehn, siebzehn Jahren war ich plötzlich Berufsmusikerin, ohne Gelegenheit gehabt zu haben, zu überlegen, was ich eigentlich werden will.« Das war nicht immer leicht für sie: »Auf meinen Konzertreisen kam ich überall zum ersten Mal hin und kannte niemanden, und ich wusste auch nicht, wie man Kontakte knüpft. Manchmal habe ich nach drei oder vier Tagen das erste Mal wieder gesprochen, wenn ich etwas eingekauft habe. Dann habe ich sogar ein bisschen gestottert.« Heute sind ihr die Konzertsäle der Welt vertraut, und sie trifft häufig auf alte Bekannte. Besonders glücklich ist sie auf den Konzertreisen des Arcanto Quartetts, das sie 2002 gemeinsam mit den befreundeten Musikern Antje Weithaas, Daniel Sepec und Jean-Guihen Queyras gegründet hat. »Das Tourneeleben ist mir außerordentlich suspekt. Aber mit dem Quartett ist es herrlich, die gemeinsamen Konzerte, die Zugfahrten, man ist immer in Gesellschaft.« 1982 gewinnt Tabea Zimmermann den internationalen Concours in Genf, 1984 den Wettbewerb in Budapest. Ein Jahr zuvor entscheidet sie den Wettbewerb »Maurice Vieux« in Paris für sich. Der erste Preis ist eine flammend rot-orange Bratsche des zeitgenössischen Geigenbauers Etienne Vatelot. Tabea Zimmermann reagiert mit badischem Understatement: »Ich dachte zunächst, was will ich mit einer neuen Bratsche. Sie schien mir damals viel zu groß. Aber sie war von Anfang an gut, und wir haben uns sehr miteinander angefreundet und entwickeln uns gemeinsam weiter.« Anders als italienische Meisterinstrumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert, etwa von Guarneri und Stradivari mit ihrem brillanten, aber schmalen Klang, ermöglicht ihr das Instrument ihren charakteristisch großen, strahlenden Ton und die profunde Kraft, die sie auf der tiefsten Saite, der C-Saite, entwickelt. Die regt sogar György Ligeti zu einer ihr gewidmeten Komposition an: »Er hatte mich in Köln bei der Uraufführung eines Bratschenkonzertes gehört, das mit einem traurigen jüdischen Thema auf der C-Saite beginnt. In der Pause kam er zu mir und sagte, ›wenn Sie so weiterspielen, bekommen Sie noch ein Stück von mir‹. Der erste Satz seiner Sonate wird ausschließlich auf der C-Saite gespielt und ist technisch absolut grenzwertig.« Auch andere Komponisten schreiben für sie, darunter Größen wie Wolfgang Rihm, Sally Beamish und Heinz Holliger. Neue Musik ist ein wesentlicher Bestandteil ihres Repertoires, inzwischen hat sie mehr als dreißig Uraufführungen gespielt. Das große Solorepertoire wie die Bratschenkonzerte von Paul Hindemith, Béla Bartók und Alfred Schnittke spielte sie mit Dirigenten wie Kurt Masur, Christoph Eschenbach, Nikolaus Harnoncourt, James Conlon und David Shallon. 24 Es ist ihre besondere Fähigkeit, einerseits mühelos solistisch ein ganzes Orchester zu überstrahlen, andererseits ganz selbstverständlich in der Kammermusik einen dienenden Part einzunehmen. Sie ist viel gefragt in den unterschiedlichsten Besetzungen und musiziert mit Partnern wie Heinz Holliger, Frank Peter Zimmermann, Silke Avenhaus, Pierre-Laurent Aimard, Alfred Brendel, Gidon Kremer und Steven Isserlis. Ein Kritiker der Frankfurter Rundschau bringt auf den Punkt, warum sie weltweit ihr Publikum wie ihre Kollegen zu faszinieren vermag: »Wenn Tabea Zimmermann als Bratscherin in einem Kammerensemble musiziert, beginnen die Stücke von innen heraus zu leuchten«. Mit Hartmut Höll, dem langjährigen Begleiter von Dietrich Fischer-Dieskau, hat sie eine enge künstlerische Zusammenarbeit entwickelt, die auch auf etlichen ihrer inzwischen rund 30 Einspielungen dokumentiert ist. 1987 lernt Tabea Zimmermann ihren ersten Mann, den Dirigenten David Shallon kennen. Mit ihm hat sie die beiden Söhne Yuval und Jonathan, die sie auch auf ihre Tourneen mitnimmt, wann immer es geht. »Die Schwangerschaften haben mich sehr verändert, alles wurde viel existenzieller dadurch. Vielleicht tritt die Bratsche manchmal in den Hintergrund, aber wenn ich Musik mache, dann hundertprozentig. Durch die Kinder habe ich heute ein viel reicheres Gefühlsleben, inner- und außerhalb der Musik.« Mit ihrem Mann konzertiert sie viel gemeinsam, bis zu seinem plötzlichen Tod im Jahr 2000. Ein Jahr später lädt sie die Freunde Antje Weithaas und Jean-Guihen Queyras dazu ein, am Todestag ihres Mannes mit ihr gemeinsam zu musizieren. Daraus entwickelt sich 2002 das Arcanto Quartett. »Ich habe lang gezögert, obwohl ich viel Kammermusik gespielt habe. Für mich muss 25 Tabea Zimmermann, 2004 in der Kölner Philharmonie Kammermusik aus dem inneren Bedürfnis entstehen, sich mit Menschen so zu verschränken, dass jeder seine Seele öffnet und man gemeinsam ausdrückt, was in den Noten steht.« Und mit diesem Anspruch, der keine Hierarchien und angemaßte Autorität akzeptiert, bestreitet sie auch ihre Solokonzerte: »Wenn ich irgendwo gastiere und ein Stück zum fünfundzwanzigsten Mal spiele, dann habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht. Gelegentlich treffe ich auf Dirigenten, die das Stück nicht kennen oder vielleicht auch nicht mögen. Dann gehe ich offensiv auf das Orchester zu und teile ihm meine musikalischen Ideen mit«. Zum Selberdirigieren wäre der Schritt nicht weit, aber auch da geht sie ihre eigenen Wege: »Mit den Bochumer Symphonikern habe ich die Streicherserenade von Brahms gespielt, als eine Art 2. Konzertmeisterin vom ersten Pult der Bratschen aus, die ich den 1. Geigen gegenüber platziert habe. Es ist klanglich ein enormer Unterschied, ob ein Tempowechsel auf Anweisung kommt oder aus einem gemeinsamen Atem, auch wenn man dafür acht Proben braucht«. Ein ähnliches Projekt hat sie auch mit dem Chamber Orchestra of Europe gespielt. Seit 2003 ist Tabea Zimmermann mit Steven Sloane, dem Chefdirigenten der Bochumer Symphoniker, verheiratet. Auch diese Beziehung hat eine starke musikalische Seite. Zuletzt gingen sie gemeinsam mit dem Bundesjugendorchester, dem Tabea Zimmermann einst selbst angehörte, und dem Bratschenkonzert On Opened Ground von Mark-Anthony Turnage auf Tournee. Im Herbst 2005 waren sie gemeinsam in China beim Musikfestival in Peking. Mit dabei: die 2003 geborene gemeinsame Tochter Maya und ihre Brüder: »So oft es geht, nehmen wir sie mit. Wir alle profitieren sehr viel von diesen Reisen, und versuchen, das intensiv nachzubereiten.« 26 Neu – oder vielmehr wieder neu – ist für sie das Spiel auf Darm- statt auf Stahlsaiten. Vor vier Jahren konzertierte sie im Bonner Beethoven-Haus auf der Bratsche, mit der der Komponist in der Hofkapelle seinen Dienst versah; das Instrument war wie zu seiner Zeit mit Darmsaiten bespannt. »Kürzlich habe ich auch meine eigene Bratsche mit Darmsaiten bespannt, um Bachfugen zu spielen und jetzt mit Christopher Hogwood und dem Basler Kammerorchester eine Transkription von Mozarts Klarinettenkonzert. Das war das erste Mal seit zwanzig Jahren, dass ich wieder auf Darmsaiten gespielt habe. Ich hatte völlig vergessen, was für einen Preis ich für die Stahlsaiten bezahle in punkto Klangproduktion, Klangschattierungen und Ausdrucksmöglichkeiten.« Auch ihre Studenten werden sich wohl in den kommenden Semestern mit der Frage »Stahl- oder Darmsaiten?« auseinandersetzen. 1987 wurde Tabea Zimmermann Professorin an der Musikhochschule Saarbrücken. 1994 erhielt sie einen Ruf nach Frankfurt, und seit 2002 unterrichtet sie an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« in Berlin. So, wie sie für ihr Musikmachen einmal fixierte Interpretationen ablehnt, betreibt sie auch bei ihren Studierenden produktive Verunsicherung: »Die sind zunächst völlig orientierungslos, weil ihnen niemand mehr sagt, Aufstrich, Abstrich, 2. Lage, 4. Lage, sondern weil ich ihnen lauter Fragen stelle. Es hat mit einem Kunststudium nichts zu tun, wenn man genaue Spielanweisungen gibt. Man muss bewusst Entscheidungen treffen und begründen können, nur dann kann man von Interpretation sprechen«. Aber genauso wie sie sie fordert, ist sie auch da für ihre Studenten: »Manche kommen auch zu mir nach Hause, und manchmal kann man auch mit einer ausführlichen Beratung am Telefon die Seele wieder so ins Gleichgewicht bringen, dass man wieder den richtigen Lagenwechsel machen kann.« – Nur üben als Selbstzweck, das hat bei ihr keinen Platz: »Es geht immer darum, etwas zu lernen, um damit eine musikalische Idee auszudrücken.« 27 Biografien Arcanto Quartett Arcanto Quartett Nach mehrjährigem gemeinsamen Kammermusikspiel in wechselnden Formationen, im Sommer 2002 erstmalig als Streichquartett, haben Antje Weithaas, Daniel Sepec, Tabea Zimmermann und Jean-Guihen Queyras im selben Jahr das Arcanto Quartett gegründet. Im Juni 2004 gab das Arcanto Quartett in Stuttgart erfolgreich sein Debütkonzert. In den darauf folgenden Spielzeiten war das Quartett u.a. im BeethovenHaus Bonn, im Vredenburg Utrecht, im Théâtre du Châtelet Paris, im Conservatoire royal de Bruxelles, bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen, bei Leif Ove Andsnes’Kammermusik-Festival in Risør sowie in der Wigmore Hall London, in der Alten Oper Frankfurt, im Concertgebouw Amsterdam und in Mailand zu hören. Höhepunkte der laufenden Saison sind die Debüts des Arcanto Quartetts bei den Festivals in Helsinki, Edinburgh und Montreux, im Konzerthaus Wien, im Megaron Athen und im Auditorio Nacional de Música in Madrid. Im November 2006 ging das Arcanto Quartett außerdem erstmals auf eine Japan-Tournee. In der Kölner Philharmonie spielt das Arcanto Quartett nun zum ersten Mal. Kirill Gerstein Seine musikalische Ausbildung erhielt Kirill Gerstein zunächst im russischen Voronezh, wo er eine Musikschule für besonders begabte Kinder besuchte. 1993 wurde er dann mit 14 Jahren der jüngste Student in der Geschichte des Berklee College of Music in Boston, nachdem er auf einem Jazzfestival in Polen entdeckt worden war. Nach seinem zweiten Besuch der Sommerkurse in Tanglewood wechselte er an die Manhattan School of Music und studierte bei Solomon Mikowsky. 2000 debütierte Kirill Gerstein mit dem Tonhalle-Orchester Zürich unter David Zinman in Europa, 2002 beim Ravinia Festival mit dem Chicago Symphony Orchestra 28 Kirill Gerstein unter Christoph Eschenbach. In der aktuellen Saison tritt Kirill Gerstein mit dem Rotterdam Philharmonic Orchestra, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Hong Kong Philharmonic Orchestra, dem Detroit Symphony Orchestra, dem Indianapolis Symphony Orchestra sowie dem Zürcher Kammerorchester und auf einer großen Tournee durch Deutschland mit den Moskauer Philharmonikern auf. Mit Soloabenden gastiert er im Konzerthaus Wien, in Madrid, Las Palmas und Badenweiler. Verschiedene Kammermusikprojekte mit Steven Isserlis, Kolja Blacher, Clemens Hagen und Tabea Zimmermann führen ihn durch ganz Europa. 2006 erschien in Zusammenarbeit mit dem Klavier-Festival Ruhr und der Zeitschrift FonoForum eine Live-CD von Kirill Gerstein. Bei uns ist er regelmäßig zu Gast, zuletzt im November 2006 im Rahmen der Reihe »Weltbürger Strawinsky«. Danjulo Ishizaka Danjulo Ishizaka, geboren 1979, studierte bei Hans-Christian Schweiker in Köln, an der Indiana University und an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« in Berlin – von 1998 bis 2004 bei Boris Pergamenschikow, anschließend bei Antje Weithaas und Tabea Zimmermann. Er gewann u. a. 2001 den Ersten Preis beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD München sowie 2002 den Grand Prix Emanuel Feuermann der Kronberg Academy und der Universität der Künste Berlin. Danjulo Ishizaka gastiert regelmäßig bei bedeutenden Festivals wie dem Kronberg Cello-Festival, dem Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Rheingau Musik Festival, dem Jerusalem Chamber Music Festival, beim Kissinger Sommer und bei den Osterfestspielen Salzburg. Tourneen führen ihn durch Europa, in die USA, nach China, Russland und Japan. Im März 2006 debütierte er in der New Yorker Carnegie Hall. Er konzertiert mit Künstlern wie Gidon Kremer oder Lars Vogt und renommierten Orchestern wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Baltimore Symphony Orchestra, dem NHK Symphony Orchestra und den Wiener Symphonikern unter Dirigenten wie Christoph Poppen, Mstislav Rostropovich und Krzysztof Penderecki. In dieser Saison gibt er auf Europa-Tourneen seine Debüts mit dem Gewandhausorchester Leipzig, dem Bruckner Orchester Linz unter Gerd Albrecht und dem Royal Philharmonic Orchestra.Die BBC wählte ihn für das renommierte »New Generation Artists«-Programm aus. Seine Debüt-CD, die er mit dem Pianisten Martin Helmchen eingespielt hat, wurde 2006 mit dem ECHO Klassik (Nachwuchskünstler des Jahres) ausgezeichnet. Danjulo Ishizaka spielt das von Wolfgang Schnabl erbaute Violoncello der Kronberg Academy, das zuvor von Boris Pergamenschikow benutzt wurde, sowie das Stradivari-Cello »Lord Aylesford« (1696) der Nippon Music Foundation. Bei uns ist er zum ersten Mal zu Gast. Danjulo Ishizaka 29 Antoine Tamestit Antoine Tamestit war Schüler von Tabea Zimmermann, Jesse Levine und Jean Sulem und gewann mehrere Erste Preise, u.a. bei den Wettbewerben »Maurice Vieux« (Paris 2000) und »William Primrose« (Chicago 2001), bei den Young Concert Artists International Auditions (New York 2003) und beim Musikwettbewerb der ARD (2004). Seit Februar 2006 ist er Stipendiat des Borletti-Buitoni Trust. Gemeinsam mit Markus Hadulla spielte er u.a. im Concertgebouw Amsterdam, im Megaron Athen, im Festspielhaus Baden-Baden, im Palais des Beaux-Arts Brüssel, in der Wigmore Hall London, in der New Yorker Carnegie Hall und im Musikverein Wien. Zu weiteren Kammermusikpartnern gehören das Quatuor Ébène, Isabelle Faust, Gidon Kremer, Christian Poltéra, Emmanuel Pahud, Daniel Hope, Jan Vogler, Renaud und Gautier Capuçon, Janine Jansen und Mirijam Contzen. Als Solist arbeitete er u. a. mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, dem Beethoven Orchester Bonn, der Dresdner Philharmonie, dem Saarländischen Staatsorchester, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem BBC Philharmonic und dem Orchestre Philharmonique de Liège. In der Saison 2006/07 debütiert er beim Gewandhausorchester Leipzig und beim Radio-Symphonieorchester Wien und ist »Artist in Residence« des Theaters der Stadt Duisburg. Regelmäßig konzertiert er bei internationalen Festivals wie dem Rheingau Musik Festival, dem Festival der Kronberg Academy, dem Kissinger Sommer, dem Kammermusikfestival Lockenhaus, dem Moritzburg Festival, der Schubertiade Schwarzenberg, dem Festival d’Aix-enProvence, dem Jerusalem Chamber Music Festival und dem Festival de Divonne. Antoine Tamestit spielt auf einer Viola von Etienne Vatelot. Auf dem Podium der Kölner Philharmonie gab er im Januar 2006 sein Debüt im Rahmen der Reihe »Rising Stars«. Tabea Zimmermann Tabea Zimmermann erhielt im Alter von drei Jahren ihren ersten Bratschenunterricht, zwei Jahre später begann sie mit dem Klavierspiel. An ihre Ausbildung bei Ulrich Koch an der Musikhochschule Freiburg schloss sich ein kurzes, intensives Studium bei Sándor Végh am Mozarteum in Salzburg an. Eine Reihe von Wettbewerbserfolgen krönte ihre Ausbildung, darunter Erste Preise bei den internationalen Wettbewerben in Genf (1982) und Budapest (1984) sowie beim Wettbewerb »Maurice Vieux« in Paris (1983). Dort erhielt sie als Preis eine Bratsche des zeitgenössischen Geigenbauers Etienne Vatelot, auf der sie seitdem konzertiert. Tabea Zimmermann zählt seit vielen Jahren zu den renommiertesten Musikern unserer Zeit. Als Solistin ist sie regelmäßig zu Gast bei den großen internationalen Orchestern wie den Berliner Philharmonikern oder dem London Symphony Orchestra. In der vergangenen Saison 30 Antoine Tamestit gastierte sie im Rahmen zweier Residencies in der Alten Oper Frankfurt und im Concertgebouw Amsterdam. Zu den weiteren Höhepunkten der Saison zählten Konzerte mit dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Orchestre Philharmonique de Radio France und den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon Rattle bei den Salzburger Festspielen, daneben kammermusikalische Auftritte mit Hartmut Höll in Boswil, Stuttgart und Zürich, mit Antje Weithaas in Antwerpen und Ludwigshafen, mit Silke Avenhaus in der Wigmore Hall London sowie mit Christian Tetzlaff, Alban Gerhardt und Lars Vogt beim Edinburgh Festival und der Schubertiade Schwarzenberg. Im Jahr 2002 gründete sie mit den Geigern Antje Weithaas und Daniel Sepec sowie dem Cellisten Jean-Guihen Queyras das Arcanto Quartett. Das Debütkonzert des Quartetts fand mit großem Erfolg im Juni 2004 in Stuttgart statt. Anschließend gastierte das Quartett u. a. im Beethoven-Haus Bonn, in der Alten Oper Frankfurt, im Concertgebouw Amsterdam, im Musikzentrum Vredenburg in Utrecht, im Théâtre du Châtelet in Paris sowie im Conservatoire Royal in Brüssel. Tabea Zimmermann hat das Interesse vieler zeitgenössischer Komponisten für die Bratsche geweckt und zahlreiche neue Werke in das Konzert- und Kammermusikrepertoire eingeführt. 1994 spielte sie mit großem Erfolg die Uraufführung der eigens für sie komponierten Sonate für Viola solo von György Ligeti. Auch die Erstaufführungen dieses Werks in London, Paris, Jerusalem, Amsterdam und Japan fanden euphorischen Anklang bei Publikum und Presse. Des Weiteren spielte sie in den vergangenen Saisons die Uraufführungen von Heinz Holligers Recicanto für Viola und Orchester mit dem WDR Sinfonieorchester Köln, das Bratschenkonzert Nr. 2 von Sally Beamish mit dem Scottish Chamber Orchestra sowie das 2. Bratschenkonzert »Über die Linie« IV von Wolfgang Rihm mit der Jungen Deutschen Philharmonie. Zahlreiche CDs dokumentieren Tabea Zimmermanns musikalische Bandbreite, unter anderem mit Werken von Bartók, Brahms, Bruch, Britten, Hindemith, Schostakowitsch Tabea Zimmermann und Strawinsky. Ihre jüngste Veröffentlichung ist eine Live-Einspielung von Berlioz’ Harold en Italie mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Sir Colin Davis. Für ihr künstlerisches Wirken ist Tabea Zimmermann mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Frankfurter Musikpreis, dem Hessischen Kulturpreis und dem Internationalen Preis der Accademia Musicale Chigiana in Siena. Im Januar 2006 erhielt sie den Paul-Hindemith-Preis der Stadt Hanau für ihre besonderen Verdienste in der Auseinandersetzung mit dem Werk Paul Hindemiths. Seit Oktober 2002 ist sie Professorin an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« in Berlin. Zuvor unterrichtete sie bereits von 1987 bis 1989 an der Musikhochschule Saarbrücken sowie von 1994 bis 2002 an der Frankfurter Hochschule für Musik. Auf dem Podium der Kölner Philharmonie war sie zuletzt im September vergangenen Jahres in den beiden ersten Portrait-Konzerten zu erleben. 31 Impressum Herausgeber: KölnMusik GmbH Louwrens Langevoort Intendant der Kölner Philharmonie und Geschäftsführer der KölnMusik GmbH Postfach 102163, 50461 Köln www.koelner-philharmonie.de Redaktion: Andreas Günther Redaktionelle Mitarbeit: Dr. Tilman Fischer, Heidi Rogge Fotorecherche: Eva Schütz Bildnachweis: akg-images S. 3, 20/21 Arnold Schönberg Center Wien S. 11 Susesch Bayat S.30/31 Christoph Fein S. 28 oben Jürgen Hasenkopf S. 29 Keystone Pressedienst / Conti Press S. 15 Lebrecht Music & Arts S. 4, 16/17, 19 mauritius images / Edmund Nägele S. 12 Klaus Rudolph Cover, S. 23, 25, 26, 28 unten, 30 Schott-Archiv / Kropp S. 18 Hyou Vielz S. 7, 8 Textnachweis: Die Texte von Ulrike Heckenmüller, Dr. Egbert Hiller und Johannes Hirschler sind Originalbeiträge für die KölnMusik. Gestaltung: ROT Designteam, Düsseldorf Produktion: adHOC Printproduktion GmbH, Köln Bitte beachten Sie noch folgende Hinweise: Sollten Sie elektronische Geräte, insbesondere Handys bei sich haben: Bitte schalten Sie diese in der Kölner Philharmonie zur Vermeidung akustischer Störungen aus. Danke! Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass Bild- und Tonaufnahmen in der Kölner Philharmonie aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet sind. 32