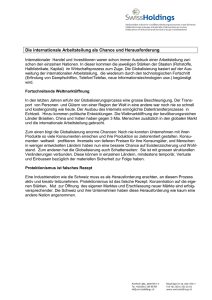Zu den Ängsten über den globalen Kapitalismus
Werbung

6.8.2001 Zu den Ängsten über den globalen Kapitalismus Thesen zur Diskussion mit Elmar Altvater auf einer Veranstaltung der Ludwig-Erhard Stiftung „Globaler Kapitalismus: Bändigen oder tolerieren?“ vom 27. März 2001 in Berlin, überarbeitet und aktualisiert Horst Siebert* In den alten Industrienationen geht die Angst um, die Angst vor der Globalisierung, die Furcht, dass die aufstrebenden Volkswirtschaften den Industrieländern die Wettbewerbsvorteile wegkonkurrieren, das Bangen, dass Arbeitsplätze verloren gehen, und die Sorge, dass die Altländer im globalen Wettbewerb an Wohlstand verlieren. Gleichzeitig machen die Schwellen- und Entwicklungsländer geltend, dass sie in ihrer Entwicklung gehemmt werden, dass sie sich marginalisiert fühlen, ja dass sie ihre Identität verlieren. Außerdem machen sich Befürchtungen breit, dass außerökonomische Wertebereiche – so der Schutz der Umwelt – in der internationalen Arbeitsteilung unter die Räder geraten. In dieser Diskussion erscheint es wichtig, einige zentrale Punkte festzuhalten: 1. Jede Volkswirtschaft kann grundsätzlich durch einen intensiveren internationalen Güteraustausch Wohlstand gewinnen. Von daher bietet Globalisierung Chancen. Es ist unbestritten, dass sich die internationale Arbeitsteilung verändert. Dabei sind auf den Gütermärkten zwei wichtige Tendenzen zu beobachten: Zum einen werden Marktsegmentierungen abgebaut; dadurch wird die Interdependenz der Produktion in verschiedenen Ländern durch den Austausch von Gütern — einschließlich Dienstleistungen —, durch internationalen Kapitalverkehr und durch Transfer von technischem Wissen intensiver. Märkte werden bestreitbarer; der Wettbewerb wird härter. Zum anderen treten mit den neuen Marktwirtschaften Mittel- und Osteuropas und mit China wichtige Regionen der Welt, die in der Vergangenheit mehr oder * Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Kiel und Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 2 weniger abgeschlossen waren, in die internationale Arbeitsteilung ein. Wir erleben derzeit einen historischen Prozess, bei dem nahezu ein Viertel der Weltbevölkerung in die Weltwirtschaft integriert wird. Die internationale Arbeitsteilung ist kein Nullsummen-Spiel, bei dem das eine Land lediglich dann gewinnt, wenn das andere Land verliert. Sie ist vielmehr ein Positivsummenspiel, bei dem alle Volkswirtschaften Vorteile haben. Dies gilt vor allem deshalb, weil für jedes der an der Arbeitsteilung partizipierenden Länder über den heimischen Absatzbereich hinaus zusätzliche Absatzmöglichkeiten, also neue Märkte, entstehen. Anders gewendet: Man kann Güter kostengünstiger vom Ausland haben, als man sie selbst produzieren kann. Technisch heißt dies, dass sich nach Aufnahme von Handel die Terms of Trade1 sowohl der Industrienationen als auch der Schwellenländer verbessern. Für die Industrieländer lohnt es sich verstärkt humankapitalintensiv hergestellte Produkte zu erzeugen, für die Schwellenländer arbeitsintensive Produkte. Zusätzlich stiftet die These des intra-industriellen Handels Hoffnung für die Weltwirtschaft: Während bei dem interindustriellen Handel Länder nur dadurch Vorteile aus internationaler Arbeitsteilung ziehen können, dass sie Sektoren mit einem relativen Preisnachteil bei sich schrumpfen lassen, bedeutet intra-industrieller Handel, dass der gleiche Sektor in verschiedenen Ländern durch eine intensivere Arbeitsteilung expandieren kann. Freihandel lohnt sich für ein einzelnes Land selbst dann, wenn sich die anderen Staaten abschotten. (Free trade for one theorem). Auch die Schwellenländer gewinnen. Den (nicht erdölexportierenden) Entwicklungs- und Schwellenländern ist es gelungen, ihren Anteil am Welthandel von 17 Prozent (1970) auf etwa 30 Prozent (1998) nahezu zu verdoppeln; die vier Tiger haben ihren Anteil von 3 vH (1970) auf etwa 9 vH erhöht. Dies heißt, dass sich die Entwicklungs- und Schwellenländer insgesamt in die Weltwirtschaft integriert haben. Vor allem haben es die Schwellenländer geschafft, einfache und mittlere Industriegüter in ihre Exportpalette aufzunehmen. 1 Sie sind definiert als Preisindex der Exportgüter zum Preisindex der Importgüter des jeweiligen Landes. 3 Angesichts dieser Entwicklungen ist es verblüffend, dass Ökonomen nun darauf hinzuweisen beginnen, dass die Globalisierung nicht uferlos zunehmen kann. Die Exportquoten der großen Länder bewegen sich bei gut 10 vH des Bruttoinlandsprodukts, so dass 90 vH der Produktion nicht direkt von der internationalen Arbeitsteilung erfasst sind; bei kleineren Volkswirtschaften liegen die Exportquoten deutlich höher. Nachbarschaftseffekte spielen beim internationalen Handel eine wichtige Rolle, regionale Integrationen stärken diese räumlichen Verbünde, kurzum die geographische Distanz ist noch nicht gestorben. 2. Für die Arbeitnehmer bietet die internationale Arbeitsteilung Chancen auf höhere Realeinkommen. Die Sorge in den Industrieländern, das Hereindrängen der reichlich mit Arbeitskräften ausgestatteten Länder in Mittel- und Osteuropa und am pazifischen Rand – stellt man sich einen Weltarbeitsmarkt vor, so nimmt das Arbeitsangebot der Weltwirtschaft effektiv um ein Viertel zu - in die internationale Arbeitsteilung, habe negative Auswirkungen, so dass die Löhne in Peking gesetzt werden, sind unbegründet: Zwar steigt effektiv in einem Gedankenexperiment das Arbeitsangebot der Welt, und auch wenn die arbeitsintensiven Produkte dieser bevölkerungsreichen Länder nicht alle direkt bei uns ankommen - China hat einen Weltmarktanteil von nur etwa 2 vH -, so drücken sie, so das Argument, bisher arbeitsintensive Anbieter wie Taiwan und Südkorea in höherwertige Produktionen. Manche Entwicklungs- und Schwellenländer tragen inzwischen in der Tat einen falschen Namen, sie sind längst zu neuen Industrieländern geworden, mit einem ähnlichen oder sogar einem größeren industriellen Anteil an ihrer gesamtwirtschaftlichen Produktion und an ihren Exporten als in den alten Industrieländern; sie stoßen mit neuen Produkten auf die oberen Sprossen der Weltproduktleiter vor. Aber: Die Arbeitnehmer in den Industrieländern sind besser qualifiziert, sie sind mit besserer Technologie und hochwertigerem Sachkapital ausgestattet, so dass sie über eine höhere Produktivität verfügen. Gleichzeitig entstehen neue Märkte, die vor allem die von den Industrielländern uns hergestellten Investitionsgüter aufnehmen. Mit anderen Worten: die Schranke der Marktgröße, so weit sie in der Vergangenheit eine Grenze für die Ausdehnung der internationalen Arbeitsteilung darstellte, wird zunehmend weniger Bedeutung haben..2 Im 2 Etwa zehn Prozent der deutschen Exporte gehen inzwischen nach Mittel- und Osteuropa, ebenso viel wie in die USA. Gerade wegen der neuen Märkte dürfen die Industrieländer erwarten, dass sich ihre 4 Übrigen müssen die Arbeitskräfte insgesamt auch bei rein intersektoralem Handel nicht verlieren. Empirisch lässt sich ein Druck auf die Löhne der Industrieländer im Zusammenhang mit dem Handel mit den Schwellenländern bisher nicht feststellen. Unbestritten ist aber, dass sich in den Industrieländern die Struktur der Nachfrage nach Arbeitskräften massiv verschiebt, und zwar zu Ungunsten der weniger Qualifizierten. Dies ist in allen Industrieländern zu beobachten, in Europa ebenso wie in Nordamerika. So hat in Deutschland in den letzten zwanzig Jahren im produzierenden Gewerbe die Nachfrage nach Unausgebildeten um 1,8 Millionen abgenommen, die Nachfrage nach Ausgebildeten dagegen nur um 0,4 Millionen. Die Ausgebildeten sind also von dem Nachfragerückgang deutlich weniger stark betroffen. Im Dienstleistungsgewerbe ist im gleichen Zeitraum die Nachfrage nach Ausgebildeten um 2,8 Millionen gestiegen, nach Unausgebildeten nur um 0,8 Millionen. Die Ausgebildeten sind von der Nachfragezunahme also deutlich begünstigt. Als Ursache für diese Nachfrageverschiebung wird in der Literatur ein arbeitssparender technischer Fortschritt ausgemacht. Dabei wird eine originäre technologische Entwicklung unterstellt. Ein direkter Zusammenhang mit der internationalen Arbeitsteilung wird nicht gesehen, obwohl es nicht auszuschließen ist, dass der Austausch zwischen den bevölkerungsreichen Staaten und den reichlich mit Kapital ausgestatteten Ländern ein Anreiz sein kann, nach arbeitssparendem technischen Fortschritt zu suchen. Auf keinen Fall lässt sich argumentieren, dass die Arbeitnehmer in den Industrieländern verlieren, weil Arbeitskräfte in den Schwellenländern verstärkt für die Exportproduktion eingesetzt werden, und dass gleichzeitig die Arbeitskräfte in den Schwellenländern verlieren. Zumindest diese gewinnen, da sich die Nachfrage nach ihnen ausdehnt. Eine Illusion wäre es, dass sich weltweit der Lohn angleicht. So bin ich in einer Diskussion in Cordoba, Argentinien gefragt worden, ob es nicht einen Mindestlohn für die Welt geben sollte. Dafür sind die Arbeitsproduktivitäten zu unterschiedlich. Ein Mindestlohn, der weltweit bindet, würde die Arbeitslosigkeit in den Schwellenländern exorbitant ansteigen lassen. Es wäre ein Interesseninstrument zu Ungunsten der Arbeitnehmer in den Schwellenländern. Terms of Trade, also die relativen Tauschpreise, verbessern, das aber heißt Gewinne aus Handel für die Industrieländer. 5 3. Außer im Güteraustausch bieten sich den Staaten Vorteile auch durch die internationale Mobilität der Produktionsfaktoren Neben bestreitbaren Gütermärkten und der Zunahme des Weltarbeitsangebots bedeutet Globalisierung aber auch etwas Weiteres: eine größere Faktormobilität. So ist die Weltwirtschaft durch eine größere Mobilität des Kapitals gekennzeichnet. Die Direktinvestitionen nehmen in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich stärker zu, und zwar dreimal so stark als der Weltexport, der wiederum kräftiger — doppelt so kräftig — als die Produktion wächst. Und: Portfoliokapital ist weltweit mobil geworden. Es kann schlagartig, sozusagen per Knopfdruck, von einem in das andere Land umgeschichtet werden. Aber auch technisches Wissen ist im höchsten Maße beweglich. Ferner sind die hochqualifizierten Arbeitskräfte wesentlich mobiler geworden. Mit der Mobilität der Produktionsfaktoren gewinnt ein neuer Erklärungsansatz der internationalen Arbeitsteilung Bedeutung: das Paradigma des Standortwettbewerbs. Dabei geht es nicht darum, dass Unternehmen mit ihren Produkten auf den Gütermärkten der Welt im Wettbewerb stehen und dort wirtschaftlich um Marktanteile streiten, sondern dass Staaten oder Regierungen auf den internationalen Faktormärkten um die mobilen Produktionsfaktoren konkurrieren, also um das mobile Kapital, um das mobile technische Wissen und um die mobilen hoch qualifizierten Arbeitskräfte. Staaten können in diesem Standortwettbewerb gewinnen, wenn sie die mobilen Produktionsfaktoren zu Hause halten oder von draußen attrahieren und dadurch die Produktivität ihrer immobilen Faktoren steigern. Dies gilt für mobiles Sachkapital, für mobiles technisches Wissen und für mobile hochqualifizierte Arbeitskräfte. Staaten können auf diese Weise ihre komparativen Vorteile gestalten (acquired comparative advantage). So ist es den mittel- und osteuropäischen Ländern gelungen, einen Teil ihrer Bruttoinvestitionen durch ausländische Direktinvestitionen zu finanzieren, beispielsweise Polen gut 15 vH im Zeitraum 1995-1999. Besonders für Entwicklungs- und Schwellenländer besteht darin die Chance, schnell Zugang zu neuen Technologien zu finden. Die Kehrseite ist, dass man den zugewanderten Produktionsfaktoren eine Prämie zahlen muss. Will man dies nicht, so muss man auf ihre Zuwanderung verzichten. 6 Dort wo das Kapital abwandert, sehen sich der Staat oder die Regierung einem eingeengten Bewegungsspielraum gegenüber. Denn wenn Kapital abwandert oder es nicht hinreichend zuströmt, so hat ein Land eine geringere Steuerbasis. Und: Wandert Kapital ab oder strömt es nicht hinreichend zu, so werden die Arbeitnehmer schlechter mit Maschinen und Computern ausgestattet, die Arbeitsproduktivität wird geringer oder nimmt schwächer zu, die Chancen für Realeinkommen und Beschäftigung werden ungünstiger. Auch von daher wird die Steuerbasis schwächer, die Finanzierung der Systeme der sozialen Sicherung wird schwieriger. Analog lässt sich für mobiles technisches Wissen und hochqualifizierte Arbeitskräfte argumentieren. Staaten müssen deshalb stärker zwischen der negativen Wirkung der Besteuerung auf Kapital — hohe Steuern treiben die Investitionen ins Ausland — und der positiven Wirkung der Infrastruktur - eine gute Infrastruktur lockt Investitionen an – abwägen. Dies heißt aber nicht, dass Staaten machtlos geworden sind. Sie müssen sich auf den Standortwettbewerb einstellen. Und es heißt auch nicht, dass es bei den Steuern ein „race to the bottom“ gibt. Die einzelnen Länder haben nach wie vor ein breites Instrumentenspektrum, um ihre Standortgunst und damit ihre Entwicklungschancen zu verbessern: Bei der Besteuerung der Unternehmen müssen die Länder darauf achten, dass Kapital auch anderswo eingesetzt werden kann. Bei der Bereitstellung öffentlicher Güter ist das Äquivalenzprinzip zu beachten. Die Steuern müssen der angebotenen Leistung des Staates entsprechen. Die Stichworte lauten „Benefit Taxation“, „User Charges“, Knappheitspreise und Privatisierung der Infrastruktur. Die Grundlagenforschung und die Diffusion des neuen Wissens müssen gestärkt werden. Dies weist auf die Rolle des Universitätssystems und der Grundlagenforschung hin. Die Bedingungen für Investition, Innovation und Unternehmensführung müssen günstig sein. Der Staat darf durch seine Genehmigungspolitik den Marktzugang nicht vereiteln. Die Chancen für den Arbeitnehmer können dadurch verbessert werden, dass er über ein besseres Humankapital verfügt. Verblüffend ist, dass in der Literatur jetzt verstärkt darauf hingewiesen wird, dass ja die Kapitalmobilität gar nicht viel höher ist als vor dem ersten Weltkrieg, dass die Investitionen eines Landes überwiegend aus den nationalen Ersparnissen finanziert werden und die Kapitalbilanzen der einzelnen Volkswirtschaften in aller Regel nur einen geringen Prozentssatz des Bruttoinlandsprodukts ( etwa 3- 4 vH, in seltenen Fällen mehr) ausmachen. 7 4. Es gibt Bedingungen dafür, dass ein Land Gewinne aus der internationalen Arbeitsteilung und dem Standortwettbewerb zieht. Die Gewinne aus der internationalen Arbeitsteilung und aus dem Standortwettbewerb fallen nicht wie Manna vom Himmel. Es gibt Bedingungen dafür, dass sie eintreffen. Diese Bedingungen sind ausführlich in der Literatur der Entwicklungsländer diskutiert worden. Erstens: Ein wichtiger Aspekt ist, dass ein Land sich an veränderte Wettbewerbsbedingungen anpassen und sich neue Exportgüter erschließen kann. So ist es denkbar, dass das zentrale Exportgut eines Landes auf dem Weltmarkt von einem neuen Substitutionsgut ersetzt wird. Die Terms of Trade verschlechtern sich dann. Zweitens kann der Exportbereich nicht auf die gesamte Volkswirtschaft ausstrahlen (Exportenklave, kein carry over, duale Volkswirtschaft). Drittens können Länder in ihrer Position gefangen sein (locked in, Teufelskreise), so dass sie neuen Entwicklungen nicht begegnen können und keinen hinreichenden Schub für einen take-off entfalten können. Viertens sind wirtschaftliche Wachstums- und Entwicklungsprozesse pfadabhängig; Strukturen, die zu einem Zeitpunkt gegeben sind, wirken in die Zukunft fort. Fünftens fehlen oft entscheidende institutionelle Voraussetzungen, und zwar eine verlässliche Rahmenordnung, für wirtschaftliche Dynamik. Sechstens brauchen Konvergenzprozesse, bei denen die armen Länder aufholen können, viel Zeit. Siebtens sind Länder in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und in ihrer Rangordnung zurückgefallen, so Argentinien, das um 1900 zu den zehn reichsten Ländern der Erde zählte. Schließlich: Auch wenn ein Land Gewinne aus Außenhandel hat, ist damit noch nicht gesagt, dass alle Mitglieder der Gesellschaft gewinnen. Die Fixierung auf die Verteilungsdebatte kann wirtschaftliche Dynamik kosten. Für eine ganze Reihe von Volkswirtschaften lassen sich empirisch Konvergenzprozesse in der Weltwirtschaft feststellen. So haben viele asiatische Länder den relativen Abstand im Einkommen pro Kopf zu den USA in den letzten dreißig Jahren verkürzt. Dies gilt trotz des Rückschlags während der Währungskrise 1997 für die asiatischen Tiger, es trifft in den letzten zwei Jahrzehnten ebenfalls für China zu. Lateinamerika verharrt in fünf Jahrzehnten in der relativen Position zu den USA, wobei die verlorene Dekade der achtziger Jahren einer Abnahme im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf besonders ins Gewicht fällt (Siebert 1999, Figure 1.2). Nach empirischen Untersuchungen liegt die Konvergenzrate zwischen den Industrieländern bei etwa 1 vH pro Jahr; dieses Ergebnis dürfte sich eher noch bessern, wenn man die erfolgreichen Schwellenländer hinzufügt. Wählt man den Kreis der beobachteten 8 Volkswirtschaften dagegen weit (wie in der Untersuchung von Barro und Sala-i-Martin (1992) mit 98 Ländern), so stellt sich Divergenz ein. Dieses Resultat dürfte insbesondere auf die Länder Afrikas südlich der Sahara zurückzuführen sein. 5. Eine Abschottungsstrategie wird nicht erfolgreich sein Auch wenn es Bedingungen dafür gibt, dass Länder Gewinne aus der internationalen Arbeitsteilung und dem Standortwettbewerb ziehen, wird eine Abschottungsstrategie dazu führen, dass die Länder auf die möglichen Vorteile aus der internationalen Arbeitsteilung verzichten. Einfach weltweit Sand ins Getriebe zu schaufeln, mindert die Wohlfahrt für viele. Und auf einen Außenschutz zu setzen, lässt Chancen der Wohlstandssteigerung ungenutzt. Der Beleg hierfür ist die Erfahrung Lateinamerikas mit der fehlgeschlagenen Politik der Importsubstitution in den vier Jahrzehnten seit 1950. Ein anderer Beleg ist der Fehlschlag der Arbeitsteilung des Comecon, die sich im wesentlichen auf einen Binnenorientierung mit einer im Comecon von oben geplanten Spezialisierung stützte und letztlich kläglich scheiterte. Abschottung würde bedeuten, dass die Länder keine Signale mehr bekämen, wo die Gewinnchancen liegen. Die Länder würden die Knappheitspreise nicht mehr kennen, und die Unternehmen dieser Länder würden deshalb nicht wissen, in welche Richtung sie sich spezialisieren sollen. 6. Finanzkrisen wird es zwangsläufig immer wieder geben, wenn einzelne Länder von dem Pfad der Stabilität abweichen In den bisherigen Aussagen haben wir nur die Realwirtschaft betrachtet; Störungen können vom monetären Bereich ausgehen. Wir haben eine reichhaltige Erfahrung über die Hyperinflationen lateinamerikanischen Typs. Wenn wie in Brasilien die Geldmenge jährlich – wie im Zeitraum 1991- 1995 mit 219,9 vH zunimmt, darf man sich nicht wundern, dass die jährliche Inflationsrate bei 223, 7 vH liegt, also von stabilem Geld keine Rede sein kann. Dass dann die heimische Währung abgewertet werden muss, darf ebenfalls nicht überraschen. Und wenn diese Abwertung zeitweise hinausgezögert wird, so wenn die gleitende Anpassung die Inflationsdifferenz zum Ausland nicht hinreichend wiederspiegelt, muss es zwangsläufig zu einer Währungskrise kommen. Deren Ursache liegt in der mangelnden Stabilität, der Auslöser ist das Ausbleiben des kurzfristigen und kurzsichtigen Kapitalverkehrs, ja das Umdrehen des 9 Kapitalverkehrs, der einem currency run gleichkommt. Ohne eine solide nationale Stabilitätspolitik werden solche Krisen nicht zu vermeiden sein: Dies heißt, dass die Notenbank nicht die Budgetdefizite des Staates finanzieren darf, dass sie von der Politik unabhängig sein muss und auf einen stabilen Geldwert verpflichtet sein muss. Notwendig sind aber auch Bedingungen, die die Stabilität des Banken- und Finanzsektors sicherstellen. Die Dinge können wesentlich komplizierter sein als bei den typischen lateinamerikanischen Währungskrisen, wie die asiatische Krise des Jahres 1997 zeigte. Mangelnde Regulierung des Bankensektors zusammen mit einem Immobilienboom (wie in Thailand), eine etwas unglückliche Entwicklung des Exports und damit der Leistungsbilanz zusammen mit strukturellen Schwächen (wie in Kora) oder anderen Ursachenfaktoren (wie in Indonesien) können zu Währungskrisen führen, die sich gegenseitig anstecken. Das Stabilitätserfordernis wird in einem solchen Umfeld um so gravierender: Eine Volkswirtschaft muss wegen der Ansteckungsgefahr für eigene Immunstärke Sorge tragen. Dies ist nicht umsonst zu haben. Globalisierungsgegner werden nicht argumentieren können, Länder sollten sich um monetäre und finanzielle Stabilität nicht scheren. Dies würde sich in der mittleren Frist bitter rächen und zu Lasten der Menschen in diesen Ländern gehen. 7. Man braucht einen Ordnungsrahmen (global governance) in der internationalen Arbeitsteilung Aus einer ganzen Reihe von Gründen brauchen souveräne Staaten ein internationales Regelwerk für eine Reihe von Bereichen. Dabei geht es darum, dass Staaten (teilweise) auf ihre Souveränität verzichten und sich für ihr Verhalten an bestimmte Regeln binden. Ein sehr simpel erscheinender Ansatz lautet, mit den institutionellen Regelungen die Transaktionskosten zu senken. Aber dieser Ansatz trägt weit: er vermeidet strategisches Verhalten einzelner Länder (vor allem der großen) zum Nachteil der anderen, etwa in der Handelspolitik, er reduziert negative externe Effekte (dazu zählen auch Kriege) und schöpft positive externe Effekte aus. Damit umfasst dieser Ansatz auch öffentliche Güter, d.h. für den Ökonomen Güter, die von allen in gleicher Intensität genutzt werden wie die globale Umwelt, Biodiversität, die Verlässlichkeit 10 von Handelsregeln und die Stabilität des weltweiten Finanzsystems.3 Dementsprechend sollte sich das internationale Regelwerk auf die internationale Handelsordnung im Rahmen der WTO (einschließlich der Dienstleistungen) , die internationale Wettbewerbspolitik, globale Umweltgüter und die internationale Finanzordnung beziehen. Im Rahmen der Welthandelsordnung verpflichten sich die inzwischen 142 Mitgliedsländer der WTO, ihren Handel zu liberalisieren, Liberalisierungsschritte, die sie einem Land einräumen, auch allen anderen zu gewähren (Meistbegünstigung) und von protektionistischen Maßnahmen abzusehen. Von den Globalisierungsgegnern und einer Reihe der NGOs, der Nichtregierungsorganisationen, wird eine mögliche Lösung darin gesehen, dass in den Entwicklungs- und Schwellenländern die gleichen Arbeits- und Sozialnormen wie in den reichen Industrieländern durchgesetzt werden. Dabei geht es nicht um Mindeststandards, zu denen sich die meisten Staaten dieser Erde in den Abkommen über die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) verpflichtet haben; dies gilt etwa in Bezug auf Kinderarbeit und das Recht der gewerkschaftlichen Organisation. Es geht um Sozialnormen, die über diese Mindeststandards hinausgehen. Solche Vorschriften wären unfair. Denn die Arbeitnehmer in den Industrieländern sind reichlich mit Sachkapital ausgestattet und mit modernster Technologie ausgerüstet. Ihre Arbeitsproduktivität ist deshalb deutlich höher. Dagegen können die Entwicklungs- und Schwellenländer zunächst nur ihren reichlich vorhandenen Faktor Arbeit setzen, der nicht so gut mit Sachkapital ausgestattet ist und auch nicht über eine vergleichbare moderne Technologie verfügt. Entwicklungs- und Schwellenländer hätten keine Chance. Ihnen würden positive Perspektiven genommen. Es wäre ähnlich, als ob jemand fordern würde, die Entwicklungs- und Schwellenländer müssten den gleichen Lohn wie die Industrieländer bezahlen (siehe oben); die Arbeitslosigkeit würde dort ins Übermaß steigen. Es darf daher auch nicht verwundern, dass die Forderung nach einer Angleichung der Sozialnormen von den Entwicklungs- und Schwellenländern nicht akzeptiert wird. Es macht keinen Sinn, die Ausstattungsvorteile der Länder dieser Erde harmonisieren zu wollen. Die internationale Arbeitsteilung begründet sich aus Unterschieden in der Ausstattung mit Produktionsfaktoren. Die Forderung nach einer 3 Unter diesen Ansatz lassen sich auch grundlegende Menschenrechte subsumieren. Ein weitergehender Ansatz ist, Verteilungsaspekte zwischen Volkswirtschaften explizit in das Regelwerk einzubeziehen. Dies reicht von Ansätzen der Armutsreduzierung im Rahmen der freiwilligen Entwicklungshilfe bis hin zu einer expliziten Umverteilungspolitik. 11 Harmonisierung entspringt also dem Schutzbedürfnis der Industrieländer, nicht jedoch den Interessen der Entwicklungs- und Schwellenländer. Die Einführung von Sozialnormen in der Dritten Welt wäre anders zu beantworten, wenn wir in den Industrienationen bereit wären, die anderen Länder dafür zu kompensieren. Selbst innerhalb der Europäischen Union lässt sich eine Harmonisierung in den Standards des Arbeitsmarktes und in den Systemen der sozialen Sicherung nicht realisieren. 8. Die Ausgestaltung von Umweltregeln erweist sich als komplex Auch bei Umweltnormen wird eine Harmonisierung gefordert. So weit hierfür die Begründung angeführt wird, dass die Unternehmen in den verschiedenen Ländern die gleichen Ausgangsbedingungen brauchen, ist das Argument falsch. Die internationale Arbeitsteilung beruht darauf, unterschiedliche Ausstattungen der Volkswirtschaften mit Arbeit, Kapital und auch mit natürlichen Ressourcen auszunutzen. Wenn andere Länder reichlicher mit Umweltgütern ausgestattet sind, so können sie auch umweltintensiver produzieren. Und wenn sie auf Umweltschutz keinen so großen Wert legen wie die Industrieländer, so haben wir in den Industrienationen kein Recht, unsere Präferenzen den Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern aufzuoktroyieren. Sie müssen auch die Kosten für eine bessere Umweltqualität tragen, also auf Realeinkommen verzichten. Wir sollten deshalb auch nicht festlegen dürfen, wie andere Länder ihre Güter herstellen. Grundsätzlich anders ist die Frage zu beantworten, wenn ein Land Güter importiert, die Schadstoffe enthalten, ob dies nun Toxide oder BSE-Erreger sind. Dann hat ein Land grundsätzlich ein Recht, Qualitätsnormen für die Importgüter zu bestimmen. Allerdings darf dabei nicht der Protektionismus die Begründung sein. Auch muss man sehen, dass die Festlegung von Mindestnormen an Importgüter den internationalen Handel schnell zum Erliegen kommen lassen kann. Denn wenn jedes einzelne Bestimmungsland von Importen Produktnormen für seine Importe definieren würde (Bestimmungslandprinzip), so wäre der Willkür Tür und Tor geöffnet. Deshalb gründet sich das Regelwerk der internationalen Arbeitsteilung im Rahmen der Welthandelsordnung (WTO) nicht auf das Bestimmungslandprinzip, sondern auf das Ursprungslandprinzip. Demnach sollen grundsätzlich die Regeln des Ursprungslandes akzeptiert werden. Von daher braucht man in diesem Bereich eine internationale Abstimmung. 12 Die Frage einheitlicher Umweltnormen stellt sich auch bei globalen Umweltgütern anders. Dabei geht es um Fragen wie die globale Klimaerwärmung oder die Erhaltung von Biodiversität in einzelnen Regionen der Erde wie am Amazonas. So gilt es, für die CO2Emissionen eine globale Lösung zu finden. Allerdings heißt das nicht, dass die Industrieländer den Entwicklungs- und Schwellenländern vorschreiben können, wie viel CO2-Emissionen dort zulässig sind. Vielmehr stellt sich dann auch die Frage, inwieweit die Industrieländer bereit sind, die Kosten für die globale Umweltqualität mitzutragen. Insgesamt ist nach einem multilateralen Regelwerk zu suchen, in dem sich die Staaten binden, ihre CO2-Emissionen einzuschränken und unter Kontrolle zu halten. Im Grunde geht es darum, sich international auf Nutzungsrechte der einzelnen Staaten an der globalen Umwelt in ihrer Funktion als Aufnahmemedium für Schadstoffe zu verständigen. Ein anderer Bereich sind internationale Abkommen zur Erhaltung der Artenvielfalt. 9. Regeln sollten systemische Finanzkrisen vermeiden helfen Bei Finanz- und Währungskrisen stellen sich zwei Fragen (Siebert 1999, Kapitel 5-6): Erstens: Was ist zu tun, um eine Krise – wenn sie ausgebrochen ist – ex post abzumildern und ihre Ausdehnung in eine systemische Krise der Weltwirtschaft zu verhindern? Das ist die Aufgabe des Internationalen Währungsfonds. Zweitens: Was kann man tun, um ex ante das Entstehen einer Krise zu vermeiden? Bei der Bekämpfung einer bereits ausgebrochenen Währungskrise ist ein neues Gleichgewicht für den Wechselkurs zu finden. Das Problem liegt darin, dass eine Finanzspritze des Internationalen Währungsfonds allein dazu nicht ausreicht, wenn in der Zukunft in dem betroffenen Land Stabilität nicht gewährleistet ist. Daraus leitet sich die Auflagenpolitik des IMF ab. Diese Politik greift jedoch massiv in den nationalen Gestaltungsspielraum ein, so dass sich die Frage der Legitimation des IMF stellt. Bei der Krise in Asien wurden zum Teil falsche Rezepte angewandt. Vor allem kann es nicht das Ziel sein, einen gegebenen Wechselkurs zu verteidigen. Hinzu kommt, dass den privaten Gläubigern die Lasten oft abgenommen werden. Eine besondere Schwierigkeit der IMF- Aktivitäten liegt darin, dass sie ein Moral Hazard Problem aufwerfen: Souveräne Staaten und private Kreditgeber können allzu leicht versucht 13 sein, darauf zu setzen, dass ihnen Hilfe zu teil wird. Von daher setzt die ex-post Hilfe Anreize für ex-ante Fehlverhalten. Sollen Währungskrisen ex ante vermieden oder unwahrscheinlicher gemacht werden, so wird dies nur dadurch zu erreichen sein, dass jedes einzelne Land bei sich selbst für monetäre Stabilität sorgt (siehe oben). Im Zusammenhang mit Währungsfragen taucht immer wieder der Wunsch nach Referenzzonen für Wechselkurse der großen Weltwährungen auf. So erfreulich stabile Wechselkurse auch sein mögen, die Idee ist impraktikabel und unrealistisch. Unter anderem verlangt ein solches System eine auf mehrere Jahre haltende Abstimmung der Geld- und Finanzpolitiken der drei großen Regionen der Welt — die drei Regionen müssen stabilitätspolitisch im Konzert fahren. Sie müssen ihre Makropolitiken aufeinander abstimmen. Dies gilt nicht nur für die Geldpolitik, sondern auch für die Finanzpolitik und die Lohnpolitik, jedenfalls in den Volkswirtschaften, in denen die Löhne nicht auf dem Markt gefunden werden und in denen stattdessen eine Lohnpolitik betrieben wird. Dies wird aber nicht funktionieren. Vielmehr werden die einzelnen Länder versuchen, jeweils dem Ausland den schwarzen Peter für notwendige Anpassungsprozesse in die Schuhe zu schieben. 10. Es wäre naiv zu meinen, man könne volkswirtschaftliche Zwänge aus der internationalen Arbeitsteilung verbannen. Liest man die Literatur über die Besorgnisse der Globalisierungsgegner, so hat man zuweilen den Eindruck, volkswirtschaftliche Restriktionen könnten aus der Welt geschafft werden. Dies ist eine Illusion. Es gibt sie, die wirtschaftlichen Zwänge, man kann sie nicht einfach verdrängen: Ein Land kann wertmäßig nicht mehr konsumieren als es selbst produziert, es sei denn es verschuldet sich im Ausland. Dies ist die Zahlungsbilanzrestriktion. Und es kann nicht mehr produzieren, als es seine technischen Produktionsmöglichkeiten und seine vorhandenen Produktionsfaktoren erlauben. Will man Kapital akkumulieren, so muss man Sparen, also Konsumverzicht leisten – es ist verblüffend, dass arme Länder wie China in den letzten zwanzig Jahren mit 40 vH eine deutlich höhere Sparquote hatten als die Industrieländer; dort liegt sie nur halb so hoch. 14 Die vorstehenden Punkte können nicht beanspruchen, die gesamte Thematik der Globalisierung abzudecken. Einige wichtige Aspekte dürfen bei der derzeitigen Orientierungsdebatte aber nicht unter den Teppich gekehrt werden: Müssen unsere Gesellschaften — in den Worten Karl Poppers — nicht „offene Gesellschaften“ sein, in der sich — so Popper —„die Individuen persönlichen Entscheidungen gegenübersehen“, „die Institutionen. Raum für die persönliche Verantwortlichkeit“ lassen und die die kritischen Fähigkeiten der Menschen in Freiheit setzt“. Nicht verdrängt werden sollte auch, dass sich die Marktwirtschaft gegenüber der Zentralplanung zum Ende des letzten Jahrhunderts durchgesetzt hat. Ein Zurück können auch die Globalisierungsgegner nicht wollen. Vielmehr geht es um eine Weiterentwicklung der Marktwirtschaft. Institutioneller Wettbewerb hat positive Wirkungen. Er ist ein Mechanismus zur Kostendeckung und zur Aufdeckung neuer Lösungen im Sinne Hayeks. Man darf deshalb davon ausgehen, dass der Wettbewerb zwischen Staaten auch zur Effizienzverbesserung beiträgt. So wird RentSeeking eingeschränkt. Standortwettbewerb zähmt Regierungen, wie es in dem Aufsatztitel „The Taming of Leviathan„ von Sinn (1991) zum Ausdruck kommt. Der institutionelle Wettbewerb in der Europäischen Union, ausgelöst durch die Anerkennung der Regeln des Ursprungslandes, hat sich als ein Büchsenöffner für nationale Regulierungen erwiesen. . Wettbewerb ist ein Entdeckungsverfahren, er ist ergebnisoffen und bringt Innovationen mit sich. Es ist auch ein Mechanismus zur Kontrolle von Regierungen. Die Abstimmung der Menschen mit den Füßen gegen die Systeme der Zentralwirtschaftssysteme war den damaligen Regierungen bei leibe nicht angenehm, sie sind durch ihn zusammengebrochen. Aber wer will daran zweifeln, dass er für die Menschen in der langen Frist eine Wohlstandssteigerung bedeutet hat. Das Fazit: Wir dürfen getrost auf den Wettbewerb setzen. Wie heißt es doch bei John Stuart Mill „If competition has its evils, it prevents greater evils...„ 15 Literatur Barro, R.J. und X. Sala-i- Martin (1992). Convergence across States and Regions, Brookings Papers on Economic Activity, 107-158. Siebert, H. (1999). The World Economy. Routledge, London und New York. — (2000). Außenwirtschaft, 7. völlig überarbeitete Auflage, Lucius & Lucius, Stuttgart.