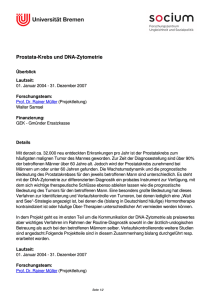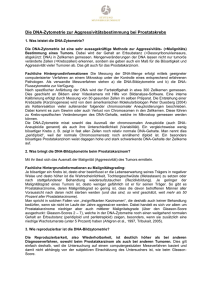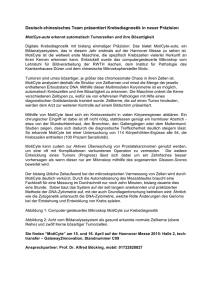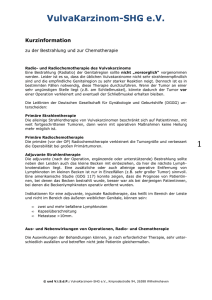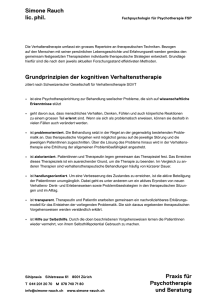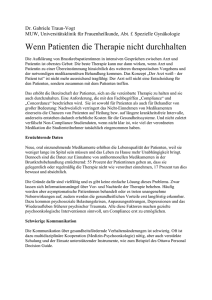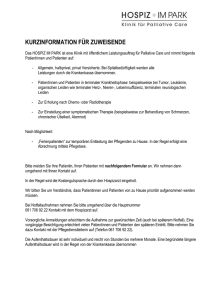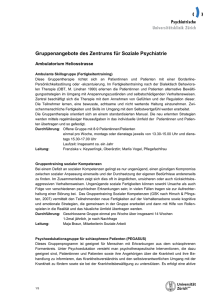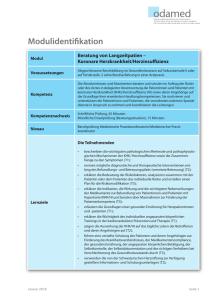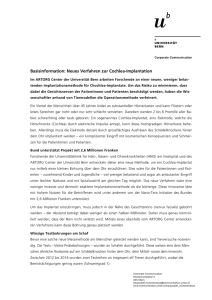Endoprothese oder Steinextraktion bei Hochrisikopatienten?
Werbung

M E D I Z I N KONGRESSBERICHT/FÜR SIE REFERIERT einschätzung über- oder untertherapiert werden, auf 40 Prozent geschätzt wird. Therapeutische Entscheidungen werden derzeit beim Mammakarzinom vor allem von der Tumorgröße, dem Lymphknotenstatus und dem Hormonrezeptorstatus abhängig gemacht. Als wichtigster Prognosefaktor gilt der Lymphknotenstatus. Es ist jedoch bekannt, daß zirka 25 Prozent der Patientinnen ohne Lymphknotenmetastasen nicht länger als fünf Jahre überleben, während umgekehrt 25 Prozent der Patientinnen mit positivem Lymphknotenstatus rezidivfrei bleiben. Unter den nodal negativen Patientinnen gibt es also eine „highrisk“-Gruppe, die eine adjuvante Therapie benötigt. Diese Gruppe (pT1, N0) wie auch Patientinnen mit Lymphknotenmetastasen, aber guten Überlebenschancen, lassen sich mit Hilfe der DNA-Bildzytometrie identifizieren. Sowohl die Stammlinienploidie (-aneuploidie) wie die S-Phase-Fraktion sind geeignete prognostische Parameter, wobei die S-Phase-Fraktion die höhere prognostische Relevanz besitzt. Beim Mammakarzinom besteht die Bedeutung der statischen DNA-Zytometrie also vor allem in einer verbesserten (objektiven) Einschätzung der Prognose und in einer Entscheidungshilfe für die adjuvante Therapie im Stadium pT1, N0. Prostata- und Harnblasenkarzinom Karl-Horst Bichler (Tübingen) betonte in seinem Referat die Notwendigkeit der statischen DNA-Zytometrie für die Diagnostik und The- rapie von Prostata- und Harnblasenkarzinomen. Beim Prostatakarzinom stellt die DNA-Bestimmung ein unabhängiges Kriterium zur Beurteilung der Dignität des Tumors dar. Sie erlaubt eine biologische Bewertung der Tumorprogression und sich daraus ergebende therapeutische Ansätze und gibt Hinweise auf die Hormonsensibilität eines Prostatakarzinoms. So sollte man bei rein diploiden oder tetraploiden Prostatakarzinomen eine „wait-and-see“-Strategie einschlagen. Rein diploide Karzinome, die diploid bleiben, benötigen keine Therapie, da solche Karzinome unbehandelt keine Verkürzung der Lebenserwartung erkennen lassen. Bei Patienten, deren Prostatakarzinom ein tetraploides DNA-Verteilungsmuster aufweist, sollte eine Hormontherapie vermieden werden, weil sie bei solchen Tumoren eine rasche Progression begünstigt. Aneuploide Prostatakarzinome benötigen eine aggressive operative Therapie. Bei Blasenkarzinom-Patienten besitzt die DNA-Zytometrie die höchste prognostische Wertigkeit und stellt – wie beim Prostatakarzinom – ein unabhängiges Instrument dar zur Beurteilung der Tumorbiologie, der Prognose und für den Einsatz einer adjuvanten Chemotherapie nach Tumorresektion oder für den Verzicht auf eine adjuvante Chemotherapie. Zum Schluß referierte Reinhard Bollmann (Bonn) über seine Erfahrungen mit der DNA-Zytometrie bei Ergüssen, Weichteil- und gastrointentialen Tumoren. Die gemessenen DNA-Parameter können als Malignitätsmarker bei der oftmals schwie- rigen Differentialdiagnose zwischen reaktiven und pseudomalignen Zellkernveränderungen und malignen Zellen in Körperhöhlenergüssen helfen. Hochdifferenzierte Weichteilsarkome lassen sich mit Hilfe der DNAZytometrie von gutartigen Geschwülsten abgrenzen. Bei gastrointestinalen Karzinomen erlaubt die DNA-Bestimmung die Vorhersage einer Lymphknotenmetastasierung. Präoperativ an Biopsien gewonnene DNA-Daten können also das operative Vorgehen beeinflussen. Peter Drings (Heidelberg-Rohrbach) war von den Veranstaltern zur Diskussion geladen. Sein Fazit lautete, daß der Stellenwert der DNA-Zytometrie in der deutschen Onkologie derzeit eher gering sei und hier noch großer Informationsbedarf besteht. Er sah den Vorteil der Methode vor allem in der Möglichkeit, von eher subjektiven Bewertungsmaßstäben zu objektiven, reproduzierbaren prognostischen Aussagen und Entscheidungshilfen über Therapiemodalitäten zu gelangen, objektive Begründungen für einen Therapieverzicht auch den Patienten gegenüber zu finden und vor allem solche Patienten und Patientinnen zu identifizieren, bei denen eine adjuvante Therapie erforderlich ist, obgleich die üblichen konventionellen Bewertungskriterien eine solche Therapie nicht notwendig erscheinen lassen. Anschrift für die Verfasser Prof. Dr. med. Friedrich-Wilhelm Kolkmann Arzt für Pathologie Jahnstraße 38 a 70597 Stuttgart Endoprothese oder Steinextraktion bei Hochrisikopatienten? Nicht immer gelingt es, bei der Sanierung einer Choledocholithiasis durch endoskopische Sphinkterotomie die Steine komplett zu extrahieren, so daß die Einlage eines Gallengangsstents oder einer nasobiliären Sonde vorgeschlagen wurde. In einer randomisierten Studie bei je 43 Hochrisikopatienten wurde die Einlage eines Doppelpigtailkatheters von 7F mit einer sofortigen Steinextraktion oder mechanischen Lithotripsie verglichen. Da bei einer Langzeitanalyse die Zahl der biliären Komplikationen, insbesondere einer aszendierenden Cholangitis, bei den mit einer Gallengangsendoprothese versorgten Patienten signifikant höher lag, empfehlen die Autoren, nach Möglichkeit eine Steinextraktion oder Zertrümme- rung vorzunehmen, um einen steinfreien Gallengang zu bekommen. w Chopra KB, Peters RA, O’Toole PA, Williams SGJ, Gimson AES, Lombard MG, Westaby D: Randomised study of endoscopic biliary endoprothesis versus duct clearance for bileduct stones in high-risk patients. Lancet 1996; 348: 791–794. Gastrointestinal Unit, Chelsea & Westminster Hospital, London SW10 9NH, Großbritannien. Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 14, 4. April 1997 (53) A-925