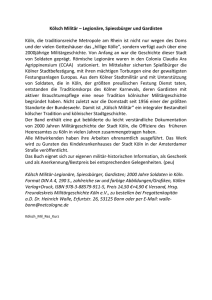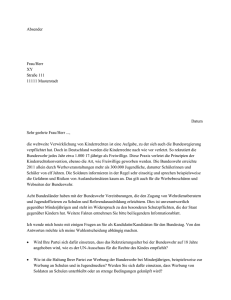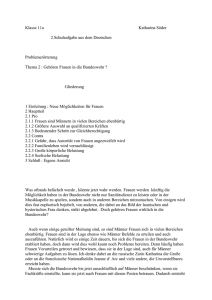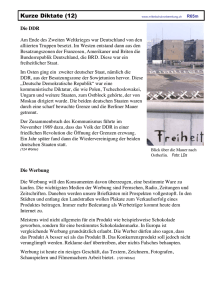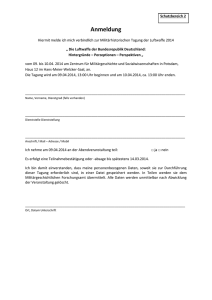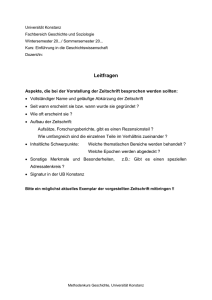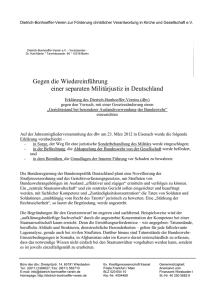Zeitschrift "Militärgeschichte" - RK
Werbung

Zeitschrift für historische Bildung C 21234 ISSN 0940 – 4163 Heft 4/2003 Militärgeschichte Militärgeschichte im Bild: Rückkehr aus Kambodscha Die Schlacht bei Poltava Zwangsarbeit Kampf um Gold Militärgeschichtliches Forschungsamt MGFA IMPRESSUM Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Herausgegeben vom Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Jörg Duppler und Hans Ehlert Redaktion: Clemens Heitmann (ch), Agilolf Keßelring (aak), Herbert Kraus (hk), Andreas Kunz (ak) Redaktionsassistent: René Henn Anschrift der Redaktion: Militärgeschichtliches Forschungsamt Postfach 60 11 22, 14411 Potsdam Telefon: (0331) 9714-531 Telefax: (0331) 9714-507 www.mgfa.de Manuskripte für die Militärgeschichte werden an diese Anschrift erbeten. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird nicht gehaftet. Durch Annahme eines Manuskriptes erwirkt der Herausgeber auch das Recht zur Veröffentlichung, Übersetzung u.s.w. Honorarabrechnung erfolgt jeweils nach Veröffentlichung. Die Redaktion behält sich Kürzungen eingereichter Beiträge vor. Nachdrucke, auch auszugsweise, fotomechanische Wiedergabe und Übersetzung sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Redaktion und mit Quellenangaben erlaubt. Dies gilt auch für die Aufnahme in elektronische Datenbanken und Vervielfältigungen auf CD-ROM. Die Redaktion hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte derjenigen Seiten, auf die in dieser Zeitschrift durch Angabe eines Link verwiesen wird. Deshalb übernimmt die Redaktion keine Verantwortung für die Inhalte aller durch Angabe einer Linkadresse in dieser Zeitschrift genannten Seiten und deren Unterseiten. Dieses gilt für alle ausgewählten und angebotenen Links und für alle Seiteninhalte, zu denen Links oder Banner führen. © 2003 für alle Beiträge beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt (MGFA) Sollten nicht in allen Fällen die Rechteinhaber ermittelt worden sein, bitten wir ggfs. um Mitteilung. Technische Herstellung durch MGFA, Schriftleitung Lektorat: Aleksandar-S. Vuletić Bildredaktion: Marina Sandig Layout/Grafik: Maurice Woynoski Karten: Bernd Nogli Editorial Die grundlegende Bedeutung von Geschichtskenntnissen für die politische Urteilsbildung ist unbestritten. Daher wird von verantwortlicher politischer und militärischer Seite die Vermittlung von Kenntnissen über historische Abläufe und deren Ursachen auch für die Soldaten der Bundeswehr immer wieder eingefordert. Gerade jüngste Äußerungen über die Bewertung historische Zusammenhänge und die Reaktionen von Politik und Öffentlichkeit verdeutlichen diese Notwendigkeit. Das Militärgeschichtliche Forschungsamt sieht sich dieser Aufgabe in besonderer Weise verpflichtet und gibt bereits seit 1991 für ein breites Publikum die Zeitschrift Militärgeschichte heraus. Der wachsenden Aufmerksamkeit, die der Geschichte in der politischen Bildung der Bundeswehr, aber auch von der Öffentlichkeit und den Medien beigemessen wird, entsprechen die Leserzuschriften, welche die Redaktion der Militärgeschichte regelmäßig erreichen. Häufig melden sich Leser, die das eine oder andere Ereignis selbst erlebt haben, vielleicht sogar daran beteiligt waren und mitunter anders bewerten. Solche Zeitzeugenberichte sind für Historiker immer interessant, zugleich aber auch problematisch, denn sie geben eben nur die individuelle Erinnerung, aber nicht unbedingt die historischen Tatsachen wider. Wer jemals einen Verkehrsunfall beobachtet hat, weiß, wie zwei Zeugen denselben Sachverhalt völlig unterschiedlich schildern können. Aus diesem Grunde sind Ereignisse der Zeitgeschichte, also des Zeitalters der noch lebenden Zeitzeugen, zwar bei vielen Geschichtsinteressierten besonders beliebt, jedoch auch stets besonders strittig – Zeitgeschichte ist Streitgeschichte, sagen die Historiker. Die vor einigen Jahren geführte Debatte um die Zwangsarbeiter, die während des Krieges unter schlimmen Bedingungen in der deutschen Kriegswirtschaft arbeiten mussten, mag dies verdeutlichen. Erst nach heftigen innenpolitischen Kontroversen und der Vermittlung der Bundesregierung gelang es, unter Einbeziehung der deutschen Industrie ein Entschädigungsabkommen abzuschließen. Verena Krüger zeigt im vorliegenden Heft, welches Schicksal den aus ganz Europa angeworbenen oder verschleppten Zwangsarbeitern im Deutschen Reich widerfuhr. Ebenfalls kontrovers diskutiert werden die Geschichte der Blockkonfrontation oder der Entwicklung deutscher Streitkräfte nach 1945. Uta Andrea Balbier beschreibt den »Kampf um Gold«, d.h. den sportlichen Wettstreit der beiden deutschen Armeen und ihrer Spitzenathleten während dieser Zeit, und Herbert Kraus erinnert an den humanitären Einsatz in Kambodscha, bei dem die Bundeswehr ihren ersten Toten im Auslandseinsatz beklagen musste. Außerdem haben wir aus der Vielzahl der historischen Jahrestage und Jubiläen wieder zwei Daten ausgewählt. Die Gründung der russischen Stadt St. Petersburg durch Zar Peter I. (»der Große«) im Jahr 1703 nimmt Martin Meier zum Anlass, um über Russlands Drang zur Ostsee und die Schlacht bei Poltava zu berichten; Karlheinz Deisenroth erinnert an die »Zabern-Affäre« vor neunzig Jahren, als die unbedachten chauvinistischen Äußerungen eines preußischen Leutnants die deutsche Öffentlichkeit und den Reichstag beschäftigten. Ich hoffe, die vielfältigen Beiträge dieses Heftes vermitteln Ihnen ebenso Erkenntnisgewinn wie neue Denkanstöße. Gleichzeitig darf ich mich Ihnen als neuer Leiter der für die historische Bildung zuständigen Abteilung im MGFA vorstellen. Damit übernehme ich auch die Mitherausgeberschaft dieser Zeitschrift von meinem Vorgänger, Herrn Oberst i.G. Dr. Hans-Joachim Harder, dem ich für seine erfolgreiche und verdienstvolle Tätigkeit für die Militärgeschichte an dieser Stelle herzlich danke. Ich hoffe, das vorliegende Heft des neuen Redaktions-Teams findet wie gewohnt Interesse und Gefallen, und wünsche Ihnen in diesem Sinne eine anregende Lektüre! Druck: SKN Druck und Verlag GmbH & Co., Norden ISSN 0940-4163 Hans Ehlert, Oberst i.G. D i e A u t o r e n Inhalt Die Schlacht bei Poltava 4 am 28. Juni 1709 Zwangsarbeit Martin Meier M.A., geboren 1975 in Bergen/Rügen, Historiker am Militärgeschichtlichen Forschungsamt, Potsdam 10 im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkriegs Kampf um Gold Spitzensportförderung in der Nationalen Volksarmee und in der Bundeswehr Verena Krüger M.A., geboren 1972 in Elmshorn, wissenschaftliche Hilfskraft bei der Landeskonferenz der Frauenbeauftragten an den wiss. Hochschulen Baden-Württembergs Uta Andrea Balbier M.A., geb. 1974 in Saarbrücken, Historikerin, Stipendiatin der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin, forscht zur Geschichte der deutsch-deutschen Spitzensportförderung 16 Service 22 Das historische Stichwort: Vor 90 Jahren: Die Affäre von Zabern 22 Medien online/digital 24 Lesetipp 26 Ausstellungen 28 Geschichte kompakt 30 Militärgeschichte im Bild 31 12. November 1993: Rückkehr aus Kambodscha Deutsche Soldaten treten vor dem German Fieldhospital in Phnom Penh, Kambodscha an (Foto: BMVg / Kiesel) Die Schlacht bei Poltava Die Schlacht bei E ben noch blickte Gefreiter Måle auf das ihm gegenüberliegende kleine Birkenwäldchen, aus dem der Feind zum Angriff antrat. Steif, dem Befehle seines Offiziers, eines Kompaniechefs aus dem Uppland-Infanterieregiment folgend, marschierte er auf die feindliche Linie zu. Der Lärm der Geschütze, der unausstehlich beißende Pulverdampf, die Schreie der Sterbenden, all dies nahm der junge Soldat nicht zur Kenntnis. Ruhig schlug nun das ihn zuvor ängstigende Herz. Automatisch, maschinengleich folgte er den Anweisungen der brüllenden Vorgesetzten, bis schließlich um 10 Uhr ein russisches Artilleriegeschoss den einundzwanzigjährigen Familienvater aus dem Leben riss. Sein enthaupteter Leib sank zu Boden, tränkte die ukrainische Erde mit einem Strom dunklen Blutes. Sein Schicksal ist überliefert. Neben ihm starben an jenem Tage etwa 20 000 Menschen vor der strategisch wertlosen russischen Festung Poltava. Jener Bedeutungslosigkeit zum Trotze rangen zwei Monarchen unerbittlich auf dem Schlachtfeld, das eigene Leben nicht schonend. Karl XII. von Schweden und Peter der Große lieferten sich vor den Toren der Feste einen Kampf, der das Schicksal des nördlichen Europas entscheidend beeinflussen sollte. Angesichts des bislang Geschilderten drängen sich unweigerlich zwei Fragen auf. Erstens: Wofür verbluteten Schweden, Deutsche, Russen, Polen, Tataren und Ukrainer an jenem 28. Juni 1709, oder einfacher ausgedrückt: Was führte den Schwedenkönig in die ukrainische Ödnis? Und zum Zweiten: Warum fand die entscheidende Schlacht im russisch-schwedischen Ringen ausgerechnet an einem derart unbedeutenden Orte statt? 4 Zur Beantwortung ist es erforderlich, auf eine Sommernacht des Jahres 1698 zurückzublicken. Zechend, doch bei gutem Verstande, saßen in Rawa Ruska der polnische König und sächsische Kurfürst, August der Starke, sowie der russische Zar Peter I. (der Große) beisammen, um über Frauen, Kunst und Politik lachend zu streiten. Natürlich vergaß August nicht, die schönen Polinnen zu loben und vor dem Zaren mit neuen weiblichen Eroberungen aufzuwarten. Peter kümmerte dieses Gerede allerdings kaum. Ihm lagen die internationalen Beziehungen stärker am Herzen als dem beleibten Kurfürsten. Mit Russland beherrschte er ein großes, potenziell reiches Land. Doch dessen Schätze harrten ihrer Erschließung. Unendlich rückständig war sein Staat, verglichen mit Frankreich, England, ja selbst mit den zerstückelten deutschen Landen. Anbindung an Westeuropa blieb zeitlebens das Ziel des großen Zaren, dem er alles Handeln unterwarf. Um aber jenen Anschluss an die »moderne« Welt zu erlangen, gebrach es Peter vor allem an Seemacht. Häfen besaß er keine, die Ostsee blieb ihm verschlossen, solange Schweden alle in Frage kommenden Gebiete in seiner Hand hielt. Endlich nun, in eben jenem Jahre 1698 schien seine Stunde gekommen. Der alte Schwedenkönig war gerade gestorben und an seine Stelle ein Knabe getreten. Karl nannte er sich, so wie schon sein Vater und sein Großvater geheißen hatten. Jener Karl XII. stand gerade in seinem siebzehnten Lebensjahr und konnte natürlich von den diplomatischen Gepflogenheiten und von europäischer Politik nur eine geringe Ahnung besitzen. Eine leichte Beute, glaubte der Zar. Auch August wähnte Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 4Darstellung der Schlacht von Poltava im Jahr 1709. Im Vordergrund führt Zar Peter I. einen Angriff auf eine schwedische Kavallerieeinheit, im Hintergrund am linken oberen Bildrand befindet sich die von den Schweden belagerte Festung Poltava, darunter das russische befestigte Feldlager. In zwei Treffen hinter einander aufgestellt, empfängt der Verteidiger die glücklosen schwedischen Angreifer. Am oberen Bildrand sind die Redouten deutlich erkennbar. Foto: akg-images / Nr: 84082/1SW-33-E1709 Poltava am 28. Juni 1709 5 Der verwundete Karl XII. lässt sich auf einer Bahre über das Schlachtfeld tragen. Lithographie, 1860, von Johann Nepomuk Geiger (1805–1880) Berlin, Slg. Archiv f. Kunst & Geschichte Krigsarkivet, Stockholm, Foto: Bertil Olofsson Eines aber bedachten weder Peter I. von Russland noch seine beiden Verbündeten: den kriegerischen Charakter Karls XII. Mochte er auch blutjung sein, seine ganze Liebe galt von Kindesbeinen an dem Militär. Zudem stellte die schwedische Armee seit Gustav Adolf (1594–1632) eines der schlagkräftigsten Heere Europas dar. Auf jene Macht konnte Karl bedingungslos bauen. Hier soll der Weg in den bewaffneten Kon- Foto: akg-images / Nr:172241 / 9RD-1709-7-8-A1 die Situation günstig. Durch Bestechung an die polnische Krone gelangt, bot sich ihm endlich Gelegenheit, seine Talente als Feldherr unter Beweis zu stellen. Beide Monarchen vertraten die Ansicht, dass es Zeit sei, Schweden Land an der Ostseeküste zu entreißen. Ihnen schloss sich wenig später der dänische König Friedrich IV. an. Seit weit mehr als hundert Jahren kämpften dessen Vorfahren mit den Schweden um die Vormacht im Ostseeraum. Nun bot sich auch für Dänemark Gelegenheit, den Erzrivalen aus seiner Position am baltischen Meer zu drängen. 5 Peter der Große schlägt den Schwedenkönig Karl XII., »Die Schlacht bei Poltawa« Gemälde, 1717, von Jean Marc Nattier (1685–1766), Öl auf Leinwand, 90 x 112 cm Moskau, Staatl. Puschkin-Mus. f. Bild. Künste Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 5 Die Schlacht bei Poltava August der Starke und Polen Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, wie Deutschland bis 1806 hieß, setzte sich aus Hunderten selbständiger Staatsgebilde zusammen. Eines der größeren war das Kurfürstentum Sachsen, an dessen Spitze Friedrich August I. stand. Ihm sagten Zeitgenossen ungeheure körperliche Kräfte nach. Es wird behauptet, er habe Hufeisen gerade zu biegen vermocht und 352 Kinder gezeugt. So fiel ihm der Beiname »der Starke« zu. Nach dem Ableben des polnischen Königs bewarb sich Friedrich August 1697 um die frei gewordene Krone. Als protestantischer deutscher Fürst aber wäre er im tiefreligiösen Polen nicht akzeptiert worden, weswegen er sein Glaubensbekenntnis wechselte und nun zum Katholizismus übertrat. 5 Friedrich August I. Kurfürst von Sachsen als August II. König von Polen, Gemälde von Louis de Silvestre d.J. um 1720 Original: Dresden, Staatliche Kunstsammlungen Foto: Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz / F 10652 b flikt nicht weiter skizziert werden. In Erinnerung möchten dem Leser nur die Kriegsziele der einzelnen Mächte bleiben. Für Schweden stand die Vorherrschaft im Ostseeraum auf dem Spiel. Russland hoffte, diese Position zu übernehmen. August der Starke setzte auf Prestigegewinn durch militärische Erfolge und Dänemark schließlich drang auf Ausschaltung des schwedischen Feindes. Karl XII. besiegte das dänische Heer in Schleswig-Holstein noch im selben Jahr, als der Krieg begann. Das war 1700. Bereits wenige Monate später schlug er die russischen Truppen vernichtend vor der Festung Narva. Statt jedoch seinen Erfolg zu einem endgültigen Sieg auszubauen, widmete er sich 6 Nach erfolgter Krönung zum polnischen König im September 1697 hieß er August II. von Polen. Während seiner Herrschaft bemühte er sich, Polen dauerhaft an Sachsen zu binden. Zudem suchte er in beiden Teilen seines Reiches absolutistisch, also unumschränkt, zu herrschen. Seine Regierungszeit war geprägt von prunkvollen Festen, einer Förderung der Künste, kostspieligen Jagden und einem in jeder Hinsicht ausschweifenden Leben des Monarchen. Vor nunmehr dreihundert Jahren, am 1. Februar 1733 starb August der Starke in Warschau. seinem letzten und zugleich schwächsten Gegner – August dem Starken. Mochte dieser auch Hufeisen verbiegen und hunderte Frauen zu glücklichen Müttern werden lassen, auf dem Schlachtfelde blieb er erfolglos. Den schwedischen Infanteristen und Kavalleristen schien keine Macht gewachsen. 1706 gab sich der Sachse im Frieden zu Altranstädt geschlagen. Wieviel Zeit aber blieb durch diesen Feldzug verloren! Zeit, die Zar Peter nutzte. Er setzte ein überwältigendes Reformwerk in Russland in Gang. Die russische Armee formte er zur schlagkräftigen Truppe. Im Ural gossen gerade errichtete Hütten Stahl und fertigten neue Schmieden qualitativ hochwertige Geschütze für die Artillerie. Aus Sankt Petersburg, der 1703 an der Nevamündung gegründeten Stadt, lieferten Textilmanufakturen Uniformstoffe. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 5 Karl XII. (1682–1718), König von Schweden, Gemälde von David von Krafft um 1706, Original: Schloss Gripsholm Von all dem nahm Karl XII. kaum Notiz; für Wirtschaft und Politik besaß er wenig Sinn. Der Schwedenkönig setzte einzig auf die Schlagkraft seiner kampferprobten Regimenter, die zu einem Teil aus Schweden und Finnen, zum anderen aber aus zahlreichen Deutschen bestanden. Im Juni 1708 marschierten die stolzen schwedischen Verbände aus Sachsen ab, um Russland endgültig den Todesstoß zu versetzen. Dieser Moment schien denkbar günstig. Peter der Große kämpfte mit erheblichen innenpolitischen Problemen. Insbesondere bereiteten ihm Kosakenaufstände Sorgen. Am Don zeigten sich die Wehrbauern unzufrieden mit seiner autokratischen Herrschaft. Peter, der zu aufbrausender unbedachter Rede fähig war, hatte den Donkosakenhetman Ivan Mazeppa gegen sich aufgebracht. Karl XII. und Schweden Der schwedische Staat nahm im Verlaufe des 17. Jahrhunderts einen erstaunlichen Aufstieg. König Gustav II. Adolf schuf mit seinem Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg 1628/1630 die Voraussetzung für eine Vormachtstellung des nordischen Staates im Ostseeraum. Innenpolitisch vermochten er und seine Nachfolger in Schweden den Absolutismus zu etablieren. Als der fünfzehnjährige Karl XII. 1697 den Thron bestieg, stand Schweden einer Welt von Feinden gegenüber, welche die Position Stockholms im Ostseeraum zu schwächen trachteten. Karls positiven Charakterzügen traten ebenso viele Schwächen zur Seite. Ruhmsüchtig war er, ungeduldig, undiplomatisch, mit dem politischen Geschäft nicht im mindesten vertraut. Seinem Starrsinn fielen Tausende zum Opfer. Um die Staatsfinanzen kümmerte er sich nicht, jedes Reformbemühen seiner Berater wies der Schwedenkönig beharrlich zurück. So erlebte Schweden unter seiner Ägide nicht nur in außenpolitischer Hinsicht schwere Rückschläge. Nach dem Tode Karls erlitt die Staatsmacht auch im Lande selbst eine herbe Niederlage. Der Absolutismus, d.h. die alleinige Herrschaft des Königs, wurde beseitigt, an seine Stelle trat die Herrschaft des Adels. Karls Leichnam bildete, seit seiner Beisetzung mehrfach den Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, zuletzt 1917. Um die Frage zu entscheiden, ob ein Mörder oder ein feindliches Geschoss dem Leben des Kriegerkönigs ein frühes Ende bereitete, begutachteten Gelehrte die Eintritts- und Austrittswunden an seinem Kopf. Bis heute halten sich dennoch befürwortende und ablehnende Stimmen eines möglichen Mordkomplottes die Waage. Karl XII. baute auf dessen Unterstützung. Zudem hoffte er, das Osmanische Reich zu einem Angriff gegen Russland zu bewegen. Gleichzeitig gab er den im Baltikum und in Polen stationierten Truppen Weisung, sich dem Feldzug anzuschließen. Die drei Heeressäulen sollten sich auf gegnerischem Gebiet vereinen und gemeinsam auf Moskau marschieren. Werden sämtliche schwedischen Streitkräfte, einschließlich der im Baltikum verbleibenden Festungsbesatzungen, zusammengerechnet, so zählte Karls Heer etwa 110 000 Mann. Demselben vermochte Moskau etwa 100 000 Soldaten entgegenzustellen. Selbst bei deutlicher Unterlegenheit der Schweden wäre ein russischer Sieg höchst unwahrscheinlich gewesen. Peter wusste um die immense Schlagkraft seines Gegners. Schon der Name des Schwedenkönigs löste Verzweiflung, ja Panik unter den russischen Truppen aus. Deshalb hielten sich die Verteidiger bedeckt, operierten vorsichtig und schonten ihre Verbände nach Möglichkeit. Ihr größter Vorteil blieben die russischen Weiten. Taktik der verbrannten Erde trat hinzu. Zar Peter befahl beispielsweise, bei Smolensk alle Vorräte von der Marschroute seines Gegners zu entfernen, jedes Dorf niederzubrennen, das den Schweden Quartier bieten könnte, und jedes Feld anzuzünden, das dem Feinde Korn zu geben vermochte. Als sich die russischen Hauptkräfte 1708 bei Holowczyn erstmals gegen Karls Verbände stemmten, erlitten sie trotz leichter Überlegenheit eine Niederlage. Schlechter erging es jedoch der zweiten schwedischen Heeressäule unter General Lewenhaupt. Der erfah- rene Feldherr unterlag bei Lesnaja. Das Kriegsglück Schwedens verebbte. Zu den verlustreichen Schlachten und der sich deutlich verschlechternden Versorgungslage traten politische Misserfolge. Der türkische Sultan verhielt sich abwartend. Konstantinopel wollte zunächst schwedische Erfolge sehen, bevor es eigene Kräfte in die Waagschale warf. Zudem stieß der Kosakenführer Mazeppa zwar wie versprochen zu den Angreifern, aber nur mit Resten einer einstmals kampfkräftigen Truppe. Seine Streitmacht war von russischen Verbänden nahezu aufgerieben. Mehrfach sah Karl sich nun gezwungen, die Marschroute zu ändern und das weitere Vorgehen gegen Moskau zu überdenken. Er verzettelte sich zunehmend. Schließlich brach der Winter Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 7 Die Schlacht bei Poltava Quelle: Svenska slagfält / Lars Ericson u.a. Stockholm 2003. S:298. Copyright Publisher Produktion AB Peter der Große und Russland Bereits als Kind übte sich der am 9. Juni 1672 geborenen Zarensohn Peter im militärischen Handwerk. Aus Bauernjungen stellte der Knabe zwei Regimenter zusammen, mit denen er Krieg spielte. Mit Kanonen, die Rüben verschossen, und mit Holzgewehren bewaffnet, schlugen die jungen »Soldaten« aufeinander ein. Seine politische und ökonomische Bildung erlangte Peter insbesondere durch enge Kontakte zu Ausländern, die in der »DeutschenVorstadt« am Rande Moskaus wohnten. Nachdem er als Peter I. 1689 den Zarenthron bestiegen hatte, behielt er seine beiden Lieblingsregimenter 3 Peter I. in der Schlacht von Poltava, Gemälde von Gottfried Danhauer, 1718 Original: St. Petersburg, Russisches Museum, Foto: Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz / F 17108 b im Dienst, und betrachtete sie nun als Garde, die den Grundstock eines neuen russischen Heeres darstellte. Sein erster Feldzug galt den Türken. Noch oft führte er mit wechselndem Erfolg Krieg gegen das Osmanische Reich. Peter trachtete nach einem Zugang zum Asovschen Meer, der ihm durch die Truppen des Sultans verwehrt wurde. Im Norden sah sich Russland der Großmacht Schweden gegenüber. Auch hier zielte der Zar auf Zugang zur Küste. Innenpolitisch prägte Peters Regierungszeit ein umfangreiches Reformwerk. Mit äußerster Härte setzte er einen wirtschaftlichen, kulturellen, politischen und militärischen Aufstieg Russlands in Gang. Er ließ Kanäle errichten, Rathäuser bauen und Gesetze erarbeiten. Der russische Adel kleidete sich fortan westeuropäisch, den Bojaren befahl Peter, die Bärte abzuschneiden, und im russischen Militär hielt die Perücke Einzug. Das Handwerk, die Manufakturen, der Handel, das Bergwesen, der Verkehr, die Forsten, alles gedieh unter Aufsicht des unermüdlichen Zaren. Als er am 8. Februar 1725 starb, verlor Russland einen Monarchen, der mit Recht den Beinamen »der Große« trug. über die ausgehungerten schwedischen Soldaten herein. Ohne die Hilfe der Donkosaken, die Lebensmittel zuführten, wäre Karls Heer jämmerlich zu Grunde gegangen. Allein der König gab den Kavalleristen und Infanteristen Hoffnung. Geschichten, die sich ohnehin zahlreich um ihn rankten, gewannen durch die Entbehrungen neue Nahrung. Aus jenen schweren Wochen wird beispielsweise berichtet, ein schwedischer Soldat habe vor der Front seinem Monarchen murrend ein Stück schimmliges Brot unter die Nase gehalten. Ungerührt nahm Karl das ihm Dargebotene und verzehrte es. Dann wandte er sich an den erstaunten Infanteristen mit den Worten: »Gut ist es nicht, aber essbar.« 8 Mag diese Geschichte auch erfunden sein, zeigt sie doch den immensen Respekt zeitgenössischer Beobachter gegenüber dem schwedischen König. Die witterungsbedingten Verluste erwiesen sich auf beiden Seiten als derart schmerzlich, dass sich Zar und König auf eine mehrmonatige Waffenruhe einigten. Im Februar 1709 jedoch begannen die Kampfhandlungen erneut. Karl erfuhr nun, dass seine »polnische« Armee noch nicht einmal aufgebrochen war. Mit Entsatz konnte er also auf lange Sicht kaum rechnen. Dem Zaren waren einige tausend Tote egal. Er vermochte seine Streitmacht rasch wieder aufzufüllen. Karl hingegen konnte Verluste nicht ausgleichen. Das Kräfteverhältnis verschob Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 sich somit deutlich zu seinen Ungunsten. Er führte im Frühjahr noch etwa 25 000 Mann ins Feld. Zar Peter stellte ihm 45 000 entgegen. Der Schwedenkönig setzte nun auf seine Überlegenheit in der offenen Feldschlacht. Er hoffte, seinen russischen Widersacher zur Entscheidung zu zwingen. Hierfür bedurfte es eines Köders. Er fand sich in der äußerst schwachen Festung Poltava, die am westlichen Ufer der Vorskla lag und lediglich Werke aus Holz vorweisen konnte. Wenige Tage hätten genügt, um den Ort unter schwedische Kontrolle zu bringen. Wie verwundert aber, ja geradezu verärgert zeigten sich die Artilleristen, als ihr König verbot, mehr als eine Salve täglich auf die Feste abzufeuern. Je länger sich Poltava hielt, desto größer wurde das Prestige, das sich mit dem an sich unbedeutenden Punkt auch für Zar Peter verband. Für ihn bestand die Gefahr einer allgemeinen Erhebung der einheimischen Völkerschaften gegen die verhasste Zarenherrschaft nach dem Fall Poltavas. Karls XII. Rechnung ging also auf: Die Festung wirkte wie ein Magnet auf die russische Armee. Peter zog seine Verbände am östlichen Vorskla-Ufer zusammen. Ein wochenlanger Kampf um den Flussübergang entbrannte. Bei einem Versuch, die Russen an der Forcierung der Vorskla zu hindern, verletzte eine feindliche Kugel Karl schwer am Fuß. Da der junge Monarch seiner Gesundheit keinerlei Aufmerksamkeit entgegenbrachte, entzündete sich die Wunde rasch. Fieber erfasste ihn derart heftig, dass die Ärzte den König beinahe aufgaben. Nur langsam wieder zu Kräften kommend, betraute Karl einen seiner geschicktesten Feldherren mit dem Kommando in der unmittelbar bevorstehenden Entscheidungsschlacht. Feldmarschall Renskiöld (eigentlich Reinschild), ein gebürtiger Pommer aus Stralsund, sollte die russischen Truppen schlagen. Renskiold war ein tapferer, der Krone treu ergebener Mann, jedoch von kaltgefühlloser und überheblicher Natur. Am Morgen des 28. Juni 1709 sollte er gemäß dem Wunsche seines Monarchen mit der Infanterie voran, gefolgt von der Kavallerie, in das russische Verteidigungssystem einbrechen. Ohne sich um die Feldbefestigungen zu seiner Rechten und Linken zu kümmern, oblag es ihm dann, rechts schwenken zu lassen und vor der Hauptmasse der gegnerischen Truppen derart schnell Aufstellung zu nehmen, dass diese nicht Zeit fänden, die eigenen Reihen zu positionieren. Ein einfacher, aber kluger Plan, dessen Umsetzung jedoch gänzlich misslang. Bereits der Aufmarsch gestaltete sich überaus kompliziert. In stockfinsterer Nacht verirrten sich einige Bataillone. Das kostete Zeit. Das Überraschungsmoment entfiel hierdurch. Die alarmierten Russen erwiesen sich als meisterhafte Pioniere. In der Zeit, da die Schweden Marschordnung einnahmen, errichteten sie vier neue behelfsmäßige Feldbefestigungen, und zwar feindwärts im rechten Winkel zu den alten Anlagen. Somit scheiterte der schnelle kampflose Einbruch in die Verteidigung. Die schwedische Formation riss auseinander, da einige Bataillone die nun in der Flanke befindlichen russischen Verteidiger ausschalten mussten. Ein Drittel der Kräfte war somit gebunden, während die Masse des Heeres weiter gegen das russische Zentrum vorging. Dasselbe befand sich jedoch bereits wohlgeordnet in Schlachtaufstellung. Voll entfaltet empfingen die Russen ihren deutlich verminderten Gegner, der sich noch in Marschformation bewegte. Seine eilends gebildete Front drückten die russischen Truppen schnell ein. Angefeuert durch den Zaren, stellte die Infanterie ihre neugewonnene Schlagkraft unter Beweis. Peter, der eine Vorliebe für Verkleidungen besaß, trat in der Uniform eines Generalmajors unter seine Soldaten. Das Kommando überließ er einem anderen fähigen Offizier. Die schwedische Kavallerie wich als erste vom Schlachtfeld. Ihre Absatzbewegung verlief erfolgreich. Der schwerfälligeren Infanterie gelang ein Ausweichen jedoch nur unter erheblichen Verlusten. Dennoch zog auch sie sich geordnet zurück und blieb zunächst unverfolgt. An einen neuen Angriff war nicht zu denken. Diesmal half auch die persönliche Anwesenheit Karls XII. unter seinen kämpfenden Soldaten nicht. Der Schwerverwundete ließ sich während der stundenlangen Kämpfe auf einer Bahre über das Schlachtfeld tragen, um seinen Truppen Mut zuzusprechen. Von den vierundzwanzig Trägern, die den Monarchen an jenem Tage über die Walstatt beförderten, blieben einundzwanzig tot zurück. Nur Karl selbst entkam wie durch ein Wunder. Als die Flucht der Schweden Richtung Süden begann, dem türkischen Reiche entgegen, war der König noch bei vollem Verstande. In ihrem Verlaufe aber schwanden Karl die Sinne. Das Wundfieber griff erneut nach seinem Leben. Zweimal fiel er aus dem Sattel und musste halbtot von Offizieren wieder aufs Pferd gehoben werden, bis das geschlagene Heer schließlich die Flussgabelung Vorskla-Dnepr erreichte. Ein aus wenigen hundert Mann bestehendes Vorauskommando erreichte nachts den Fluss, unter ihnen auch der mit dem Tode ringende Karl XII. Wenige Stunden später trafen die russischen Verfolger ein. General Lewenhaupt übergab ohne zu zögern den Rest der verzweifelten schwedischen Truppen, etwa 9000–10 000 Mann, dem siegreichen Gegner. Sein Monarch aber erreichte wohlbehalten das türkische Exil. Nach Karls Genesung bemühte sich dieser unablässig, den Sultan zum Angriff gegen Russland zu bewegen. Erst 1714 kehrte er zu seinen Truppen zurück. Von nur einem Getreuen begleitet, brachte ihn ein legendärer Ritt vom Osmanischen Reich nach Stralsund. Dort verteidigte er die bedeutendste schwedische Festung auf deutschem Boden gegen drei feindliche Heere. Sein Lebensweg nahm 1718 ein gewaltsames Ende. Bis heute sind die Umstände des Todes ungeklärt. Man fand den Sechsunddreißigjährigen während eines Norwegenfeldzuges erschossen in einem Graben vor Frederikshald. Ob durch eine gegnerische Kugel gefallen oder durch die Hand eines Verräters aus den eigenen Reihen gemeuchelt, ist nach wie vor ungewiss. Die Schlacht von Poltava 1709 aber blieb der eigentliche Auslöser des schwedischen Niedergangs. Sie ist von europäischer, ja von weltgeschichtlicher Bedeutung. Schon Zeitgenossen empfanden den Sieg der Russen vor der kleinen ukrainischen Festung als Wende im Krieg. Nicht wenige hielten das Ringen zwischen den nordischen Reichen sogar gänzlich für beendet. Auch aus heutiger Sicht darf Poltava als historischer Markstein gesehen werden. Die Schlacht besiegelte das Ende der schwedischen Vormachtstellung im Ostseeraum und ermöglichte dem Reiche Peters des Großen, an dessen Stelle zu treten. Russlands Aufstieg zur Weltmacht nahm seinen Anfang. n Martin Meier Literatur Jörg-Peter Findeisen, Karl XII. von Schweden. Ein König, der zum Mythos wurde, Berlin 1992 Reinhard Wittram, Peter I. Czar und Kaiser. Zur Geschichte Peters des Großen in seiner Zeit, 2 Bde, Göttingen 1964 Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 9 Zwangsarbeit Zwangsarbeit Bundesarchiv / K 0511/500/1N im Deutschen Reich während des Zweiten Weltkriegs I m Juli 2000, 55 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde in Berlin das Abkommen über die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter unterzeichnet. Damit wurde Zwangsarbeit als nationalsozialistisches Unrecht anerkannt und ein Entschädigungsanspruch generell begründet. Da es während des Kalten Krieges nicht im Interesse der westlichen Verbündeten lag, dass die bundesdeutsche Regierung immense Summen an die Sowjetunion und andere Staaten jenseits des Eisernen Vorhangs leistet, wurde sie in ihrer abwehrenden Haltung gegen die Entschädigung ausländischer Zwangsarbeiter – maßgeblich von den Vereinigten Staaten – unterstützt. So wurden Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg, unter die die Ansprüche von ausländischen ehemaligen Zwangsarbeitern fielen, auf einen künftigen Friedensvertrag verschoben. Dieser Fall trat mit der deutschen Wiedervereinigung auf der Grundlage des Zwei-plus-Vier-Vertrages ein, der im März 1991 in Kraft trat und quasi als Friedensvertrag angesehen wird. Es bedurfte jedoch erst der großen Sammelklagen amerikanischer Anwälte gegen deutsche Unternehmen und des öffentlichen Drucks aus den Vereinigten Staaten, bis es zu einer Einigung kam. Das Interesse der deutschen Wirtschaft an dem Entschädigungsgesetz lag hauptsächlich in der zukünftigen Rechtssicherheit vor weiteren Klagen begründet. Schließlich wurde festgelegt, dass die Bundesregierung und die Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft 10 Mrd. DM zur Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen bereitstellen. Im Prinzip ausgeschlossen wurden allerdings die kriegsgefangenen Zwangsarbeiter und die zivilen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die in der Landwirtschaft oder in privaten Haushalten eingesetzt waren. 10 5 Zwangsarbeiterinnen aus der Sowjetunion in einem Kfz-Instandsetzungswerk der deutschen Wehrmacht in Berlin, 19. Januar 1945 Mit der finanziellen Entschädigung widerfährt den wenigen noch lebenden Opfern, die einen Anspruch geltend machen können, zumindest insofern Gerechtigkeit, als sie einen Schadensersatz für erzwungene Arbeitsleistung erhalten; Geld also, das ihnen als Zwangsarbeitern ganz oder zum Teil vorenthalten wurde. Der größte Teil des Betrages fließt nach Polen und in die Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die Länder, aus denen die größten Opfergruppen stammen. Etwa 2500 € sollen beispielsweise die Personen erhalten, die ins Deutsche Reich deportiert wurden, in der Industrie eingesetzt wurden und unter besonders schlechten Lebensbedingungen zu leiden hatten. 7500 € sind für ehemalige KZ-Häftlinge vorgesehen. Der Entschädigungsfonds hat außerdem insofern Bedeutung, als man sich durch ihn einen positiven Einfluss auf das Deutschlandbild im Ausland verspricht. Die Verschleppung von Millionen Zivilisten und Kriegsgefangenen zur Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 Zwangsarbeit sowie deren Umstände gelten als völkerrechtliches Verbrechen und wurden im Rahmen der Nürnberger Prozesse zum Kriegsverbrechen und zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt. Insgesamt arbeiteten in den Jahren 1939 bis 1945 nach neueren Schätzungen 11–12 Mio. Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus fast 20 europäischen Ländern im Deutschen Reich. Ohne diese Arbeitskräfte hätte Deutschland den Krieg mit großer Wahrscheinlichkeit schon im Sommer 1943 verloren. 1944 stellten ausländische Zivilarbeiter und Kriegsgefangene ein Viertel aller Beschäftigten im Deutschen Reich. Der millionenfache Einsatz von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen war nicht von langer Hand geplant, vielmehr entwickelte sich diese Praxis erst in den Kriegsjahren. In der Behandlung und Versorgung der Menschen, die sich insbesonders nach der Herkunftsnation richtete und von der die Überlebenschancen abhingen, beruhte maßgeblich auf der nationalsozialisti- schen Rassenideologie, aber auch auf bündnispolitischen Erwägungen. 3 Ukraine, Mai 1942: Vor dem Abtransport nach Deutschland werden die Arbeitsdienstverpflichteten untersucht. Zwischen Ideologie und Pragmatismus: Die Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte Der Masseneinsatz ausländischer Arbeitskräfte im Deutschen Reich begann mit dem Überfall auf Polen im September 1939. Schon im Oktober desselben Jahres arbeiteten über 200 000 polnische Kriegsgefangene in der deutschen Landwirtschaft. Aus ideologischen Gründen war die nationalsozialistische Führung zuvor gegen den Einsatz polnischer Arbeitskräfte gewesen. Diese Haltung hatte sich jedoch schnell geändert: Wenn nicht deutsche Frauen in großem Umfang zur Arbeit in Industrie und Landwirtschaft herangezogen werden sollten – was ebenso wie der Einsatz von Polen gegen die nationalsozialistische Ideologie verstieß –, dann mussten ausländische Arbeitskräfte eingesetzt werden, um den Krieg wie geplant fortführen zu können. Nach größtenteils erfolglosen Anwerbungskampagnen der deutschen Arbeitsverwaltungsbehörden im besetzten Gebiet wurden Anfang 1940 polnische Zivilisten zur Arbeit in Deutschland zwangsverpflichtet. Wer sich zu entziehen versuchte, wurde mit Gewalt fortgebracht. Die Behandlung der polnischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die vorwiegend in der Landwirtschaft eingesetzt wurden, war zunächst nicht eindeutig geregelt. Erst im März 1940 wurden die zahlreichen Vorschriften und Bestimmungen in den so genannten »Polenerlassen« zusammengefasst, die die Diskriminierung der Polen und Polinnen in allen Lebensbereichen zur Folge hatten. Die polnischen Zwangsarbeiter deckten die Bedürfnisse des Krieg führenden Deutschen Reiches noch nicht. Mit der Besetzung Frankreichs im Juni 1940 zog man nun auch französische Kriegsgefangene als Arbeitskräfte heran. Zudem setzten die deutschen Behörden auf die Anwerbung von Zivilisten zur Arbeit im Deutschen Reich. Auch im besetzten Belgien und den Niederlanden wurden Zivilisten Bundesarchiv / B 19 880 3 Ukraine, Juni 1942: Die Bevölkerung wird zur Zwangsarbeit nach Deutschland verfrachtet, um hier in der Rüstungsindustrie eingesetzt zu werden. Bundesarchiv / B 25 445 zunächst formal als freie Beschäftigte angeworben. In diesen besetzten Ländern wurde erst im Frühjahr 1941 (Niederlande) bzw. 1942 (Frankreich, Belgien) durch die Einführung der allgemeinen Arbeitspflicht und Repressalien verschiedener Art der Druck auf Zivilisten erhöht, in Deutschland zu arbeiten. Erst ab 1943 begann man in den Niederlanden und Belgien mit jahrgangsweisen Aushebungen zur Rekrutierung von Arbeitskräften. Mit Deportationen in größerem Umfang und einhergehend mit brutalen Repressionsmaßnahmen begannen die deutschen Behörden in den Niederlanden 1944. Die Arbeitskräfte aus den westeuropäischen Ländern standen in der nationalsozialistischen Hierarchie deutlich über den Polen und dementsprechend gestaltete sich ihre Behandlung. Schon bald nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 zeichnete sich ab, dass dieser Krieg nicht mit einem schnellen Sieg für die Deutschen enden würde. In der Kriegswirtschaft wurde ein deutlicher Mangel an Arbeitskräften festgestellt, zumal immer mehr deutsche Arbeiter zur Wehrmacht einberufen wurden. Ende 1941 gaben Hitler und Göring einen Beschluss heraus, der fortan das Leben von schätzungsweise 3–4 Mio. Sowjetbürgern bestimmen sollte: Sie genehmigten den Arbeitseinsatz sowjetischer Kriegsgefangener und Zivilisten für das Deutsche Reich. Ähnlich wie im Falle der Polen hatten sich bis dahin vor allem die Ideologen in der Parteiführung und die SS gegen die Vorstellung gesperrt, auf sowjetische Arbeitskräfte angewiesen zu sein. Diese bezeichneten sie gemäß der nationalsozialistischen Rassenlehre als »slawische Untermenschen« und sahen in ihnen außerdem – anders als bei den Polen – eine politische Gefahr, den »Bolschewismus«. Hitler und Göring entschieden sich mit ihrem Beschluss jedoch pragmatisch und gaben somit dem kriegswirtschaftlichen Druck nach. Auf die meisten sowjetischen Kriegsgefangenen konnte jedoch nicht mehr zurückgegriffen werden: Zu dem Zeitpunkt waren bereits 70 % (= 2,8 Mio.) der sowjetischen Kriegsgefangenen in den Lagern der Wehrmacht umgekommen; ihr Tod war einkalkuliert und Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 11 Quelle: Spoerer, Mark/ Zwangsarbeit im Dritten Reich und Entschädigung: ein Überblick http://www.akademie-rs.de/publikationen/hp56_spoerer.htm Zwangsarbeit ist als ein Aspekt des »Vernichtungskrieges« zu sehen. Die deutsche Führung hatte kein Interesse am Erhalt des Lebens der Gefangenen, solange an einen Arbeitseinsatz noch nicht gedacht wurde. Nun entschied man, wie in Polen vorzugehen und in großer Anzahl sowjetische Zivilisten und Zivilistinnen als Arbeitskräfte für das Deutsche Reich heranzuholen. Die Rekrutierungen von Arbeitskräften aus den besetzten Gebieten und der Arbeitseinsatz der Zivilisten sollten fortan durch das Amt des »Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz« effektiver und zentral geleitet werden, das der Thüringer Gauleiter Fritz Sauckel im März 1942 übernahm. Gemeinsam mit den Behörden der Zivilverwaltung bzw. der Wehrmacht im eroberten Gebiet setzte Sauckel die Deportation der Sowjetbürger ins Werk. Im Unterschied zum Vorgehen in den westeuropäischen Ländern ging man hier, ebenso wie in Polen, nach einer kurzen Phase von erfolglosen Anwerbungskampagnen schnell zur Gewaltanwendung über. Oft kam es vor, dass Zivilisten auf Märkten, vor Milchständen oder Kinos abgefangen, in Lastwagen gestoßen und in Sammellager transportiert wurden. Ihnen stand eine mehrwöchige Fahrt in verschlossenen Eisenbahnwagen bevor, in der Regel Vieh- 12 waggons. Stellten Städte oder Gemeinden die festgelegten Kontingente an Arbeitskräften nicht, drohten Gewalttaten der Deutschen. In einem Bericht der Sicherheitskräfte werden die als Reaktion auf den Versuch, sich dem Abtransport zu entziehen, anzuwendenden Maßnahmen genannt: »Beschlagnahmung des Getreides und des Eigentums, Inbrandsetzung des Hauses, gewaltsames Zusammentreiben, Fesselung und Misshandlung der Gesammelten, Zwangsaborte von schwangeren Frauen«. Diejenigen sowjetischen Soldaten, die nach dem Beschluss Hitlers und Görings in Gefangenschaft gerieten und für den Arbeitseinsatz im Deutschen Reich vorgesehen waren, wurden zunächst in Durchgangslager und von dort aus in Kriegsgefangenen-Stammlager im Deutschen Reich gebracht. Arbeitsfähige sowjetische Kriegsgefangene wurden über die Arbeitsämter an Einsatzstellen verteilt. Der Status der sowjetischen Zwangsarbeiter, der in den so genannten »Ostarbeitererlassen« vom Februar 1942 festgeschrieben wurde, lag noch unter dem der Polen. Dementsprechend geringer waren in der Regel ihre Überlebenschancen. Die Politik gegenüber den sowjetischen Zwangsarbeitern gestaltete sich para- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 dox: Wegen ihrer Arbeitskraft waren die Menschen ins Deutsche Reich verschleppt worden, aber ihre Arbeitsleistung konnte bei der katastrophalen Versorgungslage, der sie ausgesetzt waren, nicht hoch sein. Deshalb hatten anfangs viele Betriebe an einem Einsatz sowjetischer Zwangsarbeiter kein großes Interesse. Nach der deutschen Niederlage in Stalingrad Anfang 1943 strebte die deutsche Führung fortan die Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität der sowjetischen Zwangsarbeiter an. Unter der Leitung des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels wurde eine Kampagne zur Leistungssteigerung sowjetischer Arbeiter und Arbeiterinnen durch bessere Versorgung und mehr Spielraum der Betriebe bei der Behandlung der Zwangsarbeiter durchgeführt. Gleichzeitig sollte der angenommenen politischen Gefahr durch die sowjetischen Arbeiter und Arbeiterinnen durch die Verschärfung des Strafsystems entgegengewirkt werden. Mit diesen veränderten Bestimmungen wurden die sowjetischen Arbeitskräfte für die Industrie äußerst lohnend, und auch die Privatwirtschaft forderte nun in großer Anzahl sowjetische Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen an. Dass auch die Privatindustrie nicht nur auf Bestimmungen reagiert hat, sondern aktiv an dem Zwangsarbeitsprogramm beteiligt war und außerdem einen großen Kapitalgewinn aus dieser Praxis gezogen hat, ist inzwischen durch die Forschung belegt. Bei der letzten größeren Gruppe von ausländischen Zwangsarbeitern, die nach Deutschland deportiert wurden, handelte es sich um italienische Kriegsgefangene. Anfang September 1943 wurde das Mussolini-Regime gestürzt. Kurze Zeit später gab die neue italienische Regierung unter Marschall Badoglio den Waffenstillstand mit den Alliierten bekannt. Daraufhin besetzten deutsche Truppen Rom, nahmen italienische Soldaten gefangen und deportierten sie ins Deutsche Reich. Die Italiener wurden vorwiegend für militärische Arbeiten eingesetzt. Neben den italienischen Soldaten wurden auch Zivilisten deportiert. Man behandelte sie in ähnlich unmenschlicher Weise wie die Sowjetbürger, vor allem aufgrund des »Verrats«, der ihnen vorgeworfen wurde. Bundesarchiv / 183-H28897 3 In einem Kraftfahrzeug-Instandsetzungswerk der deutschen Wehrmacht, in dem aus dem Material unbrauchbarer Kraftwagen fahrtüchtige Wagen montiert werden, sind auch zwangsverpflichtete Facharbeiter aus der Sowjetunion beschäftigt. Aufnahme vom 19. Januar 1945 Die Haager Landkriegsordnung (1907) Mit der Haager Landkriegsordnung wurden völkerrechtliche Vereinbarungen getroffen, die dazu beitragen sollten, menschliches Leid im Krieg einzudämmen. Der Vertrag wurde auf der zweiten Haager Friedenskonferenz, an der 44 Staaten teilnahmen, geschlossen und regelte die Behandlung von Kriegsgefangenen und den Schutz der Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten. Die Bestimmungen besagten u.a., dass Kriegsgefangene mit Menschlichkeit zu behandeln seien und ihre Verpflegung und Unterkunft jener der eigenen Truppenreserve zu entsprechen habe. Zum Arbeitseinsatz durften, soweit der Gesundheitszustand dies erlaubte, nur einfache Soldaten herangezogen werden, Offiziere jedoch nicht. Die Arbeitsleistungen der Kriegsgefangenen durften darüber hinaus in keinem Zusammenhang mit Kriegshandlungen stehen. Die kriegsgefangenen Zwangsarbeiter unterstanden dem Oberkommando der Wehrmacht. Den italienischen, sowjetischen und polnischen Kriegsgefangenen verweigerte das nationalsozialistische Deutschland den völkerrechtlichen Schutz gemäß der Genfer Konvention (1929) bzw. der Haager Landkriegsordnung (1907) vollkommen. Auch die Überführung in den Zivilarbeiterstatus, wie er im Fall polnischen und italienischen Kriegsgefangenen erfolgte, widersprach dem Völkerrecht. Den Franzosen wurde der Schutz der Genfer Konvention nur zum Teil gewährt, während die Bestimmungen im Umgang mit den britischen und amerikanischen Kriegsgefangenen weitgehend eingehalten wurden. Ab Frühjahr 1944 konnten aufgrund der Kriegslage ausländische Zivilisten nur noch in geringem Umfang zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich deportiert werden. Gleichzeitig war der kriegswirtschaftliche Druck so groß, dass das Rüstungsministerium den »Einsatz« von KZ-Häftlingen in der Privatindustrie durchsetzen konnte. Sie unterstanden der SS und waren zuvor vorwiegend in SS-eigenen Betrieben eingesetzt worden. Aufgrund hoher Verluste in der Rüstungsproduktion durch die Bombardierungen der Alliierten wurde 1944 auf höchster Ebene entschieden, einen Teil der Rüstungsfabriken untertage – in Steinbrüche, Bergwerke und Eisenbahntunnel – oder in Großbunker übertage zu verlagern. Das Vorhaben verlangte ein enormes Arbeitskraftpotential, denn neben den Produktionsstätten mussten auch Unterkünfte für die Arbeiter errichtet und Transportwege ausgebaut werden. Die Privatindustrie, vorwiegend einige der großen Rüstungsfabriken, arbeitete dabei eng mit der SS und Albert Speer, dem Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, zusammen. In dieser Phase stellten Vertreter der Industrie konkrete Forderungen auf Zuweisung von KZ-Häftlingen. Insgesamt waren etwa 1,5 Mio. KZHäftlinge als Zwangsarbeiter eingesetzt, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen so schrecklich waren, dass die Opfer kaum eine Überlebenschance hatten. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 13 Bundesarchiv / 183-N0619-503 Zwangsarbeit Die Genfer Konventionen 1864 schlossen 16 Staaten eine Vereinbarung zum Schutz von Verwundeten der kriegführenden Heere. Diese Genfer Konvention wurde 1906 erweitert und 1907 durch die Haager Abkommen auf den Seekrieg ausgeweitet. 1929 trat ein Vertrag zur Behandlung von Kriegsgefangenen hinzu, der im Wesentlichen auf den Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung basierte, diese aber noch ausführlicher regelte. Die Genfer Abkommen von 1929, zu deren Unterzeichnern auch das Deutsche Reich zählte, galten bis nach dem Zweiten Weltkrieg. 1949 wurden die früheren Vereinbarungen durch die Vier Genfer Abkommen ersetzt (Schutz der Verwundeten der Streitkräfte im Felde und zur See, der Kriegsgefangenen und der Zivilbevölkerung). Später wurden Zusatzprotokolle aufgenommen, die das Völkerrecht an die Veränderungen der Kriegstechnik anpassen und außerdem den Opfern von nicht internationalen bewaffneten Konflikten Schutz bieten sollten. Hunger, Kälte, Krankheit und Diskriminierung: Die Lebensumstände der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen Die Bedingungen, unter denen die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen inmitten der deutschen Bevölkerung leben mussten, wurden von vielfältigen Aspekten bestimmt. Das Kriterium der Nationalität bzw. der »Volkstumszugehörigkeit« gemäß der nationalsozialistischen Rassenlehre wirkte sich am stärksten aus. Die Abstufungen waren feiner, als sie hier dargestellt werden können. Allgemein gefasst kann jedoch gesagt werden, dass französische, belgische und niederländische Arbeiter in der rassistischen Hierarchie unter den Deutschen, aber über den anderen Gruppen der Zwangsarbeiter angesiedelt wurden. Die Ernährung der Zwangs- 14 5 Frankreich, April 1943: Ehemalige Kriegsgefangene, die zur Arbeit in der Rüstungsindustrie in Deutschland verpflichtet wurden, vor der Abfahrt arbeiter aus diesen Ländern war in der Regel wesentlich besser als die der Polen und Sowjetbürger. Einige der Arbeitskräfte aus Westeuropa konnten sogar eine private Unterkunft finden und somit das Leben im Lager umgehen. Ihr Lohn entsprach in der Regel dem der deutschen Arbeiter, ebenso verhielt es sich mit der Arbeitszeit. Allerdings hatten diese Arbeitskräfte fast keine Möglichkeit, Heimaturlaub zu erhalten. Sie hatten häufig unter Diskriminierungen, Schikanen und demütigenden Strafen zu leiden. jegliche Arbeitsminderleistung hatte mit Einweisung in ein »Arbeitserziehungslager« bestraft zu werden. Arbeitszeitbegrenzungen gab es kaum. Bei sexuellem Kontakt eines Polen mit einer deutschen Frau drohte seine öffentliche Hinrichtung, die Frau wurde öffentlich gedemütigt; Polen durften außerdem ihren Ortsbezirk nicht verlassen und keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Die optische Stigmatisierung erfolgte durch ein »P«-Abzeichen, das deutlich sichtbar an der Kleidung zu tragen war. Die polnischen Arbeiter und Arbeiterinnen mussten hingegen in Unterkünften untergebracht sein, die von denen der Deutschen getrennt waren: In der Praxis handelte es sich dabei meist um Ställe. Den Polen wurde weniger und qualitativ schlechteres Essen als den Zwangsarbeitern aus westeuropäischen Ländern zugeteilt. Viele der polnischen Arbeiter hatten aber in gewisser Hinsicht dadurch einen Vorteil, dass sie in der Landwirtschaft eingesetzt waren und dort leichter Zugang zu zusätzlichen Nahrungsmitteln hatten als beispielsweise sowjetische Zwangsarbeiter, die vorwiegend in der Industrie arbeiteten und aus Lagerküchen und Werkskantinen verpflegt wurden. Von ihrem Bruttolohn wurde den Polen eine diskriminierende Sondersteuer abgezogen; Der Status der Sowjetbürger lag sogar unter dem, der den Polen zugeschrieben war, und so litt diese Gruppe der Zwangsarbeiter in der Regel unter noch extremeren Lebensbedingungen. Dies drückte sich z.B. in den deutlich geringeren Verpflegungssätzen aus, die gerade zum Überleben ausreichen sollten. Die sowjetischen Zwangsarbeiter litten unter ständigem Hunger. Insbesondere wurde auch Wert darauf gelegt, die sowjetischen Bürger und Bürgerinnen noch stärker von den deutschen Arbeitern abzugrenzen, als es im Fall der Polen praktiziert wurde. Sie wurden vorwiegend in fabriknahen Baracken untergebracht, die sie, außer zur Arbeit, nicht verlassen durften. Auch die sicherheitspolitischen Bestimmungen waren um einiges rigider: Schon bei geringster »Disziplin- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 widrigkeit« hatte die Einweisung in ein Konzentrationslager oder die »Sonderbehandlung«, d.h. die Hinrichtung ohne formelles Urteil, zu erfolgen. Zudem war die diskriminierende Sondersteuer höher als die, die den polnischen Arbeitskräften auferlegt wurde. Aus dem Bericht eines Amtsarztes, der im August 1942 ein Lager für sowjetische Zwangsarbeiter in Freiburg im Breisgau inspizierte, geht hervor, welchen katastrophalen hygienischen Umständen die Menschen in diesen Unterkünften ausgesetzt waren: »Das Russenlager wurde heute von mir besichtigt. Es beherbergt z. Zt. etwa 160 Männer und Frauen. Es ist erforderlich folgende Einrichtungen mit größter Beschleunigung fertig zu stellen: 1) Waschgelegenheiten, da die vorhandene Möglichkeit ganz ungenügend ist und die meisten Leute sich überhaupt nicht waschen können, es sei denn im vorbeifließenden Kanal. 2) Abortanlagen. Da nur 2 oder 3 Aborte vorhanden sind, findet notgedrungen jede Nacht eine unbeschreibliche Verunreinigung der Umgebung und sogar des Hauses selbst statt, die zu den größten gesundheitlichen Bedenken Anlass gibt. […] Es ist, wenn eine Wiederverlausung der Leute und die unerträgliche Ausbreitung der jetzt schon zahlreich vorhandenen Flöhe vermieden werden soll, auch nötig, dass jeder Mann und jede Frau zwei Garnituren Wäsche besitzt. Die meisten Leute besitzen nur ein Hemd, das meist noch zerrissen ist und konnte[n] sich bisher nie umziehen.« Dieser Bericht wurde aufgrund der Seuchengefahr verfasst, von der auch Deutsche bedroht waren, nicht etwa aus Gründen der Menschlichkeit. Angesichts dieser Umstände verwundert es nicht, dass die vorwiegend jungen und gesunden Menschen aus der Sowjetunion bereits nach einer kurzen Aufenthaltsdauer in Deutschland erkrankten. Sie litten vor allem an Tuberkulose, Flecktyphus und Hungerödemen. Arbeitsunfähige wurden bald in ihre Heimat zurücktransportiert, wenn sie nicht vorher starben. Den sowjetischen Zwangsarbeitern blieb von ihrem Arbeitslohn nach Abzug der so genannten »Ostarbeiterabgabe« und Abzügen für Verpflegung und Unterkunft kaum etwas. Die Frauen, die etwas mehr als die Hälfte der sowjetischen Zivilarbeiter stellten, erhielten bei gleichen Leistungsanforderungen eine noch schlechtere Bezahlung als die Männer. Die Lebensverhältnisse der Zwangsarbeiter hingen jedoch nicht ausschließlich von den Bestimmungen der Behörden ab. Wenn ein Zwangsarbeiter einem Bauernhof zugeteilt wurde, so kam es auf die Familie an, ob sie den Arbeiter hungern ließ und misshandelte oder menschlich mit ihm umging. In Fabriken bestimmte beispielsweise auch das Verhalten des Vorarbeiters den Leidensdruck des Zwangsarbeiters mit. Er konnte den Arbeiter zusätzlich schikanieren, bestrafen und misshandeln, oder aber ihn weitgehend in Ruhe lassen. Frauen waren sexuellen Übergriffen schutzlos ausgeliefert. Im Verhalten des Großteils der deutschen Bevölkerung, die mit Zwangsarbeitern zu tun hatte, zeigte sich – von Ausnahmen abgesehen –, dass die nationalsozialistische Führung sich durchaus auf den bestehenden Rassismus im Volk verlassen konnte. Die zur Zwangsarbeit eingesetzten KZHäftlinge hatten kaum eine Überlebenschance. Zugleich bedeutete die Zwangsarbeit für sie fast die einzige Möglichkeit, den Vernichtungsprogrammen zu entgehen. Zu der täglichen Arbeitszeit von 15-16 Stunden kamen die langen Anmarschwege, die katastrophale Versorgungslage und körperliche Misshandlungen durch die SS, Wachmannschaften und Zivilarbeiter. Die KZ-Häftlinge waren in ungeheizten Baracken, Zelten oder Erdlöchern untergebracht. Waren sie im Baubereich eingesetzt, so konnten sie nur einige Wochen überleben. Die Lebenserwartung der Häftlinge in der Produktion war etwas höher, da ihrer Arbeitskraft durch die Anlernzeit ein höherer Wert beigemessen wurde. Insgesamt aber kalkulierte man ihren Tod ein: Er blieb das Ziel der SS. Der Vernichtungsprozess der Häftlinge auf den Großbaustellen im Deutschen Reich lief vor den Augen der einheimischen Bevölkerung ab. Einer der wenigen Überlebenden, Ladislaus ErvinDeutsch, wurde 1944 aus Klausenburg, damals Ungarn, zunächst nach Auschwitz, und von dort aus zur Zwangsar- beit in das Dachauer Außenlager Kaufering deportiert. Er erinnert sich an die Ankunft in Kaufering: »Hinter dem Bahnhof erwachte gerade ein friedliches, kleines Städtchen. […] Vielleicht hatte die Bevölkerung von Kaufering noch nicht einmal die zur Zwangsarbeit Verschleppten gesehen. Als wir vorbeizogen, nahmen sie die zum Lüften hinausgehängten Betten wieder rein und schlossen die Fenster. In den Straßen drückten sich die Menschen an die Häuserwände. Wir waren Ausgestoßene aus der zivilen Welt.« n Verena Krüger Literatur: Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des »Ausländer-Einsatzes« in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Bonn 1999 Mark Spoerer, Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945, Stuttgart/München 2001 Aus den Erinnerungen einer Ukrainerin, die als Jugendliche ins Deutsche Reich zur Zwangsarbeit verschleppt wurde: »Ich hatte mein 15. Lebensjahr noch nicht vollendet. Man brachte mich 1942 nach Deutschland, in die härteste Fabrik. Die Arbeit war schrecklich […] man goss den Zement, einen speziellen Zement, wenn er tropfte, bildeten sich in der Kleidung sofort Löcher. In der Nähe der Fabrik waren die Baracken, wo wir schliefen, […] wir bekamen nicht einmal Strohsäcke […]. Als man uns in Viehwaggons nach Deutschland brachte, kamen die Deutschen, die uns anschauten als seien wir Wilde. […] Zu essen gab man uns Steckrüben und verschiedene Rübenabfälle, von solchen Rüben, die für Tiere angebaut werden.« Das Zitat ist entnommen aus: G.G. Verbickij, Ostarbajtery. Istorija rossijan nasil’stvenno vyvezennych na raboty v Germaniju (vtoraja mirovaja vojna). Dokumenty i vospominanija. / G.G. Werbizky, Ostarbeiters. Russian Forced Laborers in Nazi Germany (World War II). Documents and Life Stories, Vestal, N.Y., 2000, S. 16 f. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 15 Kampf um Gold Kampf um Gold Spitzensportförderung in der Nationalen Volksarmee und in der Bundeswehr Die Konkurrenzsituation zwischen der Bundeswehr und der Nationalen Volksarmee im Bereich der Spitzensportförderung ist nur vor dem Hintergrund der allgemeinen sportpolitischen Entwicklung der beiden deutschen Staaten in der Zeit des Kalten Krieges zu 16 Bundesarchiv Z u keinem Zeitpunkt während der deutschen Teilung standen sich die Bundeswehr und die Nationale Volksarmee in einer Gefechtssituation gegenüber. Doch einzelne Soldaten kämpften immer wieder auf Aschenbahnen, Ruderstrecken und eisigen Bobbahnen gegeneinander. Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 1964 konnten die beiden deutschen Armeen jeweils den ersten Olympiasieger in ihren Reihen feiern. Luftwaffenfähnrich Willi Kuhweide hatte dort Olympisches Gold ersegelt, während unweit von ihm der Kanute Feldwebel Jürgen Escher als erster Soldat der DDR auf das oberste Podest des Siegertreppchens gepaddelt war. Ihnen sollten viele weitere folgen. So teilten sich bei den Olympischen Spielen in München im Sommer 1972 zwei Armeesportler das Gold im Gehen »brüderlich«. Hauptmann Peter Frenkel holte Gold über 20 km für die DDR; Oberfeldwebel Werner Kannenberg erhielt für seine Leistungen über die 50 km Strecke Olympisches Gold für die Bundesrepublik. Aufs eindringlichste dürfte jedoch das Rodelfinale zwischen dem Obergefreiten Georg Hackl und Hauptmann Jens Müller vom Armeesportclub Oberhof 1988 in Calgary in Erinnerung geblieben sein. Dort wurde auf dem Siegertreppchen auch deutlich, welcher deutsche Staat sich über rund vierzig Jahre im Spitzensport gegen den Systemkonkurrenten jenseits der Mauer hatte durchsetzen können. Am mittleren Flaggenmast wurden Hammer und Zirkel gehisst, während sich die Bundesrepublik erneut mit Platz zwei zufrieden geben musste. 5 Olympische Winterspiele 1988: Siegerehrung auf dem Olympic Plaza im Zentrum von Calgary. In der Herren-Einsitzerkonkurrenz des Rennschlittenwettbewerbes verwies der NVA-Soldat Jens Müller den Bundeswehrsoldaten Georg Hackl auf den zweiten Platz. Dritter wurde Juri Chartschenko aus der UdSSR. erklären. Bereits in den 1950er Jahren hatte die DDR ein zwar noch grobmaschiges, aber mit der Zeit immer effizienter arbeitendes Fördersystem für den Spitzensport entworfen, das durch Zentralisierung, Konzentration, Verstaatlichung und frühe Talentförderung gekennzeichnet war. Dahinter stand das politische Kalkül der Parteiführung, dem noch jungen zweiten deutschen Staat durch sportliche Siege zu außenpolitischem Ansehen zu verhelfen. Damit hoffte die SED den bundesrepublikanischen Alleinvertretungsanspruch, seit 1955 in der Hallstein-Doktrin zementiert, im sportlichen Bereich systematisch zu unterlaufen. Die bundesdeutsche Sportführung versuchte das sportliche Streben der DDR nach Anerkennung zunächst auf sportpolitischem Weg zu verhindern. Deshalb setzte sie immer wieder im engen Schulterschluss mit der Bundesregierung vor dem Internationalen Olympischen Komitee die künstliche Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 Verklammerung beider deutscher Staaten in einer gesamtdeutschen Olympiamannschaft durch. Mitte der 1960er Jahre begann diese Strategie jedoch zu bröckeln. Denn erstens wurde die DDR 1965 in der Olympischen Bewegung vollständig anerkannt, und zweitens forderte – seit dem schlechten Abschneiden der westdeutschen Athleten in Tokio 1964 – auch die westdeutsche Öffentlichkeit mehr sportliche Siege zur Steigerung des nationalen Prestiges; eine Einstellung, die sich besonders nach der Vergabe der Olympischen Spiele an die Stadt München im Jahr 1966 verfestigte. Die politisch aufgeladene Medailleneuphorie in beiden deutschen Staaten spiegelte sich auch in der Spitzensportförderung ihrer Armeen wieder. Beide wurden ihrer Verantwortung im sportlichen Wettkampf der Systeme mit dem Aufbau einer eigenen Spitzensportförderung gerecht. dpa dpa/epu 5 11. September 1960, Rom: Abschlussfeier der XVII. Olympischen Sommerspiele. Die zweifache Goldmedaillengewinnerin im Kunst- und Turmspringen Ingrid Krämer (DDR) trägt die mit den Olympischen Ringen versehene schwarz-rot-goldene Fahne der gesamtdeutschen Mannschaft. 5 10. Oktober 1964, Tokio: XVIII. Olympische Sommerspiele. Einmarsch der gesamtdeutschen Olympiamannschaft in das Olympiastadion Unter Druck von außen: Spitzensport in der Bundeswehr Gesamtdeutsche Olympiamannschaft: Mit ihrer Gründung 1955 stellte sich die Bundeswehr in die Tradition des prinzipiell engen Verhältnisses zwischen Sport und Militär in Deutschland. Dabei lag der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit zunächst ausdrücklich auf dem Breitensport, der die militärische Ausbildung spielerisch ergänzte. Doch bereits mit dem Inkrafttreten der Allgemeinen Wehrpflicht im Jahr 1957 sah sich die Bundeswehr mit einem naheliegenden Problem konfrontiert, da sich unter den eingezogenen Rekruten bald auch erste Leistungssportler befanden. Deren Förderung während ihres Militärdienstes beschränkte sich jedoch bis Ende der 1960er Jahre lediglich auf die Delegierung an Standorte mit günstigen Trainingsmöglichkeiten und die Freistellung zum täglichen Training ab 15.00 Uhr. Außerdem ermöglichten Dienstbefreiung und Sonderurlaub den sportlichen Soldaten die Teilnahme an Wettkämpfen, auch wenn diese im kommunistischen Machtbereich stattfanden. Auf diese Art und Weise sollte verhindert werden, dass die jungen Athleten durch ihren Wehrdienst in einen unaufholbaren Trainingsrückstand zur Weltelite gerieten. Zu Beginn der 1960er Jahre wuchs jedoch der öffentliche Druck auf die Bundeswehr, nachdem bekannt wurde, dass neben den USA auch einige europäische Staaten dazu übergingen, die Ressourcen ihrer Armeen zur gezielten Ausbildung von Spitzensportlern zu nutzen. Außerdem war bekannt, wie hoch der kommunistische Konkurrent für die Medaillen in den Armeesport investierte. Der Sportreferent der Bundeswehr, Oberstleutnant i.G. Dr. Hugo Bach, meldete gegenüber diesen Forderungen jedoch prompt »erhebliche sachliche und moralische Bedenken« an. So machte er geltend, dass es der Auftrag der Bundeswehr sei, Soldaten auf ihre Verteidigungsaufgaben vorzubereiten, nicht jedoch eine kleine Gruppe von Spitzensportlern zu trainieren. Außerdem verstoße die Einrichtung von so genannten »Sportbataillonen« gegen den Olympischen Amateurstatus und eine zu starke Leistungsorientierung laufe dem in der Bundeswehr gepflegten kameradschaftlichen Sport zuwider. So sehr Bach im Recht war, so schnell wurden seine Auffassungen von der allgemeinen sportpolitischen Entwicklung dennoch eingeholt. Im Zusammenhang mit der Pleite von Tokio 1964 und der »sportlichen Mobilmachung« vor München seit 1966 forderte der Deutsche Bundestag im Jahr Erstmalig traten west- und ostdeutsche Athleten 1956 in Melbourne und Cortina d’Ampezzo mit in einer gemeinsamen Olympiamannschaft an. Sie war von dem damaligen Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), dem Amerikaner Avery Brundage, ins Leben gerufen worden. Dieser wollte mit ihr das Unpolitische und Verbindende der Olympischen Bewegung symbolisieren. Tatsächlich wich das IOC durch diese Kompromisslösung jedoch auch der unpopulären Entscheidung aus, die DDR als vollständiges Mitglied ihrer Gemeinschaft anzuerkennen. Seit 1959 wurde für die gesamtdeutsche Olympiamannschaft eine eigene künstliche Flagge gehisst. Sie zeigte die fünf weißen Olympischen Ringe vor schwarz-rot-goldenem Hintergrund. Als Hymne diente Beethovens »Ode an die Freude«. Obwohl die DDR 1965 als vollständiges Mitglied der Olympischen Bewegung anerkannt wurde, trat sie 1968 in Mexiko und Grenoble noch einmal mit Olympiaflagge und -hymne auf. Erst in Mexiko fiel dann die Entscheidung des IOC, der DDR in Zukunft auch ihr volles staatliches Protokoll zuzugestehen. Diesen neu gewonnenen Trumpf ihrer staatlichen Selbstdarstellung spielte die DDR 1972 erstmalig in Sapporo aus und auch zu den Olympischen Spielen in München im gleichen Jahr brachte sie »Hammer und Zirkel« und »Auferstanden aus Ruinen« mit. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 17 SKA/IMZ / Foto: Matthias Zins Kampf um Gold Die Hallstein-Doktrin: Die Hallstein-Doktrin, benannt nach dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt Walter Hallstein, war ein diplomatischer Hebel, mit dem die DDR isoliert und der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik gefestigt werden sollte. Sie unterstrich, dass die Bundesregierung weiterhin jede Anerkennung der DDR durch einen dritten Staat als »unfreundlichen Akt« betrachten und gegebenenfalls die diplomatischen Beziehungen zu dem anerkennenden Staat abbrechen würde. Eine Bekräftigung dieser Position schien angezeigt, nachdem Bundeskanzler Konrad Adenauer im Rahmen seines Besuches in Moskau im September 1955 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetunion vereinbart hatte. Damit war die Bundesrepublik von dem bisherigen Grundsatz abgewichen, keine diplomatischen Beziehungen zu Staaten zu pflegen, die die DDR anerkannten. Nach Ansicht Bonns vertiefte eine solche Anerkennung nicht nur die Spaltung Deutschlands, sondern sie lief auch dem Grundsatz zuwider, dass allein die demokratisch gewählte Bundesregierung befugt sei »für das deutsche Volk zu sprechen«. Wenn Bonn dennoch einem Botschafteraustausch mit Moskau zustimmte, so konnte dies zwar mit Hinweis auf den Status der Sowjetunion als Besatzungsmacht zur Ausnahme erklärt werden. Das Auswärtige Amt fürchtete jedoch, dass vor allem Entwicklungsländer nun an der Prinzipienfestigkeit der Bundesregierung zweifeln und versucht sein könnten, die DDR anzuerkennen. Die Hallstein-Doktrin diente dazu, eine solche Anerkennungswelle zu verhindern. Sie erfüllte auch zunächst ihren Zweck, erwies sich aber angesichts der zunehmenden Entspannungsbemühungen in den 1960er Jahren als außenpolitischer Bumerang, der die diplomatische Bewegungsfreiheit der Bundesrepublik zusehends einengte. 18 1968 die Bundeswehr auf, zur Förderung von Spitzenathleten Fördergruppen einzurichten, die möglichst eng an die Leistungszentren des Deutschen Sportbundes (DSB) angelehnt sein sollten. Daraufhin richtete die Bundeswehr zwei Lehrkompanien ein, eine am Standort der Sportschule in Sonthofen und eine an der Außenstelle der Sportschule in Warendorf. Jede der Kompanien umfasste 200 Förderplätze. Zusätzlich bauten Heer, Luftwaffe und Marine bei Truppenverbänden und Dienststellen Sportfördergruppen auf, die weitere 230 Förderplätze zur Verfügung stellten. In diese Einheiten wurden seit dem 1. April 1970 wehrpflichtige Sportler nach Abschluss ihrer Grundausbildung versetzt. Dort nahmen das sportliche Training 70 %, der militärische Lehrstoff nur 30 % des Dienstes ein. Die Bundeswehr bot zwar nur in Ausnahmefällen Übungsund Sportstätten, garantierte jedoch jedem Spitzensportler einen Verpflegungszuschuss. Die eigentliche sportliche Hoheit über die dienenden Leistungsträger lag jedoch bei den Fachverbänden. Ihre Bundestrainer trugen die Verantwortung für die individuellen Trainingspläne der Athleten, in ihren Leistungszentren sollte das dienstliche Training durchgeführt werden. Zudem beantragten sie die Versetzung eines wehrpflichtigen Sportlers in die Lehrkompanien oder Fördergruppen. Parallel zum Aufbau dieser neuen Sportförderstrukturen änderte sich auch die öffentliche Haltung der Bun- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 5 Bundespräsident Prof. Dr. Karl Carstens verleiht das Silberne Lorbeerblatt an verdiente Sportler, u.a. an sieben Soldaten der Bundeswehr deswehr zum Spitzensport. Entgegen vorheriger Bedenken wurde nun die Signalwirkung des Spitzensports auf den Breitensport betont. So erklärte die »Truppenpraxis« im Jahr 1969, dass auch Sportidole in Uniform jugendliche Nacheiferer fänden und so ihren Beitrag zur Gesunderhaltung der Bevölkerung leisteten. Nun unterstrich man die durch die Konkurrenzsituation des Kalten Krieges gewandelte gesellschaftliche Bedeutung des Sports und verpflichtete sich zum verantwortungsvollen Umgang mit sportlichen Talenten. Aber die Bundeswehr argumentierte nicht nur aus reiner Selbstlosigkeit, denn schließlich gehörte jeder Soldat auf dem obersten Treppchen zur eigenen Imagepflege dazu; getreu dem Werbeslogan der 1970er Jahre: »Solche Männer hat die Bundeswehr«. Intern wurde zwar von Zeit zu Zeit der Verteilungsschlüssel 30 % zu 70 % auf den Prüfstand gehoben und kritische Stimmen formulierten immer wieder Vorurteile gegen den Leistungssport per se. Doch bereits nach zwei Jahren, pünktlich zu den Olympischen Spielen in München 1972, zeigte sich, dass das neue Förderkonzept von den Sportlern angenommen wurde, denn von insgesamt 430 Förderplätzen waren zu diesem Zeitpunkt 390 belegt. Auch die Tatsache, dass Bundeswehrangehörige bei den internationalen Militärsportveranstaltungen des Conseil Internati- Bundesarchiv Bild 183-L0831-226 / Foto: Schlage 5 XX. Olympische Sommerspiele München, 20-km Gehen: Peter Frenkel (DDR) überquert den Zielstrich im Olympiastadion onal du Sport Militaire (CISM) immer mehr Medaillen errangen, und die ständig steigende Zahl Bundeswehrangehöriger als Teilnehmer bei den Olympischen Spielen bestätigten den Erfolg der gezielten militärischen Spitzensportförderung. Erfolgreiche Kindergärtner: Spitzensport in der NVA Die Entwicklung der Spitzensportförderung der Nationalen Volksarmee unterschied sich wesentlich von derjenigen der Bundeswehr. In der DDR bestand zum Zeitpunkt der Gründung der Armeesportvereinigung Vorwärts (ASV) am 1. Oktober 1956 bereits ein staatlich initiiertes und reglementiertes Leistungssportfördersystem. In dieses hatte sich bereits die Vorgängerorganisation der ASV strukturell eingepasst und auch sie selbst unterwarf sich nun den Vorgaben, die von Seiten der Partei und der Führung des Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB) gemacht wurden. Dazu gehörte zum einen die Konzentration ihrer talentiertesten Sportler in so genannten Armeesportclubs (ASK). Diese waren seit 1954 neben den zivilen Sportclubs die Kernzellen des DDR-Leistungssports. Für die Sportler der Sportclubs hatte das Politbüro ausdrücklich festgelegt, dass ihre Haupttätigkeit im sport- 5 In der DDR waren Sport und Politik untrennbar miteinander verbunden. Die Monatszeitschrift »Armeesportler« der NVA-Sportvereinigung propagierte nicht nur die sportlichen Erfolge der ASV-Athleten, sondern warb zugleich für die politischen Absichten der SED und ihrer Armee. lichen Training zu bestehen habe. Die Armeesportclubs bestanden zunächst in Berlin, Leipzig, Rostock und Oberhof. In den 1970er Jahren kamen in Frankfurt/Oder jeweils ein ASK und ein FC Vorwärts dazu. Doch nicht nur dort wurde das Gold für die NVA geschmiedet. Der auffälligste Unterschied zur Bundeswehr bestand in der Nachwuchsarbeit der NVA, welche die zweite Säule der armeeinternen Leistungssportförderung bildete. Die Schlüsselfunktion des Nachwuchsleistungssports betonte SED-Parteichef Walter Ulbricht, der die Entstehung des DDR-Leistungssportsystems nicht nur aufs engste begleitete, sondern auch mitformte, bereits in Reden aus den frühen 1950er Jahren. Somit erstaunt auch nicht die Äußerung von Verteidigungsminister Generaloberst Willi Stoph, der bereits im Februar 1956 die NVA darauf einschwor: »Den Sportnachwuchs, den wir brauchen, müssen wir uns selbst entwickeln und heranbilden.« Unmittelbar nach der Gründung der ASV folgten circa 1000 Jungen und Mädchen diesem Ruf, bis zum Fall der Mauer sollten es 33 000 werden. Doch Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 19 Kampf um Gold 5 Olympische Sommerspiele in München, am 31. August 1972: Siegerehrung für die Medaillengewinner im 20-km-Gehen. Bildmitte Goldmedaillengewinner Peter Frenkel, rechts Hans-Georg Reimann (Bronzemedaille/beide DDR), links Wladimir Golubnitschi (UdSSR/Silbermedaille) Bundesarchiv Bild 183-L0901-200 / Foto: Schulze gerade zu Beginn meldeten sich noch kritische Stimmen, die – vergleichbar mit der Diskussion, die rund zehn Jahre später in der Bundesrepublik geführt wurde – auf den Konflikt zwischen Verteidigungsauftrag und sportlicher Kaderschmiede hinwiesen. Trotzdem wurde gemäß der Parteilinie auf der 1. Sportkonferenz der ASV im Juni 1958 angestrebt, in Zukunft in jedem Standort Kinder- und Jugendabteilungen zu bilden, außerdem wurden Patenschaften über Schulsportgemeinschaften übernommen. Für die größten Talente unter den Kindern und Jugendlichen wurden in den Sportclubs A- und B-Jugendmannschaften jeder betriebenen Sportart gebildet. Diese Auslese lief jedoch nur schleppend an. 1960 trainierten erst 20 2000 Kinder und Jugendliche in den Armeesportklubs. Aus diesen Anfangsschwierigkeiten, der Umstrukturierung des westdeutschen Leistungssports seit Mitte der 1960er Jahre und dem besonderen Stellenwert der Olympischen Spiele 1972 für die DDR-Sportführung, resultierte Mitte der 1960er Jahre auch ein starker Veränderungsdruck auf die Talentförderung in den Reihen der NVA. So wurde die Armeesportvereinigung im Jahr 1964 durch den Deutschen Turn- und Sport-Bund (DTSB) aufgefordert, für ihren Nachwuchs ein zusätzliches Stützpunktsystem aufzubauen, aus dem die späteren Trainingszentren (TZ) hervorgingen. Diese TZ bildeten schließlich in den 1970er Jahren die Basis des dreigliedrigen Fördersystems, das den DDR-Sport zum Weltruhm bringen sollte. Der unterschiedliche Stellenwert des Spitzensports in der NVA im Vergleich zur Bundeswehr erklärt sich unter anderem aus der unterschiedlichen gesellschaftlichen Stellung des Spitzensportlers in beiden deutschen Staaten. Denn da die Stellung des Leistungssportlers im Sozialismus dank ideolo- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 gischer Mystifizierung höher war als in der Bundesrepublik, verfiel die NVA noch schneller der Versuchung zur Geburtsstätte von Helden zu werden. Deutlich wird dieses Selbstverständnis an dem Loblied, das Oberst Wolfgang Sachse seiner ASV zum 25. Geburtstag schrieb: »Im Klassenkampf (…) seinen Mann zu stehen, sich als Patriot der sozialistischen Heimat zu bewähren, Kämpfertum, Risikobereitschaft, und einen unbändigen Siegeswillen auszustrahlen – das ist es, was die Popularität unserer Leistungssportler ausmacht (…).« Daher integrierte die NVA ihre Sportler generell viel stärker in die eigene Imagepflege. Dazu gehörte beispielsweise die Teilnahme der rot-gelben Trikotträger bei den Massenübungen des Leipziger Sportfestes seit 1956. Aber auch die ersten weiblichen Medaillengewinnerinnen der ASV sollten helfen, der grauen Truppe ein menschliches Antlitz zu geben. Für die Geburt von Helden – neben ihrem unbestrittenen breitensportlichen Engagement 5 Den Arbeitern und Bauern zum Dank: die Armeesportvereinigung (ASV) »Vorwärts« bei den Massenübungen des Leipziger Turn- und Sportfestes im Leipziger Zentralstadion im Juli 1977 unter der Losung »Stärkt unsere DDR«. Bundesarchiv Bild 183-S0730-104 / Foto: Koard – wurde die Armeesportvereinigung Vorwärts pünktlich zur bereits genannten Jubiläumsfeier belohnt: Sie erhielt 1981 den Vaterländischen Verdienstorden in Gold. Statt Krieg – Zusammenfassung Zum Zeitpunkt der Gründung der NVA und ihrer Armeesportvereinigung Vorwärts im Jahr 1956 bestand in der DDR bereits der außenpolitisch motivierte »Staatsauftrag Olympisches Gold«. Dieser Vorgabe kam die Armeesportvereinigung von Beginn an durch die gezielte Förderung, aber auch die frühe Sichtung von Leistungssportlern in ihren Sportgruppen nach. Im Gegensatz dazu kam die Bundeswehr in ihren Anfangsjahren jungen Leistungssportlern zwar durch Freistellungen entgegen, definierte aber für sich keinen expliziten Förderauftrag. Erst die wachsende sportliche Stärke der DDR, die Verve, mit der ostdeutsche Sportfunktionäre und Politiker sportliche Wettkämpfe zum Kampf der Systeme stilisierten, und die Annahme dieser Herausforderung durch die westdeutsche Bevölkerung führten zu einem langsamen Umdenken. Dieser Prozess wurde maßgeblich durch den Zielpunkt der Olympischen Spiele 1972 in München bestimmt, an dem sich die NVA gleichermaßen orientierte. So erklärt es sich auch, dass es in beiden Armeen gleichzeitig zu Strukturveränderungen in der Sportförderung seit Mitte der 1960er Jahre kam. Die entscheidenden Weichen für die Spitzensportförderung in den Reihen von NVA und Bundeswehr wurden vor 1972 gestellt; beide Armeen perfektionierten ihr Fördersystem zwar im Laufe der Jahre, doch die Grundbestandteile Sportclubs und Trainingszentren auf der einen, Sportlehrkompanien und Sportgruppen auf der anderen Seite der Mauer blieben bis in die späten 1980er Jahre bestehen. Mit der Auflösung der DDR kam auch das Ende der Armeesportvereinigung Vorwärts, ihr kostspieliges Spitzensportfördersystem war für die Bundeswehr nicht finanzierbar. Dennoch veränderte das Jahr 1990 auch die Sportförderung in der Bundeswehr, indem man es zu Neustrukturierung und Konzentration nutzte. Was von der Armeesportvereinigung Vorwärts blieb, sind ihre unvergesslichen sportlichen Erfolge und einige Talente, die in den 1990er Jahren in der Bundeswehr ein neues sportliches Zuhause fanden. Dazu gehörten die Biathleten Stabsunteroffizier Frank Luck (Gold und Silber in Lillehammer 1994), Stabsunteroffizier Sven Fischer (Gold und Bronze in Lillehammer 1994) und Mark Kirchner (als Unteroffizier Gold in Albertville 1992 und als Stabsunteroffizier ebenfalls Gold in Lillehammer 1994). Auch Oberfeldwebel Wolfgang Hoppe erfuhr in einem Bundeswehrbob noch einmal olympisches Silber in Albertville und für den Schwimmer Stabsunteroffizier Jörg Hoffmann reichte es 1992 in Barcelona noch einmal für Bronze. n Uta Andrea Balbier Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 21 Service Das historische Stichwort »Jetzt hört alle Jurisprudenz auf, ... jetzt regiert Mars die Stunde!« Vor 90 Jahren: Die Affäre von Zabern I ©Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG m Frankfurter Frieden vom 10. Mai 1871, der den Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 formell beendete, hatte der preußische Ministerpräsident und Reichskanzler Otto von Bismarck, auch unter dem Druck der Militärführung, auf der Abtretung des seit dem Ende des 17. Jahrhunderts von Frankreich annektierten alten deutschen Kulturlandes Elsass und Teilen Lothringens einschließlich der Festung Metz bestanden. Von deutscher Seite wurden die neu hinzugekommenen Landesteile in erster Linie als militärisches Bollwerk gegenüber eventuellen französischen Revanchebestrebungen gesehen und dementsprechend mit 22 einer unübersehbaren Militärmacht überzogen. In der Münsterstadt Straßburg war nun das Generalkommando des XV. Armeekorps stationiert. In der alten Reichsstadt Metz stand das XVI. Armeekorps. Beide Festungen wurden darüber hinaus zusätzlich verstärkt und in Mutzig westlich von Straßburg wurde mit der Feste »Kaiser Wilhelm« eine moderne, der Waffenentwicklung der Artillerie entsprechende Großfestung geschaffen. Den als »verwelscht« (umgangssprachlich für »fremdländisch«; im wilhelminischen Kaiserreich wurde das Wort abwertend für die romanischen Völker, vorwiegend Franzosen und Italiener, benutzt) geltenden Einwohnern der neu hinzugekommenen Gebiete wurde mit vornehmlich preußischen Regimentern und einer aus zumeist preußischen Beamten bestehenden Zivilverwaltung eine sich zu den in zwei Jahrhunderten herausgebildeten Mentalitäten entgegengesetzt verhaltende Führungsschicht aufgezwungen. Diese sollte den häufig als »Wackes« beschimpften Elsässern ›den Franzosen austreiben‹. Ein vom Kaiser persönlich eingesetzter Statthalter wachte über die politische Sicherheit dieser im Reichsinneren immer als Grenz-, wenn nicht gar als Feindesland empfundenen Region, für die beispielsweise die Passpflicht erst in späteren Jahren abgeschafft wurde. Die bestehenden Spannungen soll- Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 5 Oktober 1913, Schloßpark zu Donaueschingen: General v. Deimling und Graf Wedel im Gespräch Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz / Foto: H. Hoffmann ten sich im Jahre 1913 schließlich in einer die Welt aufhorchen lassenden Eruption entladen und dem Deutschen Reich einen Scherbenhaufen militärischer und politischer Fehlentscheidungen hinterlassen. Die vom 28. Oktober 1913 ausgehende »Zaberner Affäre« entzündete sich vordergründig an einer Kasernenhofblüte, wie sie nicht nur für die Armee der Kaiserzeit typisch war. Während einer Instruktionsstunde über das Verhalten im Umgang mit Einheimischen äußerte der junge Leutnant Günther Freiherr von Forstner (1893–1915) aus der 5. Kompanie des Infanterieregiments 99: »Wenn ihr dabei einen solchen Wackes [= herabsetzende, laut Regimentsbefehl verbotene Bezeichnung für einen Elsässer] über den Haufen stecht, schadet das auch nichts.« Mit dieser die Elsässer verletzenden Bemerkung setzte er einen Mechanismus in Gang, dessen Weiterungen zuletzt den Reichstag und die Weltöffentlichkeit in äußerste Rage brachten. Denn elsässische Soldaten gaben der örtlichen Zeitung den Hinweis, dass Forstner für hartes Vorgehen gegen die einheimische Bevölkerung eine Belohnung von 10 Mark angeboten hatte; der begleitende Sergeant hatte diese zusätzlich noch um weitere drei Mark erhöht. Am 6. November wurde die Öffentlichkeit durch die Presse in verhaltener Form über den Vorfall informiert. Die sich hieran entzündende Unruhe in der Bevölkerung artikulierte sich zuerst nur in Gespött und Hänseleien gegenüber Forstner, so dass diesem zum Schutz bei seinen Spaziergängen und Einkäufen in der Stadt eine Wache unter Gewehr beigegeben wurde. Die aus dem unvermindert provokanten Auftreten des Leutnants resultierende Erregung in der Bevölkerung geriet mehr und mehr außer Kontrolle der zivilen Ordnungsmacht, so dass sich der Regimentskommandeur, Oberst Friedrich Ernst von Reuter, allen gesetzlichen Vorgaben zum Trotz, zum bewaffneten Eingreifen berechtigt glaubte und sich in der Folge mehrfacher Kompetenzüberschreitungen schuldig machte. Zu tumultartigen Szenen kam es am 28. November, als Reuter in höchster Erregung etwa zwei Dutzend Bürger, darunter auch höhere Justizbeamte, verhaften ließ, die sich – seiner Meinung nach – auffällig verhalten und seinen auf den Vorschriften für das Einschreiten des Militärs basierenden Anordnungen angeblich widersetzt hatten. Bestärkt in seinem Handeln wurde Reuter noch vom Kommandierenden General des XV. Armeekorps, Berthold von Deimling, wie auch vom Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen, Wilhelm, der mittels impulsiver Telegramme an die Beteiligten die Stimmung weiter anheizte. Mehrere Tage herrschte in Zabern (frz.: Saverne) der Ausnahmezustand, das Militär dominierte über die Zivilgewalt. Ein ungeheurer Proteststurm erhob sich allenthalben und erreichte am 3. Dezember den Reichstag, wo sich Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg einem Misstrauensantrag stellen musste. Der neuen Kriegsminister Erich von Falkenhayn sprach sich in scharfer Rede im Parlament gegen eine rechtliche Würdigung des Verhaltens des Militärs aus und trug damit dazu bei, dem Kanzler mit großer Mehrheit das Misstrauen auszusprechen. Jedoch musste Bethmann Hollweg, da er nach der damaligen Verfassung nur dem Kaiser gegenüber verantwortlich war, nicht von seinem Amt zurücktreten. 3 Karikatur zur »Zabern-Affäre« von Th. Th. Heine aus dem Simplicissimus, 1913: »Preußen kolonisiert.« – »Lieben sollt ihr mich, ihr Wackes!!« Original: Kunstbibliothek, Berlin Repro: Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz © VG Bild-Kunst, Bonn 2003 Als unumgänglich allerdings erwies sich die kriegsgerichtliche Aufarbeitung des militärischen Verhaltens der Beteiligten. Zusätzlich zur disziplinären Ahndung des Gebrauchs des Schimpfwortes »Wackes« mit einer Woche Stubenarrest für Forstner begannen um die Jahreswende 1913/14 die Prozesse gegen die beteiligten Offiziere wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung, die letztlich mit Freisprüchen endeten. Ein zumindest nicht unvoreingenommenes Gericht bemühte sich gerade im Falle des Obersten von Reuter, den vom Kriegsministerium und besonders vom Kaiser für unabdingbar erachteten Vorrang der militärischen Kommandogewalt vor der zivilen Administration gleichsam als Axiom deutlich herauszustreichen. Mit wenig Fingerspitzengefühl und geringem Verständnis für die Belange der zivilen Macht wurde damit zugleich deren oberste Spitze im Reichslande, der kaiserliche Statthalter Karl Graf von Wedel, als Marionette in der Hand des Kaisers bloßgestellt. Noch einmal hatte das Militär über die zivilen Instanzen obsiegt und seine Vorrangstellung im politischen Gefüge des Reiches der Öffentlichkeit sichtbar vor Augen geführt. Das Scheitern dieser jegliches Maß vermissen lassenden Politik manifestierte sich schließlich in der Ablösung der gesamten politischen Führungsspitze in Elsass-Lothringen. Während der Kaiser den Statthalter auf dessen mehrfach geäußerten Wunsch sowie die übrige zivile Verwaltungsspitze von ihren Dienstposten entließ, verlieh er demonstrativ dem in ein bevorzugtes Regiment versetzten Oberst von Reuter den Preußischen Orden des Roten Adlers und beließ den eigentlichen Scharfmacher in der Affäre, General von Deimling, in seinem Kommando. Der anscheinend für den Grenzlanddienst für besonders befähigt gehaltene Leutnant von Forstner schließlich wurde in ein Grenzregiment auf der anderen Seite des Reiches nach Bromberg transferiert, das Infanterieregiment 99 für einige Zeit den Augen der Bevölkerung auf einem nahe gelegenen Truppenübungsplatze entzogen, sehr zum wirtschaftlichen Schaden wiederum der Zaberner Einwohner. Einziges materielles Ergebnis dieser Affäre bestand in einer Kodifizierung und Spezifizierung der Dienstvorschrift über den Waffengebrauch des Militärs, die in revidierter Form noch vor dem Kriegsbeginn 1914 erschien. Eine parlamentarische Kommission dagegen zur Untersuchung der Zaberner Vorfälle tagte einige Male und vertagte sich dann für immer. Dass der an sich unbedeutende und geringfügige Zaberner Vorfall auf dem Kasernenhof einen solchen, das Gefüge des Reiches erschütternden Eklat hervorrufen konnte, gewährt tiefe Einblicke in die angespannte politische Situation des Elsass am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Karlheinz Deisenroth Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 23 Service Medien online/digital Erinnerungsorte des Kalten Krieges D er Kalte Krieg prägte nicht nur die politische, sondern auch die bauliche Landschaft im geteilten Deutschland. Die bekanntesten Bauwerke dieser Teilung der Welt in zwei Militärblöcke waren die Berliner Mauer und die innerdeutsche Grenze, neben denen andere Überreste häufig vergessen werden, wie z.B. leerstehende Kasernen und Bunkeranlagen. Denn die politischen und militärischen Führungen der beiden verfeindeten deutschen Staaten hatten sich on 4www.dienststellemarienthal.de jeweils Schutzräume errichten lassen, aus denen heraus sie im Kriegsfall regieren und führen wollten. Für die Verfassungsorgane der Bundesrepublik war dies die »Dienststelle Marienthal« im Ahrtal und für den DDRMinister für Nationale Verteidigung und die Führung der NVA der Bunker Harnekop bei Berlin. Von den beiden Anlagen ist die ostdeutsche auch über die Wiedervereinigung hinaus erhalten geblieben; sie liegt gut versteckt im Wald etwa 30 Kilometer nordöstlich von Berlin. Im nahe gelegenen Ort Harnekop deutet nichts darauf hin, dass sich hier der »Führungsbunker« des Verteidigungsministers der DDR befand (Tarnbezeichnung: »Flugwetterstation«). Das dreietagige Bauwerk wurde zwischen 24 1971 und 1976 für die Führung der NVA im Kriegsfall gebaut, war mit damals modernster Technik ausgestattet und sollte im Ernstfall etwa 450 Personen aufnehmen. Heute ermöglicht der Verein »Baudenkmal Bunker Harnekop e.V.« die Besichtigung eines der früher am besten gehüteten Staatsgeheimnisse der DDR. Das Pendant der Bundesrepublik liegt in einem alten Eisenbahntunnel im Ahrtal, etwa 25 Kilometer südlich von Bonn. Dort wurde Anfang der 60er Jahre ein »Ausweichsitz der Verfassungsorgane des Bundes im Krisenund Verteidigungsfalle zur Wahrnehmung von deren Funktionsfähigkeit« errichtet. Der Regierungsbunker wurde im Jahre 1972 in Betrieb genommen und kostete seitdem 3 Milliarden DM. Er erstreckt sich unter einer bundeseigenen Grundstücksfläche von 188 023 Quadratmetern und besteht aus einem unterirdischen Stollensystem mit einer Gesamtlänge von 19 000 Metern; die unterirdische Fläche umfasst insgesamt 83 000 Quadratmeter, der umbaute Raum 367 000 Kubikmeter. Unter anderem finden sich hierin 936 Schlafzellen, 897 Büros, fünf Großkantinen, fünf Kommandozentralen, fünf Sanitätsbauwerke, zwei Fahrradabstellhallen, eine Druckerei, ein Friseursalon sowie ein Raum für ökumenische Gottesdienste. Fünf völlig autarke Sektionen sollten ca. 3000 Personen eine Lebensgarantie für 30 Tage gewähren. Ein unabhängiges System der Strom-, Wasser- und Luftversorgung sowie ein nahezu unerschöpfliches Reservoir an Nahrung und Gebrauchsgegenständen (allein 20 000 Ersatzteil-Artikel für die technischen Anlagen) und 25 000 Türen bürgten für größtmögliche Autarkie. Trotzdem ist der Regierungsbunker, der während eines Manövers mit dem Codenamen »Rosengarten« bezeichnet wurde, Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 4www.bunker-harnekop.de während der 22-jährigen Nutzung niemals von einem Bundeskanzler betreten worden. An dessen Stelle erprobte ein Double, als »Bundeskanzler üb.« bezeichnet, bei der zweijährlich stattfindenden NATO-Übung den atomaren Kriegszustand. Am 8. Dezember 1997 beschloss die Bundesregierung die Schließung der nationalen Sicherungsanlage und seitdem wurde der Bunker zwischenzeitlich als Standort für ein Münzdepot, eine Technodisco, ein unterirdisches Erlebnishotel (»Bunker-Wunderland«) sowie für die Züchtung von Pilzkulturen in Erwägung gezogen. Wegen mangelnder Brandschutzvorrichtungen und zu hoher Folgekosten scheiterten diese Nutzungsversuche, so dass die Anlage nun verschlossen werden soll. Beide Bunker verfügen über eine eigene Internet-Seite. Während die Webseite der Dienststelle Marienthal einen »Abwicklungscharakter« aufweist, da lediglich eine kurze Geschichte des Baues und einige Photographien abrufbar sind, ist die Seite des Bunkers in Harnekop deutlich umfangreicher. Der Nutzer hat auf dieser, neben der Erlangung von Detailinformationen zum Bau, die Möglichkeit einen virtuellen Rundgang durch den Bunker zu unternehmen. Des weiteren sind Dokumente und eine große Linkliste zum Thema Bunkerbau verfügbar. Auf beiden Internet-Seiten besteht zudem die Möglichkeit Bücher oder Videos über die jeweiligen Bunker zu bestellen. ch/René Henn 4www.bunkernetzwerk.de Auf dieser Seite findet der interessierte Besucher umfassende Informationen zum Themen wie: 4 Bunkeranlagen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, im speziellen 4 der NVA, des MfS, der Volkspolizei, der Post und der GSSD 4 Bunkeranlagen beider Weltkriege 4 Literatur- und Reisetipps Dokumentensuche im Internet D ie Suche nach Dokumenten im Internet gestaltet sich oft schwierig: meist findet man nach langwieriger Suche nicht das gewünschte Dokument oder dieses wird nur auszugsweise wiedergegeben. Die Freude über eine InternetSeite, auf der Dokumente zum Thema deutsche Geschichte von 1800 bis heute nicht nur auszugsweise, sondern vollständig abrufbar sind, ist daher verständlich. Dieser Glücksfall ist mit dem documentArchiv gegeben. Momentan sind hier 1003 Dokumente online verfügbar, deren Anzahl jedoch stetig steigt. Das Archiv gliedert sich in die sieben Rubriken: line 19. Jahrhundert, Kaiserreich, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Bundesrepublik, DDR, Ausland/Internationales Innerhalb der einzelnen Rubriken sind die Dokumente in chronologischer Abfolge aufgelistet. So ist für das 19. Jahrhundert auch die Emser Depesche abrufbar, die gerade in militärgeschichtlicher Hinsicht eine bedeutende 4www.documentArchiv.de Rolle spielte, da durch sie der deutschfranzösische Krieg 1870/71 ausgelöst wurde. Aber auch zahlreiche Dokumente aus der Zeit des Nationalsozialismus können eingesehen werden – so z.B. die Weisung des Obersten Befehlshaber der Wehrmacht Adolf Hitler für den bewaffneten Einmarsch der Wehrmacht in Österreich (»Unternehmen Otto«). Nutzer von dieser u.a. auf die Seite des Feldpost-Archivs, wo ausgewählte Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg zur Verfügung gestellt werden, gelangen. Alles in allem also eine gelungene Seite, die sowohl Suchende als auch Interessierte gleichermaßen erfreuen dürfte. René Henn Die Webseite bietet zudem eine umfangreiche Linkliste. So kann der Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 25 Service Lesetipp Immer wieder werden Historiker von Geschichtsinteressierten gefragt, wo man denn nur all die vielen Informationen und für Laien häufig verwirrenden Zusammenhänge in Ruhe nachlesen könne. Auch die Redaktion der Militärgeschichte erreichen regelmäßig solche Anfragen. Häufig enthalten sie aber gar keine konkreten Nachfragen zu einem speziellen Gegenstand, sondern erfolgen aus einem allgemeinen Interesse an der Geschichte oder auch einfach aus dem Wunsch heraus, das eigene Schulgeschichtswissen noch mal aufzufrischen. Daher stellen wir Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, heute keine einzelnen Buchtitel zu ausgewählten Themen vor, sondern verschiedene, aus Sicht der Redaktion empfehlenswerte Buch- und Zeitschriftenreihen. Wir glauben, dass Sie dort neben einem grundlegenden Überblick über die allgemeine Geschichte auch militärgeschichtliche Themen in ansprechender und fundierter Form präsentiert bekommen, und würden uns freuen, wenn der eine oder andere Titel Ihr Interesse fände. ch 26 (Militär-)Geschichte bei »C.H.Beck Wissen« Seiten). Alle diese Magazine zeichnen sich durch unterhaltsam geschriebene und leicht verständliche Beiträge sowie eine attraktive Bebilderung, viele Grafiken, Tabellen und andere Informationen aus. Damit kombinieren sie Unterhaltung und Wissensvermittlung in idealer Weise. or rund zehn Jahren legte der renommierte C.H.Beck Verlag (München) eine handliche Buchreihe zu wissenschaftlichen Themen aus den Bereichen Geschichte, Naturkunde, Religion, Philosophie, Medizin, Musik und Sprachwissenschaften auf. Deren Format war und ist der vielzitierten »Informationsgesellschaft« angepasst: Mit 110 bis 140 Seiten knapp im Seitenumfang und konzentriert in der Darstellung ist jeder Band von anerkannten Fachleuten ihrer Disziplin verfasst und in sich abgeschlossen. Die Darstellungen richten sich an ein Lesepublikum, das weit über die wissenschaftlichen Experten hinausreicht. Zweifellos nutzt der zusammenfassende Charakter des Forschungsstandes in den zumeist äußerst gelungenen Überblicken auch dem Spezialisten. Adressat der mittlerweile ca. 230 Werke aus den verschiedensten Wissensgebieten ist aber eher der interessierte Laie. Lesbarkeit und Verständlichkeit ohne übertriebenen Wissenschaftsjargon, eine knapp bemessene Beigabe von Bildern oder Karten und ein weiterführendes Literaturverzeichnis kennzeichnen bei gleichzeitigem Verzicht auf einen gelehrten Anmerkungsapparat das Profil der Reihe. Selbstverständlich greifen diese Titel immer wieder auch militärgeschichtliche Themen auf, doch wer sich ausschließlich für Militärgeschichte interessiert, kann nicht nur zur Militärgeschichte greifen, sondern auch zu der alle zwei Monate erscheinenden »Militär und Geschichte« ( 3,- € für 50 Seiten). Diese präsentiert ausschließlich Berichte über militärgeschichtliche Themen überwiegend des 19. und 20. Jahrhunderts sowie auch über Militaria (Uniformen, Orden, Waffen). Innerhalb des bisherigen Verlagsprogramms von »C.H Beck Wissen« spielt Geschichte, insbesondere auch Alte Geschichte, eine dominierende Rolle. Von Anfang an wurden dabei militärgeschichtliche Themen berücksichtigt und so sind inzwischen sind fünf Darstellungen erschienen, die sich explizit vergangenen Kriegen widmen: dem Bauernkrieg 1524–1526 (von Peter Blickle), dem Dreißigjährigen Krieg 1618–1648 (Georg Schmidt), dem Ersten Weltkrieg 1914–1918 (Volker Berg- W Die monatlich erscheinenden Magazine »Damals«, »Geschichte« sowie »PM-history« (zehn Ausgaben im Jahr) sind im Umfang und Qualität recht ähnlich und bieten für einen moderaten Preis (6,10 bzw. 4,30 €) auf etwa 70–100 Seiten einen attraktiven Mix aus jeweils mehreren Beiträgen zu einem Hauptthema und verschiedenen kleineren Rubriken. Außerdem enthalten sie verschiedene Serviceelemente, wie z.B. TV- und Lesetipps sowie Ausstellungshinweise; die »Damals« bietet dazu sogar eine Internetsuchmaschine an, die wir den Leserinnen und Lesern der Militärgeschichte schon wiederholt vorgestellt haben (siehe ServiceAusstellungen in diesem Heft). Ebenfalls im Zeitschriftenhandel erhältlich ist ein Ableger der Zeitschrift »Geo«, die vor allem wegen ihrer exzellenten Bilder bekannt ist. »Geo-Epoche« erscheint alle drei Monate und besticht ebenfalls durch eine hervorragende Bildqualität, ist dafür aber auch etwas teurer (8,-€ für 180 ch V Geschichte(n) im Magazinformat er sich für Geschichte, Zeitgeschichte und Politik interessiert, kann nicht nur aus einer unüberschaubaren Flut von Büchern etwas nach dem jeweils eigenen Geschmack auswählen, sondern bekommt außerdem in fast allen gängigen Zeitungen und Zeitschriften Beiträge über entsprechende Themen geboten. Es gibt aber auch einige Spezialzeitschriften für historisch Interessierte, die in Zeitschriftenläden, Kiosken, im Supermarkt und sogar an Tankstellen erhältlich sind, wobei der Leser zwischen fünf empfehlenswerten Titeln die Qual der Wahl hat. Fazit: Wer sich für (Militär-)Geschichte interessiert und den Griff zum dicken Buch scheut oder einfach eine Lektüre für die Bahnfahrt oder die Badewanne sucht, wird unter den vielen Geschichtszeitschriften bestimmt etwas nach dem eigenen Geschmack finden. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 hahn), dem Zweiten Weltkrieg (Gerhard Schreiber) und dem Kalten Krieg 1945–1991 (Bernd Stöver). Militärgeschichte ist in diesen Büchern nirgendwo die pure Chronologie der Feldzüge und Schlachten. Sie wird vielmehr verknüpft mit den politischen Hintergründen und Entwicklungen, den Auswirkungen auf die einzelnen Gesell- schaften im Kriege sowie dem alltäglichen Leben an der Front und in der Heimat. Breiten Raum etwa widmet Peter Blickle in seinem Porträt des Bauernkrieges dem langen Nachwirken dieser »Revolution des Gemeinen Mannes«: sei es als Bezugspunkt liberaler Forderungen im 19. Jahrhundert, sei es in der Vereinnahmung Thomas Müntzers durch die DDR-Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert. Doch nicht nur jene Bücher der Reihe, die den Krieg ausdrücklich im Titel führen, sind militärgeschichtlich relevant. Ins Gewicht fallen z.B. auch die kleinen Biographien über Alexander den Großen (von Hans-Joachim Gehrke) und Hannibal (Pedro Barceló), deren Leben der Nachwelt als einzige große Feldzüge erscheinen: über die »japanischen Ritter«, die Samurai (Hermann Schwentker), über Stauffenberg und den 20. Juli 1944 (Peter Hoffmann); schließlich viele Bände über Goten, Inkas, Wikinger usw., Ländergeschichten über Mesopotamien, Frankreich, China etc., in denen Wehrverfassung und Militärpolitik wenigstens am Rande eine Rolle spielen. Anzuzeigen und zu empfehlen bleibt damit eine engagierte Buchreihe, aus der sich jeder (militär-)geschichtlich Interessierte seinen eigenen kleinen Handapparat zusammenstellen kann, und das zu einem überschaubaren, einheitlichen Preis von 7,90 € pro Band. Armin Wagner Deutsche und Weltgeschichte im Überblick B ereits seit Jahren werden Studierenden der Geschichtswissenschaft schon in den ersten Semestern die Reihen »Grundriss der Geschichte« sowie »Enzyklopädie deutscher Geschichte« aus dem R. Oldenbourg Verlag empfohlen. Viele Studenten haben einen oder gar mehrere der schmalen grauen oder der dickeren blau-grauen Bände bei sich im Regal stehen. Beide Reihen sind aber auch für andere Nutzer, insbesondere für Multiplikatoren (z.B. in der politischen Bildung) hervorragend geeignet. Der universalgeschichtlich angelegte »Grundriss der Geschichte« bietet mit nunmehr 33 Bänden einen historischen Überblick zu zahlreichen Ländern und Themen. Deren Bandbreite reicht von der griechischen und römischen Antike über das Mittelalter, die Frühe Neuzeit bis zur Zeitgeschichte (z.B. Imperialismus, Zwischenkriegszeit, Weimarer Republik, Drittes Reich, DDR, Bundesrepublik), wobei auch die außereuropäische Geschichte Beachtung findet (z.B. Byzanz, Afrika, Osmanisches Reich). Wer eine kompetente und systematische Einführung in eines dieser Themen sucht, ist mit dem »Grundriss« aus dem Oldenbourg-Verlag gut beraten. Neben den ausgewiesenen Autoren trägt dazu vor allem die einheitliche Gliederung der Bände bei. Jeder umfasst etwa 350–450 Seiten und ist unterteilt in eine Darstellung, die einen Überblick über das Thema bietet, sowie einen zweiten Teil, der ausgewählte Einzelfragen vertieft und schließlich eine ausführliche Bibliographie, die weiterführende Literatur und Quellen nennt. Diese beiden letzten Teile machen die Reihe insbesondere für Studierende und Fachhistoriker zum wertvollen Arbeitsmittel. Wer sich evt. vom stattlichen Umfang der Bände abschrecken lässt oder sich mehr für deutsche und weniger für allgemeine Geschichte interessiert, dem sei die Enzyklopädie deutscher Geschichte (EdG) aus dem selben Verlag empfohlen. Die mittlerweile fast 70 Bände der Reihe betrachten alle Epochen und vielfältige Themen ausschließlich zur deutschen Geschichte. Demnächst erscheinen sogar Bände zur Militärgeschichte (Militärgeschichte des späten Mittelalters und der Frühen Neuzeit sowie Militärgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts). Im Unterschied zum »Grundriss der Geschichte« sind die einzelnen Bände der EdG mit etwa 150 Seiten deutlich weniger voluminös, die Fragestellungen dafür aber spezieller. Themen, die im »Grundriss« mit einem Band abgehandelt werden (z.B. DDR), sind hier auf drei Bände aufgeteilt (z.B. Innen- und Außenpolitik sowie Sozialgeschichte der DDR). Die bewährte Gliederung der GrundrissBände wurde für diese Enzyklopädie übernommen; die einzelnen Bände enthalten einen Überblick über das Thema, eine Erörterung zu Einzelfragen und abschließend wiederum einen Literaturteil. Beide Reihen sind weniger zum abendlichen »Schmökern«, als vielmehr zum systematischen Nachlesen und Selbststudium geeignet. Nicht zuletzt der relativ günstige Preis (Grundwissen 24,80 € bzw. EdG 19,80 €) hat sie so zum unverzichtbaren Arbeitsmittel für Historiker, Studierende und Lehrer sowie andere in der historischen Bildung Tätige werden lassen. Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 ch 27 Service Ausstellungen •Berlin Abgestempelt. Judenfeindliche Postkarten Museum für Kommunikation Berlin Leipziger Straße 16 D-10117 Berlin-Mitte Telefon: (030) 20 29 40 Telefax: (030) 20 29 41 11 www.museumsstiftung.de/berlin e-mail: [email protected] Dienstag bis Freitag 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr Samstag bis Sonntag 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr 9. Oktober 2003 bis 15. Februar 2004 Verkehranbindungen: U-Bahn: Bis Haltestelle »Mohrenstraße« bzw. »Stadtmitte« (U2/U6), Buslinien TXL, 148, 200, 348 Hofjagd Deutsches Historisches Museum/ Ausstellungshalle von I.M. Pei Hinter dem Gießhaus 3 10117 Berlin www.dhm.de Täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 19. Februar bis 12. April 2004 Eintritt frei 28 »Stalingrad erinnern«. Stalingrad im deutschen und im russischen Gedächtnis Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst Zwieseler Straße 4/ Ecke Rheinsteinstraße D-10318 Berlin Telefon: (030) 50 15 08 10 www.museum-karlshorst.de e-mail: [email protected] Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 Dienstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 15. November 2003 bis 29. Februar 2004 Eintritt frei Verkehrsanbindungen: Ab S-Bahnhof »Karlshorst« (S 3) Ausgang »Treskowallee«, zu Fuß Richtung Rheinsteinstraße (ca. 15 Min. ) oder mit dem Bus 396; ab U-Bahnhof »Tierpark« (U5) mit dem Bus 396 •Bonn Der Kreml. Gottesruhm und Zarenpracht Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland GmbH Museumsmeile Bonn Friedrich-Ebert-Allee 4 53113 Bonn Telefon: (0228) 91 71-0 Telefax: (0228) 23 41 54 www.kah-bonn.de e-mail: [email protected] Dienstag bis Mittwoch 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr Donnerstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr 13. Februar bis 9. Mai 2004 Verkehrsanbindungen: Bus: Linien 610 und 630 bis Haltestelle »Heussallee«, U-Bahn: Ab Hauptbahnhof U16/63/66 (in Richtung Regierungsviertel) bis Haltestelle »Heussallee« •Dresden Deutsche Jüdische Soldaten. Von der Epoche der Emanzipation bis zum Zeitalter der Weltkriege Neue Synagoge 23. Januar bis 3. März 2004 Telefon: (03364) 21 46 www.museumeisenhuettenstadt.de e-mail: [email protected] Dienstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr Mittwoch bis Freitag 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr jeden ersten Samstag und Sonntag im Monat 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 10. November 2003 bis 14. März 2004 Dienstag bis Sonntag 8.45 bis 16.30 Uhr Bis 21. März 2004 Verkehrsanbindungen: Ab Hauptbahnhof mit Bus bis Haltestelle »Roßmühlstraße/ Paradeplatz« •Luckenwalde •Hamburg Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1944 Kampnagel Jarrestraße 20 22303 Hamburg www.verbrechen-derwehrmacht.de Dienstag bis Donnerstag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr Freitag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 19.30 Uhr 29. Januar bis 28. März 2004 •Mainz Die Kreuzzüge •Potsdam Königliche Visionen. Potsdam – eine Stadt in der Mitte Europas Haus der BrandenburgischPreußischen Geschichte Schloßstr. 1 14467 Potsdam Telefon: (0331) 201 39 3 Telefax: (0331) 201 39 59 www.hbpg.de Dienstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr Mittwoch 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr ab 18.00 Uhr 50 Prozent Eintrittsermäßigung 30. August 2003 bis 28. März 2004 •Saverne •Ingolstadt Dom- und Diözesanmuseum Domstraße 3 55116 Mainz Eingang durch den Dom und Kreuzgang Telefon: (06131) 25 33 44 Telefax: (06131) 25 33 49 www.kath.de/bistum/mainz/ kirche/dommuseum.htm ð Festungen. Graphiken und Bücher aus dem Besitz des Bayerischen Armeemuseums • E i s e n h ü t te n s t a d t Kriegsgefangene in Brandenburg – Das Stalag III B in Fürstenberg/Oder Städtisches Museum/ Galerie Eisenhüttenstadt Löwenstraße 4 15890 Eisenhüttenstadt ð Aufstand des Gewissens. Militärischer Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime 1933–1945 Foyer der Kreisverwaltung des Landkreises Teltow-Fläming 15. März bis 20. April 2004 e-mail: [email protected] Dienstag bis Sonntag 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr 2. April bis 30. Juli 2004 Eintritt frei Verkehrsanbindungen: Buslinien 54–57, 60 65, 71, 73 bis Haltestelle »Höfchen« (Zabern) Saverne 1913 Chateau de Rohan Musée de Saverne F 67700 Saverne Telefon: 0033 (3889) 10 62 8 Montag, Mittwoch bis Sonntag 14.00 bis 17.30 Uhr 2. Januar bis 20. Februar 2003 3 Neues Schloß Paradeplatz 4 85049 Ingolstadt Telefon: (0841) 93 77 0 Telefax: (0841) 93 77 200 www.bayerischesarmeemuseum.de Interessante Ausstellungen zu Themen Ihrer Wahl und in Ihrer Nähe können sie ganz gezielt und bequem im Internet suchen: www.damals.de ð René Henn Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 29 Geschichte kompakt 28. November bis 1. Dezember 1943 Konferenz von Teheran In seiner mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichneten Darstellung des Zweiten Weltkrieges bezeichnete Winston Churchill die Ergebnisse der Konferenz von Teheran als die »Lösung des Gordischen Knotens«. Trotz einer Vielzahl von Interessengegensätzen konnten sich die alliierten Staats- und Regierungschefs der »Anti-Hitler-Koalition« auf wichtige Grundsätze der weiteren Kriegführung und der Nachkriegsordnung verständigen. Das Treffen der »Großen Drei«, des sowjetischen Parteiund Regierungschefs Stalin, des amerikanischen Präsidenten Roosevelt und des britischen Premierministers Churchill dauDie »Großen Drei« beim Fototermin erte von Ende November bis Anfang Dezember 1943. Man akg-images 9AA-1943-11-28-A1 einigte sich für das Jahr 1944 auf die Errichtung der »Zweiten Front« durch westalliierte Landungen in Nord- und Südwestfrankreich, eine gleichzeitige sowjetische Offensive auf die deutsche Ostfront und sowjetische Unterstützung im Kampf gegen Japan nach Abschluss der Kampfhandlungen in Europa. Des Weiteren wurde die Verschiebung der sowjetisch-polnischen Grenze nach Westen vereinbart, wofür Polen als Kompensation deutsche Gebiete östlich der Oder erhalten sollte. Über die Teilung Deutschlands, die nach dem Ende des Krieges geplant war, konnte indes keine abschließende Einigung erzielt werden: Während Churchill für eine Zweiteilung eintrat, schwebte Roosevelt die Bildung von fünf »autonomen« und zwei durch die Vereinten Nationen zu verwaltenden Gebieten vor; Stalin forderte wie Roosevelt die Zerstückelung Deutschlands, wollte sich dabei jedoch nicht auf Einzelheiten festlegen. Roosevelts Vorstellung der »Einen Welt« mit Errichtung einer Weltfriedensorganisation unter Einschluss der UdSSR wurde besprochen; die Zustimmung Stalins zur Gründung und Organisation der Vereinten Nationen erfolgte jedoch erst auf der nachfolgenden Konferenz von Jalta im Februar 1945. René Henn 25. Juli 1963 Militärgeschichte Zeitschrift für historische Bildung Ü Vorschau Sebastian Haffner bezeichnete ihn als den »Anfang einer Geschichte, die noch nicht zu Ende ist – auch für die Jüngsten unter uns nicht«. Der Erste Weltkrieg stellte die Weichen für das 20. Jahrhundert. Oktoberrevolution und Sowjetimperium, Nationalsozialismus und der »totale Krieg« eines Adolf Hitler sind ohne ihn kaum vorstellbar. Die politische Landkarte veränderte sich infolge des »Großen Krieges«, wie der Erste Weltkrieg genannt wurde, ehe er durch einen zweiten Weltkrieg noch übertroffen wurde. Er kostete rund acht Millionen Soldaten das Leben, etwa Die Nagold-Affäre Am 30. Juli 1963 meldete die Kölnische Rundschau: »Kölner Rekrut im Todeskampf nach Gewaltmarsch«. Zwei Tage später verstarb der 19-jährige Rekrut Gerd Trimborn. Es konnte im Rahmen der gerichtlichen Untersuchung nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob der Tod durch die Überlastung auf dem Marsch am 25. Juli oder durch ein bereits vorhandenes Nierenleiden verursacht worden war. Dennoch sollten die dabei zu Tage getretenen Zustände in der Ausbildungskompanie 6/9 bei den Fallschirmjägern in Nagold einen der größten Skandale der noch jungen Bundeswehr auslösen. Entgegen bestehenden Befehlen, welche die Durchführung einer Marschübung in den Stunden außerordentlicher Tageshitze verboten, hatte der Kompaniechef den im Dienstplan angesetzten Marsch nicht gestrichen. Während einer kurz vor Erreichen der Kaserne befohlenen »Gefechtseinlage« musste der Jäger Trimborn den Lauf abbrechen, erreichte gestützt auf Kameraden noch die Kaserne, um dann bewusstlos zusammenzubrechen. © Kölnische Rundschau Der Kompaniechef meldete den Vorfall dem vorgesetzten Brigadekommando; eine weitere Meldung als Besonderes Vorkommnis unterblieb. Eine Zeitungsbotin der Kölnischen Rundschau erfuhr von den Eltern Trimborns von dem Vorfall und meldete ihn ihrer Redaktion. Das nicht in Kenntnis gesetzte Verteidigungsministerium musste erst mit Nachdruck auf dem Dienstweg Meldungen einholen. Die Anzeige unbeteiliger Zivilisten bei der Polizei über Misshandlungen von Soldaten eines anderen Zuges auf demselben Marsch – Beleidigungen, Fußtritte und Stöße mit dem Gewehr – und die Recherchen der zunehmend misstrauischer werdenden Presse brachten erst das ganze Ausmaß der entwürdigenden Schleifermethoden in dieser Kompanie in den Blick der schockierten Öffentlichkeit. In seinem Jahresbericht stellte der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hellmuth Heye, den Fall in den weiteren Zusammenhang der geistigen Auseinandersetzung um die Grundsätze der Inneren Führung. Er griff diejenigen, die deren Prinzipien als für die Praxis ungeeignet, zu weich und die Ausbilder nur verunsichernd diffamierten, scharf an und forderte eine Menschenführung in der Bundeswehr, »die den Soldaten als Persönlichkeit und als Staatsbürger respektiert und seinen guten Willen nicht bricht«. Um seinem Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen, stellte Heye seinen Bericht der Illustrierten Quick zur Verfügung, die ihn unter dem Titel »In Sorge um die Bundeswehr« veröffentlichte. Die darauf folgende, sehr kontroverse Debatte führte zum Rücktritt des Wehrbeauftragten, aber auch zu einer breiten öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Innenleben der Bundeswehr. hk 30 Heft 1/2004 Service Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 5 Gedenktafel am Schauplatz des Attentates im bosnischen Sarajevo, wo unweit der »Lateinerbrücke« über die Miljačka am 28. Juni 1914 der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Ehefrau Sophie ermordet wurden. 20 Millionen wurden verwundet und allein drei Millionen Menschen starben an durch den Krieg verursachten Krankheiten und Seuchen. Durch diese »Urkatastrophe« des 20. Jahrhunderts für Europa wurden Kräfte freigesetzt, welche die großen Vielvölkerreiche, wie das Osmanische Reich, die Habsburger Monarchie und das Zarenreich in den Untergang stürzten. Mit den Vereinigten Staaten von Amerika trat in Europa erstmals eine außereuropäische Großmacht maßgeblich auf den Plan. Viele aktuelle Krisen, über die uns Rundfunk und Fernsehen täglich informieren, sind ohne den Ersten Weltkrieg kaum denkbar. Die nächsten Ausgaben der Militärgeschichte werden verstärkt über den Ersten Weltkrieg berichten. 90 Jahre nach dem schicksalhaften Attentat von Sarajevo und dem anschließenden Kriegsausbruch beginnt die Serie mit einem »virtuellen Rundgang« durch die Ausstellung des Deutschen Historischen Museums »Der Weltkrieg 1914–1918, Ereignis und Erinnerung«. aak Militärgeschichte im Bild 12. November 1993: Rückkehr aus A Kambodscha m 12. November 1993 kehrten die letzten der 145 Ärzte und Sanitäter der Bundeswehr aus Kambodscha, wo sie seit Mai 1992 auf Bitten der Vereinten Nationen humanitäre Hilfe geleistet hatten, nach Deutschland zurück. UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambodia) hatte die Aufgabe gehabt, Kambodscha auf seinem Weg aus dem Bürgerkrieg militärisch und administrativ zu unterstützen. Die Entwaffnung der Bürgerkriegsparteien sowie die Vorbereitung und Begleitung freier Wahlen spielten dabei eine zentrale Rolle. Dazu wurden 22 000 Blauhelme im ganzen Land stationiert. Deren sanitätsdienstliche Versorgung wurde durch deutsche, indische und französische Soldaten sichergestellt. Das deutsche Kontingent betrieb in der Hauptstadt Phnom Penh das mit 60 Betten ausgestattete »UNTAC Field Hospital« und behandelte dort in den 17 Monaten ununterbrochenen Einsatzes 3489 Patienten stationär und 95 409 Patienten ambulant. Die Leistungsfähigkeit und das Engagement der deutschen Soldaten verschaffte ihnen nicht nur bei den Vereinten Nationen, sondern auch in der kambodschanischen Zivilbevölkerung großes Ansehen, da nach Zusage der VN im Rahmen freier Kapazitäten auch die einheimische Bevölkerung medizinisch versorgt werden konnte, was letztlich etwa 25 % der Behandlungen ausmachte. In dem auch als »größtes Minenfeld der Welt« bezeichneten Land waren die Räumung der Minen und die Ausbildung einheimischer Experten eine wichtige Aufgabe von UNTAC. Beinoperationen nach Minenexplosionen gehörten zum täglichen Pflichtprogramm der Chirurgen im deutschen Hospital. Ärztliche Begleitung bei der Lebensrettung durch die Luft (MEDEVAC) – gelegentlich auch unter Beschuss durch die Roten Khmer – war genauso zu leisten wie die Versorgung von Verletzten nach Überfällen oder nächtliche Operationen nach Terroranschlägen. der Einsatz in Kambodscha nicht vergessen werden, der den guten Ruf der Bundeswehr international mit begründen half. hk Trauriger Höhepunkt des Einsatzes war für das deutsche Kontingent die Ermordung des Sanitätsfeldwebels Alexander Arndt am 14. Oktober 1993 auf offener Strasse, nur wenige Tage vor Einsatzende. Feldwebel Arndt war der erste deutsche Soldat, der bei einer VNMission den Tod fand. Der erfolgreiche humanitäre deutsche Einsatz in Kambodscha rückte durch das fast gleichzeitige deutsche Engagement in Somalia in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit etwas in den Hintergrund. Er fiel in eine Zeit heftiger und kontroverser Diskussionen in Deutschland über den Sinn und das Ausmaß deutscher Beteiligung an internationaler Friedenswahrung und Friedensschaffung.1994 leitete die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hierzu ein neues Kapitel ein. Über der raschen Folge von internationalen Aufgaben der Bundeswehr seither sollte 5 Im Feldhospital in Phnom Penh untersucht Dr. Altherr, MdB, als Oberstabsarzt d.R. einen Kambodschaner SKA/IMZ / Foto: Detmar Modes 5 Das von deutschen Sanitätssoldaten betriebene Hospital in Phnom Penh BMVg / Foto: Detmar Modes Militärgeschichte · Zeitschrift für historische Bildung · Ausgabe 4/2003 31 NEUE PUBLI K AT I O N E N des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes E rstmals werden ostdeutsche Generale und Admirale, die aufgrund ihrer herausgehobenen Position die Kasernierte Volkspolizei und die Nationale Volksarmee zwischen 1949 und 1990 nachhaltig geprägt haben, in ausführlichen Porträts vorgestellt. Anhand neuester Forschungsergebnisse können die unterschiedlichen Wege dieser Männer in die Streitkräfte, ihre politischen Überzeugungen, ihr Führungsverhalten, ihre militärischen Leistungen, aber auch ihr Arrangement mit der SED-Diktatur sowie ihre persönlichen Konflikte und Brüche aufgezeigt werden. Genosse General! Die Militärelite der DDR in biografischen Skizzen. Im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes Dabei geht es nicht nur um die individuellen Lebensläufe, sondern auch um das Milieu, in dem die »sozialistischen Militärkader« lebten, wodurch Einblicke in bisher wenig bekannte Bereiche der Militärgeschichte der DDR möglich werden. herausgegeben von Hans Ehlert und Armin Wagner Berlin: Ch. Links Verlag 2003, VIII, 632 S. (= Militärgeschichte der DDR, 7) ISBN: 3-86153-312-X 29,90 Mit Beiträgen zu Rudolf Bamler, Bernhard Bechler, Friedrich Dickel, Rudolf Dölling, Wilhelm Ehm, Heinz Hoffmann, Theodor Hoffmann, Heinz Keßler, Arno von Lenski, Vincenz Müller, Erich Peter, Fritz Peter, Wolfgang Reinhold, Horst Stechbarth, Fritz Streletz, Willi Stoph, Waldemar Verner, Kurt Wagner, Heinz Bernhard Zorn