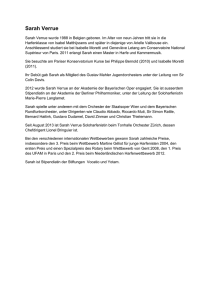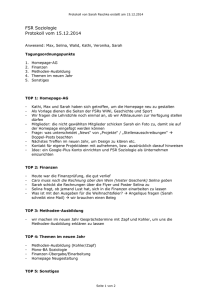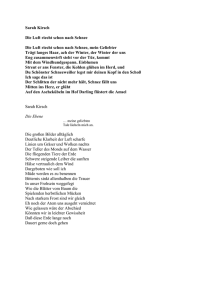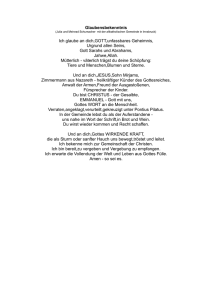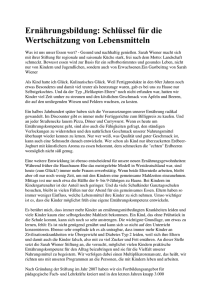Möglichkeiten und Grenzen musikalisch
Werbung
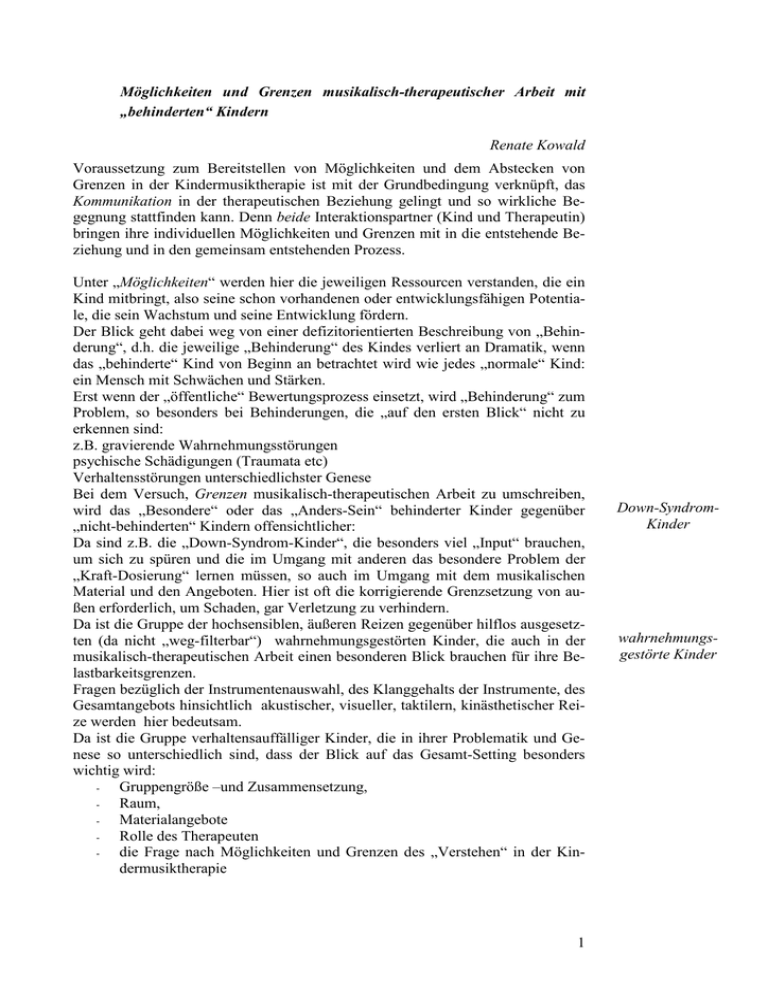
Möglichkeiten und Grenzen musikalisch-therapeutischer Arbeit mit „behinderten“ Kindern Renate Kowald Voraussetzung zum Bereitstellen von Möglichkeiten und dem Abstecken von Grenzen in der Kindermusiktherapie ist mit der Grundbedingung verknüpft, das Kommunikation in der therapeutischen Beziehung gelingt und so wirkliche Begegnung stattfinden kann. Denn beide Interaktionspartner (Kind und Therapeutin) bringen ihre individuellen Möglichkeiten und Grenzen mit in die entstehende Beziehung und in den gemeinsam entstehenden Prozess. Unter „Möglichkeiten“ werden hier die jeweiligen Ressourcen verstanden, die ein Kind mitbringt, also seine schon vorhandenen oder entwicklungsfähigen Potentiale, die sein Wachstum und seine Entwicklung fördern. Der Blick geht dabei weg von einer defizitorientierten Beschreibung von „Behinderung“, d.h. die jeweilige „Behinderung“ des Kindes verliert an Dramatik, wenn das „behinderte“ Kind von Beginn an betrachtet wird wie jedes „normale“ Kind: ein Mensch mit Schwächen und Stärken. Erst wenn der „öffentliche“ Bewertungsprozess einsetzt, wird „Behinderung“ zum Problem, so besonders bei Behinderungen, die „auf den ersten Blick“ nicht zu erkennen sind: z.B. gravierende Wahrnehmungsstörungen psychische Schädigungen (Traumata etc) Verhaltensstörungen unterschiedlichster Genese Bei dem Versuch, Grenzen musikalisch-therapeutischen Arbeit zu umschreiben, wird das „Besondere“ oder das „Anders-Sein“ behinderter Kinder gegenüber „nicht-behinderten“ Kindern offensichtlicher: Da sind z.B. die „Down-Syndrom-Kinder“, die besonders viel „Input“ brauchen, um sich zu spüren und die im Umgang mit anderen das besondere Problem der „Kraft-Dosierung“ lernen müssen, so auch im Umgang mit dem musikalischen Material und den Angeboten. Hier ist oft die korrigierende Grenzsetzung von außen erforderlich, um Schaden, gar Verletzung zu verhindern. Da ist die Gruppe der hochsensiblen, äußeren Reizen gegenüber hilflos ausgesetzten (da nicht „weg-filterbar“) wahrnehmungsgestörten Kinder, die auch in der musikalisch-therapeutischen Arbeit einen besonderen Blick brauchen für ihre Belastbarkeitsgrenzen. Fragen bezüglich der Instrumentenauswahl, des Klanggehalts der Instrumente, des Gesamtangebots hinsichtlich akustischer, visueller, taktilern, kinästhetischer Reize werden hier bedeutsam. Da ist die Gruppe verhaltensauffälliger Kinder, die in ihrer Problematik und Genese so unterschiedlich sind, dass der Blick auf das Gesamt-Setting besonders wichtig wird: Gruppengröße –und Zusammensetzung, Raum, Materialangebote Rolle des Therapeuten die Frage nach Möglichkeiten und Grenzen des „Verstehen“ in der Kindermusiktherapie 1 Down-SyndromKinder wahrnehmungsgestörte Kinder Nicht zuletzt ist mit einem bestimmten Bild einer „Behinderung“ eine Vielzahl von Problematiken verbunden, die obige Klassifikationsbemühungen ein Stück weit sofort wieder aufheben. So wird in dem zweiten Fallbeispiel von einem Mädchen, hier genannt SARAH, berichtet, deren Problem zunächst eine SI-Problematik zu sein schien, d.h. eine Problematik des Prozesses der Sensorischen Integration. Das Aufnehmen und Verarbeiten von Sinnesreizen ist gekoppelt mit der kindlichen Lernerfahrung, mit Hilfe der Motorik sich durch aktives Handeln mit der Umwelt auseinander zu setzen. Dieses Zusammenspiel von Sinnesreizen und Motorik, bzw. Handeln, lässt sich als Sensorische Integration bezeichnen. Der sensorische Integrationsprozess besteht aus: - Reizaufnahme-Eingliederung/Verarbeitung der Reize - Planen und Organisieren von Verhalten - Anpassende motorische Reaktion - Rückmeldung der Reize Er betrifft: - die Körper- bzw. Nahsinne (vestibuläres System, popriozeptives System, taktiles System) - die Fernsinne (akustisches System, visuelles System, olfaktorisches System, gustatorisches System) Alle Sinnessysteme haben zwei Aufgaben: - die Wahrnehmung und Rückmeldung von Reizen - die Wirkung auf andere Systeme durch Hemmen, Fördern und Abstimmen Sensorischen Integration Der Prozess der Sensorischen Integration umfasst sowohl neurophysiologische und sensomotorische als auch mentale, d.h. kognitive und emotionale Prozesse (vgl. Miske-Flemming 1998, 10-23). Die in diesem Beitrag vorgestellte musiktherapeutische Arbeit fand statt in der Kindertagesstätte „Integratives Montessori-Kinderhaus „Die Wolkenburg“ in Bad Honnef. Es gibt hier drei integrative Gruppen, in denen jeweils je fünf „behinderte“ und zehn „nicht-behinderte“ Kinder pädagogisch und therapeutisch betreut und gefördert werden. Die pädagogische Ausrichtung orientiert sich an dem Konzept von Maria MONTESSORI. Gruppenübergreifend arbeiten: eine Sprachheilpädagogin, eine Physiotherapeutin, eine Motopädin und eine gruppenübergreifende Fachkraft mit dem Angebot Musiktherapie. Der Begriff „Behinderung“ wird für integrative Kindertagesstätten im GTK (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder) verwendet Bleidick, ein führender deutscher Heilpädagoge, definiert wie folgt: „Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, dass ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft erschwert werden“ (vgl. 1981, 9). Intern werden in der Tagesstätte die „behinderten“ Kinder als Kinder mit einem „besonderen Förderbedarf“ angesprochen. Als formal-juristische Grundlage zur Finanzierung der „Förderplätze“ dient die Eingliederungshilfe im Rahmen des BSHG (Bundessozialhilfegesetz) in einer teilstationären Einrichtung, bzw. die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im Rahmen des KJHG (Kinderjugendhilfegesetz), das im SGB (Sozialgesetzbuch)VIII verankert ist. Auf diesen „Förderplätzen“ finden sich: 2 Integratives MontessoriKinderhaus Behinderung KJHG - Kinder mit sogenannten „Entwicklungsverzögerungen“ Kinder mit Wahrnehmungsstörungen Kinder mit psychopathologischen Diagnosen Kinder mit Körperbehinderungen Kinder mit geistiger Behinderung Kinder mit Sprachstörungen Kinder mit chronischen Erkrankungen: Epilepsie, schwere Allergien, Stoffwechsel- und Drüsenerkrankungen... Zahlreiche dieser Kinder bedürfen einer komplexen Differentialdiagnostik, die eine eindeutige Zuordnung in eine der obigen Diagnose-Kategorien nicht möglich macht. Beispiel: Ein Mädchen mit „eingestellter“ Epilepsie, mit einem Down-Syndrom“, (fast) blind und taub, zeigt gehäuft autoaggressiv wirkende Verhaltensweisen in Form von Sich-Beißen, Kopf-Schlagen. Die häufige Koppelung von „Behinderung“ und damit verbundenen Verhaltensauffälligkeiten ist für die musiktherapeutische Arbeit relevant. Auch auf den sogenannten „Regelplätzen“ finden sich zunehmend Kinder mit Auffälligkeiten, sodass gelegentlich ein Wechsel eines „Regelkindes“ auf einen „Förderplatz“ initiiert wird. Das theoretische Konzept dieses Beitrags fußt auf der psychoanalytisch orientierten Kindermusiktherapie in Anlehnung an Beate Mahns (vgl. 1997) und Dietrich Petersen und Eckhard Thiel (vgl. 2001). Diese beiden Autoren integrieren in ihrem Beitrag auch Elemente der analytischen Spieltherapie sowie der Gestalttherapie. Ein einheitliches Konzept psychoanalytisch orientierter Kindermusiktherapie gibt es bislang nicht. Eine Definition von Priestley (vgl. 1980, 21-36) basiert auf den Lehren von C.G. Jung. „Analytische MT ist der symbolhafte Gebrauch improvisierter Musik durch den Therapeuten und seinen Klienten, um dessen Seelenleben zu erforschen und seine Bereitschaft zur seelischen Weiterentwicklung zu fördern. Sie zielt....darauf, entwicklungshemmende Sperren zu entfernen, und dadurch den Klienten in geeigneter Weise Zugang zu Selbsterfahrungen zu verschaffen.“ Nach Priestley steht im Vordergrund der Arbeit das Wiederherstellen bzw. das Wecken der Fähigkeit des Kindes, sich auf die „wichtige Arbeit des selbstheilenden Spiels einzulassen und ...für den Einsatz seiner natürlichen Neugier und Kreativität freizuwerden.“ Als wesentlich gilt die Wahrnehmung von Übertragung und Gegenübertragung. Übertragung wird als „...Prozess beschrieben, in dem der Patient versucht, unfertige Erfahrungen aus früheren, wichtigen Beziehungen mit dem Therapeuten nachzuleben und in gewissem Maße nochmals zu durchleben“ (Priestley 1982, 191). „Gegenübertragung wird (...) in dem Sinne verwendet, dass der Therapeut seine Reaktionen auf unbewusste oder vorbewusste Emotionen des Patienten wahrnimmt“ (Priestley 1980, 50). In der jeweiligen Interaktion zwischen Therapeut und Kind wird dabei dem Dialog auf verschiedenen Ausdrucksebenen: Spiel, Musik, Sprache - eine hohe Bedeutung beigemessen. Die musikalische Interaktion ist zudem geprägt durch die Doppelrolle des Therapeuten, der sowohl die Rolle als Spielpartner als auch als distanzierte Übertragungsfigur einnimmt. 3 Differentialdiagnostik Verhaltensauffälligkeiten psychoanalytisch orientierten Kindermusiktherapie Übertragung und Gegenübertragung Materialien, auch außermusikalische, werden entsprechend den situationsbedingten Bedürfnissen der Interaktionspartner verwendet. Worin liegt nun die spezifische und übergeordnete Bedeutung und Funktion von Klang/Musik, Spiel und Sprache? Schon intrauterin bilden Klänge, Vibrationen und Bewegungsempfindungen die frühesten Erfahrungen. Nach der Geburt hat in der Interaktion zwischen Mutter und Kind die akustische und taktile Verständigung über Gestik, Mimik, Stimme (geprägt durch Rhythmus, Tonhöhe und Klangfarbe) entscheidende Bedeutung für eine optimale Verständigung, die von Stern (vgl. 1992) als affect-attunement bezeichnet wird und innerhalb derer v.a. Gefühle ausgetauscht werden, da das Kind nur diese Ebene zu verstehen vermag. Klang kann in früher Kindheit - das Kontinuum intrauteriner Geborgenheit wachrufen bzw. stören - emotionale Erinnerungsspuren anlegen (durch z.B. laute Einbrüche oder plötzliche Veränderungen - als Übergangsobjekt benutzt werden. Übergangsobjekte repräsentieren die Geborgenheit der Mutter und bleiben tröstend beim Kind, wenn sich die Mutter entfernt. Je mehr ein Instrument mit dem Körper verbunden ist, desto mehr kann es als Teil des Körpers, als Verstärkung des körperlichen Ausdrucks erlebt werden. Übergangsobjekte helfen dem Kind bei der Wiederholung und Verarbeitung von Erlebnissen und Handlungen und bei der Erprobung neuer Handlungsmöglichkeiten. In Interaktionszusammenhängen betrachtet, lassen sich nach Wolfgang Mahns (1984, 301 f.) vier übergeordnete Funktionen für Musik benennen: 1. Musik dient der Abkapselung von der Umwelt. (Funktion der Einhüllung) Beispiel: Lallmonologe des Säuglings, der – sich selbst einhüllend – sich in den Schlaf singt. 2. Musik dient der Verdoppelung des eigenen Selbst. (Funktion der Selbstverdoppelung). Indem ich auf meinem Instrument spiele, verschaffe ich mir ein Gegenüber, werde zu zwei „Personen“: Körper-Ich und musikalischer Symbolausdruck. (...) 3. Musik dient der symbolischen Berührung mit den anderen Menschen. (Kontaktfunktion) Im Singen oder Spielen eines Tons berühre ich einen anderen Menschen, sofern dieser anwesend ist. Auf symbolischer Ebene findet Berührung statt (...) 4. Musik dient der Auseinandersetzung mit der äußeren Natur. (Funktion der Auseinandersetzung) Durch die Erforschung der äußeren Natur der Gegenstände erfahren Menschen ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen. In der Praxis zeigt sich die enge Verbindung von musikalischem Ausdruck auf der einen und spielerischem Umgehen mit Objekten auf der anderen Seite, bzw. ein schneller Wechsel zwischen diesen beiden Ebenen. So werden die Musikinstrumente häufig als Spielzeug benutzt. Beispiele: Eine Kinder - Djembé wird umgedreht zum Steuerrad eines Schiffes, eine Guiro wird auf dem Rücken festgebunden zur Sauerstofflasche eines Tauchers. In der kindlichen Entwicklung ist die Fähigkeit zu spielen an Voraussetzungen geknüpft: - Sicherheit und Stabilität in der Beziehung zu der wichtigsten Bezugsperson, erst mit dieser Sicherheit wagt das Kind, die Welt der Objekte zu erforschen 4 Bedeutung von Klang, Musik, Spiel und Sprache ÜbergangsObjekte Funktionen von Musik MusikInstrumente als Spielzeuge - Die bewusst gewordene Erfahrung von Getrenntheit von sich und der Welt der belebten und unbelebten Objekte Funktionen des Spielens fasst Hartmann (1973, 81-102) zusammen: - Alternativbefriedigung für in der Realität vorhandene Wünsche - Angstabwehr - Stärkung und Zusammenführen von verschiedenen Ich-Funktionen: Identität, schöpferische Funktionen, Entwicklung des Selbst Das Agieren von Kindern in der Kindermusiktherapie bewegt sich ständig zwischen den Polen: Musik-Machen, Spielen, Bewegen, Sprechen, häufig tun Kinder alles gleichzeitig. Dieses Phänomen macht es schwierig, nur eine Methode anzuwenden. Das analytische Prinzip des „freien Assoziierens“ findet sich in der Therapie mit Kindern in sämtlichen Ausdrucksbereichen und umfasst hier auch die Funktionen von Sprache - Verarbeitung und Verstehen (Erkenntnis) von Außen-Einflüssen - Distanzierung und Abwehr - Brücke zwischen innerer und äußerer Realität in Form von Märchen, Geschichten, (Tag-)Träumen. Funktionen des Spielens Freies Assoziieren In der Arbeit mit 3-6 jährigen „behinderten“ Kindern finden sich vielfältige Sprachprobleme bis hin zur Sprachlosigkeit, sodass der Umgang mit Musik zu Selbst-Ausdrucks und Verständigung führen kann, die es auch gerade schwer gehandicapten Kindern möglich macht, als gleichwertiger Partner in eine GruppenInteraktion eintreten zu können. Wichtige Themen sind hier die Regulierung von Nähe-Distanz, Macht-Ohnmacht über die Gestaltung musikalischer Prozesse in der jeweiligen Gruppe. In den nun folgenden methodischen Aspekten wird der Begriff des „musikalischen Materials“ näher erläutert. Es wird dargestellt, wie sich der Umgang mit dem Material notwendigerweise an den Bedürfnissen und Grenzen behinderter Kinder orientiert. In Anlehnung an Waltraud Vorel (vgl. 1993) wird in der hier beschriebenen Arbeit der Rahmen von Kindermusiktherapie weit gespannt und umfasst kreative Ausdrucksäußerungen der Kinder - in der Musik - in der Aktion (Rollenspiel, Verkleidung, Versteck...) - in der Farbe (malen, betrachten, raten...) - in der Form (kneten, bauen, mitbringen von Objekten aller Art...) - in der Bewegung (Tanz, Rhythmik, Psychomotorik...) - in der Sprache (Gespräche, Lieder, Geschichten, Verse, Träume, Phantasiereisen...) Die Instrumente sind das Hauptwerkzeug auch in der Kindermusiktherapie. Sie schwingen, klingen und erzeugen Stimmungen, geben in Klängen wieder, was ein Mensch fühlt. Sie stellen in analytischer Sicht Übergangsobjekte dar. In diesem Verständnis dienen Musikinstrumente insbesondere - der Projektion von Gefühlen - der Abreaktion von Gefühlen - der Befriedigung libidinöser Tendenzen durch die Berührung mit Tönen - der Bearbeitung nicht bewältigter Konflikte Doch nicht immer bieten die Instrumente genügend Schutz, um sich auszudrücken. Gerade in der Arbeit mit wahrnehmungsgestörten Kindern ist ein behutsa5 Musikalisches Material MusikInstrumente mer Umgang mit Instrumenten, d.h. Klängen, wesentlich, um Grenzen der Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesreizen nicht zu überschreiten und damit eine Überforderungssituation, unter Umständen eine psychische Dekompensation, herbeizuführen. Eine homogene Gruppenstruktur bietet sich an, da das „Verstehen“ und „Nach-Empfinden“ der besonderen Problematik auditiv und taktil überempfindlicher Kinder für „normale“ Kinder nicht oder nur sehr schwer nachvollziehbar ist. Beispiel („Regelkind“ zu einem „wahrnehmungsgestörten“ Kind): „Warum schreist Du denn schon wieder, dass es Dir zu laut ist?“ Nahezu gegenteilig gestaltet sich die Arbeit mit den Kindern mit „DownSyndrom“, die auch an einer Wahrnehmungsproblematik, hier jedoch im entgegengesetzten Sinn „leiden“. Was für oben beschriebene Kinder ein häufig ein „Zuviel“ bedeutet, ist für diese Kinder häufig das „Zuwenig“ (um sich zu spüren...) D.h. „Down-Syndrom-Kinder“ brauchen allgemein ein intensives Angebot an Reizen und basalen Stimulationen, um mit sich selbst in einen guten Kontakt zu kommen. Hier bietet sich bevorzugt das Trommeln an, sowie die Arbeit mit langklingenden körpernahen Instrumenten (Klangschale, Gong...) Bei allen wahrnehmungsgestörten Kindern liegt eine Störung der KörperSelbstwahrnehmung vor, der regressionsfördernde Aspekt von musiktherapeutischer Arbeit verdient Aufmerksamkeit, um nicht ein regressives Verharren auf einer frühen Entwicklungsstufe zu unterstützen. So kann das Klangangebot im Sinne des „Umhüllen, „Einlullen“, Getragen-Werden“ ggf. notwendige Entwicklungsschritte blockieren. Förderliche Entwicklungsschritte wurden bei den Kindern mit „Down-Syndrom“ eher mit Interventionen erzielt, die provozieren, aktivieren, „ärgern“ mit Klängen, dadurch Bewegungsimpulse in Gang setzen, sinnvolles Tun, Erfolgserlebnisse, Kreativität initiieren. Nicht alle Bedürfnisse von Kindern können durch die Verwendung von Musikinstrumenten erfüllt werden. So ist denn z.B. auch das Kuscheltier nötig, die Knetmasse für Matsch- und Schmierbedürfnisse, die Bildergeschichte zum „einfach nur zuhören“, die Decke zum Träumen und „Abtauchen“ in eine selbstgebaute „Höhle“... Gerade behinderte Kinder sind in ihrem Erleben und mit ihren Bedürfnissen darauf angewiesen, „Körpernahes“ zur Verfügung zu haben, um Bedürfnisse ausdrücken zu können. Mehr als „nicht-behinderte Kinder“ suchen insbesondere wahrnehmungsgestörte Kinder intensiven und nahen Körperkontakt. Dieses Bedürfnis kann ein Musikinstrument nur begrenzt durch Klang kompensatorisch befriedigen. Im übrigen wird die Möglichkeit der Identifikation über ein Tier sehr viel schneller gegeben als das ein Instrument zum Identifikationsobjekt wird. Die abstrakte Gegenständlichkeit eines Instruments wird beim Kuscheltier sofort zum konkretgegenständlichen Begreifen umgewandelt und erleichtert so dem behinderten Kind das Ausdrücken v.a. basaler körperlicher Bedürfnisse. Beispiel: Ein entwicklungsverzögertes Mädchen weigerte sich zunächst, sich musikalisch auf einem Instrument auszudrücken, über den Kuscheltier-Elch „Floppy“ war es ihr dann jedoch möglich, Gefühle zu projizieren. „Floppy ist heute ganz müde und traurig..“ Das Medium, das verwendet wird (ob Musikinstrument, Kuscheltier, Malstifte und Papier, Knete, Spielsachen und Spielerisches wie Seifenblasen, Seile, Bälle, Bilderbücher...), soll der jeweiligen therapeutischen Situation und damit den Bedürfnissen des Kindes entsprechen. 6 Basale körperliche Bedürfnisse W. Mahns (1998, 159) äußert hierzu: „Wichtiger als das Festhalten am Medium Musik ist hier das Festhalten am Kontakt zum Kind, auch um den „Preis“, dass Musik phasenweise nur eine geringe Rolle in der Musiktherapie spielt“. Im folgenden schließt sich an, wie der „freie“ Umgang mit dem Material, die „freie Improvisation“ zum methodischen „roten Faden“ einer so weit abgesteckten kindermusiktherapeutischen Arbeit wird. Die Improvisation wird auch als „Königsweg“ in der Musiktherapie analog zu der freien Assoziation in der Psychoanalyse bezeichnet (vgl. Loos 1986, 157 f.). Die Fragen, die sich unmittelbar im Zusammenhang mit behinderten Kindern stellen: Kann mit behinderten Kindern die Methode der „freien Improvisation“ angewendet werden? Brauchen nicht gerade behinderte Kinder klare Strukturen und Vorgaben zur Orientierung und Sicherheit? Welche Möglichkeiten und Grenzen sind zu beachten? „Behinderte“ Kinder sind in ihrem Alltag in der Kindertagesstätte an vielfältige von außen vorgegebene Tagesablaufstrukturen gebunden. Die Möglichkeit der kreativen Selbst-Entwicklung und die Auseinandersetzung mit der nahezu jede Behinderung begleitenden Beeinträchtigung der sozialen Kontakt- und emotionalen Erlebnisfähigkeit ist in einer integrativen Gruppe mit 15 Kindern kaum realisierbar. Der nötige Frei-Raum für die Entwicklung eines kreativen Prozesses ist nicht gegeben, da die Vielfalt von Angeboten und Einflüssen von außen eine ungestörte Entwicklung eines solchen Prozesses verhindern würde. Andererseits brauchen gerade wahrnehmungsgestörte Kinder stressfreie und reizarme „Räume“, um sich ihren inneren psychischen Prozessen widmen zu können. Doch gibt es auch eine Korrelation mit dem eigenen therapeutischen Verhalten: In dem Maße, wie ich mich selbst von Unsicherheitsgefühlen und Sicherheitsbedürfnissen distanzieren konnte und damit die Vorgabe von Strukturen aufgab, konnten die Kinder sich zunehmend dem freien musikalischen Spielen öffnen. Ich konnte beobachten, wie die Kinder in ihrem gesamten Ausdrucksverhalten spontaner, flexibler und differenzierter gestalten lernten, mehr Selbstverantwortung für ihr Tun übernehmen konnten und mich in die Rolle des Spielleiters und Spielpartners seltener hineinforderten. So entsteht auch in der Arbeit mit „behinderten“ Kindern ein an die Therapiesituation gebundener Prozess, der aus einer jeweils anfänglichen Experimentier- und Erprobungsphase des Materials meist zügig in von den Kindern selbst strukturierte musikalische und außermusikalische Spielsituationen übergeht. In Anlehnung an die Gestalttherapie lässt sich darauf bezogen eine von Dietrich Petersen und Eckhard Thiel (vgl. 2001, 105f.) entwickelte Stufenabfolge des sogenannten kreativen Prozesses benennen. 1. Er - leben: Experimentier- und Erprobungsphase des Materials 2. Be - leben: Entscheidung für eine bestimmte Auswahl an Medien. Eine Spielidee wird „geboren“, Kommunikation entsteht, es wird verhandelt und schließlich umgesetzt. 3. Be - greifen: Betrachten des gemalten Bildes, der aufgebauten Spielszene, Hören der auf Band aufgenommenen musikalischen Produktionen 4. Benennen und 5. Reflektieren. Die Ebenen (4/5) der Verbalisierung sind in der Therapie mit „behinderten“ Kindern zum Teil nicht möglich. Häufig findet sich bei „behinderten“ Kindern eine ausgeprägte Diskrepanz hinsichtlich Sprachverständnis und aktiver Sprache. Hier 7 Improvisation Kreativität gebe ich dann den Kindern angemessene Beschreibungen dessen, was ich gehört, gesehen und empfunden habe („stellvertretende“ Reflexionsebene). In Analogie zur lebensgeschichtlichen Chronologie des Menschen ,können diese Phasen so zur Grundlage jeder einzelnen therapeutischen Sitzung werden. Im folgenden Praxisteil wird dargestellt, wie sich in einer langfristigen Therapie diese Chronologie auch als Themen innerhalb des gesamten therapeutischen Prozesses wiederfinden lassen. „Jonas“ Diagnose: Down-Syndrom JONAS (6,4 Jahre) ist seit ca. einem Jahr einmal wöchentlich für 45 Minuten in der Musiktherapie. Das erste halbe Jahr fand in einer Vierergruppe mit noch einem „Down-Syndrom-Mädchen und einem stark entwicklungsverzögerten Jungen (beide 6 Jahre alt) statt, die beide seit dem Sommer 2000 die Schule besuchen. Hier möchte ich mich auf die Darstellung des musiktherapeutischen Prozesses in den vergangenen 8 Monaten beziehen, der zu zweit mit einem fast gleichaltrigen Mädchen (Philippa, 6,4 Jahre), ebenfalls mit Down-Syndrom, stattfand. JONAS kommt aus einem sehr behüteten Elternhaus. Er wird von der Mutter noch überfürsorglich auf Kleinkindniveau angesprochen (er bekommt abends noch die Flasche, wird im Liegen gewickelt, z.T. noch gefüttert, wird angezogen...), so dass seine bisherige Selbständigkeitsentwicklung kaum statt finden konnte. PHILIPPA dagegen kommt aus einer italienischen Großfamilie und hat in ihrer primären Sozialisation schon viel soziale Kompetenz erworben. So zeigt sie Umsicht und Fürsorge gegenüber Johannes, will ihm auch vieles abnehmen, kommt dabei selbst „zu kurz“. PHILIPPA musste in den letzten Monaten die mit heftigen familiären Krisen verbundene Trennung ihrer Eltern erleben. Ihre Mutter zog aus, sie blieb bei ihrem Vater und sah ihre Mutter nur sehr sporadisch. Die sich im Verlauf der Therapie abzeichnende Konfliktsituation der Eltern führen bei ihr zu ausgeprägten Stress- und Angstreaktionen. Es kommt zu Wutausbrüchen und lautem Schreien in der Therapie, meist ohne erkennbaren Zusammenhang. Möglicherweise wiederholt sie erlebte Szenen aus ihrem Elternhaus ausagierend in der Therapiesituation. Zu Beginn der Therapie zeigen beide Kinder ein sehr unterschiedliches Entwicklungsniveau und entsprechende Unterschiede in ihrem Ausdrucksverhalten. JONAS zeigt eine ausgeprägte orale Bedürftigkeit. Er nimmt alle Instrumente mit dem Mund durch Anlecken in Besitz, sitzt lange Phasen der Therapiezeit in absoluter Passivität aus. Interessiert sich scheinbar weder für PHILIPPA, noch für das Material, noch für mich. Aus der Begegnung mit ihm in der Großgruppe weiß ich jedoch um seine ausgesprochene Vorliebe für Musik. So fällt mir auf, dass ich ihn zunächst mit gesungenen Improvisationen erreichen kann. Wenn ich anfange zu singen, fängt er an - im „wahren Sinne“ des Wortes- zu lauschen. Er nimmt dann auch gerne Körperkontakt mit mir auf, indem er zu mir kommt, seinen Kopf gegen meinen stößt, begleitet mit der Wortsilbe „Dotz“. Ein eindeutiger Zuneigungsbeweis, wie ich im Verlauf der Therapie merke. PHILIPPA ist von Beginn an aktiv darum bemüht, einen liebevollen Kontakt zu JONAS herzustellen. Sie nimmt ihn gerne in den Arm, drückt ihn fest an sich, schimpft auch mit ihm, wenn er regungslos verharrt. Letztlich ändert sich nichts an ihrer offensichtlichen Liebe zu ihm. Als Spielpartner werde ich von beiden Kindern während des gesamten Therapieprozesses selten angesprochen. Sie sind ausgesprochen selbst-zufrieden und fordern wenig Unterstützung. In meiner therapeutischen Rolle erlebe ich mich häufig in einer Art vermittelnden „sprachlichen Brückenfunktion“: Ich „übersetze“ das (fast) ausschließlich non-verbale Kommunizieren beider Kinder sozusagen als „non-verbale Gesprächstherapeutin“...Dies führt m.E. zu einer stabilen und intensiveren Beziehung und Wahrnehmung der Kinder untereinander und erleichtert uns das Klären von Konfliktsituationen. für JONAS formuliere ich folgende musiktherapeutischen Ziele: allgemeine pychomotorische Aktivierung der Abbau seiner Egozentrik, die Entwicklung von selbständigem Handeln und sozialem Austausch Mein theoretischer Ansatz einer grundsätzlichen Nicht-Vorstrukturierung des therapeutischen Settings erschien mir angesichts der Heterogenität dieser Kleingrup8 Fallbeispiel Down-Syndrom Familiäre Situation Lauschen Musiktherapeutische Ziele Musikalische Ebene pe zunächst fragwürdig zu sein. Umso mehr überraschte mich, wie intuitiv beide Kinder in Kürze das Trommeln in der Anfangsphase der Therapie als quasi „gemeinsamen Nenner“ für sich entdeckten. Aufgrund der SI-Problematik bei „Down-Syndrom-Kindern“ war das Trommeln als basale Stimulation und zur Förderung der Tiefensensibilität bestens geeignet, die Selbstwahrnehmung der Kinder zu unterstützen, und v.a. bei JONAS eine deutliche Aktivierung in Gang zu setzen. Unterstützt durch elementare übungsorientierte Trommelangebote setzte bei JONAS auch langsam das „Den-Anderen-Wahrnehmen“ ein. Du-Ich, Laut-Leise, Langsam-Schnell, Ja-Nein-Spiele förderten diese Entwicklung. Nach dieser „Trommelphase“, folgte eine Phase des spielerischen Entdeckens der anderen Instrumente, bei PHILIPPA auch das Entdecken des Tanzens zu deutlich rhythmisch geprägter v.a. afrikanischer und brasilianischer Tanzmusik. Eine Wendepunkt trat ein, als JONAS seine Vorliebe für Langklinger, besonders die Klangschale, entdeckte. Bis heute sind sie bevorzugtes Instrumentarium, sehr gezielt sucht sich JONAS inzwischen selbständig seine „Musik“ aus, die Phase des (scheinbar) untätigen Nichts - Tun (in der Anfangsphase bis zu einer halben Stunde unserer 45-minütigen Therapiezeit) scheint völlig überwunden. Neben den Langklingern weckt das Spielen auf der Kinder-Gitarre zunehmend JONAS Interesse, hier zeigt sich seine hohe musikalische Sensibilität und sein im wahren Sinn des Wortes hochsensibles „Fingerspitzengefühl“. JONAS wird durch PHILIPPAs Lebendigkeit immer wieder zum gemeinsamen Spielen animiert. In einer Musiksequenz zeigt sich m.E., wie mit übungszentriertem Singen sowohl Sprachanbahnung als auch Kontaktfähigkeit unterstützt werden können: Das Singen der Aussage „Hey, hey, hey, das wäre doch gelacht!“, im Verlauf von mir rhythmisch durch die Trommel unterstützt, wird zwischen JONAS und mir zu einer ritualisierten Übung. Vor ca. drei Monaten löste diese Melodie bei JONAS begeistertes Lachen und Freude und hohe Motivation aus. Sie wird im folgenden zur Nähe stiftenden Begegnungsmelodie zwischen JONAS und mir. In dem Beispiel erkennt JONAS schließlich anhand des Trommelrhythmus den Sprachrhythmus wieder. Ohne mein Mitsingen wiederholt er die Melodie im Anschluss an den getrommelten Rhythmus. Der fließende Austausch zwischen uns gerät ins Stocken, als ich das „Hey, hey, hey“ zwischendurch beim Vorsingen weglasse. Meines Erachtens kommt hier zum Ausdruck, dass für JONAS die vollständige Klanggestalt entscheidend zur Wiedererkennung ist. Wie ich im theoretischen Teil zur Funktion von Klängen ausführte, scheint sich für JONAS diese Klanggestalt zur „emotionalen Erinnerungsspur“ entwickelt zu haben. Das Auslassen der Anfangssilben führt hier offenbar zu einer plötzlichen Veränderung, die JONAS überfordert. Trommeln als basale Stimulation Langklinger Sprachanbahnung mit übungszentriertem Singen Zusammenfassend lässt sich heute sagen: JONAS nimmt aktiv Kontakt zu mir auf und zeigt auch deutlich sein Bedürfnis nach Kontakt mit anderen Kindern. Die inzwischen gelegentlichen Aggressivitäten und Provokationen, die er einsetzt, um Kontakt anzubahnen, können in der pädagogischen Arbeit durch Setzen klarer Grenzen und eindeutigem Beziehungsverhalten aufgefangen werden. Therapeutisch zeigt sich aufgrund der Wahrnehmungsproblematik der „Down-Syndrom-Kinder“ die Schwierigkeit einer angemessenen Kraft-Dosierung im (auch körperlichen) Beziehungsverhalten. In der Musiktherapie kann dieser Selbst-Wahrnehmungsschwierigkeit m.E. vor allem durch den Einsatz von Klangangeboten, die den tiefensensiblen Wahrnehmungsbereich ansprechende (siehe oben: Trommeln) entsprochen werden. Die Fähigkeit beider Kinder, das für sich „Richtige“ herauszusuchen und damit die Fähigkeit des „Für-Sich-Selbst-Gut-Sorgen“ zu können, überrascht und fasziniert mich immer wieder von neuem. „Sarah“ ist 6,8 Jahre alt. Ihre Diagnose lautet: Reaktive Bindungsstörung auf dem Hintergrund ungünstiger psychosozialer Lebensumstände. In einem Bericht der Kinderpsychiaterin heißt es: „SARAH „scheint in frühester Zeit einem „Wechselbad“ zwischen Deprivation und Reizüberflutung ausge- 9 Fallbeispiel setzt gewesen zu sein...“. Sie zeigt eine „starke Störanfälligkeit gegenüber Außenreizen..“ Der Verdacht auf das Vorliegen eines sexuellen Missbrauchs von SARAH in ihrer frühesten Kindheit wird heute als erwiesen angesehen. Aufgrund des zunächst im Vordergrund stehenden Verdachts einer SI-Problematik, kam SARAH zu uns in das Kinderhaus auf einen Förderplatz. Parallel zur Musiktherapie erhält SARAH außerhalb des Kinderhauses Therapie bei einem analytischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, zu dem regelmäßiger Kontakt besteht. Mit 2 Jahren wurde SARAH in einem Kinderheim untergebracht, nach einigen Monaten erfolgte die Aufnahme in einer Pflegefamilie, seit 2,9 Jahren lebt sie als Pflegekind und einziges Kind bei ihren jetzigen Pflegeeltern. Doch auch in dieser Familie bahnen sich weitere Konflikte für SARAH an. Beim Eintritt in unser Kinderhaus erleben wir SARAHS Pflegeeltern völlig überfordert und hilflos in Bezug auf einen angemessenen Umgang mit ihrer Tochter. Im Erstgespräch mit der Pflegemutter fällt ihre emotional indifferente Haltung gegenüber SARAH auf. Die Mutter berichtet, sie habe SARAH adoptiert, da sie sie sehr an sich selbst als Kind erinnert habe. Sarah sei jedoch so „schwierig“ (Zitat der Mutter), dass sie keine Kraft mehr habe, die Auffälligkeiten ihrer Tochter zu ertragen. Es fällt auf, dass die Mutter zwar ausführlich über ihre Befindlichkeit berichtet, die emotionale Betroffenheit wird jedoch nicht spürbar. In den 2,5 Jahren SARAH’s Kinderhauszeit wird die fehlende Nähe zwischen SARAH und ihrer Mutter zum für SARAH schon fast als tragisch zu bezeichnendem durchgängigen Thema. Mit der seit kurzem bekannt gewordenen und langersehnten Schwangerschaft der Mutter kommt in diese Beziehungsproblematik eine für SARAH konfliktbeladene neue Dimension. Der anstehende Übergang in die Schule, der bei SARAH zur Zeit ohnehin massive Trennungsängste wieder aufkeimen lässt, führt zu einer weiteren Verschärfung der Gesamtsituation. Für die Musiktherapie ergeben sich folgende Perspektiven: - Aufbau einer stabilen, Schutz, Sicherheit, Klarheit und Verlässlichkeit anbietenden therapeutischen Beziehung - Arbeit an dem gestörten Verhältnis zwischen Nähe und Distanz; ein klares, grenzensetzendes Gegenüber in der Begegnung sein, - behutsamen emotionalen Zugang zu den eigenen Gefühlen und Körperwahrnehmungen ermöglichen - „heilende“ Klangerfahrungen ermöglichen v.a. über Arbeit mit „Langklingern“ - Rhythmusarbeit zum Herstellen eines tragfähigen „Bodens“ Eine besondere Qualität der Musiktherapie besteht darin, dass die klanglichen Erfahrungen immer zugleich auch Beziehungserfahrungen sind. Im vorliegenden Falle, bei dem es um Bindungsstörungen geht, soll in einer tabellarischen Übersicht die enge Verknüpfung von musikalischem und Beziehungsgeschehen deutlich werden. 10 Reaktive Bindungsstörung Familiäre Situation Musiktherapeutische Perspektiven Musikalische Ebene: Beziehungsebene: 1. Phase: ER-LEBEN „Die blaue Trommel“ (v. SARAH so benannt..) SARAH wählt eine bestimmte Djembé mit blauer Fellrandumschnürung aus. Diese Trommel bekommt in den ersten Monaten der Musiktherapie eindeutig die Funktion eines „Übergangsobjektes“: - sie muss in jede Therapiestunde mitgenommen werden, - sie wird „geliebt, gehasst, getreten, als Schutz gewählt SARAHs Spielen ist zunächst laut, hämmernd, unruhig, kantig, zeigt kaum dynamische Nuancen. Ich beginne, ihr „Boden“ anzubieten, spiele für sie viel ruhige „Herzschlagrhythmen“. 1. Phase: ER-LEBEN SARAH beginnt, zu mir Kontakt aufzunehmen, panische Angstanfälle lassen langsam nach. In für sie zu bedrohlichen Momenten fängt sie an, aktiv bei mir Schutz zu suchen. Mit ihrem daran anschließenden zum Teil sehr impulsiven Verhalten (plötzliches Schreien und Wutausbrüche) testet sie meine Belastbarkeit. 2. Phase: BE-LEBEN Die „blaue Trommel“ muss zwar immer noch unbedingt in jede Musiktherapiestunde mitgenommen werden, doch „weitet“ sich nun SARAHs Blick auch für die anderen Instrumente, das „musikalische Malen“ (zu ausschließlich meditativer Instrumental-Musik) wird zum Schlussangebot jeder Stunde und scheint vor allem Entspannung und Beruhigung bei SARAH zu bewirken. Ansonsten dominieren strukturierte Spielangebote meinerseits. SARAH verfällt leicht in zwanghaft erscheinendes Bedürfnis, einmal Bekanntes wiederholen zu wollen. 2. Phase: BE-LEBEN Im Vordergrund steht weiterhin der Aufbau einer stabilen und vertrauensvollen Beziehung. Das Bedürfnis, bekannte Spiele zu wiederholen, scheint besonders auch SARAHs Bedürfnissen nach Kontrolle zu entsprechen. Im Übertragungsgeschehen agiert sie Wut und Aggressivität aus. In den Spielen zeigen sich (psychotische?) Tendenzen, Spiel und Realität nicht mehr trennen zu können. Gelegentlich führen die damit verbundenen massiven Ängste zu der Notwendigkeit meinerseits, das Spiel zu beenden und den Realitätsbezug wieder herzustellen. SARAH Orientierung und Sicherheit anzubieten, sind für mich Leitlinie in unserer Begegnung. 3. Phase: BE-GREIFEN „Polaritäten“ Regressive Momente versuche ich musikalisch durch sanfte „Langklinger“ (Gong, Becken, Klangschale) zu begleiten. Daneben entstehen in den gemeinsamen Improvisationen zum Teil heftige Aggressionen und „Kämpfe“ im Ringen um Autonomie. M.E. wird in der Musik SARAHs Grundkonflikt spürbar, vermutlich nie eine von Authentizität und „wirklicher“ Liebe geprägte Beziehung zu einer Mutter erfahren zu haben. In der Übertragung werde auch ich jetzt häufig als „böse Mutter“ mit Klanggewalt symbolisch „vernichtet“. Meine symbolische „Unzerstörbarkeit“ lässt die Möglichkeit einer allmählichen Integration hilfloser, ohnmächtiger und hasserfüllter Gefühle zu. 3. Phase: BE-GREIFEN SARAH regrediert jetzt häufig, wird zum „daumenlutschenden Baby“, kann kurzzeitig Nähe durch direkten Körperkontakt (Streicheln, Massage) annehmen. Jäh unterbricht sie diese Phasen durch plötzliches Aufspringen. Ich spüre das Ausmaß ihrer seelischen Verletzungen und ihr unbedingtes Recht auf Schutz vor einem Zuviel an (noch) nicht integrierbaren Gefühlen. Hinter SARAHs Bewegungsdrang vermute ich neben der Möglichkeit, Stress und Angst abzubauen, vor allem eine Fluchttendenz vor überwältigendem Schmerz und Trauer. 11 Verknüpfung von musikalischem und Beziehungsgeschehen 4. Phase: BE-NENNEN und REFLEKTIEREN v.a. durch mich als „verbalisierende Stellvertreterin“ für die Kinder Sie umfasst etwa den Zeitraum des vergangenen Jahres. SARAH nimmt jetzt neben der Einzeltherapie auch an einer gruppenübergreifenden Kleingruppe mit drei „nicht-behinderten“ Kindern teil. Die Therapiestunden verlaufen ohne Vorstrukturierung. Musikalische Elemente verbinden sich in den entstehenden Spielszenen mit spielerischem Gestalten des zur Verfügung stehenden, auch außermusikalischem Material. Ritualisiert wird die Idee eines Mädchens, SARAH aus ihren „Rückzugsverstecken“ mit improvisierter Musik herauszulocken. 4. Phase: BE-NENNEN und REFLEKTIEREN SARAHs Frustrationstoleranz ist kaum entwickelt, sie braucht zunächst (zeitweise auch mich überfordernd) stete Bestätigung und Lob. Doch lasse ich sie auch erfahren, ob die Gruppe sie trägt, wenn sie (was häufig vorkommt), aus dem Spielgeschehen aussteigt. Nochmals wird SARAHs ausgeprägtes Bedürfnis nach Kontrolle deutlich. Sie möchte „den Ton angeben“, zieht sich „schmollend“ zurück, wenn es nicht gelingt. Mich überrascht die Toleranz, Geduld und Warmherzigkeit der Kinder, SARAHs zum Teil „nerviges“ provokatives Verhalten auszuhalten und ihr entgegenzukommen. SARAH kann sich in dieser Gruppe m.E. viel „Nahrung“ holen für ihren (unstillbaren?) Hunger nach grundlegender Wertschätzung und Beantwortung ihrer zentralen Fragen: „Werde ich gesehen und angenommen, so wie ich bin...?“ Heutige Situation: SARAHs Mutter wird schwanger. Der Mutter-Tochter-Konflikt scheint zu eskalieren, als sich SARAH während der Frühschwangerschaft ihrer Mutter auf den Bauch wirft und die Mutter das Kind kurze Zeit darauf verliert. Die medizinische Diagnose lässt keinen Zusammenhang zu diesem Vorfall erkennen, dennoch äußert die Mutter uns gegenüber, dass sie „SARAH hätte umbringen können“. Jetzt ist die Mutter zum zweiten Mal schwanger, diesmal verläuft offensichtlich alles komplikationslos.. SARAH besucht ab dem Sommer die Schule. Alte Trennungsängste flammen wieder auf. SARAH hat jedoch Kompetenzen entwickelt, die es ihr ermöglichen, schon ein Stück weit für sich selbst zu sorgen. Das wird sehr deutlich, wenn man ihr jetziges musikalisches Verhalten mit dem vom Beginn der Musiktherapie vergleicht: Zu Beginn der Musiktherapie war das innere Erleben SARAHs offensichtlich erfüllt von überflutenden, bedrohenden archaischen Gefühlen, die in der Musik entsprechend als „Chaos-Klänge“ ohne erkennbare Strukturen und Zusammenhänge innerhalb der musikalischen Parameter hörbar wurden. Heute, nach fast dreijähriger „Kinderhauszeit“, zeigt sich, dass SARAH innere Strukturen entwickelt hat. In der Musik werden jetzt eigenständige kurze rhythmische Figuren hörbar, mit denen SARAH m.E. für sich selbst beginnt, einen tragfähigen „Klang-Boden“ gegen Angst und Bedrohung zu errichten. Bezogen auf mein Thema wird hier deutlich, dass sich SARAHs Entwicklungsmöglichkeiten langsam erweitern. Daneben werden aber auch die Grenze spürbar: SARAHs Lebenssituation können wir nicht auflösen. Literatur: Bleidick, U.: Einführung in die Behindertenpädagogik, Band 1, Stuttgart 1981 Hartmann, K.: Psychoanalytische Funktionstheorien des Spiels. In: Das Kinderspiel (Hrsg.: Flitner, A.), München 1973 Loos, G. K.: Spiel-Räume. Musiktherapie mit einer Magersüchtigen und anderen frühgestörten Patienten, Stuttgart 1986 Miske-Flemming, D.: Theorie und Methode zur Behandlung von perzeptionsgestörten Kindern, Idstein 1998 Mahns, B.: Musiktherapie bei verhaltensauffälligen Kindern, Stuttgart 1997 Mahns, W.: Das Musikkonzept in der Musiktherapie. In: Musiktherapeutische Umschau, 1984, 12 Veränderung des musikalischen Verhaltens 295-305 Mahns, W.: Musiktherapie mit Kindern – Ein Überblick. In: Musiktherapeutische Umschau, 1998, 151-163 Petersen, D., Thiel, E.: Tonarten, Spielarten, Eigenarten – Kreative Elemente in der Musiktherapie mit Kindern, Göttingen 2001 Priestley, M.: Musiktherapeutische Erfahrungen, Stuttgart 1982 Priestley, M.: Analytische Musiktherapie und musikalischer Respons. In: Musiktherapeutische Umschau, 1980, 21-36 Stern, D.: Die Erfahrungswelt des Säuglings, Stuttgart 1992 Vorel, W.: Musiktherapie mit verhaltensgestörten Kindern, Bremen 1993 Renate Kowald Ausbildung: abgeschlossenes Schulmusikstudium (Musikhochschule Köln), Studium der Sozialpädagogik (Fachhochschule Köln), Staatlich anerkannte Diplom-Sozialpädagogin, Absolventin der musikalisch-therapeutischen Zusatzausbildung der Universität Siegen Berufliche Entwicklung: langjährige Unterrichtstätigkeit als Klavierlehrerin, seit 1995 musikalisch-pädagogisch-therapeutische Arbeit mit „behinderten“ und „nicht-behinderten“ Kindern in einer integrativen Kindertagesstätte, seit 2001 Nebentätigkeit als freie therapeutische Mitarbeiterin in einer ambulanten Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie Mutter eines 17-jährigen Sohnes und einer 15-jährigen Tochter e-Mail: [email protected] 13