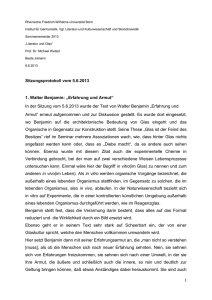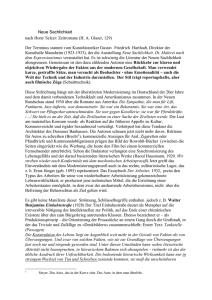ZIP - Albert-Ludwigs
Werbung

WALTER BENJAMINS IDEENLEHRE Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. vorgelegt von Raffaella Soldani aus Turin Freiburg i. Br. 2005 1. Gutachter: Prof. Dr. Günther Figal (Philosophisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.) 2. Gutachter: Prof. Dr. Andrea Poma (Dipartimento di Filosofia, Università di Torino) Tag der Promotion: 4. Oktober 2005 In Erinnerung an meinen Vater INHALTSVERZEICHNIS Einleitung S.1 Kapitel I ERFAHRUNG UND ERKENNTNIS S.8 1. Wissenschaftliche Erfahrung und unmittelbare Erfahrung S.8 2. Die Beziehung Erkenntnis – Erfahrung und der Untergang des Subjektes S.11 2.1 Erkenntnis und Erfahrung: die Termini eines Doppelbegriffes S.12 2.2 Der Untergang des Subjektes S.14 3. Eine höhere Erfahrung: die metaphysische Erfahrung S.17 4. Die konkrete Totalität der Erfahrung: Was nie geschrieben wurde S.20 5. Erfahrung und Religion S.25 6. Wahrheit als Symbol. Die Zweideutigkeit der Erkenntnis S.32 7. Erkenntnis ist Erfahrung S.36 Kapitel II DAS ZWEIDEUTIGE ANTLITZ DER WAHRHEIT. DER URSPRUNG EINER THEORIE DER IDEEN S.38 1. Probleme, Fragen. Allgemeine Linien S.38 2. Der Kunstinhalt: Die wahre Natur S.40 3. Die Rezeption des Urphänomens. Der Ort der Wahrheit S.42 4. Das zweideutige Antlitz der Wahrheit S.46 4.1 Idee als unendliche Aufgabe: Neukantianismus Cohens S.46 4.2 Der Funktionalismus der Idee S.50 4.3 Idee: unmittelbare Erfahrung der Einheit S.54 Kapitel III DIE IDEENLEHRE IM URSPRUNG DES DEUTSCHEN TRAUERSPIELS S.58 1. Probleme, Fragen, Allgemeine Linien S.58 2. Die Erkenntnis in der Vorrede zum Trauerspielbuch S.59 3. Das „Objekt“ der Philosophie S.61 I 3.1 Idee ist Einheit S.61 3.2 Idee ist Monade S.65 3.3 Idee ist Ursprung S.66 3.4 Idee ist Name S.71 4. Die Temporalität der Idee S.75 5. Das Darstellungsproblem S.78 6. Eine neue philosophische Einstellung S.82 Kapitel IV DIE ROLLE DER IDEE NACH DEM TRAUERSPIELBUCH S.88 1. Probleme, Fragen. Allgemeine Linien S.88 2. Erkenntnis und Erfahrung S.89 3. Das dialektische Bild S.97 3.1 Die Dialektik S.98 3.2 Das dialektische Bild und die Lesbarkeit der Vergangenheit S.105 4. Die „Wahrnehmung“ der Idee S.111 5. Die Aufgabe des Intellektuellen: die Rettung der Phänomene S.118 Kapitel V DIE ROLLE DER IDEE IN DER PRAKTISCHEN PHILOSOPHIE WALTER BENJAMINS 1. Probleme, Fragen. Allgemeine Linien S.125 S.125 2. Die Ethik und die Idee in den Studentenschriften (1914): Die Religion als neue Moral S.126 3. Die Hoffnung und die Ethik: Goethes Wahlverwandtschaften S.128 3.1 Der Mythos (d.h. das natürliche Leben) und der ethische Kampf gegen den Mythos S.129 3.2 Die Versöhnung aus dem Mythos S.133 3.3 Erlösung und Versöhnung S.144 4. Intellektuelle Versöhnung als existentielle Antizipation der eschatologischen Erlösung S.147 5. Die doppelte ethische Wahrheit: die komplementäre Welt S.151 6. Der Mythos und die Vergessenheit S.154 6.1 Die zwei Bedeutungen des Vergessens und die Weisheit der Erinnerung 7. Ethik als Utopie S.158 S.161 II Literaturverzeichnis S.163 III Der Apparat der vorliegenden Arbeit verwendet im weiteren die folgenden Abkürzungen für die Schriften Benjamins: B = Gesammelte Briefe, hrg. Von Christoph Gödde und Henri Lonitz, Suhrkamp, Frankfurt am Mein 1995-2000: Bd. I (1995): Briefe 1910-1918. Bd. II (1996): Briefe 1919-1924. Bd. III (1997): Briefe 1925-1930. Bd. IV (1998): Briefe 1931-1934. Bd. V (1999): Briefe 1935-1937. Bd. VI (2000): Briefe 1938-1940. BW = WALTER BENJAMIN – GERSHOM SCHOLEM, Briefwechseln 1933-1940, hrg. von G. Scholem, Suhrkamp, Frankfurt am Mein 1980. GS = Gesammelte Schriften, hrg. Von R. Tiedemann und H. Schweppenhäuser, Suhrkamp, Franfurt am Main 1972-1989: Bd. I (1974): I 1; I 2; I 3. Bd. II (1977): II 1; II 2; II 2. Bd. III (1972): III. Bd. IV (1972): IV 1; IV 2. Bd. V (1982): V 1; V 2. Bd. VI (1985): VI. Bd. VII (1989): VII 1; VII 2. In dem Text folgt die Bandnummer und die Seite der Abkürzung GS. IV EINLEITUNG Es ist bekannt, dass sich das Leben Walter Benjamins zwischen den Grenzen verschiedener Nationen abspielt, und dass eine Grenze – gemeint ist diejenige zwischen Frankreich und Spanien – auch der Ort ist, an dem diese Erfahrung endet. Ausgerechnet an eben einee Grenze, könnte man sagen, hat Benjamin seine Gedanken geführt, denn schon beim ersten Aufschlagen der Lektüre dieses Autors gewinnt man nämlich den Eindruck, sich in Anwesenheit eines Denkens zu finden, das zwischen einer Grenze und deren Überschreitung schwankt. Das Überschreiten der Grenzen spiegelt sich zunächst in der äußeren Form des Denkens Benjamins wider. Dies ist ein „Denken“ im weitesten Sinne des Wortes, weil es über vielerlei Themen nachdenkt: von Kunst bis Kinematographie, von Politik bis Kindermärchen, von Dichtung bis Religion. Somit überschreitet es die Grenzen der traditionellen philosophischen Forschung. Die Grenze hat aber auch eine konzeptuelle Bedeutung. In diesem Fall bewahrt, bestimmt die Grenze die tiefste Struktur von Benjamins Philosophie: diese befindet sich an der Grenze zwischen dem Phänomen und der Idee, welche den Horizont seiner Forschung ausmachen. Es gibt weder bloß die Idee noch das Phänomen allein. Dennoch gibt es eine Bewegung, die von der einen zum anderen geht. Die Philosophie Benjamins ist die Darstellung des Phänomens in seiner kontinuierlichen Spannung zur Idee und in seiner kontinuierlichen Konzentration zur Überwindung des Phänomenalen. Die Unmöglichkeit, die Grenze zu überschreiten, bedeutet, dass die Philosophie Benjamins – genauso wie jegliche andere phänomenale Manifestation – darauf angewiesen ist, in dem Profanen zu bleiben; aber ihr Wert und ihre Aktualität werden von der Anerkennung einer Realität bestimmt, welche über die des Phänomens hinausgeht. Die beiden Extreme – d.h. das Phänomen und die Idee – können nicht vereint werden, weil zwischen ihnen eine unendliche Distanz bestehen bleibt, die niemals ausgefüllt werden kann. Zwischen diesen beiden Extremen wirkt und arbeitet die Philosophie. Das Vorhaben dieser Arbeit ist es über diese „Grenze“ nachzudenken und dementsprechend das Thema der Idee – oder besser das Problem der Idee und deren Beziehung mit dem Endlichen – zu entwickeln. Die Ideenlehre, welche Benjamin vorschlägt, bleibt aber bezüglich mehrerer Fragen offen: wie gelangt nämlich der Philosoph zu der Idee? Wozu „dient“ die Idee? Und 1 schließlich: was ist die Idee? Benjamin systematisiert niemals seine Ideenlehre. Er wendet sie aber – wie wir sehen werden – innerhalb seiner Schriften an. Darum ist es vorrangig die Absicht dieser Forschung, die benjaminschen Ideenlehre aus seinen Texten zu extrahieren. In den früheren Jahren seiner philosophischen Aktivität – wie die Briefen an Scholem beweisen – hatte Benjamin ein Projekt über Kant und Cohen formuliert. Dieses war auf die Möglichkeit zentriert, eine neue Theorie der Erkenntnis im Bezug auf den Begriff der Erfahrung auszudenken. Das Bedürfnis die Integrität und die Einheit der Erfahrung zu bewahren, bringt aber Benjamin dazu sich von Cohen zu entfernen und solche Problematiken in eine andere Richtung zu entwickeln, indem er zu einem Begriff der Erkenntnis und zu einem Begriff der Erfahrung gelangt, die wenig mit denen der Marburger Schule zu tun haben. Die Erfahrung wird nämlich bei Benjamin zu einer „höheren Erfahrung“: d.h. eine Erfahrung als Totalität verstanden, die folglich die wissenschaftliche Ausschließlichkeit des Neukantianismus überwinden will, um in sich jede Art von Erfahrung einzuschließen, inklusive der Religiösen. Der Leser der Programmschrift findet sich aber vor einer Schwierigkeit: die Totalität der Erfahrung, von welcher bei Benjamin die Rede ist, stellt sich nämlich auf der einen Seite als ein utopisches Ideal vor, welches, um erreicht zu werden, ein unendliches Streben verlangt. Andererseits wird aber auf die Möglichkeit einer unmittelbaren Wahrnehmung hingewiesen, die eine solche Totalität augenblicklich wahrzunehmen ermöglicht. Genau die selbe Schwierigkeit begegnet uns bei dem Begriff der Erkenntnis: diese letzte meint nicht mehr bloß die wissenschaftliche Erkenntnis, wie es bei Kant und den Neukantianern der Fall war; vielmehr wird sie zum „Inbegriff aller Erkenntnisse“, indem sie – wenigstens in der Absicht Benjamins – die Grenze des bloßen wissenschaftlichen Begriffes der Erkenntnis überwindet und erneut auf eine Totalität hinweist, die einerseits ein asymptotisches Prinzip ist, andererseits aber auf eine unmittelbare Wahrnehmung verweist. Benjamin beginnt also mit den Kantischen und Neukantischen Begriffen – der Erkenntnis und der Erfahrung – jedoch kehrt er deren ursprünglichen Bedeutung um. „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ verweisen beide auf eine Totalität und ideelle Einheit. Bewahrt Benjamin einerseits das Prinzip der unendlichen Verfahren - d.h. der Aufgabe - in Annährung zu dieser Totalität, taucht aber andererseits bereits in den jugendlichen Schriften die Möglichkeit einer unmittelbaren Wahrnehmung dieser Totalität auf. Die Ambivalenz, die diesen beiden Begriffen zugrunde liegt, hängt meiner Meinung nach von der Zweideutigkeit des Benjaminschen Begriffes der „Idee“ ab, um welchen sich die „Erkenntnis“ und die „Erfahrung“ drehen. Die Idee präsentiert sich im Denken Benjamins in der Bedeutung des „regulativen Ideals“. Bereits in den jugendlichen Schriften und 2 Fragmenten wird die Idee als Führer und Aufgabe des erkenntnistheoretischen Verfahrens des Philosophen übernommen. Wie bei Kant ist die Idee bei Benjamin eine Einheit, die niemals gegeben wird, sondern als regulative – und deshalb logische – Einheit der Erkenntnis fungiert. Zugleich erwirbt aber die Idee die Bedeutung der Wahrheit und des Ursprungs in einem ontologischen Sinne. Die Idee, die ontologisch anders als das Phänomen ist, gründet das Phänomen selbst, indem sie es in einer originären Beziehung bestimmt. Mit anderen Worten, die Ambivalenz, vor der man den Eindruck hat zu stehen, ist, dass die Idee nicht nur im Kantischen Sinne ein Ideal ist, an dem das Denken sich orientieren soll, sondern auch der Terminus der ontologischen Beziehung, die das Phänomen konstituiert. Die phänomenale Welt, d.h. die Welt des Scheins, ist die Manifestation der Idee, die sich - selbst wenn sie jenseits der empirischen Realität bleibt – in dem Phänomen verkörpert. D.h. sie tritt in die ontologische Konstitution des Phänomens ein. Das ist aber nicht alles. Ist die Idee einerseits – konsequent im Sinne der Marburger Schule – eine „unendliche Aufgabe“, die eine progressive aber niemals vollendete Annährung zu ihr impliziert (nach dem berühmten Satz Hermann Cohens1, nach dem die größte Gabe, die je dem Menschen gegeben wurde, nicht die Wahrheit selbst ist, sondern die unendliche Suche nach der Wahrheit), manifestiert Benjamin andererseits das Bedürfnis eines unmittelbaren Ansatzes zu der Idee, der sich in den Begriffen der „Betrachtung“, der „Darstellung“ und der Wahrnehmung“ konkretisiert. Die Wahrheit, oder die Idee – da die beiden Begriffe nicht von dem Autor zu unterschieden werden scheinen –, findet ihr Zugangsorgan: nämlich die Wahrnehmung. Wir haben also mit einer nichtwissenschaftlichen Wahrheit zu tun, zu der man etwa durch Zufall oder mittels einer „Illumination“, allerdings ohne die Anwendung jeglicher etablierten Methode, gelangt. Diese „Inkongruenz“ – oder Korrelation zweier gegensätzlicher Gedanken über die Wahrheit – manifestiert sich bereits in der Programmschrift und in den jugendlichen Fragmenten, in denen z.B. die Wahrheit nicht als „systematisch“, sondern als künstlerisch bezeichnet wird. Der „Doppelbegriff“ der Wahrheit hat mich dazu gebracht, der Hypothese einer anderen Quelle nachzugehen, welche Benjamin für die Konstruktion seiner Erkenntnistheorie inspiriert hat: die Lektüre Goethes. Freilich – wie ein Teil der Sekundärliteratur feststellt – wurde Benjamin in einem gewissen Masse von den mystischen Theorien des Judentums beeinflusst (die er durch seinen Freund Gershom Scholem kennen gelernt hatte). Meiner Meinung nach ist aber eben durch die Lektüre Goethes – dessen Begriff des Urphänomens wichtig ist, um den der Idee bei Benjamin zu begreifen – zu erklären, dass Benjamin 1 Vgl. HERMANN COHEN, Ethik des reinen Willens, Hildesheim- New York 1981, I Kap. 3 schließlich dazu gelangt, den Begriff der unmittelbaren und wahrgenommenen Wahrheit zu thematisieren. Die scheinbare Duplizität der Idee wird also das Hauptthema, an dem ich die vorliegende Arbeit orientieren werde: bleibt diese Zweideutigkeit in den späteren Schriften Benjamins erhalten? Welche Bedeutung hat sie letztlich? Meine Auslegungshypothese ist, dass diese Ambivalenz tatsächlich existiert. Jedoch ist sie nur scheinbar eine Ambivalenz. In der Entwicklung dieses Problems spielt der Begriff des „Lesens“ eine grundsätzliche Rolle. Die Aussage Benjamins, – welche auch der Titel eines früheren Fragmentes ist –, „Wahrnehmung ist Lesen“ ist die Spur gewesen, die mich dazu gebracht hat diese Ambivalenz der Idee zu beleuchten. Eben diese Ambivalenz erweist sich als der theoretische Kern der Philosophie Benjamins und verweist bedeutungsvoll auf jene zwischen der Idee und dem Phänomen bestehende „Grenze“, die problematisch war. Der Satz „Wahrnehmung ist Lesen“ - wo sich der Begriff der Wahrnehmung auf die unmittelbare Wahrnehmung der Idee bezieht – hat mich eben zu der Hypothese geführt, welche meine Arbeit beweisen will: die Idee, die in Ursprung des deutschen Trauerspiels bedeutungsvoll als „Bild“ definiert wird, ist die Auslegendenstruktur der phänomenalen Welt. Und das Lesen – welches die Wahrnehmung der Idee mit sich bringt – ist das unendliche und immer für neue Entwicklungen offene Verfahren dieser Interpretation. Dies bedeutet, dass die Unmittelbarkeit der Wahrnehmung und die Idealität der unendlichen Aufgabe nicht einen Widerspruch in der Philosophie Benjamins bilden, sondern vielmehr deren Originalität bestimmen. Die dialektische Bewegung zwischen dem Phänomen und der Idee ist die „Grenze“, auf welche sich die Philosophie bewegt und arbeitet. Von dem Phänomen geht man aus, um es im Licht der Idee zu analysieren und zu lesen; von dieser steigt man in die phänomenale Welt hinab. Diese Bewegung, die meiner Meinung nach der Leseschlüssel des Benjaminschen Denkens ist, verweist auf einen anderen bekannten Begriff Benjamins: die „Rettung der Phänomene“, welchen Benjamin in dem Trauerspielbuch einführt und der auch in seinen späteren Schriften vorkommt. Die gleiche unendliche Bewegung, die das Verfahren des Lesens (als Auslegungsaktivität) charakterisiert, ist – in einer radikalen Weise – in den Begriff der „Rettung der Phänomene“ anwesend. Ein solcher Begriff hat Anlass zu „theologischen“ Interpretationen der Schriften Benjamins gegeben. Die letzten beiden Kapitel dieser Arbeit sind diesem Begriff gewidmet: sie beabsichtigen zu zeigen, dass dieser, selbst wenn er ein religiöses Fundament hat und selbst wenn er auf dem jüdischen Begriff der Erlösung hinweist, in dem Denken Benjamins zunächst eine operative Aufgabe ist. Die Rettung der Phänomene hat bei Benjamin also zuerst eine methodisch-intellektuelle 4 Bedeutung, die zu der eschatologischen zurückführt, indem die erste die letzte antizipiert. Mit dem Begriff der τά φαινόµενα σώζειν - (eben „Rettung der Phänomene“) – theoretisiert Benjamin das, was ich als die „Methode“ seiner Philosophie definieren will. Die Rettung, als intellektuelle Rettung ist für Benjamin die Aufgabe des Intellektuellen, welche in dem Zitat von Karl Kraus’, das als Epigraph anfangs der vierzehnten These über die Geschichte erscheint, synthetisiert ist: „Ursprung ist das Ziel“. Die Aufgabe der Philosophie besteht also darin, unendlich von dem Phänomen zu der Idee hinaufzusteigen, die zugleich das Ziel und der Ausgangspunkt des Denkens ist. Dies bedeutet, dass die Aufgabe – d.h. das Ziel der Philosophie – darin besteht, die ursprüngliche Bedeutung des Phänomens zu finden. Wir werden also die Stellen zutage bringen, in denen Benjamin die Methode der Rettung thematisiert und jene Stellen, in denen er sie anwendet. Die Methode der intellektuellen Rettung hat aber auch eine weitere Bedeutung, die ich als moralisch bezeichnen möchte. In dem letzten Kapitel dieser Forschung wird durch die Analyse des Essays Goethes Wahlverwandtschaften gezeigt, in welchem Sinne es möglich ist, dass in der Philosophie Benjamin von einem ethischen Denken die Rede sein kann. Mein Vorhaben ist es zu beweisen, dass wenn einerseits die Erlösung eine religiöse Bedeutung hat, welche eine eschatologische Ethik gründet, andererseits der Begriff der Erlösung auf eine Aussöhnung zwischen der Idee und dem Menschen hinweist, die aber eine „Ethik der Hoffnung“ gründet. Diese letzte ist also das moralische Streben des Phänomens, um seinen Ursprung in der Idee zu anerkennen und an dieser letzten orientiert zu handeln. Die Aktualität der Philosophie Walter Benjamins, die in den letzten Jahren zugenommen hat, ist vor allem auf die Originalität zurückzuführen, mit der er die Ränder der technischen Gesellschaft und deren Entstellungen beschrieben hat. Die Moderne – und deren existentielles Synonym: der Mythos – ist die historische (sowohl theoretische als auch moralische) Situation der Verblendung der Idee. D.h. die Idee in dem Phänomen zu erblicken, – und das eben ist, was in der Welt der Moderne eben immer schwieriger wird –, ermöglicht das Phänomen emporzuheben und es vor dem bloßen Schein, zu dem es als Phänomen verurteilt ist, zu retten. Das gleiche Prinzip gilt auch in der Moral: das Phänomen soll zu der Idee emporgehoben werden, um somit einen Sinn und einen moralischen Wert zu erwerben. Es darf also nicht von menschlichem Leben die Rede sein, sondern nur von natürlichem Leben, wenn dem Menschlichen die von der Idee gegebene ethische Bedeutung fehlt: Eine Person wird eben zu einer solchen, wenn sie sich zur Idee der Menschlichkeit und zu dem, was diese impliziert – d.h. die Verantwortung und die Wahl – erhebt. Die Rettung des 5 Phänomens wird also in der Benjaminschen Ethik nicht nur die Aufgabe des Intellektuellen, sondern jedes Menschen. Impliziert die Erlösung eine völlige und radikale Befreiung von dem Schein, ist jedoch die Versöhnung (also die intellektuelle und menschliche Erlösung), als Möglichkeit die Idee in dem Schein zu anerkennen, nur das Symbol der eigentlichen Erlösung. Sie ist also deren Antizipierung. Wir können noch sagen, dass, wenn die Hoffnung der Erlösung ein Streben zu der vollendeten Resolution des Phänomens in der Idee ist, eine solche Hoffnung nur denjenigen zu eigen sein kann, denen der ontologische Unterschied zwischen der Idee und der phänomenalen Realität bewusst ist. Also denjenigen, die dazu gelangen, die Realität als eine bloße Manifestation der Idee zu sehen. Dann taucht erneut das folgende Problem auf: wem manifestiert sich die Idee? Und wie? Diesbezüglich erweist sich das Denken Benjamins als elitär. Die Möglichkeit, die Idee im Zeitalter ihrer Verblendung wahrzunehmen, sieht Benjamin nämlich für einen begrenzten Kreis – der als „komplementäre Welt“ bezeichnet wird – von Intellektuellen und Künstler vor, die eben die einzigen sind, die noch imstande sind die Idee in ihren mittlerweile vagen phänomenalen Manifestationen wahrzunehmen. Im Laufe der Arbeit beabsichtige ich, über die Benjaminschen Konzeption der „Zeit“ nachzudenken, in welcher der Begriff des „Jetzt“ zwar von zentraler Bedeutung ist, wie auch in der Sekundärliteratur immer wieder betont wird. Denn es kreisen auch noch zwei Elemente um ihn herum, die ebenso grundsätzlich zum Begreifen der Benjaminschen Temporalität sind: die Vergangenheit, in ihrer besonderen Form des „Gewesenen“, und die Zukunft, in ihrer besonderen Form des „Wartens“. Das alles hat, wie wir sehen werden, eine sehr deutliche jüdische Herkunft. Die Zeit der Idee verweist auf die Dialektik des Begriffes der Rettung, erneut in der Formel „Ursprung ist das Ziel“ ausgedrückt. Dieser Ausdruck zeigt nämlich eine zeitliche und zugleich ideelle Zirkularität: die „Vergangenheit“ des Ursprungs ist auch die „Zukunft“ des Zieles. Die Vergangenheit ist nicht die bereits gestorbene und vergessene Vergangenheit, sondern sie erwirbt die ideale Bedeutung einer Vergangenheit, die wiederaktualisiert werden kann (und muss): d.h. vor dem Vergessenen gerettet. Zugleich ist die Zukunft nicht die künftige kommende Zeit, sondern sie ist die unendliche Bewegung der Rettung des Phänomens, das wieder zur Idee geführt wird. Das Benjaminsche Gewesene ist bedeutungsvoll mit dem Begriff des „Eingedenkens“ verbunden, d.h. mit einem aktiven Erinnern, das die vergangene Zeit wiedererleben will. Die Zukunft ist mit dem Begriff der Hoffnung verbunden, der die ständige Spannung des Phänomens zur Idee ausdrückt. Der Begriff der Zeit bringt uns außerdem dazu zu beweisen, inwiefern die Rettung auch eine existentielle Bedeutung hat. Die bekannte Figur des Benjaminschen Engels, der in 6 die Zukunft aufbricht, dessen Blick aber melancholisch der Vergangenheit starrt, als ob er sie mit ihm in seiner Reise Richtung Zukunft mitnehmen wollte, ist etwa das Symbol dieser existentiellen Rettung. Der „Heimweg“, auf dem sich die Hoffnung des Engels konzentriert, ist der metaphorische Ausdruck des existentiellen Bedürfnisses der Möglichkeit, die Vergangenheit wiederzuerlangen, da für Benjamin die Vergänglichkeit des Menschen die Unmöglichkeit, die vergangene Zeit wiederzuleben, ausdrückt. Nur die Rettung, im eschatologischen Sinne verstanden, rettet die Menschheit für immer vor der Grenze ihrer Endlichkeit und vor dem, was ewig vergeht. Dennoch ist die intellektuelle Rettung bloß das Symbol des eschatologischen Endes, und außerdem deren Antizipierung. Die Erlösung zu antizipieren bedeutet, sowohl die existentielle Möglichkeit in den dem Menschen gestatteten Grenzen - d.h. durch die Erinnerung - zur Vergangenheit zurückzukehren als auch die (ethische und theoretische) Möglichkeit einen neuen Begriff der Geschichte (anders als der der Tradition) zu erschaffen, aber auch die existentielle Möglichkeit in der Erinnerung die bereits erlebte Vergangenheit wiederzuerlangen. Die intellektuelle Erlösung ermöglicht also dem Menschen nicht nur die Hoffnung auf ein neues historisches Gedächtnis, sondern auch die Hoffnung auf ein existentielles Gedächtnis zu haben. 7 ERSTES KAPITEL ERFAHRUNG UND ERKENNTNIS 1. Wissenschaftliche Erfahrung und unmittelbare Erfahrung Ich möchte meine Arbeit mit einer Analyse der Begriffe „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ innerhalb des Fragmentes 19, Über die Wahrnehmung, der Gesammelte Schriften anfangen. Benjamin hat gegen 1917 das Fragment geschrieben, das von den Herausgebern der Werke Benjamins als Vorstudium1 der berühmten Schrift Über das Programm der kommenden Philosophie aus dem Jahr 1917 betrachtet wird. Zunächst muss man den Titel beachten: „Über die Wahrnehmung“. Es ist nämlich interessant, dass Benjamin das Fragment bezüglich der Wahrnehmung betitelt, während seinem Inhalt nach – der sich völlig um die Begriffe der Erfahrung und der Erkenntnis dreht – die Wahrnehmung nur am Ende des Textes erwähnt wird. Es ist aber wichtig sich daran zu erinnern, dass dieses Fragment von Benjamin nicht zur Veröffentlichung gedacht wurde, genauso wenig wie die folgende und kompliziertere Programmschrift. Das erklärt die häufige Inkonsequenz Benjamins bei der Analyse der Begriffe und den Mangel an Definitionen derselben, die die Begegnung mit dem Text extrem schwierig machen. Man erinnert oft daran, dass das Fragment 19 zu der Reihe der Kantischen und Neukantischen Studien gehört, die Benjamin von 1917 an begann. Er hatte nämlich die Absicht, als Promotionsarbeit ein Projekt über Kant und Cohen zu schreiben, die als Hauptthema den Begriff „unendliche Aufgabe“ haben sollte. Daher war Benjamin in den Jahren 1917 und 1920 – wie vor allem der Briefwechsel mit Scholem beweist - mit einer gründlichen Untersuchung dieser Autoren und besonders ihrer Erkenntnistheorie beschäftigt. 1 Vgl. GS VI 657. 8 Aber inwiefern ist Benjamin in seinen Reflexionen über die Begriffe „Erfahrung“ und „Erkenntnis“ tatsächlich Kant und Cohen gefolgt? Das Fragment Über die Wahrnehmung fängt mit einer Auseinandersetzung des Autors mit den Kantischen Begriffen „Erfahrung“ und „Erkenntnis“ an, ohne aber dass diese Begriffe deutlich bezeichnet werden. Benjamin schreibt, dass Kant der erste Philosoph war, der eine Trennung zwischen Erfahrung und Erkenntnis der Erfahrung macht, wobei man unter Erkenntnis die apriorische Naturerkenntnis versteht, die Kant „Metaphysik der Natur“ nennt: mit „Metaphysik“ meint Kant also eine reine und apriorische Erkenntnis der Konstitution der Naturdinge, die direkt und nur aus dem Verstand hervorgeht, während die „Materie der Empfindung“ das aposteriorische Element darstellt, das als Materie für die Konstruktion der Erfahrung dient. So macht Kant, laut Benjamin, eine Trennung zwischen Erfahrung und Erkenntnis der Erfahrung, da die erste aposteriorische Elemente enthält, die zweite hingegen rein ist und ausschließlich aus dem Verstand herausgeht. Darüber hinaus gibt es noch einen wichtigen Punkt, den Benjamin in dem Fragment hervorhebt, nämlich: der Begriff, mit dem sich Kant und die Aufklärer beschäftigten, ist ein leerer Begriff, gottlos2. Er hat nämlich die ursprüngliche Fülle verloren, die er bei den vorkantischen Philosophen hatte. Auch in diesem Fall erklärt und vertieft Benjamin den Begriff der „gottlosen Erfahrung“ nicht, sondern er bezeichnet ihn sozusagen negativ, indem er ihn auf den Begriff der Erfahrung, der der Aufklärung eigen ist, bezieht und entgegensetzt: die einzige Erfahrung, die für die Aufklärung Wert hatte und sich von daher zu betrachten und zu ergründen gelohnt hat, ist diejenige (Erfahrung), die mit der Erfahrung zusammenfällt, die Objekt der Wissenschaften ist. Der Begriff der Erfahrung, den Kant in Erwägung zieht, ist also ein reduzierter Begriff, weil er eben bloß demjenigen der wissenschaftlichen Erfahrung entspricht. Mit anderen Worten, nach Benjamins Ansicht muss, von der Aufklärung her und insbesondere von Kant her die Erfahrung, die zu ergründen und zu rechtfertigen ist, die mechanische sein, die Objekt der Wissenschaft ist und eben nicht die ganze Erfahrung in ihrer Fülle und Vielfältigkeit. Die Schlussfolgerungen, die Benjamin im Fragment 19 zieht, sind also die Folgenden: der Kantische Begriff der Erfahrung ist ein reduzierter Begriff, weil er dem Gegenstand der Wissenschaft entspricht. Darüber hinaus unterscheidet er sich nicht genug von der Erkenntnis der Erfahrung selbst: die Erfahrung als Gegenstand der wissenschaftlichen Erkenntnis ist eben nicht mehr etwas außerhalb der letzteren und doch nicht mehr etwas Neues für sie: 2 Vgl. GS VI 36. 9 „Für den Begriff der Erkenntnis ist nämlich die Erfahrung nichts außer ihr liegendes Neues, sonder nur sie selbst in einer anderen Form, die Erfahrung als Gegenstand der Erkenntnis ist die Einheitliche und Kontinuierliche Mannifaltigkeit der Erkenntnis. Die Erfahrung selbst kommt, so paradox dies klingt, in der Erkenntnis der Erfahrung gar nicht vor, eben weil diese Erkenntnis der Erfahrung, mithin ein Erkenntniszusammenhang ist“3. Benjamin beschreibt die Beziehung zwischen Erfahrung und Erkenntnis mit einer Metapher: „Die Erfahrung selbst ist das Symbol dieses Erkenntniszusammenhanges und steht mithin in einer völlig anderen Ordnung als dieser selbst. Vielleicht ist der Ausdruck Symbol sehr unglücklich gewählt, er soll lediglich die Verschiedenheit der Ordnungen ausdrücken die vielleicht auch in einem Bilde zu erklären ist: Wenn ein Maler vor einer Landschaft sitzt und sie wie wir zu sagen pflegen abmalt, so kommt diese Landschaft selbst auf seinem Bilde nicht vor; man könnte sie höchstens als Symbol seines künstlerischen Zusammenhanges bezeichnen und freilich würde man ihr damit eine höhere Dignität als dem Bilde zusprechen, und auch gerade das würde sich rechfertigen lassen“4 . Wenn Kant und die Aufklärung den Anstoß zu einer Verwirrung zwischen „Erfahrung“ und „Erkenntnis der Erfahrung“ gegeben haben, bemüht sich Benjamin dennoch – ich wiederhole, indem er eine Theorie entwirft, ohne aber deren Schlussfolgerungen zu rechtfertigen – zwischen „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ zu unterscheiden, indem er als Beweis dazu die Tatsache nutzt, dass die Erfahrung, die sich als Symbol in der Erkenntnis offenbart, also eben nicht die wissenschaftliche Erfahrung ist, sondern die unmittelbare und natürliche Erfahrung5 - anders als die wissenschaftliche und ursprünglicher, da letztere bloß eine Ableitung, eine Reduktion davon ist. Von dieser unmittelbaren und natürlichen Erfahrung, schreibt Benjamin, entfernt man sich im Laufe der Geschichte der Philosophie. Was meint nun Benjamin mit der „unmittelbaren und natürlichen“ Erfahrung? Wieso wird sie als „Symbol“ bezeichnet? Am Ende des Fragments schreibt Benjamin: „Philosophie ist Absolute Erfahrung deduziert im systematisch symbolischen Zusammenhang als Sprache. Die absolute Erfahrung ist, für die Anschauung der Philosophie, Sprache; Sprache jedoch als symbolischsystematischer Begriff verstanden. Sie spezifiziert sich in Spracharten, deren eine die Wahrnehmung ist; die Lehren über die Wahrnehmung sowie über 3 GSVI 36. GSVI 36f. 5 „Es ist nämlich der unmittelbare und natürliche Begriff der Erfahrung zu unterschieden von dem Erfahrungsbegriff des Erkenntniszusammenhanges“ (GSVI 36). 4 10 alle unmittelbaren Erscheinungen der absoluten Erfahrung gehören in die Philosophischen Wissenschaftlichen im weiteren Sinne. Die ganze Philosophie mit Einschluss der philosophischen Wissenschaften ist Lehre“6. Benjamin endet also das Fragment, indem er die ursprüngliche Erfahrung als absolute Erfahrung bezeichnet. Er fügt hinzu, dass sie Sprache ist, als systematisch–symbolischer Zusammenhang gemeint; gleichzeitig ist aber der ursprünglichere Begriff der Erfahrung, an den Benjamin denkt, und der sich von dem Begriff der Aufklärung unterscheidet und insbesondere von dem Kantischen der Erfahrung, eine unmittelbare Erfahrung. Sehen wir uns hier mit einer Zweideutigkeit konfrontiert? Wie ist es möglich, dass die absolute Erfahrung ein systematischer Zusammenhang ist und gleichzeitig eine unmittelbare Erfahrung? Es ist außerdem zu bemerken, dass in der Definition der absoluten Erfahrung der Begriff „Wahrnehmung“ eingeführt wird, und dass die Wahrnehmung eine Sprachart ist. Was meint nun Benjamin mit Wahrnehmung? In welchen Sinn ist die Wahrnehmung eine Sprachart? In welchen Sinn kann also die Erfahrung Wahrnehmung sein und als solche Sprachart? 2. Die Beziehung Erkenntnis - Erfahrung und der Untergang des Subjektes Sehen wir für den Moment von der oben gestellten Frage über die Beziehung zwischen dem Begriff der Erfahrung und dem der Wahrnehmung ab, um das Verfahren des Gedankenganges Benjamins in dem Passage vom Fragment 19 zu der Programmschrift zu verfolgen7. Auch, und vor allem, in diesem Text, setzt sich Benjamin mit Kant und teilweise mit Cohen bezüglich der Begriffe „Erfahrung“ und „Erkenntnis“ auseinander, und auch in diesem Text finden wir die selben begrifflichen Zweideutigkeiten des oben betrachteten Fragments wieder. Wie ich schon oben gesagt habe, ist es zunächst wichtig die Aufmerksamkeit Benjamins – seit den frühen Schriften– für diese beiden Begriffe, die – man könnte sagen – einen Doppelbegriff formen, zu unterstreichen: insbesondere in der Programmschrift bezieht Benjamin sie aufeinander und er betont, dass, wenn sich die Bedeutung des einen Elementes des Doppelbegriffes ändert, sich auch die des zweiten ändert. Dann werde ich ein zweites 6 GS VI 38. Dieser Text reicht November 1917 zurück und wird eine Entwicklung des Fragments 19 betrachtet (vgl. Fußnote 1). 7 11 Problem betrachten, das mit der Erkenntnistheorie verbunden ist, und zwar Benjamins Absicht einen neuen Begriff der Erkenntnis zu erfinden, der aber nicht in der traditionellen Beziehung Subjekt – Objekt gegründet wird. Also werde ich versuchen, diese beiden Themen – die in der Tat untrennbar sind – die von der Auseinandersetzung Benjamins mit Kant und mit dem Neukantianismus herrühren, zu beleuchten. 2.1 Erkenntnis und Erfahrung: die Termini eines Doppelbegriffes Benjamin schreibt am Anfang der Programmschrift, dass Kant der erste und der einzige Philosoph nach Platon war, für den die wichtigste Aufgabe der Philosophie in der Rechtfertigung der Erkenntnis bestand, und der erste Philosoph, der die Existenz einer engen Beziehung zwischen den Begriffen „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ behauptet. Kant wollte die Realität finden, deren Erkenntnis begründet sein und gewiss werden sollte: einerseits also galt sein Interesse der Gewissheit der zeitlosen Erkenntnis, andererseits der zeitlichen und kontingenten Erfahrung8. Es war ihnen aber nicht klar – schreibt Benjamin weiter – weder Kant noch den Philosophen der Aufklärung, dass der Begriff der „Erfahrung“, den es zu gründen galt, in Wirklichkeit die singuläre, zeitliche und primitive Erfahrung war9. Nun, während Benjamin im Fragment 19 schreibt, dass der Begriff der „Erfahrung“ bei Kant leer war, weil er auf jenen der wissenschaftlichen Erfahrung reduziert war, behauptet Benjamin jedoch in der Programmschrift, dass, obwohl der Begriff der „Erfahrung“ von Kant in Bezug auf die wissenschaftliche Erfahrung formuliert wird, in ihm eine Bindung mit dem Begriff der primitiven Erfahrung, d.h. kontingent und singulär, bleibt, der nicht mit dem reinen Bewusstsein, sondern mit dem empirischen verbunden ist. Kants Verdienst, schreibt Benjamin, war ja eben, dass er „die Frage nach der Dignität einer Erfahrung die vergänglich war“10 stellte. Trotzdem wird, während im Fragment 19 die als „natürliche und unmittelbare“ bezeichnete Erfahrung als ursprüngliche und demzufolge gottvoll – und von ihr entfernt man sich allmählich in der Geschichte der Philosophie – betrachtet wird, in der Programmschrift genau diese zeitliche, singuläre und begrenzte 8 Vgl. GS II/1 158. Vgl. Ibidem. 10 Ibidem. 9 12 Erfahrung ein Wert, der „sich der Null näherte“11. Ändert sich also die Ansicht Benjamins über die Bedeutung der natürlichen Erfahrung, die sich in der Programmschrift genauso leer wie die der wissenschaftlichen Erfahrung gibt? Wie werden darüber hinaus die Begriffe „Erfahrung“ und „Erkenntnis“ verbunden? Benjamin schreibt: „Es ist von der höchste Wichtigkeit für die kommende Philosophie, zu Erkennen und zu sondern welche Elemente des Kantischen Denkens angenommen und gepflegt, welche umgebildet und welche verworfen werden müssen [...]. Und das eben soll zum Thema der zu erwanderten Philosophie gemacht werden, dass eine gewisse Typik im Kantischen System aufzuzeigen und klar aufzuheben ist die höhern Erfahrung gerecht zu werden vermag [...]. Allein nicht nur von der Seite der Erfahrung und Metaphysik muss der künftigen Philosophie die Revision Kants angelegen sein. Und methodisch, d.h. als eigentliche Philosophie überhaupt nicht von dieser Seite sondern von Seiten des Erkenntnisbegriffes her. Die entscheidenden Irrtümer der Kantischen Erkenntnislehre sind wie nicht zu bezweifeln ist auch auf die Hohlheit der ihm gegenwärtigen Erfahrung zurückzuführen, und so wird auch die Doppelaufgabe der Schaffung eines neuen Erkenntnisbegriffes und einer neuen Vorstellung von der Welt auf dem Boden der Philosophie zu einer einziger werden“12. Die Kantische Philosophie, oder besser, die Kantische Erkenntnistheorie, ist also, laut Benjamin, der Ausgangspunkt, von dem man anfangen muss, um nicht nur einen neuen Begriff „Erfahrung“ zu formulieren, sondern gleichzeitig einen neuen Begriff „Erfahrung“, welche tief und metaphysisch13 sei: die beiden Begriffe sind nämlich aufeinander bezogen, so dass, wenn sich der Sinn des ersten Terminus ändert, ändert sich auch jener des zweiten. Laut Benjamin ist es Kants Verdienst, (als erster) die Verbindung von Erkenntnis mit der Erfahrung erkannt zu haben, und als erster behauptet zu haben, dass sich die Philosophie darauf gründet, dass „in der Struktur der Erkenntnis die der Erfahrung liegt und aus ihr zu entfalten ist“14. Kant hat aber die Erfahrung nur als Faktum betrachtet, von dem man anfangen muss, eine reine Erkenntnistheorie zu theoretisieren, die Rechenschaft über dasselbe Faktum geben könnte. Benjamin vertritt jedoch eine richtige gegenseitige Abhängigkeit zwischen den Begriffen „Erfahrung“ und „Erkenntnis“. Die Philosophie gründet sich nämlich nicht nur auf die Voraussetzung, dass die Struktur der Erkenntnis auch die der Erfahrung enthält und dass 11 GS II/1 159. GS II/1 160. 13 Vgl. GS II/1 160, 163. 14 GS II/1 163. 12 13 die erste aus der zweite abgeleitet werden könnte, sondern dass eben die Bedingungen der Erkenntnis die selben der Erfahrung seien. Mit anderen Worten, bei dem Benjamin der Programmschrift existiert nicht – wie aber bei Kant – eine richtige Begründung der Erfahrung in der Erkenntnis, weil der Leser der Programmschrift den Eindruck hat, dass diese beiden Begriffe – ich wiederhole: vom Autor nicht deutlich genug in ihrer Beziehung zueinander geklärt – in einer Korrelation zueinander und in einem zu wenig klaren gegenseitigen Verhältnis stehen. Diese Korrelation, die Benjamin aber nicht vertieft, wird eben als die theoretische Voraussetzung der künftigen Philosophie bezeichnet und betrachtet, und in diesem Sinn ist es daher möglich, dass bezüglich der Begriffe „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ von einen Doppelbegriff die Rede ist. Die künftige Philosophie hat also als Aufgabe die Begründung eines höheren Begriffes „Erfahrung“, eines metaphysischen Begriffes „Erfahrung“, der seine Rechenschaft in einem ebenso höheren Begriff „Erkenntnis“ findet, der – wie Benjamin schreibt – der logische Ort15 der Möglichkeit der Metaphysik sei; eine gegenseitige Begründung zwischen Erkenntnis und Erfahrung berücksichtigend. Um das alles zu verwirklichen, ist es aber Benjamin nach notwendig, die beiden Begriffe von ihrem traditionellen Bindung zu lösen. 2.2 Der Untergang des Subjektes Ich lasse mich nun auf das zweite Problem ein, das die Programmschrift stellt: die Überwindung des Subjektes; ein Thema, mit dem ich mich in diesem Paragraph nur kurz auseinander setze, weil es in dem frühen Fragment enthalten und thematisiert ist, aber noch nicht richtig von Benjamin entwickelt wird. Die Anwesenheit dieser Problematik in der Programmschrift, selbst wenn nur angedeutet, ist eine Bestätigung ihrer Zentralität schon in dem Denken des jungen Benjamin. Sie wird trotzdem vor allem in den späteren Werken des Autors auftauchen. Selbst Adorno sieht in den verschiedenen Phasen der Philosophie Benjamins die Mühe, die Metaphysik durch die Abschaffung des Subjektes zu überwinden: „In all seinen Phasen hat Benjamin den Untergang des Subjektes und die Rettung des Menschen zusammengedacht“16. 15 16 GS II/1 161. TH. W. ADORNO, Charakteristik Walter Benjamins in Über Walter Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt 1970, S.11. 14 In der Programmschrift – viel mehr als im Fragment 19 – werden nicht so sehr die Verdienste Kants als die Lücken seines Denkens zutage gebracht, von denen Benjamin anfangen will die Kantische Philosophie zu reinigen – und damit ihre wichtigsten Aspekte aufhebend und die metaphysischen Fehler, die sie enthält, überwindend. Er nennt zwei solcher Fehler: die Konstruktion einer auf Subjekt und Objekt begründeten Erkenntnistheorie und die Beziehung von Erkenntnis und von Erfahrung mit dem empirischen Bewusstsein: „Die wichtigsten dieser Elemente sind: erstens die bei Kant trotz aller Ansätze dazu nicht endgültig überwundene Auffassung der Erkenntnis als Beziehung zwischen irgendwelchen Subjekten und Objekten oder irgendwelchem Subjekt und Objekt; zweitens: die ebenfalls nur ganz ansatzweise überwundene Beziehung der Erkenntnis und der Erfahrung auf menschlich empirisches Bewusstsein“17. Die zweite18 Aufgabe der künftigen Philosophie ist es, einen neuen Begriff „Erkenntnis“ zu finden, der aber nicht auf der metaphysischen Struktur Subjekt-Objekt begründet ist: „Es ist die Aufgabe der kommenden Erkenntnistheorie für die Sphäre totaler Neutralität in Bezug auf die Begriffe Objekt und Subjekt zu finden; mit andern Worten die Autonomie ureigne Sphäre der Erkenntnis auszumitteln in der dieser Begriff auf keine Weise mehr die Beziehung zwischen zwei metaphysischen Entitäten bezeichnet“19. Wir finden den selben Hinweis auf die Überwindung dieses metaphysischen Status der Philosophie in einem anderen Fragment – der den Herausgebern der Werke Benjamins zufolge zwischen 1920 und 1921 geschrieben wurde, also nach der Programmschrift – mit dem Titel Erkenntnistheorie. Auch in diesem Kontext schlägt Benjamin als Aufgabe der Philosophie die Überwindung in zwei Punkten vor: der erste, „Die falsche Disjunktion: Erkenntnis sei entweder im Bewusstsein eines erkennenden Subjekts oder im Gegenstand 17 GSII/1 161. Die erste, wenn eine Nummerierung möglich ist, ist, wie im vorherigem Paragraph gesagt wurde, die der Suche nach einer metaphysischen Erfahrung. 19 GSII/1 163. 18 15 (bzw. mit ihm identisch)“20; der zweite, „Der Schein eines erkennenden Menschen (z.B. Leibniz, Kant)“21. In welchem Sinne nun versteht Benjamin den Untergang des Subjektes und welche Vorschläge gibt es für die Lösung dieses traditionellen philosophischen Problems? Des weiteren schreibt er in der Programmschrift: „So lässt sich also die Aufgabe der kommenden Philosophie fassen als die Auffindung oder Schaffung desjenigen Erkenntnisbegriffes, der indem er zugleich auch den Erfahrungsbegriff ausschließlich auf das transzendentale Bewusstsein bezieht, nicht allein mechanische sondern auch religiöse Erfahrung logisch ermöglicht“22. Es fallen uns sofort zwei Sachen auf. Zunächst verbindet Benjamin im Kontext der Programmschrift das Problem der Überwindung der Erkenntnistheorie des Subjektes mit dem Begriff eines transzendentalen Bewusstseins. Zweitens muss dieses transzendentale Bewusstsein die logische Möglichkeit einer Erfahrung nicht nur mechanisch, aber auch religiös sichern. Die Lösung des Problems wird also anfangs – und scheinbar durch einen Versuch – angesetzt, um einen neuen Begriff „Erkenntnis“ zu theoretisieren, der einen neuen Begriff „Erfahrung“ ermöglicht. Ich erinnere aber daran, dass Benjamin nicht konsequent mit einem solchen Ansatz ist, weil vielmehr – wie wir oben gesehen haben – eine Reziprozität zwischen Erfahrung und Erkenntnis auftaucht, statt einer Begründung der einen durch die andere. Was sich aber klar innerhalb dieser komplizierten Schrift ergibt, ist, dass die beiden Begriffe – jener der Erkenntnis und jener der Erfahrung – von dem traditionellen Verhältnis mit dem empirischen Bewusstsein befreit werden und in dem transzendentalen Bewusstsein, d.h. absolut rein, begründet werden müssen. Sicherlich ist die Programmschrift als Programm gedacht, also als ein Vorschlag, in dem der einzuschlagende Weg für die Lösung der gestellten Problemen nur gezeigt wird, was dazu dient, die begriffliche Undeutlichkeit des Autors zu erklären. Das ist auch der Fall des transzendentalen Bewusstseins. Es könnte so scheinen, dass Benjamin als Lösung der Erkenntnistheorie des Subjektes an die Philosophie Hermann Cohens denkt, und dennoch – schreibt Benjamin – hat der Neukantische Versuch einen der metaphysischen Elemente lediglich radikalisiert, das erkennende Bewusstsein aber immer seinen Charakter des 20 GS VI 46. Ibidem. 22 GS II/1 164. 21 16 Subjektes behält, weil es analog zu dem empirischen23 ist. Gewiss haben Cohen und der Neukantianismus das Problem der Erkenntnistheorie Kants geahnt, das laut Benjamin nicht ausreichend radikal und konsequent gewesen ist. Trotzdem haben sie an der Begründung einer eben auf das Subjekt gründeten Erkenntnistheorie festgehalten, das unvermeidbar in der Form des empirischen Bewusstseins gedacht wird. Benjamin nach müssten wir nun sogar den Terminus „Bewusstsein“ abschaffen24. In welche Richtung muss man also vorgehen, um einen Begriff der Erkenntnis zu formulieren, der aber völlig von Elementen der rudimentären Metaphysik frei ist? Bemerken wir noch, dass Benjamin, in dem schon erwähnten Fragment Erkenntnistheorie, auf das ich bereits oben kurz hingewiesen habe, in einer schematischen Art eine Theorie der Erkenntnis vorschlägt, die sich in zwei Punkten entwickeln muss: „1) die Konstitution der Dinge im Jetzt der Erkennbarkeit und 2) die Einschränkung der Erkenntnis im Symbol sind die beiden Aufgaben der Erkenntnistheorie“25. Also führt Benjamin im diesen Kontext bezüglich einer positiven Definition des Begriffes „Erkenntnis“ zwei neue Elemente ein: Das Symbol, das wir schon in Bezug auf den Begriff „Erfahrung“ im Fragment Über die Wahrnehmung getroffen haben, und das Jetzt26 der Erkennbarkeit. Vor der Analyse dieser beiden Begriffe ist zunächst nötig, den in der Programmschrift von Benjamin gesuchten Begriff „Erfahrung“ zu untersuchen. 3. Eine höhere Erfahrung: die metaphysische Erfahrung Nach was für einer Art der Erfahrung sucht Benjamin? Welche Art der Erkenntnis ist in der Lage, die höhere Erfahrung zu gründen? Und noch weiter: wie beziehen sich die Begriffe der Erfahrung und der Erkenntnis aufeinander, die, wie wir vorher gesagt haben, zueinander in Korrelation zu stehen scheinen und sich gegenseitig begründen? Im Laufe der Programmschrift wird mehrere Male auf das Bedürfnis hingewiesen, eine neue Art der 23 Vgl. GS VI 161. Vgl. GS VI 162f. 25 GS VI/ 46. 26 Ich gehe davon aus, dass Benjamin in seinen Schriften keinen Unterschied zwischen den Termini „Jetzt”, „Augenblick“ und „Aufblitzen“ macht, da er sie nicht näher erläutert. Darum werde ich in diesem Kapitel nicht diese mögliche Unterscheidung berücksichtigen. 24 17 Erfahrung aufzufinden und zu rechtfertigen. Um dies zu tun, muss man notwendigerweise von einem Begriff „Erkenntnis“ ausgehen, der aber von den Aspekten der „rudimentären“ Metaphysik, die – wie Benjamin schreibt – jede andere vermeidet, befreit ist. Cohen hatte, laut Benjamin, einen Kantischen Mangel zu radikalisieren versucht, indem er die apriorischen Formen der Wahrnehmung abschaffte. So reduziert er die Erkenntnis auf das Subjekt und demzufolge den Begriff „Erfahrung“, der auf die wissenschaftliche Erfahrung reduziert und begrenzt ist, modifiziert. Der Begriff der „Erfahrung“, an den Kant denkt, war jedoch immer noch mit der primitiven und unmittelbaren Erfahrung verbunden. Oben haben wir die Frage über die zweideutige Einstellung Benjamins für diese letztere Art der Erfahrung gestellt. In der Programmschrift nämlich sucht man – bezüglich der Revision der Kantischen Philosophie– eine andere Art der Erfahrung: eben als metaphysisch bezeichnet und unterschieden sowohl von der wissenschaftlichen als auch von der primitiven Erfahrung. Versuchen wir also die Bedeutung der „metaphysischen Erfahrung“ zu vertiefen. Nur ein neuer Begriff „Erkenntnis“, schreibt Benjamin, kann der logische Ort eines neuen Begriffes „Erfahrung“, die metaphysisch ist, sein. Dieser neue Begriff der Erkenntnis muss aber von dem empirischen Bewusstsein befreit werden und muss eine kontinuierliche und einheitliche Erfahrung ermöglichen: also erstens eine nicht in den verschiedenen Objekten der Naturwissenschaften verrissene Erfahrung und zweitens eine Erfahrung, die die verschiedenen Bereiche des Denkens und der Forschung, die von der Kantischen und Neukantischen Philosophie vernachlässigt werden, umfassen kann: als erstes den Bereich der Religion. Benjamin schreibt: Diese Erfahrung umfasst denn auch die Religion, nämlich als die wahre, wobei weder Gott noch Mensch als Objekt oder Subjekt der Erfahrung ist, wohl aber diese Erfahrung auf der reinen Erkenntnis beruht als deren Inbegriff allein die Philosophie Gott denken kann und muss“27. Im Laufe der Exposition weist Benjamin bloß kurz auf die neue Funktion der Philosophie hin, die von einem neuen Begriff „Erkenntnis“ ausgehend Gott denken können muss. Es ist interessant festzustellen, dass Benjamin kurz auf die Rolle der Religion hindeutet, und er macht das im Bezug auf das Problem der Überwindung einer in dem empirischen Bewusstsein begründeten Erkenntnistheorie. Von dem her, was er in der Programmschrift schreibt, würde 27 GS II/1 163. 18 es scheinen, dass wenn nur die Erkenntnistheorie – und der ihr entsprechende Begriff „Erkenntnis“ – in der wahren Religion28 begründet wird, also wenn die reine Erkenntnis Gott als Gegenstand hat, es möglich ist, das Problem der Gnoseologie des Subjektes zu überwinden. Wenn nun Benjamin über „wahre Religion“ spricht, meint er die Möglichkeit der Philosophie, Gott zu denken: weder als Subjekt noch als Objekt des Denkens, sondern als Inbegriff der Erkenntnis29, bzw. als eine ideale Totalität, nämlich als eine Idee; wir könnten sogar sagen als die Idee der Totalität. Gegen Ende des Textes schließlich weist Benjamin kurz eben auf diese Idee hin. Schon in der Kantischen Dialektik hatte die Idee eine zentrale Rolle, da sich auf sie die Einheit der Erfahrung gründete - jetzt aber gilt für die Begründung eines höheren Begriffes „Erfahrung“ die Kontinuität und die Einheit der Erfahrung als unerbehrliche Bedingung: Diese letzte, so unterstreicht Benjamin, ist weder die vulgäre Erfahrung noch die wissenschaftliche, sondern die metaphysische Erfahrung. Die Idee wird im Rahmen der Programmschrift also dargestellt, selbst wenn nur als Andeutung, als mögliches Zentrum einer neuen Erkenntnistheorie, die darauf zielt, die traditionale Metaphysik zu überwinden und daher einen neuen Begriff „Erfahrung“ mit einer neuen metaphysischen Bedeutung zu begründen, die den Prinzipien der Einheit und der Kontinuität entspricht. Es scheint gerade die Beziehung – die es immer noch zu bestimmen gilt – zwischen dem Begriff der „Idee“ und dem der Gottheit, der – wie wir oben gesehen haben – mit einer Idee vergleichbar ist oder, um genau zu sein, mit der Idee der Totalität der Erkenntnis, interessant zu sein. Aber der „Gott“ der Programmschrift gewinnt noch eine andere Bedeutung, die Benjamin dieses Mal an dem Begriff der metaphysischen Erfahrung bindet. Mit dem Ausdruck „metaphysische Erfahrung“ muss man zunächst die Metaphysik im traditionellen Sinne ausschließen, da die Art der Metaphysik einem leeren und rudimentären Begriff, der überwunden werden muss, entspricht. Wenn also Benjamin in der Programmschrift über Metaphysik - sie auf die Erfahrung beziehend - redet, hat er folglich die Ansicht, diesen Begriff zu erneuen, genauso wie er die Begriffe „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ zu erneuen meint. Die metaphysische Erfahrung ist, wenigstens in der Programmschrift, die kontinuierliche und einheitliche Erfahrung: „Erfahrung ist die einheitliche und kontinuierliche Mannigfaltigkeit der Erkenntnis“30. Eine solche Erfahrung wird aber auch als eine „konkrete Totalität der Erfahrung“ definiert, die von der Erkenntnis niemals erreicht werden kann; und 28 GS II/1 163. Vgl. GS II/1 168. 30 Ibidem. 29 19 doch, schreibt Benjamin, existiert eine Form der einheitlicher Erfahrung, die erreichbar ist und auf die sich die Erkenntnis richten kann: diese ist die religiöse Erfahrung. Also könnte man vorläufig abschließen, dass der gesuchte Begriff „Erfahrung“, die höhere und metaphysische Erfahrung, eine Totalität, eine nie erreichbare Einheit ist, die Religion jedoch eine Form jener Erfahrung darstellt, zu der die Erkenntnis irgendwie einen Zugang hat. Genau wie in dem Fall des Inbegriffes der Erkenntnis, ist die Totalität der Erfahrung auf die Religion bezogen und auf deren höheren Begriff: Gott. 4. Die konkrete Totalität der Erfahrung: Was nie geschrieben wurde Nun kehren wir zu den Fragen und zu den Problemen, die in den vorangegangenen Seiten gestellt worden sind, zurück. Zunächst haben wir gesehen, dass Benjamin den Begriff der Erfahrung in der Programmschrift und im Fragment 19 anders zu behandeln scheint. Wir haben gesagt, dass während im Fragment 19 die zu suchende Erfahrung, auf welche sich die Philosophie beziehen muss, die „natürliche und unmittelbare“ ist, die in der Erkenntnis als Symbol vorkommt; in der Programmschrift ist sie jedoch die metaphysische Erfahrung, die sich sowohl von der primitiven und natürliche Erfahrung als auch von der bloß wissenschaftlichen unterscheidet. Aber nur scheinbar widerspricht sich Benjamin. Der Begriff der „Erfahrung“ des Fragments 19 entspricht nämlich nicht der - sozusagen - vulgären Erfahrung; sie ist also nicht die primitive Erfahrung, die ein jeder in dem alltäglichen Leben macht. Vielmehr scheint Benjamin an einen Begriff, der einer Idee entspricht, oder besser, an ein Ideal, zu denken. Oben haben wir gesehen, dass Benjamin durch eine Metapher erklärt, dass sich die Erfahrung auf deren Erkenntnis als Symbol bezieht: sie ist nämlich bloß als Symbol innerhalb der Erkenntnis der Erfahrung zu denken. Darüber hinaus wird uns gesagt, dass ursprünglich der Begriff dessen was Erfahrung genannt wird, d.h. „das Symbol der Erkenntniseinheit“, höher und „gottvoll“ war. Aus dieser Fülle wird die von der Aufklärung eingeführte Erfahrung dann entbehrt. Schließlich ist jene ursprüngliche Erfahrung, die Symbol ist und „gottvoll“ ist, auch irgendwie mit der Wahrnehmung verbunden. Das Wort „Wahrnehmung“, das, ich erinnere daran, der Titel des Fragmentes ist, erscheint als Begriff aber nur am Ende desselben, 20 eben in Bezug auf die Definition eines höheren Begriffes „Erfahrung“. Genauso wie die natürliche und unmittelbare Erfahrung dem Begriff der vulgären Erfahrung nicht entspricht, sondern einem höheren, so dass, wenn Benjamin von Wahr-Nehmen spricht, er sich nicht auf die Wahrnehmung im allgemeinen Sinne bezieht, sondern auf eine höhere Art das Wahr(e) zu begreifen. Die drei Fragmente Wahrnehmung ist Lesen, Über die Wahrnehmung in sich und Notizen zur Wahrnehmungsfrage, geschrieben um das Jahr 1917, sind manchen ziemlich komplexen Reflexionen über die Wahrnehmung gewidmet. Zunächst wird dort gesagt, dass die Wahrnehmung Lesen ist. Insbesondere in den Notizen zur Wahrnehmungsfrage behauptet Benjamin, indem er die Wahrnehmung von dem Zeichen unterscheidet, dass erstere nicht die unendliche Nummer der möglichen Bedeutungen, sondern die endliche Nummer der möglichen Deutungen31 ist. Die Wahrnehmung wird also als die Fähigkeit, durch die Deutung Bedeutung zu geben, präsentiert, und sie ist zunächst Lesen. In dem kurzen Fragment 16, bedeutungsvoll Wahrnehmung ist Lesen betitelt, deutet Benjamin darüber hinaus auf die Unfähigkeit der Menge hin, die Erkenntnis von der Wahrnehmung zu unterscheiden, und er fügt hinzu, dass diese letzte sich auf Symbole32 bezieht. Die Wahrnehmung ist also auch in diesen Fragmenten ein Wahr-Nehmen, und zwar als Fähigkeit gemeint, die Wahrheit, die sich als Symbol offenbart, zu begreifen – zu lesen. Interessant sind auch die späteren zwei Fragmente Lehre vom Ähnlichen und Über das mimethische Vermögen, geschrieben um das Jahr 1933. In ihnen wird die Wahrnehmung als eine Fähigkeit aufgefasst, Ähnlichkeiten und Korrespondenzen unter der Sachen zu finden. In Über das mimethischen Vermögen – eine Überbearbeitung des Fragmentes Lehre vom Ähnlichen – behauptet Benjamin, dass, die Alten die Gabe hatten, „magische Korrespondenzen und Analogien“33 unter der Sache zu erkennen; dann hat sich diese Fähigkeit im Laufe der Geschichte so sehr gewandelt und allmählich vermindert, dass der moderne Mensch sie bloß im niedrigsten Grade besitzt. Die Alten – schreibt Benjamin – konnten den Gestirnstand im Himmel lesen und in sie die Korrespondenzen mit dem menschlichen Schicksal, konnten in dem Tanz die Bedeutungen und symbolischen Ähnlichkeiten begreifen: sie konnten schließlich „was nie geschrieben wurde“34 lesen und deuten. Das ist die erste, die älteste und, man könnte auch sagen, die ursprüngliche Form vom Lesen: das ist das Lesen, das jeder Sprache vorangeht, es ist die Auslegung der Gesten und der 31 Vgl. GS VI 33. Vgl. GS VI 32. 33 GS II/1 211. 32 21 Zeichen in dem Aufblitzen. Benjamin versucht hervorzuheben, dass diese Wahrnehmung der Alten notwendigerweise mit dem Aufblitzen verbunden sei: nur in dem Aufblitzen offenbaren sich die Verbindungen und die magische Korrespondenzen unter den Sachen, und nur in dem Augenblick ist die Wahrnehmung der unsinnlichen Ähnlichkeiten möglich. Das interpretative Lesen der Alten war also ein Wahrnehmen, das, wie Benjamin schreibt, „an ein Aufblitzen gebunden” ist, das „vorbei huscht ”.35 Dem Menschen der Moderne, der diese Fähigkeit fast völlig verloren hat, ist aber eine andere Quelle, oder, wie Benjamin schreibt, ein „Archiv der unsinnlichen Ähnlichkeiten”,36 geblieben. Mit anderen Worten, obwohl der Moderne die Wahrnehmung der Alten zumeist verschlossen ist, bleibt ihr trotzdem die Sprache und die Möglichkeit, in der Sprache eben „was nie geschrieben wurde” zu lesen. Benjamin betont darüber hinaus, dass nicht so sehr die gesprochene Sprache wie die geschriebene erlaubt, Korrespondenzen und Ähnlichkeiten unter den Sachen zu finden: „’jedes Wort ist - und die ganze Sprache’, so hat man wohl behauptet, ‘ist onomatopoetisch’”.37 Ohne im Moment uns mit der Sprache und mit der Bedeutung, die die Sprache in der Philosophie Benjamins hat, zu beschäftigen, kehren wir aber zu dem Fragment Über die Wahrnehmung zurück, in dem gesagt wird, dass die absolute Erfahrung Sprache ist und, dass eine Form deren die Wahrnehmung ist: Wir können nun zunächst feststellen, dass „Sprache” in diesem Kontext in dem breiteren Sinne des interpretativen Lesens genutzt wird, und dass der Terminus „Wahrnehmung”, den Benjamin benutzt, dem gerade analysierten Begriff der Wahrnehmung entspricht. Also, der Begriff der ursprünglichen Erfahrung fällt nicht mit der alltäglichen Erfahrung, natürlichen und primitiven, zusammen, sondern mit einer Form des Lesens - die ursprüngliche Sprache - welche Wahrnehmung der Symbole in dem Augenblick ist. Benjamin bemerkt nämlich, dass, während die vorkantische Erfahrung „bedeutungsvoll” und „Gottvoll” war, die nächste – die der Moderne – degeneriert ist; sie hat die Bedeutung und die ursprüngliche Fülle verloren. Ebenso hat sich im Fragment Über die mimetischen Vermögen die Moderne allmählich von der ursprünglichen Wahrnehmung entfernt. In Über die Wahrnehmung ist die Erfahrung der Moderne, die langsam ihre ursprünglichen Bedeutung verliert, unfruchtbar und leer werdend. Von daher kann man zwei Hypothesen wagen: erstens, die eines Zusammenfalles zwischen den Begriffen der „Wahrnehmung” und der „absoluten Erfahrung” (diejenige wovon 34 GS II/1 213. Ibidem. 36 Ibidem. 35 22 man im Fragment 19 spricht); zweitens, da – wie wir gerade gesehen haben – der Moderne die ursprüngliche Wahrnehmung verschlossen ist, bleibt ihr als einzige Möglichkeit dieses Archiv der Korrespondenzen, das die Sprache ist. Man kann wohl behaupten, dass es eine sehr starke Beziehung zwischen Erfahrung, Wahrnehmung und Sprache gibt und, dass diese Beziehung durch die Tatsache begründet und gerechtfertigt ist, dass sich eben – und ausschließlich, mindestens für den Benjamin dieser Jahre – für die Moderne gerade in der Sprache die Möglichkeit offenbart, die Wahrheit wahrzunehmen und zu begreifen. Nun kehren wir zu der Beziehung zwischen Erfahrung und Wahrnehmung zurück. Ein weiteres interessantes Element, das uns denken lässt, dass diese Beziehung in Wirklichkeit ein Zusammenfall ist, ist der Begriff des Augenblicks. Man hat gesagt, dass in den oben betrachteten Fragmenten über das mimetische Vermögen der Augenblick das zeitliche Element zu sein scheint, in dem man das Symbol wahrnehmen kann. Im Fragment Über die Wahrnehmung Benjamin ist die unmittelbare und natürliche Erfahrung der aufklärerischen entgegensetzt. Halten wir uns nun an den Sinnen der Unmittelbarkeit einer solchen Erfahrung auf. Was ist also eine unmittelbare Erfahrung? Ganz im Gegensatz zu der Erfahrung der einzelnen Wissenschaften, die notwendigerweise durch mehrere Faktoren, wie z.B. die Beobachtung und die Messinstrumente, gemittelt ist38, ist die unmittelbare Erfahrung eine vermittlungslose Erfahrung der Symbole, die in dem Augenblick geschieht: also ein interpretatives Lesen, das erlaubt, die vom Anfang an verborgene Bedeutungen zutage zu fördern. Wir könnten uns nun noch fragen, ob diese Unmittelbarkeit auch von der Vermittlung der Vernunft und des Verstandes entbunden ist, und ob der Augenblick, von dem Benjamin redet, eben nicht der zeitlichen Extension entnommen ist, sondern ob er vielmehr ein Element außerhalb der Zeit ist. An dieser Stelle bleibt nur zu sehen, ob diese Verwandtschaft, oder besser gesagt, dieser Zusammenfall zwischen „Erfahrung” und „Wahrnehmung”, auch in der Programmschrift, wo - ich wiederhole - die zu gründende Erfahrung als „metaphysisch” und nicht mehr „absolut” bezeichnet ist, zu finden ist, und schließlich in welchem Sinne Benjamin in der Programmschrift von metaphysischer Erfahrung als konkrete Totalität der Erfahrung, die niemals von der Erkenntnis erreichbar ist, spricht. Auch in der Programmschrift finden wir den Hinweis auf die Sprache: Benjamin endet nämlich den Text der Programmschrift, indem er behauptet, dass nur eine Reflexion über das sprachliche Wesen der Erkenntnis diesen Begriff erweitern kann und ihm alle Bereiche zu 37 GSII/ 212. 23 umfassen erlaubt, die ein durch die Mathematik oder durch die Logik begründeter Begriff der Erkenntnis notwendigerweise vernachlässigen muss. Diesem erweiterten Begriff der „Erkenntnis“ entspricht also ein erweiterter Begriff der „Erfahrung“, der nicht mehr auf die Erfahrung der einzelnen Wissenschaftlichen begrenzt ist. Die sprachliche Reflexion über die Erkenntnis ist durch die Tatsache gerechtfertigt, dass alle unsere Erkenntnisse sich durch die Sprache und nicht durch mathematische Formeln aussprechen lassen. In der Programmschrift finden wir auch den Hinweis auf den Augenblick,39 auf die Unmittelbarkeit wieder. Aber gerade an dieser Stelle wird der Gedankengang Benjamins komplizierter. Er führt nämlich seinen Gedankengang über die Sprache nicht weiter, sondern hält sich an dem Verhältnis Philosophie-Religion auf, das in dem Nachtrag der Programmschrift – der sich aber schwer verstehen lässt, weil er, verglichen mit dem Rest des Textes, auf eine ganz andere Stufe gestellt ist – thematisiert, oder besser, entworfen worden ist. Benjamin behauptet – eben in diesem Nachtrag – dass der Begriff der „Erkenntnis“, den er jetzt Stammbegriff oder Urbegriff nennt, eine Doppelfunktion hat. Die erste, die der eigentlichen erkenntnistheoretischen Funktion entspricht, besteht in einer Spezifikation eines solchen Begriffes in den einzelnen Erkenntnissen und Erfahrungen. Diese Funktion, schreibt Benjamin, kommt nie dazu, weder eine konkrete Totalität der Erfahrung noch einen Begriff des Daseins zu begreifen, sondern bezieht sich auf die Gesetze der Dinge: mit anderen Worten, diese erste Funktion der Erkenntnis scheint dem traditionellen Begriff „Erkenntnis“, der sich in den mannigfaltigen und einzelnen Wissenschaften spezifiziert, zu entsprechen. Sie wird aber auch negativ beschrieben und definiert, nämlich als die gnoseologische Funktion, die nicht in der Lage ist, weder eine konkrete Totalität der Erfahrung noch irgendeinen Begriff des Daseins zu begreifen. Sie ist also nicht imstande, weder das unendlich Große (die Totalität) noch das unendlich Kleine (das Dasein der Einzeldinge) zu begreifen, sondern bleibt mit den Gesetzen der Dinge verbunden. Man würde nun erwarten, dass Benjamin genau an dieser Stelle auch die zweite Funktion des Urbegriffes „Erkenntnis“ beschreiben würde, und dass diese demzufolge durch die Fähigkeit gekennzeichnet ist, irgendwie die konkrete Totalität der Erfahrung und das Dasein zu erreichen. Aber der Diskurs Benjamins verläuft anders weiter. Er behauptet, dass es eine konkrete Totalität der Erfahrung gibt, auf die sich die Erkenntnis unmittelbar (und zwar im doppelten Sinne, also ohne Vermittlung und in dem Augenblick) bezieht, und dass solch eine Totalität die Religion ist. Also der neue Begriff „Erkenntnis“ hat - wenn er sich nicht spezifiziert, sondern wenn er sich wie eine 38 Vgl. GS VI 40ff. 24 kontinuierliche Einheit entfaltet, wenn er Lehre40 ist - die Fähigkeit, eine konkrete Totalität der Erfahrung zu erreichen, auf die er sich unmittelbar und ohne Vermittlung bezieht: Diese Funktion des Erkenntnisbegriffes ist diejenige, die von Benjamin eigentlich als „metaphysisch” definiert wird, und die Totalität, auf die sie sich bezieht, ist die Religion. Versuchen wir nun in der Programmschrift uns das problematische Verhältnis zwischen Erfahrung und Wahrnehmung vor Augen zu führen, das, wie wir schon gesehen haben, von den Begriffen des Augenblicks und des Symbols her analysiert werden muss. Um dies zu tun, müssen wir zunächst beleuchten, was Benjamin mit „Religion” meint, weil gerade die Religion die höhere Erfahrung, die metaphysische, ist, auf die sich der Stammbegriff „Erkenntnis“ bezieht. 5. Erfahrung und Religion Es wurde schon gesagt, dass Benjamin in der Programmschrift einige Probleme hervorhebt, die nur entworfen, nicht aber gelöst werden, weil er diesen Text nur als ein Programm und als eine Arbeitshypothese betrachtete. Die wohl undeutlichsten Hauptpunkte sind: der Vorschlag einer Überwindung der auf der Beziehung Subjekt-Objekt begründeten traditionellen Erkenntnistheorie; die Suche nach einer nicht näher spezifizierten metaphysischen Erfahrung; und schließlich, der vielleicht komplizierteste Aspekt, das Verhältnis zwischen Philosophie und Religion, der nur in dem spät hinzugefügten Nachtrag der Programmschrift angedeutet wird. Auf dieses letzte Argument möchte ich nun in diesem Abschnitt eingehen, in soweit es mir scheint, dass die Problematiken, die er hervorhebt, hinweisend für ein besseres Verständnis der oben erwähnten Punkte sein können. Wir haben in dem vorherigen Abschnitt gesehen, dass Benjamin dem Urbegriff „Erkenntnis“ zwei Bedeutungen zuschreibt, von denen nur die metaphysische in der Lage ist, zu einer “konkreten Totalität der Erfahrung” zu gelangen. Zunächst muss man sich fragen, was in diesem Ausdruck das Wort „konkret” heißt. Wieso also bezeichnet Benjamin die metaphysische Erfahrung, als konkret; und zwar diese Art von Erfahrung - die im Unterschied zu der Kantischen - einheitlich, total und kontinuierlich ist? Es zeigt sich deutlich, dass bei Benjamin die Erfahrung eine andere Bedeutung und eine andere Funktion hat als bei Kant; 39 Vgl. GS II/1 170 25 nicht nur insofern als dass diejenige Erfahrung, nach der Benjamin sucht, eine totale Erfahrung ist – d.h. nicht nur eine wissenschaftliche wie bei Kant –, sondern auch da wir uns folglich fragen könnten, ob er die Möglichkeit eines a priori der Geschichte, der Kunst usw.,41 auf die kurz in der Programmschrift hindeutet worden ist – theoretisiert, er den Begriff des a priori ablehnt, oder er gar dem a priori eine andere Bedeutung zuschreibt. Doch das Wort „konkret” scheint ein deutlicher Hinweis auf Kant zu sein. Das ist weder seltsam noch unplausibel, da Benjamin in der Programmschrift selbst und in dem Briefwechseln mit Scholem, der genau in diese Jahre zurückreicht, erklärt, dass Kant unwiderlegbar der Ausgangspunkt für das Ausdenken einer neuen Philosophie und eines neuen Begriffes „Erfahrung“ ist. Es ist interessant festzustellen, dass das Wort „konkret“, mit dem Begriff „Erfahrung“ verbunden, nur in dem Nachtrag vorkommt, während es vorher im Verlaufe der Programmschrift nie verwendet wird: man spricht von der metaphysischen, totalen, einheitlichen Erfahrung, nie aber von der „konkreten Totalität der Erfahrung“. Dieses Wort könnte nun ein Hinweis auf die Transzendentale Dialektik sein, wo Kant den Ausdruck „in concreto“ bezüglich der Ideen der Vernunft42 verwendet, und genauer, im Bezug auf die Idee der Welt, die bei Kant die unbedingte Totalität der objektiven Bedingungen ist. In den Paragraphen über die Antinomie der Vernunft schreibt Kant, dass die Idee keine Darstellung in concreto hat, d.h. ihr tatsächlich kein Gegenstand entspricht. Also können wir auch keine Erfahrung davon haben. Die Idee bleibt so ein asymptotischer Punkt, ein Ursprung und ein ideales Ziel, von dem her und zu dem hin man die intellektuelle Forschung ausrichten muss. Benjamin verwendet nun den Terminus „konkret“ im Bezug auf die Totalität der Erfahrung. Während einerseits das als ein Hinweis auf Kant und auf die Idee der Vernunft erscheinen würde – da auch bei Benjamin die konkrete Totalität der Erfahrung eine Idee ist, vielmehr ein Ideal, von der Erkenntnis niemals konkret erreichbar – entstehen andererseits jedoch Probleme, als Benjamin in dem Nachtrag behauptet, dass der Stammbegriff, oder Urbegriff, „Erkenntnis“ sich unmittelbar zu einer konkreten Totalität der Erfahrung, die die Religion ist, wendet. In diesem Fall scheint Benjamin also - im Gegensatz zu Kant - zu behaupten, dass es möglich sei, unmittelbar auf die Totalität der Erfahrung einzugehen, d.h., dass eine Erfahrung der Idee irgendwie möglich ist. 40 GS II/1 170. Vgl. GSVI 167. Benjamin deutet kurz auf das Bedürfnis hin, die Lehre der Kategorie Kants auch zur Kunst, zum Recht und zur Geschichte zu wenden. 42 Vgl. IMMANUEL KANT, Kritik der reinen Vernunft, hg. Benno Erdmann, Berlin 1900, S. 360ff 41 26 Ein anderes Wort, das zum Nachdenken anregt, ist „Lehre“, das mehrere Male in der Programmschrift verwendet wird, genauer gesagt in dem Nachtrag bezüglich des Verhältnisses zwischen Religion, Erfahrung und Philosophie: „Es gibt aber eine Einheit der Erfahrung die keineswegs als Summe von Erfahrungen verstanden werden kann, auf die sich der Erkenntnisbegriff als Lehre in seiner kontinuierliche Entfaltung unmittelbar bezieht. Der Gegenstand und Inhalt dieser Lehre, diese konkrete Totalität ist die Religion, die aber die Philosophie zunächst nur als Lehre gegeben ist. Die Quelle des Daseins liegt nur in der Totalität der Erfahrung und erst in der Lehre stößt die Philosophie auf ein Absolutes, als Dasein, und damit auf jene Kontinuität im Wesen der Erfahrung in deren Vernachlässigung der Mangel des Neukantianismus zu vermuten ist“43. Der Begriff der „Lehre“ wird hier auf die Erkenntnis und gleichzeitig auf die Einheit der Erfahrung bezogen, als Religion bezeichnet. Derselbe Begriff der Lehre befindet sich auch in dem Brief vom 22. Oktober 1917 aus dem schon erwähnten Briefwechsel zwischen Benjamin und Scholem: „Ohne bisher dafür irgendwelche Beweise in der Hand zu haben bin ich des festen Glaubens dass es sich im Sinne der Philosophie und damit der Lehre, zu der diese gehört, wenn sie sie nicht etwa sogar ausmacht, nie und nimmer um eine Erschütterung, eine Sturz des Kantischen Systems handeln kann sondern vielmehr um eine seine granitne Festlegung und universale Ausbildung. Die tiefste Typik des Denkens der Lehre ist mir bisher immer in seinen Worten und Gedanken aufgegangen, und wie unermesslich viel vom Kantischen Buchstaben auch mag fallen müssen diese Typik seines Systems die innerhalb der Philosophie nur mit der Platos meines Wissens verglichen werden kann muss erhalten bleiben. Einzig im Sinne Kants und Plato und wie ich glaube im Wege der Revision und Fortbildung Kants kann die Philosophie zur Lehre oder mindestens ihr einverleibt werden [...]. Aber es ist meine Überzeugung: wenn nicht in Kant das Denken der Lehre selbst ringen fühlt und wer daher nicht mit äußerster Ehrfurcht ihn mit seinen Buchstaben als ein tradendum, zu Überlieferndes erfasst (wie weit man ihn auch später umbilden müsse) weiß von Philosophie gar nichts“44. Die Bedeutung des Begriffes „Lehre“ ist, in beiden Fällen, die des Systems, oder besser, die der Totalität. Wir können dazu sagen, dass er eine wichtige religiöse Valenz gewinnt: die Lehre ist nicht nur ein System, sondern eine mit „Ehrfurcht“ zu liefernde Totalität. Diese 43 44 GSII/1 170 (der Kursiv ist von mir). GB I 389. 27 religiöse Bedeutung weist auf den hebräischen Sinn von Lehre hin, nach welchem die Torah nicht nur eine Sammlung von Lehren enthält, sondern das göttliche Wort selbst ist. In dem Brief an Scholem wendet Benjamin nun die Bedeutung von Lehre – in ihrem religiösen Sinn – auf die Philosophie an, um das Bedürfnis eines Denkens, das eine lebendige Totalität ist – wie eben die Torah für das Judentum – und gleichzeitig ideal, d.h. unmöglich auf einmal und für immer zu lehren und zu liefern, zu zeigen und auszudrücken. Diese Lesart des Terminus „Lehre“ und seines Hinweises auf die Philosophie, hilft das schon erwähnte Fragment 19 (s. o. S.4;GS VI 38) zu begreifen, in dem Benjamin schreibt, dass die ganze Philosophie Lehre ist. Auch in diesem Kontext wird der Begriff „Lehre“ auf die Philosophie angewendet, oder besser gesagt, auf die ganze Philosophie, d.h. auf die Philosophie in ihrer Totalität, um auf eine Ganzheit zu verweisen, d.h. eine Einheit der Philosophie, die als solche nichts anderes als ideal sein kann. Kehren wir jetzt zu dem Nachtrag der Programmschrift zurück, um dort den Begriff der „Lehre“ zu untersuchen. Auch hier wird der Stammbegriff der „Erkenntnis“, - also die Philosophie, die kantisch als Erkenntnistheorie konzipiert wird –, zwar als Lehre bezeichnet, aber nur in dem Moment, in dem die Philosophie eben in ihrer metaphysischen Funktion aufgefasst wird. Mit anderen Worten - man kann an dieser Stelle feststellen, dass die Erkenntnis nur in dem Moment, in dem sie sich nicht in den einzelnen und mannigfaltigen Erkenntnissen spezifiziert, eine kontinuierliche Einheit bleibt; sie gerade dann Philosophie ist. Und als solche wendet sie sich unmittelbar der „konkreten Totalität der Erfahrung“ zu und ist folglich in der Lage, die Totalität und das Dasein zu begreifen. In diesem einzigen Fall ist die Erkenntnis Lehre. Haben wir nun hier mit einem Begriff der Philosophie zu tun, die als ideale und nie völlig erreichte Erkenntnis gemeint ist? Oder handelt es sich vielmehr um eine Art von Erkenntnis, die gleichzeitig Erfahrung der Wahrheit ist – wie übrigens im Falle der religiösen Lehre – aber doch nie Erfahrung der ganzen Wahrheit, d.h. der Wahrheit als ein Ein-für-alleMal-Gegebenes? Doch mit dieser Frage enden nicht die Probleme des Verständnisses des Nachtrages. Es bleibt nämlich nicht nur zu verdeutlichen, was die Religion ist, sondern auch was ihr Verhältnis zu der Philosophie ist. Was ist also die Religion für den Benjamin der Programmschrift? Man kann eine Hypothese wagen, indem man behauptet, dass Benjamin in der Programmschrift den Begriff der Religion in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet. Die erste Bedeutung weist, meiner Meinung nach, auf die historische, anerkannte Religion 28 hin: Benjamin, einen neuen Begriff der „Erfahrung“ vorschlagend, schreibt, dass dieser Begriff jeden Bereich der Erfahrung umfassen muss, die von Kant und vom Neukantianismus vernachlässigt wurden: zu erst den der Religion45- in diesem Fall schließt Benjamin folglich die Religion innerhalb des ausgedehnteren Begriffes der Erfahrung mit ein. Die zweite Bedeutung der Religion, die interessanter, vielleicht aber gerade die problematischere ist, findet sich in dem Nachtrag, wo Benjamin die Religion mit der „konkreten Totalität der Erfahrung“ identifiziert. Die Religion wird also, im Gegensatz zum ersten Fall, nicht als Teil des Erfahrungsfeldes aufgefasst, sondern fällt mit der Erfahrung selber in ihrer Totalität zusammen. Meiner Meinung nach dürfen wir nun doch von zwei Bedeutungen der Religion, einer beschränkten und einer ausgedehnten, sprechen. Wenn wir ja vermuten, dass dieser Unterschied einen Sinn hat, was heißt dann der Begriff der „Religion“ in seiner zweiten Bedeutung? Bzw. was heißt die Religion als „konkrete Totalität der Erfahrung“? Wenn, wie wir gesehen haben, die konkrete Totalität der Erfahrung als Lehre, d.h. als Erfahrung der Wahrheit – jene aber nie völlig besitzend – zu erfassen ist, dann hat der Terminus „Religion“ hier nicht eine historische Bedeutung, sondern eine ideale, symbolische. Mit anderen Worten, sie ist nicht als Summe von Dogmen oder von im Voraus gebildeten Regeln zu denken und zu begreifen, sondern als ein Zusammenhang, eine Einheit der Symbole, und als Wahrheit im allgemeinen Sinne, d.h. nicht bloß mit einer besonderen Religion identifizierbar. Es ist einleuchtend, was Benjamin bezüglich der konkreten Totalität der Erfahrung, die eben die Religion ist, schreibt: „Es gibt aber eine Einheit der Erfahrung die keineswegs als Summe der Erfahrung verstanden werden kann, auf die sich der Erkenntnisbegriff als Lehre in seiner kontinuierlichen Entfaltung unmittelbar bezieht. Der Gegenstand und Inhalt dieser Lehre, diese konkrete Totalität der Erfahrung ist die Religion, die aber der Philosophie zunächst nur als Lehre gegeben ist“46 Es ist noch interessant festzustellen, dass bei Benjamin „Lehre“ sowohl die konkrete Totalität der Erfahrung, als auch die Philosophie – in dem Moment, in dem diese letztere eine kontinuierliche Entfaltung ist – ist. Von daher können wir zwei Schlussfolgerungen ziehen: die erste bestätigt die Tatsache, dass die Religion, wenigstens in der Programmschrift, die Bedeutung von Lehre in dem oben betrachteten Sinne als Wahrheit, d.h. als Totalität im 45 46 GSVI 163. GSVI 170. 29 Werden und nie ganz eingängig, hat; und die zweite, dass die Erkenntnis, nämlich die Philosophie, Lehre ist, aber nur dann, wenn sie selber auch in ihrer idealen Totalität betrachtet wird. Folglich kann man wohl zunächst, dem Begriff der „Lehre“ nach, behaupten, dass die Philosophie nicht tout court die Erkenntnis ist, sondern jener einheitliche und darum metaphysische Begriff der „Erkenntnis“; und darüber hinaus, dass die Philosophie und die metaphysische Erfahrung in dem Moment zusammenfallen, wenn sie beide als Lehre verstanden und begriffen werden.47 Mit anderen Worten, wenn sich die Erkenntnis nicht spezifiziert, in die diskontinuierliche Pluralität der einzelnen Erkenntnisse zersplitternd, dann ist sie in der Lage, die kontinuierliche Totalität der Erfahrung zu begreifen, die ihrerseits nicht in der Summe von einzelnen Erfahrungen besteht, sondern sie die Einheit der Erfahrung, oder, wir könnten sagen, die Idee ist: „Eine Erkenntnis ist metaphysische heißt im strengen Sinne: sie bezieht sich durch den Stammbegriff der Erkenntnis auf die konkrete Totalität der Erfahrung, d.h. aber auf Dasein“48. Benjamin geht schließlich von den Begriffen „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ aus, die er bei Kant findet, kommt jedoch dazu, die Grundsätze der Kantischen Theorie zu revolutionieren: weil – während bei Kant die Erfahrung ein Faktum ist, das in der Erkenntnis zu begründen ist, deren a priori ihm Rechenschaft geben muss – es bei Benjamin hingegen kein a priori mehr gibt, das die Aufgabe hat, eine faktische Erfahrung zu begründen. Freilich hält Benjamin es für möglich, den Verweis der Kategorienlehre auch auf die Bereiche der Geschichte, des Rechts und der Kunst49 zu erstrecken. Er setzt sich aber nicht mit dem Hauptproblem der Kantischen Theorie auseinander, bzw. dem Unterschied zwischen der Kategorie der Kausalität und der Freiheit (freie Kausalität) - d.h. die Unterscheidung zwischen dem theoretischen Bereich und dem praktischen, in dem die theoretische Kausalität sozusagen von der menschlichen Freiheit ergänzt wird. Schließlich ist das a priori, von dem Benjamin spricht, nicht das Kantische; es scheint vielmehr so zu sein, dass die Idee die Aufgabe hat, eine Erfahrung und eine Erkenntnis zu begründen, die als metaphysisch bezeichnet werden könnte: 47 Benjamin endet bedeutungsvoll den Nachtrag, indem er vorschlägt, die Beziehung zwischen Religion und Philosophie – für denen er eine „virtuelle Einheit“ annimmt – zu vertiefen (GS VI 171). 48 GS II/1 171. 49 Vgl. GS II/1 167. 30 „Für den vertieften Begriff der Erfahrung ist aber, wie schon gesagt, Kontinuität nächst der der Einheit unerlässlich und in den Ideen muss der Grund der Einheit und der Kontinuität jener nicht vulgären und nicht wissenschaftlichen sondern metaphysischen Erfahrung aufgewiesen werden“50. Darüber hinaus schreibt Benjamin in dem Nachtrag in Bezug auf Kant, dass die Philosophie aus einem dogmatischen Teil und aus einem kritischen besteht. In dem Moment aber, wenn er auf eine Theorie des a priori der Erkenntnis und auf ein aposteriorisches Übrigbleibsel, das die Erfahrung charakterisiert, verzichtet, ergibt folglich eine solche Teilung der Philosophie keinen Sinn. Welche Art der Erfahrung und der Erkenntnis theoretisiert also Benjamin? In dem Vergleich mit Kant, auf den er den Text der Programmschrift gründet, taucht zunächst auf, dass die Begriffe der metaphysischen Erfahrung und der Erkenntnis gar nicht im Kantischen Sinne zu verstehen sind. Die Erkenntnistheorie Benjamins, wenigstens in den jugendlichen Schriften scheint sich jedoch an eine Hermeneutik des Symbols anzunähern, d.h. an ein interpretatives Lesen, das eben als Zweck hat, einen nicht näher erklärten Begriff der „Wahrheit“ zu begreifen. Doch müssen wir nun uns fragen, ob es möglich ist, eine Beziehung zwischen dem Begriff der metaphysischen Erfahrung der Programmschrift und der Wahrnehmung, im Sinne der Wahrnehmung des Wahren, dem wir bereits in den Fragmenten über die Wahrnehmung – die in diese Jahre der Programmschrift zurück reichen – begegnet sind, oder ob zwischen beiden Begriffen nur Ähnlichkeiten und Analogien bestehen, ohne eine effektive Verbindung. Die Begriffe „Lehre“ und „Symbols“ sind für eine mögliche Lösung dieses Problems bedeutungsvoll. Die Wahrnehmung, wie wir bereits gesehen haben, ist ein interpretatives Lesen, das sich zu den Symbolen wendet und das, laut Benjamin, ursprünglich eine Fähigkeit jedes Menschen war; er schlägt eine Brücke – die scheinbar wie ein Bruch aussieht – zwischen der Welt der Alten und der der Moderne: nach dieser Ansicht betrifft die Wahrnehmung, im tiefsten Sinne, die Fähigkeit, die den Alten zu eigen ist, während sie der Moderne – die unfähig geworden ist, die Symbole und die Korrespondenzen zu begreifen – versperrt bleibt. Also fällt der Anbruch der Moderne mit dem Verlust der alten und ursprünglichen Fähigkeit, das Symbol wahrzunehmen, d.h. mit der ursprünglichen Fähigkeit, das Wahre in seinen phänomenalen Manifestationen zu begreifen, zusammen. In der Programmschrift nun spricht 50 GSII/1 167. 31 man nicht von der Wahrnehmung, sondern von einem Begriff der „Erfahrung“, der gesucht und definiert sein muss: die aufklärerische Erfahrung ist degeneriert, sie ist leer geworden – genauso wie im Fragment 19 die Wahrnehmung, die der Moderne zu eigen ist – während die metaphysische Erfahrung, also die totale, kontinuierliche und einheitliche Erfahrung, ein Ideal ist, an das sich die Philosophie wenden muss, genauso wie der Begriff der „Wahrnehmung“ ein Archetyp ist, an den sich die Moderne richten muss. Der Schlüssel nun, um eine Verbindung zwischen der Wahrnehmung und der metaphysischen Erfahrung zu finden, scheint eben der Begriff des „Symbols“, zu sein. 6. Wahrheit als Symbol. Die Zweideutigkeit der Erkenntnis Es handelt sich jetzt darum, den Begriff des „Symbols“ zu vertiefen. Nicht nur weil er ein erleuchtender Moment für das Verständnis des Begriffes der „Wahrnehmung“ zu sein scheint – soweit wir gesehen haben, behauptet Benjamin im Fragment 16 - Wahrnehmung ist Lesen -, dass die Wahrnehmung eine Wahrnehmung der Symbole ist – sondern auch – wie es in den vorherigen Paragraphen auftaucht – dieser Begriff oft in den frühen Texten Benjamins vorkommt und seine Funktion sicherlich der zentrale Punkt ist, zu dem die Theorie der Erkenntnis und der Erfahrung führt. Um über das Symbol reden zu können, ist es darum noch einmal notwendig, auf den Begriff „Erkenntnis“ zu verweisen, der – wie wir sehen werden – bei Benjamin nicht zufällig in einer engen Beziehung mit den Begriffen des „Augenblicks“ und des „Symbols“ steht. Mit anderen Worten, wenn wir erneut (in diesem Kontext) von Erfahrung sprechen, können wir nicht davon absehen, auch von der Erkenntnis zu sprechen; nicht nur das, sondern ist es ebenso festzustellen, dass sowohl der Begriff der Erfahrung, wie wir oben bereits gesehen haben, als auch der der Erkenntnis in einer scheinbar zweideutigen Art aufgefasst und beschrieben werden: einerseits stellen sie eine unendliche Aufgabe, eine nie völlig erreichbare Idealität, dar, andererseits sind sie jedoch auch effektive Erfahrung und effektive Erkenntnis. Mit anderen Worten, indem wir in diesem Abschnitt die Fragmente 20, 25 und 26 untersuchen, werden wir sehen, dass die Beziehung der Erkenntnis und der Erfahrung mit dem 32 Symbol, d.h. mit der Wahrheit und mit der Idee, uns neuerlich auf den Weg einer möglichen Identifizierung beider Begriffe, Erkenntnis und Erfahrung, führt – wobei die beiden im Sinne jener ursprünglichen Wahrnehmung, die mit Symbole zu tun hat, zu verstehen sind, und gleichzeitig als phänomenale Manifestation, die in dem Augenblick geschieht. Zunächst finden wir das Symbol im Bezug auf den Begriff der „Erkenntnis“, im Fragment 20 um verlorenen Abschluss der Notiz über die Symbolik in der Erkenntnis, geschrieben zwischen 1917 und 1918. In dem ersten Teil dieses kurzen Textes erwähnt Benjamin Goethe, dessen Naturforschung die „echte in Symbolen vollzogene theoretische Erkenntnis gefasst“51 hat, und er schreibt weiter, dass sich die Symbole Goethe nicht in poetischen Analogien, in denen die Natur erkennbar ist, sondern in „seherischen Einsichten“52 offenbart haben. Das Symbol wird danach als Urphänomen bezeichnet, das eben ein „systematisch-symbolischer Begriff“ und ein „Ideal-Symbol“53 ist. Bereits aus diesem Text ist es möglich, eine Zweideutigkeit festzustellen, oder besser, eine doppelte Valenz des Begriffes des Symbols. Zuerst schreibt Benjamin, dass das Symbol sich durch eine seherische Einsicht offenbart: d.h. zunächst, dass man von ihm keine Erkenntnis, sondern eine Art der Wahrnehmung, eine „Evidenzerfahrung“, hat, und dass darüber hinaus nicht ein jeder in der Lage ist, das Symbol - die Idee in der Natur wahrzunehmen. Zweitens schreibt er, dass das Symbol die Idee im Sinne der Aufgabe ist: d.h. kantisch, dass das Symbol, als Idee, nie der Wahrnehmung gegeben ist, sondern als regulatives Ideal für die intellektuelle Forschung fungiert. Bevor wir mit dem zweiten Teil – der auf den ersten Blick völlig anders als der erste aussieht; der sich aber doch extrem einleuchtend ergibt – dieses Fragmentes beschäftigen, wollen wir noch bemerken, dass in dem bereits erwähnten Fragment 25, Erkenntnistheorie, der Begriff des „Symbols“ vorkommt - immer noch in Beziehung zu der Erkenntnis. Dieser Text ist in drei Teile unterteilt. Der erste ist eine kurze Reflexion über die Wahrheit, von dem Wahr-sein der Sache unterschieden, und über das Verhältnis der beiden Begriffe – Wahrheit und Wahr-sein – zu der Erkenntnis; der zweite identifiziert in zwei Punkten die Art der Erkenntnis, die von der Philosophie überwunden werden muss; der dritte schließlich schlägt in zwei Punkten die Aufgabe für eine neue Theorie der Erkenntnis vor:1.) die Konstitution der Dinge im Jetzt der Erkennbarkeit; 2.) die Einschränkung der Erkenntnis im Symbol54. Ausgehend von der Voraussetzung, dass das Symbol implizit mit der Wahrheit identifiziert 51 GS VI 38. Ibidem. 53 Ibidem. 52 33 sei – wie es andererseits, aber explizit, auch in der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels55 geschehen ist – schreibt Benjamin, dass die Wahrheit sich in dem Jetzt der Erkennbarkeit offenbart. Während in dem ersten Teil des selben Fragments die Wahrheit das Wahr-sein des Sachverhalts ist, als solche aber unerkennbar; sie ist eine unendliche Aufgabe56. Wir stehen also wieder vor der Doppeldeutigkeit, die wir bereits im Fragment 20 festgestellt haben: das Symbol – bzw. die Wahrheit und die Idee – offenbart sich in dem Jetzt, aber gleichzeitig ist es eine unendliche Aufgabe. Was sich bisher aber deutlich ergibt, ist, dass die Erkenntnis des Symbols nicht die Erkenntnis im traditionellen Sinne ist: die Wahrheit ist also nicht erkennbar, wenn man unter Erkenntnis Konzeptualisierung und Spezifizierung versteht. Die Wahrheit offenbart sich jedoch in einer Art der augenblicklichen Wahrnehmung, wie eine Art der Evidenzerfahrung. Kehren wir nun zum Fragment 20 zurück, dessen zweiter Teil auf dem Verhältnis Wahrheit – Erkenntnis beruht. Zum ersten Mal spricht Benjamin von Ontologie und schreibt: „Ontologie dient keineswegs der Erkenntnis des Wahres, sofern man irgend etwas innerhalb dieser Ontologie oder innerhalb einer äußeren Welt unter Wahrheit versteht. Es ist um dies zu verdeutlichen, entscheidend, die radikale Verschiedenheit von Wahrheiten oder besser von Erkenntnissen zu begreifen“57. Die Ontologie wird also mit dem System identifiziert, d.h. sie ist nicht die einzelnen Erkenntnisse, sondern die Totalität der Erkenntnisse, d.h. die Wahrheit. Die einzelnen Erkenntnisse sind jedoch Manifestationen der Wahrheit, was bedeutet, dass sie die Wahrheit in ihrer Totalität nicht enthalten, sondern sie von der Wahrheit „geladen“ sind; sie gewinnen von ihr also den Grad der Wahrheit, der aber – abermals – nicht mit der Wahrheit an sich zusammenfällt. In dem Nachtrag dieses Fragments schreibt Benjamin außerdem: „Jene Wahrheiten enthalten ‚Wahrheiten’, nämlich die jenige auf welche der Philosoph es absieht, aber sie deuten nicht, wie die philosophische (in nieder) durch die philosophische Systematik (in höherer Intention) auf sie hin. Für jene unphilosophische, nämlich künstlerische oder in engerm [sic !] Sinne musische Einsicht in Wahrheiten ist Goethes Gedankenwelt repräsentativ“58. 54 GS VI 46. Siehe unten Kap. III. 56 GS VI 46. 57 GS VI 39. 58 GS VI 40. 55 34 Das Verhältnis Phänomen-Wahrheit scheint also wie jenes Sache-Symbol – im goethischen Sinne, wie wir sehen werden – gemeint und aufgefasst zu sein, d.h. die Wahrheit ist in dem Phänomen, aber sie versiegt nicht darin, da sie für die phänomenale Welt eine Idee ist, die die Wahrheit der Erkenntnisse gründet und garantiert, die sie mit einer symbolischen Intention lädt. Die einzelnen Wahrheiten der phänomenalen Welt sind schließlich nur ein Symbol der Wahrheit, d.h. sie sind die Wahrheit selbst, sie besitzen sie – sozusagen – aber nie gänzlich. Die Wahrheit wird schließlich nicht durch den traditionellen Begriff der „Erkenntnis“ erkannt, da sie nicht Objekt der Erkenntnis ist, insoweit sie doch kein Objekt ist. Sie ist sogar der „Tod der Intention“59: die Wahrheit unterscheidet sich nämlich von dem Begriff, der jedoch das Objekt, jenes der Erkenntnis, ist. Benjamin versucht also auf eine neue Art zu theoretisieren, die Wahrheit zu begreifen, die nicht im traditionellen Sinne als Objekt, Datum gemeint ist, und darum stellt er fest, dass die Wahrheit nur durch eine Erfahrung – die wir als Evidenzerfahrung bezeichnen können – aufgefasst wird: eine Erfahrung im Sinne einer ursprünglichen Wahrnehmung, d.h. eine unmittelbare Erfahrung, augenblicklich und evident. Schließlich finden wir bei der Analyse des Begriffes des „Symbols“ eben die selbe begriffliche Zweideutigkeit wieder, der wir bereits bezüglich des Begriffes der „Erfahrung“ begegnet sind. In beiden Fällen spricht Benjamin über einen idealen Begriff, d.h. über eine Totalität, die – genau wie bei Kant – niemals erreicht werden kann, die als ein regulatives Ideal fungiert: also über eine für die Erkenntnis unendliche Aufgabe; gleichzeitig aber – genau wie in der Programmschrift – besteht die Möglichkeit, auf eine konkrete Totalität der Erfahrung einzugehen, d.h. eine Totalität, von der aus die Erfahrung möglich ist. Ebenso scheint Benjamin zu behaupten, dass von der Wahrheit - als Symbol gemeint - eine unmittelbare Erfahrung möglich sei, d.h. eine Evidenzerfahrung. Mit anderen Worten scheint die Wahrheit nicht nur eine unendliche Aufgabe zu sein – d.h. ein unerreichbares Ziel, zu dem hin man sich immer und bloß nähern kann – sondern die Wahrheit ist auch in den Phänomenen als „symbolische Intention“ enthalten. Kommen wir nun zum Schluss. In dieser Analyse taucht nicht nur die Zweideutigkeit – mit dem Symbol, mit der Wahrheit und mit dem Begriff der „Erfahrung“ verbunden – auf, sondern vor allem erschließt sich aus der Analyse des Symbols und der Wahrheit, dass man – wie es am Anfang vermutet wurde – von der Wahrheit eine Erfahrung haben kann. Eine solche Erfahrung ist unmittelbar, sie geschieht in dem Augenblick und ist eine Wahrnehmung. 59 GS I/1 216. 35 Schließlich können wir feststellen, dass – wenigstens bezüglich der Analyse der frühen Schriften – die ursprüngliche Erfahrung - also diejenige, die Gegenstand der kommenden Philosophie ist und sein muss - Wahrnehmung ist; diese wird aber als Wahr-Nehmung gemeint und theoretisiert: eine unbegriffliche Wahrnehmung des Wahren. Wie müssen wir nun an dieser Stelle das Verhältnis Wahrheit-Phänomen verstehen, das als Symbol und gleichzeitig als Aufgabe gemeint ist? 7. Erkenntnis ist Erfahrung Selbst wenn viele bisher gestellte Fragen momentan noch offen bleiben müssen, können wir allerdings anfangen, eine Reihe von Schlussfolgerungen zu ziehen, was die bis hierhin analysierten Punkte betrifft. Aus der Analyse der frühen Fragmente und insbesondere der Programmschrift – die irgendwie ein echtes philosophisches Programm ist, das in nuce Themen enthält, die Benjamin in den darauffolgenden Jahren entwickeln wird – vor allem hervorgeht, dass Benjamin zu einem neuen Begriff von „Erkenntnis“ und „Erfahrung“ gelangt, um diese zu theoretisieren, oder besser gesagt, zu entwerfen, die aber nicht den traditionellen und vor allem den aufklärerischen entsprechen. Die Erfahrung und die Erkenntnis, die Gegenstand der kommenden Philosophie sein müssen, bestehen in einem einzigen Begriff und fallen in der Idee der Totalität zusammen. Mit anderen Worten, wird die Erfahrung als „konkrete Totalität der Erfahrung“ bezeichnet, die Summe der Erfahrungen nicht, sondern die Idee der Erfahrung in ihrer Totalität; ebenso fällt der Begriff der „Erkenntnis“ mit der Erkenntnis im Kantischen Sinne nicht zusammen, sondern sie ist der „logische Ort“, der die metaphysische Erfahrung – d.h. die Totalität der Erfahrung – ermöglicht, und die ihrerseits der Inbegriff der Erkenntnis ist: also nicht die Summe der Erkenntnisse, sondern die einheitliche Totalität derer, d.h. die Lehre. Gleichzeitig ist aber von der Totalität her eine Erfahrung möglich, oder besser gesagt, eine augenblickliche Erfahrung: die Wahrnehmung. Mit anderen Worten, das, was Benjamin in der Programmschrift „Wahrheit“ nennt – und was in der Programmschrift die Totalität ist – ist sowohl eine unendliche Aufgabe, d.h. ein Ideal, als auch eine Evidenzerfahrung, die in dem Augenblick gescheht. Von der Wahrheit – also von der Idee – kann es schließlich keine Erkenntnis geben, sondern nur eine Erfahrung im Sinne von augenblicklicher, und eben nicht 36 begrifflicher, Wahrnehmung. Diese Konzeption der Idee, die in den frühen Fragmenten auftaucht, eröffnet einen Weg, um auf eines der Probleme einzugehen, mit dem sich Benjamin in den ersten der philosophischen Forschung gewidmeten Jahren auseinandersetzt: dem Problem der Überwindung des traditionellen Gegensatzes Subjekt-Objekt. Indem er die Begründung der Erkenntnis von dem transzendentalen und erkennenden Subjekt zu der Idee hin verlagert – bisher nicht besser spezifiziert – erahnt Benjamin die Möglichkeit einer anderen Konzeption – die nicht mehr im traditionellen Sinne metaphysisch ist, der Erkenntnistheorie und – wie wir bemerken werden – vielleicht der Konzeption des Seins. 37 ZWEITES KAPITEL DAS ZWEIDEUTIGE ANTLITZ DER WAHRHEIT. DER URSPRUNG EINER THEORIE DER IDEEN 1. Probleme, Fragen. Allgemeine Linien Die Absicht dieses Kapitels ist nicht so sehr, die in dem vorherigen Kapitel aufgeworfenen Probleme zu lösen, sondern vielmehr zu sehen, von welchen Lektüren und in welcher Masse Benjamin in der Konstruktion seiner Erkenntnistheorie beeinflusst war. Ich möchte zeigen, dass die Fragen, die sich Benjamin am Anfang seiner philosophischen Aktivität stellt, und seine Versuche, eine Erkenntnistheorie – und im weitesten Sinne eine Ideenlehre – zu thematisieren, sich in einem besonderen Kontext einfügen, der aber nicht so sehr einer spezifischen philosophischen Strömung unterliegt. Vielmehr handelt es sich dabei um eine genaue Richtung von Problematiken, die gewiss mit bestimmten Autoren verbunden sind, vor allem aber mit einer Problemgeschichte. Der Ursprung von Benjamins Erkenntnistheorie und seiner Ideenlehre reicht - meiner Meinung nach - auf seine Auseinandersetzung mit einigen Begriffen, Problemen und Gedanken zweier Autoren zurück: J. W. Goethe und Hermann Cohen. Der Versuch, der sich hinter dem ganzen begrifflichen Apparat, den Benjamin von den Lektüren Goethes und Cohens übernimmt und in den ersten Jahren seiner philosophischen Aktivität zu entwickeln versucht, versteckt und schließlich offenbart, ist nichts anderes als ein Versuch eine neue Theorie der Erkenntnis - und der Erfahrung – zu entwickeln, die den traditionellen Gegensatz Subjekt-Objekt überholt. Es ist der Versuch einer Begründung, der aber vor allem ein Versuch der Legitimation der Erkenntnis ist. Doch habe ich nicht vor, an dieser Stelle das Argument zu vertiefen, weil es Gegenstand der ganzen Arbeit ist. Aber meiner Auslegungshypothese nach ist es, bereits seit der Schrift über das Trauerspiel und dann vor allem mit den späten Schriften,1 genau dieser Versuch der Legitimation, der aufgehoben wird. Bereits seit Ursprung des deutschen Trauerspiels, wo Begriffe und 1 Vgl. unten Kap. III. 38 Terminologie, die in den Jahren zuvor übernommen wurden, eine andere Anwendung finden, als im Vergleich zu den Texten vor 1927 – dem Jahr der Veröffentlichung des Buches über das Trauerspiel, besteht eine Entwicklung im Denken Benjamins. Einige Begriffe verschwinden sogar, wie beispielweise im Fall des Symbols, und werden von Begriffen gegensätzlicher Bedeutung ersetzt. Ändert sich die philosophische Einstellung Benjamins? Ändert sich das intellektuelle Ziel seiner Philosophie? Wir könnten im Folgenden vereinfachen und dann dies im Laufe der Arbeit beweisen: in der Frühperiode versucht Benjamin eine Theorie der Erkenntnis und der Erfahrung zu begründen, indem er mit einer Auseinandersetzung mit Kant und Cohen beginnt, der er aber Elemente hinzufügt, die ihn auf den Weg der Metaphysik bringen. Seine Konzeption der Idee ist nämlich nicht funktionalistisch, oder besser gesagt, sie ist nicht nur funktionalistisch im Sinne Kants und Cohens, sondern auch – und vor allem – metaphysisch: Die Idee ist das metaphysische Fundament des Seins. In welchem Sinn sind nun die Ideen ein anderes Sein als das der phänomenalen Realität? Im Trauerspielbuch bemerken wir eine Art von Stillstand des begründenden Denkens: Benjamin sucht weder nach einer Legitimation der Erkenntnis, noch deren Begründung. Er spricht nicht mehr von Erkenntnistheorie, sondern von Erkenntniskritik, in der der Terminus „Kritik“ nicht den Kantischen Sinn einer Begründung der Erkenntnis gewinnt. Dennoch wird der Begriff der Erkenntnis ein „Sich-Darstellen“ der Wahrheit und der Idee in dem Augenblick der Erkennbarkeit; ist es also der Zufall und nicht das erkennende Subjekt, der die Hauptrolle in der Erkenntnistheorie Benjamins spielt? Dies sind nur allgemeine Fragen, die – ich wiederhole – keine ausreichende Antwort in dem vorliegenden Kapitel erhalten werden, das der Analyse des Ursprungs der Ideenlehre Benjamins und dem Einfluss, die J. W. Goethe und Hermann Cohen2 auf sie hatten, gewidmet ist. 2 Für die Studien über die Beziehung Cohen-Benjamin, verweise ich auf die folgenden Schriften hin: LISELOTTE WIESENTHAL, Zur Wissenschaftstheorie Walter Benjamins, Athenäum Verlag, 1973 Frankfurt/M.; ASTRID DEUBER-MANKOWSKY, Der frühe Walter Benjamin und Hermann Cohen: Jüdische Werte, Kritische Philosophie, vergängliche Erfahrung, Vorwerk 8, 2000 Berlin; BERND WITTE, Walter Benjamin. Der Intellektuelle als Kritiker, Stuttgart 1976; PIERFRANCESCO FIORATO, L’ideale del problema. Sopravvivenza e metamorfosi di un tema neukantiano nella filosofia del giovane Benjamin, in Conoscenza, valori e cultura. Orizzonti e problemi del neocriticismo, a cura di Stefano Besoli e Luca Guidetti, Quaderni di Discipline Filosofiche, Anno VII, Nuova Serie, n. 2, Vallecchi Editore, Firenze 1997, SS. 361-386. 39 2. Der Kunstinhalt: Die wahre Natur In dem letzten Teil von Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik, der „Die frühromantische Kunsttheorie und Goethe“ betitelt ist, beschäftigt sich Benjamin mit einem Problem, das ich in den nächsten Abschnitten vertiefen möchte: die Beziehung zwischen Urbild und Bild, d.h. zwischen der Idee und dem Phänomen, die in dem oben zitierten Titel auf die Ästhetik und auf die kritische Theorie der Kunst bezogen wird. Ich beabsichtige daher zu analysieren, wie Benjamin an Goethe anknüpft, um eine Ideenlehre zu entwickeln, die aber nicht nur mit der Ästhetik verbunden ist, sondern die vielmehr das Fundament einer Erkenntnistheorie ist, die der Mittelpunkt der Gedanken und der frühen Schriften Benjamins ist und bleibt. Doch sowohl die Erkenntnistheorie als auch die Ästhetik, zu der die Erkenntnistheorie Benjamins hinführt – denn die Idee, wird uns in Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik gesagt, offenbart sich in dem Kunstwerk, und dieses scheint die einzige Möglichkeit zu sein, das Unsichtbare sichtbar zu machen –, haben eine Theorie des Seins als Grundlage, die von einer Lektüre Goethes geprägt ist. Darüber hinaus muss man ab sofort betonen und im Hinterkopf behalten, dass mit diesem und den folgenden Paragraphen beabsichtigt wird, sich mit der Benjaminianischen Interpretation Goethes zu beschäftigen, und deshalb mit dem Denken Benjamins. Die Lektüre Goethes, von anderen Autoren – z.B. Elisabeth Rotten, Georg Simmel3 – oft filtriert, spielt eine wichtige Rolle im Denken Benjamins, der ihre Begriffe und Terminologie innerhalb einer eigenen Kunstphilosophie und Erkenntnistheorie nutzt. Nach der Theorie, die Benjamin in dem letzten Teil der Schrift4 darstellt, unterscheidet sich die Kunstphilosophie Goethes von derjenigen der Frühromantiker, insofern als dass sie als Ausgangspunkt und Mittel das „Ideal“, d.h. den Kunstinhalt, hat. Während sich also die Frühromantiker damit beschäftigten, die Idee der Kunst – d.h. die Form der Kunst und ihre Methode – theoretisch zu bestimmen, verlieh Goethe der philosophischen Bestimmung des idealen Kunstinhalts eine wichtigere Bedeutung, und gerade in diesem Punkt nimmt seine Ästhetik Anstoß. Interessant ist der Unterschied, den Benjamin zwischen Idee und Ideal macht: wenn die Idee der a priori der Form ist, ist das Ideal – nach Benjamins Lesart Goethes – der a priori des Kunstinhalts. Goethe nennt also den Kunstinhalt „Ideal“. Laut Benjamin handelt es sich um einen Inhalt, dessen erkenntnistheoretisches Wesen der Idee im platonischen5 Sinne ähnlich ist, und 3 Vgl. GSI/ 110 und GS I/3 955f. Vgl. GS I/1 112. 5 Vgl. GSI/1 214; Das ist die einzige Stelle, wo Benjamin unterscheidet die Idee vom Ideal. 4 40 er wird von Benjamin als der Inbegriff aller reinen Inhalte bezeichnet, die Goethe Urbilder nennt. Die Kunstwerke sind nicht diese reinen Inhalte, aber denen können sie sich in verschiedenen Graden nähern. Mit anderen Worten, die Urbilder befinden sich auf einer anderen ontologischen Stufe verglichen mit den einzelnen Kunstwerken. Das Urbild ist nur anschaubar, und allein der Künstler kann eine Anschauung davon haben. Dagegen sind die einzelnen Werke sichtbar und, allgemeiner, wahrnehmbar. Benjamin beschreibt die Beziehung zwischen dem Kunstwerk und dem Urbild mit dem Begriff des „Gleichnisses“: dieser Begriff bezeichnet die Beziehung zwischen dem, was naturgemäß unsichtbar ist, und dem, was dagegen sichtbar ist; ebenso zwischen dem, was nur anschaubar ist und dem, was dagegen wahrnehmbar wird. Das Urbild, d.h. das Ideal, ist schließlich ein anschaubarer Inhalt, der durch das Kunstwerk wahrgenommen werden kann, ohne aber dass es jemals dazu kommt, dass es sich vollständig in ihm offenbart. Zuerst gilt es zu bemerken, dass wir es mit einem Problem zu tun haben, welches das Denken Benjamins seit seinen ersten Schriften charakterisiert: nämlich die Beziehung zwischen der Zeitlosigkeit der Idee und der gleichzeitigen Notwendigkeit deren Verkörperung in dem Phänomen, in dem Endlichen, zu begreifen. Zweitens ist es interessant, dass dieses Problem von Benjamin auf die Ästhetik begrenzt wird, d.h. auf die Beziehung der Idee zum dem Kunstwerk. Die Kunst, führt Benjamin weiter aus, ist nicht schöpferisch, insofern ihr Inhalt, das Urbild, bereits gegeben ist, oder besser, bereits auf-gegeben, d.h. als Aufgabe gegeben ist. Das Urbild geht jedem Kunstwerk voran und findet sich in der Natur: es ist sogar Natur. Wenn man aber über Natur spricht, erklärt Benjamin, muss man darunter weder die phänomenale Natur der Welt, noch die Natur als Objekt der Wissenschaft, sondern die „wahre Natur“ verstehen, die mit der Sphäre der Urphänomene, d.h. der Urbilder und der Ideale, zusammenfällt. Es ist also die „wahre Natur“, die den Kunstinhalt ausmacht und gleichzeitig wird sie nur in der Kunst sichtbar. Von daher schließt Benjamin darauf, dass der Kunstinhalt „sichtbare Natur“ ist: “Das Dargestellte kann nur im Werk gesehen, außerhalb desselben allein angeschaut werden. Ein naturwahrer Inhalt des Kunstwerks würde voraussetzen, dass die Natur der Maßstab sei, an dem er gemessen würde; dieser Inhalt selbst soll aber sichtbare Natur sein. Goethe denkt im Sinn der erhabenen Paradoxie jener alten Anekdote, nach der die Sperlinge auf die Trauben des großen griechischen Meisters flogen. Die Griechen waren keine Naturalisten, und die übermäßige Naturwahrheit, von der die Erzählung berichtet, scheint nur eine großartige Umschreibung für die wahre Natur als Inhalt der Werke selbst. Hier käme nun allerdings alles auf die nähere Definition des Begriffes der ‚wahren Natur’ an, indem diese 41 ‚wahre’ sichtbare Natur, welche den Inhalt des Kunstwerks ausmachen soll, nicht nur nicht mit der erscheinenden sichtbaren Natur der Welt ohne weiteres identifiziert, sondern vielmehr sogar zunächst streng begrifflich von ihr unterschieden werden muss“.6 Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik bezeugt Benjamins Positionierung zugunsten der Ästhetik gegen die Naturwissenschaft, denn die einzige Möglichkeit, welche die Idee hat um sich zu offenbaren, ist nicht in den natürlichen Phänomenen – in denen es die Idee, wenn auch nicht deutlich sichtbar, gibt – sondern in dem Kunstwerk: “[...] in dem [sich] freilich danach dann das Problem einer tiefern essentiellen Identität der ‚wahren’ sichtbaren Natur im Kunstwerk und in der Erscheinungen der sichtbaren Natur präsenten (vielleicht unsichtbaren, nur anschaubaren, urphänomenalen) Natur [...] stellen würde. Und dies würde möglicher und paradoxer Weise so sich lösen, dass nur in der Kunst, nicht aber in der Natur der Welt, die wahre, anschaubare, urphänomenale Natur abbildhaft sichtbar würde, während sie in der Natur der Welt zwar präsent aber verbogen (durch die Erscheinung überblendet) wäre“.7 Insofern behauptet Benjamin, dass alle Anstrengungen Goethes, in der Beobachtung der Phänomene und der Prozesse der Natur die Urphänomene zu finden, trotz allem auf die Kunst gezielt waren. Genauer gesagt waren solche Mühen darauf gerichtet, die Idee der Natur zu begreifen und sie Objekt der Kunst werden lassen8: Die Idee der Natur ist das, was den idealen Kunstinhalt bestimmen muss, weshalb die Urphänomene in der Natur erforscht sind. 3. Die Rezeption des Urphänomens. Der Ort der Wahrheit Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik wurde im Jahr 1919 geschrieben und im Jahr 1921 herausgegeben. Aus den selben Jahren stammen die Fragmente, die wir in diesem Abschnitt betrachten. Während Benjamin im Werk über den Begriff der „Kritik“ Idee und Phänomen in einem ästhetischen Kontext aufeinander bezieht, werden in den Fragmenten die selben Goethischen Begriffe auch innerhalb einer Erkenntnistheorie benutzt: wir finden 6 GS I/1 113. Ibidem. 8 Vgl. GS I/1 112. 7 42 also eine Alternation der Stellen, in denen ein Entwurf einer Ästhetiktheorie und ein Entwurf einer Erkenntnistheorie erscheinen, ohne irgendeine Systematik. Laut diesen Fragmenten offenbart sich die Wahrheit – d.h. die Idee - teils in der Kunst und teils in der Erkenntnis, teils in einer Augenblicklichkeit und teils in einer Fortschrittlichkeit. Wie bereits gesagt wurde, aber an dieser Stelle wiederholt werden sollte, waren die Fragmente von Benjamin nicht zur Veröffentlichung gedacht. Es handelt sich um ein Sammelsurium der Gedanken – manchmal einfach um Aphorismen – völlig unsystematisch, die aber wichtige Hinweise enthalten um zu verstehen, wie und von welchen Problematiken das Denken Benjamins - und insbesondere die Ideenlehre - ausgeht und was sich dann in der Philosophie der folgenden Jahre entwickeln wird. Ich erforsche nun diese Fragmente, möchte aber noch einmal betonen, dass Benjamin in ihnen weder eine begriffliche Unterscheidung, noch eine terminologische zwischen „Wahrheit“ und „Idee“ feststellt. Im Fragment 20 Zum verlorenen Abschluss der Notiz über die Symbolik in der Erkenntnis schreibt Benjamin, dass die Naturforschung Goethes die Repräsentantin der echten und vollzogenen theoretischen – in Symbolen gefassten und begriffenen – Erkenntnis ist.9 Das Urphänomen wird in dem selben Fragment als „Symbol“, als „Ideal“ und schließlich als „Idee“ definiert: “Das Urphänomen ist ein systematisch-symbolischer Begriff. Es ist als Ideal Symbol. Es war [das Urphänomen] [...] als Idee außerdem bezeichnet. Aber in welchem Sinne? Im rein-theoretischen Sinne, in welchem aus der Idee die Begriffe derivieren. Im Sinne der Idee als Aufgabe. – Das Ideal dagegen stellt die Beziehung zur Kunst, oder eigentlich zu reden, zur Wahrnehmung dar“.10 Nach dem, was Benjamin in dem Fragment schreibt, ist das Urphänomen zunächst ein systematisch-symbolischer Begriff; insofern es Symbol ist, ist das Urphänomen Ideal. Das Urphänomen wird auch als Idee bezeichnet. Wenn es Ideal ist, wird es auf die Kunst und auf die Wahrnehmung bezogen, wenn es aber Idee ist, hat es eine theoretische und erkenntnistheoretische Bedeutung – vom Urphänomen als Idee sind die Begriffe abgeleitet – und es ist eine Aufgabe für die Erkenntnis. Darüber hinaus ist das Urphänomen als Idee mit einer progressiven und unendlichen Zeitauffassung verbunden – die erinnert uns an die Kantische und Neukantische Konzeption der progressiven Erkenntnis, der man sich ständig 9 Vgl. GS VI 38. Ibidem. 10 43 nähert, die aber niemals in ihrer Ganzheit erreicht wird.11 Das Urphänomen als Ideal ist dagegen mit dem Augenblick und mit der Unmittelbarkeit der Wahrnehmung verbunden: man kann eine unmittelbare und augenblickliche Erfahrung der Wahrheit, enthalten in dem einzelnen Kunstwerk, haben. Auch in Nachträge zu: Über die Symbolik in der Erkenntnis, ein Teil des Fragments 20 - von Benjamin erst später verfasst - wird Goethe zitiert. Und genauso wie bei dem Fragment 20 wird dort gesagt, dass sein Denken repräsentativ ist, dieses Mal aber wieder nur in bezug auf die Kunsttheorie. Benjamin unterstreicht den Unterschied zwischen Wahrheit und Wahrheiten – der in dem vorherigen Kapitel analysiert wurde – und fügt hinzu, dass jede einzelne Wahrheit die Wahrheit enthält: der Gedanke Goethes ist repräsentativ für eine nichtphilosophische und unsystematische, also eine künstlerische Einsicht der Wahrheit, denn sie manifestiert sich teilweise, also niemals ganz, in der Kunst und in einer nicht-progressiven Art, sondern unmittelbar innerhalb jedes einzelnen Kunstwerks. Dies ist eine Wahrheit, die von jener wissenschaftlichen und systematischen verschieden ist, und die, genau wie bei der Schrift über den Begriff der „Kritik“ und wie bei dem Fragment 20, auf die zweite Bedeutung von „Urphänomen“, nämlich die des Symbols und des Ideals, hinweist. Kann man sagen, dass Benjamin zwei verschiedene Bedeutungen von Wahrheit, die eine wissenschaftlich, systematisch und die andere künstlerisch, nicht-begrifflich und unmittelbar, annimmt? Fragen wir uns nun an dieser Stelle, welche Beziehung zwischen den beiden Termini „systematisch“ und „symbolisch“ besteht, der erste von Benjamin auf die Erkenntnis und der zweite auf die Kunst bezogen. Handelt es sich um ein Verhältnis von Gegensätzen? Mit anderen Worten, kann das, was systematisch ist, zugleich symbolisch sein und umgekehrt? In dem oben erwähnten Fragment 20 wird das Urphänomen als ein „symbolischsystematischer Begriff“ bezeichnet, indem zwei anscheinend gegensätzliche Begriffe zusammengefasst werden. Um zu verstehen, ob bei Benjamin die künstlerische Wahrheit von jener wissenschaftlichen zu unterscheiden ist, oder ob es im Gegenteil um die eine selbe Wahrheit, allerdings unterschiedlich wahrgenommen, geht, müssen wir zunächst auf die Analyse der letzten zwei Fragmente eingehen. In dem Fragment Erkenntnistheorie, behauptet Benjamin – über das Jetzt der Erkennbarkeit sprechend –, dass nur in ihm die Wahrheit ein „systematisch begrifflicher“12 Zusammenhang ist, und er definiert das Urphänomen als einen symbolischen Begriff. Als ob die Wahrheit in erster Linie ein Symbol wäre, und nur in dem Augenblick, eben in dem Jetzt 11 12 Siehe oben, Kap. I. GS VI 46. 44 der Erkennbarkeit, irgendwie begrifflich verständlich würde. Schließlich, wenn es in den vorherigen Fragmenten in dem Kunstwerk ist, wo sich die Wahrheit als solche offenbart – wenn gleich in einer nicht-begrifflichen und nicht-philosophischen Art –, wird in dem Fragment Erkenntnistheorie die Wahrheit auf die Erkenntnis bezogen und sie hat in der Erkenntnis die Möglichkeit, sich zu offenbaren: sie offenbart sich in dem Augenblick, und bloß in dem Augenblick wird die Wahrheit vom wahrnehmbaren Symbol zu einem Begriff, also erkennbar. In diesem Fragment fehlt aber der Hinweis auf die unendliche Aufgabe. Es wird sogar gesagt, dass sich die Wahrheit auch in der Erkenntnis unmittelbar und augenblicklich offenbart. Unklar ist das Fragment 26 Wahrheit und Wahrheiten. Erkenntnis und Erkenntnisse, in dem die Wahrheit als „Inbegriff der Erkenntnisse als Symbol“13 bezeichnet wird. Sie ist aber nicht der Inbegriff der unendlichen Wahrheiten, denn die Wahrheit drückt sich im System aus, während einzelne Wahrheiten sich weder systematisch noch begrifflich ausdrücken, sondern in der Kunst: „die Kunstwerke sind der Ort der Wahrheiten“.14 Wir finden also in den Fragmenten Stellen, an denen Benjamin schreibt, dass die Wahrheit, d.h. die Idee, sich in dem Kunstwerk als eine nicht-philosophische und nichtbegriffliche Erfahrung offenbart, und ebenso Stellen, an denen die Wahrheit eine theoretische Bedeutung hat, sie also Aufgabe für die Erkenntnis ist und als „Inbegriff“ der Erkenntnis d.h. der einheitliche Zusammenhang, aber nicht als Summe verstanden, aller Erkenntnisse – definiert wird. Darüber hinaus finden wir Stellen, an denen sich die Wahrheit, also die Idee, in dem Augenblick offenbart und Stellen, an denen sie aber als unendliche Aufgabe für die Erkenntnis betrachtet wird. Das einzige Element, das die Fragmente gemeinsam haben, ist, dass die Wahrheit ständig mit dem Symbol verknüpft wird, und dass sie oft zu dem goethischen Begriff des Urphänomens zurückgeführt wird. Es ist ebenso wichtig die Hypothese zu betonen, dass der Benjaminsche Dualismus Idee-Phänomen, sowohl auf der ästhetischen Stufe als auch auf der erkenntnistheoretischen betrachtet, eine zugrundeliegende Metaphysik hat, d.h. eine Theorie des Seins, die auf dem radikalen Unterschied zwischen Idee und Phänomen beruht, und dass diese Theorie ursprünglich Benjamins Lektüre der Frühromantik und insbesondere Goethes entstammt. 13 14 GS VI 47. Ibidem. 45 4. Das zweideutige Antlitz der Wahrheit Aus der vorherigen Analyse der frühen Fragmente geht also ein Grenzbegriff der WahrheitIdee hervor, der, da ein solcher Begriff sowohl der Erkenntnis als auch der Erfahrung zugrunde liegt, in ihnen die doppelte Valenz, die wir in dem Kapitel zuvor angetroffen haben, zustandebringt: Einerseits die Unendlichkeit der Aufgabe, andererseits die Unmittelbarkeit einer Erfahrung und einer Erkenntnis, die augenblicklich ist. Welchen Ursprung hat bei Benjamin diese doppelte Konzeption der Wahrheit? 4.1 Idee als unendliche Aufgabe: Neukantianismus Cohens Aus dem Jahr 1923 stammt das Fragment Die unendliche Aufgabe. Es ist in zwei Teile geteilt: Als Begründung der Autonomie und Als Begründung der Methode. In dem ersten Teil bezeichnet Benjamin die Wissenschaft als unendliche Aufgabe15, oder besser, die Wissenschaft wird ihrer Form nach als unendliche Aufgabe definiert. Unendliche Aufgabe heißt nicht eine Aufgabe, deren Lösung unendlich ist, sondern unendlich ist das, was niemals bloß gegeben werden kann, sondern was also als Aufgabe gegeben ist: es ist auf-gegeben. Die unendliche Aufgabe findet sich in der Wissenschaft. Sie ist sogar die Wissenschaft: die Wissenschaft ist die Einheit der unendlich gegebenen Fragen, die jedoch endlich sind; die Einheit dieser Fragen als solche ist aber ein Begriff höherer Mächtigkeit im Vergleich zu der bloßen Summe der unendlichen endlichen Fragen. Das bedeutet, dass die Wissenschaft als Einheit weder gegeben noch erfragbar sein kann: Sie ist Aufgabe. Wie Benjamin spezifiziert, ist sie nichts, soweit sie nicht eine unendliche Aufgabe ist.16 In dem zweiten Abschnitt des Fragmentes kehrt Benjamin zu dem Begriff der Aufgabe zurück. Es wird uns gesagt, dass die Wissenschaft in sich selbst weder unendlich noch endlich ist, sondern dass, nur insofern sie Aufgabe ist, sie unendlich ist. Das heißt nicht, dass die Wissenschaft als unendlich aufgegeben ist, sondern dass sie als aufgegeben unendlich ist. In diesem Sinne ist die Aufgabe der Wissenschaft, die ihr aufgegeben ist, die Lösbarkeit. Benjamin versucht also eine Idee der Einheit der Wissenschaft zu theoretisieren, die eine Idee im Sinne Kants, d.h. Ausgangpunkt und intellektuelles Ziel der Forschung, ist. Es ist noch wichtig zu bemerken, dass hier die Wissenschaft eine Idee ist, während in der Handschrift, 15 16 Vgl. GS VI 51. Vgl. GS VI 52. 46 Theorie der Kunstkritik17 betitelt, und in dem dritten Abschnitt der Schrift Goethes Wahlverwandtschaften der Begriff der „unendlichen Aufgabe“ der Philosophie und nicht mehr der Wissenschaft zugeschrieben wird. Wie bei dem oben betrachteten Fragment, und ebenso in der Handschrift Theorie der Kunstkritik, wird die Philosophie als unerfragbare Einheit, d.h. die nicht erfragbar sein kann, bezeichnet. Eine Einheit, die nicht die Summe der unendlichen endlichen Fragen ist, die sich aber auf einer anderen Stufe in Vergleich zu ihnen befindet. Es bleibt zu erklären, ob es sich um einen logischen oder ontologischen Unterschied handelt. Benjamin schreibt mit den selben Worten des vorherigen Fragmentes, dass die Philosophie, als System verstanden, eine Antwort höherer Mächtigkeit ist: “Die Einheit der Philosophie, ihr System, ist als Antwort von höherer Mächtigkeit als die an Zahl unendlichen stellbaren, endlichen Fragen. Sie ist von höherer Art und Mächtigkeit, als der Inbegriff all dieser Fragen fordern kann, weil die Einheit der Antwort nicht erfragt werden kann. Sie ist also auch von höherer Mächtigkeit als irgend eine einzelne philosophische Frage, ein Problem fordern kann“.18 Benjamin verwendet aber in dem Kontext der Handschriften zwei neue Begriffe hinsichtlich des Fragmentes: das „Weiterfragen“ und das „Ideal des Problems“. In Theorie der Kunstkritik wird die Philosophie als ein System und als eine unendliche Aufgabe betrachtet: sie ist eine Einheit, für die keine Frage existiert, die sie erfragen kann: es ist ein unablässiges Aufkommen weiterer Fragen, die aber eine Einheit sind, für welche die einzige Antwort das System der Philosophie selber wäre, d.h. die Ganzheit endlicher Fragen, die gestellt werden können. Benjamin verwendet in diesem Zusammenhang die Termini „Weiterfragen“ und „Zurückfragen“, beide auf das unendliche Verfahren der Frage-Antwort bezogen. Das alles weist sofort auf einen Autor hin, der in seiner Logik des reinen Denkens einen Begriff des Denkens als unendlichen Aufgabe und als dialektisches Verfahren theoretisiert, wonach jede Antwort eine neue Frage aufwirft, bis ins Unendliche: Hermann Cohen. Bei Cohen ist die Idee das, was das Denken begründet, sie ist sogar das Verfahren des Denkens selbst, als eine unaufhörliche Aktivität verstanden, wie eben ein Weiterfragen. Die 17 Vgl. GS I/3 833. Es handelt sich um eine Variante für den dritten Teil der Schrift über die Goethes Wahlverwandtschaften. 18 GS I/3 833. 47 Idee ist bei Cohen eine Methode, eine Hypothese, die das Gesetz ausdrückt, wodurch das Verständnis sein Objekt, d.h. das Sein, durch unablässige Begründungen „produziert“. Die Idee ist allerdings für den Begründer der Neukantischen Schule in Marburg – ebenso wie bei Kant – nicht ein Sein, sondern ein Sollen, d.h. die Idee ist keineswegs eine metaphysische Struktur, sondern eine logische Funktion, die eben funktioniert. Die platonische Dialektik ist das Modell, worauf sich Cohen bezieht: „Hierbei betrachtet er die Voraussetzungen nicht als unbedingt Erstes und Oberstes, sondern in Wahrheit als bloße Voraussetzungen, gleichsam als Stufe und Ausgangpunkte, damit er bis zum Voraussetzungslosen vordringend an den wirklichen Anfang des Alls gelange, und wenn er ihn erfasst hat, an alles sich halte, was mit ihm im Zusammenhang steht, und wieder zum Ende herabsteige, ohne irgendwie das sinnlich Wahrnehmbare dabei mit zu verwenden, sondern nur die Ideen selbst nach ihrem eigenen innen Zusammenhang, und mit Ideen auch abschließe“.19 Das Denken bei dem Neukantischen Philosophen schreitet durch Trennung und Vereinigung fort,20 ohne jemals eine endgültige Vollendung zu erreichen: „Die Vereinigung ist nicht als ein Ereignis, dessen Vollzug zum Abschluss gekommen wäre; sondern als eine Aufgabe, und das als Ideal einer Aufgabe; wie nur die Logik eine solche Aufgabe stellen, ein solches Ideal aufstellen kann. Denn die Aufgabe, die dem Denken im Urteil gestellt wird, darf niemals zur Ruhe, zur Vollendung gekommen betrachtet werden“ .21 Die Bewegung des Denkens ist ein Weiter-fragen: der Begriff, d.h. die Einheit des Objekts, ist niemals ein Abschluss, sondern immer wieder eine neue Frage: „Das ist die tiefe Bedeutung des sokratischen Begriffes, der, nach der Auslegung Cohens, nicht in der Frage: ‚was ist es’ besteht, sondern in der Frage selber: der Begriff ist wesentlich Frage und von daher Aufgabe“.22 So lassen sich deutlich die Analogien zwischen der Konzeption Cohens - bei dem die Philosophie ein immer offenes und in ständiger Bewegung befindliches systematisches Denken ist - und der Position Benjamins - die in den Frühschriften kaum vertieft ist - 19 PLATON, Der Staat, 511 b-c, vgl. auch A. POMA, La filosofia critica di Hermann Cohen, Mursia, Milano S.95. Vgl. ANDREA. POMA, op. cit. S.98. 21 HERMANN COHEN, Logik der Reinen Erkenntnis, Berlin 1919, S. 64. 22 ANDREA POMA, op. cit. S.100. 20 48 feststellen. Wobei der Neukantische Begriff der unendlichen Aufgabe Benjamin nicht auszureichen scheint. Man könnte nämlich sagen, dass die unendliche Aufgabe für Benjamin nicht nur die wissenschaftliche Methode des Neukantianismus ist. Darüber hinaus enthält die Philosophie als System und unendliche Aufgabe bei Benjamin ein Grundelement, das mit dem Neukantianismus Cohens nicht übereinkommen kann: sie ist nämlich mit einem metaphysischen Gedanken verbunden. In diesem Zusammenhang ist das kurze Fragment Zweideutigkeit des Begriffs der „Unendlichen Aufgabe“ in der Kantischen Schule interessant, in dem Benjamin den Begriff der unendlichen Aufgabe in der Kantischen Schule analysiert. In dem Fragment unterscheidet Benjamin zwei Bedeutungen des Begriffs der „unendlichen Aufgabe“. Die erste Bedeutung ist diejenige, die das Ziel in einen entfernten, utopischen Punkt einsetzt, der, so schreibt Benjamin, wie ein Gipfel ist, dem man sich fortlaufend nähert, der aber trotzdem immer unendlich fern bleibt, weil sich - nach der Metapher des Gipfels - in dem Annährungsweg immer wieder neue Täler mit unendlichen Gipfeln eröffnen. Schließlich ist dieser Begriff der „unendlichen Aufgabe“ ein empirischer Begriff, der also nicht a priori betrachtet werden kann. Die zweite Bedeutung der unendlichen Aufgabe, jene, die Benjamin dem Neukantianismus zuschreibt, besteht jedoch darin, das Ziel in eine unendliche Entfernung zu setzen, die aber auch und vor allem unsichtbar ist. Eine solche Bedeutung, schließt Benjamin, ist eine „nicht apriorische aber vollkommen leere Art der Unendlichkeit ihrer Aufgabe“.23 Benjamin zufolge ist der Begriff der unendlichen Aufgabe also in der Neukantischen Schule ein leerer Begriff, da das Ziel „nicht scheinbar sondern wirklich ganz unabsehbar in die Ferne“ flüchtet.24 Darüber hinaus ist es interessant – wie Pierfrancesco Fiorato zu Recht bemerkt25 – dass Benjamin in Theorie der Kunstkritik eben den Terminus „Weiterfragen“ verwendet, um eine Tendenz „auf ein Weiterfragen, jene Tendenz, welche den Anlass zu den flachen Auslegungen des Wortes von der Philosophie als unendlichen Aufgabe gegeben hat“26 zu bezeichnen; diesem Terminus aber wird derjenige des „Zurückfragens“ entgegengesetzt, mit dem Benjamin eben das Zurückfragen „nach der verlornen Einheit der Frage, oder nach einer bessern Frage, in welcher die Einheit der Antwort zugleich erfragt wäre“27 versteht. 23 GS VI 53. GS VI 53. 25 PIERFRANCESCO FIORATO, op. cit. S.363ff. 26 GS I/3 833. 27 GS I/3 833. 24 49 Freilich weder vertieft Benjamin, noch argumentiert er diesen Unterschied.28 Von daher kann man also bloß wagen zu behaupten, dass das Weiterfragen, worauf Benjamin sich bezieht, schon wieder ein Hinweis – in negativo – auf den Neukantianismus ist. Oder besser, unter dem Terminus „Weiterfragen“ versteht Benjamin wahrscheinlich die logische Bedeutung des philosophischen Antwort-Frage-Verfahrens, während im Gegensatz dazu das „Zurückfragen“ einen metaphysischen Ansatz bezeichnet, auf den allerdings die Terminologie Benjamins verweist, für die das Zurückfragen auf die verlorene Frage bezogen ist und es schließlich ein an den Ursprung29 gewandtes Zurückfragen ist. Welche Bedeutung hat also bei Benjamin die „unendliche Aufgabe“, mit der die Philosophie den Intellektuellen betraut? Und in welchem Sinn weist sie auf eine Metaphysik hin? 4.2 Der Funktionalismus der Idee Vor der Analyse des zweiten Teils des Textes Theorie der Kunstkritik, der wichtig für meine Arbeitshypothese ist, halte ich es für notwendig kurz einen Text zu betrachten, den Benjamin in den Jahren, in denen er sich mit der Erkenntnistheorie beschäftigte, las. Es handelt sich um Goethes Urphänomen und die platonische Idee von Elisabeth Rotten, einer Schülerin von Paul Natorp in Marburg. An diesem Text, den Benjamin in Der Begriff der Kunstkritik in der früheren Romantik erwähnt,30 interessiert mich insbesondere jener Teil, wo Elisabeth Rotten die Bedeutung des „Weiterfragens“ und der „unendlichen Aufgabe“ in dem Wissenschaftsbegriff Goethes beschreibt. Elisabeth Rotten, ausgehend von den Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes, bemerkt, dass der Begriff „Typus“, der darin zentral ist, die Neukantische Bedeutung von „Funktion“, d.h. von Idee, im Sinne der Aufgabe und intellektuelles Ziel der Forschung, hat: Der Typus ist nicht ein „Gegeben“, sondern ein „Auf-gegeben“; er ist eine „Setzung des Denkens zur sukzessiven Bestimmung des Sinnlichen“.31 Darüber hinaus behauptet die Autorin, dass der Idee-Typus bei Goethe in sich den Sinn und die Bedeutung der platonischen 28 Vgl. PIERFRANCESCO FIORATO, op. cit. S.362. Siehe unten Kap. III. 30 Vgl. GS I/1 110. 31 ELISABETH ROTTEN, Goethes Urphänomen und die platonische Idee, Gießen 1913, S.44ff. 29 50 Dialektik enthält, d.h. dass der Typus die Beweglichkeit, also die Kinesis, der Begriffe ausdrückt, und das entspricht – mit Neukantischen Worten ausgedrückt – dem unendliche Verfahren des Denkens: “Die Bestimmung muss ins Unendliche gehen, da das zu Bestimmende unendlich, grenzlose ist. Der fortschreitende Charakter des Mannigfaltigen macht es unmöglich, bei irgendeiner Bestimmung stehenzubleiben. Wohl ist die Idee zunächst eine (vorläufige, vorbereitende) Antwort ist auf die unendlich andrängendenden Fragen der sinnlichen Welt; darum bleibt sie aber nicht weniger, vom Standpunkt des Erkennenden aus, eine ewige Frage, nämlich ein unermüdliches Weiterfragen“.32 Elisabeth Rotten findet also in den Naturwissenschaftlichenschriften Goethes platonische Elemente wieder, die auf die Neukantischen Philosophie zurückgeführt worden sind: die Idee als Funktion und Hypothese für die Forschung; das Verfahren des Denkens als unendliche Bestimmung des Sinnlichen und als Weiterfragen, das niemals eine endgültige Ruhe erreicht. Die Idee ist vor allem eine Methode, durch die „das Schwankende, oft Irreführende der Erscheinung, die zum Stillstand nur in der Betrachtung gebracht werden kann, aber auch gebracht werden muss“.33 Das ist aber nicht alles. Die Dialektik, als Bezeichnung und Bestimmung des Phänomens seitens der Idee, besteht – laut Elisabeth Rotten – als ein wichtiger platonischer Aspekt der Schriften Goethes in zwei Sinnen: wenn wir, auf einer Seite die ewige Dialektik – die wir logisch nennen könnten – zwischen Problem und Lösung, Frage und Antwort haben, so gibt es auf der anderen Seite noch eine Dialektik – die ich metaphysisch nennen möchte – zwischen Erscheinung und Idee. Der Idee-Typus der Naturwissenschaftlichenschriften Goethes ist eine reine Idee, schreibt Rotten Goethe zitierend, der es nicht möglich ist und niemals möglich sein wird, eine adäquate Manifestation in der Natur finden zu können. Trotzdem verkörpert sie sich notwendigerweise in eben ihren unangemessenen, phänomenalen Manifestationen. Wenn man von Phänomenen spricht, spricht man von Manifestation der Idee: „Die Idee ist ewig und einzig; dass wir auch den Plural gebrauchen, ist nicht wohlgetan. Alles, was wir gewahr werden und wovon wir reden können, sind nur Manifestationen der Idee“.34 32 ELISABETH ROTTEN, op. cit. S.45. ELISABETH ROTTEN, op. cit. S.47. 34 ELISABETH ROTTEN, op. cit. S.30; J. W. GOETHE, Maximen und Reflexionen, in Goethes Werke, Wegner Verlag, Hamburg 1953-63, Bd. XII S.366. 33 51 Das bedeutet, dass die Idee Funktion und Methode für die Erkenntnis ist, jedoch hat sie auch eine begründende Bedeutung gegenüber dem Phänomen. Mit anderen Worte, nicht nur ist das Phänomen in der Idee begründet, insofern letztere – wie beim Neukantianismus – das Gesetz des Phänomens ist, sondern die Idee ist auch das, durch was das Phänomen in seinem Sein besteht, die sogar dessen Sein bestimmt, indem sie ihm auf diese Weise Bedeutung verleiht. In der Auslegung die Rotten in ihrem Buch gibt und die Benjamin vor Augen hatte, wird das Denken Goethes also vorgestellt, indem es zwei Elemente berücksichtigt. Das erste, Neukantische, das die Idee als Arbeitsmethode, Funktion des Verstandes, Gesetz der Phänomene und Blickpunkt der Erkenntnis betrachtet; die Idee „dient“ in diesem Fall – genauso wie eine logische Funktion „dient“ – dem Denken und der Erkenntnis. Das zweite, das die Idee nicht als eine Form in Bewegung betrachtet, welche die Dialektik des Denkens erzeugt, sondern Rücksicht auf die tatsächliche Präsenz der Idee in dem Schein nimmt: die Dialektik zwischen Idee und ihren Manifestationen. Das wird in dem der Kunsttheorie Goethes gewidmeten Teil des Buchs erklärt. In ihm unterstreicht die Autorin zwei Punkte: 1) Es wird erläutert, dass bei Goethe die Idee eine Art von Vision ist, die sich in erster Linie dem Künstler offenbart, die sich ihm vielmehr vor seinen Augen zeigt: „Das Schöne blieb ihm [Goethe] ein Urphänomen, das sich in seiner letzten Einheit und Tiefe nicht aussprechen lässt, das nur der künstlerisch Begabte besitzt und intuitiv erfasst“.35 Der Künstler hat schließlich vor Augen die Idee als Urbild: eine geistig Erfasste, innerlich Erschaute, durch die jeder Gegenstand der Erfahrung für den Künstler eine Manifestation der Idee wird, oder besser, ein Symbol der Idee „natürlich zugleich und übernatürlich“,36 von der „höchsten Wahrheit“ ohne keine „Spur von Wirklichkeit“.37 2) Es wird betont, dass es der Kunst und damit dem mit einer besonderen Sinnlichkeit begabten Künstler irgendwie zugänglich wäre, was der wissenschaftlichen und vulgären Erfahrung zunächst versteckt bleibt: „Wahrscheinlich ist die Bedingung der Kunst, aber innerhalb des Reiches der Wahrscheinlichkeit muss das Höchste geliefert werden, was sonst nicht zur Erscheinung kommt“.38 Es wird nämlich ein Stufenunterschied zwischen der Kunst und der Wissenschaft erzeugt, denn die Kunst erlaubt das zu begreifen, was in der 35 ELISABETH ROTTEN, op. cit. S. 92. ELISABETH ROTTEN, op. cit. S. 93; J. W. GOETHE, W.A. 47, 265. 37 ELISABETH ROTTEN, op. cit. S 93; J. W. GOETHE, W.A. 47, 12. 38 ELISABETH ROTTEN, op. cit. S. 95; J. W. GOETHE, W.A. 49/2, 18. 36 52 Erscheinung durch die bloße Erfahrung - sowohl vulgär als auch wissenschaftlich - nicht wahrnehmbar werden kann. Eng mit dem Aspekt der Offenbarung der Idee verbunden ist der Begriff des „Symbols“. Das Symbol ist die sichtbare Verkörperung, oder besser die Verkörperung eines sichtbaren Wesens dessen, was seiner Natur nach unsichtbar ist: die Idee. Das Symbol ist die Sache selbst ohne die Sache selbst zu sein. Betrachten wir jetzt ein Zitat, von Rotten übernommen, aus den Maximen und Reflexionen Goethes: “Die Symbolik verwandelt die Erscheinung in Idee, die Idee in ein Bild, und so, dass die Idee immer unendlich wirksam und unerreichbar bleibt und selbst in allen Sprachen ausgesprochen doch unaussprechlich bliebe“.39 Das Symbol ist also ein allgemeiner Fall, der in sich das Besondere enthält. Das Symbol ist die sinnliche Manifestation der Idee. Und der Künstler ist derjenige, der von dieser Idee eine sinnliche Erfahrung hat, als lebendige und unmittelbare Offenbarung dessen, was seinem Wesen nach unerforschbar ist. Elisabeth Rottens Auslegung von Goethe ist ausgesprochen platonisch, allerdings platonisch im Neukantischen Sinne.40 Alles, was in der Natur existiert, ist „nur ein Gleichnis“ einer höheren Realität, die nicht in einem ontologischen Wesen besteht, sondern laut Rotten, in einem heuristischen Prinzip: die Idee ist nicht ein Gegebenes, sondern eine Aufgabe; die Idee hat ja einen begründenden Wert für das Phänomen, aber in dem Sinne, dass sie das Gesetz der phänomenalen Manifestation ist. Die Forschung Elisabeth Rottens zielt nämlich darauf ab, das Denken Goethes innerhalb der Interpretation der Neukantischen Schule zu präsentieren und damit die metaphysische und symbolische Interpretation Goethes zu verblenden. Die Idee ist schließlich für die Autorin – ebenso für die Neukantische Schule – eine Methode und eine Funktion, die dazu dient, die phänomenale Welt zu erklären: Goethe setzt die Begriffe der „Bewegung“ und des „Stillstandes“, die des „Werdens“ und des „Seins“ in Korrelation, er verleiht aber – laut der Autorin – durch die Begriffe der „Anschauung“ und der „Offenbarung“ der Idee der Sinnlichkeit eine übermäßige Bedeutung. Und dies führt notwendigerweise die Korruption der Reinheit des Denkens mit sich. Diese Korruption wird laut Rotten in Goethe durch einer Mangel an Begriffssystematik verursacht. 39 ELISABETH ROTTEN, op. cit. S. 98; J. W. GOETHE, Maximen und Reflexionen, in Goethes Werke, Wegner Verlag, Hamburg 1953-63, Bd. XII S.470. 40 Vgl. PAUL NATORP, Ideenlehre, Leipzig 1903. Bei der Neukantischen Schule ist die Platonische Idee keine Hypostatisierung, sondern das Regulative im Sinne Kants. Kant war nämlich der erste Philosoph, der den Sinn der Ideenlehre Platos wieder entdeckte und aussprach (vgl. Rotten, op. cit. 8ff.). 53 4.3 Idee: unmittelbare Erfahrung der Einheit Wie bereits gesagt hat Benjamin das Buch Urphänomen und die platonische Idee gelesen, und in der Tat ist es möglich, in den frühen Schriften, die wir bisher übergeprüft haben, manche Affinitäten zwischen der jugendlichen Benjaminianischen Auslegung Goethes mit der von Elisabeth Rotten festzustellen: Wir haben z.B. den Begriff des Weiterfragens, von Benjamin zuerst auf die Wissenschaft und später auf die Philosophie bezogen, den Begriff der Idee als unendliche Aufgabe, die Kunst als Möglichkeit für die Idee, sich zu verkörpern und sich sinnlich zu machen, betrachtet. Benjamin übernimmt die Interpretation von Elisabeth Rotten, indem er vor allem das zweite Element hervorhebt, das die Autorin im Denken Goethes unterstreicht, und zwar die Präsenz der Idee in den Phänomenen, die Manifestation der Idee und ihre notwendige phänomenale Verkörperung. Dieser Punkt, so wurde vorher gesagt, ist aber eine Bestätigung der Neukantischen Lektüre Rottens, insofern als die Idee in den Phänomenen als deren Gesetz anwesend ist, jedoch nicht als ein metaphysisch anderes Sein, welches das Sein der Phänomene begründet: das Urphänomen wird – in dem oben zitierten Buch – auf dem Begriff der Idee als Gesetz der Neukantischen Schule zurückgeführt. Die Manifestation des Urphänomens in dem Schein entspricht der Fähigkeit, sie in ihren mannigfaltigen phänomenalen Manifestationen zu erkennen. Benjamin - zumindest in seinen jugendlichen Schriften - legt dagegen die Anwesenheit der Idee in dem Phänomen mehr in einem metaphysischen als in einem funktionalistischen Sinne aus und betont den sinnliche Aspekt der Idee durch den Begriff der „Wahrnehmung“. Verfolgen wir nun wie. Daher kehren wir zunächst zu dem Text Theorie der Kunstkritik zurück. Wie ich bereits oben unterstrichen habe, zentriert sich der erste Teil der Schrift um den Begriff des „Weiterfragens“ und um die „unendliche Aufgabe“, welche die Philosophie in ihrer Ganzheit und Einheit ist. Wir haben auch gesagt, dass diese Richtung des Gedankenganges Benjamins auf den ersten Blick auf Neukantischen Absichten zu beruhen scheint. Allerdings geht Benjamin ein Schnitt weiter, indem er seinem Gedankengang der Neukantischen Schule fremde Elemente hinzufügt, die eben auf eine vielmehr metaphysischere Lektüre Goethes zurückgeführt werden können. Ein Beispiel dafür ist der Begriff des „Ideals des Problems“, den wir in der Mitte des Textes, in bezug auf das Verhältnis zwischen der Einheit der Philosophie und dem Kunstwerk, finden. „Das Ideal des Problems“ wird auf die Philosophie als System bezogen, und zwar auf die virtuelle Frage, welche die Einheit der Philosophie – eben virtuell – erfragt. Es wurde zuvor gesagt, dass die Einheit der Philosophie als System auf 54 keinen Fall erfragbar ist, sondern sie weist auf eine unaufhörliche Alternierung von Fragen und Antworten hin. Dieser virtuellen Frage aber entspricht eine virtuelle Antwort, die das System selber ist. Die Frage, die virtuell das System erfragt, erhält als virtuelle Antwort das System selber: d.h. die Wahrheit, als die Einheit der einzelnen Wahrheiten verstanden, die aber niemals deren Summe ist. Das System als Antwort der virtuellen Frage wird - wie bei dem Neukantianismus - als asymptotische Grenze des Denkens begriffen, bzw. als das heuristische Ziel, das die Forschung des Philosophen leitet: „Das Ideal [des] Problems ist eine Idee“.41 Dennoch schreibt Benjamin genau an dieser Stelle, dass das Kunstwerk eine besondere Affinität zu der Philosophie und zu dem Ideal des Problems hat: „Es gibt jedoch Gebilde, welche – ohne die Philosophie selbst, d.h. ohne die Antwort auf jene virtuelle Frage, und ohne virtuell zu sein, d.h. ohne die Frage sein zu können, dennoch zur Philosophie vielmehr zum Ideal ihres Problems, die tiefste Affinität haben, wirkliche, nicht virtuelle Gebilde, welche weder Antworten noch Fragen sind. Es sind die Kunstwerke. Nicht mit der Philosophie konkurriert das Kunstwerk, sondern es tritt lediglich zu ihr in das tiefste Verhältnis durch seine Verwandtschaft mit dem Ideal des Problems“.42 Selbst wenn die Idee unendlich entfernt vom Phänomen bleibt, ist das einzelne Kunstwerk für Benjamin der Ort, an dem sich die Idee verkörpert und manifestiert. Nur in der Mannigfaltigkeit der Werke, schreibt Benjamin, lässt sich das Ideal des philosophischen Problems darstellen.43 Das bedeutet, dass sich die Idee in der Pluralität der Werke darstellen lässt. Man kann feststellen, dass Benjamin in diesem Text das Moment der Unendlichkeit und der Jenseitigkeit der Idee unterstreicht. Zugleich aber wird der Moment der Präsenz der Idee in dem Phänomen und der Moment der Möglichkeit, eine Erfahrung – im Sinne einer Wahrnehmung – der Idee zu haben, stärker betont. Die Idee ist nicht bloß das Gesetz des natürlichen Phänomens, so wie im Neukantianismus, sondern die Präsenz einer Wahrheit, die von einer breiteren Tragweite ist, verglichen mit der wissenschaftlichen Wahrheit der Naturwissenschaften, an die sich der kritische Idealismus wendet. Das wurde bereits festgestellt in bezug auf den Begriff der „Erfahrung“ in der Programmschrift, für den Benjamin eine neue, nicht mehr wissenschaftliche, sondern allumfassende Bedeutung, die er „Erfahrung höherer Art“ nennt, sucht. Meiner Meinung nach ist dies alles auf Benjamins Auslegung von Goethe 41 GS I/3 833. Ibidem. 43 Vgl. GS I/3 834. 42 55 zurückzuführen, nach der das Denken Goethes repräsentativ für eine intuitive, jedoch nichtbegriffliche Wahrheit steht. Es ist interessant, zu bemerken, dass derselbe Begriff der „Erfahrung höherer Art“ auch von Goethe benutzt wird.44 Goethe verwendet diesen Begriff, um die Methode der wissenschaftlichen Forschung zu beschreiben, in der die Entdeckung des Urphänomens den Zweck und das Ziel des Verfahrens darstellt. Mit anderen Worten, die wissenschaftliche Methode, die Goethe in den Naturwissenschaftlichen Schriften beschreibt, besteht in der Beobachtung, in dem Versuch und schließlich in der Findung des Gesetzes, d.h. des Urphänomens. Letzteres ist eben die höhere Erfahrung, die der Natur eine Ordnung zu geben erlaubt.45 Allerdings ist in den Ästhetischen Schriften Goethes die Wahrnehmung des Urphänomens, oder besser des Urbildes, nicht mehr eine theoretische Erfindung und nicht Teil einer wissenschaftlichen Methode, sondern eine unmittelbare Anschauung, die der Künstler hat. Bei Benjamin ist die „Erfahrung höherer Art“ näher an der Bedeutung der Ästhetischen Schriften Goethes: sie ist die Fähigkeit, in dem Augenblick die Ganzheit, d.h. die Idee, zu begreifen; bei Benjamin genauso wie bei Goethe ist die höhere Erfahrung also die Wahrnehmung eines letzten Elementes. Sie ist eine zufällige Evidenzerfahrung, nicht eine wissenschaftliche Methode. Ebenso behauptet Benjamin, indem er den Begriff des „Ideals des Problems“ vorstellt, dass das Kunstwerk der Philosophie nahe steht, weil es die Verkörperung des Ideals, das für die Philosophie eine Aufgabe ist und bleibt, zustandebringt. Es ist also die Kunst, die eine höhere unmittelbare und augenblickliche Erfahrung der Idee erlaubt. Bis hierhin haben wir undifferenziert von Wahrheit und Idee geredet. Benjamin selber, sowohl in den Fragmenten als auch in der Schrift über den Begriff der „Kritik“, unterscheidet die zwei Termini nicht. Jedoch scheint er sie mit der gleichen Valenz zu benutzen. Man kann behaupten, dass es in den jugendlichen Schriften keinen effektiven Unterschied zwischen den zwei Termini und den entsprechenden Inhalten gibt. Nur das Fragment Eidos und Begriff lässt über diese anscheinende Äquivalenz nachdenken. Benjamin stellt in ihm nämlich fest, indem er einen der Fixpunkte der Phänomenologie kommentiert, dass das Wesen eines Dinges, von dem Begriff eines Dinges unterschieden, zeitlos ist.46 Das Eidos eines Dinges ist also immer unabhängig von der Raum-Zeit-Lage des Dinges, dessen Wesen es ist. Dies gilt nicht so für den Begriff, der auch der Begriff eines Dinges in hic et nunc ist. Mit anderen Worten, während das Wesen eines Dinges immer vom Hier und Jetzt absieht, sieht dagegen der Begriff eines Dinges nicht notwendigerweise von der effektiven 44 J. W. GOETHE, W.A.II 38ff.; ELISABETH ROTTEN, op. cit. S. 57ff. Vgl. ELISABETH ROTTEN, op. cit. S.59ff.; J. W. GOETHE, Goethes Werke, Wegner Verlag, Bd. 15, S.12ff. 46 Vgl. GS VI 29f. 45 56 und wirklichen Raum-Zeit ab. Bisher ist Benjamins Konzeption von Eidos - also von Idee ähnlich der Husserls, bei der das Wesen eines Dinges als reine Idee von Raum-Zeit und vom Phänomen entfesselt wahrgenommen wird. Aber das Wesen eines Dinges, führt Benjamin fort, ist immer noch das Wesen von irgendetwas, meint also eine phänomenale Realität. Dagegen ist die Wahrheit, wird Benjamin einige Jahre später in dem Trauerspielbuch schreiben, völlig intentionslos. Von daher sieht es so aus, als ob die Wahrheit nicht von den Dingen gesagt werden kann, sondern vielmehr – wie auch aus der Schrift über den Kritikbegriff herausgelesen werden kann – in den Dingen eine symbolische Intention ist. Wir werden allerdings in der Analyse der erkenntniskritischen Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels sehen, dass die Begriffe „Idee“ und „Wahrheit“ weiterhin ununterschieden bleiben. Aus dem, was bisher aufgetaucht ist, schließe ich, dass Benjamin in der Periode der jugendlichen Schriften einige Elemente der Neukantischen Philosophie, wie den Begriff des offenen Systems und den der unendlichen Aufgabe, in seinem Denken aufnimmt; zugleich übernimmt er Elemente – vom metaphysischen Schlage – zu denen er durch die Lektüre Goethes gelangt und die aber den oben erwähnten Neukantischen Elementen widersprechen. Der Begriff der Wahrheit-Idee ist das Ergebnis dieses Amalgams. Die Wahrheit stellt sich mit einem doppelten Antlitz vor. Sie ist unendliche Aufgabe, welche die intellektuelle Forschung vorantreibt, zugleich ist sie jedoch „Gegenstand“ einer unmittelbaren Wahrnehmung, der aber nicht möglich ist, eine Methode zu bestimmen. 57 DRITTES KAPITEL DIE IDEENLEHRE IM URSPRUNG DES DEUTSCHEN TRAUERSPIELS 1. Probleme, Fragen, Allgemeine Linien Ursprung des deutschen Trauerspiels, geschrieben zwischen 1925-1926 und im Jahre 1928 veröffentlicht, stellt einerseits den Versuch dar, in der Erkenntniskritischen Vorrede die Erkenntnistheorie zu „systematisieren“, an der Benjamin zuvor bloß fragmentarisch arbeitete, und andererseits einen wichtigen Übergang von den frühen Schriften zu den späteren. Außerdem erlaubt das Trauerspielbuch, eine Distanzierung Benjamins von einigen philosophischen Gedanken ans Licht zu bringen, die in die Jahre der Fragmente und der Programmschrift zurückreichen und damit eine quasi endgültige Entwicklung seiner Philosophie festzustellen. In dem folgenden Kapitel beabsichtige ich hervorzuheben, wie sich die Erkenntnistheorie Benjamins entwickelt, und zu beweisen, dass von Ursprung des deutschen Trauerspiels her eine metaphysische Perspektive des Autors zu Tage gefördert wird, die bereits in den frühen Fragmenten erschient. In der Schrift über das Trauerspiel verstärkt sich nämlich die metaphysische Valenz der Idee. Diese erwirbt über die erkenntnistheoretische Funktion hinaus, wie wir sie im ersten Kapitel gefunden haben, auch und vor allem die Bedeutung von einem „metaphysischen Prinzip“. Diese beiden Bedeutungen der Idee entsprechen der Doppelbedeutung der Wahrheit, – d.h. einerseits die unendliche Aufgabe, andererseits das unmittelbare und augenblickliche Besitztum - die wir im ersten Kapitel gesehen haben. Darüber hinaus werden wir versuchen das zu verdeutlichen, was Benjamin mit der „Aufgabe der Philosophie“ meint, die er wie folgt in der Erkenntniskritischen Vorrede bezeichnet: „Will die Philosophie nicht als vermittelnde Anleitung zum Erkennen, sondern als Darstellung der Wahrheit das Gesetz ihrer Form bewahren, so 58 ist der Übung dieser ihrer Form, nicht aber ihrer Antizipation im System, Gewicht beizulegen [...] Darstellung ist der Inbegriff ihrer Methode”1 „Gegenstand dieser Forschung [der Philosophie]sind die Ideen“2 „Und so ist die Philosophie im Verlauf ihrer Geschichte [...] ein Kampf um die Darstellung von eigenen wenigen, immer wieder denselben Worten von Ideen“3 Es soll gezeigt werden, wie die philosophische Aufgabe der „Darstellung der Idee“ mit einer neuen Einstellung der Philosophie Benjamins verbunden ist. 2. Die Erkenntnis in der Vorrede zum Trauerspielbuch Wir haben oben bereits gesehen, dass Benjamin sich in der Programmschrift vornimmt, einen neuen Begriff der „Erkenntnis“, unterschieden von dem traditionellen, zu suchen und zu formulieren. In der Erkenntniskritischen Vorrede haben wir nicht mehr mit einer „Theorie“ der Erkenntnis zu tun, sondern mit einer „Kritik“ der Erkenntnis. Die einzige Erkenntnis, die in der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels vorkommt, ist nämlich die traditionelle, die sich mit Objekten und Begriffen beschäftigt. Dieser Erkenntnis setzt Benjamin die Philosophie entgegen, die kein Objekt „hat“, sondern sich an die Idee und die Wahrheit wendet, die aber keineswegs Objekt sind und die also nie eigentlich gekannt werden können. Von daher, wenn die Erkenntnis immer Objekte meint, während die Wahrheit und die Idee laut Benjamin nicht intentionales Objekt der Erkenntnis sein können, dann stellt sich wieder das Problem, wie die Idee und die Wahrheit erfahren werden können. Dieses Problem wurde in dem ersten Kapitel in bezug auf die frühen Schriften angetroffen und, zumindest teilweise, durch den Begriff der Wahrnehmung gelöst. Aus diesen Fragmenten und aus der Programmschrift konnte man nämlich ableiten, dass ein Wahr-Nehmen zu der Idee führt, die sich als Evidenzerfahrung in der Wahrnehmung manifestiert. So schreibt Benjamin über die Erkenntnis in der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels: 1 GS I/1 207ff. GS I/1 209. 3 GS I/1 217. 2 59 „Erkenntnis ist ein Haben. Ihr Gegenstand selbst bestimmt sich dadurch, dass er im Bewusstsein [...] innengehabt sein muss. Ihm bleibt der Besitzcharakter. Diesem Besitztum ist Darstellung sekundär“.4 Wir merken vor allem, dass die Erkenntnis der Vorrede nicht mit der Erkenntnis der Programmschrift zusammenfällt. Wir stellten oben nämlich fest, dass in der Programmschrift zwei verschiedene Begriffe der „Erkenntnis“ vorkommen: der eine ist die traditionelle, wissenschaftliche Erkenntnis, der andere ist die Erkenntnis als Inbegriff aller Erkenntnisse, d.h. als die Einheit, der ein höherer Begriff der Erfahrung entspricht. Wenn nun Benjamin in der Erkenntniskritischen Vorrede den Terminus „Erkenntnis“ benutzt, dann tut er es, indem er ihm eine solche Bedeutung zuschreibt, die mit der Bedeutung der „wissenschaftlichen Erkenntnis“ der Programmschrift zusammenfällt. Dagegen wird in der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels der Begriff der „höheren Erkenntnis“ - dem in der Programmschrift der Begriff der „höheren Erfahrung“ entspricht - durch den Begriff der „Philosophie“ ersetzt. Wenigstens im Sinne der Terminologie betont Benjamin im Ursprung des deutschen Trauerspiels eine reine Opposition zwischen der Philosophie und der Erkenntnis. In der neuen Perspektive Benjamins ist die Philosophie nicht mehr Erkenntnis, denn sie kümmert sich weder um Objekte noch um Begriffe, sondern um die Darstellung der Wahrheit. Darf man also annehmen, dass Benjamin nicht nur einen Unterschied zwischen der Philosophie und der wissenschaftlichen Erkenntnis, wie er in der Programmschrift auftaucht, sondern radikaler, zwischen der Philosophie und der allgemeinen Erkenntnis behauptet? Kehren wir nun zu einem anderen Problem zurück: Womit beschäftigt sich die Philosophie? Welches ist das „Objekt“ der Philosophie: die Idee oder die Wahrheit? Und vor allem, wie „erfährt“ man die Idee, oder die Wahrheit, wenn sowohl die erste als auch letztere als ein nicht-intentionales Sein betrachtet werden sollen, d.h. als ein Wesen, das niemals zum Objekt des Bewusstseins, der Vernunft oder des Verstandes gemacht werden kann? In den folgenden Abschnitten werden die Probleme analysiert, die bisher aufgetaucht sind: Was ist eigentlich die Idee? Besteht ein Unterschied zwischen der Wahrheit und der Idee als „Objekte“ der Philosophie? Wie bezieht sich die Philosophie auf die Erkenntnis? Was bedeutet, dass die Philosophie Darstellung ist? Und wie kommen die Idee und die Wahrheit zur Darstellung? 4 GS I/1 209. 60 3. Das „Objekt“ der Philosophie Das „Objekt“ – oder mit den Worten Benjamins der „Gegenstand“5 - der philosophischen Forschung sind die Ideen. „Objekt“ aber in welchem Sinn? Wir haben festgestellt, dass die Philosophie sich von der Erkenntnis unterscheidet. Diese letztere ist nämlich ein „Haben“, das ein Objekt meint. Dagegen „hat“ die erste kein Objekt, sondern „hat“ vielmehr die Darstellung der Ideen und der Wahrheit zur Aufgabe. Benjamin setzt die Erkenntnis der Philosophie wesentlich entgegen. Und das in einer radikaleren Art, verglichen mit der vorherigen Programmschrift: nicht nur wird die Philosophie der wissenschaftlichen Erkenntnis entgegensetzt, sondern der Erkenntnis im Allgemeinen. Betrachten wir daher zuerst, wie Benjamin die Idee und die Wahrheit innerhalb der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels bezeichnet, ohne uns jetzt um den Unterschied zwischen Wahrheit und Idee zu kümmern, indem wir die beiden Begriffe, vorläufig, als Synonyme setzten. 3.1 Idee ist Einheit Benjamin schreibt, dass die Ideen nicht der phänomenalen Welt angehören: „Die Ideen sind in der Welt der Phänomene nicht gegeben“.6 Laut dieser Aussage befinden sich die Ideen hinsichtlich der Phänomene auf einer anderen Stufe. Noch ein Hinweis auf den unterschiedlichen Status der Wahrheit und der Idee im Vergleich zu dem der Phänomene wird uns in der Aussage gegeben, dass die Wahrheit unerfragbar ist.7 An dieser Stelle des Textes kümmert sich Benjamin darum, das Objekt der Erkenntnis von dem der Philosophie zu unterscheiden: das Objekt der Erkenntnis fällt nicht mit der Wahrheit zusammen. Diese ist Einheit. Dagegen wendet sich die Erkenntnis, schreibt Benjamin, Einzelerkenntnissen zu,8 d.h. dem Einzelnen. Die Einheit der Wahrheit ist darüber hinaus verschieden von einer hypothetischen Einheit der Erkenntnis, die, selbst wenn sie existieren würde, „vielmehr ein nur vermittelt, nämlich auf Grund der Einzelerkenntnisse und gewissermaßen durch deren Ausgleich, herstellbarer Zusammenhang“9 wäre. Dagegen schreibt Benjamin über die Wahrheit als Einheit: 5 GS I/1 209. GS I/1 215. 7 Vgl. GS I/1 210. Benjamin schreibt: „Als Einheit im Sein und nicht als Einheit im Begriff ist die Wahrheit außer aller Frage“ (ibidem). 8 Vgl. GS I/1 210. 9 Ibidem. 6 61 „Während im Wesen der Wahrheit die Einheit durchaus unvermittelt und direkte Bestimmung ist. Dieser Bestimmung als einer direkten ist es eigentümlich, nicht erfragt werden zu können. Wäre nämlich die integrale Einheit im Wesen der Wahrheit erfragbar, so müsste die Frage lauten, inwiefern auf sie die Antwort selbst schon gegeben sei in jeder denkbaren Antwort, mit der Wahrheit Fragen entspräche. Und wieder müsste vor der Antwort auf diese Frage die gleiche sich wiederholen, dergestalt, dass die Einheit der Wahrheit jeder Fragestellung entginge. Als Einheit im Sein und nicht als Einheit im Begriff ist die Wahrheit außer aller Frage [...] die Ideen sind ein Vorgegebenes. So definiert die Sonderung der Wahrheit von dem Zusammenhange des Erkennens die Idee als Sein. Das ist die Tragweite der Ideenlehre für den Wahrheitsbegriff. Als Sein gewinnen Wahrheit und Idee jene höchste metaphysische Bedeutung, die das Platonische System ihnen nachdrücklich zuspricht“.10 Schließlich erreicht die Erkenntnis niemals eine Einheit, und selbst wenn sie diese irgendwie erreichen würde, wäre jene auch immer eine bloße Summe der Begriffe und nicht eine Einheit höherer Stufe wie dagegen diejenige Einheit, aus der das Wesen der Wahrheit besteht. Die Einheit der Wahrheit ist unvermittelt, d.h. unmittelbar, und nicht erfragbar. Sie ist „Einheit im Sein“ und nicht „Einheit im Begriff“. Was bedeutet aber nun, dass die Wahrheit, als Einheit, nicht erfragbar ist? Und vor allem, was für eine Art von Unmittelbarkeit charakterisiert das Wesen dieser Einheit? Dass die Wahrheit nicht erfragbar ist, bedeutet laut Benjamin, dass sie nicht „Objekt“ der Erkenntnis sein kann: die Erkenntnis verfährt nämlich durch Fragen und Antworten, und sie befragt sich, indem sie die Welt in Daten und „Objekte“ verwandelt, die mit dem Verstand zu erforschen sind. Dagegen existiert keine mögliche Frage, welche die Wahrheit befragen kann, da diese eine Einheit keineswegs objektivierbar ist. Die Einheit der Wahrheit ist also ein Ideal. Die Unfragbarkeit und die Idealität der Wahrheit bringen uns zu einer zuvor analysierten Stelle in der Theorie der Kunstkritik zurück.11 Auch in diesem Text spricht Benjamin von einer nicht-erfragbaren Einheit. Die Einheit ist aber in diesem Fall diejenige der Philosophie, die bei Benjamin noch mit dem System zusammenfällt. Letzteres wird als eine Einheit von höherer Mächtigkeit bezeichnet, die wiederum höher als die Summe unendlich stellbarer, endlicher Fragen12 ist. Es existiert also keine wirkliche Antwort auf dieser virtuellen Frage, die eine solche Einheit befragen würde. Die einzige mögliche Antwort 10 GS I/1 210. Siehe oben Kap. II. 12 Vgl. GS I/3 833. 11 62 wäre das System der Philosophie,13 d.h. die Philosophie in ihrer Ganzheit. Von daher schließt Benjamin: das System der Philosophie ist niemals erfragbar. In dem Text Theorie der Kunstkritik ist also die Philosophie als System unerfragbar,14 dagegen ist in der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels die Einheit der Wahrheit als nicht-erfragbar definiert und eben nicht die Philosophie. Diese fällt nicht mit der Wahrheit zusammen, sondern sie hat zur Aufgabe die Darstellung der Wahrheit. Ein zweiter Unterschied, der relevant hinsichtlich der Vorrede ist, taucht eben mit der Anwendung des Begriffes des „Systems” auf. In Theorie der Kunstkritik spricht man von der Wahrheit und versteht darunter das System, d.h. die Ganzheit der Philosophie, die aber nicht erfragbar ist, weil sie ein unaufhörliches Weiterfragen ist, für das es keine adäquate Antwort gibt. Die einzige Möglichkeit für die Wahrheit, sich im Phänomen zu verkörpern, wird schließlich von der Kunst angeboten, die in den einzelnen Werken eben eine Darstellung der Wahrheit zutage fördert. In der Erkenntniskritischen Vorrede spricht Benjamin nicht von „System”, wenn nicht um mit diesem Terminus das zu bezeichnen, was die Philosophie nicht sein soll. Dieser Unterschied ist wohl wichtig, weil er effektiv einen Bruch mit dem frühen Denken Benjamins zeigt. Das System ist in Ursprung des deutschen Trauerspiels nicht mehr die Form der Philosophie. Diese wird jedoch das „Traktat”: “Die Alternative der philosophischen Form, welche durch die Begriffe von Lehre und von dem esoterischen Essay gestellt wird, ist’s, die der Systembegriff des XIX. Jahrhunderts ignoriert. Soweit er die Philosophie bestimmt, droht diese einem Synkretismus sich zu bequemen, der die Wahrheit in einem zwischen Erkenntnissen gezogenen Spinnennetz einzufangen sucht als käme sie von draußen herzugeflogen [...]. Will die Philosophie nicht als vermittelnde Anleitung zum Erkennen, sondern als Darstellung der Wahrheit das Gesetz ihrer Form bewahren, so ist der Übung dieser ihrer Form, nicht aber ihrer Antizipation im System, Gewicht beizulegen. Diese Übung hat sich allen Epochen, denen die unumschreibliche Wesenheit des Wahren vor Augen stand, in einer Propädeutik aufgenötigt, die man mit dem scholastischen Terminus des Traktats darum ansprechen darf“.15 Die Methode des Traktats, führt Benjamin weiter aus, ist die Darstellung. Des Traktats wichtigste Eigenschaft ist der Verzicht auf einen unaufhörlichen und regelmäßigen Verlauf des Denkens: 13 Vgl. GS I/3 833. Darüber hinaus möchte ich daran erinnern, dass in dem Fragment 30, Die unendliche Aufgabe, die Wissenschaft und noch nicht die Philosophie unerfragbar ist (vgl. GS VI 51). 15 GS I/1 207f. 14 63 “Ausdauernd hebt das Denken stets von neuem an, umständlich geht es auf die Sache selbst zurück. Dies unablässige Atemholen ist die eigenste Daseinsform der Kontemplation. Denn indem sie den unterschiedlichen Sinnstufen bei der Betrachtung eines und desselben Gegenstandes folgt, empfängt sie den Antrieb ihres stets erneuten Einsetzens ebenso wie die Rechtfertigung ihrer intermittierenden Rhythmik. Wie bei der Stückelung in kapriziösen Teilchen die Majestät den Mosaiken bleibt, so bangt auch philosophische Betrachtung nicht um Schwung. Aus Einzelnem und Disparatem treten sie zusammen [...]. Der Wert von Denkbruchstücken ist um so entscheidender, je minder sie unmittelbar an der Grundkonzeption sich zu messen vermögen und von ihm hängt der Glanz der Darstellung im gleichen Maße ab, wie der des Mosaiks von der Qualität des Glasflusses“.16 Nicht mehr das System ist also das philosophische Muster Benjamins, sondern eine Form, nämlich die des Traktats, darstellt, welche die Bewegung des Denkens – das keinem linearen Weg folgt, sondern immer wieder und pausenlos vom Anfang beginnt und erneut zu der „Sache selbst“ zurückkehrt. Wir merken also einen deutlichen Unterschied zwischen Ursprung des deutschen Trauerspiels und den frühen Schriften über die Erkenntnistheorie. Benjamin verlässt die Konzeption, nach der die Philosophie Ganzheit und System sein soll, und übernimmt diejenige, nach der die Philosophie fragmentarisch und a-systematisch wird. D.h. das Denken verlangt nicht mehr ein System, das alles in sich einschließt, zu sein, sondern bleibt bei den Sachen und betrachtet sie, aber niemals schließlich und endgültig, weil es zu denen immer wieder erneut zurückkehrt. Wenn die Idee nun eine unerfragbare Einheit ist, die niemals Objekt ist, dann kann sie nicht einmal „Objekt” des Denkens, weder des Verstandes noch des erkennenden Bewusstseins, sein: die Einheit ist das Ideal der Einheit und der Vollständigkeit, das aber niemals völlig erreicht wird. Wohl wird die Idee als etwas Unvermitteltes in der unendlichen Bewegung des Denkens dargestellt. Welche Art von Unmittelbarkeit ist der Einheit der Wahrheit eigen? Was versteht Benjamin unter unmittelbarer Einheit? „Unmittelbar” bedeutet nämlich sowohl „direkt”, „nicht vermittelt“ – d.h. eine nicht von Begriffen vermittelte Wahrheit - als auch „plötzlich”, „augenblicklich”. Das hieße, dass die Wahrheit sich augenblicklich manifestiert, analog mit der Evidenzerfahrung der frühen Schriften. Haben wir erneut mit einem zweideutigen Begriff der „Wahrheit“ - unendliche und ideelle Aufgabe einerseits, unmittelbare Erfahrung andererseits – zu tun? 64 3.2 Idee ist Monade Die Tatsache, dass die Form der Philosophie nicht mehr die abgeschlossene Totalität des Systems ist, hebt aber nicht die Idee der Ganzheit im Denken Benjamins auf. Die Ganzheit ist jedoch nicht als eine geschlossene und in sich vollendete Struktur zu denken, sondern vielmehr als eine immer offene Ganzheit. Soweit die Idee eine Einheit ist, ist sie eine Ganzheit. Nicht aber die Philosophie ist die Ganzheit, sondern das „Objekt” ihrer Darstellung: die Idee. So schreibt Benjamin, indem er die Idee als Monade bezeichnet: „Deren Bau [der Idee], wie die Totalität sie im Kontrast zu der ihr unveräußerlichen Isolierung prägt, ist monadologisch. Die Idee ist Monade. Das Sein, das mit Vor- und Nachgeschichte in sie eingeht, gibt in der eigenen verborgenen die verkürzte und verdunkelte Figur der übrigen Ideenwelt, so wie bei den Monaden der „Metaphysischen Abhandlung“ von 1686 in einer jeweils alle andern undeutlich mitgegeben sind. Die Idee ist Monade – in ihr ruht prästabiliert die Repräsentation der Phänomene als in deren objektiver Interpretation. Je höher geordnet die Ideen desto vollkommener die in ihnen gesetzte Repräsentation“.17 Die Idee ist Totalität, so wie die Monade von Leibniz: Wie die Monade ist jede Idee ein Bild der Welt. Noch einmal: was bedeutet also, dass die Idee eine Ganzheit ist? Und weiter, was bedeutet, dass sie eine offene Ganzheit ist? Auf diese zweite Frage kann man antworten, indem man auf die erkenntnistheoretische Funktion der Idee hinweist, d.h. auf die Idee als ideelle Einheit. Benjamin schreibt, dass die Idee ein „Extrem zur Synthese“18 ist. Sie ist kein abstrakter Begriff (keine Universalie), der induktiv aus den Phänomenen abgeleitet wird. „Extrem zur Synthese” bedeutet, dass die Idee – wie die Monade – in sich die Darstellung der Welt enthält und deshalb die Interpretation der Welt ermöglicht. Die Ganzheit der Idee ist nicht abgeschlossen, insofern sie ein unendliches Weiterfragen um das Phänomen und dessen unendliche Interpretation ermöglicht: Die Idee scheint die unendliche Möglichkeit zu sein, die Phänomene lesen zu können: d.h. das Denken bleibt bei den Dingen und betrachtet und interpretiert sie immer erneut. Die Ganzheit der Idee stellt sich also als unendliche Aufgabe des Denkens vor. Kehren wir nun zu dem zurück, was bereits oben gesagt wurde. Wenn die Form der Philosophie die unregelmäßige Bewegung des Denkens und die Aufgabe der Philosophie die 16 GS I/1 208. GS I/1 228. 18 GS I/1 221. 17 65 Darstellung der Idee ist, muss also, laut Benjamin, die Philosophie die Bewegung der Ideen darstellen können, die nichts anderes ist als eine Bewegung des Denkens von einer Ganzheit zu der anderen, d.h. von einem Bild – der Welt – zum anderen. Die Philosophie fängt also an, sich wie die Kunst zu benehmen, die ihr in Theorie der Kunstkritik nur ähnlich war.19 Dagegen wird die Kunst hier ihr Muster. Dasselbe goethische Epigraph der Vorrede weist auf die darstellende Aufgabe der Kunst hin: „Da im Wissen sowohl als in der Reflexion kein Ganzes zusammengebracht werden kann, weil jenem das Innere, dieser das Äußere fehlt, so müssen wir uns die Wissenschaft notwendig als Kunst denken, wenn wir von ihr irgend eine Art von Ganzheit erwarten. Und zwar haben wir diese nicht im Allgemeinen, im Überschwänglichen zu suchen, sondern, wie die Kunst sich immer ganz im jedem einzelnen Kunstwerk darstellt, so sollte die Wissenschaft sich auch jedesmal ganz in jedem einzelnen Behandelten erweisen“.20 Wie die Kunst, so hat die Philosophie die Aufgabe die Bilder darzustellen, weil in den Bildern die Ganzheit anwesend ist. Das Denken, das die Idee darstellen soll, ist von daher dialektisch: es besitzt weder, noch erwirbt es die Ganzheit, sondern ist es selber eine Beweglichkeit (zwischen Ideen und Phänomenen), die durch die Ideen die Phänomene der Welt auslegt. Für ein solches Denken ist aber die Ganzheit der Erkenntnis ein Ideal, das - wie wir sehen werden - ein intellektueller Reiz bleibt. Der Begriff der Monade weist aber zwei Mal auf die Ganzheit hin: indem die Ganzheit etwas darstellt – nämlich die Welt – aber zugleich auch selber dargestellt – nämlich von der Philosophie – werden kann. D.h.: Wenn einerseits die Ganzheit ein Ideal und eine Aufgabe für das Denken ist, andererseits sie selber als Ganzheit - wie in der Kunst – unmittelbar dargestellt wird. Der Begriff der Monade bringt also das oben erwähnte Problem der Doppelstruktur der Idee mit sich. 3.3 Idee ist Ursprung Indem Benjamin die Idee als „Ursprung“ definiert, setzt er sie nicht so sehr mit einer Theorie der Erkenntnis in Beziehung als vielmehr mit der phänomenalen Welt. Benjamin verbindet 19 20 Vgl. GS I/3 833f. J.W. GOETHE, Materialen zur Geschichte der Farbenlehre, in GS I/1 207. 66 aber die Idee nicht nur mit dem phänomenalen Vergehen und Werden, sondern vielmehr lässt diesen die Ideen zugrunde liegen: „Im Ursprung wird kein Werden des Entsprungenen, vielmehr dem Werden und Vergehen Entspringendes gemeint. Der Ursprung steht im Fluss des Werdens als Strudel und reißt in seine Rhythmik das Entstehungsmaterial hinein“21. Der Ursprung ist nicht die Genesis.22 Er ist weder der Anfang noch die Geburt. Die Idee als Ursprung ist nicht in der Geschichte, denn sie ist der Grund der Geschichte und der Phänomene, aus deren die Geschichte besteht. Das bedeutet auch, dass die Idee nicht in der Zeit ist, sondern sie vielmehr mit ihrem Sein eine andere Art der Temporalität gründet. Lassen wir vorübergehend das Problem der Zeit bei Benjamin, um durch den Begriff des „Ursprungs zu begreifen, welches Sein das Sein der Idee ist. Indem Benjamin der Idee die Bedeutung des „Ursprungs” zuschreibt, macht er einen weiteren Schritt in der Bezeichnung der Idee: der Ursprung hat nämlich einen Status und einen Wert ontologisch verschieden verglichen mit dem, dessen er Ursprung ist. Einige Autoren23 führen den Begriff des „Ursprungs” bei Benjamin auf den Neukantianismus Marburgs und insbesondere auf Hermann Cohen zurück. Der Ursprung ist nämlich das Zentrum des ersten Teils des philosophischen Systems24 (die Logik) dieses Autors. Der Ursprung ist nun bei Cohen ein logischer Begriff: Ursprung heißt nämlich bei ihm „Ursprung des Denkens“. Bei Cohen ist der Begriff des „Ursprungs“ keineswegs ein metaphysisches Prinzip – deshalb bezeichnet er den Ursprung nicht als „Grundlage”, sondern als „Grundlegung“ der Erkenntnis und des Denkens. Mit anderen Worten, der Ursprung ist nicht ein fremdes Seiendes, das das Denken von Äußern begründet, sondern das Denken selbst. Auf diesem Prinzip – das Prinzip des Ursprungs – beruht die ganze Erkenntnistheorie Cohens. Es ist also das Prinzip, wofür die ganze Erkenntnis (das Sein) seinen Ursprung in dem Denken hat, das aus diesem Grund „rein” definiert wird: es ist von der Empirie völlig 21 GS I/1 226. Vgl. Ibidem. 23 Liselotte Wiesenthal z.B. führt den Begriff des „Ursprungsphänomen” Benjamins auf den Neukantianismus Cassirers zurück (LISELOTTE WIESENTHAL, Zur Wissenschaftstheorie Walter Benjamins, Athenäum Verlag, Frankfurt a.M. 1973, S.11ff.) und versucht eben systematisch die Erkenntnistheorie Benjamins zu rekonstruieren, indem sie – meiner Meinung nach – aber zu viel Wert der Benjaminschen Theorie der Extreme, die Benjamin aber nicht vertieft und die er sogar im Laufe der Vorrede verlässt, beimisst. Für die anderen Autoren, die sich mit der Beziehung Benjamin – Cohen beschäftigen, siehe oben Kap. II. 24 Der Ursprung ist „das treibende Prinzip“ (HERMANN COHEN, Logik der Reinen Erkenntnis, Berlin 1919, S.36), auf dem Cohen seine Logik der reinen Erkenntnis konstruiert, die deswegen eine „Logik des Ursprungs“ ist; Der 22 67 unabhängig. Der Ursprung ist also bei Cohen die unbedingte „Grundlage“ der Erkenntnis, des Seins und des Denkens, aber nur insoweit er „Grundlegung” ist, d.h. ein logisches Prinzip. Das Denken erzeugt das Objekt der Erkenntnis, ohne jemals aus sich selbst herauszugehen: es ist ein produktives Denken. Zugleich bildet es aber auch seine eigene Grundlage. Das Denken ist der Ursprung des Denkens als Ursprung. Dem produktiven Denken - das Denken, welches das Sein innerhalb sich selbst erzeugt25 – setzt Cohen das bildnerische Denken entgegen, d.h. das Denken, das mit Inhalten wirkt, die der Erkenntnis von Außen her gegeben sind. Der Begriff des „Ursprungs” bei Benjamin hat sehr wenig gemeinsam mit dem Prinzip des Ursprungs Cohens.26 Benjamin nimmt dadurch Abstand von Cohen, indem er den Ursprung als historischen Begriff und nicht als logischen bezeichnet.27 Diese Aussage ist konsequent zu dem Projekt, das Benjamin einige Jahre zuvor in der Programmschrift – in der er durch die Suche nach höheren Begriffen von „Erfahrung“ und „Erkenntnis“, die jenseits der logisch-wissenschaftlichen „Limitation” des Neukantianismus’ Marburgs liegen, eben jene zu überschreiten versuchte – durchzuführen beabsichtigte. Ebenso ist in Ursprung des deutschen Trauerspiels der Begriff des „Ursprungs“ nicht ein logisches Prinzip. Der Ursprung ist bei Benjamin vielmehr eine Kraft, oder besser, die Kraft der Idee, die in die Geschichte und in die phänomenale Welt einbricht und sie – mit Worten Cohens – ermöglicht. Die Idee ermöglicht die Welt: d.h. die Idee ist ein vom Sein des Scheins unterschiedenes Sein und es hat die Aufgabe, das Phänomen zu prägen und ihm eine Gestalt und einen Wert zu geben. Der Benjaminsche Ursprung hat also nichts mit einem logischen Begriff zu tun, weil er die Grenzen der reinen Logik überwindet, indem er die der Geschichte konstruiert. Der Ursprung ist vielmehr bei Benjamin ein reines Prinzip, im Sinne eines energischen und lebendigen Prinzips, das in der Geschichte wirkt. Der Begriff des „Ursprungs“ Benjamins ist auf das Urphänomen Goethes zurückzuführen, und, um genau zu sein, auf die Lektüre und die Auslegung des goetheschen Ursprung ist „der Grundgedanken, worauf die Logiktheorie Cohens beruht und entwickelt“. A. POMA, La filosofia critica di Hermann Cohen, Mursia, Milano 1988, S.101. 25 Metaphorisch spricht Cohen von „schöpferischer Souveränität des Denkens“ (HERMANN COHEN, op. cit. S.28) 26 Das wird auch von Astrid Deueber-Mankowsky und Liselotte Wiesenthal anerkannt. Die beiden Autorinnen bemerken wohl den Unterschied zwischen dem Begriff des „Ursprungs“ Cohens und dem Benjamins; sie versuchen aber die Gemeinsamkeit der beiden Philosophen herauszustreichen. Vgl. ASTRID DEUBERMANKOWSKY, Der frühe Walter Benjamin und Hermann Cohen: Jüdische Werte, Kritische Philosophie, vergängliche Erfahrung, Vorwerk 8, 2000 Berlin S. 13ff und LISELOTTE WIESENTHAL, Zur Wissenschaftstheorie Walter Benjamins, Athenäum Verlag, 1973 Frankfurt/M. S.8f. Für Wiesenthal bleibt trotzdem der Begriff des „Ursprungs“ Benjamins eine epistemologische Kategorie (vgl. LISELOTTE WIESENTHAL, op. cit. S.25) 27 So Benjamin: „Die Kategorie des Ursprungs ist also nicht, wie Cohen meint eine reine logische, sondern historisch“ (GS I/1 226). 68 Urphänomens, die Georg Simmel im seinen Buch Goethe, aus dem Jahr 1913,28 entwickelt. In Nachträge zum Trauerspielsbuch schreibt Benjamin: „Bei dem Studium von Simmels Darstellung des goetheschen Wahrheitsbegriffs [s. Georg Simmel: Goethe, Leipzig 1913] insbesondere an seiner ausgezeichneten Erläuterung des Urphänomens (p 56/57 ff p 60/61) wurde mir unwidersprechlich deutlich, dass mein Begriff des ‚Ursprungs’ im Trauerspielbuch eine strenge und zwingende Übertragung dieses goetheschen Grundbegriffs aus dem Bereich der Natur in das der Geschichte ist. ‚Ursprung’ – das ist die theologisch und historisch differente, theologisch und historisch lebendige und aus den heidnischen Naturzusammenhängen in die jüdischen Zusammenhänge der Geschichte eingebrachte Begriff des Urphänomens. ‚Ursprung’ – das ist Urphänomen im theologischen Sinne. Nur darum kann er den Begriff der Echtheit erfüllen“.29 Benjamin findet also einige Verbindungen zwischen dem Begriff der „Wahrheit“ und dem Begriff des „Urphänomens“, die Simmel bei Goethe erforscht hat, und seinem eigenen Begriff des „Ursprungs“ in dem Trauerspielbuch. Ähnlich dem Goetheschen Urphänomen ist der Ursprung Benjamins ein „theologischer und historischer“ Begriff, d.h. ein von der Geschichte und von der Natur ontologisch unterschiedenes Sein, zugleich aber ebenso „lebendig“, denn er verkörpert und manifestiert sich in der Geschichte. Da sie sich nicht auf den logischen Begriff beschränkt, erweist sich die Idee als Ursprung als eine Kraft, die aktiv in der Geschichte wirkt. Sehen wir jetzt einige Punkte des ersten Teils des Buchs Simmels – betitelt Wahrheit, die uns als Hilfe dienen können, um den Begriff des „Ursprungs“ Benjamins und insbesondere seine ontologische Natur zu begreifen. Zunächst berichtet Simmel von einer „Sinnlichkeit“ der Wahrheit, welche sich in der Natur verkörpert und nie außerhalb von ihr ist. Darüber hinaus wird die Anwesenheit der Wahrheit in der phänomenalen Welt, durch eine sinnliche Anschauung, Wahrnehmung erfahren: die Wahrheit ist bei Simmel die harmonische Summe von Vernunft und Wahrnehmung.30 Ein anderer Punkt Goethes, der höchstwahrscheinlich die Aufmerksamkeit Benjamins auf sich gezogen hat, ist die Überlegung, dass die Wahrheit31 jenseits der Opposition Subjekt-Objekt32 liegt. Interessant ist 28 GEORG SIMMEL, Goethe, Klinkhardt & Biermann, Leipzig 1913. GS I/3 953f. 30 Die Wahrheit ist in dem simmelchen Goethe mit der Ganzheit des Menschen verbunden, deshalb ist sie nicht nur Vernunft, sondern auch Sinnlichkeit. Vgl. GEORG SIMMEL, op. cit. S.28f. 31 Vgl. GEORG SIMMEL, op. cit. S.26. Simmel definiert die Wahrheit als „die Relation zwischen dem Leben des Menschen und der Totalität der Welt, in die es sich einordnet; sie ist Wahrheit nicht um ihres logischen und nur logisch nachprüfbaren Inhaltes willen (der vielmehr erst so seine metaphysische Fundierung erhalten wird), sondern weil der Gedanke [...] ein Sein des Menschen ist, das seine Richtigkeit oder Nicht-Richtigkeit als reale 29 69 diese Überlegung, da es sich dabei um ein für Benjamin besonderes wichtiges Thema handelt, das bereits in den Jahren der Programmschrift aktuell war. Ein offen gelassenes Problem, das aber bereits in der Programmschrift auf eine mögliche Lösung eben durch die Idee hinweist. Letztere befindet sich auf einer Stufe, die jenseits des Subjekt-Objekts ist. Die Idee – wie wir es im folgenden vertiefen werden – ist etwas, das sich von selbst manifestiert, d.h. das sich darstellt, das also unabhängig von der traditionellen begrifflichen Dyade Subjekt-Objekt33 ist. Der Unterschied und die Gemeinsamkeit zwischen dem Philosophen und dem Künstler ist noch ein Element, das Benjamin dazu bringt, sich für die Reflexionen Simmels zu interessieren. Seit der Dissertation Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik beschäftigt sich Benjamin nämlich ständig mit der Beziehung Philosophie-Kunst, wie es sich auch von dem Epigraph des Ursprung des deutschen Trauerspiels zeigt. Simmel betont, wie bei Goethe sowohl der Philosoph als auch der Künstler die Anwesenheit der beiden Pole, die niemals voneinander trennbar sind, - von Denkkraft und Anschauen, Erscheinung und Idee -, gemein ist.34 Schließlich wird in Simmels Goethe unterstrichen, dass das Urphänomen ein innerliches Gesetz der Sachen ist, entsprechend dem berühmten Zitat aus Maximen und Reflexionen Goethes: „Das Höchste wäre, zu begreifen, dass alles faktische schon Theorie ist. Die Bläue des Himmels offenbart uns das Grundgesetz der Chromatik. Man suche nichts hinter den Phänomenen; sie selbst sind die Lehre“.35 Ein Gesetz aber nicht im logischen Sinne, wie beim Neukantianismus, sondern in einem ontologischen. Das Urphänomen ist die Seele des Phänomens: d.h. es ist ein lebendiges Prinzip, das sich innerhalb des Phänomens selbst befindet, dessen Wesen bestimmt und aufwirft. Bei Benjamin nun ist die Idee als Ursprung eben dieses lebendige Prinzip. Die Bedeutung des Ursprungs, die Benjamin der Idee zuschreibt, hat aber auch eine „erkenntnistheoretische“ Aufgabe: die Welt zu interpretieren. Wie wir bereits oben in bezug auf die Bedeutung der Einheit der Idee festgestellt haben – und zwar dass „Einheit“ zugleich die unmittelbare Wahrheit und das Prinzip der Erkenntnis im Sinne der unendlichen Qualität, Ursache oder Folge seines gesamten Weltverhältnisses besitzt. ‚Kenne ich mein Verhältnis zu mir selbst und zur Außenwelt, so heiß’ich’s Wahrheit’“ (Ibidem). 32 So schreibt Simmel: „Durch eine verhältnismäßig einfache metaphysische Vertiefung also zeigt sich der scheinbare Subjektivismus des Goetheschen Wahrheitsbegriffes nur als der eine Aspekt einer Einheit, deren anderer durchaus objektivischen Wesen ist“ (op. cit. S.35). 33 Vgl. GEORG SIMMEL, op. cit. S.28ff. 34 Vgl. GEORG SIMMEL, op. cit. S.52ff. 35 GEORG SIMMEL, op. cit. 57; W. J. GOETHE, Maximen und Reflexionen, in Goethes Werke, Wegner Verlag, Bd. 12, S. 432. 70 Auslegung der Welt ausdrückt – drückt die Bedeutung des Ursprungs ebenso die metaphysische Grundlage - die unmittelbar wahrgenommen wird - der phänomenalen Welt und zugleich das Prinzip der einzigen Erkenntnismöglichkeit der Phänomene aus: d.h. ihre unendliche Lektüre, ihre Interpretation. Den Sinn des Ursprungs als eine „Methode“ der Auslegung der phänomenalen Welt werde ich in dem nächsten Kapitel in bezug auf den Benjaminschen Begriff der „Rettung“ genauer analysieren. 3.4 Bereits in Idee ist Name den frühen 36 Sprachphilosophie Fragmenten versucht Benjamin die Wahrheit und die miteinander zu verbinden, und in der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels schreibt er, dass die Idee „ein Sprachliches“37 ist. Die Absicht Benjamins, wie bereits gesehen, ist, zu beweisen, dass das Sein der Idee – und das der Wahrheit – vom phänomenalen Sein verschieden ist. Von daher wird die Wahrheit als intentionsloses Sein definiert: „Als Ideenhaftes ist das Sein der Wahrheit verschieden von der Seinart der Erscheinungen. Also erfordert die Struktur der Wahrheit ein Sein, das an Intentionslosigkeit dem schlichten der Dinge gleicht, an Bestandhaftigkeit aber ihm überlegen wäre. Nicht als ein Meinen, welches durch die Empirie seine Bestimmung fände, sondern als die das Wesen dieser Empirie erst prägende Gewalt besteht die Wahrheit“.38 Diese Intentionslosigkeit befindet sich nun laut Benjamin in dem Namen, dessen Sein jeder Phänomenalität entrückt ist und daher rein ist. Der Name, dem Benjamin die Gegebenheit der Idee anvertraut, ist das Wort in jenem Moment, in welchem dieses Symbol ist. Schließlich bestimmt der Name die Gegebenheit der Ideen, die sich in einem „Urvernehmen“39 manifestieren. Diese Aussagen haben nur scheinbar mit einer bloßen Sprachtheorie zu tun; in Wirklichkeit steckt dahinter eine Theorie des Seins, die auf die Ideenlehre hinweist, die wir gerade von einem komplexen Kontext – wie der des Trauerspielsbuches – zu extrapolieren versuchen. Was ich zu beweisen beabsichtige, ist, dass die Sprachtheorie Benjamins nicht 36 Vgl. GS I/1 216. Ibidem. 38 Ibidem. 39 Ibidem. 37 71 gelesen und verstanden werden kann, sofern sie nicht aus dem Blickwinkel einer Ideenlehre betrachtet wird, und dass, demzufolge, die Idee nicht ein Sprachliches ist, sondern dass die Sprache – die reine Sprache – ein Ideelles ist. D. h. die Sprache ist auf die Idee zurückführbar. Um den Sinn der Sprachtheorie Benjamins zu verstehen, müssen wir kurz auf den Text Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen aus dem Jahr 1917 eingehen. Wie die Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels so wirft auch der Sprachessay – zehn Jahre vor dem Trauerspielbuch geschrieben – Auslegungsschwierigkeiten auf. Allerdings hat die Kritik die Originalität der Sprachphilosophie Benjamins, in der sich Elemente der Kabbala und der jüdischen Theologie40 mit Elementen der Frühromantischen Sprachphilosophie41 vermischen, unterstrichen. In diesem Text unterscheidet Benjamin die ursprüngliche Sprache von der geschichtlichen42. Die sozusagen historischen Sprachen resultieren aus der Degeneration der ursprünglichen Sprache – oder, wie Benjamin sagt, der Sprache des Namens – nach dem Sündenfall. Die Ursprache – d.h. diejenige vor dem Sündenfall – ist eine reine Sprache. Reine Sprache meint die Sprache, durch welche Gott die phänomenale Welt erschaffen hat: Das göttliche Wort ist schöpferisch. Die Sprache des Menschen vor dem Sündenfall ist selber göttlich, aber nicht schöpferisch, sondern erkennend. Die reine und ursprüngliche Sprache ist also, laut der theologischen Auslegung Benjamins, bloß eine einzige: sie ist bei Gott schöpferisches Wort, bei dem Menschen ist sie erkennendes und nennendes Wort. Anders formuliert, die menschliche Sprache ist dieselbe göttliche Sprache, aber ihres schöpferischen Charakters entzogen und erkenntnisfähig geworden. Das Wort Gottes erschafft die Dinge und gibt ihnen das Wesen; der Mensch hingegen, dessen Wort die Reflexion des Göttlichen ist, kann sie erkennen, weil er Zugang zu einem solchen Wesen durch den Namen hat, den er den Dingen zuschreibt. Die Sprache des Menschen ist die einzige Sprache der Namen. Der von Gott ausgesprochene Name, erschafft das Wesen der Dinge; der Name, von dem Menschen ausgesprochen, erkennt sie in ihrem eigentlichen Wesen. Aus diesem Grund ist der Mensch auch die Vollendung der göttlichen Schöpfung: Gott lässt die Dinge existieren, der Mensch, indem er sie benennt, teilt ihr spirituelles Wesen in seiner Sprache mit. Genau an dieser Stelle liegt der Schwerpunkt der Sprachtheorie Benjamins. Das spirituelle Wesen ist jedem Ding zu eigen. Ebenso zu eigen ist jedem Ding das Bedürfnis, seinen eigenen spirituellen Inhalt 40 GERSHOM SCHOLEM, Walter Benjamin und sein Engel, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1983, S.102ff; BERND WITTE, Walter Benjamin – der Intellektuelle als Kritiker, Stuttgart 1976, S.9ff; LISELOTTE WIESENTHAL, op. cit. S. 116ff. 41 Vgl. WINFRIED MANNINGHAUS, Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, Suhrkamp, Frankfurt am Mein 1995, S. 188ff. 42 GS II/1 140ff. 72 mitzuteilen. Das sprachliche Wesen eines Dings ist dagegen seine Art, seinen eigenen spirituellen Inhalt zu kommunizieren. Nun, die Art des Menschen zu kommunizieren – d.h. sein sprachliches Wesen – ist höher als das der Dinge, da sein sprachliches Wesen die Sprache Gottes selbst ist, also die vollkommene Sprache. Die Sprache des Menschen, indem sie die Dinge nennt, teilt in dem Name – also in der vollkommenen Sprache – den spirituellen Inhalt der Sache mit. Deswegen wirkt der Mensch als Vollendung der Schöpfung, aber gleichzeitig auch als Retter, denn er übersetzt in dem Moment, in dem er die Dinge benennt, diese in seine eigene Sprache: Er überträgt sie also aus der unvollkommenen Sprache der Dinge in die Sprache der Namen. Dadurch hebt er sie von der niedrigen Stufe der Natur auf eine höhere. Nach dem Sündenfall degeneriert die Sprache des Namens zu einer bloßen mitteilenden Sprache43 und verliert den Charakter des Benennens und des Erkennens. Das mitteilende Wort ist nicht mehr imstande, das Wesen des Dings zu begreifen. Es wird zu einer Myriade von Zeichen, die sich in der Mannigfaltigkeit der unterschiedlichen geschichtlichen Sprache zerstreuen. Die Funktion der Sprache ist nicht mehr das Erkennen: die Sprache erkennt nicht mehr das Ding in seinem Wesen, und wird ein bloßes Kommunikationsmittel. Der Name und die Ursprache bleiben, nach dem Sündenfall des ersten Menschen, bloß ein Ideal, das teilweise als Echo und als Bild von dem, was nicht mehr mitteilbar in den geschichtlichen Sprachen sein kann, anwesend ist: „Es ist nämlich Sprache in jedem Falle nicht allein Mitteilung des Mitteilbaren, sondern zugleich Symbol des Nicht-Mitteilbaren“.44 Der Name ist also laut der Interpretation Benjamins eine Idee. Wenn Benjamin in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels schreibt, dass sich die Idee in dem Namen – also in dem Moment, in dem der Name Symbol ist - offenbart45, so bedeutet das, dass der Name, auf den er hinweist und an den er sich wendet, nicht das Wort der geschichtlichen Sprache ist, sondern der Name der Ursprache. Diese ist aber eine Idee, die niemals völlig, wie wir oben gesehen haben, in dem Schein anwesend ist. Die Aufgabe des Philosophen ist es, das Wort auf den Namen zurückzuführen, d.h. das Phänomen zur Idee rückzuführen: 43 So schreibt Benjamin: „Indem der Mensch aus der reinen Sprache des Namens heraustritt, macht er die Sprache zum Mittel [...], damit auch an einem Teile jedenfalls zum bloßen Zeichen“ (GS II/1 153). 44 GS II/1 156. 45 Vgl. GS I/1 216f. 73 „Sache der Philosophen ist es, den symbolischen Charakter des Wortes, in welchem die Idee zur Selbstverständigung kommt, die das Gegenteil aller nach außen gerichteten Mitteilung ist, durch Darstellung in seinen Primat wieder einzusetzen“.46 Wenn also Benjamin behauptet, dass die Idee sich in dem Namen offenbart, meint er nicht damit seine Philosophie auf einer mystisch-theologischen Sprachtheorie zu begründen, sondern auf einer Ideenlehre, eben weil der reine Name eine Gestalt der Idee ist. Aus diesem Grund kann ist berechtigt festzustellen, dass die Sprachphilosophie Benjamins die Ideenlehre zum Fundament hat, die der wahre Kern des Gedankens Benjamins darstellt. Die Idee als Name führt uns zu dem vorher analysierten Attribut des Ursprungs. Wie die Idee als Ursprung auf die gründende Aufgabe – d.h. also die ontologische Aufgabe – der Idee hinsichtlich des Phänomens verweist, so ist auch die Idee als Name das höher-reine Sein, d.h. das einzige Sein, das, insoweit es eben rein und der Empirie entzogen ist, das Wesen der Empirie selbst prägt und bestimmt.47 Aus dem, was bisher festgestellt wurde, könnten wir nun bestätigen, dass die Idee für Benjamin eine Doppelstruktur besitzt. Dies taucht nämlich in den frühen Schriften auf, wird aber erst deutlich in Ursprung des deutschen Trauerspiels: Ist die Idee einerseits das Prinzip der Synthese, d.h. der Blickpunkt der Erkenntnis und die unendliche Aufgabe des Denkens – welche genauer in dem nächsten Kapitel analysiert werden wird –, ist sie andererseits eine metaphysische und fundierende Struktur, von der das Sein des Phänomens abhängt.48 „Als Sein gewinnen Wahrheit und Idee jene höchste metaphysische Bedeutung, die das Platonische System ihnen nachdrücklich zuspricht“.49 46 Ibidem. Vgl. GS I/1 216. 48 Ähnliches behauptet auch Bernd Witte in seinem Buch Walter Benjamin – der Intellektuelle als Kritiker im Bezug mit dem Begriff der Kritik: „Sie [die Idee] ist zugleich erkenntnistheoretische Konstruktion, die in der Geschichte selbst den Maßstab zu deren Beurteilung findet, und ‚metaphysische Struktur’, die das messianische Ende der Geschichte in der schlechten Gegenwart geistig vorwegnimmt“ (BERN WITTE, Walter Benjamin – der Intellektuelle als Kritiker, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1976, S.22). Ich bin aber der Meinung, dass man von einer sozusagen gründenden metaphysischen Struktur der Idee sprechen kann. D.h., die Idee ist etwas ontologisches nicht nur in bezug auf die Geschichte, weil sie das messianische Ende antizipiert, wie bei Witte, sondern vor allem – im ontologischen Sinne – in bezug auf die ganze phänomenale Welt. Die Beziehung der Idee mit dem messianischen Ende der Geschichte wird in dem nächsten Kapitel genauer analysiert. 49 GS I/I 210. 47 74 4. Die Temporalität der Idee Bereits in dem Fragment Erkenntnistheorie bezieht nämlich Benjamin die Erkenntnis auf das Jetzt der Erkennbarkeit. Die Erkenntnis, nach der er sucht, ist, wie gesagt, anders als die traditionelle – bzw. wissenschaftliche – Erkenntnis und muss mit dem Jetzt verbunden sein, denn nur in ihm ergibt sich die Wahrheit50. Das, was anfängt aus dieser Schrift herauszukommen, ist, dass die Idee nicht der traditionellen Zeit51 entspricht. Vielmehr verbindet Benjamin die Idee mit dem Jetzt und dem Augenblick. Insofern bestimmt er eine unkonventionelle Temporalität. Ein weiter Hinweis auf die Zeit der Idee befindet sich in der Programmschrift. Hier spricht Benjamin nicht direkt von dem Jetzt, sondern umreißt deutlich die Züge einer ideellen Erfahrung, nämlich der höheren Erfahrung, die unmittelbar sein soll. D.h. sowohl „ohne Vermittlung“ als auch „augenblicklich“. Das Problem der Temporalität der Idee wird aber in den Fragmenten und in den frühen Schriften nicht vertieft. In der Vorrede zum Trauerspielbuch finden wir einige Elemente, die uns erlauben, die Temporalität der Idee zu rekonstruieren. Zuerst ist die Idee außerhalb der Zeit und außerhalb der Geschichte, weil sie jenseits von beiden liegt. D.h. obwohl die Idee in der Zeit und in dem Verlauf der Geschichte anwesend ist, ist sie aber nicht vom kontingenten Phänomen begrenzbar. Die Idee gilt nämlich als Grundlage der Geschichte und der Zeit. Der Schlüsselbegriff, um das zu verstehen, ist der Begriff des „Ursprungs“: er enthält in sich die Vorgeschichte und die Nachgeschichte der Phänomene,52 als ob er eine Totalität wäre, in der sich die Vergangenheit und die Zukunft in der augenblicklichen Zeit der Ewigkeit treffen. Der Ursprung „steht im Fluss des Werdens als Strudel und reißt in seine Rhythmik das Entstehungsmaterial hinein“53: die Idee vermischt sich mit dem Werden der Geschichte, trotzdem bleibt sie über ihm, weil sie eben dessen Ursprung ist. Benjamin setzt also die Idee als Grundlage des Werdens ein und denkt sie als metaphysisch fundierendes und ewiges Prinzip. Dennoch leben in der Idee Gegensätze zusammen, die dialektisch harmonisieren. Die Idee, so schreibt Benjamin: „Will als Restauration, als Wiederherstellung einerseits, als eben darin Unvollendetes, Unabgeschlossenes andererseits erkannt sein“.54 50 Vgl. GS VI 46. Als traditionelle Zeit wird nämlich die Zeit in der regelmäßigen Rheinfolge des Vorher und Nachher gemeint. Gegen diese Konzeption der Zeit äußert sich Benjamin besonderes in den Thesen über die Geschichte und in den Notizen für das Passagen-Werk. 52 Vgl. GS I/1 226. 53 Ibidem. 54 GS I/1 226. 51 75 Als Fundament der historischen Zeit haben wir also ein Prinzip, das aus einer innerlichen Dialektik besteht: einerseits ist die Idee die Wiederherstellung eines Vorgegebenen, d.h. etwas Vollkommenes, anderseits ist sie ein Unvollendetes und Unabgeschlossenes; einerseits ist sie „Einmaligkeit“, andererseits ist sie „Wiederholung“.55 Es wird jetzt nötig, auf die Konzeption der Zeit hinzuweisen, die Benjamin in der kurzen Skizze Agesilaus Santander, um das Jahr 193356 entstanden, beschreibt, in der wir die selbe Dialektik von Gegensätzen finden. Es handelt sich um eine kleine Schrift, deren Inhalt ohne weiteres hermetisch bezeichnet wurde, sogar delirierend. In dem Text berichtet Benjamin von einer talmudischen Erzählung,57 in der die Schar von „neuen“ Engeln beschrieben wird. Die „neuen Engel“ sind die Engel, die nur einen Augenblick lang leben: sie werden erschaffen für einen Augenblick, um sich dann ins Nichts zu zerstreuen.58 So beschreibt Benjamin den neuen Engel: „Der Engel aber ähnelt allem, wovon ich mich habe trennen müssen: den Menschen und zumal den Dingen. In den Dingen, die ich nicht mehr habe, haust er [...]. Denn auch er selbst, der Klauen hat und spitze, ja messerscharfe Schwingen [,] macht keine Miene, auf den, den [er] gesichtet hat, zu stürzen. Er fasst ihn fest ins Auge – lange Zeit, dann weicht er stoßweis, aber unerbittlich zurück. Warum? Um ihn sich nachzuziehen, auf jene[m] Wege in die Zukunft, auf dem er kam und den er so gut kennt, dass er ihn durchmisst ohne sich zu wenden und den, den er gewählt hat, aus dem Blick zu lassen. Er will das Glück: den Wiederstreit, in dem die Verzückung des Einmaligen, Neuen, noch Ungelebten mit jener Seligkeit des Nocheinmal, des Wiederhabens, des Gelebten liegt. Darum hat er auf keinem Wege Neues zu hoffen als auf dem der Heimkehr, wenn er einen neuen Menschen mit sich nimmt“.59 Der in diesem Text beschriebene Engel ist die Allegorie der Temporalität der Idee. Er, schreibt Benjamin, schaut bereuend die Vergangenheit, die Personen und die bereits vergangenen Dinge an, die er in die Zukunft mitnehmen möchte. Die Melancholie der Ohnmacht, die der Engel darstellt, ist mit ihrem Gegensatz, dem Glück, verbunden; dieses wird als die gleichzeitige Anwesenheit von zwei Gegensätzen verstanden und bezeichnet: die Einmaligkeit des Jetzt und seine Wiederholung. Aber als Ausdruck des menschlichen 55 So schreibt Benjamin: „Aus ihr erweist in allem Wesenhaften Einmaligkeit und Wiederholung durcheinander sich bedingt“ (GS I/1 226). 56 Vgl. GS VI 522ff. 57 Vgl. Berešit Rabba, LXXVIII. 58 Ihre Aufgabe, nach dem Talmud, ist es in dem einzigen Augenblick ihres Lebens, für Gott zu lobsingen (vgl. GS. VI 523). 59 GS VI 523. 76 Schicksals weiß das Agesilaus Santander, dass dieses Glück, d.h. die Vereinigung der Einmaligkeit mit der Wiederholung, nicht dem Menschen möglich ist, wenn nicht als Objekt einer existentiellen Sehnsucht. Die beiden Elemente, aus denen das Glück in Agesilaus Santander besteht, sind nun die gleichen Elemente, welche die Dialektik der Idee in der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels bestimmen, obgleich – wenigstens in der erkenntniskritischen Vorrede dieses Textes – ihrer existenziellen Bezeichnung entzogen. Diese besondere Konzeption der Zeit, als eine dialektische Spannung zwischen dem Jetzt und der Dauer, zwischen der Einmaligkeit und der ewigen Wiederholung verstanden, hat bestimmt eine jüdische Herkunft60 zugrunde liegend. Das weist aber auch auf die ebenso dialektische Konzeption hin, die für Benjamin die Wahrheit hat: die Bedeutung der unendlichen Aufgabe und die Bedeutung der Wahrheit als Einmaligkeit, die sich in dem Jetzt vergegenwärtigt. In Agesilaus Santander ist die Zeit, die zugleich Jetzt und Permanenz des Jetzt ist, auch mit der Erinnerung verbunden. Benjamin beschreibt den Blick des Engels, der sich auf die Dinge fixiert und sich bewusst ist, dass er sie nicht in die Zukunft mitnehmen kann, weshalb er sie sich – wie Bilder – in sein Gedächtnis einprägt. Mit dem Buch über das Trauerspiel beginnt sich eine Temporalität der Idee abzuzeichnen, mit der Dialektik von Jetzt und Totalität verbunden, die aber die räumliche Komponente nicht ausschließt, sondern fördert. In der Erkenntniskritischen Vorrede ist die Idee - und das Jetzt ihrer Vergegenwärtigung - in einer Darstellung vorhanden. Die Terminologie Benjamins weist also auf die Sprache der bildnerischen Kunst hin, und infolgedessen auf den Raum, d.h. auf das Bild, das die Idee eben selbst wird, in jenem Moment, in dem sie sich vergegenwärtigt. Dies wird deutlicher – wie wir sehen werden – in den Schriften nach dem Trauerspielbuch. Es ist aber gerade in diesem Text, dass Benjamin zum ersten Mal eine Konzeption der Temporalität einführt61, die an den Raum und an das Jetzt gebunden ist und die sich in dem Begriff des Bildes harmonisiert. 60 In seinem Buch Hauptströmungen der jüdischen Mystik teilt Gershom Scholem den Messianismus in zwei Kategorien ein. Die erste beschreibt die messianische Zeit als ein unerwartetes und augenblickliches Ereignis in der Geschichte. Die Erlösung ist, nach dieser Konzeption des Messianismus, ein plötzliches Ereignis, das in keiner Weise von dem menschlichen Handeln abhängig ist. Die zweite Idee des Messianismus, dessen Vertreter und Begründer Isaac Luria war, meint dagegen die Erlösung und den Zugang zu der messianischen Ära als ein langer fast unendlicher Prozess, in dem der Mensch eine Hauptrolle spielt, weil er konkret und aktiv durch seine weltlichen Taten an der Rettung mitwirkt (vgl. GERSHOM SCHOLEM, Hauptströmungen der jüdischen Mystik, Suhrkamp, Frankfurt am Mein 1993, S. 267ff.). 61 Diese Konzeption der Temporalität der Idee finden wir eigentlich in einer vorherigen Niederschrift, Trauerspiel und Tragödie, aus dem Jahr 1916, betitelt. Es geht aber um eine Urzelle des Trauerspielbuches. Hier unterscheidet Benjamin bereits zwischen dem leeren Zeitablauf und der geschichtliche Zeit, die auf eine Erfüllung ausgerichtet ist. 77 5. Das Darstellungsproblem Der Raum, verbunden mit der Zeit der Idee, bringt uns zu dem, was Benjamin in der Erkenntniskritischen Vorrede „das Darstellungsproblem“ nennt.62 Die Aufgabe der Philosophie ist die Darstellung der Idee-Wahrheit, die sich der traditionellen Erkenntnis entzieht. In diesem Abschnitt werde ich die Beziehung zwischen der Philosophie und der Erkenntnis – bzw. zwischen der Idee und dem Begriff – vertiefen und im Folgenden auf einige vorher offen gebliebene Probleme eingehen, wie beispielsweise: Wie zeigt sich die Idee? Was versteht man unter den Begriff der „Betrachtung“ der Idee? Und, nicht zuletzt, gibt es einen Unterschied zwischen der Idee und der Wahrheit? Am Anfang der Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels spricht Benjamin von einer Betrachtung der Ideen: „Während der Begriff aus der Spontaneität des Verstandes hervorgeht, sind die Ideen der Betrachtung gegeben. Die Idee sind ein Vorgegebenes“63 und weiter im Mittelteil der Vorrede: „Die Idee bilden eine unreduzierbare Vielheit. Als gezählte – eigentlich aber benannte – Vielheit sind die Ideen der Betrachtung gegeben“.64 Was bedeutet also nun, dass die Ideen in der Betrachtung gegeben sind? Kann man von einer Anschauung der Idee sprechen? Oder von einer Wahrnehmung, wie jene der wir in dem ersten Kapitel begegnet sind? Benjamin schließt aus, dass die Idee das Objekt einer intellektuellen Anschauung65 ist. Ebenso schließt er aus, dass sie das Objekt der Erkenntnis ist. Die Abhandlung Benjamins ist nur scheinbar zweideutig. Einerseits spricht er von einer Betrachtung der Ideen (im Platonischen Sinne), die er als ein Vorgegebenes bezeichnet. Andererseits versucht er die Ideen auf die Begriffe zu beziehen, indem er auf diese Weise eine Art von Übergang zwischen letzteren – also von dem Menschen künstlich hergestellten Abstraktionen – und ersteren, die sich auf einer von der Empirie völlig verschiedenen Stufe befinden, zulässt. Gehen wir auf diesen scheinbaren Widerspruch ein, beginnend mit der 62 GS I/1 207. GS I/1 210. 64 GS I/1 223. 65 Vgl. GSI/1 215. 63 78 Erforschung des zweiten Punktes, nämlich der Analyse der Beziehung, welche die Ideen mit den Begriffen haben. So Benjamin: „Die Phänomene gehen aber nicht integral in ihrem rohen empirischen Bestande, dem der scheint sich beimischt, sondern in ihren Elementen allein, gerettet, in das Reich der Ideen ein. Ihrer falschen Einheit entäußern sie sich, um aufgeteilt an der echten der Wahrheit teilzuhaben. In dieser ihrer Aufteilung unterstehen die Phänomene den Begriffen. Die sind es, welche an den Dingen die Lösung in die Elemente vollziehen. Die Unterscheidung in Begriffen ist über jedweden Verdacht zerstörerischer Spitzfindigkeit erhaben nur dort, wo sie auf jene Bergung der Phänomene in den Ideen, das Platonische τά φαινόµενα σώζειν es abgesehen hat. Durch ihre Vermittlerrolle leihen die Begriffe den Phänomenen Anteil am Sein der Ideen“.66 Die Begriffe spielen für Benjamin eine Vermittlerrolle zwischen der Welt der bloßen Empirie und jener reinen der Ideen: Die Ideen können sich nur durch die Begriffe offenbaren. Diese „subsumieren“ das Phänomen und führen es von seiner falschen Einheit zu der einzigen wirklichen Einheit der Idee. Die Idee erwirbt also die Bedeutung der „Synthese“, im Kantischen Sinne des Wortes. Ein Teil der Sekundärliteratur berücksichtigt nämlich diese Beschreibung der Beziehung zwischen Begriffen, Ideen und Phänomenen und nutzt sie, um Benjamin einen sozusagen linearen67 Gedanken zuzuschreiben, der in einigen Zügen auf Kant und auf den Neukantianismus Cohens zurückgeführt wird. Folgt man genau dieser funktionalistischen Interpretation, bleiben aber ungelöste Probleme bestehen. Wenn es also wahr ist, dass Benjamin einerseits versucht, die Gedanken, die er in den frühen Fragmenten und in der Programmschrift skizziert hat, zu systematisieren, indem er sich darum bemüht, eine Theorie zu konstruieren, in der die Idee in Beziehung mit den anderen Elementen der Erkenntnis steht, dann bleiben andererseits jedoch einige undeutliche Stellen, die nur durch eine metaphysische und eben nicht funktionalistische Interpretation der Idee geklärt werden können. Wir erinnern uns daran, dass, wenn Benjamin von Idee spricht, er ein Wesen meint, das sich immer auf einer anderen Stufe sowohl hinsichtlich des Phänomens als auch des Begriffs – d.h. das Objekt der Erkenntnis – befindet, so dass es mehrere Stellen in der Vorrede gibt, wo Benjamin von einem verschiedenen Sein der Idee, von Inkommensurabilität zwischen der Idee und den Phänomenen usw. spricht. Es wird also wieder die Frage aufgeworfen, wie nämlich ein intentionsloses Wesen, das niemals rein in die phänomenale Welt hineintritt, sich 66 67 GS I/1 213f. Vgl. LISELOTTE WIESENTHAL, op. cit. S.7ff. 79 in einer „Beziehung“ in der phänomenalen Welt befinden könnte. Die Vermittlung, die es zwischen den Ideen und den Begriffen geben sollte, erweist sich also als problematisch. Es scheint, dass zwischen Phänomenen, Begriffen und Ideen ein – eben Kantischer – Mechanismus entsteht, dank dem die Phänomene in den Begriffen und, folglich, den Ideen „subsumiert“ werden. Trotzdem zeigt die berühmte Metapher der Sterne und der Sternbilder in eine andere Richtung. Die Ideen, so schreibt Benjamin, haben mit den Dingen eine Beziehung, die derjenigen ähnlich ist, die zwischen dem Sternbild und den Sternen besteht.68 Die Sterne sind laut Benjamin die Phänomene und die Sternbilder die Idee. Durch die Ideen verlieren die Begriffe ihre falsche Einheit und nehmen an der wahren Einheit der Idee teil. Die Ideen sind schließlich nicht die Gesetze der Begriffe der Dinge und sie dienen nicht der Erkenntnis der Phänomene,69 sondern sie sind deren „objektive Interpretation“.70 Das ist wohl der bedeutendste Teil in der ganzen Rede Benjamins. Mit anderen Worten, die Idee ist Einheit, unter der die Begriffe der Dinge erfasst, verstanden und gedacht werden müssen. Diese Einheit ist aber nicht Kantisch - d.h. als Mittel für die Erkenntnis der Phänomene - zu denken. Oder besser, sie ist nicht nur in dieser Art zu denken, denn die Idee hat zwei Strukturen: eine erkenntnistheoretische und eine andere metaphysische. Wenn also auf der einen Seite die Idee eine Erkenntnisfunktion hat – in dem Sinne aber, dass sie dazu dient, die Phänomene auszulegen – ist sie auf der anderen Seite auch die metaphysische Grundlage des Phänomens. Wir haben also einerseits den erkenntnistheoretischen Versuch, Phänomene, Begriffe und Ideen quasi systematisch aufeinander zu beziehen, andererseits einen Hinweis auf eine metaphysische Beziehung zwischen Phänomenen und Ideen. Die Theorie nach der die Begriffe die Funktion haben, die Phänomene zu verteilen und sie zu den Ideen zurückzuführen, die aber von Benjamin innerhalb des Trauerspielbuchs nicht weiter vertieft wird, ist offensichtlich ein Neukantisches Residuum. Durch die Analyse der Programmschrift wird die Wichtigkeit deutlich, die für den jungen Benjamin die Auseinandersetzung mit den Kantischen und Neukantischen Philosophie, in bezug auf die Erkenntnistheorie, hat. Jedoch ist es nicht genug, um beruhend auf den wenigen Hinweisen der Vorrede eine systematische Erkenntnistheorie konstruieren zu wollen, die Benjamin nicht zu Ende führt, und die vielmehr dem Geist von Ursprung des deutschen Trauerspiels widerspricht. Die metaphysische Intention, und zwar der Hinweis auf die metaphysische und begründende Struktur der Idee, kommt aber mehrere Male in Form des Darstellungsproblems 68 Vgl. GS I/1 215. Vgl. GS I/1 214. 70 Vgl. GS I/1 215. 69 80 vor. Die Ideen sind, laut dem Benjaminschen Zitat von Goethe, wie die faustischen Mütter,71 d.h. sie sind Ideale und sie verkörpern sich durch die Phänomene; dagegen erreichen letztere durch die Darstellung der Ideen die wahre Einheit. Wie werden aber die Ideen erfahren? Was ist und wie ereignet sich die Darstellung der Ideen? Benjamin erklärt nicht, was er mit „Betrachtung der Ideen“ meint. Die Betrachtung könnte ein Expedient sein, mit dem Benjamin versucht, die unendliche Entfernung, die er selbst – bereits zu Beginn der Vorrede – zwischen der Welt der Ideen und der phänomenalen bestimmt, zu überwinden: wenn es wahr ist, dass die Ideen durchaus vom Schein getrennt sind, muss es aber auch eine Berührung zwischen den zwei Welten geben. Dagegen könnten wir das geringste Bewusstsein der Ideen72 nicht haben. Da die Idee ein intentionsloses, unbegreifbares und unobjektivierbares Wesen ist, ist eine geistige Betrachtung - wie die platonische Betrachtung der Ideen und wie diejenige Betrachtung, die Goethe dem Philosophen und dem Künstler zuschreibt - die einzige Möglichkeit, sie erfahren zu können. Die Betrachtung impliziert nun die Beobachtung eines Objektes durch ein Subjekt, das betrachtet. Das aber spiegelt die traditionelle Theorie der Erkenntnis wieder, die auf der Dyade Subjekt-Objekt beruht, und folglich die Wahrheit zum Objekt macht. Eben die Überwindung dieser Theorie war das Ziel des philosophischen Programms Benjamins bereits seit dem Jahr 1917, begonnen, mit der Abfassung der Programmschrift. Es ist aus diesem Grund, dass der Begriff der „Betrachtung“, innerhalb der Vorrede, von dem der „Darstellung“ – oder besser, von der „Selbstdarstellung“ der Idee – begleitet ist und dadurch ergänzt wird: die Ideen werden beobachtet, jedoch geben sie sich selber irgendwie der Beobachtung hin, und verlieren auf diese Weise den traditionellen Status des von einem Subjekt beobachteten Objekts. Durch diesen Expedient gelingt es Benjamin den traditionellen Dualismus SubjektObjekt zu überwinden, indem es hier nicht darum geht, dass ein Subjekt eine Idee als Objekt betrachtet, sondern vielmehr dass sich die Idee - das reine Sein von der Empirie losgelöst dem Philosophen und dem Künstler offenbart. Damit meint Benjamin – wir werden es noch besser in dem nächsten Kapitel sehen können – dass es weder eine Methode noch System gibt, um zu der Ideenwelt zu gelangen. Umgekehrt manifestieren sich die Ideen demjenigen, der die Aufgabe hat, sie zu erkennen und sie durch das begriffliche Denken oder durch die Kunst darzustellen. Erneut sind die Analogien mit Goethe offensichtlich und mit der Idee, 71 So Benjamin: „Wie die Mutter aus voller Kraft sichtlich erst da zu leben beginnt, wo der Kreis ihrer Kinder aus dem Gefühl ihrer Nähe sich um sie schließt, so treten die Ideen ins Leben erst, wo die Extreme sich um sie versammeln. Die Ideen – im Sprachgebrauche Goethes: Ideale – sind die faustischen Mütter. Sie bleiben dunkel, wo die Phänomene sich zu ihnen nicht bekennen und um sie scharen“ (GS I/1 215). 72 Vgl. MICHAEL RUMPF, Spekulative Literaturtheorie: zu Walter Benjamins Trauerspielbuch, Verlag Anton Hain Meisenheim, Königstein/Ts. 1980, S21ff. 81 nach welcher der Künstler und der Philosoph die Fähigkeit haben die Ideen, die sich „vor Augen“ manifestieren, zu betrachten. Schließlich, wenigstens in dem Trauerspielbuch, ersetzt der Begriff der „Betrachtung“ das, was in den frühen Schriften die Rolle der Wahrnehmung war. Der Begriff der „Betrachtung“ weist deutlicher auf den Begriff des „Raumes“ hin, dem die Idee verbunden ist; er bereitet – meiner Meinung nach – den Übergang zu dem Begriff des „Bildes“ vor, welches in den Schriften nach dem Trauerspielbuch die tiefgehendste Bedeutung der Idee wird. Besteht schließlich ein Unterschied zwischen der Idee und der Wahrheit? Die Darstellung der Idee und der Wahrheit ist für Benjamin die Aufgabe der philosophischen Forschung. Er schreibt, dass die Wahrheit eine „Selbstdarstellung“73 ist, aber auch dass sie sich durch die Darstellung der Idee offenbart: „Die Wahrheit vergegenwärtigt im Reigen der dargestellten Idee“,74 und weist damit - zum ersten und einzigen Mal - relativ deutlich auf eine Unterscheidung zwischen den Ideen und der Wahrheit hin. Nur an dieser Stelle unterscheidet Benjamin explizit die Idee von der Wahrheit. An vielen anderen Stellen der Vorrede nimmt aber Benjamin keine Unterscheidung zwischen Idee und Wahrheit vor. Man kann deswegen von einem einzigen Fall eine eigentliche begriffliche Unterscheidung zwischen der Idee und der Wahrheit nicht ableiten. 6. Eine neue philosophische Einstellung Wir haben durch die Analyse der Fragmente und der Programmschrift gesehen, dass sich das Denken Benjamins um einen Kern herum, der die Begriffe der Erkenntnis und der Erfahrung enthält, entwickelt hat. Durch die Analyse der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels ist aber aufgetaucht, dass in diesem Text, Benjamin bloß auf den Begriff der „Erkenntnis“ eingeht, dessen Bedeutung jedoch gegensätzlich zu dem Begriff der „Erkenntnis“ in den frühen Schriften ist. Wenn nämlich Benjamin in diesen Schriften einen höheren Begriff der Erkenntnis, und damit ein Ideal, an das sich die Philosophie wenden 73 74 Vgl. GS I/1 213. GS I/1 209. 82 sollte, suchte, erwirbt die Erkenntnis75 in der Vorrede jedoch eine sekundäre Bedeutung. Was die Erfahrung – das zweite Element des Doppelbegriffs der frühen Fragmente – betriff, so wird sie in dem Trauerspielbuch nicht erwähnt. Das ist nicht nur interessant, weil der Begriff der „Erfahrung“ der Kern des philosophischen Programms des jungen Benjamins war, sondern vielmehr weil es ein Begriff ist, welcher erneut Wert und Zentralität in den Schriften nach dem Trauerspielbuch erwirbt. Wieso fehlt nun die Erfahrung in Ursprung des deutschen Trauerspiels? Eine mögliche Antwort auf diese Frage ist, dass Benjamin den Begriff der „Erfahrung“ mit dem der Philosophie und dem der Betrachtung der Ideen, die sie charakterisiert, ersetzt: In den früheren Fragmenten ist nämlich die Erfahrung eine Wahrnehmung – d.h. eine Beobachtung und eine Lektüre76 der Ideen - und in Ursprung des deutschen Trauerspiels ist die Philosophie eine Betrachtung der Ideen. Ein entscheidender Unterschied zwischen den frühen Schriften und dem Trauerspielbuch betrifft genau den Begriff der „Philosophie“. Hatte nämlich die Philosophie, die in den früheren Fragmenten der „höheren Erfahrung“ entsprach, als Ziel und als Ideal die Totalität und die Einheit, – schließlich war ihr Zweck, jede mögliche Erfahrung in der Welt des Scheins in sich zusammenfassen zu können - so fehlt in Ursprung des deutschen Trauerspiels gerade dieser Anspruch. In diese selbe Richtung wird Benjamin auch in den Werken nach 1927 weitergehen. Die Philosophie selber ist nicht mehr ein Ideal, sie erhebt nicht mehr Ansprüche an die Unendlichkeit, sondern sie ertappt sich dabei mit der Darstellung eines Unendlichen (der Idee) beschäftigt zu sein. Wenn die Philosophie bis zum Trauerspielbuch etwas Unendliches war, das in sich die unendliche Nummer der endlichen Erfahrung erhalten sollte, ist die Philosophie in Ursprung des deutschen Trauerspiels – genau im Gegensatz dazu – etwas Endliches, das die Aufgabe hat, eine Unendlichkeit - die Idee darzustellen, die ihr aber nicht mehr entspricht. Vor deren Angesicht befindet sie sich sogar mit einer Metapher Kants - wie gegenüber einem Abgrund. Ein Indiz für diese neuen philosophischen Einstellung Benjamins ist die Abwesenheit der drei Begriffe des „Systems“, der „Kontinuität“ und des „Symbols“ in dem 75 Benjamin sucht nicht mehr einen Begriff der „Erkenntnis“, wie er es in den frühen Neukantischen Studien gemacht hatte, sondern er stellt eine „Kritik“ der Erkenntnis vor. Sicherlich hat der Übergang von der „Theorie“ der Erkenntnis der jugendlichen Jahre zu der „Kritik“ der Erkenntnis des Jahrs 1927 eine Cohensche Reminiszenz. Es scheint aber, dass solcher Neukantischen Terminologie eine gegensätzliche philosophische Intention entspricht. Der Benjamin der Programmschrift hat die Philosophie als Theorie der Erkenntnis verstanden, oder besser, als Theorie der ganzen Erkenntnis. Wir haben gesehen, dass diese Konzeption nicht ohne weiteres auf den Neukantianismus Cohen zurückführbar war, weil sie in sich einige Zweideutigkeiten enthielt: die Einheit der Erkenntnis war ja doch für Benjamin ein Ideal, das also als unendliche Aufgabe verstanden wird, sondern auch und zugleich, als eine Art der Evidenzerfahrung, die sich unmittelbar – zufällig – ereignet und dann verschwindet. 76 Vgl. oben Kap. I und II. 83 Trauerspielbuch, die in den frühen Schriften Benjamins eine Hauptrolle spielen. In der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels ist nämlich eine Veränderung Benjamins zu bemerken, die in Richtung dreier gegensätzlicher Begriffe geht: „Allegorie“, „Traktat“ und „Diskontinuität“, die eine bescheidene Konzeption der Philosophie andeuten und bestätigen. In den Fragmenten und insbesondere in der Programmschrift77 haben wir mehrere Male den Begriff des „Systems“ angetroffen. Die Philosophie selbst wurde da von Benjamin als System betrachtet, oder besser, auf ihn sollte sie abzielen wie auf ein Ideal. Verbunden mit dem Begriff des „Systems“ ist der Begriff der „Kontinuität“. Benjamin erwähnt oft diesen Begriff in den frühen Schriften, um die Charakteristik der „Erfahrung höherer Art“, d.h. Einheit und Kontinuität, zu bezeichnen, die er zu suchen beabsichtigte. Die Kontinuität ist auch die des Systems, in dessen Einheit sich die verschiedenen Teile wie in einem Kontinuum harmonisieren. Diese beide Begriffe, „System“ und „Kontinuität“, weisen deutlich auf eine Kantische und Neukantische Beeinflussung in der Philosophie Benjamins hin. Seit Ursprung des deutschen Trauerspiels bemerken wir aber nicht nur die Abwesenheit des Systems und der Kontinuität, sondern vielmehr deren Ersetzung durch zwei genau gegensätzliche Begriffe: „Traktat“ und „Diskontinuität“. Was den ersten betrifft, so ist laut Benjamin das Traktat die einzige Form, welche die Philosophie übernehmen kann. Das Traktat schließt die systematische Form aus und wirkt jedoch mit Stücken und Fragmenten des Denkens wie bei der Konstruktion eines Mosaiks.78 Und später schreibt Benjamin das System der wissenschaftlichen Erkenntnis zu, die eben mit einer systematischen und lückenlosen Logik fortzuführen versucht, die aber in Wirklichkeit aus unbeweisbaren Voraussetzungen besteht. Die Wissenschaft ist durchaus entfernt von der Wahrheit, zu der sie zu gelangen verlangt, indem sie darauf abzielt das enzyklopädische Ganze der Wahrheiten umzufassen.79 Das System ist also nicht mehr auf die Philosophie bezogen, wie es in den frühen Schriften der Fall war, sondern auf die Wissenschaft. Benjamin führt weiter aus: das System hat Sinn, insoweit als es nicht ein Zusammenhang der einzelnen spezialisierten Disziplinen ist, sondern es von der diskontinuierlichen Struktur der Ideen inspiriert ist.80 Diese Ideenwelt aber kann – wie gesagt – besser von dem Traktat und von dem fragmentarischen Denken dargestellt werden. Der Terminus „Diskontinuität“ deutet eine Abwendung des jungen Benjamin von der Neukantischen Einstellungen an. Dies kann besser bei der Analyse der Thesen über die Geschichte festgestellt werden. Gerade in der Vorrede zu 77 Vgl. GS VI 37, 39 und GS II/1 157ff. Vgl. GS I/1 208. 79 Vgl. GS I/1 213. 80 Vgl. Ibidem. 78 84 Ursprung des deutschen Trauerspiels, taucht zum ersten Mal der Begriff der „Diskontinuität“ auf, der deutlich dem der Kontinuität – Synonym der Einheit – der in den vorherigen Jahren auf die Philosophie und auf die Erfahrung bezogen wurde, entgegensetzt ist. Für den Benjamin des Trauerspielbuchs ist eben die Diskontinuität das Synonym der Idee. Außerdem wird der Begriff des „Symbols“ aus den frühen Schriften durch dem der Allegorie ersetzt. Die Allegorie stellt in Ursprung des deutschen Trauerspiels die Beziehung Phänomen-Idee dar. Sie drückt die grundliegende und grundsätzliche Entfernung zwischen dem Phänomen und der Idee aus, wogegen der Begriff des „Symbols“ dazu neigt sie zu überholen. Das Symbol ist nämlich die Sache, ohne die Sache selbst zu sein: die Sache - welche Symbol ist - enthält in sich das, wessen Symbol sie ist; bei der Allegorie dagegen weist etwas auf etwas anderes hin, das sich in einer unterschiedlichen und völlig unerreichbaren – Stufe befindet. Darüber hinaus ist es zu bemerken, dass die Beziehung Idee-Phänomen von Benjamin in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels als „Rettung“ bezeichnet wird. Die Beziehung Idee-Phänomen wird also als Rettung aufgefasst: das Phänomen ist in dem Moment, in dem es an der Idee teilnimmt, gerettet, da es so die Einheit erwirbt, die ihm wesentlich fehlt. Der Terminus „Rettung“ und der Begriff der „Allegorie“ drücken die Distanzierung Benjamins von seiner frühen Konzeption aus, die dazu neigte, die Kluft zwischen der Ideenwelt und der Scheinwelt zu überwinden. Das Thema der „Rettung“ ist in diesem Kapitel nur skizziert und wird aber in den nächsten in allen seinen Formen entwickelt werden. Hier möchte ich nur noch feststellen, dass die „Rettung“ für Benjamin eine Art von „intellektueller Methode“ ist, durch die der Philosoph, indem er das Phänomen zur Einheit der Idee zuführt, die Welt des Scheins von seiner eigenen Ausdruckslosigkeit und Endlichkeit rettet. Mit der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels gelangt Benjamin zu einer anderen philosophischen Einstellung, in der sich die Philosophie ihrer Grenze bewusst ist, eben weil sie selbst Teil des Scheins ist und die Erfahrung der Entfernung der Idee erlebt. Die Philosophie wird ein Mosaik der Gedanken, welche die diskontinuierliche Ideenwelt darzustellen versuchen. Es gibt aber keine Methode. Dagegen sieht es so aus, dass eine solche Darstellung dem einzelnen Philosophen anvertraut ist und dessen Fähigkeit die Phänomene zu betrachten und die Ideen wahrzunehmen, die sich schließlich nie in dem Schein offenbaren, wenn nicht durch einen schwachen allegorischen aus dem Phänomen bestehenden Hinweis. Das Phänomen weist auf die Idee hin, es enthält sie aber nicht mehr, anders als in den frühen Schriften. Was ist schließlich die Idee in Ursprung des deutschen Trauerspiels? 85 Wir haben eine Definition der Idee innerhalb der Vorrede dieses Textes gesucht. Das was wir aber gefunden haben, waren ziemlich undeutliche und ungenaue Definitionen. Die Idee – oder die Wahrheit – wird in dem Trauerspielbuch als Ursprung, Monade, Name und Einheit bezeichnet.81 Das Denken, nicht mehr systematisch, sondern dialektisch, hat die unendliche Aufgabe, sich an dem Phänomen aufzuhalten und es unendlich zu der Einheit der Idee zurückzuführen, wobei es diese aber nicht endgültig erreicht. Gleichzeitig existiert zwischen der Idee und dem Phänomen eine Abhängigkeit. Das Phänomen braucht die Idee, um die Einheit zu erreichen und um gedacht werden zu können, und die Idee – durchaus von der Empirie getrennt – braucht das Phänomen, um sich zu verkörpern und zu offenbaren. Man könnte sagen, dass die Idee in dem Moment, in dem das Denken die unendliche Entfernung zwischen Ideen und Phänomenen begreift, dargestellt ist. In dem Text aus dem Jahr 1927 überwindet also Benjamin die philosophische Einstellung der Programmschrift, indem er die Äquivalenz Philosophie-Erkenntnis abschafft, und indem er die Dringlichkeit dazu betont, einen unmittelbareren Übergang zur Realität und eine Einstellung der Philosophie, die nicht mehr eine bloße abstrakte Analyse der Begriffe ist, zu finden. Die Behauptung Benjamins in der Vorrede, dass die Idee nicht dazu dient, die Objekte zu kennen, ist also in dem Sinne zu verstehen, dass die Philosophie nicht wissenschaftliche Erkenntnis ist, sondern dialektisches Denken: d.h. ein Denken das sich zwischen der Idee und dem Phänomen bewegt. Es geht von der Idee aus und bliebt bei der Realität um sie auszulegen, und nicht um ihren logischen und strukturalen Zusammenhang zu begreifen. Die Idee „dient“ zur Interpretation der Realität, die für Benjamin die einzige Form der Erkenntnis82 der Welt ist. Die Idee, wie gesehen, hat bei Benjamin zweierlei Strukturen: eine erste erkenntnistheoretische, welche die „Erkenntnis“ des Phänomens erlaubt, im Sinne dass sie dessen Konzeptualisierung und Auslegung ermöglicht. Das Phänomen ist nämlich in sich reine und grobe Empirie, welche die Vermittlung des Begriffs braucht um gedacht, ausgedrückt usw. werden zu können. Die Einheit, welche die Idee dem Phänomen verleiht, 81 Vgl. MICHAEL RUMPF, op. cit., S.31ff. Hinsichtlich der Vorrede schreibt Rumpf, dass Benjamin: „Nirgendwo eine Ablehnung begrifflich genauer und argumentativ klarer Gedankenführung [formuliert]. Seine Forderung nach ästhetischer Darstellung impliziert keine Aufgabe gedanklicher Stringenz [...]. An dieser nun mangelt es. Bei aller Fülle der eingeführten Begriffe bleiben die genauen Verhältnisse der Begriffe untereinander doch unklar. Wie auch immer ihre Relation bestimmt wird, die verschiedenen Äußerungen, die sich innerhalb der Vorrede finden, ergeben selten ein harmonisches Bild“ (M. RUMPF, op. cit. S.31). Rumpf besteht darauf, dass Benjamin weder das erklärt, was die Ideen eigentlich sind, noch welche Relation sie mit Begriffen und Phänomenen haben: der Autor betont also die Undeutlichkeit Benjamins, wenn er über die Idee redet. Rumpf ist eigentlich der Meinung, dass von Benjamin jeder Begriff zur Idee geadelt wird (S.33). Benjamin, laut Rumpf, denkt die Idee als eine Allgemeinheit: „Benjamins Ideenlehre ist eine Wesenlehre [...] insofern kann Benjamin alles zu Idee erheben, was normalerweise als Begriff figuriert“ (M. RUMPF , op. cit. S.35). 82 Siehe unten, Kap. IV. 86 erlaubt ihm (d.h. der Empirie) mitgeteilt und folglich vor einer Welt, die ansonsten nicht erreichbar83 wäre und die ausdruckslos bleiben würde, gerettet werden zu können84. Die Idee ist in diesem Fall ein Ideal, nach dem der Gedankengang unendlich strebt, wobei er sich aber seine unüberwindbare und notwendige Endlichkeit immer vor Augen hält. Diese „erkenntnistheoretische“ Funktion der Idee – wie wir sehen werden – stellt für den Philosophen eine Art von Methode dar, die in einer unendlichen Aufgabe besteht: Die Wahrheit ist in diesem Fall dem jüdischen Begriff der „Torah“ assimilierbar, d.h. Lehre in unendlicher Weiterverbreitung, die unendlich mögliche Lektüren erlaubt. Die zweite Struktur der Idee ist die metaphysische, d.h. die fundierende Struktur. Wir haben gesehen, dass die Idee der Ursprung des Phänomens ist, und dass sie das ist, was dem Phänomen zugrunde liegt und was dessen Existenz einen Wert gibt. Schließlich haben wir gesehen, dass bei dieser metaphysischen Struktur der Idee sich das Bedürfnis zeigt, unmittelbar zur Wahrheit zu gelangen, fast wie durch eine Evidenzerfahrung oder eine unmittelbare Eingebung85. Man kann sagen, dass die Idee der Ursprung und das Ziel86 der Welt des Scheins ist und dass die Rettung als Beziehung zwischen Idee und Phänomen der rote Faden der Philosophie Benjamins von Ursprung des deutschen Trauerspiels bis hin zu seinen letzten Schriften ist: die Aufgabe der Philosophie ist nicht mehr System zu werden, sondern die einer Darstellung der Idee, indem das Phänomen zu dieser zurückgeführt und dadurch gerettet wird. Mit dem Trauerspielbuch zeigt sich eine neue Einstellung der Philosophie, eben als nicht systematisches, sondern dialektisches und fragmentarisches Denken, und eine neue Beziehung Phänomen-Idee, die von einer unüberwindlichen Entfernung charakterisiert wird. Aus dieser Entfernung ist der Begriff der „Allegorie“ eben Allegorie. 83 Ähnlich mit dem, was Benjamin in dem Sprachessay schreibt, in dem die Sprache der Dinge von der Sprache der Namen – d.h. die des Menschen – gerettet werden muss, ist das Phänomen in der Vorrede, das in der völligen Ausdruckslosigkeit stecken bleibt, bis es zu der Einheit der Idee zurückgeführt wird. 84 Siehe unten, Kap. IV. 85 Rumpf ist der Meinung, dass die Vorrede zum Ursprung des deutschen Trauerspiels einige theoretische Probleme und viele Inkongruenzen enthält: Benjamin war nicht in der Lage auf sie einzugehen. M. Rumpf findet die Tatsache problematisch, dass, wenn die Wahrheit sich selber darstellt, dann die Betrachtung des Philosophen völlig unnützlich wird. Darüber hinaus, wenn die Wahrheit ein unintentionales Wesen ist, dann kann sie nicht zugleich ein Name sein (Vgl. MICHAEL RUMPF, Spekulative Literaturtheorie: zu Walter Benjamins Trauerspielbuch, Königstein/Ts. 1980, S21ff.). 86 Den Satz übernimmt Benjamin von Karl Kraus: „Du kamst vom Ursprung – Ursprung ist das Ziel“. Die sind die Worte, die Gott dem „Sterbende Mensch“ als Trost sagt, und die Benjamin in seinem Essay über Kraus erwähnt (vgl. GS II/1 360). 87 VIERTES KAPITEL DIE ROLLE DER IDEE NACH DEM TRAUERSPIELBUCH 1. Probleme, Fragen. Allgemeine Linien In diesem Kapitel werde ich die Rolle der Idee in den Schriften nach dem Trauerspielbuch betrachten. Innerhalb des Materials über das Passagen-Werk, über Baudelaire und über die sogenannten Thesen über die Geschichte, werde ich die Begriffe der „Erkenntnis“ und der „Erfahrung“ erläutern, genauso wie es in dem vorherigen Teil der Arbeit gemacht worden ist. Damit möchte ich zeigen, dass die Gedanken Benjamins, selbst bloß in der Form von Fragmenten und Notizen, in eben jene Richtung fortfahren, die uns von der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels gezeigt wurde, und dass sie eigene Punkte daraus entwickeln und einige Begriffe radikalisieren. Es wird zutage gebracht, dass in den zuletzt genannten Schriften Benjamins 1) der Begriff der „Wahrnehmung“ wieder eine grundsätzliche Rolle spielt, und dass er mit dem der „wahren Erkenntnis“ und der „wahren Erfahrung“ zusammenfällt; 2) die Idee die Bedeutung von „Bild“ radikal annimmt, und dass dies nicht so sehr eine terminologische Änderung beweist, sondern vielmehr eine konzeptuelle. Wir werden untersuchen, ob die Idee, d.h. die Wahrheit, auch in den Spätwerken durch die Anwesenheit zweier gegensätzlicher Bedeutungen gegeben ist: einerseits unmittelbare Wahrnehmung und andererseits unendliche Aufgabe, um schließlich zu verstehen, in welchem Sinn in diesem scheinbaren Wiederspruch eine Bedeutung steckt, die – meiner Meinung nach – durch den benjaminschen Ausdruck „Wahrnehmung ist Lesen“ ausgedrückt wird. Demzufolge werde ich mich mit dem Begriff der „Dialektik“ beschäftigen, indem die Besonderheit, die sie in dem späteren Denken unseres Autors erwirbt, erforscht wird. Schließlich wird der Begriff der „Rettung“ - der bereits im Trauerspielbuch erscheint nicht von einem theologischen Gesichtspunkt aus, sondern von einem intellektuellen 88 thematisiert, und wir werden damit zeigen, in welchem Sinn bei Benjamin von einer intellektuellen Rettung als philosophische „Methode“ die Rede ist, und wie diese „Methode“ ihrerseits eine Antizipation der eschatologischen Rettung sein kann. 2. Erkenntnis und Erfahrung Rolf Tiedemann hat in der Einleitung des Herausgebers zu Passagen-Werk geschrieben, dass ein sinnvolles Studium dieses Textes mit der Lektüre des Konvoluts N - 1 Erkenntnistheoretisches, Theorie der Forschritt betitelt - anfangen sollte. Das ist nämlich der Teil der riesigen benjaminschen Notizensammlung, der die bedeutungsvolleren Elemente enthält, welche die theoretische Entwicklung des Denkens Benjamins nach 1929 beschreiben. Zunächst kommt in dem Material über das Passagen-Werk2 der Begriff der „Erkenntnis“ wieder vor, der – wie zuvor gezeigt – in dem Trauerspielbuch aufgegeben und durch den der „Philosophie“ ersetzt worden ist. Dennoch ist die Erkenntnis, die in Passagen-Werk erscheint, anders als die traditionelle Erkenntnis, mit den im Trauerspielbuch gestellten Thesen übereinstimmend. Bekannt ist das Fragment, in dem Benjamin seine Absicht äußert, das XIX. Jahrhundert – ebenso wie er in dem Trauerspielbuch das XVI. Jahrhundert studiert hatte – durch die Analyse der Formen und der Änderungen der Pariser Passagen3 methodologisch zu studieren. Die „Fakten“, die Benjamin zu betrachten beabsichtigt, sind nicht unter dem traditionellen Begriff der „Kausalität“ erforscht, sondern sie werden betrachtet, so dass die Entwicklung ihrer Form sich aus ihren eigenen Innern offenbart. Nicht zufällig benutzt Benjamin den goetheschen Begriff des „Urphänomens“: „Diese Fakten, angesehe[n] unter dem Gesichtspunkt der Kausalität, also als Urdachen, wären aber keine Urphänomene; das werden sie erst, indem sie in ihrer selbsteigenen Entwicklung – Auswicklung wäre besser gesagt – die Reihe der konkreten historischen Formen der Passagen aus sich hervorgehen lassen, wie das Blatt den ganzen Reichtum der empirischen Pflanzenwelt aus sich herausfaltet“.4 1 Vgl. GS V/1 41. Der vom Herausgeber des Werkes ausgewählte Titel für das Konvolut N des Passagen-Werks ist Erkenntnistheoretisches, Theorie der Fortschritt; dennoch haben wir wieder mit einer Erkenntniskritik anstatt mit einer Erkenntnistheorie zu tun. 3 Vgl. Briefe, S.83f. 4 GS V/1 577. 2 89 Welche sind diese „Fakten“, an die sich das philosophische Denken richtet? Was für eine Art der Erkenntnis ist die philosophische Erkenntnis, die die „Fakten“ als „Objekt“ hat? In der Analyse der Vorrede zum Trauerspielbuch erkannten wir den undeutlichen Ausdruck Benjamins, nach dem die Philosophie die Aufgabe hat, die Idee „darzustellen“. Da fragten wir uns, was „die Ideen darzustellen“ heißt, und wie demzufolge etwas Endliches – d.h. die Philosophie – etwas Unendliches, Unobjektivierbares, Undarstellbares – d.h. die Idee – darstellen kann. All dies scheint deutlich in dem Material zum Passagen-Werk zum Ausdruck zu kommen: das, was also in der Vorrede zum Trauerspielbuch bloß entworfen war, nimmt in dem Passagen-Werk eine endgültigere Wendung. Die Ideen darzustellen heißt bei Benjamin, die „Fakten“ darzustellen, als ob sie Ideen wären. Das bedeutet zudem das Phänomen zur Ideen zurückzuführen: nur so – d.h. wenn es zur Idee zurückgeführt wird wird es zu einem „Fakt“. Sehen wir jetzt in welchem Sinn. In dem Passagen-Werk hat die Philosophie die Aufgabe, das Phänomen zu betrachten, an das sich das Denken hält, als ein „Urphänomen“, dessen Formen und Änderungen sie beschreiben soll. Unter „Urphänomen“ versteht Benjamin - wie zuvor gesagt - die Idee; eine an sich einheitliche und organische Form, die von den anderen Formen unabhängig ist. Die „Fakten“ also sollen als Formen für sich betrachtet werden, deren inneren Teile sich organisch entwickeln – als seien sie Organismen – Benjamin erklärt – selbst wenn nur fragmentarisch – wie dies geschieht. Die philosophische Erkenntnis ist zunächst „blitzhaft“: „In den Gebieten, mit denen wir zu tun haben, gibt es Erkenntnis nur blitzhaft. Der Text ist der langnachrollende Donner“.5 Und außerdem: „Auf den Differentialen der Zeit, die für die anderen die ‚großen Linien’ der Untersuchung stören, baue ich meine Rechnung auf“.6 Bleiben wir bei dem Begriff der „Erkenntnis“. Obwohl der Terminus „Erkenntnis“ wieder in dem Passagen-Werk auftaucht, unterscheidet Benjamin diese „philosophische“ Erkenntnis weiterhin von der wissenschaftlichen. In dem Passagen-Werk finden wir also wieder die selbe Unterscheidung, die bereits in den frühen Schriften zufinden war, zwischen der wissenschaftlichen Erkenntnis und der philosophischen Erkenntnis. Der selbe Terminus 5 6 GS V/1 570. Ibidem. 90 „Erkenntnis“ wird wieder auf die Philosophie erweitert und demzufolge in seiner Bedeutung erhöht, ebenso wie es in der Programmschrift gemacht wurde. Die philosophische Erkenntnis verhält sich anders als die wissenschaftliche und behält die Eigenschaften, welche die Philosophie in der Vorrede zum Trauerspielbuch innehatte: während die wissenschaftliche Erkenntnis mit dem Begriff „Kausalität-Wirkung“ verbunden ist, und demzufolge dem Begriff der traditionellen Zeit - d.h. die Reihenfolge der Momente in ein „zuvor“ und einem „danach“ –, ist die philosophische Erkenntnis „blitzhaft“, also unmittelbar und unberechenbar. Zweitens benutzt sie nicht den traditionellen Nexus Kausalität – Wirkung: das philosophische Denken soll über die „Fakten“ gleiten, bis es an einem besonderen anhält und diesen aus seinem Kontext (immer noch mit dem kausalistischen Nexus verbunden), in welchen ihn die Tradition eingefügt hat, extrapoliert. An diesem Punkt wird das Phänomen, aus dem kausalistischen Nexus entfesselt, isoliert und als „Urphänomen“ betrachtet, d.h. als eine organische Totalität und Einheit, in der die inneren Entwicklungen und die Änderung betrachtet und beschrieben werden, ohne die Fakten, die einem solchen Phänomen nach dem Prinzip Kausalität-Wirkung vor- und nachstehen, zu berechnen. Die Philosophie, schreibt Benjamin, betrachtet und zeigt: „Methode dieser Arbeit: literarische Montage. Ich habe nichts zu sagen. Nur zu zeigen“.7 Benjamin vergleicht die philosophische Erkenntnis mit dem Prozess des Erwachens. Beide verbindet die gleiche Augenblicklichkeit: „Dann wäre der Moment des Erwachens identisch mit dem ‚Jetzt der Erkennbarkeit’, in dem die Dinge ihre wahre – surrealistische – Miene aufsetzten“.8 Vor allem aber verbindet sie der gleiche Übergang, der den Prozess Traum-Wachzustand charakterisiert: die unmittelbare Erinnerung. So schreibt Benjamin: „Sie [historische Fakten] festzustellen ist Sache der Erinnerung. Und Erwachen ist der exemplarische Fall des Erinnerns“.9 7 GS V/1 574. GS V/1 579. 9 GS V/2 1057. 8 91 Und weiter: „Das Korrektiv dieser Gedankengänge liegt in der Überlegung, dass die Geschichte nicht allein eine Wissenschaft sondern nicht mindern eine Form des Eingedenkens ist. Was die Wissenschaft ‚festgestellt’ hat, kann das Eingedenken modifizieren. Das Eingedenken kann das Unabgeschlossene (das Glück) zu einem Abgeschlossenen und das Abgeschlossenen (das Leid) zu einem Unabgeschlossenen machen“.10 Die philosophische Erkenntnis ist der Prozess eines Eingedenkens der Fakten, das dem dialektischen - Prozess des Erwachens ähnelt. Benjamin schreibt in einem Fragment des Teils, den die Herausgeber des Werkes Frühe Entwürfe. Pariser Passagen II betiteln: “Dialektische Struktur des Erwachens: Erinnerung und Erwachen sind aufs engste verwandt. Erwachen ist nämlich die dialektische, kopernikanische Wendung des Eingedenkens. Es ist ein eminent durchkomponierter Umschlag der Welt des Träumers in die Welt der Wachen“.11 Was sind also die „Fakten“, mit denen sich die Philosophie beschäftigt? Wenn Benjamin von der geschichtlichen Erkenntnis spricht, dann meint er nicht damit sich bloß auf die Historiographie zu beziehen. „Geschichte“ ist bei Benjamin die Beschreibung der Formen und der Entwicklungen eines Phänomens, das als eine Einheit für sich vollständig betrachtet wird. Ein solches Phänomen kann ein Ereignis (oder eine Epoche) der Geschichte der Humanität sein (die universelle Geschichte), aber auch ein Ereignis der individuellen Geschichte. So schreibt Benjamin in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels: „Die philosophische Geschichte als die Wissenschaft vom Ursprung ist die Form [...], die die Konfiguration der Idee als durch die Möglichkeit eines sinnvollen Nebeneinanders solcher Gegensätze gekennzeichneten Totalität heraustreten lässt. Die Darstellung einer Idee kann unter keinen Umständen als geglückt betrachtet werden, solange virtuell der Kreis der in ihr möglichen Extreme nicht abgeschritten ist. Denn das in der Idee des Ursprungs Ergriffene hat Geschichte nur noch als einen Gehalt, nicht mehr als ein Geschehen, von dem es betroffen würde. Innen erst kennt es Geschichte, und zwar nicht mehr im uferlosen, sondern in dem aufs wesenhafte Sein bezogenen Sinne, der sie als dessen Vor- und Nachgeschichte solcher Wesen ist, zum Zeichen ihrer Rettung oder 10 11 GS V/1 589. GS V/2 1058. 92 Einsammlung in das Gehege der Ideenwelt, nicht reine, sondern natürliche Geschichte“.12 Benjamin schreibt, dass ein „Fakt“ geschichtlich ist – bzw. wird –, wenn er auf die Ideen bezogen ist, wenn er an den Ideen teilnimmt. Nur so wird er von der falschen Überlieferung der Tradition gerettet. Dass der Fakt zur Idee zurückgeführt wird, heißt, dass er eine Organizität und Einheitlichkeit gewinnt und behält, die der Historismus doch a priori eliminiert, indem er es als ein Element einer Kette von Ursache und Wirkungen betrachtet. Die Konstruktion der Geschichte, die uns vom Historismus13 vorgeschlagen wird, ist eine Aufzählung von Ereignissen: die Fakten werden nämlich von dem Chronisten nach dem Kriterium der Wichtigkeit ausgewählt. Diejenigen, die am bedeutensten sind, sind dann nach einer rigorosen Ordnung und einem kausalistischen Kriterium, in eine Serie eingeordnet. Nach dieser ist jedes vorhergehende Faktum die notwendige Ursache dessen, das ihm folgt. Das Ergebnis einer solchen Operation hat zweierlei Konsequenzen. Zuerst fördert der Chronist nur die Ereignisse zutage, die, seiner Meinung nach, ein relevantes Bedeutung haben übernehmen: die Geschichte ist traditionell die Geschichte der Gewinner. Zweitens wird die Geschichte durch die Idee eines unendlichen Fortschrittes ausgelegt, als ein weitergehender Entwicklungsprozess. Beim Historismus ist ein Ereignis geschichtlich, wenn es in die Ereignisreihenfolge der kausalistischen Serie eingefügt wird, wenn also jede Ursache und jede Wirkung objektiv gefunden werden kann, und wenn auf diese Art und Weise möglich ist, die Entwicklung der Humanität manifestieren zu lassen. Laut Benjamin, führt die Forschung nach der Objektivität notwendigerweise zu einer Paralyse der Geschichte und zu einer abstrakten und verfälschten Konstruktion. Das Bild der Geschichte, welches der Historismus der Tradition als Erbschaft hinterlässt, ist das Resultat einer Verkümmerung: die wissenschaftliche erlangte Konstruktion muss also eine deutliche und ordentliche Ganzheit ergeben. Demzufolge wird die Vergangenheit in rigiden Schemata gelähmt. Die „wahre“ Geschichte aber, laut Benjamin, darf nicht wissenschaftlich studiert werden, d.h. nach den Kriterien der historistischen Tradition, weil es sich um ein Material handelt, das nicht klassifiziert und schematisiert werden kann, sondern erinnert. Die universelle ebenso wie die individuelle Geschichte muss also durch eine Art von Erinnerung verarbeitet werden: 12 GS I/1 227. Ich bleibe nicht bei der sehr bekannten Benjaminchen Kritik des Historismus; ein Hinweis dafür ist das ausreichende Buch von KLAUS GABER, Rezeption und Rettung, Niemeyer, Tübingen 1987, S.20ff.; das Buch von JULIAN ROBERTS, Walter Benjamin, London 1982, S. 199ff, S. 199ff.; und schließlich das Buch von GIULIO SCHIAVONI, Walter Benjamin. Il figlio della felicità, Einaudi, Torino 2001, S. 373ff. 13 93 „Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen ‚wie es denn eigentlich gewesen ist’. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt“.14 Diese Erinnerung ist das Eingedenken in der Jetztzeit. Der Terminus „Eingedenken“, wie Andreas Panngritz zu Recht bemerkt, wird absichtlich von Benjamin ausgewählt, um auf eine konzeptuelle Unterscheidung hinsichtlich dem häufigeren Terminus „Erinnerung“ hinzuweisen.15 Das Eingedenken ist keine bloße Erinnerung. Die terminologische Wahl Benjamins ruft das hebräische Wort für Erinnerung, zakhar16, hervor, das nicht nur „erinnern“ bedeutet, sondern auf die Dimension des Gelebten hinweist, und zwar auf die Möglichkeit, das vergangene Ereignis durch die Erinnerung wiederzuerleben. „Erinnerung“ verweist dennoch auf die vulgäre Konzeption des Erinnerns, nämlich auf den Begriff der ordentlichen Zeit, die als ein Kontinuum verstanden wird, in dem die Momente nach einer regulären Ordnung aufeinander folgen. Die Zeit der Geschichte ist aber die des Eingedenkens, welches, wie es aus dem oben zitierten Fragment hervorgeht, nicht nur dazu in der Lage ist, die Feststellungen der Geschichte zu ändern, sondern vor allem in der Lage ist, die Vergangenheit zu re-aktualisieren. Kehren wir zum Begriff der „Erkenntnis“ zurück, und gehen wir auf dessen Beziehung mit dem der „Erfahrung“ ein. Aus dem Material, das Benjamin nach 1929 schrieb, tritt die Identifizierung – ebenso wie bei den frühen Schriften – zwischen dem Begriff der „Erkenntnis“ – wo als „Erkenntnis“ die philosophische Erkenntnis und nicht die wissenschaftliche gemeint ist – und dem der „Erfahrung“ erneut hervor. Ebenso wie die philosophische Erkenntnis den Charakter des Erwachens und den des Überganges vom Unbewussten zum Bewussten gewinnt, macht der gleiche Charakter des Überganges vom Unbewussten zum Bewussten die benjaminschen Reflexionen über die Erfahrung aus. In der Schrift Über einige Motive bei Baudelaire setzt Benjamin der wahren Erfahrung die degenerierte Erfahrung (die er Erlebnis nennt) der Moderne entgegen. Ebenso wie Benjamin in der Schrift über das mimetische Vermögen eine progressive Degenerierung der Wahrnehmung bemerkt, stellt er in Über einige Motive bei Baudelaire eine Modifizierung des Begriffes der „Erfahrung“ in der Moderne fest. Um diesen Prozess zu beschreiben, fängt Benjamin von der von Proust17 bekannten „beschriebenen Erfahrung“ an, nach der der Geschmack eines Kuchens das unwillkürliche Gedächtnis zu vergangenen Zeiten zurückführt. 14 GS I/2 695. Vgl. ANDREAS PANNGRITZ, Walter Benjamin als „Theologe“, in Jüdische Denker im 20. Jahrhundert, hg. von H. Lehming, EB Verlag, Hamburg 1997, S.63ff. 16 Vgl. STÉPHANE MOSÉS, La storia e il suo angelo. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, it. Üb. von M. Bertaggia, Anabasi, Milano 1993, S. 171ff. 17 Vgl. GS I/2 610ff. 15 94 Die Erfahrung ist bei Benjamin – ebenso wie die Erkenntnis – ein unwillkürlicher Prozess des Eindenkens. Die in ihm gesammelten Daten sind unbewusst und nur zufällig, ohne jegliche Methode noch mit Rechnung, sondern sie treten durch zufällige Ideenassoziationen an das Bewusstsein heran. Dann haben wir also die Erfahrung, welche Erfahrung – und zugleich Erkenntnis – der Vergangenheit ist, da man von der Geschichte (die universelle und individuelle Vergangenheit) keine wissenschaftliche Erkenntnis haben kann, sondern „nur“ eine philosophische Erfahrung. Das geschieht sowohl beim Individuum als auch bei der Gemeinschaft durch die Kulte und Feste: „Wo Erfahrung im strikten Sinn obwaltet, treten im Gedächtnis gewisse Inhalte der Individuellen Vergangenheit mit solchen der kollektiven in Konjunktion. Die Kulte mit ihrem Zeremonial, ihren Festen [...] führten die Verschmelzung zwischen diesen beiden Materien des Gedächtnisses immer von neuem durch“.18 Kurz gehen wir nun auf den Unterschied zwischen dem Erlebnis und der Erfahrung ein, anhand der in Über einige Motive bei Baudelaire dargestellten Theorie. Während mit der letzteren die unwillkürlich und unbewusste Erfahrung gemeint ist, ist die erste die automatische und unmittelbare Antwort auf den äußeren Reiz. Sich auf Jenseits des Lustprinzips Freuds19 aus dem Jahr 1921 beziehend, erklärt Benjamin dieses Verfahren: Die durch die äußeren Energien entstehende Bedrohung, ist eine Schocksbedrohung. Das Bewusstsein hat die Funktion, die Schocks aufzunehmen und zu registrieren, denen es alltäglich durch die äußere Umgebung ausgesetzt ist.20 Das Bewusstsein setzt einen Reizschutzmechanismus in Gang, das die äußeren Reize kontrolliert. Es registriert sie und verwandelt sie in Erlebnis. Diese Operation erlaubt, sich bewusst Reize anzueignen, indem sie in ein komplexes Gewohnheitssystem, in dem das moderne Bewusstsein verwurzelt ist, eingesetzt sind. Die Reizaufnahme wird dann zu einem Teufelkreis: Das Bewusstsein schützt sich vor dem Stoß, den der Schock provozieren könnte, und zugleich wird es nach und nach steif, indem es sich immer mehr daran gewöhnt, die Reize zu kontrollieren, bis zum folgerichtigen Verfall der Erfahrung. Diese Erfahrung ist eng mit der „Menge“ verbunden, und beide sind, laut Benjamin, die konstitutiven Eigenschaften der Moderne. Benjamin erklärt,21 dass die Menge bei der Dichtung Baudelaires eine „verborgene Figur,“22 niemals 18 GS I/2 611. Vgl. GS I/2 612. 20 Vgl. GS I/2 613. 21 Vgl. GS I/2 618. 22 Ibidem. 19 95 explizit anwesend, sondern immer nur evoziert, ist: Der Leser nimmt ihre Präsenz durch die Geräusche und die Laute der vom Autor benutzten Worte, die das Straßengewühl der Menge heraufbeschwören, wahr. Benjamin schließt sich den Worten Baudelaires an, um die urbane und zivilisierte Menge, d.h. die Masse der Passanten, welche die Städte im neunzehnten Jahrhundert füllt, zu beschreiben, indem er die Uniformität und die Vereinheitlichung betont. Die Leute aus der Menge „sahen aus wie Leute, die mit sich zufrieden sind und mit beiden Füßen im Leben stehen“23 und die Menge ist eine scheinbare weitere Bewegung, die aber in Wirklichkeit die Unbeweglichkeit und die Immobilität darstellt: Sie ist das „Immerwiedergleiche in großen Massen“.24 Nicht nur sehen die Passanten in der Menge alle gleich aus, wie seriell hergestellte Maschinenmenschen, sondern die selben menschlichen Beziehungen sind denaturiert und zur Ware geworden, weil es die einzige Art ist, welche die Moderne kennt, sich auf das, was sie umgibt, zu beziehen. Die Relation Subjekt-Objekt ist das Muster der interpersonellen Beziehung.25 Der Schock, in der Form z.B. des Ereignisses und der Begegnung, ist das, was, laut Benjamin, eine eigentliche und authentische Erfahrung zu erleben erlaubt. Das Bewusstsein lässt die Schutzbarriere wegfallen, um die Reize zu empfangen und aufzunehmen, welche die äußere Welt ihm anbietet. Der Stoß, der den Einsturz des Bewusstseinsschutzes provoziert, ist aber nicht schmerzlos. Er ist dennoch eine revolutionäre Erfahrung, weil er die falsche Sicherheit abschafft, welche die Moderne um sich herum aufgebaut hat. Wenn das Erlebnis, d.h. die Erfahrung der Moderne, das Resultat der Reaktion des Bewusstseins auf die äußeren Reize ist, dann besteht der Prozess der Wahrnehmung der Moderne, und somit der Schutz, der den Schock unschädlich macht, darin, das Erlebte in eine Ordnung, d.h. in ein Kontinuum, einzufügen, indem sie als seine Objekte klassifiziert werden. Die Erfahrung der Moderne ist also eine im Bewusstsein registrierte Masse von Daten. Die Erfahrung aber ist die der Schocks: wenn der Schock sich nicht in eine kontinuierliche Serie von Daten einsetzen lässt, reizt er das Bewusstsein dazu, das Erlebte in seiner Ganzheit und Vollheit, d.h. getrennt von dem anderen Erlebten, wahrzunehmen. Das, was die Wahrnehmung des Erlebten nach einer regulären Ordnung ermöglicht, ist die Konzeption der Zeit als Kontinuum. Während einerseits das Erlebte einem Punkt in der Zeit, als eine Serie von Augenblicken verstanden und wahrgenommen, zugeschrieben wird, vernichtet andererseits der Schock die Schemata des Bewusstseins und hebt die zeitliche Serie heraus. Demzufolge zeigt sich das Erlebte in dem Augenblick, wo es, von den anderen 23 GS I/2 625. GS V/1 429. 25 Dieses Thema ist auch mehrere Male von Th. W. Adorno in seinem Buch Minima Moralia übernommen worden. Vgl. TH. W ADORNO, Minima Moralia. Reflexionen aus dem Beschädigten Leben, Suhrkamp, Frankfurt 2001. 24 96 isoliert, erscheint. Doch wir bemerken eine Kontinuität zwischen den frühen Schriften – insbesondere der Programmschrift – und den Späteren. Analog mit dem, was Benjamin in der Programmschrift zu tun beabsichtigte – in der er einen neuen und höheren Begriff der „Erfahrung“ suchte – taucht erneut in den Schriften nach dem Trauerspielbuch das Bedürfnis auf, eine neue – die wahre – Erfahrung zu suchen, die in Gegensatz zu jenem denaturierten Erlebnis der zivilisierten Menge steht.26 Die Eigenschaften, die Benjamin dem Begriff „wahren Erfahrung“ in Über einige Motive bei Baudelaire zuschreibt, sind die selben, welche die „wahre Erkenntnis“ in dem Passagen-Werk bestimmen: Augenblicklichkeit, Eingedenken, und das Aufheben der als Kontinuum gemeinten Zeit. Es ist daher also evident, dass, wenn Benjamin von Erfahrung und von philosophischer Erkenntnis spricht, er im Grunde genommen von einem einzigen Begriff spricht. Die Erkenntnis der Geschichte (in beiden Sinnen) ist tatsächlich eine Erfahrung; und die Schlüsselbegriffe zum Begreifen der philosophischen Erkenntnis und der Erfahrung, sind der Begriff der Temporalität, d.h. das Eingedenken und das Jetzt, und der des Bildes, welche sie in ihre eigene Struktur implizieren. 3. Das dialektische Bild In dem vorherigen Kapitel haben wir die verschiedenen Bedeutungen von „Idee“ analysiert, und mit der Bedeutung von „Bild“ haben wir die Analyse beendet. In dem Passagen-Werk taucht die Idee der Bildvalenz noch offensichtlicher auf, der Benjamin in den Notizen und Materialen das bedeutungsvolle Attribut „dialektisch“ hinzufügt. Wie Ansgar Hillach richtigerweise bemerkt, drückt der Begriff „dialektischem Bild“ ein Paradox aus. Ein Bild ist nämlich eine Gestalt, und zwar das Resultat eines Prozesses, und weist deshalb auf eine Festigkeit hin. Dennoch drückt die Dialektik die ununterbrochene Bewegung von gegensätzlichen Elementen aus.27 26 GS I/2 608. Vgl. A. HILLACH, Dialektisches Bild, in Benjamins Begriffe, hg von M. Opitz und E. Wizisla, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2000, S.186ff. 27 97 3.1 Die Dialektik Wir sind dem Begriff der „Dialektik“ in dem vorherigen Kapitel begegnet und haben ihn benutzt, indem wir die Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels untersuchten. Es wurde gesagt, dass die Philosophie Benjamins sich zwischen dem Phänomen und der Idee dialektisch bewegt; trotzdem wurde jener Begriff damals nicht direkt erforscht. Inwiefern kann man von Dialektik in Bezug auf das Denken Benjamins sprechen? Dieses Thema ist extrem umstritten, vor allem wegen der sehr bekannten Polemik Adornos hinsichtlich des benjaminschen Exposés über das Passagen-Werk aus dem Jahr 1935, in dem der Begriff des „dialektischen Bildes“ einen psychologistischen (das dialektische Bild als „Traum des Bewusstseins“28) und metaphysischen Charakter zu gewinnen, und den eigentlich materialistischen29 zu verlieren scheint. Bezüglich der Auslegung der benjaminschen Dialektik wurde also in den letzten Jahren auf die Interpretation Adornos30 hingewiesen, der nach dem Tod Benjamins, den Briefwechsel mit dem Freund und Philosophen, den Text Charakteristik Walter Benjamins, in der Essaysammlung Über Walter Benjamin enthalten,31 und das Vorwort zu den benjaminschen Schriften aus dem Jahr 1955 publiziert hat. Alle diese Texte waren sehr wichtig für die Rezeption der Philosophie Benjamins. Für die Einzelheiten über die Polemik Adornos hinsichtlich des dialektischen Bildes verweise ich auf den Artikel von Hillach. Doch möchte ich noch betonen, dass laut Hillach bei Benjamin „Traum und Erwachen nicht Kategorien individueller oder kollektiver Psychologie, sondern Kategorien der Erfahrung“ sind, und dass Adorno dies nicht richtig verstanden hat.32 So möchte ich jetzt behaupten, dass auch der Begriff der „Dialektik“, und insbesondere des „dialektischen Bildes“, eine Kategorie der Erfahrung, und nicht eine auf Hegel33 oder auf die Psychologie Jungs34 zurückzuführende Kategorie ist. Auch laut Bernd Witte hat Adorno den Sinn der Philosophie Benjamins nicht grundlegend verstanden, deren Materialismus „nur ein begrifflich nicht vermittelter und daher naiv zu kurz greifender Versuch ist, konkrete 28 Vgl. GS V/2 1128 und Briefe 671ff. Vgl. ibidem. Bezüglich der Interpretation Adornos über das „dialektische Bild“ weise ich auf den Essay von Hillach hin. 30 Vgl. BERND WITTE, Walter Benjamin. Der Intellektuelle als Kritiker, Mezler, Stuttgart 1976, S.2ff; KLAUS GERBER, op.cit., S.124ff. 31 TH. W. ADORNO, Über Walter Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1970. 32 Vgl. HILLACH, op.cit. S. 210. 33 Von der Dialektik Hegels nimmt Benjamin Abstand in einem Fragment des Passagen-Werkes, vgl. V/2 1037f. 34 Auf Jung bezieht sich Adorno in Charakteristik Walter Benjamins, op.cit. S.21. Selbst wenn Adorno in diesem Text den Unterschied zwischen dem dialektischen Bild Benjamins und den Archetypen des Bewusstseins Jungs erkennt, kritisiert er in dem Brief aus Hornberg aus dem Jahr 1935 die „psychologistische“ Position Benjamins entschieden (vgl. GS V/2 1128ff). 29 98 psychische wie gesellschaftliche Phänomene mit Sinn zu belehnen“.35 Benjamin wäre also auf Hegel und seine Begriffe zurückführbar, was aber bloß ein schlechter und ungeschickter Versuch bleiben würde. Nach Adorno führt dessen Student Rolf Tiedemann die hegelsche Interpretation des Denkens Benjamins weiter, insbesondere in dem Text aus dem Jahr 1965: Studien zur Philosophie Walter Benjamins. In dem Text – so kommentiert Bernd Witte – interpretiert Tiedemann „Benjamins Denken auf die Positionen der traditionellen Philosophie, ohne dessen spezifische erkenntnistheoretische Methode erkennend nachzuvollziehen“.36 Die Lektüre Tiedemanns, nach der Benjamin z.B. „die hegelsche List“ übernehmen würde, um „der Subjekt-Objekt-Spaltung in der Erkenntnis zu entgehen [...]“. Denn „[...] dann wird damit Benjamins erkenntnistheoretischer Ansatz von einer Leitfrage her interpretiert, die seinem Werk fremd ist. Auf Grund dieser hermeneutischen Vorentscheidung kommt Tiedemann notwendigerweise zu dem Schluss, Benjamins Philosophie sei in ihren Ergebnissen mit der hegelschen identisch“.37 Laut Witte würde die Subsumierung des Denkens Benjamins der hegelschen Theorie die geschichtsphilosophische Dynamik „der es gerade nicht um eine wie auch immer geartete Doppelung des Vorhandenen, sondern um dessen Rettung geht“38 dieses Letzte erstarren lassen. Die Dialektik Benjamins ist nicht eine Dialektik der Synthesis oder der Identität: man könnte sagen, dass durch die Anwendung der Terminologie Cohens, zwischen der Idee und dem Phänomen bei Benjamin eine „Korrelation“ besteht, die eine weitergehende Spannung zwischen den gegensätzlichen Elementen der Dialektik (Idee-Phänomen) ausdrückt. Diese kommen niemals zur Ruhe und somit zur Synthesis. Der Kern der benjaminschen Dialektik, d.h. ihr Ursprung, ist die Metaphysik der erkenntniskritischen Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels, die weder die Vollendung der Geschichte noch das Ende der Dialektik theoretisiert, sondern dem Philosophen die unendliche Aufgabe eines intellektuellen und – wie wir sehen werden – ethischen Verfahren eines weitergehenden Strebens stellt, um das Phänomen zu der Idee zurückzuführen.39 Wenn die Dialektik eine weitergehende Bewegung der Gegensätze - die 35 BERND WITTE, op.cit. S.3. Ibidem. 37 BERND WITTE, op.cit. S.4. Rolf Tiedemann schreibt nämlich: „Benjamins Philosophie nicht anders als die Hegelsche stellt am Ende eine Nachkonstruktion der geschichtlich-gesellschaftlichen Gesamtverfassung dar“ (BERND WITTE , op.cit. S.4; ROLF TIEDEMANN, op.cit. S.21). 38 BERND WITTE , op.cit. S.4. 39 Es ist nicht beweisbar, dass die benjaminsche Dialektik direkt von dem Cohensche Begriff der „Korrelation“ beeinflusst wurde. Dennoch ist es evident, dass zwischen den beiden Begriffen eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Mit der Kategorie der „Korrelation“ thematisiert Cohen eine Dialektik, die gegensätzlich zu der Hegels, d.h. gegensätzlich zu der Identität der Synthesis ist. Der Begriff der „Korrelation“ übernimmt bei Cohen eine fundamentale Bedeutung in den Religionsschriften, wo er die Dialektik Mensch-Gott bezeichnet, die durch eine unüberwindbare Distanz bestimmt ist. Dagegen drückt in dem System der Philosophie, insbesondere in der Ethik, die Korrelation die Dialektik Wirklichkeits-Idee aus, die ein Verhältnis bezeichnet, das sich aber nicht in die Identität der beiden niederschlägt, sondern ein Verhältnis, in dem die Idee sich in der Realität wirkend ergibt, 36 99 sich nähren, bis sie sich berühren, aber immer getrennt bleibend – ist und wenn die Philosophie der Versuch ist, die Idee „darzustellen“, die nur durch die Phänomene, in denen sie sich zum Teil vergegenwärtigen, darstellbar sind, dann ist die Dialektik der Sinn der gesamten Philosophie Benjamins, und das mit zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung entsteht in dem Moment, in dem sie das Problem der Darstellung theoretisiert, und allgemeiner das Problem des Verhältnisses Idee-Phänomen: Aus der Idee heraus entsteht die Fundierungsbewegung des Phänomens, während aus dem Phänomen heraus die Bewegung entsteht, die dieses wiederum zur Idee zurückführt. Die zweite Bedeutung begründet sich durch die Tatsache, dass die Philosophie selber ein Phänomen ist, das sich der Ideenwelt zuwendet. Demzufolge ist die dialektische Bewegung ein wesentlicher Bestandteil von ihr. Das Denken Benjamins entfaltet sich dauernd zwischen dem Phänomen und der Idee, die den Horizont seiner Forschung bestimmen. Es gibt weder nur das Phänomen noch nur die Idee, sondern eine andauernde Bewegung, die von einem zum anderen geht: Die Philosophie Benjamins ist die Darstellung des Phänomens selbst, das in einer dauernden Spannung zur Idee und in einer dauernden Anstrengung zur Überwindung des Phänomenalen selber steht. Die beiden Extreme, das Phänomen und die Idee können durch keine Synthesis vereinigt werden, weil zwischen ihnen eine unendliche Ferne besteht. Welche sind nun die Charakteristika der benjaminschen Dialektik? Inwiefern ist die benjaminsche Dialektik eine Kategorie der Erfahrung? Die Reflexionen über die Dialektik erscheinen vor allem in den Notizen und in den Materialen nach 1929. Einer der ersten Hinweise auf die Dialektik befindet sich in den Notizen für das Passagen-Werk hinsichtlich des Prozesses des Erwachens, d.h. hinsichtlich des Übergangs Traum-Wachzustand, oder noch genauer des Übergangs Unbewusstsein – Bewusstsein. Nun weist die Dialektik des Erwachens auf die Dialektik des philosophischen Denkens hin, dessen Allegorie sie ist: das philosophische Denken hält bei den Fakten an, und nimmt sie als solche unmittelbar und zufällig wahr. D.h. es begreift in ihnen die Wahrheit – gleichsam wie wenn wir es mit dem Übergang vom Unbewussten zum Bewussten zu tun haben, wie es im Augenblick des Wachwerdens passiert, oder im Augenblick der Erinnerung wie von Proust beschrieben - in dem die unbewussten Erinnerungen unmittelbar, plötzlich und zufällig in das willkürliche Gedächtnis eintauchen. Dieser erste dialektische Moment ist bei Benjamin die „Methode“ der Philosophie, welche die Geschichte als „Objekt“ hat, wo mit „Geschichte“ nicht nur die universelle, sondern auch die des einzelnen Menschen gemeint die sich ihrerseits an der Idee orientiert – oder besser orientieren soll. Vgl. ANDREA POMA, La filosofia critica di Hermann Cohen, Mursia, Milano 1988, S.77ff.; HERMANN COHEN, Ethik des reinen Willens, insbesondere, über den Unterschied zu Hegel, das Kapitel VII. 100 wird. Das dialektische Verfahren besteht in dem Übergang, in dem das, was versteckt ist, in dem Augenblick zu Tage gebracht wird: es handelt sich nicht um einen psychologistischen Prozess, sondern vielmehr um einen Prozess des Eingedenkens, welcher die Erfahrung der Geschichte ausmacht. In dem Begriff des „Eingedenkens“ steckt noch ein wichtiges dialektisches Element: die Zeit. Hinsichtlich des Trauerspielbuchs haben wir kurz gesehen, dass die Idee der Temporalität bei Benjamin nicht die traditionelle ist. Dieses Konzept wird in den späteren Schriften betont und unterstrichen. Bisher haben wir nur die „Gegenwart“ dieser Temporalität angetroffen: das Jetzt. Mit ihm ist das Element der Vergangenheit dialektisch verbunden. Genauso wie es bei dem Terminus „Erinnerung“ geschieht, den Benjamin lieber durch den selteneren Begriff „Eingedenken“ ersetzt, wird der Terminus „Vergangenheit“ von dem selteneren Begriff des „Gewesenen“ ersetzt. So schreibt Benjamin: „Denn während die Beziehung der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche ist, ist die des Gewesnen zum Jetzt eine dialektische“.40 Das Gewesene unterscheidet sich also von der Vergangenheit, weshalb es sich in einer dialektischen Beziehung zum Jetzt befindet, während die Vergangenheit als ein Element der Zeit, als Kontinuum verstanden, wird. Die Charakteristik des Gewesenen ist, dass es bereit ist, in dem Jetzt reaktualisiert zu werden; das Gewesene ist nämlich eine lebendige Vergangenheit, die in sich zu aktualisierende Potentialität enthält, während die Vergangenheit ein für alle Mal gegeben und vergangen ist. Versuchen wir nun das zu begreifen, was Benjamin mit einer solchen Unterscheidung meint und welche Bedeutung sie impliziert. Um die Begriffe des „Gewesenen“ und des „Eingedenkens“ zu verstehen, ist es zunächst wichtig die grundsätzliche Rolle aufzuzeigen, die der jüdische Begriff der „Geschichte“ auf die benjaminschen Begriffe der „Zeit“ und vor allem des „Eingedenkens“ hat. Durch das Eingedenken – dies haben wir gesehen – erwirbt das Gewesene eine Aktualität, und zwar in dem Augenblick, in dem es aus dem Kontinuum der traditionellen Geschichte entfesselt wird. In Über einige Motive bei Baudelaire ist nicht das Jetzt, was das Kontinuum der traditionellen Zeit aufhebt, – wie z. B. in den Thesen über die Geschichte oder in dem Passagen-Werk – 40 GS V/1 578. 101 sondern es sind die „Tage des Eingedenkens“,41 die auch als „bedeutende“ zu bezeichnen sind.42 Über diese schreibt Benjamin: „Sie sind von keinem Erlebnis gezeichnet. Sie stehen nicht im Verbande der übrigen, heben sich vielmehr aus der Zeit heraus. Was ihren Inhalt ausmacht, hat Baudelaire im Begriff der correspondances festgehalten [...]. Wesentlich ist, dass die correspondances einen Begriff der Erfahrung festhalten, der kultische Elemente in sich schließt [...]. Was Baudelaire mit den correspondances im Sinne hatte, kann als Erfahrung bezeichnet werden, die sich krisensicher zu etablieren sucht. Möglich ist sie nur im Bereich des Kultischen [...]. Die correspondances sind die Data des Eingedenkens. Sie sind keine historischen, sondern Data der Vorgeschichte. Was die festlichen Tage groß und bedeutsam macht, ist die Begegnung mit einem früheren Leben“.43 Der Inhalt von „Tage des Eingedenkens“ ist also die Vergangenheit, aber nicht diejenige, die mittlerweile vergangen und deshalb tot ist, sondern eine Vergangenheit die – durch den Kult und das Eingedenken – reaktualisiert werden kann und soll, und die aus diesem Grund als „früheres Leben“ bezeichnet wird. Das Eingedenken weist nicht nur auf die individuelle Form des Erinnerns, sondern ist es auch mit den Festtagen und mit der Zelebration einer kollektiven Vergangenheit verbunden.44 Der Begriff des „Tag des Eingedenkens“ weist auf den jüdischen „Jom ha-Zikkaron“ hin, der eben „Tag des Eingedenkens“ bedeutet. Im Judentum werden gewisse Feste als „Tag des Eingedenkens“ bezeichnet, unter ihnen Jom Kippur und Pessach.45 Mit dem Pessach-Fest46 wird der den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten gefeiert. Die Observanz des Pessach-Festes ist ein Gebot.47 Joseph Soloveitchik schreibt: 41 GS I/2 637. Vgl. Ibidem. 43 GS I/2, 637f. 44 Aus diesem Grund stellt Benjamin die von Uhren gezählte Zeit der Kalendarischen Zeit entgegen (vgl. GS I/2 701). Die Zeit der Kalender setzt uns in Beziehung mit der Vergangenheit, indem sie uns an ihre Kulte und an ihre Symbole erinnert, und ermöglicht uns durch die Wiederholung der Kulte mit der Vergangenheit in eine direkte Beziehung einzutreten. 45 Ich gehe auf die Bedeutung des Eingedenkens ein, indem ich nur das Pessach-Fest betrachte, da es an dieser Stelle nicht möglich ist, all die andere jüdischen Rituale, in denen das Erinnern eine grundsätzliche Rolle spielt, zu berücksichtigen; so beispielweise den Kaddisch, das man in Erinnerung an die Toten spricht, oder an das Jizkor, d.h. ein Gebet das mit dem Wort „jizkor“ („er wird erinnern“) beginnt, und das insbesondere am Versöhnungstag (Jom Kippur) ausgesprochen wird. 46 Das Wort Pessach heißt „überschreiten“ und erinnert an den Todesengel, der an die Häuser der in Ägypten weilenden Israeliten „überschritt“. 47 Dieses Gebot ist in der Bibel erinnert: „Ihr sollt euren Söhnen sagen an denselben Tagen: Das halten wir um dessentwillen, was unser Herr getan hat, als wir aus Ägypten zogen“ (Ex, 13,8). Das Erinnern hat in dem Alten Testament eine theologische Bedeutung. D.h.: Gott erinnert, also muss der Mensch erinnern. So bemerkt Soloveitchik, dass die Pflicht das im Gedächtnis immer lebendig zu halten, was in dem Exodus aus Ägypten geschah, von der Halacha deutlich geboten wird (vgl. JOSEPH B. SOLOVEITCHIK, Reflections of the Rav, 1993, S.207ff). 42 102 „The Seder observance is basically a reliving of the Exodus experience, and during the rest of the year we are required to recall the event daily“.48 Am Seder-Abend wird an den Auszug aus Ägypten nicht nur erinnert und dieser erzählt, sondern vielmehr wiedererlebt. So führt Soloveitchik aus: „Because the event being commemorated is over 3500 years old, one can easily come to regard oneself as so remote from the entire episode as to be completely detached from it. This poses a problem, is not truly fulfilled unless we personally identify with the Exodus […]. Not only does the Exodus account for our present Jewish identity […]. We not only know history but relive it”.49 Die Bedeutung des Eingedenkens in der jüdischen Tradition ist also das Zurückkehren in die Vergangenheit, die wiedererlebt, und demzufolge vor dem Vergessen gerettet und als Muster für zukünftige Aktionen verwendet wird. Ebenso ist die Bedeutung des benjaminschen Gewesenen die Möglichkeit, die Vergangenheit (des einzelnen Menschen und der Kollektivität) durch das Eingedenken wiedererleben und aktualisieren zu lassen. Das Thema der Aktualisierung der Vergangenheit ist auch das, worum es in dem kurzen Text geht, das in dem vorherigen Kapitel50 behandelt wurde: Agesilaus Santander, handelt davon, dass der Engel die Allegorie des menschlichen Schicksals darstellt, für welches das „Gewesene“, das für das Verschwinden bestimmt ist, in dem Eingedenken seine Rettung findet. Der Engel ist die Allegorie des Begriffes des „Glückes“, das dialektisch aus zwei Gegensätzen besteht: Das Jetzt und die Wiederholbarkeit des Jetzt. Die gleiche Dialektik ist eben diejenige, die im Begriff des Gewesenen eingeschlossen ist: Einerseits das Gewesene – als bereits Erlebte – und andererseits die Möglichkeit, das Gewesene wiederzuerlangen, was nur in dem Jetzt des Erinnerns möglich ist. Das Gewesene verbindet sich zum Jetzt in einer dialektischen Bewegung, die das ordinäre Tempo aufhebt. Wohl ist es interessant zu bemerken, dass der Begriff des „Glückes“ erneut der Vergangenheit zugewandt ist. So schreibt Benjamin: „Das Bild von Glück, das wir hegen, durch und durch von der Zeit tingiert ist, in welche der Verlauf unseres eigenen Daseins uns nun einmal verwiesen hat. Glück, das Neid in uns erwecken könnte, gibt es nur in der Luft, die wir geatmet haben, mit den Menschen, zu denen wir hätten reden, 48 JOSEPH B. SOLOVEITCHIK, op. cit. S.188. JOSEPH B. SOLOVEITCHIK, op. cit. S.211. 50 Siehe oben, Kap. III. 49 103 mit Frauen, die sich uns hätten geben können. Es schwingt, mit anderen Worten, in der Vorstellung des Glücks unveräußerlich die der Erlösung mit. Mit der Vorstellung von Vergangenheit, welche die Geschichte zu ihrer Sache macht, verhält es sich ebenso. Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf die Erlösung verwiesen wird“.51 Die Wiedererlangung der Vergangenheit, d.h. ihre Rettung durch das Erinnern, enthält in sich einen „heimlichen Index“, der, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, die eigentliche Erlösung ankündigt und antizipiert. Die Bedeutung der neuen Konzeption der Geschichte, die Benjamin als Alternative zu der Geschichte sieht, wie sie die Tradition uns vorlegt, – stellt also die Möglichkeit dar, dass das „Faktum“ durch das Eingedenken - ebenso wie beim Judentum - reaktualisiert und demzufolge gerettet wird, indem es aufhört, in Bücher geschriebene tote Ware zu sein: nur so hat man eine Erfahrung der Geschichte. Die Dialektik des Prozesses des Eingedenkens – von den zwei Polen des Jetzt und des Gewesenen ausgedrückt - ist also eine Kategorie der Erfahrung, insofern als sie die Methode der geschichtlichen (in beiden Sinnen: universelle und individuelle) Erkenntnis ist. Die Möglichkeit, die Geschichte als lebendige Materie, zu betrachten, d.h. als unerschöpfliche Quelle der Möglichkeiten, die darauf warten, wieder aktuell gemacht zu werden, hat nämlich nicht nur Wert für das Kollektiv, sondern erwirbt auch eine besondere existentielle Bedeutung, wenn man an die Geschichte des Individuums denkt. Ein Beispiel dafür ist die Briefsammlung Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen, insbesondere der Kommentar Benjamins zu dem Brief von Goethe an Moritz Seebeck.52 Bezüglich eines Satzes dieses Briefes: „das vorüberrauschende Leben“, schreibt Benjamin: „Bewegt und gedrängt heißt dies Leben an anderer Stelle [des Briefes]: Beiworte, die es überdeutlich machen, dass der Schreiber selbst [Goethe] sich, betrachtend, an dessen Ufer zurückzog, im Geiste, wenn auch nicht im Bilde, jenes anderen Greisenwortes, mit dem Walt Withman verschieden ist: ‚Nun will ich mich vor die Tür setzen und das Leben betrachten’“.53 Die Vergangenheit eingedenkend, als ob man in der Todesstunde wäre, heißt, die Bilder des Lebens gleiten zu lassen, sie aus dem zeitlichen Kontinuum zu entbinden, und die reguläre 51 GS I/2 693. Moritz Seebeck war der Sohn von Thomas Seebeck, dem Entdecker der entoptischen Farben. Die entoptischen Farben sind durch ein gewisses Maß an Lichtanregung in durchsichtigen Körpern zum Vorschein kommende Farbbilder. In ihnen erblickte Goethe einen experimentellen Hauptbeweis seiner Farbenlehre der Newtonschen gegenüber; er nahm also starke Anteil an ihrer Entdeckung und stand von 1802 bis 1810 zu ihrem in Jena ansässigen Urheber in näherer Beziehung. Der Brief, von dem Benjamin berichtet, ist aus dem Jahr 1832 und ist die Antwort Goethes an einem Brief von Moritz Seebeck, in dem dieser Goethe den Tode des Vaters ankündigte. 53 GS IV/1 211. 52 104 Zeitfolge zu überwinden: das Gewesene ist auch die Vergangenheit des einzelnen Individuums, in dem sie durch das Eingedenken vor der Vergessenheit gerettet und aktualisiert wird (d.h. erneut erlebt wird). Der Sinn des Gewesenen ermöglicht, das eigene Leben nicht als einen bibliographischen Zusammenhang von Daten, die in einer genauen Ordnung aufeinander folgen, und die ein für alle Mal vergangen sind, zu erleben, sondern als eine lebendige Einheit, die noch imstande ist aktualisiert zu werden: Das ist die einzige „Methode“, die man an der lebendigen Materie der menschlichen Geschichte anwenden kann. In der Schrift Berliner Kindheit um Neuzehnhundert erinnert Benjamin - mit der selben „Methode“, mit der er in dem Passagen-Werk die Geschichte von Paris erzählt – einige Momente seines eigenen Lebens, indem er es rückwärts betrachtet. Bei der Geschichte ebenso wie bei der individuellen Vergangenheit antizipiert das Eingedenken die endliche Erlösung: durch das Bild von Agesilaus Santander und durch das Bild von der zweiten These über die Geschichte – für die ich auf das nächste Kapitel verweise – wird verständlich, wie bei Benjamin die Grenze der Humanität in der Vergänglichkeit der Vergangenheit besteht. An die Vergangenheit zu erinnern und diese wiederzuaktualisieren, - d.h. sie vor der Vergessenheit zu retten, der sie verdammt ist - ist eine Form der Antizipation der Erlösung: das ist die Aufgabe des Philosophen, der sich mit der Erzählung der Geschichte beschäftigt, und jedes Menschen, der durch die Erzählung und das Eingedenken seiner eigenen unvermeidlichen Vergänglichkeit einen Sinn verleiht. 3.2 Das dialektische Bild und die Lesbarkeit der Vergangenheit Das dialektische Verhältnis zwischen dem Gewesenen und dem Jetzt und die Konzeption der Zeit Benjamins bringen uns zu dem Begriff des „Bildes“. Benjamin schreibt in dem folgenden Fragment aus dem Passagen-Werke: „Nicht so ist es, dass die Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf das Vergangene wirft, sondern Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt. Mit andern Worten: Bild ist die Dialektik im Stillstand. Denn während die Beziehung der Gegenwart zur Vergangenheit 105 eine rein zeitliche, kontinuierliche ist, ist die des Gewesnen zum Jetzt dialektisch: ist nicht Verlauf sondern Bild [,] sprunghaft“.54 In dem Jetzt, dem Zeitdifferential,55 zeigt sich einen Augenblick lang das Bild der Vergangenheit als Gewesenes. Es hebt sich deutlich von dem Text ab, so dass das Verhältnis zwischen dem Jetzt und dem Gewesenen, d.h. der Prozess nach welchem das, was es gewesen ist, tatsächlich ein solches wird, in dem dialektischen Moment des Jetzt entsteht, in dem der Philosoph, indem er sich an das Faktum anhält, die Vergangenheit in ihrer wirklichen Form wahrnimmt, die nichts mit ihrer traditionellen Überlieferung zu tun hat. Von daher ist das Jetzt die geschichtliche Zeit und die conditio sine qua non für die Wiedererlangung der Vergangenheit. So schreibt Benjamin weiter: “Zum Denken gehört ebenso die Bewegung wie das Stillstellen der Gedanken. Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation zum Stillstand kommt, da erscheint das dialektische Bild. Es ist die Zäsur in der Denkbewegung“.56 Das „methodische“ Verfahren des Philosophen besteht also darin, die Fakten bis zu dem Punkt zu betrachten, in dem das Denken sich in einer „von Spannungen gesättigten Konstellation“ aufhält: In diesem Moment „erscheint das Bild“. Wie bereits in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels, so kann auch in diesem Fall nicht von einer eigentlichen philosophischen Methode die Rede sein: Das Denken, nach der Beschreibung Benjamins, hält bei einem Fakt an und in dem Jetzt – das in den Schriften nach 1929 als „Jetzt der Erkennbarkeit“ gekennzeichnet ist – wird die wahre Erkenntnis wahrgenommen. Diese Wahrnehmung ist aber zufällig. In dem Jetzt wird nämlich dem Philosophen die Gelegenheit dazu geboten das Bild wahrzunehmen, das – wie auch in den Thesen über die Geschichte betont ist – aufblitzt und flieht. Das Bild muss also der Möglichkeit des Verschwindens, die es in seiner eigenen Struktur ausmacht, entrissen werden. Die Wahrheit erscheint also nur einen Augenblick lang und nur in Form des Bildes. Gerade das Bild ist eine der Bedeutungen der Idee, die wir bereits in der Analyse von Ursprung des deutschen Trauerspielbuchs gefunden haben. In dem Passagen-Werk spricht Benjamin nicht mehr von „Idee“, sondern er verwendet den Begriff des „Bildes“, der bereits in der Vorrede des Textes aus dem Jahr 1929 auftaucht, hier allerdings nur als „Bild“. In dem Material zu den Pariser Passagen erwirbt er das Attribut „dialektisch“. Wie Hillach 54 GS V/1 576f. Vgl. GS V/2 1037. 56 GS V/1 595. 55 106 anmerket,57 gibt Benjamin vom dialektischen Bild niemals eine systematische Erklärung; er führt nur dessen Begriff ein. Wie kann nun ein Bild dialektisch sein? Wie kann eine Idee – die bei Benjamin ein Synonym für Wahrheit ist – Bild sein? Zusammen mit dem Begriff des „dialektischen Bildes“ prägt Benjamin den der „Dialektik im Stillstand“, mit dem er ein Stillstehen der Dialektik des Denkens meint. Nach der Interpretation Hillachs bezeichnet die „Dialektik im Stillstand“ das Stillstehen, welches das Denken in der Moderne – Epoche des Forschritts und der Verdinglichung der menschlichen und kulturellen Beziehungen, in der das Denken also nicht mehr imstande ist, dialektisch zu sein - zu erleiden gezwungen ist. Die benjaminschen Stellen, die diesen Begriff behandeln, sind aber umstritten, so dass Hillach selbst die Zweideutigkeit Benjamins in der Verwendung von „Dialektik im Stillstand“58 bekannt gibt. Wenn wir aber der Logik Benjamins folgen, drückt die „Dialektik im Stillstand“, meiner Meinung nach, nicht die Verkümmerung des Denkens und der Kultur der Moderne aus, sondern zeigt, ganz im Gegenteil, die andauernde Fähigkeit des philosophischen Denkens, sich an die Fakten zu halten und jenes Jetzt wahrzunehmen, in dem – so können wir jetzt sagen – die Idee sich von selbst offenbart. Die „Dialektik im Stillstand“ ist derselbe Begriff wie der des „dialektischen Bildes“: Unter diesem versteht man die Kristallisierung des Denkens in dem Augenblick, in dem es anhält und eine Epoche oder ein Fakt betrachtet, und deshalb ist es das Resultat des dialektischen Prozess des Denkens. Dennoch wird der selbe Prozess mit dem Begriff „Dialektik im Stillstand“ bezeichnet. Kehren wir nun zu den gestellten Fragen und zu den scheinbaren Inkongruenzen des Begriffes des „dialektischen Bildes“ und demzufolge zu dem der „Dialektik im Stillstand“ zurück. Das Bild hebt sich aus dem Strom der Geschichte heraus, und „nur durch einen Akt des Sehens heraus, der unterbrechenden Charakter hat, einen Zustand allererst herstellt und als besondere Gestalt fixiert“.59 Was aber bedeutet, dass das Bild dialektisch ist? In den Notizen für das Passagen-Werk ebenso wie in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels ist die Konstellation der Fakten, bei den das Denken anhält und die folgende mögliche Kristallisierung, die daraus entsteht, eine organische Struktur, in der – genauso wie in der Monade der Vorrede – die Vor- und Nachgeschichte erhalten ist. So schreibt Benjamin: 57 A. HILLACH, Dialektisches Bild, in Benjamins Begriffe, hg von M. Opitz und E. Wizisla, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2000, S.189. 58 A. HILLACH, op. cit. S.186ff. 59 A. HILLACH, op. cit. S. 218 107 „Die Vor- und Nachgeschichte eines historischen Tatbestandes erscheinen kraft seiner dialektischen Darstellung an ihm selbst. Mehr: jeder dialektisch dargestellte historische Sachverhalt polarisiert sich und wird zu einem Kraftfeld, in dem die Auseinandersetzung zwischen seiner Vorgeschichte und Nachgeschichte sich abspielt. Er wird es, indem die Aktualität in ihn hineinwirkt. Und so polarisiert der historische Tatbestand sich nach Vorund Nachgeschichte immer von neuem, nie auf die gleiche Weise. Und er tut es außerhalb seiner, in der Aktualität selbst; wie eine Strecke, die nach dem apoll[i]nischen Schnitt geteilt wird, ihre Teilung außerhalb ihrer selbst erfährt.60 Laut dem, was Benjamin in dem Fragment schreibt, kann jeder Fakt dialektisch dargestellt werden, und anhand dieser Möglichkeit wird es ein „Kraftfeld“, in dem sich die Vor- und Nachgeschichte miteinander auseinandersetzen. Ein vom Denken „polarisierter“ Fakt ist also ein Phänomen, das zur Idee, im Sinne von Totalität und Organizität, zurückgeführt wird. Was heißt Totalität in diesem Fall? Zuerst heißt „Totalität“ die Möglichkeit, eine Darstellung des Faktes zu geben, die nicht an die traditionelle Lektüre gebunden ist, die begrenzt bleibt. (Benjamin spricht in den Thesen über den Begriff der Geschichte von der Geschichte der Sieger, mit der er die traditionelle Überlieferung der Geschichte identifiziert, die sich immer in den Sieger hineinversetzt und damit die Geschichte der „namenlosen“ Niedergeschlagenen vergisst).61 Die Idee ist also eine weit entfernte Totalität, ebenso wie der Kantische Gesichtspunkt – d.h. die asymptotische Bedeutung der Idee (das „Als-ob“ und das „focus imaginarius“ Kants). Die „Totalität“, zu der das Phänomen zurückgeführt werden soll, ist die der Flexibilität und der Möglichkeit der Ausbreitung der Betrachtung, die ermöglicht, den begrenzten Gesichtspunkt der historistischen Tradition zu überwinden. Die „Totalität“, auf die das Phänomen zurückzuführen ist, bedeutet die unendliche Möglichkeit seiner Interpretation. In der oben zitierten Notiz für die Pariser Passagen, spricht Benjamin von einer immer wieder neuer Polarisierung der Fakten, die niemals in der gleichen Art geschieht. Das philosophische Denken hält bei einem Fakt an, es betrachtet ihn und nimmt unmittelbar die Wahrheit wahr: die ihm eigenste Art und Weise, den Fakt auszulegen. In diesem Sinn erleidet die Dialektik des Denkens einen Stillstand. Das Bild ist dialektisch, weil es in ständiger Bewegung zwischen der Gestaltung eines Bildes, d.h. seiner ersten Interpretation, und den nachfolgenden Kristallisierungen, d.h. den nachkommenden Lektüren ist: das Bild kann immer erneut gelesen werden und niemals auf die selbe Art. Es stellt sich als plötzliches Bild vor, das in sich eine Möglichkeit der Interpretation enthält. Die Lesbarkeit 60 61 GS V/1 587f. Vgl. GS I/2 696. 108 des Bildes (bzw. der Wahrheit) ist also der Schlüsselbegriff, um den Begriff des „dialektischen Bildes“ Benjamins zu verstehen. So schreibt Benjamin: „Der historische Index der Bilder sagt nämlich nicht nur, dass sie einer bestimmten Zeit angehören, er sagt vor allem, dass sie erst in einer bestimmten Zeit zur Lesbarkeit kommen. Und zwar ist dieses ‚zur Lesbarkeit’ gelangen ein bestimmter kritischer Punkt der Bewegung in ihrem Innern. Jede Gegenwart ist durch diejenigen Bilder bestimmt, die mit ihr synchronisch sind: jedes Jetzt ist das Jetzt einer bestimmten Erkennbarkeit. In ihm ist die Wahrheit mit Zeit bis zum Zerspringen geladen. (Dieses Zerspringen, nichts anderes, ist der Tod der Intentio, der also mit der Geburt der echten historischen Zeit, der Zeit der Wahrheit, zusammenfällt.) [...] Das gelesene Bild, will sagen das Bild im Jetzt der Erkennbarkeit trägt im höchsten Grade den Stempel des kritischen, gefährlichen Moments, welcher allem Lesen zugrunde liegt.62 Die Bilder der Vergangenheit, so schreibt Benjamin, unterscheiden sich von den Wesen Husserls aufgrund ihres historischen Indexes, der sie an die Zeit bindet, zu der sie gehören, und vor allem an die Zeit bindet, in der sie zur Lesbarkeit kommen können. Die dialektische Bewegung des Bildes besteht also in der Möglichkeit, in verschiedener Art und Weise gelesen zu werden, aber nur – so schreibt Benjamin – in einer bestimmten Zeit. Was soll dies bedeuten? Scheinbar sehen wir uns vor einer Inkongruenz: einerseits scheint es, dass Benjamin verschiedene Lektüren des Bildes vorschlägt, andererseits aber spricht er von einer wahren Lektüre des Bildes, und zwar von genau derjenigen, in der das Bild selbst in einer bestimmten Zeit zu Lesbarkeit kommt. Dies führt zu der Aussage der Vorrede zurück, in der die Idee als „objektive Interpretation“ der Phänomene bezeichnet wurde.63 Das Bild der Vergangenheit erscheint als solches nur in einer bestimmten Gegenwart, oder um besser zu sagen, in einem bestimmten Augenblick, in welchem es dem Philosophen – indem er den kritischen Moment, in dem das Bild verschwinden kann – gelingt es zu lesen, und von ihm eine Interpretation zu geben. Diese scheinbare Inkongruenz kann eine Erklärung finden, indem wir, wenn wir über das „Bild“ sprechen, an die „Idee“ denken. Wie in der Vorrede zum Trauerspielbuch schreibt Benjamin, dass die Idee sich von selbst manifestiert. Ebenso offenbart sich in dem PassagenWerk das Bild von selbst in der Jetztzeit, unabhängig von dem Willen und von der Absicht des Philosophen. Es offenbart sich als die Wahrnehmung desjenigen, der beabsichtigt es zu lesen. Das heißt: es ist das Bild, welches sich manifestiert, und es ist die Wahrheit im Jetzt, in 62 63 GS V/1 577f. Siehe oben, Kap. III. 109 dem es erscheint – und welches auch das Jetzt der philosophischen Erkennbarkeit ist. Anders gesagt, es sind jene Unabsichtlichkeit und Unmittelbarkeit, die den Übergang von Schlafen zum Wachzustand bestimmen, ebenso wie die Intuition, die Goethe dazu brachte, nach langdauernden Beobachtungen das Urphänomen in dem betrachteten Phänomen zu sehen. So ist es der Philosoph derjenige, der die Fakten betrachtet. Dennoch ist die Idee, die sich dem „Blick“ seines Denkens offenbart: jenes Bild stellt in jenem Moment die einzige wahre Möglichkeit der Lektüre des betrachteten Phänomens dar. Wenn Benjamin in dem Fragment schreibt, dass das Denken sich immer wieder von neuem und niemals auf die selbe Art kristallisiert, dann beabsichtigt er zu sagen, dass die Offenbarung der Idee, d.h. des Bildes, zu immer weiteren Interpretationen fähig ist. Dies widerspricht aber nicht dem Prinzip des Jetzt der Erkennbarkeit und also der einzigen wahren Lektüre, die von einem Fakt gegeben sein kann, weil es das Bild ist, das sich in einem bestimmten Augenblick vergegenwärtigt und sich lesen lässt. Mit anderen Worten, wenn es wahr ist, dass der Philosoph, genau wie im Trauerspielsbuch geschrieben ist, das unabsichtliche Subjekt der Idee ist, die sich ihm „vor Augen“ anbietet, gilt aber auch, dass eine Interpretation und eine Lektüre eines Fakts, welche in genau jenem Augenblick wahr sind, weiter ausgelegt und in späteren Zeiten vertieft werden können, in denen die Idee – als Bild – sich weitermanifestieren, und andere Interpretationen ermöglichen wird. Das ist genau das Prinzip, das Benjamin in der Schrift Die Aufgabe des Übersetzers thematisiert. Nach der benjaminschen Theorie der Übersetzung, die eine Verwandtschaft unter den Sprachen voraussetzt,64 besteht die Aufgabe des Übersetzers „darin, diejenige Intention auf die Sprache, die in die übersetzt wird, zu finden, von der aus in ihr das Echo des Originals erweckt wird“.65 Und weiter schreibt er: „Die Übersetzung [muss] liebend vielmehr und bis ins Einzelne hinein dessen Art des Meinens in der eigenen Sprache sich anbilden, um so beide wie Scherben als Bruchstück eines Gefäßes, als Bruchstück einer größeren Sprache erkennbar zu machen“.66 Laut Benjamin soll die Übersetzung, die wohl mehr als eine bloße Bedeutungsüberlieferung in eine andere Sprache ist, in ihrer eigenen Sprache die Sprache des Originals anklingen lassen, aber trotzdem und offensichtlich bleibt sie mit der Epoche und mit der Zeit, in der sie entsteht, verbunden: Sie ist vorläufig und wird von anderen und neuen Übersetzungen überwunden, die sie ergänzen werden, indem sie versuchen, in sich die „größere Sprache“ 64 Vgl. GS IV/1 12. GS IV/1 16. 66 GS IV/1 18. 65 110 (d.h. die Idee) wiederzuerschaffen. Kehren wir nun zu dem Bild zurück. Es ist, als ob der Philosoph, indem er das Bild auslegt, das Bild, d.h. die Idee, in seine eigene Sprache übersetzen würde. Das Bild eines Fakts, das der Philosoph gibt, bleibt aber mit der Zeit, in der es entsteht, verbunden, oder besser gesagt, mit den Worten Benjamins, der Zeit, in der das Bild sich dem Philosophen zur Lesbarkeit gibt. Man kann also von „Dialektik des Bildes“ in zwei Hinsichten sprechen: einerseits ist die Dialektik äußerlich und andererseits im Bild selbst verinnerlicht. Die erste ist die Dialektik der Gestaltung des Bildes: das Bild ist der Prozess der Kristallisierung des Denkens über einen Fakt, also eine Bewegung, die eine bestimmte Form erwirbt, indem sie sie anhält. Die zweite Dialektik, die man als innerlich bezeichnen kann, ist die Möglichkeit des Lesens – d.h. die Lesbarkeit – des Bildes selbst. Diese zweite Bewegung geschieht innerhalb des Bildes selbst, und setzt wieder in Bewegung, etwas das strukturell fixiert ist, oder anders ausgedrückt, etwas das sich fixiert hat. Dass also die Wahrheit – d.h. die Idee – Bild ist, bedeutet dass, sie gelesen wird und ausgelegt werden kann, wenn man sie in dem Jetzt, in dem sie sich vergegenwärtigt, wahrnimmt. Wie ein Gesichtspunkt, d.h. eine gewonnene Perspektive, die nachher modifiziert, erweitert, werden kann.67 4. Die „Wahrnehmung“ der Idee In den Werken nach dem Trauerspielbuch ist im Denken Walter Benjamins jener doppelwertige Begriff der „Wahrheit“ zu finden, den wir bereits aus der Analyse der frühen Schriften hervorgehoben haben. Als wir oben den Begriff der „Dialektik“ betrachtet haben, haben wir gesehen, dass die Idee sich in dem Jetzt manifestiert, das bedeutungsvoll als „Jetzt der Erkennbarkeit“ bezeichnet wird: Die Wahrheit ist das Bild der Vergangenheit, das unvermeidbar mit dem augenblicklichen und einzigen Moment, in dem es zu Offenbarung kommt, verbunden ist. Zugleich ist die Idee, d.h. die Wahrheit, der unendliche Prozess der Auslegung des Bildes: eine Lektüre des Bildes ist niemals abgeschlossen, sondern enthält in seiner Struktur – so wie die Übersetzung – die Möglichkeit, nach dem Prinzip der Einheit der Idee, weiter verarbeitet und interpretiert werden zu können. Daraus lässt sich schließen, dass der Begriff der „Wahrheit“ – d.h. die Idee – Benjamins von den frühen Schriften bis zu den 67 Hier theoretisiert und antizipiert Benjamin ein typisches Thema der modernen (und postmodernen) Zeit: Die Kommunikation der Medien geschieht in der Art der Erzählung. Es ist bekannt dass, mit der Geburt er Photographie und der Werbung das Bild ist, mehr als das Wort, der Mittel der Informationen über einen Sachverhalt mitteilt: es sind also die Bilder, die Interpretationen der Welt geben. Das Bild ist schon an sich eine Form von Erzählung: die Wahrheit, die als Bild ausgelegt wird, ist die Möglichkeit einer Erzählung, unmittelbarer als das Wort oder, mit den Worten Benjamins - als der Name. 111 späteren ein doppelter bleibt: einerseits wird die Wahrheit unmittelbar wahrgenommen, andererseits ist die Wahrheit eine ewige Forschung. Scholem hat nicht zu Unrecht Benjamins Denken als Synthese von jüdischer Mystik und jüdischer aufklärerischer Philosophie, für die ihm etwa Hermann Cohen einsteht, konstruiert.68 Es hätten sich also in ihm eine letzte Mystik und Aufklärung zusammengefunden. Eine solche Aussage spiegelt die Interpretation der doppelten Struktur der Wahrheit wider, obwohl, wie oben gesagt, der Begriff der „unmittelbaren Wahrheit“ nicht so sehr auf die Mystik, sondern vielmehr auf die Lektüre Goethes zurückzuführen ist, und nicht zuletzt zu dem Bedürfnis, das offensichtlich metaphysisch und nicht erkenntnistheoretisch (im Kantischen Sinne) ist, nach einem unmittelbaren Zugang zur Wahrheit. Der Prozess des Denkens Benjamins beginnt also mit einer Auseinandersetzung mit der Kantischen und Neukantischen Philosophie in Bezug auf die Begriffe „Erfahrung“ und „Erkenntnis“. Bereits in diesen ersten Studien bemerkt man aber ein Distanzierung vom Neukantianismus eben hinsichtlich der Konzeption der Erfahrung und der Erkenntnis, über die, nach der Meinung Benjamins, der Kritizismus Marburgs eingeschränkt blieb. Das Bedürfnis und die Notwendigkeit eines unmittelbaren und wenig logischen Begriffes der „Wahrheit“ tritt also hervor; all das bringt Benjamin dazu, sich dem Begriff der „Wahrnehmung“ zu nähern und eine der Identifizierung der Erkenntnis und Erfahrung in der Wahrnehmung zu bekommen. Die Wahrheit wird also eine Art der Evidenzerfahrung, die sich im Jetzt dem intellektuellen Blick des Philosophen zeigt. Trotzdem bleibt im Denken des Autors das alter ego Neukantischer Aszendenz dieser unmittelbaren Wahrheit: Die unendliche Aufgabe. Bevor die Bedeutung dieses zweiten Punkts – der mit dem berühmten Ausdruck Benjamins „Rettung der Phänomene“ (τά φαινόµενα σώζειν) zu tun hat – bis in die Einzelheiten erforscht wird, sehen wir uns zunächst den ersten Aspekt der Wahrheit, nämlich die unmittelbare Wahrnehmung und die Identifizierung, in der Wahrnehmung der Erkenntnis und der Erfahrung, an. In den Schriften nach dem Trauerspielbuch bleiben die Umrisse undefiniert, welche die philosophische Erkenntnis von der Erfahrung unterscheiden, und die zwei Begriffe werden identifiziert. Darüber hinaus, wie es bereits in den frühen Fragmenten geschah, münden diese beiden Begriffe in dem der Wahrnehmung. Es ist gesagt worden, dass Benjamin in dem Passagen-Werk den Prozess der Erkenntnis der Wahrheit zu jenem des Übergangs von Schlaf zum Wachezustand vergleicht: Das Bild vergegenwärtigt sich dem Philosophen plötzlich und unmittelbar. Aber wie vergegenwärtigt es sich? In der Vorrede zu 68 Vgl. BERND WITTE, Walter Benjamin. Der Intellektuelle als Kritiker, Stuttgart 1976, S.10 und GERSHOM SCHOLEM Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1967, S.28ff. 112 Ursprung des deutschen Trauerspiels wird gesagt, dass sich die Idee von selbst manifestiert, es ist aber nicht klar wie. Benjamin sagt nur, dass die Ideen der „Betrachtung“69 gegeben sind. Es sind unterschiedliche Stellen, an denen Benjamin sich auf das Symposion Platons bezieht, und auch für Benjamin scheint, dass die Idee sich dem Philosophen evident macht, der sie in gewisser Hinsicht bereits besitzt, d.h. sie bereits „betrachtet“ hat. Das Phänomen dient also als Erinnerung an die Idee.70 Die Rede Benjamins ist in der Vorrede nun klar, wie wir gesehen haben, hinsichtlich der Tatsache, dass die Ideen sich weder der Intuition noch dem Verstand ergeben, weil sie ein intentionsloses Wesen sind. Es scheint also eine platonische Interpretation zu sein, nach der die Ideen vom Menschen bereits „betrachtet“ worden sind. Demzufolge hat der Mensch sie bereits als eine Art von ontologischen a priori inne, als eine Gegebenheit. Sie werden dann nachher in dem Jetzt der Erkennbarkeit - von dem oben geredet wurde - „wahrgenommen“ – d.h. im Sinne von „erinnert“. In den späteren Werken zeigt sich nämlich dem Intellektuellen durch die Wahrnehmung die Wahrheit in der Form des Bildes. Dass bei Benjamin die Wahrheit „wahrgenommen“, „gesehen“ oder „gehört“ wird, ist eine Konstante. Es genügt, an die Schrift Über das mimetische Vermögen zu denken, in dem die Wahrnehmung die Rolle der Erkenntnis und der Erfahrung übernimmt. In diesem Text besteht Benjamin auf den sinnlichen Aspekt der Wahrheit, bzw. auf die fortschreitende Degeneration des wahrnehmenden Vermögens, und demzufolge – wie wir in dem nächsten Kapitel genauer feststellen werden – auf die Verblendung der Wahrheit, die nicht mehr deutlich „gehört“ oder „gesehen“, sondern von der nur ein leichtes und undeutliches Echo wahrgenommen wird. Diese letztere wird aber weiter wahrgenommen in der Epoche ihrer Verblendung, nämlich in der Moderne, selbst wenn bloß in einer unbestimmten Form. Verschieden sind die Ausdrücke Benjamins, die auf die sinnliche Wahrnehmung der Wahrheit hindeuten, oder in dem umgekehrten Fall, auf die Abstumpfung der Sinne, welche die ursprüngliche Wahrnehmung der Wahrheit verhindert. Einige Beispiele dafür: in Goethes Wahlverwandtschaften werden die Stummheit Ottilies und die Blindheit der Personen des Romans betont. Sie sind Elemente, die eben auf die Degenerierung der Wahrnehmung der Moderne und ihrer Unfähigkeit dazu, die Wahrheit wahrzunehmen, hinweisen.71 In der Schrift über Leskov, in welcher Benjamin die Beziehung zwischen dem Roman und der Erzählung analysiert, betont er, dass die 69 Vgl. GS I/1 210. Ab der ersten Seite der Vorrede zum Trauerspielbuch übernimmt Benjamin einige Stellen aus dem Phaedron und aus dem Symposion hinsichtlich des Verhältnisses Schönheit-Wahrheit. Ein evidenter platonischer Hinweis sind die Worte Benjamins über die Idee, die sich in dem Phänomen – in dem Schönen – manifestiert und verkörpert, das seinerseits von der Wahrheit gerettet wird, die seinen Inhalt ausmacht. 71 Vgl. unter, Kap V. 70 113 Kondition für die Assimilierung der erzählten Geschichten das „Zuhören“72 ist, das allmählich in der Moderne fehlt, so dass in dem Essay Franz Kafka die Welt der kafkaesken Personen die Welt der Moderne - als „schweigend“ bezeichnet wird.73 In den Thesen über den Begriff der Geschichte verwendet Benjamin den Terminus „wahrnehmen“, um die Wahrnehmung des Bildes zu beschreiben, in dem das Denken sich kristallisiert hat,74 und die Wahrnehmung das Organ der geschichtlichen Erkenntnis (immer im doppelten Sinne der Geschichte: universell und individuell) ist. Noch ein Text, in dem die Wahrnehmung eine wichtige Rolle spielt und mit der Erfahrung identifiziert wird, ist Über einige Motive bei Baudelaire aus dem Jahr 1939. Die Wahrnehmung ist in diesem Fall mit dem Begriff der „Aura“ verbunden. Alles, was uns umgibt, besitzt eine Aura, die den Gegenstand aus der Zeit, der er angehört, und aus dem Nutzenzustand, an den er normalerweise gebunden ist, entbindet. So Benjamin: „Die Aura einer Erscheinung erfahren, heißt, sie mit dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen“.75 Später fügt er hinzu, dass die Aura eine „einmalige Erscheinung einer Ferne“76 ist. Die Erfahrung der Aura – d.h. die Wahrnehmung der Aura – lässt Bilder und Erinnerungen in dem Gedächtnis auftauchen, aber nicht nach einer chronologischen Ordnung, sondern durch Assoziationen der Ideen, die unabsichtlich ins Bewusstsein gleiten. Nach dieser Theorie, die Benjamin auch in dem Text Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit verwendet, ist die Wahrnehmung das Organ, durch das die Wahrheit wahrgenommen wird, und die die Rolle der nicht-wissenschaftlichen Erfahrung-Erkenntnis übernimmt. Eben jener unbestimmte Begriff der „Aura“, von Josef Fürnkäs als „Definition des Undefinierbaren“77 bezeichnet, drückt am besten den undefinierbaren und nicht zu einer Methode zurückzuführenden Prozess aus, in dem sich die Wahrheit – d.h. die Idee manifestiert: Als etwas Unbestimmtes.78 Angemessen schreibt Josef Fürnkäs hierfür: „Diese Bestimmtheit teilt der Begriff der Aura zumindest formal mit dem der authentischen Wahrheit. Benjamin hat nie einen Zweifel daran gelassen, dass ‚Wahrheit’ nicht per 72 Vgl. GS II/2 438ff. GS II/2 415f. 74 Vgl. GS I/2 703. 75 GS I/2 646f. 76 GS I/2 647. 77 Vgl. JOSEF FÜRNKÄS, Aura, in Benjamins Begriffe, op. cit. S. 97. Dazu berichtet Fürnkäs über den Widerspruch, den Bertold Berecht bezüglich des benjaminschen Begriffes der Aura festgestellt hat (ibidem). 78 Siehe auch JOSEF FÜRNKÄS, Aura, in Benjamins Begriffe, op. cit. S.99. 73 114 definitionem eingefangen und dingfest gemacht werden kann“.79 Also übereinstimmend mit der Theorie der Vorrede zum Trauerspielbuch bleibt die Wahrheit durch Begriffe undefinierbar. Zu diesem Punkt werden langsam die Stellen der Vorrede deutlicher, an den Benjamin das Verhältnis Phänomen-Begriff-Idee angedeutet hat. Der Begriff ist der Vermittler zwischen dem Phänomen und der Idee, in dem Sinne, dass er das Instrument ist, welches das Phänomen „ausdrücken“ und mitteilen kann, während die Idee das ontologische a priori dieses kommunikativen Prozesses ist, indem sie das Fundament des Phänomens und der Sprache, die ihrerseits ein Phänomen ist, ist. Mit anderen Worten, die Idee (d.h. das Sein) ist für Benjamin die Möglichkeit, die Welt auszulegen. Sie ist eine betrachtete „Struktur“ – d.h. im Menschen bereits anwesend – an die durch eine Wahrnehmung erinnert werden soll; diese letzte Wahrnehmung ermöglicht dem Menschen, eine Weltperspektive „wahrzunehmen“; der Begriff ist der (schriftliche oder ausgesprochene) Ausdruck, mit dem die Welt zum Verständnis und zum Wort gelangt, und so mitgeteilt werden kann. Der Begriff unterscheidet sich immer noch von der Idee, die ihm zugrunde liegt, indem sie ihm ontologisch überlegen ist, und indem sie a priori des Phänomens und des Begriffes (der hingegen eine menschliche Erfindung ist) ist. So ist es möglich die Stellen, an denen Benjamin von einer „Wahrnehmung“ der Idee-Wahrheit spricht (um zu sagen, dass sie nicht konzeptualisiert werden kann, indem sie das Fundament des Begriffes selber und des Phänomens ist), mit denen der Vorrede, an denen sich – mit einem offensichtlichen Hinweis auf Platon – die Idee-Wahrheit manifestiert, d.h. der „Betrachtung“ gegeben wird, zu versöhnen. Diese wird etwa durch die Anamnese des Philosophen „erinnert“. Wenn wir uns diese Interpretation vor Augen halten, dann widersprechen sich die doppelte Struktur der Wahrheit und ihre beiden Sinne (einerseits Wahrnehmung, andererseits unendliche Aufgabe) nicht: die Wahrnehmung zeigt das „Erinnern“ an die Idee, als ontologisches Fundament des Phänomens und „Struktur“, die uns ermöglicht, die phänomenale Welt interpretieren zu können, während die Wahrheit als unendliche Aufgabe der selbe Akt der Begegnung und der Interpretation der Welt ist. Darüber hinaus wird die Wahrnehmung der Wahrheit nicht von einer Methode geleitet, wie es etwa bei der Wahrnehmung der Aura geschieht. Schließlich kann man nur mit Schwierigkeiten von den beiden als Begriffe sprechen: Benjamin scheint also auszusagen, dass die Wahrheit (indem sie die Geschichte und daher den Menschen betrifft) nicht durch Schemen definiert und eingeordnet sein kann. Vielmehr kann sie erfahren und später durch Bilder erzählt werden. Die Wahrheit (ebenso wie die Aura) vergegenwärtigt sich nur demjenigen, der – ebenso wie 79 Ibidem. 115 bei der Wahrnehmung der Ähnlichkeiten – „aufmerksam“ – d.h. offen – bleibt, um deren Manifestationen zu begreifen. Hierfür ist der Begriff der „Aufmerksamkeit“, den Benjamin in der Schrift Franz Kafka einführt, sehr interessant. Über die Aufmerksamkeit schreibt er, ein Zitat von Malebranche übernehmend: „das natürliche Gebet der Seele“,80 und in Über einige Motive bei Baudelaire schreibt er, indem er Novalis zitiert: „Die Wahrnehmbarkeit ist eine Aufmerksamkeit“.81 Und die Aufmerksamkeit, im Sinne von Offenheit – ist das, was die Lektüre des Bilds eröffnet. Eine Lektüre von dem, „was nie geschrieben wurde“82 bemerkt Benjamin in Über das mimetische Vermögen, und im Grunde genommen, eine Wahrnehmung und eine Interpretation von dem, was – bezüglich des Fakts – noch nicht zum Bewusstsein gebracht worden ist. Die Wahrnehmung ergibt sich also als das Organ der philosophischen Erkenntnis: Erkennen ist Wahrnehmen und Wahrnehmen ist Erkennen. In der Wahrnehmung manifestiert sich die Idee, die in den Schriften nach dem Trauerspielbuch die Bedeutung vom Bild gewinnt. Die Charakteristik der Idee als Bild ist die Möglichkeit gelesen werden zu können. Schließlich wird die Geschichte (sowohl die universelle als auch die individuelle) selber von Benjamin als ein „Text“ bezeichnet, und als Text soll sie gelesen werden: „Will man die Geschichte als eine Text betrachten, dann gilt von ihr, was ein neuerer Autor von literarischen sagt: die Vergangenheit habe in ihnen Bilder niedergelegt, die man denen vergleichen könne, die von einer lichtempfindlichen Platte festgehalten werden. ‚Nur die Zukunft hat Entwickler zur Verfügung’ die stark genug sind, um das Bild mit allen Details zum Vorschein kommen zu lassen [...].‚ Die historische Methode ist eine philologische der das Buch des Lebens zugrunde liegt. ‚Was nie geschrieben wurde, lesen’ heißt es bei Hofmannsthal. Der Leser, an den hier zu denken ist, ist der wahre Historiker“.83 Das alles führt uns zu dem frühen Fragment Wahrnehmung ist Lesen zurück, das wir in dem ersten Kapitel dieser Arbeit analysiert haben. Die Wahrnehmung, also das Jetzt, in dem die Idee als Bild wahrgenommen wird, und dessen Lektüre, also dessen Interpretation, sind Momente einer Dialektik - der selben Dialektik, die im Trauerspielbuch als „Darstellung der Idee“ bezeichnet wurde. 80 GS II/2 432. GS I/2 646. 82 GS II/1 213. 83 GS I/3 1238. 81 116 In dem Passagen-Werk, in den Thesen und in dem Material über Baudelaire, wird von dem magischen Aspekt der Wahrnehmung – der die Texte Lehre von Ähnlichen und Über das mimetische Vermögen charakterisiert – allmählich abgelassen. Immer noch anwesend ist dennoch der Aspekt der Zufälligkeit, mit der Benjamin dort die Möglichkeit beschreibt, die Ähnlichkeiten zu begreifen; hier die Möglichkeit die Geschichte zu lesen. Die Unmittelbarkeit ist auch immer noch anwesend: dort sprach Benjamin über den Augenblick, in dem die Analogie und die Ähnlichkeiten wahrgenommen wurden, hier spricht er über das Jetzt, in dem sich die Idee manifestiert. Schließlich ist die gleiche „Aufmerksamkeit“ anwesend, die nichts anderes ist als die sinnliche Offenheit und im Grunde genommen das Vermögen der Wahrnehmung. Die moderne Figur der Alten, die „was nie geschrieben wurde“ lesen konnten, ist der Flaneur, der durch die Pariser Straße läuft und durch das „gefühlte Wissen“ die Stadt, deren Umrisse beschreibend, „wahrnimmt“: „Jener anamnestische Rausch, in dem der Flaneur durch die Stadt zieht, saugt seine Nahrung nicht nur aus dem, was ihm da sinnlich vor Augen kommt, sondern wird oft des bloßen Wissens, ja toter Daten, wie eines Erfahrenen und Gelebten sich bemächtigen. Dies gefühlte Wissen geht von einem zum andern vor allem durch mündliche Kunde“.84 Die gleiche Wahrnehmung und das gleiche gefühlte Wissen sind die Bedingung für die Abfassung der oben zitierten Schrift Berliner Kindheit um Neunzehnhundert, die nicht nur eine bloße Sammlung von Erzählungen ist, sondern das Zeugniss des benjaminschen Begriffes für die wahrgenommene und erzählte Wahrheit zu sein scheint. Durch die Beschreibung der Bilder der Vergangenheit, fährt Benjamin mit der selben „Aufmerksamkeit“ und der selben Wahrnehmung fort, mit denen der Flaneur Paris beschreibt, und mit denen der Historiker die Fakten und die Epochen wahrnimmt und erzählt, oder schließlich mit denen der Autor von Passagen-Werk sich auf die Figuren aus dem Paris des XIX. Jahrhunderts bezieht. Schließlich ist zu bemerken, dass die Wahrnehmung der Wahrheit-Idee auch in den späteren Schriften Benjamins eine elitäre Erfahrung ist,85 ebenso wie in den frühen Schriften die Erfahrung des Künstlers und des Philosophen. Nach meiner Auslegungshypothese wäre das Elitärsein der Erfahrung der Zustand der Moderne, die Epoche in der – wie bereits angedeutet, und wie später genauer geklärt wird – die Wahrheit (d.h. die Idee) sich manifestiert, aber verblendet wird. Das würde bedeuten, dass das Individuum die Fähigkeit verliert, seine eigene Weltanschauung zu erlangen, indem es sich schon immer die geläufige 84 85 GS V/1 525. Siehe unten, Kap. V. 117 (politische, kulturell usw.) als „imponierte Wahrheit“ auferlegen lässt. Das würde zudem bedeuten, dass, wenn in den frühen Schriften das Elitärsein der Wahrnehmung der Idee einen metaphysischen Charakter hätte, es in den späteren Schriften einen sozial- und kritischen (im Bezug auf die Gesellschaft) Charakter86 dazugewinnen würde. 5. Die Aufgabe des Intellektuellen: die Rettung der Phänomene In dem Material für das Passagen-Werk begegnen wir dem Ausdruck „Rettung“, den Benjamin bereits in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels einführt, und noch früher in dem Essay Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Um den Sinn dieses Ausdrucks in dem Passagen-Werk und in den Schriften nach dem Trauerspielbuch zu analysieren und zu begreifen, sollen wir zuerst zu der Vorrede dieses Texts zurückkehren, in dem Benjamin mit dem Begriff der „Rettung der Phänomene“ (τά φαινόµενα σώζειν)87 sozusagen die „Methode“ seiner Philosophie thematisiert: Die Rettung, als intellektuelle Rettung verstanden, ist bei Benjamin die Aufgabe des Intellektuellen, die in dem Zitat Karl Kraus, das als Epigraphe am Anfang der vierzehnten These über die Geschichte erscheint, synthetisiert wird: „Ursprung ist das Ziel“.88 Die Rettung, als unendliche Aufgabe des Philosophen verstanden, weist schließlich auf die Bedeutung der Neukantischen Aszendenz hin, weil, wie bereits gesagt, die Wahrheit auch in den späteren Schriften Benjamins eine doppelte Struktur enthält: einerseits ist sie unmittelbare Wahrnehmung und verweist auf die ontologische Bedeutung der Grundlegung des Phänomens. Andererseits ist sie unendliche Aufgabe und verweist auf die erkenntnistheoretische Bedeutung der interpretierende Lektüre des Phänomens (nur durch die Lektüre wird das Phänomen erkannt). Dennoch, wie wir bereits in dem vorherigen Abschnitt gesehen haben, widersprechen sich diese zwei Dimensionen der Idee nicht. In diesem Abschnitt werde ich diese zweite Bedeutung tiefer erforschen, in Bezug auf den Begriff der „Rettung“. Es ist noch zu betonen, dass die folgende Interpretation sich von der TiedemannAdornos entfernt. Dieser letzteren nach wird die Erlösung nämlich als „innerweltlich“ 86 Siehe unten Kap. V. GS I/1 215. Der Ausdruck reicht zu Simplicius zurück, welcher der erste war, der den Ausdruck „ta phainomena diasozein“ im Bezug auf Plato in seinem Kommentar zum Aristoteles De Coelo: (Ad Aristotelis de coelo 292 b 24) anwandte. 88 “Du kamst vom Ursprung – Ursprung ist das Ziel”. Diese sind die Worte, die der Sterbende Mensch Karl Kraus als Gottes Trost und Verheißung entgegennimmt (GS II/1 360), weil die Welt „Irrweg, Abweg und Umweg zum Paradiese zurück“ ist (ibidem). 87 118 vorgestellt, und fällt mit einer utopischen Befreiung der Gesellschaft zusammen89. Es wird hier gezeigt, dass die Erlösung – die ich „intellektuell“ nennen werde – wohl innerweltlich ist, solange sie die Aufgabe des Menschen in der Welt ist. Sie hat aber primär weder eine Rolle noch eine politische Bedeutung. Stattdessen hat die innerweltliche Erlösung, entsprechend den frühen Schriften Benjamins, eine theoretische Bedeutung (und, wie wir in dem nächsten Kapitel feststellen werden, eine ethische), weshalb sie die theoretische Aufgabe des Intellektuellen (und ethische jedes Menschen) ist. In der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels hat die Ideenlehre, die Benjamin einführt, als Zentrum und Kern den Begriff der „Rettung“: das Phänomen ist in der Idee gerettet,90 welche den Ursprung, die Einheit und die Monade ist. Über die Wahrheit sprechend, bevor er die Bedeutung der Philosophie als Darstellung der Idee, zitiert Benjamin das Symposion Platons, und bezeichnet zwei Aussage dieses Textes „entscheidend“.91 Platon entwickelt die Wahrheit als den Wesengehalt der Schönheit; er erklärt die Wahrheit für schön.92 So schreibt Benjamin: „Das Wesen der Wahrheit als des sich darstellenden Ideenreiches verbürgt vielmehr, dass niemals die Rede von der Schönheit des Wahren beeinträchtigt werden kann. In der Wahrheit ist jenes darstellende Moment das Refugium der Schönheit überhaupt. So lange nämlich bleibt das Schöne scheinhaft, antastbar, als es sich frank und frei als solche einbekennt. Sein Scheinen, das verführt, solange es nichts will als scheinen, zieht die Verfolgung des Verstandes nach und lässt seine Unschuld einzig da erkennen, wo es an den Altar der Wahrheit flüchtet. Dieser Flucht folgt Eros, nicht Verfolger, sondern als Liebender; dergestalt, dass die Schönheit um ihres Scheines willen immer beide flieht: den Verständigen aus Furcht und aus Angst den Liebenden. Und nur dieser kann es bezeugen, dass die Wahrheit nicht Enthüllung ist, die das Geheimnis vernichtet, sondern Offenbarung, die ihm gerecht wird. Ob Wahrheit dem Schönen gerecht zu werden vermag? Diese Frage ist die innerste im ‚Symposion’. Platon beantwortet sie, indem er der Wahrheit es zuweist, dem Schönen das Sein zu verbürgen. In diesem Sinne also entwickelt er die Wahrheit als den Gehalt des Schönen. Nicht aber tritt er zutage in der Enthüllung“.93 89 Vgl. TH. W. ADORNO, Vorrede zu Rolf Tiedemanns Studien zur Philosophie Walter Benjamin, Frankfurt/M. 1965, und in TH. W. ADORNO, Über Walter Benjamin, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1990, S.88ff.). 90 Kaulen nach übernimmt Benjamin den Begriff der „Rettung der Phänomene“ aus der platonischen Interpretation der Marburger Schule, entwickelt ihn aber gegen den wissenschaftlichen Sinn, den der Neukantianismus Marburgs ihm zuschreibt. Benjamin, führt Kaulen fort, bereichert den Begriff der Rettung der Phänomene einer religiösen Konnotation, die zu den Antiken zurückreicht. Benjamin blieb also der antiken und radikalen Trennung zwischen der Idee – die sich auf einer metaphysischen Stufe befindet – und der Phänomenalen Welt treu (H. KAULEN, Rettung, in Benjamins Begriffe, hg. von M. Opitz und E. Wizisla, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2000, S.619ff.). 91 GS I/1 210. 92 Vgl. Ibidem. 93 GS I/1 211 und oben Kap. III. 119 In diesen Zeilen theoretisiert Benjamin, indem er Platon folgt, das Verhältnis zwischen dem Phänomen (d.h. dem Schönen) und der Idee (d.h. dem Wahren). Er sagt nicht nur, dass das Phänomen in der Idee gerettet wird, sondern auch dass diese sein eigener Inhalt ist, der in imstande ist, das Sein des Phänomens zu verbürgen: dies bleibt ein „Schein“, solange es nicht sein eigenes Sein in der Idee bekennt. Die Rede über das Verhältnis Schöne-Wahre, die sich bereits – wie wir nachher sehen werden – in dem Essay Goethes Wahlverwandtschaften findet, wird zunächst aber unterbrochen und dann schließlich im Laufe der Vorrede durch das Verhältnis Phänomen-Idee – das oben analysiert wurde – ersetzt. Dieses stellt in der Rede Benjamin den theoretischen Teil dar, der in dem Trauerspielbuch selber eine Anwendungsseite hat: das Verhältnis zwischen dem historischen Phänomen und der Idee. Von daher leitet Benjamin die Bedeutung der „Geschichte“, nach der – wie wir in den vorherigen Abschnitten gesehen haben – der geschichtliche Inhalt eines Ereignisses nicht von seinem Geschehen in der Zeit bestimmt ist, sondern von dem Verhältnis mit dem wesentlichen Sein der Idee94 ab. Interessant ist, dass Benjamin betont, dass es um die Rettung der „natürlichen Geschichte“ und nicht der reinen Geschichte95 handelt. Das heißt: das was wir „Geschichte“ nennen sollten – gegen die falsche historistische Überlieferung –solches eigentlich nur anhand der Ideen wird, welche die reine Geschichte bestehen, also der Führer – im Kantischen Sinne des Ideals – für den Philosophen, um die Geschichte zu verstehen, und um von ihr ein Bild wiederzugeben. So schreibt Benjamin in dem Passagen-Werk: „Wovor werden die Phänomene gerettet? Nicht nur, und nicht sowohl vor dem Verruf und der Missachtung in die sie geraten sind als vor der Katastrophe wie eine bestimmte Art ihrer Überlieferung, ihre ‚Würdigung als Erbe’ sie sehr oft darstellt. – Sie werden durch die Aufweisung des Sprungs in ihnen gerettet. – Es gibt eine Überlieferung, die Katastrophe ist“.96 Der Begriff der „Rettung“ wird in dem Passagen-Werk und in den Thesen über die Geschichte verwendet, um die Möglichkeit zu beschreiben, das Phänomen vor der falschen Überlieferung, welche die Fakte durch die Kategorie der Kausalität einordnet, zu retten. Dennoch ist der Prozess - durch den der Philosoph die historistische Tradition aushebt, um ein wahres Bild der Vergangenheit wiederzugeben - eine unendliche Aufgabe, weil, wie wir gesehen haben, es die Bewegung ist, durch die er das Phänomen zu der Idee der Totalität 94 Vgl. GS I/1 227. Vgl. Ibidem. 96 GS V/1 591. 95 120 zurückführt. Aus diesem Grund ist das dialektische Bild für Benjamin „diejenige Form des historischen Gegenstandes“,97 d.h. ein Ideal: „es ist das Urphänomen der Geschichte“.98 Das bedeutet aber nicht, dass die einzelne Interpretation der Geschichte – als dialektisches Bild – immer unvollendet bleibt. Sondern es bedeutet, dass - da die Idee unendlich weit entfernt ist, und sich niemals völlig vergegenwärtigt – es möglich ist, das im Bild kristallisierte Phänomen immer weiter auszulegen, wie es aus der Bedeutung der Totalität, die oben analysiert wurde, folgt. Auch in den Thesen über den Begriff der Geschichte – wie in Passagen-Werk – wird die „Methode der Rettung“ an der Interpretation der Vergangenheit angewendet. So schreibt Benjamin in der siebzehnten These: „Wo das Denken in einer von Spannungen gesättigten Konstellation plötzlich einhält, da erteilt derselben eine Chock, durch den es sich als Monade kristallisiert. Der historische Materialist geht an einen geschichtlichen Gegenstand einzig und allein da heran, wo er ihm als Monade entgegentritt. In dieser Struktur erkennt er das Zeichen einer messianischen Stillstellung des Geschehens, anders gesagt, einer revolutionären Chance im Kampfe für die unterdrückte Vergangenheit. Er nimmt sie wahr, um eine bestimmte Epoche aus dem homogenen Verlauf der Geschichte herauszusprengen; so sprengt er ein bestimmtes Leben aus der Epoche, so ein bestimmtes Werk aus dem Lebenswerk. Der Ertrag seines Verfahrens besteht darin, dass im Werk das Lebenswerk, im Lebenswerk die Epoche und in der Epoche der gesamte Geschichtsverlauf aufbewahrt ist und aufgehoben“.99 Noch ein mal: Der Intellektuelle muss sich an die Idee wenden – also an die Totalität und an die Einheit der Idee – um ein authentisches Bild der Vergangenheit zu geben, also um sie zu retten. Die erlösende Aufgabe des Intellektuellen wird auch in dem Essay Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen thematisiert, aber in Bezug auf die Sprachtheorie. In diesem Text übernimmt der Begriff der „Rettung“ zwei unterschiedlichen Bedeutungen. Die erste: Benjamin bezieht sich auf das zweite Kapitel Genesis, in dem er – wie wir gesehen haben – die menschliche Sprache (diejenige, die benennt) von der der Dinge (die stumme Sprache) unterscheidet. Nach der Interpretation Benjamins, besitzt der ursprüngliche Mensch in dem Geschöpf eine entscheidende Rolle, weil er die stumme Natur erlöst, indem er sie zum Ausdruck bringt, d.h. indem er sie offenbart.100 Nach dem Verfall, 97 GS V/1 592. Ibidem 99 GS I/2 703. 100 Siehe oben, Kap. III. Es ist interessant zu bemerken, dass bei Benjamin die Kategorie der Offenbarung und die der Erlösung von einer dialektischen Bewegung, nach der Formel „Ursprung ist das Ziel“, verbunden sind. 98 121 schreibt Benjamin, zerbricht die reine Sprache in die Pluralität der historischen Sprache und reduziert sich auf ein konventionelles System von Zeichen und Begriffen, die ein bloßes kommunikatives Mittel werden. In jeder historischen Sprache bleibt aber der „verhüllte Samen einer höheren“.101 Die Aufgabe der Philosophie – und das ist die zweite Bedeutung – ist also die, vom Phänomen zu der Idee aufzusteigen, d.h. also die symbolische, ursprüngliche, Bedeutung des Wortes wiederzufinden. Das Ursprüngliche ist also zugleich das absolut Anfängliche und das radikal Neue: Das bedeutet, dass die Philosophie die Renovierung des Wortes operieren soll, ohne sich an der profanen Bedeutung festzuhalten, die es in der alltäglichen Sprache übernimmt, sondern indem sie das Wort immer wieder erneut zu seiner Ursprung bringt. Dass die Philosophie zur symbolischen und ursprünglichen Bedeutung des Wortes zurückkehren soll, heißt aber auch etwas anderes. Wie wir oben bemerkt haben, es handelt sich nicht nur um ein Problem der Sprachphilosophie, da der Name, d.h. das reine Sein, – der die Offenbarung der Idee bestimmt, seinerseits eine Idee ist. Den symbolischen Charakter des Wortes wiederzuerlangen heißt im Grunde genommen, es zu der Idee zurückzuführen. Dies stellt der Philosophie die Aufgabe, in der Forschung in Richtung der Idee fortzuverfahren. Das heißt: wenn die Sprache, nach dem Verfall, ein konventionelles System ist, mit dem sich der Mensch in der Welt orientiert, dann soll sie zu der Idee zurückgeführt werden, die sozusagen das „a priori“, im Sinne der Bedingung der Möglichkeit der Interpretation der Welt selber ausdrückt. Also: nur indem man in der Sprache ihren ideellen Ursprung erkennt, ist es möglich sie vor der reinen Konventionalität zu retten. Genauso wie sich das „Schöne“ in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels vor dem reinen Schein rettet, solange es seinen Ursprung in dem Wahren bekennt. Noch ein Beispiel der intellektuellen Rettung ist in einem Brief zu finden, den Benjamin an Florens Christian Rang schrieb. Auch in diesem Fall expliziert Benjamin die erlösende Funktion des Philosophen, der die Phänomene rettet, indem er sie in die Ideen einordnet, und indem er sie zu dem Ursprung zurückführt. So schreibt er: „Die Ideen sind die Sterne im Gegensatz zu der Sonne der Offenbarung. Sie scheinen nicht in dem Tag der Geschichte, sie wirken nur unsichtbar in ihm [...]. Kritik ist die Darstellung einer Idee. Ihre intensive Unendlichkeit kennzeichnet die Ideen als Monade“.102 Die Erlösung (das Ziel) der nicht-menschlichen Sprache geschieht durch den übersetzenden Name - d.h. der Name, der offenbart - oder nach den Wort Benjamins, diese Sprache in die des Namens übersetzt . 101 GS IV/1 14. 102 GB, Bd. II 393 122 Der Brief hat zum Thema das Verhältnis zwischen Kunstwerk und dem Lauf der Geschichte: Benjamin behauptet, dass das Kunstwerk zeitlos ist, genauso wie die Philosophie (wenn sie als Problemgeschichte und nicht als Philosophen-Geschichte betrachtet wird). Die Philosophie verliert den Kontakt mit der zeitlichen Extension und verwandelt sich in einen „zeitlosen“ Akt: die Interpretation.103 Auch in der Kunst bringt die Philosophie – d.h. die Interpretation und die Kritik – die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Werken, die „zeitlos und dennoch nicht ohne historischen Belang sind“,104 zutage: die Kritik ist die Darstellung einer Idee, schreibt Benjamin und „die Aufgabe der Interpretation von Kunstwerken ist: das creatürliche Leben in der Idee zu versammeln. Festzustellen“.105 Auch in dem Essay Die Aufgabe des Übersetzers ist die Rettung als intellektuelle Aufgabe zu finden. In diesem Essay erklärt Benjamin, indem er die Sprachtheorie von Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, welche die Aufgabe des Philosophen hinsichtlich der Übersetzung ist. Einerseits bezieht Benjamin die Übersetzung auf das Original: die Aufgabe des Übersetzers ist es, in seiner Sprache den Sinn des Originals wiederherzustellen. Die Rettung, die er leistet, ist aber nicht auf die Sprache des Originals bezogen, sondern auf die ursprüngliche Sprache. Genauso wie in dem Essay über die Sprache, besteht Benjamin auf die unendliche Ferne und zugleich auf die Verwandtschaft zwischen der reinen Sprache und den historischen Sprachen, in denen, wie gesagt, das Echo des Originals anklingt. Die unendliche Aufgabe des Philosophen ist auch in diesem Fall die Wiederlangung der Idee. So schreibt Benjamin: „Jene reine Sprache, die in fremde gebannt ist, in der eigenen zu erlösen [...] ist die Aufgabe des Übersetzers“.106 Die „Methode“ der Philosophie Benjamins ist also eine Art von „messianischer“ Aufgabe des Philosophen,107 welcher das phänomenale Geschehen retten kann und soll, indem er es auf die Idee bezieht, die also sein Ursprung und sein Ziel ist, und damit ihm eine Bedeutung verleihet. Es handelt sich ja um eine theoretische Rettung und nicht um eine eschatologische, aber, wie wir nachher sehen werden, weist eben die theoretische Rettung des Intellektuellen 103 GB, Bd. II 392. GB, Bd. II 393 105 Ibidem. 106 GS IV/1 19. 107 Auch beim Begriff der „messianischen Aufgabe des Philosophen“ ist es möglich, einen Einfluss der mystischjüdischen Tradition zu finden. Benjamin hatte sich – durch den Freund Scholem – für die jüdische Mystik interessiert, insbesondere für die Strömung von Isaac Luria, der – durch die Tikkun-Theorie – eben die zentrale Rolle des Menschen in dem Prozess, der zur Erlösung führt, thematisiert. Vgl. GERSHOM SCHOLEM, Die jüdische Mystik, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1993, S.267ff. 104 123 auf die Erlösung hin, indem sie sie antizipiert. Nun, weil der Ursprung – wie bereits gesagt – nicht eine Kategorie der Zeit, sondern Idee ist, ist also das Phänomen – das aus ihr entsteht, als etwas das es schon immer gab und das seine Grundlegung in ihr findet –unendlich zu ihr zurückgekehrt, als ewiges Ziel und Aufgabe: die Bewegung der Rückkehr zu dem Ursprung ist einerseits „Restauration und Wiederherstellung“, andererseits ist sie aber auch etwas unvollendetes und nicht abgeschlossenes, weil der Ursprung das Ziel ist, aber das Ziel die Möglichkeit ist, die Phänomene immer weiter auszulegen und zu lesen. Die Wiederkehr zum Ursprung, d.h. die Rettung des Phänomens, kann für das Phänomen nichts anderes sein als etwas unvollendetes, d.h. immer wieder eine Aufgabe zu aktualisieren. Die Idee und das Phänomen sind und bleiben notwendigerweise getrennt, da sie sich auf zwei ontologisch verschiedenen Ebenen befinden; die Bewegung die von dem Phänomen zu der Idee geht, ist unendlich und dialektisch und deshalb handelt es sich um eine Aufgabe: die Idee – d.h. der Ursprung – ist das ideelle Ziel des philosophischen Prozesses. Die Idee ist Ursprung, weil man von ihr her beginnen soll, indem sie die Arbeit des Philosophen führen soll, aber sie ist Aufgabe, weil der Annährungsprozess zu der Idee unendlich ist. In diesem Sinn können wir auch sagen, dass die Idee als Ursprung eine ontologische Bedeutung gewinnt, währen sie als unendliche Aufgabe – d.h. als intellektueller Prozess – eine erkenntniskritische Bedeutung gewinnt, oder besser gesagt: eine auslegende, indem sie folglich das Ziel der intellektuellen Forschung wird. In dem nächsten Kapitel werden wir genauer die ethische und existentielle Seite des Begriffes der „Rettung der Phänomene“ analysieren, sowie das Verhältnis dieses Begriffes zu dem der Erlösung, dessen intellektuelle Rettung eine Antizipation ist. 124 FÜNFTES KAPITEL DIE ROLLE DER IDEE IN DER PRAKTISCHEN PHILOSOPHIE WALTER BENJAMINS 1. Probleme, Fragen. Allgemeine Linien. Dieses Kapitel ist anders als die vorherigen strukturiert. Ich werde mich nämlich mit der Rolle der Idee in dem ethischen Denken Benjamins beschäftigen: da aber Benjamin niemals etwas direkt über Ethik schrieb, werden wir uns zuerst fragen, ob und wie es möglich ist, dass in seiner Philosophie von „Ethik“ die Rede sein kann. Benjamin beschäftigte sich direkt mit der Ethik in den Jahren zwischen 1910 und 1914. Zu jener Zeit war er in der studentischen Jugendbewegung aktiv, und meistens schrieb er Artikel mit sehr schwärmerischen und idealistischen Tönen über ethische Argumente, die sich dem Programm der Jugendbewegung entsprechend mit der Jugenderziehung, dem Ideal der Jugend sowie die Freiheit der Jugend beschäftigen. Diese Themen werden kurz in dem ersten Abschnitt dieses Kapitels behandelt, so dass wir uns für einen historischen Überblick verbürgen können, in dem Benjamin nach und nach sein Denken gestaltetet. Nachher werden wir den bekannten Essay Goethes Wahlverwandtschaften aus dem Jahr 1924 analysieren, in dem Benjamin, meiner Meinung nach, zwischen den Zeilen eine neue Idee der Ethik präsentiert: immer noch von idealistischem pathos aufgeprägt, aber von einer pessimistischeren Perspektive, hinsichtlich der Verwirklichung der moralischen Werte, gekennzeichnet. Darüber hinaus werden wir zeigen, analog mit den Schlussfolgerungen des vorherigen Kapitels, dass auch im ethischen Bereich, und deutlicher als etwa in dem erkenntnistheoretischen, sich die Idee als eine Form darstellt, die in dem menschlichen Bewusstsein bereits irgendwie anwesend ist, die aber wiedererlangt werden soll, da sie sich in einem Zustand der Verblendung befindet, der mit dem historischen Zeitalter, das Benjamin „Moderne“ nennt, verbunden ist. Schließlich werden wir über das Thema der Erlösung, das wir in dem vorherigen Kapitel in Form der 125 „intellektuellen Methode“ und der Aufgabe des Philosophen betrachtet haben, hinausgehen. Demzufolge werden wir forschen, in welcher Beziehung die „intellektuelle“ Erlösung mit der eigentlichen Erlösung steht, und inwiefern sie deren Antizipation ist. 2. Die Ethik und die Idee in den Studentenschriften (1914): Die Religion als neue Moral In diesem Abschnitt möchte ich eine kurze Skizze über die ethische Richtung der frühen Schriften Benjamins vorstellen. Wir machen also einen Rückschritt hinsichtlich der Texte, die wir bisher analysiert haben, und kehren in die Vorkriegszeit zurück, in der Benjamin (eben zwischen 1910 und 1914) sich während der Jugendbewegung um Themen wie Ethik und Idee kümmert - mit einer anderen Annährungsweise im Vergleich zu der der späteren Schriften. Die Charakteristik der Veröffentlichungen Benjamins aus dieser Zeit – die meistens in der Zeitschrift „Der Anfang“1 und in dem Briefwechseln mit den anderen Studenten und Anhängern Wynekens2 erschienen – waren, wie Roberts zu Recht darauf aufmerksam macht3, geprägt von einem grundlegenden Spiritualismus, der jede Art von traditioneller Autorität zugunsten des Leitbildes des Geistes verleugnet: Indem er auf Kant zurückgreift, widersetzte er sich den empirischen und im Voraus gebildeten Normen, die Reinheit einer Ethik, die auf dem reinen Willen beruht4. Das Ziel Benjamins war, z.B. in dem Text Moralunterricht, die Basis für eine moralische Erziehung der Jugend aufzubauen, deren Fixpunkte die Ideen der Freiheit und der Unhabhängigkeit von den etablierten Autoritäten sein sollten. Der Benjamin 1 Zeitschrift der Gruppe Wynekens, für die Benjamin mehrere Male zwischen 1911 und 1916 publizierte (vgl. II/3 825ff.) . 2 Gustav Wyneken gründete 1914 den radikalsten Flügel der Jugendbewegung in Wickersdorf mit dem Ziel der Jugend „ein Leben zu bereiten, das sie sich selber mitschafft, und das ihrem Wesen darum gemäß ist, das sie tätig mitwirken lässt an etwas, dem eine Bedeutung für die Kultur zukommt“ (GS II/3 829). „Soll die Schule aber ihrem Ziele wirklich nachkommen und ein Geschlecht mit einer neuen auf die Kultur gerichteten Gesinnung heranbilden, so wird sich nicht begnügen dürfen, bloße Unterrichtsanstalt für bestimmte Lehrfächer zu sein. Sie muss vielmehr das ganze Leben der Jugend zu organisieren suchen, und dabei die Jugend selbst in weitererstem Maße bei der Gestaltung dieses Lebens zur Mitarbeit heranziehen, so erweitert sich von selbst die Idee der Lernschule zu der der Erziehungsgestalt“ (GS II/3 828). Die Hauptbegriffe der Bewegung Wynekens waren: die Autonomie – „sich selbst die Grenzen geben heißt, sie nicht von anderen gegen seinem Wille aufgezwungen bekommen, es heißt aber auch, nicht blinder Selbstentscheidung, nicht Selbstherrlichkeit ist der Sinn“ – (ibidem 829), die Freiheit – sie „ist nicht die Erlaubnis, alles und jedes zu tun oder zu lassen, sondern die Sicherheit, ungehindert seine Aufgabe erfüllen zu können. Die Freiheit führt also nicht zur Grenzenlosigkeit, sondern zu einer durch Gesetze wohl bestimmten Ordnung“. Wyneken musste Wickersdorf am 1. April 1910 verlassen. Er begann daraufhin mit einer regen Vortragstätigkeit vor interessierten Gremien verschiedenen Art, besonderes vor studentischen Gruppen, in der er die Wickersdorf Ideen propagierte. In diesen Jahren dürfte sich auch der persönliche Kontakt Benjamins mit Wyneken wieder intensiviert haben (GS II/3 829ff.). 3 Vgl. JULIAN ROBERTS, Walter Benjamin, London 1982, S.26ff. S.38. 4 Vgl. GS II/1 49ff. 126 aus dieser Zeit – wie wir bereits bei der Analyse der Erkenntnistheorie der Programmschrift gesehen haben – appelliert an die Religiosität als Grundlage für eine neue moralische Erziehung: „Während sich heute allerorts die Stimme mehren, die Sittlichkeit und Religion für prinzipiell unabhängig voneinander halten, scheint es uns, dass erst in der Religion, und nur in der Religion der reine Wille seinen Inhalt findet. Der Alltag einer sittlichen Gemeinschaft ist religiös geprägt“.5 Das Thema der Religiosität als Quelle der Ethik ist in Die religiöse Stellung der neuen Jugend aus dem Jahr 1913 wiederzufinden. Dennoch entspricht der Begriff der „Religion“ für den Benjamin dieser Jahre – wie bereits in dem ersten Kapitel gesagt – keiner offenbarten Religion, sondern zeigt vielmehr eine rituelle und sakrale Haltung für das Leben. Diese Haltung, welche die Jugend jener Zeit als ungemein wichtig für die Erziehung schätzte, konnte aber keine Entsprechung in der zeitgenössischen Gesellschaft finden. Die Religion war also die Quelle der moralischen Werte, und gerade deshalb war sie imstande, die Jugend vor die ethische Wahl zu stellen, gerade in einem Wertekrisemoment, der das Verschwinden (bzw. die Verblendung) des Objektes der Wahl implizierte. In Grunde genommen hat die Religion „die noch nicht ist“6 bei Benjamin die Rolle des „Entweder-Oder“ von Kierkegaard und stellt für die jungen Studenten vor dem Krieg die Möglichkeit dar, den verschwundenen Idealen – welche von den autoritären Begriffen des „verboten“ und „erlaubt“ ersetzt wurden – einen Sinn wiederzugeben. Noch ein kierkegaardsches Element aus diesen Jahren ist der Begriff der „Einsamkeit“ des Menschen vor der Idee7. Hierfür lässt Roberts anmerken, dass der Terminus „Gemeinschaft“ häufig von Benjamin verwendet wird, um weniger das Zusammensein als eine Form der spirituellen und simultanen Isolierung8 zu meinen. So schreibt Roberts: „Benjamin’s ethical pathos – this he derived from Kierkegaard – demanded that each individual feel the whole weight of personal responsibility for him or her self. An individual’s highest ethical attainment was the experience of being alone with the absolute. Thus, community and loneliness were joined at the highest moment of ethical experience.“9 5 GS II/1 50. GS II/1 73. 7 Vgl. Brief an Carla Seligson von 17.XI.1913 (GB I 181). In dem Brief spricht Benjamin auch über die „Notwendigkeit der Idee“ (ibidem). 8 JULIAN ROBERTS, op. cit. S. 28 9 JULIAN ROBERTS, op. cit., S. 28. 6 127 Dennoch endet mit Ausbruch des ersten Weltkriegs das jugendliche pathos Benjamin, der den Geist und die Idee gegenüber den Schwierigkeiten der zeitgenössischen Gesellschaft – welche überhaupt nicht imstande ist, diese ethische und spirituelle Einsamkeit wiederzuerschaffen – ermahnte. Dieser entscheidende Moment brachte Benjamin dazu, die Jugendbewegung und die dazugehörigen Figuren aufzugeben. Dies trägt dazu bei, die ethischen Perspektive Benjamins zu ändern. Es handelte sich in der Tat um eine theoretische Kehre, – auf welche verschiedenen Faktoren und sicherlich nicht als zuletzt die persönlichen Erfahrungen einwirkten – die, meiner Meinung nach, die neue Perspektive verständlich macht. Diese ist gekennzeichnet von einer progressiven Entfernung des Phänomens von der Idee, die man aus den Schriften Benjamins herauslesen kann. 3. Die Hoffnung und die Ethik: Goethes Wahlverwandtschaften Machen wir nun einen Schritt weiter in den Jahren. Obwohl Benjamin nicht mehr direkt über Ethik schrieb, taucht aber zwischen den Zeilen des Essays Goethes Wahlverwandtschaften eine neue Perspektive auf, die zweifellos als „moralisch“ bezeichnet werden kann. Wir versuchen nun sie in der Analyse dieses Textes zutage zu bringen und das zu begreifen, was sich in der ethischen Konzeption Benjamins verändert und wie sie entwickelt wird. Meine Ausgangshypothese ist, dass die Begriffe der „Versöhnung“ und der „Erlösung“ die Schlüsselbegriffe zum Begreifen des ethischen Denkens Benjamins vom Jahr 1925 (in dem das Essay über Goethe herausgegeben wird) an sind. In den folgenden Abschnitten werden wir uns mit diesen Begriffen beschäftigen, indem wir hervorheben, dass sie mit dem Begriff der „Hoffnung“ verbunden sind. Benjamin spricht nämlich niemals bloß von „Versöhnung“ oder von „Erlösung“, sondern von „Hoffnung auf Versöhnung“ und von „Hoffnung auf Erlösung“. Der Terminus „Hoffnung“ verweist auf die Idealität, als Spannung zur Idee verstanden (und die wir bisher aus theoretischen Gesichtspunkten erforscht haben). Es ist also bedeutsam, dass Benjamin niemals von „Versöhnung“ oder von „Erlösung“ spricht, weshalb „Hoffnung auf Versöhnung“ und „Hoffnung auf Erlösung“ auf die idealistische Spannung zu zweierlei Ideen verweisen. Wie Adorno bemerkt, ist das Thema der Hoffnung auch der Mittelpunkt der Briefsammlung10 Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen11, die 10 Die Briefsammlung schließt Briefe verschiedener Autoren mit ein. Sie enthält sowohl berühmte Briefe, von Philosophen, Mathematikern, Dichtern geschrieben, als auch unbekannte Briefe, von gewöhnlichen Menschen 128 Benjamin im Jahr 1936 in der Schweiz unter dem Pseudonym „Detlef Holz“ herausgegeben hat. Insbesondere der Brief von Samuel Collenbusch an Immanuel Kant12 ist interessant. Adorno schreibt dazu: „Die Briefe sind allesamt asketisch, sei’s in der Haltung, sei’s im Verhältnis zum Ideal [...]. Mit keinem Wort verrät der zu dem Brief Collenbuschs, der ihm der liebste war, welches Pathos bei Benjamins das Wort Hoffnung besaß, um das jener Brief zentriert ist wie Benjamins Interpretation der Wahlverwandtschaften“.13 3.1 Der Mythos (d.h. das natürliche Leben) und der ethische Kampf gegen den Mythos Benjamin beginnt den Essay Goethes Wahlverwandtschaften mit einem methodologischen Hinweis auf die Aufgabe des Kritikers, die zum Begreifen der moralischen Bedeutung des Textes sehr wichtig ist. Der Kritiker, schreibt Benjamin, kann mit dem Paläographen verglichen werden: „Man darf ihn mit dem Paläographen vor einem Pergamente vergleichen, dessen verblichener Text überdeckt wird von den Zügen einer kräftigern Schrift, die auf ihn sich bezieht. Wie der Paläograph mit dem Lesen der letztern beginnen müsste, so der Kritiker mit dem Kommentieren [...]. Nun erst kann er die kritische Grundfrage stellen, ob der Schein des Wahrheitsgehaltes dem Sachgehalt oder das Leben des Sachgehaltes dem Wahrheitsgehalt zu verdanken sei [...]. Will man, um eines Gleichnisses verfasst. Adorno schreibt nämlich: „Die Briefschreiber erscheinen in dem Band als Sozialcharaktere, nicht als individuelle“ (TH. W. ADORNO, Über Walter Benjamin, op.cit. S.55.). Benjamin gibt solche Briefe heraus und schickt jedem von ihnen ein Vorwort voran. Die Arbeit Benjamins besteht also nur in der Auswahl der Briefe. 11 Ein Teil der in Deutsche Menschen enthalten Briefe, zusammen mit den Vorworten, erschien bereits in den Jahren 1931-1932 in der „Frankfurter Zeitung“. Benjamin musste ein Pseudonym verwenden, weil der Charakter der Vorworte als eine Polemik gegen das nationalsozialistische Regime anklang, das, laut Benjamin, die Ursache der Degenerierung des wahren deutschen Geistes war. Das Epigraph des Buchs lautet nämlich so: „Von Ehre ohne Ruhm / Von Größe ohne Glanz / von Würde ohne Sold“ (GS IV/1 150). 12 So lautet der Brief: „Die Hoffnung erfreut das Herz. Ich verkaufe meine Hoffnung nicht für tausend Tonnen Goldes. Mein Glaube hofft erstaunlich viel Gutes von Gott. Ich bin ein alter, siebzigjähriger Mann, ich bin beinahe blind, als Arzt urteile ich, dass in kurzer Zeit völlig blind sein werde. Ich bin auch nicht reich, aber meine Hoffnung ist so groß, dass ich mit keinem Kaiser tauschen mag. Diese Hoffnung erfreut mein Herz!“ (GS IV/1 163ff.). 13 TH. W ADORNO, Zu Benjamins Briefbuch Deutsche Menschen (1962) in Über Walter Benjamin, op.cit. S.57ff. 129 willen, das wachsende Werk als den flammenden Scheiterhaufen ansehen, so steht davor der Kommentator wie der Chemiker, der Kritiker gleich dem Alchimisten. Wo jenem Holz und Asche allein nur die Gegenstände seiner Analyse bleiben. Bewahrt für diesen nur die Flamme selbst ein Rätsel: das des Lebendigen. So fragt der Kritiker nach der Wahrheit, deren lebendige Flamme fortbrennt über den schweren Scheitern des Gewesenen und der leichten Asche des Erlebten“.14 Zuerst macht Benjamin eine Unterscheidung zwischen der Kritik und dem Kommentar. Während letzterer die Oberfläche des Werks betrachtet, gräbt die Kritik in seine Tiefe. Zweitens hat das Kunstwerk zwei Inhalte, bzw. zwei Bedeutungsebenen: der Sachgehalt und der Wahrheitsgehalt. Laut Benjamin ist das Verhältnis der beiden ein grundsätzliches Gesetz der Literatur: „Der Wahrheitsgehalt eines Werkes, je bedeutender es ist, desto unscheinbarer und inniger an seinen Sachgehalt gebunden ist [...]. Damit aber tritt der Erscheinung nach Sachgehalt und Wahrheitsgehalt, in der Frühzeit des Werkes geeint, auseinander mit deiner Dauer, weil der letzte immer gleich verborgen sich hält, wenn der erste hervordringt“.15 Bei Benjamin ist also der Wahrheitsgehalt die wahre Bedeutung des Sachgehaltes des Werkes16 und seine Elemente, die sofort dem Publikum deutlich werden, haben einen tieferen Sinn, etwa ein Geheimnis, das von der Kritik gesucht und zutage gebracht werden soll. Anfänglich bezieht sich die Unterscheidung Benjamins auf den Kommentar und auf die Kritik, nach wenigen Zeilen erscheint die Unterscheidung allgemeiner. So schreibt er nämlich: „Dem Dichter wie dem Publikum seiner Zeit wird sich nicht zwar das Dasein, wohl aber die Bedeutung der Realien im Werke zumeist verbergen. Weil aber nur von ihrem Grunde das Ewige des Werkes sich abhebt, umfasst jede zeitgenössische Kritik, so hoch sie auch stehen mag, in ihm mehr die bewegende als die ruhende Wahrheit, mehr das zeitliche Wirken als das ewige Sein“.17 Was meint nun Benjamin mit „Ewige des Werkes“ oder „Wahrheitsgehalt“? Warum gelingt es der zeitgenössischen Kritik nicht es zu begreifen? Benjamin bestimmt einen Parallelismus 14 GS I/1 125f. GS I/1 125. 16 Vgl. GS I/1 126. 17 Ibidem. 15 130 zwischen dem Leben des Autors und dessen Werk. Beide besitzen einen Wahrheitsgehalt und einen Sachgehalt. Letzterer – der dem Publikum und der zeitgenössischen Kritik deutlich anzusehen ist – wird, bezüglich des Werkes, von dem, was in ihm dargestellt ist, und durch das Leben eines Autors, von seinen Aktionen, in denen sich das Leben manifestiert, determiniert. So schreibt Benjamin: „Vom Wesen des Verfassers zunächst wird nach dessen Totalität, seiner ‚Natur’, jede Erkenntnis durch die vernachlässigte Deutung der Werke vereitelt. Denn ist auch diese nicht imstande, von dem Wesen eine letzte und vollkommene Anschauung zu geben, welche aus Gründen sogar stets undenkbar ist, so bleibt, wo von dem Werke abgesehen wird, das Wesen vollends unergründlich. Aber auch die Einsicht in das Leben des Schaffenden verschließt sich der herkömmlichen Methode der Biographik. Klarheit über das theoretische Verhältnis von Wesen und Werk ist die Grundbedingung jeder Anschauung von seinem Leben“.18 Um das Leben eines Autors zu verstehen, ist es notwendig seine Werke zu verstehen19, dennoch gilt auch das Ungekehrte: zum Begreifen der Werke muss man mit dem Leben des Autors beginnen. Das, was Benjamin meint, ist, dass nur eine Lektüre, die von einem Überblick anfängt, sowohl das Leben eines Autors als auch sein Werk durchdringen kann. Diese Operation ist aber der beim Werk zeitgenössischen Kritik unmöglich, weil sie notwendigerweise eine begrenzte Perspektive hat. Mit anderen Worten, der Blick eines nicht zeitgenössischen Kritikers muss sich zur Vergangenheit wenden, indem er in ihr den Wahrheitsgehalt erblickt. Dies bedeutet, dass die kritische Perspektive notwendigerweise ein Rückblick sein muss. Zweitens darf diese Perspektive nicht partiell sein: nur indem man sich als Ideal die Analyse aller Werke eines Autors stellt, kann man sowohl ihre Bedeutung als auch die Funktion begreifen, welche die Werke auf das Leben eines Autors haben. Laut Benjamin muss man also zum Begreifen der Bedeutung von Goethes Wahlverwandtschaften mit einer Analyse von Goethes Leben anfangen, dessen wahrer Sinn der Methode der traditionellen Analyse entgangen ist. Der Sachgehalt der späteren goethischen Werke und insbesondere von Wahlverwandtschaften stellt für Benjamin den Kampf dar, den Goethe in seinem Alter ausgetragen hat, um aus der Welt des Mythos herauszukommen. Die Bedeutung dieses Kampfes ist moralisch. Benjamin schreibt: 18 19 GS I/1 156. Diese Aufgabe fällt der Kritik und nicht der traditionellen biographischen Methode zu. 131 „Es ist in ihm ein Ringen um die Lösung aus deren [der Mythischen Welt] Umklammerung und dieses Ringen nicht weniger als das Wesen jener Welt ist in dem Goetheschen Romane bezeugt. In der ungeheuern Grunderfahrung von den mythischen Mächten, dass Versöhnung mit ihnen nicht zu gewinnen sei, es sei denn durch die Stetigkeit des Opfers, hat sich Goethe gegen dieselben aufgeworfen. War es ständig erneuerte, in innerer Verzagtheit, doch mit eisernem Willen unternommene Versuch seines Mannesalters, jenen mythischen Ordnungen überall da sich zu untergeben, wo sie noch herrschen, ja an seinem Teil ihre Herrschaft zu festigen, wie nur immer ein Dichter der Machthaber dies tut, so brach nach der letzteren und schwersten Unterwerfung, zu der er sich vermochte, nach der Kapitulation in seinem mehr als dreißigjährigen Kampfe gegen die Ehe, die ihm als Sinnbild mythischer Verhaftung drohend schien, dieser Versuch zusammen und ein Jahr nach seiner Eheschließung [...] begann er die Wahlverwandtschaften, mit welchen er den ständig mächtiger in seinem spätern Werk entfalteten Protest gegen jene Welt einlegte, mit der sein Mannesalter den Pakt geschlossen hatte. Die Wahlverwandtschaften sind in diesem Werk eine Wende“.20 Das Leben Goethes war, laut der Interpretation Benjamins, immer in der Gewalt der mythischen Mächte. Hinweis dafür ist vor allem der goethische Begriff der „Natur“21: Sie „ist für Goethe nur das Chaos der Symbole“22. Eben in diesem Chaos mündet letztendlich das Leben des Mythos, „welches ohne Herrscher oder Grenzen sich selbst als die einzige Macht im Bereiche des Seienden einsetzt“23. Benjamin erkennt in seinem Essay Goethes Wahlverwandtschaften einige auf den Mythos zurückführbare Einstellungen Goethes. Zuerst ist eine der typischen Wesenzüge des Mythos die Angst vor dem Tode, der „die gestaltlose Panarchie des natürlichen Lebens […], die den Bannkreis des Mythos bildet”24, bedroht. Die Unruhe hinsichtlich des Todes war nämlich eine Charakteristik Goethes: „es ist bekannt, dass bei ihm [Goethe] niemand je von Todesfällen reden durfte, weniger bekannt, dass er niemals ans Sterbebett seiner Frau getreten ist”25. Darüber hinaus ist die Angst vor dem Leben auch 20 GS I/1 164f. Laut Benjamin kann man Goethe eine eigentliche Idolatrie der Natur zuschreiben. Ein Ausdruck der mythischen Konzeption der Natur ist der Begriff des „Dämonischen“. So schreibt Benjamin, indem er ein Fragment des autobiographischen Werkes Goethes Dichtung und Wahrheit: “Man hat im Verlaufe dieses bibliographischen Vortrags umständlich gesehen, wie das Kind, der Knabe, der Jüngling sich auf verschiedenen Wegen dem Übersinnlichen zu nähern gesucht [...]. Er glaubte in der Natur, der belebten und unbelebten, der beseelten und unbeseelten, etwas zu entdecken, das sich nur in Widersprüchen manifestierte und deshalb unter keinen Begriff, noch viel weniger unter ein Wort gefasst werden könnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünftig; nicht menschlich, denn es hatte keinen Verstand; nicht teuflisch, denn es war wohltätig; nicht englisch, denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Zufall, denn es bewies keine Folge; es ähnelte der Vorsehung, denn es deutete auf Zusammenhang [...]. Dieses Wesen, das zwischen alle übrigen hineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, nannte ich dämonisch“ (W.A. GOETHE, Dichtung und Wahrheit, in GS I/1 149f.). 22 GS I/1 148. 23 GS I/1 149. 24 GS I/1 151. 25 Ibidem 21 132 typisch für den Mythos: „die Angst vor seiner Macht und Breite aus dem Sinnen, die Angst vor seiner Flucht aus dem Unfassen“26. Noch ein mythischer Aspekt, der sich in der Persönlichkeit Goethes manifestiert, war laut Benjamin seine Besessenheit, versteckte Bedeutungen, welche die Gegenstände manchmal offenbaren27, zu suchen. Der Mensch, der sich auf das Chaos der Symbole versteift, verliert die Freiheit und die Autonomie der Aktionen, weil sie von Zeichen, Orakeln und Zusammenfällen bestimmt werden. Dies führt uns schließlich zur mythischen Angst vor der Verantwortung. Bei Goethe offenbart sich dies in dem Versuch, der Entscheidung entgegenzutreten, indem er an den Zwang des Schicksals und der Natur appelliert. Benjamin schreibt, dass die Angst vor der Verantwortung, „die geistigste unter allen, denen Goethe durch sein Wesen verhaftet war”28, war. Laut Benjamins Interpretation war Goethe also eine entschieden abergläubische Person. Sein Verhältnis zum Schicksal und zu den natürlichen Korrespondenzen war von der Angst beherrscht. Die komplexe Symboltheorie Goethes, seine Hinweise auf die dämonischen und astrologischen Faktoren und sein Bestehen darauf, alles bedeutsam zu schätzten, waren bloße Beispiele der Offenbarung der mythischen Angst. Benjamin liest den Roman Goethes Wahlverwandtschaften als die persönliche Darstellung des Versuchs des Autors, dem Mythos zu entkommen. Deshalb muss in den Wahlverwandtschaften “wie dunkel darin der Mythos auch walte, eine reinere Verheißung sichtbar sein”29, d.h. der Kampf zur Rettung. Schließlich ist der Text Wahlverwandtschaften kein mythisches Werk, wie es gewöhnlich interpretiert wurde30. Man muss in ihm, als seinen Wahrheitsgehalt, die praktische – im Sinne von moralische – Absicht seines Autors erkennen. 3.2 Die Versöhnung aus dem Mythos Inwiefern inszeniert Goethes Wahlverwandtschaften den moralischen Kampf des Autors gegen den Mythos? Was ist außerdem der „Mythos“? Der Titel Wahlverwandtschaften enthält laut Benjamin eine Zweideutigkeit. Der Terminus „Verwandtschaften“ verweist auf die 26 GS I/1 152. Benjamin zitiert einen Brief von Goethe an Schiller, in dem die Aufmerksamkeit der ersten für alles, das bedeutsam und symbolisch war, auftaucht (vgl. GSI/1 154). 28 GS I/1 154. 29 GS I/1 167. 30 Ibidem. 27 133 Mächte, in deren Gewalt die Gestalten des Romans sind. Durch diese Macht, die ein natürlicher Impuls, und deshalb mythischer ist, führen sie ihre Aktionen aus und handeln. Dennoch verweist der Terminus „Wahl“ auf die Möglichkeit einer Wahl. Die Zweideutigkeit des Titels besteht in der Tatsache, dass denjenigen, die vom Mythos beherrscht sind, tatsächlich die Möglichkeit der wahren Wahl entzogen wird: diese impliziert nämlich die Freiheit. Der Mythos kennt die Wahl nur als natürliche Wahl, weshalb es da, wo das Schicksal herrscht, keinen Platzt für die Wahl und die Autonomie gibt31. Laut der Interpretation Benjamins über die Wahlverwandtschaften Goethes besteht einen Nexus zwischen Schicksal, Natur und Mythos. In diesem Nexus ist die von Goethe beschriebene Welt des Romans eingetaucht32. In den Wahlverwandtschaften wird die mythische Welt durch den juridischen Bund der Ehe inszeniert. Benjamin schreibt: „die Ehe im Geschehen nicht die Mitte ist, sondern der Mittel“33. Durch die Darstellung der Auflösung der Ehe ist es möglich, die mythische Mächte auftauchen zu lassen, auf denen ein solcher Bund beruht. Der mythische natürliche Zustand impliziert nämlich notwendigerweise die Strafe, falls seine Gesetzte übertreten werden (wie im Fall der Ehe in den Wahlverwandtschaften.) Bereits in der Schrift Zur Kritik der Gewalt34 aus dem Jahr 1918 unterscheidet Benjamin den Begriff des „Rechts“ von dem der „Gerechtigkeit“. Das Recht, d.h. das Gesetz, beruht auf die Gewalt. Diese ist blind, weil sie pedantisch, oft gegenüber der Einzelperson und dazu mit Personenschaden, angewendet wird. Das Recht monopolisiert die Gewalt, mit der es die Bürger unterordnet: sein einziges Ziel ist sich selbst zu wahren und nicht die juristischen Zwecke der Person (Gewalt heißt nämlich auch Autorität, Macht). Dieser Gewalt so wie dem Recht, das sie gründet, setzt Benjamin die Gerechtigkeit entgegen. Die Gerechtigkeit ist die reine unmittelbare Gewalt, d.h. die entsühnende göttliche Macht. Die mythische Gewalt ist „blutig“ und ihre Domäne ist die Natur, denn „das Blut ist das Symbol des bloßen Lebens“35. Dagegen setzt sich die göttliche Gewalt über das bloße natürliche Leben und aus ihm hebt sie den Menschen empor. Die Alternative zwischen Mythos und Gerechtigkeit darf also als Alternative zwischen „bloßem Leben“ und der moralischen und reinen Welt der Idee gelesen werden. Es ist interessant zu bemerken, dass der Begriff des „bloßen Lebens“ auch in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels36 - wie bereits gesehen – hinsichtlich der Geschichte erscheint: die „natürliche“ Geschichte soll durch die 31 Hierfür ist die von Benjamin am Anfang des Essays eingesetzte Epigraphe interessant. Es ist ein Vers Klopstocks, der lautet: „Wer blind wählet, dem schlägt Opferdampf/ In die Augen“ GS I/1 125. 32 Benjamin schreibt nämlich, dass die Gestalten des Romans “völlig der Natur verhaftet sind” (GS I/1 133). 33 GS I/1 189. 34 GS II /1 179ff. 35 GS II/1 199. 36 Vgl. GS I/1 227. An dieser Stelle spricht Benjamin von „natürlichem Leben“. 134 Ideen gerettet werden. Dies bedeutet: jedes Phänomen, wenn es getrennt von der Idee betrachtet wird, ist nur bloßes natürliches Leben, d.h. reiner Schein. Indem dieser auf die Idee zurückgeführt wird, erwirbt er seinen Wert. Also: bloßes Leben oder natürliches Leben bedeutet bei Benjamin reiner Schein und reine Phänomenalität. Wie wir aber in der theoretischen Analyse des Verhältnisses Phänomen-Idee festgestellt haben, existiert nicht allein die Idee an sich, von dem Phänomen getrennt; ebenso existiert kein Phänomen an sich, von der Idee getrennt: das Phänomen ist bloßes Leben und Natur, indem es seinen Ursprung in der Idee nicht erkennt. Der Mythos ist bei Benjamin eben dieser Zustand: das Phänomen „verliert die Idee aus den Augen“, als seinen Wahrheitsgehalt, und diese bleibt „verblendet“ zwar anwesend, aber wie ein Schatten und ein fernes Echo. Kehren wir nun zu Goethes Wahlverwandtschaften zurück. An dieser Stelle ist es notwendig etwas zu präzisieren. Der Verfall der Ehe kann, meiner Meinung nach, nicht als unmoralisch beurteilt werden. So will er nämlich nicht sein. Die Ehe – insoweit sie Mythos ist – ist antithetisch zur Moral, die bei Benjamin die reine Welt der Idee ist. Der Mythos ist amoralisch. Beurteilt man als unmoralisch die absichtliche Übertretung bestimmter Verhältnisprinzipien, deren Existenz man sich aber bewusst ist, ist dagegen amoralisch der Verblendungszustand dieser Prinzipien. Mit anderen Worten die Welt des Mythos ist amoralisch, denn in ihr können die Ideen und die ethische Prinzipien nicht im Bewusstsein des Menschen anwesend sein. Demzufolge, wenn man nicht absichtlich solche Prinzipien übertreten kann, weil sie dem Menschen weder deutlich bewusst noch manifest sind, dann kann der Mythos nicht als unmoralisch bezeichnet werden. Wird die Moralität durch die Anpassung des Bewusstseins an die ethischen Prinzipien erworben, dann ist es notwendig, die Anwesenheit dieser Prinzipien selbst wiederzuerlangen, um von dem Zustand der Amoralität zu dem, der die Moralität ermöglicht, zu kommen. Nun wird es nötig, die folgenden Fragen zu stellen: 1) ist eine Ethik in dem Mythos möglich? 2) welches ist das Verhältnis zwischen dem Mythos und der Moderne, welcher wir in den vorherigen Abschnitten begegnet sind, als Ausdruck der Zeit der Technik? In Benjamins Interpretation des goethischen Romans ist die kurze Novelle, die Die wunderlichen Nachbarskinder betitelt ist zentral. So schreibt Benjamin: „Darf als unumstößlich gewiss betrachtet werden, dass im Bau der Wahlverwandtschaften dieser Novelle eine beherrschende Bedeutung zukommt. Wenn auch erst in dem vollen Licht der Haupterzählung all ihre Einzelheiten sich erschließen [...]: den mythischen Motiven des Romans entsprechen jene der Novelle als Motive der Erlösung. Also darf, wenn im 135 Roman das Mythische als Thesis angesprochen wird, in der Novelle die Antithesis gesehen werden“.37 Benjamin kommentiert, dass in dem Titel der Novelle Goethes38 der Terminus „wunderlich“ darauf hinweist, wie die in ihr beschriebene Welt den Gestalten des Romans fremd und unbekannt erscheint. Für sie sollte die Novelle als Beispiel dienen. Sie inszeniert das Geschehen von zwei Liebenden, die eine Versöhnung und eine Aussöhnung erreichen. Die Versöhnung bezieht sich auf die Versöhnung mit Gott, während die Aussöhnung die Aussöhnung mit der Gesellschaft ist, in der sie leben. Versuchen wir nun die Bedeutung der Novelle zu begreifen. Zuerst erscheint die Novelle ganz von dem Rest des Werkes getrennt zu sein. Die Gestalten des Romans sind den mythischen Mächten des Schicksals unterworfen, während die der Novelle dagegen frei sind. Die Freiheit und die Wahl sind also, laut Benjamin, die Elemente, welche die Welt der Novelle von der Welt des Romans, und zwar die ethische Welt der Idee von der Welt des Mythos, unterscheiden. Laut der Interpretation Benjamins setzen die Gestalten der Novelle ihr Leben aufs Spiel, um die wahre Versöhnung zu gewinnen - die sie letztendlich bekommen und mit ihr auch den Frieden - in der ihr sentimentaler Bund – der aber nicht Ehe ist – auf die Dauer bestimmt ist. So schreibt Benjamin: „Weil nämlich wahre Versöhnung mit Gott keinem gelingt, der nicht in ihr [...] alles vernichtet, um erst vor Gottes versöhntem Antlitz es wieder erstanden zu finden, darum bezeichnet ein todesmutiger Sprung jenen Augenblick, da sie – ein jeder ganz für sich allein vor Gott – um der Versöhnung willen sich einsetzen. Und in solcher Versöhnungsbereitschaft erst ausgesöhnt gewinnen sie sich. Denn die Versöhnung, die ganz überweltlich und kaum fürs Kunstwerk gegenständlich ist, hat in der Aussöhnung der Mitmenschen ihre weltliche Spiegelung“.39 Die in der Novelle dargestellte wahre Versöhnung ist antithetisch zu dem Schein der Versöhnung, nämlich der Schönheit, die der Roman seinen Gestalten verspricht. So schreibt Benjamin weiter: 37 GS I/1 171. Ibidem. 39 GS I/1 184. 38 136 “Während Liebe die Versöhnten geleitet, bleibt als Schein der Versöhnung nur die Schönheit bei den andern zurück”.40 Was bedeutet diese Unterscheidung? Zunächst verweist die Schönheit, d.h. der Schein der Versöhnung vom Mythos, auf die Theorie des Schönen hin, die wir zuvor analysiert haben. Das Schöne, d.h. der reine Schein und das Phänomen getrennt von der Idee, ist der Schein der Versöhnung des Mythos. Der Terminus „Schein“, in der Unterscheidung zwischen „Schein der Versöhnung“ und „wahre Versöhnung“, hat eine wichtige Bedeutung. Diesem Terminus sind wir bereits in seiner theoretischen Bedeutung begegnet, als wir in der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels das Verhältnis Idee-Phänomen analysiert haben: Schein bedeutet nicht „scheinbar“ im Sinne von „falsch“, sondern im Sinne von „verblendet“. Das Phänomen ist reiner Schein, wenn es nicht seine Beziehung mit der Idee erkennt. Demzufolge ist die mythische Welt „Schein“, weshalb sie sich von der Idee entfernt und zur bloßen Phänomenalität wird. Erforschen wir nun die Beziehung Idee-Phänomen, indem wir das Phänomen, d.h. den Schein, in seiner ethischen Valenz betrachten. Hierfür muss zunächst die Figur Ottilies analysiert werden, die laut Benjamin den Lesenschlüssel des Romans Goethes enthält. Das, was die Figur Ottilies kennzeichnet, ist zunächst die Schönheit, durch die Ottilie den reinen Schein verkörpert und in dem Roman darstellt. Der reine Schein ist bei Benjamin die reine Phänomenalität, in welcher keine Spur der Idee besteht. Dieses bedeutet, dass die Menschheit, wenn sie den Sinn des Ethischen verliert, zum „bloßen Leben“41 wird und so verliert sie auch ihren menschlichen Wert, indem sie der Natur und dem Schicksal unterliegt. Dieses letztere wird von Benjamin als „Schuldzusammenhang von Lebendigen“42 bezeichnet. In den vorherigen Kapiteln haben wir festgestellt, dass das Phänomen einen Wert erwirbt, indem es auf die Idee bezogen wird. Dies bedeutet: die Anwesenheit der Idee in dem Phänomen ermöglicht, diesem den reinen Schein, zu dem es als Phänomen verurteilt ist, zu erhöhen und zu retten. Das selbe Prinzip gilt in der Moral: das Phänomen soll zur Idee erhöht werden, um einen moralischen Sinn und Wert zu gewinnen. Es darf also nicht von „menschlichem Leben“ die Rede sein, sondern von „natürlichen Leben“ schlechthin, wenn der Menschheit die von der Idee gegeben ethische Bedeutung fehlt. D.h. die Person wird eine solche, solange sie sich zur Idee der Menschheit und zu dem, was sie impliziert: d.h. die Verantwortung und die Wahl, emporhebt. 40 GS I/1 185. GS I/1 139. Außerdem schreibt Benjamin: „Mit dem Schwinden des übernatürlichen Lebens im Menschen wird sein natürliches Schuld” (ibidem.) 42 GS I/1 138. 41 137 Der Mythos bringt die Strafe für die Übertretung seiner Gesetzten mit sich. Da Ottilie die Ursache des Verfalls der Ehe (d.h. ein mythisches Gesetz) der beiden Hauptfiguren des Romans, ist, ist der Tod die einzige Buße ihrer Schuld. Ottilies Tod, der von Goethe als Selbstmord dargestellt wird, ist laut Benjamin nur anscheinend so, weil innerhalb eines mythischen Kontextes weder von Wahl noch von Entscheidungen die Rede sein kann. So schreibt Benjamin: „Ihr [Ottilias] Entschluss zum Sterben bleibt nicht nur vor den Freunden bis zuletzt geheim, er scheint in seiner völligen Verborgenheit auch für sie selbst unfassbar sich zu bilden. Und dies rührt an die Wurzel seiner Moralität [...]. Denn wenn irgendwo, so zeigt sich im Entschluss die moralische Welt vom Sprachgeist erhellt. Kein sittlicher Entschluss kann ohne sprachliche Gestalt, und streng genommen ohne darin Gegenstand der Mitteilung geworden zu sein, ins Leben treten. Daher wird, in dem vollkommenen Schweigen der Ottilie, die Moralität des Todeswillens, welcher sie beseelt, fragwürdig. Ihm liegt in Wahrheit kein Entschluss zugrunde sondern ein Trieb“.43 Laut Benjamin ist die mythische Welt ein bloßer Schein. Sie ist reiner Schein, da in ihr das Verhältnis Phänomen-Idee verloren gegangen ist. Auf der ethischen Ebene ist der Mythos die Abwesenheit von Verantwortung und Entscheidung, deren Allegorie die Stummheit von Ottilie ist. So schreibt Benjamin weiter: „Nicht so sehr darum ist das Dasein der Ottilie […] ein ungeheiligtes, weil sie sich gegen eine Ehe, die zerfällt, vergangen hätte, als weil sie, im Scheinen und im Werden schicksalhafter Gewalt bis zum Tod unterworfen, entscheidungslos ihr Leben dahinlebt“.44 Bevor wir die Analyse von Goethes Wahlverwandtschaften weiterführen, sollten wir eine Überlegung über die ethische Valenz des Namens und der Sprache hinzufügen. Wie zuvor gesehen, betrachtet Benjamin die Sprache des Namens als eine menschliche Eigenschaft, durch die der Mensch sich von der Natur (welche stumm ist) abhebt und sich Gott nähert. Wir haben auch bezüglich der Vorrede zu Ursprung des deutschen Trauerspiels festgestellt, dass der Name – d.h. das reine Wesen, das von der Phänomenalität losgelöst ist – eine der Bedeutungen der Idee ist. In Goethes Wahlverwandtschaften schreibt Benjamin hinsichtlich der Gestalten des Romans: 43 44 GS I/1 176 Ibidem. 138 „Nicht natürlich sind diese Gestalten, denn Naturkinder sind […] Menschen. Sie jedoch unterstehen auf der Höhe der Bildung den Kräften, welche jene als bewältigt ausgibt, ob sie auch stets sich machtlos erweisen mag, sie niederzuhalten. Für das Schickliche ließen sie ihnen Gefühl, für das Sittliche haben sie es verloren. Nicht ein Urteil über ihr Handeln ist hier gemeint, sondern eines über ihre Sprache. Denn fühlend, doch taub, sehend doch stumm gehen sie ihren Weg. Taub gegen Gott und stumm gegen die Welt [...]. Sie verstummen“.45 Erklären wir noch mal, dass sowohl die reine ethische Valenz der Sprache als auch die reine theoretische und erkenntnistheoretische Valenz nicht der Sprache in ihrer bloßen Kommunikativen Funktion, sondern der ursprünglichen Sprache, d.h. der Sprache, die aus dem göttlichen Wort unmittelbar hervorkommt, angehören. Wie oben gesagt, entsteht mit dem Verfall des Menschen der Anfang der Geschichte, die auch die Geschichte der Sprachen ist. Entfernt sich die Sprache von der ursprünglichen Sprache – d.h. von der Idee – und degeneriert zum bloßen Kommunikationsmittel, wird der extreme Fall dieser Degenerierung von der Stummheit Ottilies und von der Unfähigkeit des Ausdrückens dargestellt. Anders gesagt: befindet sich der Mensch (nach Adam) von Natur aus bereits in einem „Mythischen Zustand“ der Trennung von der Idee, – deshalb wird die Sprache zum Kommunikationsmittel –, dann ist eine weitere Degenerierung dieses „natürlichen“ Zustandes der Verlust des Bewusstseins, dass die kommunikative Sprache (und damit jedes Phänomen) von der Idee abstammt. Daraus kann man schließen, dass es „einen anderen“ Mythos gibt, welcher nicht als Verfall des Menschen, der die Geschichte erschafft, verstanden werden muss. Sondern es handelt sich um einen Verfall, der als historischer Zustand verstanden werden muss, in dem der Mensch den Kontakt mit der Idee verliert. Dieser Zustand wird von Benjamin in den Schriften nach dem Trauerspielbuch als „Moderne“ – d.h. säkularisierter Mythos – bezeichnet. Wir haben gesehen, wie bei Benjamin mit der Sprache sowohl die Moral als auch die Erkenntnisfähigkeit des Menschen verbunden sind. Von da her ist die Eigenschaft des Menschen und sein Menschsein selbst mit der Sprache verbunden. In dem vorherigen Kapitel haben wir festgestellt, dass der Erlösungsprozess der Sprache in einer unendlichen Bewegung zu der Idee besteht. Wenn auch die Ethik mit der Sprache verbunden ist, sollten wir also daraus schließen, dass auch das Streben des Menschen, sich moralisch zu entwickeln, unendlich ist? In diesem Punkt erscheint wieder die Unterscheidung zwischen unmoralisch und amoralisch. Wir können sagen, dass die Überwindung des amoralischen Zustandes des 45 GS I/1 134. 139 Mythos von dem Bewusstseinszustand erreicht wird, dass die menschliche Sprache – ebenso wie jedes Phänomen – von der Idee herkommt, deren Manifestation sie ist. Dieser Übergang wird in Goethes Wahlverwandtschaften durch die Figur Ottilies dargestellt. Sie verkörpert nämlich die mythische Welt, die an ihre Grenzen gestoßen ist. Benjamin schreibt nämlich, dass in dieser Gestalt „der Roman der mythischen Welt zu entwachsen“46 ist. Dennoch deutet die Spitze des Mythos – d.h. seine Grenze – auf die „Hoffnung“ der Versöhnung und auf die Möglichkeit einer Ethik hin. Sehen wir nun in welchem Sinn, in dem wir auf den Begriff „Schönheit“ und ihr Verhältnis zur Wahrheit eingehen. Ottilie, erklärt Benjamin, ist reine Schönheit und letztere ist bloßer Schein. Im platonischen Phaedrus47 bringt die körperliche Schönheit das Gedächtnis desjenigen, der sie beobachtet, zur Idee der ewigen Schönheit, während die Anwesenheit Ottilies diese Erinnerung nicht erweckt. Die Schönheit Ottilies ist nämlich „das Erste und das Wesentliche“48. Mit anderen Worten ist die Manifestation des Schönen der Wesengehalt dieser Gestalt und das Zentrum des Romans selbst. So schreibt Benjamin: „Denn es ist nicht zu viel gesagt, wenn man die Überzeugung von Ottiliens Schönheit als Grundbedingung für den Anteil am Roman bezeichnet. Diese Schönheit darf, solange seine Welt Bestand hat, nicht verschwinden“.49 Und er fährt fort: “Denn der Schein ist in dieser Dichtung nicht sowohl dargestellt, als in ihrer Darstellung selber. Darum allein kann er so viel bedeuten, darum allein bedeutet sie so viel“.50 Außerdem beschreibt Benjamin in Goethes Wahlverwandtschaften den Begriff des Schönen: „Alles wesentlich Schöne ist stets und wesenhaft aber in unendlich verschiedenen Graden dem Schein verbunden. Ihre höchste Intensität erreicht diese Verbindung im manifest Lebendigen und zwar gerade hier deutlich polar in triumphierendem und verlöschendem Schein. Alles Lebendige nämlich ist, je höher sein Leben geartet desto mehr, dem Bereiche des wesentlich Schönen enthoben und in seiner Gestalt bekunden 46 GS I/1 173. Die Stelle des Phaedrus wird von Benjamin in GS I/1 178 eingefügt. 48 GS I/1 178. 49 GS I/1 178f. 50 GS I/1 187. 47 140 demnach dieses wesentlich Schöne sich am meisten als Schein. Schönes Leben, Wesentlich-Schöne und scheinhafte Schönheit, diese drei sind identisch“.51 Der Schein schöpft nicht das Wesen des Schönen aus, das laut Benjamin in einer Beziehung mit der Antithese des Scheins selbst - d.h. mit dem, was er als das „Ausdrucklose“ bezeichnet - notwendig ist: „Zum Schein nämlich steht das Ausdrucklose, wiewohl im Gegensatz, doch in derart notwendigem Verhältnis, dass eben das Schöne, ob auch selber nicht Schein, aufhört ein wesentlich Schönes zu sein, wenn der Schein von ihm schwindet. Denn dieser gehört ihm zu als die Hülle und als das Wesengesetz der Schönheit zeigt sich somit, dass sie als solche nur im Verhüllten erscheint. Nicht also ist, wie banale Philosopheme lehren, die Schönheit selbst Schein“.52 Benjamin macht hier einen weiteren Schritt: wenn er nämlich anfangs die Schönheit als Schein bezeichnet hat, sagt er jetzt, dass dieser nicht ihr einziger Inhalt ist. Das Schöne hat nämlich immer eine innere Beziehung mit dem Ausdruckslosen. Oder besser gesagt, das Schöne ist durch der dialektischen Union beiden zwei Elemente, dem Schein und dem Ausdruckslose gegeben. So schreibt Benjamin weiter: „Nicht Schein, nicht Hülle für ein anderes ist die Schönheit. Sie selbst ist nicht Erscheinung, sondern durchaus Wesen, ein solches freilich, welches wesenhaft sich selbst gleich nur unter der Verhüllung bleibt. [...] Der schöne Schein ist die Hülle vor dem notwendig Verhülltesten. Denn weder die Hülle noch der verhüllte Gegenstand ist das Schöne, sondern dies ist der Gegenstand in seiner Hülle. Enthüllt aber würde er unendlich unscheinbar sich erweisen. Hier gründet die uralte Anschauung, dass in der Enthüllung das Verhüllte sich verwandelt, dass es ‚sich selbst gleich’ nur unter der Verhüllung bleibend wird. [...] Weil nur das Schöne und außer ihm nichts verhüllend und verhüllt wesentlich zu sein vermag, liegt im Geheimnis der göttliche Seingrund der Schönheit. So ist denn der Schein in ihr eben dies: nicht die überflüssige Verhüllung der Dinge an sich, sondern die notwendige von Dingen für uns. Göttlich notwendig ist solche Verhüllung zu Zeiten, wie denn göttlich bedingt ist, dass, zur Urzeit enthüllt, in nichts jenes Unscheinbare sich verflüchtigt, womit Offenbarung die Geheimnisse ablöst“.53 51 GS I/1 194. Ibidem. 53 GS I/1 195. 52 141 Das Schöne ist also die Einheit von der Hülle und von dem Verhüllten. Auch in Ursprung des deutschen Trauerspiels deutet Benjamin – wie bereits gesehen – die Beziehung zwischen dem Schönen und der Wahrheit an. In der methodologischen Vorrede dieses Textes ist nämlich das Schöne – analog mit dem Phänomen – die Möglichkeit der Wahrheit sich zu verkörpern, und die Wahrheit ist das Refugium des Schönen – d.h. des Phänomens. In Goethes Wahlverwandtschaften ist das Verhältnis zwischen dem Schönen und der Wahrheit das Gleiche. Das, was sich ändert, ist die Perspektive Benjamins. Hat nämlich das Verhältnis Schönes-Wahrheit in dem Trauerspielbuch eine theoretische Valenz, erwirbt es in dem Essay über Goethe eine ethische. Die Schönheit Ottilies, schreibt Benjamin, muss sich auflösen: und diese Passage stellt einen Übergang dar. Oben haben wir gesehen, dass, solange das Universum des Romans andauert, die Schönheit Ottilies nicht verschwinden kann. Nun wird uns gesagt, dass sie sich auflöst. Sollen wir also daraus schließen, dass diese Passage das Ende des Mythos impliziert? Kehren wir jetzt zu dem Begriff des „Ausdruckslosen“ zurück. So schreibt Benjamin: „Im Ausdrucklosen erscheint die erhabne Gewalt des Wahren, wie es nach Gesetzen der moralischen Welt die Sprache der wirklichen bestimmt. Dieses nämlich zerschlägt was in allem schönen Schein als die Erbschaft des Chaos noch überdauert: die falsche, irrende Totalität – die absolute. Dieses erst vollendet das Werk, welches es zum Stückwerk zerschlägt, zum Fragmente der wahren Welt, zum Torso eines Symbols“.54 Das Ausdrucklose ist eine Unterbrechung, die dem Schein einen Stillstand auferlegt. Es ist die Wahrheit, die in der Schönheit aufbricht und ihre Harmonie unterbricht. Benjamin schreibt weiter: „So zwingt das Ausdrucklose die zitternde Harmonie einzuhalten und verewigt […] ihr Beben. In dieser Verewigung muss sich das Schöne verantworten, aber nun scheint es in eben dieser Verantwortung unterbrochen und so hat es denn die Ewigkeit seines Gehalts eben von Gnaden jenes Einspruchs“.55 Mit dem Tode Ottilies zieht sich jede scheinhafte Schönheit zurück, die – so Benjamin – „ja am Lebendigen einzig zu haften vermag“56. Das bedeutet aber nicht, dass die Wahrheit sich völlig enthüllt, sondern dass sie sich als Wesengehalt des Phänomens manifestiert. Die Figur 54 GS I/1 181. Ibidem. 56 GS I/1 197. 55 142 Ottilies, d.h. der reine Schein, stellt die Grenze des Mythos dar, und zwar den Gipfelpunkt, der die Möglichkeit einer Wiedererlangung dessen, was in dem Mythos abwesend scheint, erblicken lässt: d.h. die Wahrheit. Der Mythos ist nämlich nicht ganz von der Wahrheit der Idee getrennt. Das Phänomen, als Hülle, ist mit dem, was verhüllt ist (d.h. dem Wahren), immer unauflöslich verbunden: es gibt nicht die Hülle ohne das Verhüllte, ebenso wie das Verhüllte ohne die Hülle. Mit anderen Worten, es ist nicht möglich, dass sich das Phänomen rein manifestiert, ebenso wie es nicht möglich ist, dass sich die Idee an sich offenbart. Das eine braucht das andere. Aus dem mythischen Zustand herauszukommen heißt also nicht, zu der Idee in ihrer Reinheit, von dem Phänomen losgelöst, zu gelangen, sondern heißt vielmehr wieder imstande zu sein, die Idee anzusehen und wahrzunehmen, selbst bloß in ihrer begrenzten und unvollendeten phänomenalen Manifestation. Die „Versöhnung“, von der Benjamin in der Interpretation der Novelle, innerhalb des Romans Goethes spricht, ist also der Ausdruck seines ethischen Denkens, im Sinne einer Versöhnung mit der Idee. Ist die Überwindung des Mythos eine unendliche Aufgabe, kann also die Ethik – d.h. die Möglichkeit, die Idee als Grundlage des Phänomens und demzufolge der menschlichen Wahl und Aktion zu erkennen (d.h. zudem der Übergang aus der Amoralität zu dem, das die Moralität ermöglicht) – nichts anderes sein als eine Spannung eben in Richtung Idee: die völlige Verwirklichung dieser Spannung würde einen virtuellen Ausgang der Menschheit vom Mythos implizieren. Wie wir ebenfalls gesehen haben, als wir die Wahrnehmung der Idee in dem theoretischen Bereich betrachtet haben, ist sie auch in dem ethischen Bereich nicht auf einer allgemeinen Ebene möglich, sondern auf einer individuellen. Anders ausgedrückt, die Idee wird von denjenigen, die eine besondere Perspektive übernehmen, erblickt. Diese Perspektive wird von Benjamin „komplementär“ genannt und ist die Perspektive dessen, dem innerhalb des Mythos die vage und undeutliche Anwesenheit der Idee wahrzunehmen gelingt. Diese Perspektive wird, laut Benjamin, in der Wirklichkeit von Goethe übernommen, bei dem der moralische Kampf gegen den Mythos zur Versöhnung mit der ethischen Wahrheit im Roman und in der Fiktion durch die Figur Ottilies dargestellt und inszeniert wird. Zu diesem Punkt bleiben noch zwei Fragen offen: 1) Das Verhältnis zwischen der Erlösung, als menschliche Aufgabe verstanden, und der eigentlichen eschatologischen Erlösung. 2) Das Verhältnis zwischen dem Mythos und der Moderne. 143 3.3. Erlösung und Versöhnung Es ist interessant zu beobachten, dass im Laufe von Goethes Wahlverwandtschaften Benjamin von „Hoffnung auf Versöhnung“ – unten welchem Begriff er die Versöhnung der Gestalten der Novelle mit Gott meint – spricht und nur am Ende des Textes den Begriff der „Hoffnung auf Erlösung“ einführt. Der Begriff der „Hoffnung“, direkt auf die Erlösung bezogen, taucht also nur am Ende des Textes über Goethe auf: „So entringt sie [die Hoffnung] sich ihm [dem Schein] zuletzt und nur wie eine zitternde Frage klingt jenes ‚wie schön’ am Ende des Buches den Toten nach, die, wenn je, nicht in einer schönen Welt wir erwachen hoffen, sondern in einer seligen. Elpis bleibt das letzte der Urworte: der Gewissheit des Segens, den in der Novelle die Liebenden heimtragen, erwidert die Hoffnung auf Erlösung, die wir für alle Toten hegen“.57 Der Terminus „Versöhnung“ ist keineswegs ein Synonym für Erlösung58. Wir erforschen im Folgenden die Gemeinsamkeiten beider Begriffe und im Annschluss daran ihre Unterscheidungen. Zunächst spricht Benjamin sowohl in Bezug auf die Erlösung als auch auf die Versöhnung von „Hoffnung“. Dies bedeutet: auch die Versöhnung stellt sich für die Gestalten des Romans – und also für den Mythos – als eine „Hoffnung auf Versöhnung“ vor. Diese Präzisierung hat uns dazu gebracht, daraus zu schließen, dass auch die Versöhnung eine Idee ist, und dass der mythische Zustand die Bewegung zur Wiedererlangung der (ethischen) Idee und der Versöhnung mit ihr unendlich - und utopisch - macht. Sowohl die Versöhnung als auch die Erlösung sind Ideen. Dennoch gewinnt man den Eindruck, dass sie sich auf zwei verschiedenen Ebenen befinden. Können wir nun sagen, dass die Erlösung mehr Idee (d.h. im stärkeren Sinne Idee) als Versöhnung ist? Und da, sprechend über „Hoffnung auf die Erlösung“ und „Hoffnung auf Versöhnung“, eben der Terminus „Hoffnung“ denken lässt, dass Versöhnung und Erlösung auf zwei verschiedene Grade der Beziehung zwischen dem Menschen und der Idee hinweisen, dann könnte man also fragen, ob man auch eine Unterscheidung der Grade zwischen der Utopie (hinsichtlich der Verwirklichung der Ideen) der Erlösung und die der Versöhnung behaupten darf. Laut Adorno setzt die Philosophie 57 GS I/1 200. Roberts behauptet, dass bei Benjamin die Verwendung des Terminus „Versöhnung“ mit dem der „Erlösung“ gleich sei, und dass die Wahl des ersten eine Konsequenz der Lektüre Cohens sei (J. ROBERTS, op.cit. S.166ff.) Auch Adorno scheint den Begriff der Erlösung Benjamins auf den der Versöhnung zurückzuführen (vgl. TH. W. ADORNO, Charakteristik Walter Benjamin, in Über Walter Benjamin, op. cit. S.15f.). 58 144 Benjamins, vor allem in ihrer theologischen Phase, den Begriff des „Mythos als Gegensatz zur Versöhnung59. Später wäre der Begriff des Mythos säkularisiert60, aber immer noch anwesend. Adorno schreibt nämlich: „Die Versöhnung des Mythos ist das Thema von Benjamins Philosophie“61. Analysieren wir nun die Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen, um festzustellen, dass der Pol, der in der Philosophie Benjamins dem Mythos entgegensetzt wird, nicht die Idee der Versöhnung, sondern die der Erlösung ist. Ist die „Ethik“ bei Benjamin die Beziehung des Menschen, bzw. dessen Bewusstsein, mit bestimmten ethischen Prinzipien und Ideen, dann ist es folglich wahr, dass sowohl die Versöhnung als auch die Erlösung – da die beiden auf die Idee und auf die Spannung zu ihr hinweisen – der Gegensatz zum Mythos, d.h. dem Zustand der anscheinenden Abwesenheit der Idee, sein könnten. Der Begriff der „Erlösung bezieht sich aber in Vergleich zu dem der Versöhnung in radikaler Weise auf die Idee. Daraus schließt man, dass „Hoffnung auf Erlösung“ und „Hoffnung auf Versöhnung“ zwei verschiedene Spannungen sind. Wir haben festgestellt, dass, wenn wir voraussetzten, dass die Hoffnung auf Versöhnung die Möglichkeit für die Wiedererlangung der Beziehung mit der Idee und die Fähigkeit dazu, ihre Manifestationen in den Phänomenen zu erkennen, ist, dann können wir die Hoffnung auf Versöhnung als Idee bezeichnen. Hoffnung auf Erlösung im strikten Sinne bedeutet aber die Hoffnung der Menschheit, die auf ihre Befreiung von dem Schein und von dem Phänomen. Also, wenn die Erlösung eine vollendete und radikale Befreiung von dem Schein impliziert, ist die Versöhnung bloß das Symbol der wahren und eigentlichen Erlösung, weil sie auf die Möglichkeit hinweist, die Idee in dem Schein zu erkennen. Sie ist eine Antizipation der Erlösung. Zudem könnten wir sagen, dass die Hoffnung auf Erlösung ein Streben nach der vollendeten Auflösung des Phänomens in der Idee ist: Eine solche Hoffnung kann nur innengehabt werden von denjenigen, die sich des ontologischen Unterschieds zwischen der Idee und der phänomenalen Realität bewusst sind, d.h. denjenigen, denen es gelingt, in der Realität bloß eine Manifestation der Idee zu erkennen. Dies bedeutet, dass die Versöhnung die Voraussetzung für Erlösung ist. Betrachten wir noch mal die Unterscheidung zwischen Versöhnung und Erlösung. Zunächst scheint die Versöhnung eine individuelle Beziehung zur Idee zu bezeichnen62. In 59 Vgl. TH. W. ADORNO, op. cit. S15f. Bei dem „zweiten“ Benjamin wird laut Adorno das Schicksal vom Schuldzusammenhang des Lebendigen zum Schuldzusammenhang der Gesellschaft (vgl. TH. W. ADORNO, op. cit. S.15). 61 Ibidem. 62 In der jüdischen Tradition meint die „Versöhnung“ die individuelle Buße der Schuld. Der Tag der Versöhnung ist der Jom Kippur, der durch Fasten und Beten begangen wird, um die individuelle Buße der Schuld und die Versöhnung mit Gott zu erlangen (Vgl. S. PH. DE VRIES, Jüdische Riten und Symbole, Fourier Verlag, Wiesbaden 1981, S.94ff.) 60 145 Benjamins Philosophie kann die Versöhnung nur auf der individuellen Ebene möglich sein, während sie auf der allgemeinen utopisch ist (es würde in diesem Fall mit dem Ausgang der Menschheit aus dem Mythos zusammenfallen). Er behauptet nämlich, dass bestimmte Figuren in der Geschichte imstande sind, sich aus dem allgemeinen Zustand der Verblendung – des Mythos – ausnahmsweise hervorzuheben, um in ihm die Spur der Wahrheit – die nicht abwesen, sondern bloß verhüllt ist – wahrzunehmen. Dennoch beweist gerade die Außergewöhnlichkeit jener Figuren, die sich mit der Idee versöhnen, dass der Übergang von dem Mythos in die Idee unendlich und utopisch zu verstehen ist. Dieser Übergang wird als die Wiedererlangung des Sinnes und der Bedeutung des Phänomens und - auf der ethischen Ebene - als die Wiedererlegung der Autonomie gemeint. Die Erlösung, d.h. das eschatologische Ziel, welches das Verschwinden der phänomenalen Welt in der Idee mit sich führt, impliziert aber in seinem eigenen Begriff die Rettung der ganzen Menschheit und den definitiven Übergang des Phänomens in die Idee. Von da her ist die Erlösung ein weiter gefaßter Begriff verglichen zu dem der Versöhnung. Nach Benjamins Interpretation inszeniert die Novelle innerhalb der Wahlverwandtschaften die Versöhnung und eben nicht die Erlösung (und deshalb hat sie eine exemplarische Bedeutung). Zunächst, weil nur die Gestalten des Romans die Versöhnung erreichen und nicht die Menschheit in ihren Ganzen. Zweitens, weil sie uns zeigen, wie es als Versöhnte möglich ist, in der Welt des Scheins zu leben ist. So gewinnt die Novelle die Funktion des Beispiels für die Gestalten des Romans (d.h. für diejenigen, die im Mythos leben). Dennoch wird das Ende des Scheins - d.h. die eschatologische Rettung und die Befreiung von dem Schein und von der phänomenalen Vergänglichkeit - nur von der Idee der Erlösung impliziert. Die Novelle als Beschreibung der Versöhnung, und zwar als ethische Aufgabe zu interpretieren, bedeutet schließlich die Tatsache darzustellen, dass die Idee – wenn sie bekannt wird – tatsächlich in der phänomenalen Welt wirkt, indem sie die Entscheidungen und die Aktionen des Menschen leitet. Anders ausgedrückt, während die ethischen Ideen, obwohl sie Ideen sind, sich zum Teil in der Geschichte offenbaren können (d.h. wenn sie als Leitung der menschlichen Aktion übernommen werden), wird die Idee der Erlösung sich niemals in dem Phänomen verkörpern, da sie Idee im extremen Sinn ist. D.h. sie kann für den Menschen nur eine Idee sein, deren hypothetische Verwirklichung das Ende des Scheins und der Geschichte impliziert. Insofern ist die „Hoffnung auf Erlösung“ ein radikaler Begriff in Vergleich zu dem der „Hoffnung auf Versöhnung“. Kann man also behaupten, dass, wenn die Versöhnung eine innerweltliche Erlösung ist und zu einer Ethik hinführt (d.h. zur der ethischen Beziehung 146 Mensch-Idee), aber die Hoffnung auf Erlösung zu einer eschatologischen Ethik führt, d.h. zu einer absoluten Ethik, welche auf der einzigen Idee beruht, die sich nur mit dem Ende der Ethik völlig verwirklichen wird. Anders ausgedrückt, eine Ethik, die auf die Idee der Erlösung beruht, beruht nicht nur auf einer Idee, sondern vielmehr auf der absolut reinen Idee: D.h. auf der einzigen Idee, die per definitionem nicht Phänomen werden kann, weil sie sein Ende mit sich führt. 4. Intellektuelle Versöhnung als existentielle Antizipation der eschatologischen Erlösung In dem vorherigen Abschnitt haben wir die Beziehung zwischen der Erlösung und der Versöhnung bezüglich der Wiedererlangung der ethischen Werte analysiert. Die intellektuelle Erlösung (d.h. die Versöhnung) ist aber auch in einem anderen Sinn (der in dem vorherigen Kapitel kurz angedeutet wurde) eine Antizipation der eigentlichen Erlösung: in einem existentiellen Sinn. Wir erforschen nun genauer diesen Punkt durch das Bild des Engels, das, obwohl es nicht häufig explizit erscheint, die Allegorie der Philosophie Benjamins ist. Die erste Schrift, in der wir dem Bild des Engels begegnen, ist die Notiz aus dem Jahr 1933: Agesilaus Santander, die wir zuvor hinsichtlich des Begriffes des „Jetzt“ betrachtet haben. Der Engel der benjaminschen Schrift ist ein „Neuer Engel“. Er erschöpft sich, sein Leben dauert einen Augenblick lang und dann löst er sich im Nichts wieder auf. Der neue Engel ist aber nicht nur die Allegorie des Jetzt: er geht den Weg, der in die Zukunft führt. Er bewegt sich stoßweise in die Zukunft, die zugleich der Ort ist, woher er kommt: d.h. sein Ursprung. Er kehrt in die Zukunft zurück, indem er ihr aber seinen Rücken kehrt und sein Antlitz der Vergangenheit zuwendet, auf die er seinen Blick richtet.63 Wie in Agesilaus Santander beschreibt der Engel auch in der IX. These über die Geschichte64 eine Kreisbewegung des 63 Enrico Guglielminetti macht eine interessante Bemerkung über die jüdischen Termini für „Vergangenheit“ und „Zukunft“: auf Hebräisch ist die Vergangenheit mit dem Wort le-fanìm oder li-fnè bezeichnet. Es handelt sich um die Union der Präposition l – welche die Bedeutung von „vorne“ hat – mit dem Wort panim, dessen Hauptbedeutung „Antlitz“ ist. Der Ausdruck le-fanìm li-fnè bedeutet als „vor dem Antlitz“. Ist für die Juden die Vergangenheit „vorne“, d.h. vor Augen, ist die Zukunft umgekehrt ’acharìt, ’acharòn: Die Bedeutung dieses Ausdrucks ist nämlich „hinten“, „hinter dem Rücken“ (vgl. ENRICO GUGLIELMINETTI, Walter Benjamin: tempo, ripetizione, equivocità, Mursia, Milano 1990, S.150ff.) 64 So lautet die IX. These über die Geschichte: „Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ist ihm vor 147 Zurückehren in die Zukunft. Dies verweist auf die Bedeutung der intellektuellen Erlösung, d.h. auf die Aufgabe des Intellektuellen, der das Phänomen immer wieder erneut zu der Idee zurückzuführen hat. Das Bild des Engels stellt bei Benjamin aber auch das Symbol der Vergänglichkeit und des Endlichen dar: seine Anwesenheit ist blitzhaft, weil er immer bereit ist, zum Ort, woher er kommt (dem Ursprung), zurückzukehren. Der Zustand des Engels und folglich der des Philosophen, dessen Darstellung er ist, ist die Melancholie. Diese letztere ist nicht so sehr ein Gemütszustand, sondern vielmehr ein Begriff, der von Benjamin im Trauerspielbuch thematisiert wird: „Die Melancholie drückt in diesem Text die Lamentos des von dem Schwere des Gegenwartes verstricktes Geschöpften aus“, so kommentiert Cesare Cases in dem Vorwort der italienischen Ausgabe65. In Ursprung des deutschen Trauerspiels verbindet die Weltwahrnehmung des Barock die Melancholie – d.h. eine kontemplative hoffnungslose Haltung –mit der Allegorie – d.h. ästhetischer Ausdruck wird dem Symbol entgegensetzt, das in sich das Absolute enthält. Ihre Verbindung ist das Bewusstsein der Vergänglichkeit und des Verfalles, denen man nicht entgehen kann. Die Welt der Allegorie ist die Welt der Trennung und das Bewusstsein der Grenze, welche das Reich des Scheins und der zeitlichen Vergänglichkeit von dem der Transzendenz und der Totalität trennt. Eben die Beziehung zwischen der Totalität und dem Jetzt ermöglicht uns das Verhältnis zwischen der intellektuellen Erlösung und der eschatologischen Erlösung zu analysieren. Die zweite These über die Geschichte besteht aus zwei Teilen. Während in dem zweiten Teil Benjamin die Erlösung als Methode hinsichtlich der Wiedererlangung der Vergangenheit zugunsten eines neuen Begriffes der Geschichte betrachtet, wird die Erlösung in dem ersten Teil mit der Idee des Glückes assoziiert. Bevor wir auf die eschatologische Valenz, die der Begriff der „Erlösung“ in dieser These erwirbt, eingehen, ist es wichtig, bei einer anderen Stelle zu bleiben, in der Benjamin auf die Idee des Glückes hinweist, indem er über die Erlösung spricht. In Theologisch-politisches Fragment macht Benjamin eine Unterscheidung zwischen der Ordnung des Profanen, die das Reich der historischen Dynamis ist, und der Messianischen Ordnung. Das, worauf die historische Bewegung (und die Menschheit, die ihr Subjekt ist) zielt, ist das Glück: Diese historische Bewegung strebt zu der andauernden und unaufhörlichen Suche nach dem Glück als endlichem Ziel. Das Ziel der Menschheit in der Geschichte – d.h. das Glück – scheint sich anscheinend dem Reich Gottes die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügen verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Forschritt nennen, ist dieser Sturm. 65 Vgl. CESARE CASES, in WALTER BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1980, S.XIII. 148 entgegenzusetzen. Dieses kann nämlich nicht das Ziel der Geschichte sein, da es ihr Ende ist. So, während die Ordnung des Profanen als ein zur Idee des Glückes gerichteter Pfeil vorgestellt wird, entspricht der Messianischen Ordnung ein entgegengerichteter Pfeil. Dennoch nähern sich die beiden Pfeile einander. Das Profane, so schreibt Benjamin, ist nicht eine Kategorie des Reiches, sondern „eine Kategorie seines leisesten Nahens“, weshalb das Glück, das der Mensch anstrebt, als „restitutio in integrum“66 verstanden wird: d.h. die ursprüngliche Vollständigkeit und der Untergang der ewig vergänglichen Weltlichkeit. Das Profane schließlich – weil es von Natur aus fragmentarisch und vergänglich ist – strebt die Totalität an. Dennoch ist diese Totalität – und die Ewigkeit, die sie impliziert – nichts anderes als das Reich Gottes, d.h. die Unsterblichkeit und also das Ende der Geschichte. So schreibt Benjamin: „denn messianisch ist die Natur aus ihrer ewigen und totalen Vergängnis“67. In dem Fragment kommt zu Vorschein, dass die Spannung der Menschheit und ihre Hoffnungen der Zukunft zugewendet sind. Die Erlösung wird aber als restitutio in integrum verstanden, damit auf einen ursprünglichen Zustand verweisend. In der zweiten These über die Geschichte weist die Erlösung direkt auf die Vergangenheit hin: „Das Bild von Glück, das wir hegen, durch und durch von der Zeit tingiert ist, in welche der Verlauf unseres eigenen Daseins uns nun einmal verwiesen war. Glück, das Neid in und erwecken könnte, gibt es nur in der Luft, die wir geatmet haben, mit Menschen, zu denen wir hätten reden, mit Frauen, die sich uns hätten geben können. Es schwingt, mit anderen Worten, in der Vorstellung des Glücks unveräußerlich die der Erlösung mit“.68 Was haben denn die beiden Hinweise auf die Erlösung als eschatologische Hoffnung nun gemeinsam? Im ersten Teil der zweiten These ist die Erlösung auf die Vergangenheit bezogen, aber noch nicht bezüglich der historiographischen Methode. Das, was nun in den Worten Benjamins auftaucht, ist das menschliche Bedürfnis, die Vergangenheit als einen Inbegriff der Möglichkeiten, anstatt als einen Inbegriff von Fakten, zu beobachten. Nur diese Idee der Vergangenheit ermöglicht, die Wiedererlangung der vergangenen Ereignisse zumindest durch die Erinnerung zu denken. Die Hoffnung auf die Erlösung der Vergangenheit hat in diesem Fall einen existenziellen Gehalt, der auf die Eschatologie, d.h. auf die Versprechung der Rettung und des Glücks, auf welche die Menschheit hofft, verweist. Doch es ist bedeutsam, dass diese Hoffnung allerdings auf die Vergangenheit gerichtet ist und es ist 66 Ibidem Ibidem. 68 GS I/2 693. 67 149 eben dieser Punkt, der in dem sich die zweite These und das Fragment treffen. Versuchen wir nun zu erklären, was Benjamin meint, indem wir zu dem Begriff der „Totalität“ und deren Verhältnis zu dem Jetzt zurückkehren. Bei Benjamin stellt sich die Zeit als eine dialektische Spannung zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit dar. Diese Dialektik mündet in die Dimension – die ebenso dialektisch ist – zwischen der Totalität und dem Jetzt: der Bund zwischen diesen beiden zeitlichen Dimensionen taucht in der Figur des Agesilaus Santander auf, eben in Bezug auf das Glück. Der von Benjamin beschriebene Engel will das Glück, und zwar die Einheit des radikalen Neuen (d.h. des Jetzt) mit der Wiederholung (dessen, was bereits vergangen ist). Er will das Jetzt und die Totalität, die als die Möglichkeit der ewigen Wiederholbarkeit und der Fixierbarkeit des Jetzt verstanden ist. So schreibt Benjamin: „Er [der Engel] will das Glück: den Widerstreit, in dem die Verzückung des Einmaligen, Neuen, noch Ungelebten mit jener Seligkeit des Nocheinmal, des Wiederhabens, des Gelebten liegt. Darum hat er auf keinem Wege Neues zu hoffen als auf dem der Heimkehr“.69 Der Engel geht den Weg in die Zukunft, aber starrt in die Vergangenheit mit seinem melancholischen Blick, als ob er sie auf seiner Fahrt mitnehmen möchte. Die Erlösung, als eschatologische Hoffnung ist der Zukunft zugewendet, solange diese die Wiedererlangung der vergangenen Zeit verspricht. Die „Heimkehr“, auf welche sich die Hoffnung des Engels konzentriert, ist der metaphorische Ausdruck des existentiellen Bedürfnisses der Wiedererlangung der Vergangenheit. Kehren wir nun zu dem Begriff des restitutio in integrum zurück, von der Benjamin in dem Fragment spricht. Die Erlösung ist das Bedürfnis der Vollständigkeit und der Totalität, die von Natur aus die Menschheit anstrebt. Dennoch ist die angestrebte Totalität auch eine zeitliche Totalität: die Ewigkeit, d.h. die Mitanwesenheit von Vergangenheit und Zukunft in dem Jetzt. Mit anderen Worten, der in Agesilaus Santander beschriebene Engel, der heimkehren und in die Zukunft die Sachen und die Menschen, die nicht mehr sind, mitnehmen möchte, ist nichts anderes als das Symbol der Vergänglichkeit des Menschen. Ist eine Art des Ausdrucks dieser Vergänglichkeit der Zukunft zugewendet - und was darin besteht, die Endlichkeit des Menschen, der nicht ewig lebt und nicht ewig andauert, zu zeigen – ist die andere Art (welche Benjamin auswählt) an der Vergangenheit orientiert. Sie besteht in der Unmöglichkeit die Zeit anzuhalten, und demzufolge in der Unmöglichkeit zu zeigen, dass die Sachen einer un-wiedererlangbar und unrettbar vergangenen Vergangenheit angehören können. 69 GS VI 523. 150 Die Vergänglichkeit des Menschen ist also bei Benjamin die Unmöglichkeit, die vergangene Zeit wiederzuleben. Während nur die Erlösung – in ihrem eschatologischen Sinn – den Menschen aus seiner Endlichkeit und seinem ewig Vergangenen rettet, ist die intellektuelle Erlösung (und zwar das, was Benjamin Versöhnung nennt) nur das Symbol des eschatologischen Endes, und außerdem seine Antizipation. Die Erlösung zu antizipieren bedeutet, sowohl die existentielle Möglichkeit der Rückkehr in die Vergangenheit nach den dem Menschen erlaubten Grenzen (d.h. durch die Erinnerung) zu aktualisieren, als auch die – ethische und theoretische – Möglichkeit, zu der Beziehung mit der Idee innerhalb der phänomenalen Welt zurückzukehren. Die Vergangenheit durch die Erinnerung wiederzuerlangen, und also zu retten, bedeutet bei Benjamin nicht nur die theoretische Möglichkeit, einen neuen Begriff der Geschichte - der anders als der traditionelle ist – zu erschaffen, sondern auch die existentielle Gelegenheit, die erlebte Vergangenheit wiedererlangen zu können. Anders ausgedrückt, die intellektuelle Erlösung ermöglicht dem Menschen nicht nur die Hoffnung auf ein neues historisches Gedächtnis, sondern auch die Hoffnung auf ein existentielles. 5. Die doppelte ethische Wahrheit: die komplementäre Welt Das, was im Laufe der Arbeit aus dem Denken Benjamins hervorgehoben wurde, begegnet uns erneut, wenn wir sein ethisches Denken analysieren: Der Begriff der doppelten Wahrheit – den wir bisher oft bei der Analyse der benjaminschen Texte behandelt und erforscht haben – taucht nämlich in dem ethischen Denken wieder auf. Der Begriff der „Hoffnung“, im Bezug auf die Ideen der „Versöhnung“ und der „Erlösung“, hat uns zu dem Begriff der „unendlichen Aufgabe“ in seiner ethischen Bedeutung gebracht: D.h. die Erwerbung der Wahrheit und der ethischen Idee ist ein unendlicher Prozess, der niemals beenden wird, ebenso wie die Suche nach der Wahrheit und der theoretischen Idee. Dennoch gibt es auch in dem moralischen Bereich die Anwesenheit einer unmittelbaren Wahrnehmung der Wahrheit. Diese Möglichkeit ist denjenigen, die sich in der „komplementären Welt“ befinden, gegeben. D.h. sie wird dem Teil der Menschheit gegeben, der, obwohl er sich immer noch in dem Mythos befindet, trotzdem eine Perspektive gewinnt, die den Mythos von außer betrachtet. 151 Benjamin schreibt in einem Brief an Gershom Scholem70, dass Kafkas Werk eine Ellipse ist: „Deren weit auseinanderliegende Brennpunkte von der mythischen Erfahrung einerseits [...], von der Erfahrung der modernen Großstadtmenschen andererseits, bestimmt sind“.71 Dennoch hat eben der Zustand der Moderne Kafka erlaubt, einen Einblick zu erhalten: „Er lebt in einer komplementären Welt“72. Das ist nämlich die Perspektive, die erlaubt, die umgebene Welt von außen zu beobachten und ihre Aspekte – die normalerweise demjenigen, der innerhalb dieser Welt bleibt, verborgen bleiben – wahrzunehmen. Der Fall von Kafka ist laut Benjamin exemplarisch: Kafka hat nämlich diese privilegierte Perspektive gewonnen, indem er versucht hat, der Tradition zuzuhören73. Das, was er aber gehört hat, war undeutlich und unklar, wie ein weiterentferntes Echo, das von dem Lärm des neuen Zeitalters - der Moderne - übertönt wird. Das ganze Werk Kafkas stellt laut Benjamin die Erkrankung der Tradition dar. D.h. Kafka beschreibt die Realität, in der die Konsistenz der Wahrheit verloren gegangen ist und die sich zerstreut (dies wird z.B. in der Novelle Das Schloss dargestellt, in dem die Menschen die Wahrheit über die Natur des Schlosses erkennen wollen, aber jeder hat seine eigene Meinung darüber, die eben der der anderen widerspricht.) Das Genie Kafkas, so schreibt Benjamin, besteht darin aus dieser Erkrankung das Thema seiner Erzählungen entwickelt zu haben. Die Konsequenz dieser Erkrankung besteht in der Tatsache, dass in unserer Zeit von Weisheit nicht mehr die Rede sein kann, sondern man hat mit seiner Zersetzung zu tun. Diese Zersetzung stellt zwei Produkte her: einerseits „das Gerücht von den wahren Dingen“ - und zwar dass die Dinge wahr erscheinen, weil man sie so gehört hat – und 70 Vgl. GB, Bd. VI 105ff. (Brief des 12. Juni 1938) GB, Bd. VI 110. 72 GB, Bd. VI 112. 73 In dem Essay Franz Kafka gewinnt der Begriff der Tradition eine andere Bedeutung. Während nämlich in den Thesen über den Begriff der Geschichte die Tradition für Benjamin – wie oben gesagt – die schlechte Überlieferung der Geschichte ist, ist die Tradition in Franz Kafka mit dem Judentum verbunden. Das, was hier den Begriff der Tradition kennzeichnet, ist nämlich die Nähe zu der Idee und zu der Wahrheit, die nach und nach verloren gegangen ist. „Tradition“ ist also ein Synonym von Idee und von Wahrheit, die in der Moderne verloren gehen. Deshalb ist die „Tradition“ als „wahre Tradition“ zu bezeichnen, im Gegensatz zu der „falschen“. Der Essay über Kafka und ein Teil von dem Briefwechsel mit Scholem drehen sich um das Thema der Tradition und um ihren progressiven Verlust. Die „wahre Tradition“ wird laut Benjamin falsch überliefert und deshalb bleibt eine leere und sinnlose Form. In einem Brief an Scholem spricht Benjamin hinsichtlich des Werkes Kafka von dem „Nichts der Offenbarung“. Dieser Ausdruck bedeutet nämlich den Verlust des Sinnes: die Tradition ist zwar immer noch anwesend, aber wird von ihrem Gehalt entleert. Sie gilt noch, bedeutet aber nichts mehr (vgl. Brief vom 20.9.1934 in BW 175). Das „Gesetz“ verliert also seine ursprüngliche Bedeutung von „Lehre“ und wird zum bloßen Gesetz. Über die Bedeutung von „Lehre“ verweise ich auf den oben zitierten Text von Roberts, S. 142ff.) 71 152 das andere Produkt dieser Diathese ist die Torheit, die viele Figuren Kafkas kennzeichnet74. Laut Benjamin ist das Werk Kafkas der Spiegel der zeitgenössischen Gesellschaft – d.h. der Moderne – und die Rettung von dieser Zeit ist also die Offenheit und die Aufmerksamkeit für den Sinn (und dies heißt also die Wiederentdeckung des Sinnes) und die Hoffnung auf eine Rückkehr zu einem ursprünglichen und eigentlichen Zustand, der mittlerweile versunken ist. Zu diesem Punkt machen wir nun zwei Überlegungen. Die erste: auch auf der ethischen Ebene existiert eine enge Elite, die noch im Stande ist, innerhalb der Moderne, selbst wenn undeutlich, die Idee wahrzunehmen. Die komplementäre Perspektive wird laut Benjamin von bestimmten Figuren gewonnen: z.B. von Goethe (der, wie oben gesagt, gegen den Mythos kämpft), von Kafka, von Baudelaire (der die Aura wahrnimmt und man bei ihm eine Distanzierung von der Menge erkennt), aber auch von Leskov75 und von Paul Klee76. Die Rettung vor der Moderne scheint also eine Aufgabe des Intellektuellen zu sein, der durch die Literatur, die Dichtung, die Kunst und die Philosophie das zeigt, was die Moderne nicht mehr sehen kann. Hierfür ist die kurze Schrift Erfahrung und Armut aus dem Jahr 1933 interessant, in der Benjamin innerhalb der zeitgenössischen Gesellschaft eine ankommende „neue Armseligkeit“ bemerkt, in der aber nur die Künstler einen Rettungsschimmer sehen können. So schreibt nämlich Benjamin: „Eine ganz neue Armseligkeit ist mit dieser ungeheueren Entfaltung der Technik über die Menschen gekommen. Und von dieser Armseligkeit ist der beklemmende Ideenreichtum, der mit der Wiederbelebung von Astrologie und Yogaweisheit, Christian Science und Chiromantie, Vegetarianismus und Gnosis, Scholastik und Spiritualismus unter – oder vielmehr über – die Leute kam. [...] Diese Erfahrungsarmut ist Armut nicht nur an privaten sondern an Menschheitserfahrungen überhaupt. Und damit eine Art von neuen Barbarentum“.77 Eben dieses Barbarentum führt laut Benjamin dazu, wieder von Neuen anzufangen: „Und dieses selbe Vonvornbeginnen hatten die Künstler im Auge. […] Hie und da haben die besten Köpfe begonnen, sich ihren Vers auf diese Dinge zu machen. Gänzliche Illusionslosigkeit über das Zeitalter und dennoch ein rückhaltloses Bekenntnis zu ihm ist ihr Kennzeichen“.78 74 Vgl. GB, Bd. VI 112. Vgl. GS II/2 438ff. 76 Vgl. GB, Bd. VI 112. In dem Brief wird Paul Klee mit Kafka verglichen. Schreibt Benjamin: „Kafka lebt in einer komplementären Welt. (Darin ist er genau mit Klee verwandt, dessen Werk in der Malerei ebenso wesenhaft vereinzelt dasteht wie das von Kafka in der Literatur)“ (Ibidem). 77 GS II/1 214. 78 GS II/1 215f. 75 153 In diesem kurzen Text ist also eine der prägnanten Beschreibung der Moderne zu finden. Benjamin schreibt: „Natur und Technik, Primitivität und Komfort sind hier vollkommen eins geworden und vor den Augen der Leute, die an den endlosen Komplikationen des Alltags müde geworden sind und denen der Zweck des Lebens nur als fernster Fluchpunkt in einer unendlichen Perspektive von Mitteln auftaucht“.79 Die zweite Überlegung ist die folgende: das, was Benjamin „Moderne“ nennt, ist nichts anderes als der Mythos. Beide Termini verweisen auf den Zustand, in dem das Phänomen die Idee aus dem Blick verloren hat: von dem theoretischen Gesichtspunkt aus heißt es, wie oben gesagt, aufgestellten und von der Tradition etablierte Wahrheiten zu akzeptieren und die Suche nach der Wahrheit aus dem Blick zu verlieren; von dem ethischen Gesichtspunkt aus bedeutet es die scheinbare Abwesenheit der Werte, der Verantwortung und der Entscheidungsfähigkeit. Beide Begriffe drücken also die Entfernung von der Idee aus, aber während die Moderne eine historische Konnotation hat (d.h. das Zeitalter der Technik), hat der erste eine existentielle Bedeutung: er äußert nämlich menschliche Konnotationen, die unabhängig von den historischen Epochen sind. 6. Der Mythos und die Vergessenheit Die ethische Aufgabe des Intellektuellen ist, die Prinzipien, die Werte und die ethische Ideen in einer Epoche, in der all das unmöglich erscheint, wahrzunehmen. Aus diesem Grund – wie oben gesagt – spricht Benjamin von „Hoffnung“ auf Versöhnung. Der Begriff der „Hoffnung“ bringt uns zu der zeitlichen Dimension, der wir bisher explizit in den Formen der Gegenwart (nämlich das Jetzt) und der Vergangenheit (das Gewesene) begegnet sind, zurück. Der Begriff der „Hoffnung“ und die ethische Idee bringen uns also zu der dritten zeitlichen Dimension: zu der Zukunft, in ihrer ideellen Form des „Wartens“. Diese Zukunft des Wartens ist von Benjamin als die Rückkehr zum Ursprung gemeint, nach der Formel: Ursprung ist das Ziel. Rückkehr zum Ursprung bedeutet in diesem Zusammenhang die Rückkehr zu einem 79 GS II/1 218. 154 ursprünglichen aber utopischen80 Zustand, in dem die Moralität möglich ist, da die Werte und die ethische Ideen (noch) nicht verschleimt sind. Die benjaminschen Begriffe „Hoffnung auf Versöhnung“ und „Hoffnung auf Erlösung“ drücken also die Utopie der Rückkehr, in der Form der Erinnerung aus. Das Warten - auf die Erlösung – ist mit den anderen beiden Begriffen der Temporalität verbunden: mit der Vergangenheit, weil es der Vergangenheit im Sinne vom „Ursprung“ zugewendet ist (d.h. das Gewesene – das was gewesen ist – erwirbt außerdem die Bedeutung von dem, „was ursprünglich war“) und mit der Gegenwart, die auch in diesem Fall das Jetzt der Wahrnehmung der Idee ist: die Wahrnehmung der Idee wird allerdings dem Intellektuellen, dem Künstler und dem Philosophen ermöglicht. Gegenteil der Erinnerung ist das Vergessen, und das Vergessen der ethischen Idee wird bei Benjamin durch den Mythos dargestellt. Der Begriff des „Vergessens“ ist zentral in der benjaminschen Interpretation von Kafkas Werken. In dem Essay Franz Kafka schreibt Benjamin, dass hinsichtlich der Erlösung nur für „die Unfertigen und Ungeschickten“81, für die Ausgeschlossenen in der Familie oder für die Beamten (die Bewohner der Welt des Gesetzes82), Hoffnung da ist. Der Vater in den Erzählungen Kafkas ist immer der Strafende und zugleich der Ankläger. Über diese Figur schreibt Benjamin: „Der Vater ist der Strafende. Ihn zieht die Schuld wie die Gerichtsbeamten an“.83 Laut Benjamin sind die Väterwelt und die Beamtenwelt die gleiche: sie besteht aus Stumpfheit, Degradation und Schmutz84. Außerdem scheint die Sünde, deren der Vater den Sohn bezichtigt, „eine Art von Erbsünde zu sein“85, sie hat eine mythische Natur. So schreibt er: „Der Vater in den sonderbaren Familien Kafkas von dem Sohn sein Leben, liegt wie ein ungeheuerer Parasit auf ihm. Er zehrt nicht nur an seiner Kraft, er zehrt an seinem Rechte dazusein. Der Vater, der der Strafende ist, ist zugleich auch der Ankläger. Die Sünde, deren er den Sohn bezichtigt, 80 Im Bezug auf die Zukunft als Ursprung ist bei Benjamin ein Einfluss des jüdischen Denkens möglich. Wie es bereits oben angedeutet wurde, hatte die Erlösung in dem Judentum auch die Form der Rückkehr zum ideellen Zeitalter des Tempels von David. Vgl. G. SCHOLEM, Über einige Grundbegriffe des Judentums, Suhrkamp, Frankfurt/M. Kapitel III und IV. 81 GS II/2 415. 82 Vgl. GS II/2 411 und 410-413 über die Ähnlichkeit bei Kafka zwischen der Welt der Väter und der Beamtenwelt. 83 GS II/2 411. 84 Vgl. GS II/2 411. 85 GS II/2 412. 155 scheint eine Art von Erbsünde zu sein. Denn wen trifft die Bestimmung, welche Kafka von ihr gegeben hat, mehr als der Sohn: ‚Die Erbsünde, das alte Unrecht, das der Mensch begangen hat, besteht in dem Vorwurf, den der Mensch macht und von dem er nicht ablässt, dass ihm ein Unrecht geschehen ist, dass an ihm die Erbsünde begangen wurden’. Wer aber wird dieser Erbsünde – der Sünde einen Erben gemacht zu haben – bezichtigt wenn nicht der Vater durch den Sohn? Somit wäre der Sündige der Sohn“.86 In beiden Fällen, in der Familie und in der Gerichtswelt, ist die Sünde, deren man bezichtigt wird, eine Art von Erbsünde, der man ebenso nicht entgegen kann wie dem Schicksal. Somit ist K., die Hauptfigur des Prozesses, von dieser Sünde betroffen: gegen sie ist jeder Schutz vergeblich, da sie aus dem Mythos herkommt, oder besser, da sie Mythos ist. Wohl gibt es Gesetze und Normen, die aber nicht geschrieben sind, da sie auch der Welt des Mythos angehören. Übertritt der Mensch diese Gesetze, ohne es zu wissen, begegnet ihm notwendigerweise die Strafe, welche die Form des Schicksals hat. Derjenige, der sich in diesem absurden Mechanismus befindet, kann nicht anders, als diese Sünde still zu akzeptieren. Von dieser Sünde wird er aber bestimmt: Die Gesetze des Mythos erklären den Menschen für schuldig und sie verdammen ihn zur Isolierung. Mit anderen Worten, er wird von der Gesellschaft verleugnet und gezwungen in einer komplementären und parallelen Welt zu leben. Die komplementäre Welt ist nicht ganz außerhalb des Mythos, dennoch ist sie nicht mehr Mythos. Denn von letzterem wurde er entfernt. Die Gestalten Kafkas, die aus ihrer rigiden und sinnlosen Gesellschaft (d.h. dem Mythos) herauszukommen versuchen, werden als verkrüppelt und als entstellt dargestellt. Eines der von Benjamin zitierten Beispiele ist das von Gregor Samsa, der Gestalt der Metamorphosen, der eines Morgens aufsteht und sich als Insekt verwandelt findet. Er ist wohl der Prototyp desjenigen, der am Rand der Gesellschaft lebt, die ihn ausgeschlossen hat. Deshalb widert seine Figur die Familie an, die sich für ihn so sehr schämt, so dass sie ihn in einem abgeschlossenen Zimmer, versteckt und darauf aufpasst, dass niemand ihn sieht. Diese und die anderen sonderbaren Figuren Kafkas sind die Kopie des Flaneurs. Wie der Flaneur leben ebenso die Gestalten Kafkas zwischen zwei unterschiedenen Realitäten, zwischen zwei Menschengruppen: der Moderne einerseits und andererseits denjenigen, die im Stande sind, in gewissen Momenten die Moderne selbst von außen zu beobachten, in ihr nach einem Ausgang suchend – und ihn auch erblickend. Laut Benjamin sind diese Menschen (die in den Erzählungen Kafkas unmenschliche Züge annehmen) Boten87, die noch nicht ganz aus der Welt des Mythos herausgekommen sind, aber eben 86 87 GS II/2 411f. Vgl. GS II/2 415. 156 innerhalb des Mythos die Hoffnung der Erlösung, die ihm versprochen wurde, ankündigen88. Laut Benjamin ist die Welt des Mythos das Reich des Vergessenen: „Das Vergessen ist niemals ein nur individuelles. Jedes Vergessene mischt sich mit dem Vergessenen der Vorwelt, geht mit ihm zahllose, ungewisse, wechselnde Verbindungen zu immer wieder neuen Ausgeburten ein“.89 Das Vergessene ist also der Mythos (und die Moderne), in dem die seltsamen Figuren wie z.B. Gregor Samsa und K. ihr menschliches Bewusstsein verloren haben und, so könnte man sagen, die Form der Menschheit selbst vergessen haben. Dennoch verweist ihre Verkrüppelung, laut Benjamin, eben auf das Bewusstsein dieser Situation. D.h. die Entstellung manifestiert sich gerade in denjenigen, die wissen – oder mindestens „fühlen“ –, dass sie aus dem Entfremdungs- und Vergessenheitszustand, zu dem ihre Zeit verurteil ist, herauskommen sollen. Jeder Versuch einer solchen Tat ist aber vergeblich. Das Vergessene, ebenso wie die Schuld, verwandelt die Dinge, entstellt sie und macht sie unerkennbar. Der Prototyp dieser Entstellung ist der Bucklige, dessen Entstellungen mit der Ankunft des Messias – verschwinden werden: „Niemand sagt ja, die Entstellungen, die der Messias zurechtzurücken einst erscheinen werde, seien nur solche unseres Raums. Sind sie gewiss auch solche unserer Zeit“.90 Diese „unsere Zeit“ , das Zeitalter „der aufs Höchste gesteigerten Entfremdung des Menschen voneinander, der unabsehbar vermittelten Beziehungen, die ihre einzigen wurden“91, dieses Zeitalter des Vergessens des Menschen von sich selbst und von seiner Vergangenheit, eben diese Zeit verweist auf eine Rettungsmöglichkeit92. 88 Ibidem GS II/2 430. 90 GS II/2 433. 91 GS II/2 436. 92 Die Idee, dass von dem Gipfel des Mythos die Idee der Erlösung entstehen kann, ist wiederum eine jüdische. Scholem behauptet, dass die Idee der Erlösung nicht aus Zufall entsteht, sondern sich in einer Gesellschaft verkörpert, deren gesellschaftlicher und politischer Zustand den negativen Gipfel der Parabel seines Geschichtsverlaufes erreicht. 89 157 6.1 Die zwei Bedeutungen des Vergessens und die Weisheit der Erinnerung Ich habe behauptet, dass die Möglichkeit der Wiedererlangung der Vergangenheit, durch die Erinnerung, als Antizipation der Erlösung gelesen werden kann. Die Erlösung, als Idee des Glücks, ist das ewige Ziel der Menschheit, die von ihrer Natur her an das Ende der Vergänglichkeit strebt. Diese impliziert nämlich das Vergessen der Vergangenheit. Während die Erlösung zum Ende der phänomenalen Welt, die in der Ewigkeit der Idee eingeschlossen und gerettet wird, führt, ist die Gerechtigkeit – d.h. die Wiedererlangung der Idee in der phänomenalen Welt, Symbol der Erlösung und führt zur Weisheit. Machen wir nun einige Überlegungen über die Begriffe „Weisheit“ und „Erinnerung“ mittels der Figur des „bucklichten Männleins“, das sowohl in einer der Erzählungen der Sammlung Benjamins Berliner Kindheit um Neunzehnjahrhundert als auch als Titel eines Kapitels des Essays Franz Kafka auftaucht. Das „bucklichte Männlein“ ist „der Insasse des einstellten Lebens“93, und es wird verschwinden, wenn der Messias kommt94. Es ist der Darsteller der Unfertigen, der Ungeschickten, für die aber die Hoffnung da ist95. Die Figur des „bucklichten Männleins“ symbolisiert das Vergessene96, das – wie oben gesagt – die Umrisse der Vergangenheit entstellt und die Grenzen der Moderne bestimmt, d.h. einer Menschheit, welche die Form der Menschheit selbst vergessen und verloren hat. Somit ist sie zum bloßen natürlichen Leben verfallen. Mit anderen Worten, das Vergessene verweist wiederum auf den Zustand der degenerierten Beziehung zwischen dem Menschen und der Idee. In der Philosophie Benjamin hat das Vergessen aber zwei Bedeutungen. Die erste meint einen natürlichen Zustand, d.h. die Vergänglichkeit des Menschen, zu welcher der Verlust der Vergangenheit verurteilt ist. Diesem Zustand entspricht die Erlösung, als das Ende der ewig vergänglichen Zeit verstanden. Dennoch drückt die zweite Bedeutung des Vergessens einen unnatürlichen Zustand aus, d.h. den Gipfel des Mythos, der – von der Idee beraubt - in dem bloßen Schein lebt. Diesem Zustand entspricht die Versöhnung, d.h. der Ausgang aus dem Mythos und die Wiedererlangung der Idee in der Welt des Scheins. Das „bucklichte Männlein“ des benjaminschen Essays über Kafka zeigt eben diesen mythischen Zustand, über den hinaus keine weitere Degenerierung möglich scheint. Deshalb ist dieser 93 GS II/2 432. Ibidem 95 Vgl. GS II/2 415. Es ist interessant das zu bemerken, was Benjamin über die Hoffnung in Goethes Wahlverwandtschaften schreibt und zwar dass: „die letzte Hoffnung niemals dem eine ist, der sie hegt, sondern jenen allein, für die sie gehegt wird“ (GS I/1 200). Dies bedeutet, dass nicht der Mythos auf die Erlösung hofft, sondern allein diejenigen, die aus dem Mythos herauszukommen beginnen und in ihm die Idee erblicken. 96 Vgl. GS II/2 428ff. 94 158 Zustand zugleich das Symbol der Hoffnung und der Möglichkeit aus der Moderne herauszukommen. Analysieren wir nun die andere Figur des „bucklichten Männleins“, das in der letzten Erzählung von Berliner Kindheit um Neunzehnhundert, „Das bucklichte Männlein“ betitelt ist. Das „bucklichte Männlein“ der Erzählung Benjamins ist die Figur eines Kinderreims. Zudem ist er das Behältnis der Vergangenheit. Ich zitiere kurz das, was Benjamin darüber schreibt: „Wo es erschien, da hatte ich das Nachsehn. Ein Nachsehn, dem die Dinge sich entzogen, bis aus dem Garten übers Jahr ein Gärtlein, ein Kämmerlein aus meiner Kammer und ein Bänklein aus der Bank geworden war. Sie schrumpften, und es war, als wüchse ihnen ein Buckel, der sie selber nun der Welt des Männleins für sehr lange einverleibte. Das Männlein kam mir überall zuvor. Zuvorkommend stellte sich’s in den Weg. Doch sonst tat er mir nichts, der graue Vogt, als von jedwedem Ding, an das ich kam, den Halbpart des Vergessens einzutreiben. [...] So stand das Männlein oft. Allein, ich habe es nie gesehen. Er sah nur immer mich. Und desto schärfer, je weniger ich von mir selber sah. Ich denke mir, dass jenes ‚ganze Leben’, von dem man sich erzählt, dass es vorm Blick der Sterbenden vorbeizieht, aus solchen Bildern sich zusammensetzt, wie sie das Männlein von uns allen hat. Sie flitzen rasch vorbei wie jene Blätter der straff gebundenen Büchlein, die einmal Vorläufer unserer Kinematographen waren. Mit leisem Druck bewegte sich der Daumen an ihrer Schnittfläche entlang; dann wurden sekundenweise Bilder sichtbar, die sich voneinander fast nicht unterschieden. [...] Das Männlein hat die Bilder auch von mir. [...] Jetzt hat es sine Arbeit hinter sich. Doch seine Stimme [...] wispert über die Jahrhundertschwelle mir die Worte nach: ‚Liebes Kindlein, ach, ich bitt, / Bet fürs bucklicht Männlein mit“.97 Benjamin schreibt, dass das „bucklichte Männlein“ unser aller Bilder besitzt. Zwei Bemerkungen: Zunächst ist mit dem Männlein in diesem Fall das Vergessensgespenst in der ersten Bedeutung gemeint, d.h. es stellt den natürlichen Verlust der Vergangenheit dar. Zweitens kann man daraus schließen, dass die Weisheit darin besteht, das Leben und die Geschichte durch einen Rückblick zu beobachten - ebenso wie es in der Todesstunde zu geschehen scheint – und durch diesen Überblick die vom Vergessenen absorbierten Bilder wiederzuerlangen. Dem gleichen Hinweis auf die Weisheit und auf den Lebensrückblick sind wir bezüglich der Briefsammlung Deutsche Menschen in dem vorherigen Kapitel begegnet. Kehren wir nun zu der Unterscheidung zurück, die wir bezüglich des Begriffs der „Erlösung“ hervorgehoben haben. Ist es in einem Fall allein die eschatologische Erlösung (als 97 GS IV/1 303f. 159 restitutio in integrum), die die Menschheit vor der Grenze ihrer Endlichkeit und vor der Vergänglichkeit rettet, ist in dem anderen Fall (als innerweltlichen und menschlichen Erlösung) die Versöhnung das Symbol des eschatologischen Endes und außerdem ihre Antizipation. Die Erlösung zu antizipieren heißt: 1) sowohl die Möglichkeit, zu der Vergangenheit innerhalb der menschlichen Grenze (d.h. durch die Erinnerung) zurückzukehren, d.h. sie zu aktualisieren, als auch 2) die Möglichkeit, zu der Beziehung zur Idee innerhalb der phänomenalen Welt zurückzukehren: das bedeutet also die Spannung in der Überwindung der Moderne und das Wiederentdecken des Sinnes. Die Antizipation der Erlösung hat also sowohl eine existentielle Valenz als auch eine ethische. Ist die Grenze der Menschheit die Gegenwart mit dem Bewusstsein zu leben, nämlich dass alles vergänglich ist und dass alles Vergangenheit wird, die Menschen und Dinge mit sich wegführt, so ist die Größe des Menschen die Weisheit. Letztere besteht darin, das Leben und die Geschichte als Totalität zu beobachten, deren Fragmente wiederzuerlangen möglich ist. Die Weisheit führt uns also zu dem Blick des Agesilaus Santanders zurück, welcher die Vergangenheit melancholisch anstarrt, da er sie in die Zukunft nicht mitnehmen kann. Sondern er muss sich mit der Hoffnung begnügen, sie durch die Erinnerung wiederzuerleben. Insbesondere ist zu bemerken, dass die Erinnerung im Judentum – wie oben gesagt – mit dem Studium verbunden ist. D.h. die Vorschrift der Erzählung verweist nicht nur auf ein bloßes erzählen der Geschichte, sondern impliziert ihre Studium98. In dem benjaminschen Essay Franz Kafka begegnen wir dem Begriff des „Studiums“: „Die Pforte der Gerechtigkeit ist das Studium“99. Diese Aussage ist sehr bedeutsam. In diesem Text geht es Benjamin nämlich um die utopische Möglichkeit, zur Tradition durch das Studium, das der einzige Heimweg scheint, zurückzukehren. Mit der oben zitierten Aussage betont Benjamin den ethischen Aspekt der Rückkehr durch die Erinnerung zum Ursprung: das Studium, auf die Wiedererlangung der Vergangenheit gezielt, ist die Aufgabe nicht nur des Philosophen, sondern jedes Menschen. Diese Überlegungen führen uns zu dem, was wir oben festgestellt haben, als wir die Bedeutung von Hoffnung bezüglich der ethischen Aufgabe des Menschen betrachten haben. Da haben wir die folgende Schlussfolgerung gezogen: die „Hoffnung auf Versöhnung“ zeigt, laut Benjamin, den Kampf des Menschen gegen die Herrschaft des Mythos, um die Idee der Gerechtigkeit zu erreichen. Ihrerseits meint diese die Rückkehr zu der Idee, d.h. zu der Möglichkeit, dass die Idee in der phänomenalen Welt wirkt, indem sie die Aktionen und die 98 So schreibt Soloveitchik: „We are challenged to become students, not merely readers, to probe the Biblical text in depth and to interpret it in accordance with the teachings of the Oral Law” (JOSEPH B. SOLOVEITCHIK, op. cit. S212). 99 GS II/2 437. 160 Wahl des Menschen leitet. Dies bedeutet, dass die ethische Aufgabe der Menschheit die Wiedererlangung der Idee der Menschheit selbst ist, d.h. die Rückkehr zu dem ursprünglichen und zugleich ideellen Zustand. Da nun die ethische Aufgabe der Menschheit auf eine unendliche Bewegung (die der Rückkehr zum Ursprung und zur Idee) beruht, impliziert sie zugleich die beiden zeitlichen und ideellen Dimensionen der Vergangenheit und der Zukunft. Deshalb ist es nicht falsch die Ethik Benjamins zugleich als „Ethik des Wartens“ und „Ethik der Erinnerung“ zu bezeichnen: meiner Meinung nach ist dies die einzige Möglichkeit innerhalb des Mythos und der Moderne über Ethik zu reden. Benjamin schreibt bezüglich einer Erzählung Kafkas: „‚Überall’, sagt Plutarch, ‚wird bei Mysterien und Opfern, sowohl unter Griechen als unter Barbaren, gelehrt [...], dass es zwei besondere Grundwesen und einander entgegengesetzte Kräfte geben müsse, von denen das eine rechter Hand und geradeaus führt, das andere aber umlenkt und wieder zurücktreibt“.100 Die Erlösung scheint also ein Kreis zu sein, dessen Dimension der Zukunft zugänglich ist, nur indem man den Blick der Vergangenheit wendet und nur wenn man von der Erinnerung aus gegen einen Sturm „der aus dem Vergessene herweht“,101 fortfährt. 7. Ethik als Utopie Ich habe oben behauptet, dass das Denken Benjamins im Laufe der Jahre „phänomenaler“ wird und die anfänglichen Ansprüche, eine Idee sein zu können, aufgibt. Es nähert sich allmählich einer bescheideneren Konzeption von sich selbst. Und dies nicht nur hinsichtlich einer Erkenntnistheorie, sondern auch des ethischen Denkens: Der jugendliche pathos in Bezug auf eine reine, entgegensetzte der traditionalen Ethik wird also nach und nach aufgegeben. Bleibt also das Thema der individuellen Verantwortung gegenüber der Idee; dennoch taucht in diesen Schriften das moralische Prinzip der Hoffnung auf eine Ethik, d.h. die Hoffnung auf eine Wiedererlangung der ethischen Werte, die in der Moderne eben 100 101 GS II/2 437. Ibidem. 161 verblendet scheinen, auf. Die Philosophie Benjamins wird also immer mehr eine Spannung zu der Idee, und dies führt sie zu dem Bewusstsein einer von ihr unendlichen Entfernung, welche die Möglichkeit der Erinnerung utopisch macht. Gerade dieses Bewusstsein ist das Objekt der Verse, die Scholem in einem an Benjamin gewidmeten Gedicht schreibt: „In alten Zeiten führten alle Bahnen zu Gott und seinem Name, irgendwie Wir sind nicht fromm. Wir bleiben im Profanen und wo einst Gott stand, steht: Melancholie”.102 102 GERSHOM SCHOLEM, in Glückloser Engel. Dichtungen zu Walter Benjamin, hg. von E. Wizisla und Michael Opitz, Insel Verlag, Frankfurt/M. und Leipzig 1992, S59 162 Literaturverzeichnis Die folgende Bibliographie ist auf die für diese Arbeit gelesenen und benutzten Texten begrenzt. Für eine ausführlichere Bibliographie über Walter Benjamin bis 1984 verweise ich auf den Text von M. BRODERSEN, Walter Benjamin. Bibliografia critica generale (1913 - 1983), Centro Internazionale Studi di Estetica, Palermo 1984. Walter Benjamin: Die Werke Benjamins sind in der kritischen Ausgabe: Gesammelte Schriften hg. von R. Tiedemann und H. Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1972-1989 gesammelt. Die folgenden Bände sind herausgegeben worden: Die Werke Benjamins sind in der kritischen Ausgabe: Gesammelte Schriften hg. von R. Tiedemann und H. Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1972-1989 gesammelt. Die folgenden Bände sind herausgegeben worden: Bd. I (1974): I 1; I 2; I 3. Bd. II (1977): II 1; II 2; II 3. Bd. III (1972): III. Bd. IV (1972): IV 1; IV 2. Bd. V (1982): V 1; V 2. Bd. VI (1985): VI. Bd. VII (1989): VII 1; VII 2. Gesammelte Briefe, hg. v. Th. W. Adorno Archiv. Bde. I-VI hg. v. Christoph Gödde u. Henri Lonitz, Frankfurt a.M. 1995ff. WALTER BENJAMIN - GERSHOM SCHOLEM, Briefwechsel 1933-1940, hg. von G. Scholem, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1980. Versuche über Brecht, in: WALTER BENJAMIN, Über Kafka. Texte, Briefzeugnisse, Aufzeichnungen, hg. von Hermann Schweppenhäuser, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1981. Weitere Literatur ADORNO, TH. W, Minima Moralia. Reflexionen aus dem Beschädigten Leben, Suhrkamp, Frankfurt 2001. ADORNO, TH. W., Über Walter Benjamin, hg von R. Tiedemann, Frankfurt a.M. 1970 AGAMBEN, GIORGIO, Walter Benjamin und das Dämonische. Glück und geschichtliche Erlösung im Denken Benjamins, in Walter Benjamin 1882-1940. zum 100. Geburtstag, hg. v. Uwe Steiner, Bern 1992. 163 Antike und Moderne. Zu Walter Benjamins „Passagen“, hg. v. Norbert W. Bolz u. Richard Faber, Würzburg, 1986. ARENDT, HANNA, Il pescatore di perle: Walter Benjamin 1892-1940, tr. it. di Andrea Carosso, Mondadori, Milano 1993. BAUDELAIRE, CHARLES, Les Fleurs du Mal, it. Üb. v. A. Cerinotti, Demetra, Verona 1995. Benjamins Begriffe, hg von M. Opitz und E. Wizisla, Suhrkamp, Frankfurt/M. 2000. Briefe, 2 voll., hg. von Scholem und Th. W. Adorno, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1966. BROD, MENACHEM M., I giorni del Messia, a cura di rav S. Bekhor, Mamash Edizioni Ebraiche, Milano 1997. BRODERSEN, MOMME, Spinne im eigenen Netz. Walter Benjamin, Leben und Werk, Bühl-Moos 1990. BUBER, MARTIN, Das Judentum und die Juden in: Drei Rede über das Judentum, Frankfurt a.M. 1919. BUCK, MORSS SUSAN, Dialektik des Sehens. Walter Benjamin und das Passagen-Werk, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1993. CASES, CESARE, in WALTER BENJAMIN, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino 1980. CASSIRER, ERNST, Philosophie der symbolischen Formen, Darmstadt 1977. COHEN, HERMANN, Ethik des reinen Willens, Hildesheim- New York 1981. COHEN, HERMANN, Logik der Reinen Erkenntnis, Berlin 1919 DE VRIES, S. PH., Jüdische Riten und Symbole, Fourier Verlag, Wiesbaden 1981. DESIDERI, FABRIZIO, Apocalissi Profana, in WALTER BENJAMIN, Angelus Novus. Saggi e frammenti, hg. v. Renato Solmi, Einaudi, Torino 1995. DESIDERI, FABRIZIO, Walter BEnjamin. Il tempo e le forme, Roma 1980. DEUBER-MANKOWSKY, ASTRID, Der frühe Walter Benjamin und Hermann Cohen: Jüdische Werte, Kritische Philosophie, vergängliche Erfahrung, Berlin 2000. Die Philosophische Aktualität der jüdischen Tradition, hg. v. Werner Stegmaier, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2000. 164 FIGAL, GÜNTER, Recht und Moral bei Kant, Cohen und Benjamin in „Zeitschrift für philosophische Forschung“, 36/1982, S.361-377. FIORATO, PIERFRANCESCO, L’ideale del problema. Sopravvivenza e metamorfosi di un tema neokantiano nella filosofia del giovane Benjamin in “Conoscenza, valori e cultura. Orizzonti e problemi del neocriticismo”, a cura di Stefano Besoli e Luca Guidetti, Quaderni di Discipline Filosofiche, Anno VII, Nuova Serie n. 2, Vallecchi Editore, Firenze 1997, S.361-386. FIORATO, PIERFRANCESCO, Teoria della conoscenza e concetto di storia. Una questione di metodo in margine alle tesi sul concetto di storia di Walter Benjamin, in “Nuova Corrente” 43/1997. FRANK, MANFRED, Der kommende Gott. Vorlesungen über die neue Mythologie, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1982. FREUD, SIGMUND, Jenseits des Lustprinzips, Leipzig, Wien 1920. In Gesammelte Werke, Bd. 13, hg v. Anna Freud, 1987, S.3-69. FULD, WERNER, Walter Benjamin zwischen den Stühle. Eine Biographie, Hauser Verlag, München Wien 1979. FÜRNKÄS, JOSEPH, Surrealismus als Erkenntnis – Walter Benjamin – Weimarer Einbahnstrasse und Pariser Passagen, Metzler, Stuttgart 1988. GABER, KLAUS, Rezeption und Rettung, Niemeyer, Tübingen 1987 GAGNEBIN, JEANNE MARIE, Zur Geschichtsphilosophie Walter Benjamins, die Unabgeschlossenheit des Sinnes, Berlin 1977. GEISSLER, ERICH, Der Gedanke der Jugend bei Gustav Wyneken, Berlin 1963. GOETHE, JOHANN WOLFGANG., Goethes Schriften, Wegner Verlag, Hamburg 1953-1963 und Weimar, 1888-1901. GUGLIELMINETTI, ENRICO, Walter Benjamin: tempo, ripetizione, equivocità, Mursia, Milano 1990. GÜNTHER, HENNIG, Der Messianismus von Hermann Cohen und Walter Benjamin in Emuna. Horizonte 9, 1974, S. 352-359. GÜNTHER, HENNIG, Walter Benjamin. Zwischen Marxismus und Theologie, Walter Verlag, Olten 1974. HEIL, SUSANNE, Gefährliche Beziehung. Walter Benjamin und Karl Schmitt, Stuttgart 1996. 165 HOLZ, HANS HEINZ, Kontinuität und Bruch im Denken Walter Benjamin, in Bruch und Kontinuität: jüdisches Denken in der europäischen Geistgeschichte, hg. von E. Goodman- Thau und M. Daxner, Akad. Verlag, Berlin 1995, pp. 120ss. HOLZ, HANS HEINZ, Philosophie der zersplitterten Welt. Reflexionen über Walter Benjamin, Pahl – Rugenstein Verlag, Bonn 1992. HOLZEY, HELMUTH, Die praktische Philosophie des Marburger Neukantianismus in Neukantianismus. Perspektive und Probleme, hg. v. ders. u. E. W. Orth, Würzburg 1994, S. 136-158. HOLZEY, HELMUTH, Kants Erfahrung Begriff. Quellengeschichte und bedeutungsanalytische Untersuchungen, Basel 1970. KAFKA, FRANZ, Brief an den Vater, hg. von M. Müller, Reclam, Stuttgart 1995. KAFKA, FRANZ, Das Schloss, Fischer, Frankfurt a.M. 1967. KAFKA, FRANZ, Der Prozess, Fischer, Frankfurt a.M. 1990. KAISER, GERHARD, Benjamin. Adorno. Zwei Studien, Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M. 1974. KAULEN, HEINRICH, Leben im Labyrinth. Walter Benjamins letzte Lebensjahre in „Neue Rundschau“ 93, 1982, S. 34-59. KAULEN, HEINRICH, Walter Benjamin und Asja Lacis. Eine Bibliographische Konstellation und ihre Folgen in „Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte“ 69, 1995, S. 92-122. KLIBANSKY, RAYMOND – PANOFSKY, ERWIN – SAXL, FRITZ, Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst, Suhrkamp 1990. KRAUSS, R.H., Walter Benjamin und der neue Blick auf die Photographie, Canz, Stuttgart 1998. MANNINGHAUS, WINFRIED, Walter Benjamins Theorie der Sprachmagie, Suhrkamp, Frankfurt am Mein 1995. MATHIEU, VITTORIO, Goethe e il suo diavolo custode, Adelphi, Milano 2002. MAYER, H., Der Zeitgenosse Walter Benjamin, Frankfurt a.M. 1993. MENKE, BETTINE, Benjamin vor dem Gesetz. Die „Kritik der Gewalt“ in der Lektüre Derridas in Gewalt und Gerechtigkeit. Benjamin – Derrida, hg. v. A. Haverkamp, Frankfurt a.M. 1994, S. 217-278. 166 MOSCATI, A., Nota su Rosenzweig e Benjamin, in „aut aut”, maggio-agosto 1982, n.189-190, pp. 103ss. MOSES, STEPHANE, L’ange de l’histoire. Rosenzweig, Benjamin, Scholem, Seuil, Paris 1992, it. Üb. v. M. Bertaggia, Anabasi, Milano 1993. OPITZ, M. – WIZISLA, E., Aber ein Sturm weht vom Paradiese her... Texte zu Walter Benjamin, Reclam, Leipzig 1992. PANNGRITZ, ANDREAS, Walter Benjamin als “Theologe”, in Jüdische Denker im 20. Jahrhundert, hg. von H. Lehming, Hamburg 1997, pp.46ss. PIVECKA, ALEXANDER, Die Künstliche Natur. Walter Benjamin Begriff der Technik, Frankfurt a.M. 1993. POMA, ANDREA, La filosofia critica di Hermann Cohen, Mursia, Milano 1988. PONZI, MAURO, Walter Benjamin e il moderno, Roma 1993. REISCH, HEIKO, Das Archiv und die Erfahrung. Walter Benjamin Essay im medientheoretischen Kontext, Würzburg 1992. RELLA, FRANCO, Critica e storia. Materiali su Walter Benjamin, Vicenza 1980. ROBERTS, JULIAN, Walter Benjamin, London 1982. ROTTEN, ELISABETH, Goethes Urphänomen und die platonische Idee, Gießen 1913 RUMPF, MICHAEL, Elite und Erlösung: Zu antidemokratische Lektüren Walter Benjamins, Bremen/Leipzig 1997. RUMPF, MICHAEL, Faszination und Distanz. Zu Benjamins George-Rezeption in Walter Benjamin – Zeitgenosse der Moderne, hg. v. P. Gebhardt, Kronberg Ts. 1976, S. 51-70. RUMPF, MICHAEL, Spekulative Literaturtheorie: zu Walter Benjamins Trauerspielbuch, Verlag Anton Hain Meisenheim, Königstein/Ts. 1980. SCHIAVONI, GIULIO, Walter Benjamin. Il figlio della felicità, Einaudi, Torino 2001. SCHIAVONI, GIULIO, Walter Benjamin. Sopravvivere alla cultura, Sellerio editore, Palermo 1980. SCHOBINGER, JEAN-PIERRE, Variationen zu Walter Benjamins Sprachmeditationen, Basel/Stuttgart 1979. 167 SCHÖDLBAUER, ULRICH, Der Text als Material. Zu Benjamins Interpretation von Goethes Wahlverwandtschaften in Walter Benjamin – Zeitgenosse der Moderne, hg. v. P. Gebhardt, Kronberg/Ts. 1976, S. SCHOLEM, GERSHOM, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1967. SCHOLEM, GERSHOM, Die jüdische Mystik, Suhrkamp, Frankfurt/M. 1993. SCHOLEM, GERSHOM, Hauptströmungen der jüdischen Mystik, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1993. SCHOLEM, GERSHOM, Il nome di Dio e la teoria cabbalistica del linguaggio, tr. it. di A. Fabris, Adelphi, Milano 1998. SCHOLEM, GERSHOM, in Glückloser Engel. Dichtungen zu Walter Benjamin, hg. von E. Wizisla und Michael Opitz, Insel Verlag, Frankfurt a.M. und Leipzig 1992. SCHOLEM, GERSHOM, Studien zu Grundbegriffen der Kabbala, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1973. SCHOLEM, GERSHOM, The Messianic Idea in Judeaism. And other Essays on Jewisch Spirituality, Schocken books, New York 1971. SCHOLEM, GERSHOM, Über einige Grundbegriffe des Judentums, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1976. SCHOLEM, GERSHOM, Von Berlin nach Jerusalem, Frankfurt a.M. 1994. SCHOLEM, GERSHOM, Walter Benjamin - Die Geschichte einer Freundschaft, Franfurt a.M. 1975. SCHOLEM, GERSHOM, Walter Benjamin und sein Engel, Frankfurt a.M. 1983. SCHOLEM, GERSHOM, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Rhein-Verlag, Zürich 1960. SCHWARZ, ULRICH, W. Benjamin: Mimesis und Erfahrung, in Grundprobleme der großen Philosophen, hg. von J. Speck, München 1984, pp. 43ss. SIEG, ULRICH, Aufstieg und Niedergang des Marburger Neukantianismus, Würzburg 1994. SIMMEL, GEORG, Goethe, Klinkhardt & Biermann, Leipzig 1913. SMITH, GARY, „Das Jüdische versteht sich von selbst“. Walter Benjamins frühe Auseinandersetzung mit dem Judentum, in „Deutsche Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geschichte“, LXV/1991, S. 318-331. 168 SOLOVEITCHIK, JOSEPH B., Reflections of the Rav, 1993. STEINER, RUDOLF, Goethes Naturwissenschaftliche Schriften, Stuttgart 1962. STEINER, UWE, Die Geburt der Kritik aus dem Geiste der Kunst. Untersuchungen zum Begriff der Kritik in den frühern Schriften Walter Benjamins, Würzburg 1989. TIEDEMANN, ROLF, Dialektik im Stillstand. Versuche zum Spätwerk Walter Benjamins, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1983. TIEDEMANN, ROLF, Studien zur Philosophie Walter Benjamins, Frankfurt a.M. 1973. Übersetzen: Walter Benjamin, hg. v. Christiaan L. Hart Nibbrig, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2001. VOGEL, KLAUS, Das Symbolische bei Goethe, Fink, München 1997. WAGNER, GERHARD, Die Medien der Moderne, Berlin 1992. WAGNER, GERHARD, Walter Benjamin “Die Medien der Moderne”, Vistas Verlag, Berlin 1992. WEIGEL, SIGRID, Entstellte Ähnlichkeit. Walter Benjamins theoretische Schreibweise, Frankfurt a.M. 1997. WIESENTHAL, LISELOTTE, Zur Wissenschaftstheorie Walter Benjamins, Frankfurt a.M. 1973. WITTE, BERND, Walter Benjamin – Der Intellektuelle als Kritiker. Untersuchungen zu seinem Frühwerk, Stuttgart 1976. WITTE, BERND, Walter Benjamin, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg 1995. WIZISLA, ERDMUT, „Die Hochschule ist eben der Ort nicht, zu studieren“. Walter Benjamin in der freistudentischen Bewegung, in „Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität, Gesellschaftswissenschaftliche Reihe“, 1987, S. 616-623. WOLIN, R., Walter Benjamin. An Aesthetic of Redempion, University of California Press, London 1994. Zur Aktualität Walter Benjamins. Aus Anlass des 80. Geburtstag von Walter Benjamin, hg. v. Siegfried Unseld, Frankfurt a.M. 1972. 169