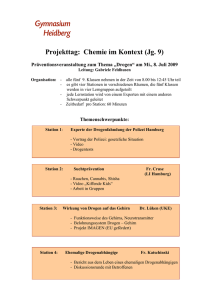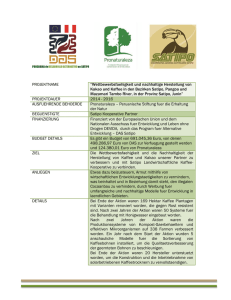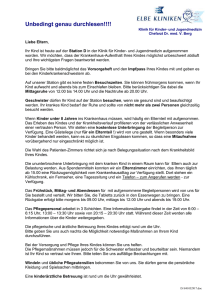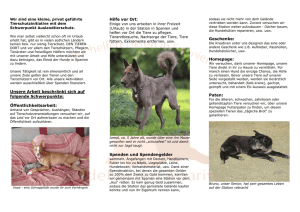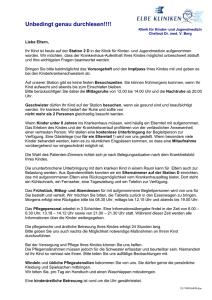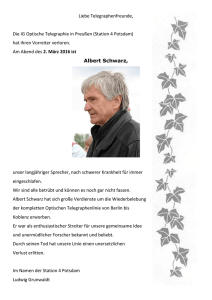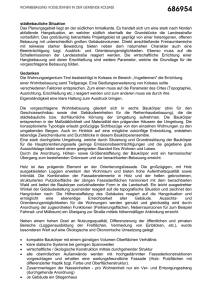Modul 2.1, 2.2, 2.4 Entwerfen und Konstruieren Entwerfen und
Werbung

Modul 2.1, 2.2, 2.4 Entwerfen und Konstruieren Entwerfen und Wahrnehmen Prof. Andreas Meck Prof. Johann Ebe LB Peter Zarecky Aufgabenstellung: Parzelle und Haus 78 Der von Adolf Krischanitz für Friedrichshof bei Zurndorf / Burgenlang entwickelte Masterplan sieht vor, lange schmale Parzellen zu errichten, die zu inselförmigen Baufeldern zusammengeschlossen sind. Die einzelnen Gebäude werden ein- bis zweigeschossig direkt aneinander gebaut, der erforderliche Lichteinfall individuell über Innenhöfe auf die jeweilige Parzelle abgestimmt. Bebauung und Höfe stehen in spannungsreichem Wechselspiel. Die um einen großen Naturraum im Zentrum des Planungsgebiets angelegten Parzellen sollen aufgrund ihres Zuschnitts von 7,5 auf 60 bis 150 Metern eine hohe Dichte ermöglichen. Durch die radikale Kombination eines aus der Region abgeleiteten traditionellen Typus mit den technischen Möglichkeiten unserer Zeit entwickelt Krischanitz eine Systemfolge von Haus- unf Hofräumen, die beliebig verlängerbare und vielfältig nutzbare Einheiten ergeben. Nichtbebaute Flächen können einzelne Atrien inmitten der Bauten oder Gartenflächen am Ende der Gebäude sein. So können die Häuser in der Länge unabhängig voneinander entwickelt werden. Aufgabe war es nun für die Studenten, die Potentiale dieser Strategie an Hand von Testentwürfen zu überprüfen. Die Grundstücke wurden dabei nach dem Zufallsprinzip vergeben. 79 Parzelle und Haus Kilian Lederer Das Projekt ist ein Einfamilienhaus auf einer sehr schmalen, langen Parzelle (70 x 7 m). Konzipiert ist das Gebäude für eine vierköpfige Familie. Auf dem Grundstück sind vier zweigeschossige, monolithische Baukörper geplant, die von einem gemeinsamen Dach überspannt werden. Zwei gleich große Höfe bzw. Gärten gliedern den Grundriss zusätzlich. Der überdachte Raum wird von einer Glashaut umspannt, die den Wohnraum begrenzt. Im Inneren der Baukörper befinden sich Schlaf- und Waschräume sowie ein Büro und eine Sauna. Der Wohnraum im Erdgeschoss erstreckt sich als Raumkontinuum über die volle Länge des Gebäudes. Die Küche mit angeschlossenem Essbereich ist zentral gelegen. Darüber ist ein Luftraum, der über ein großes Oberlicht, das bei Bedarf geöffnet werden kann, für Belichtung sorgt. Am Südende des Hauses weitet sich der Raumfluss zu einem zweiten großzügigem Wohnbereich mit zweigeschossigem Luftraum und offenem Kamin. Das über zwei Treppen zu erreichende Obergeschoss beherbergt das Büro, die Schlafräume und zwei Bäder. Die Erschließung dieser Räume erfolgt mittels einer mit Holzdielen belegten Stahlkonstruktion um die solitäre Wirkung der Korpusse zu unterstreichen sowie einen Bezug zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss herzustellen. Die beiden Badezimmer verfügen über Oberlichter. Aus dem Badezimmer der Eltern gelangt man zu der darunter liegenden Sauna, die einen direkten Zugang zum Garten hat. B C D E Ansicht Süd Ansicht Süd WC Grundriss EG 80 Kochen B A C E Sauna D Wohnen A Grundriss EG A Ansicht Nord Schnitt B-B B C D A Schniott B-B E Ansicht Nord Bad Grundriss OG Kind Büro A B Kind C Bad D Eltern E A Grundriss OG 81 Parzelle und Haus Voraussetzung war ein Masterplan von Adolf Krischanitz, der lange schmale Parzellen von 7,5 m x 60 m vorsieht, die zu inselförmigen Baufeldern zusammengefasst werden. Die direkt aneinander liegenden langen Parzellen sollten nun eine geeignete Bebauung bekommen, die den Anforderungen der Dichte und des Lichts mittels spannenden Innenhöfen entspricht. ERSCHLIESSUNG: Das Gebäude hat eine Erschließungsachse die vom Anfang des Grundstückes im Norden, hindurch durch das Gebäude bis hin zum Ende des Grundstückes im Süden reicht. Sie ermöglicht eine Sichtachse durch das komplette Gebäude. Das Gebäude ist somit in Richtung Süden orientiert, wo sich ein kleiner Park befindet. NACHHALTIGKEIT: Es besteht die Möglichkeit das Gebäude bei Bedarf in 2 Wohneinheiten, die je einen Innenhof haben, aufzuteilen. 82 Isabel Protschky 83 Parzelle und Haus AUFGABE „PARZELLE UND HAUS“ Grundlage der Aufgabe war ein Masterplan von Adolf Krischanitz für ein Wohngebiet mit rund 150 Häusern. Der Plan sieht vor, lange schmale Parzellen zu errichten, die zu inselförmigen Baufeldern zusammengeschlossen sind. Die einzelnen Wohnhäuser sollen ein- bis zweigeschossig direkt aneinander gebaut werden. Über Innenhöfe sollen die Häuser optimal belichtet werden. Als Aufgabe sollte jeder Student eine dieser länglichen Parzellen mit den Maßen 7,50mx60m bebauen. 84 Sara Lindner ENTWURF Die längliche Struktur des Grundstücks spiegelt sich in der Erschließung des Hauses wider. Wie ein Band durchzieht der länglicher Gang das komplette Erdgeschoss. Auch im Garten wird dieses Band in Form eines Weges fortgeführt. Im Obergeschoss gibt es ebenfalls einen solchen Gang zur Erschließung, der hier jedoch auf der anderen Seite als im Erdgeschoss verläuft. Die Belichtung des Ganges und der Zimmer im Erdgeschoss wird über zwei Innenhöfe sichergestellt, wodurch sich spannende Lichtsituationen im Gang ergeben. Das Gebäude ist in Arbeitsbereich, Wohnbereich, Gästebereich und Schlafbereich unterteilt. KONSTRUKTION Die tragende Konstruktion besteht aus Stahlbetonschotten und einer Stahlbetondecke, die über die komplette Breite des Grundstücks spannt. Die Fassade zum Garten und zur Straße ist in Pfosten-Riegel Konstruktion ausgeführt. 85 Modul 2.2 Konstruktion II Prof. Martin Zoll Prof. Heinz Fischer Prof. Dunja Karcher Atelierhaus 86 Lehrziele Einblick in die Wechselbeziehung von Inhalt, Form, Raum und Konstruktion unter Berücksichtigung energetischer Kriterien (Passivhausstandart). Kenntnisse von Tragwerken und Raumbegrenzungen, der Technik des Fügens und Verbindens von Bauteilen zu Bauwerken, sowie der Einflüsse von Materialeigenschaften und Verarbeitungstechniken Aufgabenstellung Anhand eines einfachen, als Schemazeichnung vorgegebenen Projektes, werden Problemstellungen aus den Bereichen der Baukonstruktion, Klima Design und Tragwerkslehre unter Berücksichtigung architektonischer Randbedingungen bearbeitet. Zu bearbeiten Konstruktionsgefüge Wände: Typologie, außen, innen, tragend, nichttragend, leicht, massiv, einschalig, mehrschalig Decken: Typologie, Spannrichtung, Material, Aussteifung Dach: Tragwerk, Spannrichtung, Deckung, Dichtung, Schichtung, Anschlüsse Gründung: Typologie (Platten, Streifen – Einzelfundamente), Konstruktionsschichten der Böden, Decken und Wände 87 Atelierhaus Anhand eines vorgegebenen Raumprogramms und einer Schemazeichnung sollte ein Atelierhaus entworfen und konstruiert werden, das den Anforderungen von Funktion, Konstruktion, energetischen und architektonischen Kriterien genügt. Die Raumsituation bildet sich durch Verschieben der einzelnen Nutzungen und Funktionen in allen drei Achsen. Somit ergibt sich ein differenzierter Baukörper mit Vor- und Rücksprüngen in der Fassade. Im Inneren abgestufte Niveaus werden zentral durch eine Treppe erschlossen. So entstehen fließende Räume, die mit dem hohen Atelier einen Raum bilden der Freiräume für die künstlerische Kreativität lässt. Die tragende Struktur ist ein Holzfachwerk, dessen Aussteifung von Holzwerkstoffplatten übernommen wird. Um den Passivhausstandard zu erreichen wurden die Räume zwischen den tragenden Holzleimbindern mit Zellulosedämmung ausgefüllt. Um den energetischen Ansprüchen gerecht zu werden, bedurfte es neben einer hochgedämmten Hülle zusätzlich eines kontrollierten Lüftungssystems und einer Wärmepumpe für die Warmwassergewinnung. Mit einer Photovoltaikanlage auf den Dachflächen wird mehr Energie erzeugt als benötigt und somit nahezu der Plusenergiehausstandard erreicht. Das Gebäude wird von einer hinterlüfteten Fassade aus Schiefer bekleidet, die als dynamische Deckung ausgeführt ist. 88 Daniel Seyfang, Martin Schlämmer 89 90 91 Modul 4.1. Entwerfen/Gestalten Prof. Maren Paulat Prof. Doris Thut Good vibrations 92 Interventionen - Neue Räume für die Karlstraße Die Idee des Entwurfseminars basiert auf einer Kritik an der gegenwärtigen Nutzung der Räume in der Karlstraße bezüglich der Studios, der Ausstattung, des Ausstellungsdisplays, der Atmosphäre etc. Über Raumwahrnehmung und Raumanalysen geht dieser Ansatz von inspirierten Überlegungen zum Ort, Handlungsraum und situativen Prozessen aus. Entwickeln und entwerfen Sie Ideen für alternative Nutzungen, Interventionen und Aktionen, Umformungen Transformationen und Atmosphären in der Karlstraße. Literatur: Philip Johnson Glashaus Playtime Projekt 58 MoMa, New York 97 Rirfrit Tiravanija A retrospective tommorrow is another fine day New Babylon Constant Archigram Andreas Spiegl, Christian Teckart, Büro für kognitiven Urbanismus Das soziale Kapital Museum für Gegenwartskunst Migros, Zürich, 1998 93 Good vibrations Intervention – Neue Räume für die Karlstraße Ein versteckter Ort der Karlstraße 6 wird für alle sichtbar ausgestellt – seine negative Form hängt modellhaft als Bausatz im offenen Eingangsbereich. Der Grundriss des Korridors transformiert sich zu einem Körper, erhält die Funktion einer Sitzmöglichkeit, behält aber seine ursprüngliche Form bei. Über dieses Podest zieht sich die Grundrisszeichnung wie eine Tätowierung. Zusätzlich gibt es eine Lichtinstallation von Sonnenlicht und kühlem Grün am originalen Standort. Ziel dieser Transformationen ist es eine bewusstere Wahrnehmung und das räumliche Gedächtnis bei den Studierenden und den Professoren zu wecken. 94 Salvat Marlen, Schöttl Sabine, Volkova Darya KORRIDOR 112,912 qm Korridorfläche 29,624 m Länge kleinster Raum 1,54 qm zwei Knicke Linoleumbelag Raumnummern 119 – 126a sieben Lichtquellen Fenster ins nirgendwo zwölf Raumzugänge acht mal Tageslicht von oben acht Einbauwaschbecken Marquardt, Rott, Schwarz-Meier, Tebrake, Tischer Variable Faltung Transluzentes Papier Neonröhren Origami (from ori meaning „folding“, and kami meaning „paper“) is the traditional Japanese folk art of paper folding, which started in the 17th century AD and was popularized in the mid-1900s. It has since then evolved into a modern art form. The goal of this art is to transform a flat sheet of material into a finished sculpture through folding and sculpting techniques, and as such the use of cuts or glue are not considered to be origami. The number of basic origami folds is small, but they can be combined in a variety of ways to make intricate designs. The most well known origami model is probably the Japanese paper crane. In general, these designs begin with a square sheet of paper whose sides may be different colors or prints. Traditional Japanese origami, which has been practiced since the Edo era (1603–1867), has often been less strict about these conventions, sometimes cutting the paper or using nonsquare shapes to start with. 95 Good vibrations Intervention – Neue Räume für die Karlstraße Kunststofffolienfaltung Heckenmotiv in Siebdruck Baustahlstäbe Kabelbinder Grünfläche Barerstraße Eine Hecke (von althochdeutsch: hegga = hegen, einhegen, umzäunen, ae. hecg, engl. hedge, frz. haie, nndl. heg, all diesen Begriffen ist derselbe Wortstamm „hag“ zu eigen) ist ein linienförmiger Aufwuchs (ein- oder mehrreihig) dicht stehender, stark verzweigter Sträucher. Die Silbe heck bedeutet beschützen, behüten, Hecke und beschreibt die Abgrenzung eines Ortes im Allgemeinen oder durch eine Heckenumpflanzung im Speziellen. Ortsbezeichnungen mit hagen oder ha(a)g im Namen sind häufig. 96 Salvat Marlen, Schöttl Sabine, Volkova Pascal Darya Bleier Tobias Richter, Sebastian Vollert Schaukel Grünfläche Barerstraße Wird eine Schaukel aus ihrer Ruhelage ausgelenkt, pendelt sie einige Male hin und her, bis die Reibungskräfte ihre Bewegung zum Stillstand bringen. Um die Schaukelbewegung aufrecht zu erhalten oder gar zu intensivieren, muss daher von der schaukelnden Person physikalische Arbeit geleistet werden. Ein solches aktives Schaukeln ist im physikalischen Sinne ein getriebenes Pendel. 97 Modul 4.3 Städtebau Projekt Prof. Ulrich Holzscheiter LB Thomas Hammer NordOstpassage 98 München: Entwicklung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes zur Aufwertung der Verbindung von Olympiapark und Englischem Garten/ Ideenproduktion für einige Zwischenstationen/ Stegreif-Entwürfe für zwei Bauquartiere an den Schlussstationen und für den Bereich der Münchner Freiheit unter verändertem Blickwinkel auf diesen Stadtraum als Schnittfeld zweier Achsen und nicht ausschließlicher Abschluss der Ludwig-, Leopolstraßenachse 99 NordOstpassage Rana Aminian, Esra Erel, Burcin Eshaghi-Farahmand 3d Achse Nordostpassage Gesamtlageplan Nordostpassage 100 Station I_Endstation West: 250 Studentenwohnungen, viergeschossige, geschlossene Randbebauung im Osten und Süden, zweigeschossige Containerzeilen im Binnenraum, Brückenschlag über den Ackermannbogen im Süden. GFZ 0,7, GRZ 0,24 Lageplan Endstation West Studentenwohnheim Vogelperspektive Endstation West Studentenwohnheim 101 Station II Kindergarten: eine Winkelform als Fassung des Luitpoldparks, aus Container-Elementen gebildet, von einem auskragenden Quader bekrönt und mit einem Spielhaus ergänzt. GFZ 0,4, GRZ 0,2, A/V 2,5 Lageplan Kindergarten Vogelperspektive Kindergarten Station III Münchener Freiheit: eine wieder aus Containerbausteinen aufgetürmte Stadtkrone von 70 Metern Höhe am Endpunkt einer fünfgeschossigen Randeinfassung, vielfältige Nutzungen, im Binnenraum eingestreute Basarbauten. GFZ 4,0_GRZ 0,7_A/V 0,25 Lageplan Münchener Freiheit 102 Münchener Freiheit Turm Station IV Biedersteiner Wiese: von linearer Bebauung im Westen und punktueller im Osten gerahmten Grünraum, ein Hochhaus mit dynamisch verschobenen Geschossschichten markiert den Schlussstein in der Nordostpassagenabfolge. GFZ 11,0, GRZ 2,6, A/V 0,2 Blick auf das Achsende Lageplan Biedersteiner Wiese Blick von der Hauptstraße Richtung Süden 103 NordOstpassage Diplomstudiengang Karolina Lison, Michael Mayer Eine Neugestaltung - und damit verbundene Begrünung - der Clemensstraße verbindet den Olympiapark mit dem Englischen Garten über fünf Zwischenstationen. Die Clemensstraße - als Hauptverbindungsachse wird fast vollständig vom PKW-Verkehr befreit, intensiv begrünt und als Mischstraße konzipiert. Das Verkehrsaufkommen wird auf die parallel verlaufenden Herzog-, und Karl-Theodorstraße umgeleitet. STATION I Das Ziel ist eine direkte Verbindung von enger urbaner Bebauung mit dem Freigelände des Olympiaparks am Ackermannbogen. Das Konzept beschreibt eine dichte Struktur mit Nord-Süd gerichteten Grundrissen. Die starke lineare Bewegung der Baukörper löst sich in Richtung Westen zum Olympiagelände hin auf, in Form von Fassadenmaterialität, Länge und Höhe der Baukörper. Wegen der erhöhten Lärmbelastung durch den Ackermannbogen werden die Wohnstrukturen Ost-West gerichtet. Für diese Baukörper dient als Lärmschutz zur Ackermannstraße ein mehrstöckiges Bürogebäude, das keine großen Öffnungen zur Wohnbebauung aufweist. Vor- und Rücksprünge in Längsrichtung der zweigeschossigen Wohnbauten garantieren einen attraktiven Freiraum zwischen den Wohnquartieren. Der Standard-Grundrisstyp sieht eine zentrale Erschließung vor, um diese sich die einzelnen Räume gruppieren. Eine horizontale Erweiterung der Grundrisse in das zweite Obergeschoss mit Dachterrassen bilden die 60 - 80 Meter langen Baukörper eine interessante und verspielte Dachsilhouette. Der PKW-Verkehr wird sofort am Beginn der Mischstraße in eine Tiefgarage geführt und garantiert eine fast vollständig von Kraftfahrzeugen bereinigtes Wohnquartier. Lageplan Station I Perspektive Station I 104 STATION II Das Grundstück am Bayernpark sieht eine ergänzende Bebauung und Verdichtung der städtischen Situation vor. Die geplante „Grüne Achse“ entlang der Clemensstraße nimmt den Bezug zum Bayernpark und den damit verbundenen Luitpoldpark auf. Die jeweils viergeschossigen quadratischen Solitäre wie auch der Riegel sind mit Maisonettewohnungen strukturiert. Der Riegel beinhaltet neben den Wohnungen auch einen Kindergarten. Dieser befindet sich auf der Westseite des länglichen Baukörpers, um eine störungsfreie und unmittelbare Verbindung zur Grünfläche im Norden des Gebäudes zu gewähren. In den beiden Solitären befinden sich ausschließlich Maisonettewohnungen. Die Baukörper besitzen eine stark plastische Fassade, die sich durch vor- und rückspringende Räume in der Grundrissstruktur ergibt. Die im Innenhof liegende Erschließung unterstützt diese freie Gestaltung der Außenhaut. Lageplan Station II Perspektive Station II STATION III Durch die Begrünung und Verkehrsberuhigung der Clemensstraße wird am Grundstück der Grünanteil der Gartenanlage erhalten und die Gebäudekante nach hinten verrückt, um die Straße zu öffnen und die Grünqualität zu erweitern. Der Gebäudekomplex fasst die Straße und begleitet sie Richtung Freiheit und zurück. Im südlichen Teil des gefalteten Riegels befindet sich auch eine Grünfläche die von den privaten Kindergärten genutzt wird. Im Erdgeschoss des östlichen Teils befinden sich Café, Bäcker und kleine Geschäfte des täglichen Bedarfs. Durch die Aufweitung des Straßenraums wird die besondere Nutzung an dieser Stelle stärker betont. Die Wohnungstypen variieren durch die Faltung des Baukörpers. Lageplan Station III 105 STATION IV Die Münchener Freiheit ist nicht gefasst, hat keinen Halt und keinen Orientierungspunkt. Es braucht eine Art Schlusslicht, das die dominante Leopoldstraße an dieser Stelle mit einem Highlight aufwertet und lenkt. Es wurde das Highlight bzw. der Endpunkt - das Hochhaus - in die Sichtachse des gebildeten Platzes gesetzt, um ihn dadurch zu fassen und abzuschließen. Die extrovertierte Fassade ins Innere des Platzes der Münchener Freiheit gedreht und die Leopoldstraße mit ihrer Dynamik, in einer glatten Fassade ohne Vorsprünge unterstützt. Der Riegel - nah an die Leopoldstraße gerückt - wird von der fortgesetzten Baumallee von der verkehrsreichen Straße getrennt. Mehrere Sitzgelegenheiten auf dem Platz mit unterschiedlichen Höhenniveaus bilden Vor- und Rücksprünge in der vertikalen und die Fassade des Neubaus in der horizontalen Ebene. Lageplan Station IV Perspektive Station IV 106 Perspektive Station V Lageplan Station V STATION V An der letzten Station - der Biedersteiner Wiese - fällt sofort der Geländeabfall auf. Die Wiese ist von der Biedersteinerstraße und einer von der Wiese weg orientierten Wohnbebauung eingerahmt. Der Baumbestand ist sehr dicht. Die Situation soll so wenig wie möglich berührt werden. Durch die Böschung und die Fassung der Straße durch die Bäume ist eine Randbebauung ausgeschlossen. Das Konzept nimmt die Struktur der Familienhäuser auf. Senkrecht zur Straße und über die Böschung in die Wiese entstehen verschieden lange Riegel, die den leichten Bogen der Straße mit in die Grünfläche einfließen lassen. Der Weg zum Englischen Garten und der ursprüngliche Gehweg der Bewohner bleiben erhalten. Die Grundrisse der einzelnen Häuser sind flexibel und bilden verschiedene Höhen- und Fassadenversprünge und sind in der Höhe erweiterbar. 107 Modul 6.1 Entwerfen und Städtebau III Entwerfen + Konstruktion IV Prof. Jörg Weber Prof. Gilberto Botti Prof. Heinz Fischer Prof. Martin Zoll urban island 108 im städtebaulichen entwurfsprojekt ‚urban island’ werden einige parameter für die qualitätvolle integration eines sg- ‚stadtbausteins’ in bezug auf verkehr, gewerbe, arbeit, freizeitangebot, sozialer - und kulturellen einrichtungen sowie wohnen in einem planungsgebiet von ca. 18.000 qm thematisiert. in münchen - schwabing steht an der schleissheimer-straße gegenüber der einmündung der lerchenauerstraße eine restfläche im stadtgrundriss als ‚urban island’ zur verfügung. das gelände einer ehem. gärtnerei liegt nördlich der hauptverkehrsachse ackermann-/ karl-theodor-straße und westlich der großen grünfläche des luitpoldparks. in unmittelbarer nähe befinden sich sämtliche einrichtungen, nutzungen und bauformen einer gemischten, tradierten stadtstruktur. daraus resultiert ein hohes potential für den entwurf eines ‚stadtbausteins’. wir gehen davon aus, dass das gebiet als brache weitgehend frei von bausubstanz und eben ist. für das gebiet ist im sinne der seminar-thesen ein städtebauliches konzept zu entwickeln. in den entwurf sind sowohl vorschläge für den weiteren umgriff zu intergrieren, wie die stadträumliche fassung und gestaltung der einmündung lerchenauer-straße und des westlichen grünzugs, als auch vorschläge im engeren planungsbereich durchzuarbeiten, wie mischung, nutzung, bebauung und grünordnung. die die von straßen ausgehenden lärmbelastungen sind zu berücksichtigen. charakterisieren sie ihren ‚stadtbaustein’ als konzept und stellen sie die einbindung in die umgebung, die bauformen mit geschossigkeit, die beabsichtigten gebäude- und nutzungstypen, die erschließung und das freiflächenkonzept nachvollziehbar dar. achten sie dabei auf das erscheinungsbild nach außen, die gestaltung und nutzbarkeit der freiflächen, abmessungen der erschließung, abstandsflächen, gewünschte und nicht gewünschte nutzungen… 109 urban island Verena Büchl, Silvia Vuong, Tobias Waider PROBLEMPUNKTE DES BAUGEBIETES - der abrupte Abbruch der Urbanität auf der Schleißheimer Straße - die stark befahrene Schleißheimer Straße und Lerchenauer Straße - die unterbrochene Ost-West-Grünverbindung Olympiapark – Englischer Garten STÄDTEBAU Die Lösung bildet ein „Urban Island“ im Bezug auf die umgebende heterogene Struktur. Durch die fast gänzlich geschlossenen Blöcke wird im Erdgeschoss eine städtische Atmosphäre erreicht. Die abnehmende Bebauungsdichte über dem 2. Geschoss gewährleistet qualitätvolles Wohnen, gleichzeitig wird ein städtischer Anlaufpunkt mit Läden und Büros auch für das weitere Umfeld geschaffen. Im Inneren führen gepflasterte Passagen und Gassen, die sich mit mehreren Winkeln durch die Bebauung hindurch ziehen, zum Park hin, während der direkte Weg am nördlichen Rand über einen Grünstreifen verläuft. BAUKONSTRUKTION Der näher betrachtete Block beinhaltet eine vertikale Nutzungsmischung aus Arbeiten und gemeinschaftlichem Wohnen, erkennbar an der variationsreichen Gewerbezone in den ersten zwei Geschossen bzw. der Laubengangerschließung. Die Verbindung zwischen diesen beiden Elementen stellt der Innenhof her. Die Ateliers im östlichen Flügel orientieren sich zu beiden Seiten, da diese sowohl für Wohnen als auch Arbeiten genutzt werden können. Der Fassadenklinker verleiht der gewinkelten Struktur durch seine Schwere eine Verankerung und stärkt gleichzeitig die urbane Ausstrahlung. Dagegen löst die weiß verputzte Außenwand zum Hof die Schwere im Inneren auf und schafft Weite und Leichtigkeit. 110 Lageplan Erdgeschoss Ansicht Ost Ansicht West 111 urban island ÜBERLEGUNGEN Es soll keine Verbindung der bereits bestehenden Grünflächen (Luitpoldund Olympiapark) hergestellt werden, da die vorhandene Bebauung nur einen schmalen Grünstreifen zulässt und dieser kann den beiden großen Parks nichts entgegensetzten. Es ist wichtiger den Luitpoldpark als eigenständigen Park mit klarer Grenze auszubilden und den Verkehr durch eine T-Kreuzung zu beruhigen und somit auch den Fuß- und Fahrradübergang zu erleichtern. Mit einem „Tor zur Stadt“ soll die Grenze zwischen Blockrandbebauung und aufgelockerter Bebauung definiert werden. Nicht um den Kern vom Umland zu trennen, sondern um auf das Zentrum zu verweisen. IDEE, KONZEPT Das Thema „Urban Island“ sollte wörtlich genommen und in einem autarken Stück Stadt umgesetzt werden. Jedoch sollte keine stadträumliche und ideelle Ab-/Ausgrenzung stattfinden. Es soll z.B. kein weiteres OEZ oder Kulturzentrum wie im Gasteig entstehen. Die Idee ist es auf dem Grundstück eine kreative Campusuniversität für Architekten und Designer zu planen. Mit den üblichen Einrichtungen wie Audimax, Vorlesungssäle, Professorenzimmern, Bibliothek etc. sowie einen großzügigen Bereich für Studenten mit Arbeitsräumen, Ateliers und Studentenwohnheim. UMSETZUNG Um den Begriff „Urban Island“ zu verstärken soll sich das Gebäude vom Boden lösen. Daher wird auf einen konventionellen Keller verzichtet und die Campusfläche mit den Freiräumen auf das erste Obergeschoss angehoben. Das Erdgeschoss beherbergt Shops für den Alltags- und Universitätsbedarf, Lagerräume, zum Luitpoldpark hin orientierte Werkstätten sowie Parkflächen. Der eigentliche Campuskomplex ist in drei Hauptareale gegliedert. Einen öffentlicheren Bereich zur Straße hin mit Unterrichts-/Professoren- sowie Verwaltungsbereich und den zur ruhigen Parkseite hin orientierten privateren Bereich mit Arbeitsräumen und Wohnheim. Auf der Freifläche befinden sich zentral gelegen und von allen Bereichen zugänglich die Bibliothek, die Mensa, die Cafeteria und eine Bar. Durch das Aufnehmen der Fluchten aus dem Bestand und den Proportionen der einzelnen Baukörper wird der Campus trotz seiner Masse nicht als Fremdkörper wahrgenommen. Und das „Tor zur Stadt“ wird durch einen 40 m hohen Turm an der Ecke Schleißheimer-/Bambergerstraße formuliert. 112 Nina Eder, Christine Gentsch, Gabriel Hägel 113 urban island SITUATION - zwischen Park und starkbefahrener Verkehrsachse - folglich extrem unterschiedliche Randzonen - Grünachse zwischen Luitpold- u. Olympiapark - heterogene Bestandsstruktur - übergeordneter Verkehr stadtein/auswärts - untergeordnete Verkehrsströme in Querrichtung - ungeordneter Sraßenraum an der Einmündung Lerchenauer-/ Schleißheimerstaße ZIELE - Durchmischung gesellschaflticher Strukturen - Arbeiten/Wohnen im gleichen Bereich - Differenzierte Öffentlichkeiten - Zusammengehörigkeiten innerhalb der Siedlung - keine Quartiersausbildung wegen fehlenden strukturellen Voraussetzungen - Bereich der Einmündung Lerchenauerstraße in die Schleißheimerstraße ordnen ENTWURF - Neuordnung der Einmündung Lerchenauerstraße in die Schleißheimerstraße - somit bleibt Platz für einen durchgehenden Grünstreifen - aufgbrochene Zeilen ermöglichen eine alternative Wegeführung untergeordneter Verkehrsströme - öffentliche Flächen werden in introvertierte und extrovertierte Bereiche aufgeteilt - geschlossene Bebauung zur Schleißheimer Straße, offene Bebauung zum Park - vielfältige Wohnungen - Arbeiten/ Konsumieren im durchgehend öffentlichen Erdgeschoss 114 Michael Meyer, Maximilian Kamlah, Korbinian Kainz Ebene 0 Ebene +3 Ebene +6 115 Modul 6.3 – 6.5 FWP Prof. Andreas Meck Gastkritik: Beate Kreutzer Dr. Barbara Wolf Ausstellungskonzeption Designing an Exhibition 116 Im Architekturmuseum Schwaben in Augsburg sollten vom 03. bis 10. September 2009 Entwürfe der Hochschule München für ein neues Ausstellungs- und Vortragsgebäude des Museums präsentiert werden. Das FWP-Fach hatte die Organisation, die Konzeption und die Durchführung der Ausstellung im denkmalgeschützten Buchegger-Haus zum Inhalt. Ziel sollte sein, dass nicht nur die ausgestellten Arbeiten überzeugen, sondern auch eine kreative Ausstellungskonzeption zum guten Ruf unserer Hochschule beiträgt. Das FWP-Fach richtete sich vorwiegend, aber nicht ausschließlich, an die Teilnehmer des Entwurfes Entwerfen / Konstruieren, Modul 5.1 „Architekturmuseum“ im WS 2008 / 2009. Die Ausstellungseröffnung fand am Donnerstag, 03.09.2009, 19 Uhr, im Architekturmuseum Schwaben in Augsburg statt; die Ausstellung wurde vom 04.09. bis 10.09.2009 präsentiert. 117 Architekturmuseum Schwaben Die Ausstellung zeigt Entwürfe von Architekturstudenten des 5. Semesters der Hochschule München für ein neues Ausstellungsund Vortragsgebäude des Architekturmuseums Schwaben. Die Arbeiten entstanden unter Leitung von Prof. Andreas Meck. Schwerpunkt war dabei die Auseinandersetzung mit dem Ensemble Thelott - Viertel und der unmittelbaren Nähe zum denkmalgeschützten Buchegger-Haus. Besonderer Wert wurde auf die Form-, Material und Raumgebung und die für Ausstellungszwecke geeignete Lichtführung gelegt. Anna Köppl, Astrid Neukirch, Alexander Pieper, Sebastian Philipp, Benjamin Möckl, Benjamin Neumeier, Bernado Rührig, Christoph Kersch Claudia Mayer, Gabriel Hägel, Ina Grothusen, Matthias Röckers Max Kamlah, Sabrina Höck, Silvia Vuong, Stefanie Mitchell 118 Semesterarbeit 119 Modul 6.4 FWP Prof. Siegfried H. Bucher Malstudio II Painting Studio II 120 Thema des Seminars ist die grundlegende Frage nach dem Phänomen des Raumes und seinem Abbild in der Fläche. Neben einer praktischen Einführung in die Ölmalerei und eigenen malerischen Versuchen soll das Studium ausgewählter Werke der Malerei in der Alten Pinakothek und aktueller künstlerischer Positionen, in den Ausstellungen Revue und Die Gegenwart der Linie in der Pinakothek der Moderne, die Möglichkeiten und Absichten der räumlichen Darstellung in unterschiedlichen Stilepochen zeigen. Literatur: Alte Pinakothek München. Bestandskatalog. Erläuterungen zu den ausgestellten Werken. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage München 1999; 622 S. mit Abbildungen aller ausgestellten Werke und 24 Farbtafeln Die Gegenwart der Linie. Katalog zur Ausstellung. Mit einer Einführung und einem Künstleranhang. Herausgeber M.Semff und A.Strobl. Ausstellung vom 19.03.2009 – 21.06.2009 in der Pinakothek der Moderne. 121 Malstudio 2 122 Adriane La 123 Modul 6.5 FWP LB Barbara Christine Henning Gastkritikerin: Anette Frankenberger Bezeichnete Räume – PARS PRO TOTO 124 Als ich im Sommer 2008 von der Kuratorin Anette Frankenberger, die damals den Kunstbunker Tumulka betreute, um ein Hochschulprojekt angefragt wurde, hatte ich spontan die Idee, dort direkt auf die Wände arbeiten zu lassen. Für diesen ungewöhnlichen Ausstellungsort im öffentlichen Raum, in den die Außenwelt nicht vordringen kann, wurden von den Seminarteilnehmern Raum-bezogene Wandprojekte entwickelt, die die sieben Ebenen des Hochbunkers an der Prinzregentenstraße in ein Panoptikum optischer, haptischer und akustischer Reize verwandeln sollten. Nach der Ideenfindungs- und Planungsphase im Wintersemester 2008/09 sollten die erarbeiteten Konzepte vor Ort in den Räumen des Kunstbunker Tumulka im Sommersemester 2009 realisiert werden. Das Team blieb also über den Zeitraum von zwei Semestern zusammen. Als im Januar 2009 das Gebäude überraschend von der Münchner Lokalbaukommission aus Brandschutzgründen für jegliche Art von Veranstaltungen gesperrt wurde, musste spontan umgeplant werden: Es entstand das Ausstellungsprojekt „pars pro toto“, dessen Konzeption sich an den vorhandenen Rahmengrößen ( Din A 0 ) in der Karlstraße orientiert. Stellvertretend für das jeweilige Raumkonzept im Kunstbunker entwickelten die Teams repräsentative Ausschnitte der Wandgestaltungen und realisierten das Projekt im Sommer 2009 im 2. Stock als autonome Ausstellung anhand von Modellen und Versatzstücken, die die ursprünglich geplante Verortung verdeutlichen. 125 Stadt auf dem Kopf Christoph Kersch, Astrid Neukirch Nach der Besichtigung des Bunkers fielen uns vor allem die Gegensätze die eine solche Räumlichkeit, eben ein innerstädtischer Luftschutzbunker mit sich bringt, auf. In gewisser Weise ist alles verkehrt. Die äußere Form zeigt nichts vom Inneren. So riesig wie der Baukörper von außen wirkt so klein ist er im Inneren. Niedrige Räume, enge verwinkelte Raumabfolgen ohne jedliche Klarheit die man von diesem Baukörper erwartet. Trotz der Lage ist die Stadt im inneren nicht spürbar, kein Geräusch hörbar, keine Menschen zu sehen. Daraus entstand unsere Idee die Stadt wieder ins Innere zu bringen und aus Konsequenz des Verkehrten diese auf den Kopf zu stellen. Weiterhin wird sie abstrahiert, d. h. durch Rechtecke dargestellt, welche die Stadtansicht an den Wänden und die Grundrisse und Aufsichten an Decke und Boden aufzeigt. Als weiteren Gegensatz soll aus der Stadt wiederrum das Land entstehen. Dies geschieht durch Schaukästen die aus der abstrakt dargestellten Stadt entstehen. Von der Stadt führen Linien zu den an der Wand montierten Schaukästen. Die Darstellung des Landes, des Ruhepols, wird durch Aufnahmen erfolgen. Diese Fotografien sollen weniger typische Landschaftsbilder zeigen, sondern eher Bilder mit Tieraufnahmen, die zu einer gedanklichen Verbindung zum Land führen. Die auf witzige Weise dargestellten Bewohner sind bewusst gewählt, da dieser angestrebte Witz auf keinen Fall in einem ehemaligen Bunker negative Stimmung erzeugen soll. Was sehr wichtig für unser entstandenes Konzept war. Um die Idee des auf den Kopfstellens auch farbliche aufzuzeigen, wird die Stadt in Grün und das Land in Blau dargestellt. 126 Begrenzen, Auflösen - Bezeichnen, Labyrinth Veronika Schmid, Benedikt Welz Dieses Konzept besteht aus zwei Arten mit den gegebenen Räumen umzugehen. Einmal das Thema bezeichneter Raum wörtlich zu nehmen und durch Bezeichnung und Bemaßung den Raum in seinen Ausmaßen und auch in der Funktion der Einzelteile (Wand, Decke, ...) völlig in seine Schranken zu weisen. Dagegen steht das „Labyrinth“. Dieses löst die Raumgrenzen so gut wie auf. Lässt die Raumkanten verschwimmen, lässt nicht mehr auf die Größe schließen und schafft eine gewisse Verwirrtheit beim Besucher. BEZEICHNETER RAUM Die Flächen des Raumes werden durch Schablonentechnik mit schwarzer und weißer Abtönfarbe bezeichnet. So steht z. B. auf der Wand in großen Lettern „Wand“. Damit wird die Funktion dieser festgelegt und lässt keinerlei Spielraum, sie als etwas anderes zu sehen. Genauso geschieht es mit den anderen Wänden, dem Boden, der Decke und vielleicht auch noch mit der Türe. Die bezeichneten Flächen erhalten zusätzlich eine Bemaßung in Breite und Höhe aus feinen Maßlinien. Dadurch wird die Dimension des Raumes nochmals weiter eingegrenzt. LABYRINTH Mit einem Overhead-Projektor wird das computergenerierte Labyrinth auf die jeweilige Wand projiziert. Die weißen Flächen werden abgeklebt und anschließend wird das Labyrinth mit schwarzer Farbe aufgetragen. Um Schatten zu vermeiden und den Raumeindruck der Grenzenlosigkeit zu verstärken, werden Boden und Decke schwarz gestrichen. Eine Option wäre, den Weg durch das Labyrinth mit weißer Neonfarbe, die im Schwarzlicht leuchtet, zu kennzeichnen. Was der Besucher mit dem Labyrinth anfängt bleibt ihm selbst überlassen. Ob er es nun als Muster sieht, die Wege nachfährt, oder auf die Idee kommt das Schwarzlicht einzuschalten. 127 Modul 6.3 - 6.5 FWP LB Uwe Gutjahr Barrierefreies Bauen Staatsbauschule München (heutige Hochschule München) Seminararbeit Analyse-Zielplanung-Universal Desgin 128 Barrierefreies Bauen erlebt vor dem Hintergrund demografischen Wandels eine neue Bedeutung für die Gesellschaft. Wie müssen wir bauen, um allen Generationen gerecht zu werden? Die UN Konventionen für die Teilhabe Behinderter wurde in Bayern mit der Novellierung der Bauordnung für die Neubauten umgesetzt. Im Bestand sind zunächst Analysen und Zielplanungen nötig. Barrierefreiheit im Denkmalschutz ist nur im Dialog mit den Fachgremien und Bauhistorikern erreichbar. Das Seminar, das sich mit der ehemaligen Staatsbauschule, der heutigen Hochschule München beschäftigt hat wurde begleitet von der untersen Denkmalschutzbehörde. Funktionsgerechte Gestaltung für alle, dies hat das Universal Desgin zum Ziel, hat den Bereich des Produktdesgin längst erreicht. Die Seminararbeiten beschäftigen sich mit Analysen, Planungskonzepten und Zielplanungen für das Hochschulgebäude. Für einen Bereich der Erschließung, der Funktionsräume oder des Innenausbaus konnten die Grundzüge des Universal Desgin exemplarisch angewendet werden. 129 Barrierefreies Bauen Die Arbeit im Wahlpflichtfach „Barrierefreies Bauen“ gliederte sich in drei aufeinanderfolgende Schritte; zunächst die Analyse, der die damit zusammenhängende Übung folgte und abschließend ein unabhängiges Design-Thema. Analyse sowie Übung befassen sich in diesem Fall mit dem Herzstück des Fachhochschulgebäudes in der Karlstraße, dem Lichthof. Dieser wurde auf Barrierefreiheit untersucht und anschließend mit praktischen Vorschlägen dahingehend verbessert. Erwähnenswert sind hierbei vor allem die schlechten Lichtverhältnisse und die undeutliche Ausschilderung optischer sowie taktiler Hinsicht in allen Ebenen des Lichthofs. Diese Aspekte zeigen, dass sich Barrierefreiheit keinesfalls nur auf ausreichende Türbreiten und automatisch öffnende Türen beschränken lässt. Einen wichtigen Aspekt stellt bei der Analyse dieses Gebäudes auch der Denkmalschutz dar, der unter Umständen auch eine Abweichung von den Normen bewirken kann. Im Zuge einer Sanierung würde das Galerie-Geländer nach Absprache mit dem Denkmalschützer aus diesem Grund erhalten bleiben, da es durch seine äußerst filigranen Bauteile und seine seltene Transparenz und Zierlichkeit ein wertvollen gestaltprägenden Bestand darstellt. Elisa Wimmer, Michaela Wimmer Bestandsaufnahme Geländer Lichthof Zur Verbesserung der Licht- und Ausstellungssituation im Lichthof schlagen wir Lichtvouten vor, die die neu gestrichenen Decken mit indirektem und blendfreiem Licht bestrahlen und so Schlagschatten verhindern. Sie schaffen ein helles und freundliches Raumklima, das sehbehinderten Personen den Zugang und die Orientierung erleichtert sowie eine ansprechende Ausstellung an den Seitenwänden ermöglicht. Anstatt der massiven Ausstellungstafeln soll ein flexibles und transparentes Seilsystem das Ausstellen von verschiedenen Planformaten ermöglichen und bei Nicht-Nutzung die Sicht auf die charakteristische homogene Holzvertäfelung freilassen. Zudem sollen flächenbündig in das Holz der Türblätter eingelassene Edelstahlziffern die Orientierung erleichtern und die Zugangstüren zu den Räumen im homogenen Wandbild deutlich kennzeichnen. Eine Kennzeichnung des Stockwerks muss an den jeweiligen Zugangstüren zum Lichthof erfolgen. Vorschlag für neues Ausstellungskonzept 130 Entwurfsthema stellte die barrierefreie Gestaltung des Sekretariats der Fakultät für Architektur dar. Die Annäherung erfolgte zunächst über Formstudien. In der weiteren Bearbeitung über Materialstudien, um geeignete Materialien zu finden, die einer barrierefreien Gestaltung genügen. Dabei wurden Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Verbundwerkstoffe und Gipswerkstoffe in Betracht gezogen. Beim Entwurf des barrierefreien Tresens wurde vor allem Wert gelegt auf eine ansprechende Gestaltung; auf die Symbiose von Funktionalität und Design. Verschiedene Skizzen zeigen, dass sich die Anforderungen an zwei Tresenhöhen und die Unterfahrbarkeit auch sehr gut mit architektonischem Gestalten in Einklang bringen lassen. Barrierefreies Bauen soll nicht länger als „unschön“ und bloßes Einhalten von Maßen gesehen werden, sondern auch zur Entwicklung von innovativen Formen führen. Die ausgewählten Materialien erfüllen die Anforderungen des barrierefreien Bauens wie beispielsweise matte und leicht zu reinigende Oberflächen und bieten trotzdem ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Der entworfene Tresen gewährleistet die Unterfahrbarkeit sowie die Einhaltung der barrierefreien Tresenhöhe von 85 Zentimetern. Die Materialwahl fiel auf den Verbundwerkstoff Corian, der sich durch beliebige Formgebung und eine sehr robuste Öberfläche auszeichnet. Diese ist in mattem Zustand erhältlich und leicht zu reinigen. Durch den hellen Grünton wird eine optisch kontrastreiche Gestaltung erreicht und zugleich eine Verbindung zum Standort aufgenommen; der Tresen leuchtet im „Fachschafts-Grün“. Materialstudien Design: Formfindung Barrierefreies Design 131 Bachelorarbeit Prof. Jörg Weber Prof. Gilberto Botti Prof. Heinz Fischer Prof. Martin Zoll allochthoneum haus der kulturen muenchen 132 prolog um 1800 lebten lediglich zwei prozent der erdbevoelkerung in groesseren siedlungen, einhundert jahre spaeter waren es 10 prozent, heute lebt die haelfte der weltbevoelkerung in staedten oder staedtischen verdichtungsgebieten. und einer UN_studie zufolge werden es im jahr 2050 75 prozent der weltbevoelkerung sein, die in gigantischen megacities leben werden. ‚die kultur unserer zeit ist die der stadt’ (matzig, sz 05.5.09), auch vom ‚jahrhundert der staedte’ ist haeufig dieser tage die rede. ‚urbanistik’, eine querschnitts-wissenschaft, die eine vielfalt von disziplinen vereinigt - darunter nicht zuletzt die architektur - ist ein zentrales thema in den kulturwissenschaften und den bildenden kuensten geworden. staedte entstehen bzw. wandeln sich nicht von selbst, sondern werden von menschen gemacht. staedtische raeume bilden gesellschaftliche strukturen ab, sind ausdruck zeittypischer konditionen. architektur gestaltet die raeume der stadt - vielfaeltige, praegnante, offene raeume braucht die stadt der zukunft, offen fuer interpretationen und offen fuer den vielfaeltigen gebrauch einer urbanen gesellschaft (wolfrum, multiple city). in einer gesellschaft, die aus immer mehr kulturell entwurzelten migranten (diaspora) bestehen wird, sind raeume zur pflege von traditionen und kulturen fuer den erhalt der persoenlichen identitaet lebensnotwendig. stadtveraenderung ist muehevolle detailarbeit: sanftes steuern von komplexen prozessen – vergleichbar mit der akupunktur in der medizin. das thema der bachelorarbeit in diesem semester ist der versuch, im zeitalter der urbanitaet die richtige nadel an die richtige stelle zu setzen. konzeption im allochthoneum – haus der kulturen muenchen wird eine organisationsform verwirklicht, die soziale dienstleistungen der stadtverwaltung, kulturelle wie soziale veranstaltungen und moeglichkeiten der entfaltung eigener aktivitaeten zusammenfuehrt. kernelemente dieser organisationsform sind weitgehende dezentralisierung und zusammenlegung von dienstleistungen zu einem ganzheitlichen hilfe- und veranstaltungsangebot. neben der beratung von hilfesuchenden und hilfeberechtigten steht vor allem die unterstuetzung und foerderung des miteinander von generationen, nationalitaeten und kulturen im vordergrund. das allochthoneum – haus der kulturen muenchen ist offen fuer alle. es ist ein treffpunkt, der raum schafft fuer persoenliche begegnung und geselligkeit. hier koennen alte kontakte gepflegt und neue geknuepft werden, ueber das gemeinsame tun koennen beziehungen wachsen, die auch im alltaeglichen leben bestand haben. die bildungsangebote im allochthoneum – haus der kulturen muenchen reichen vom gedaechtnistraining, sprachkursen oder tanz bis zur computerbegleitung, von vortraegen, literaturkreisen bis hin zu festen und hochzeiten. das allochthoneum – haus der kulturen muenchen eroeffnet allochthonen wie autochthonen mitbuergern die moeglichkeit, sich buergerschaftlich zu engagieren, selbst aktiv zu werden und neues allein oder zusammen mit anderen in gang zu bringen. es lebt vom engagement der menschen, die es besuchen. ort in muenchen - schwabing steht fuer das allochthoneum – haus der kulturen muenchen an der schleissheimer-straße gegenueber der einmuendung der lerchenauerstraße eine restflaeche im stadtgrundriss als ‚urban island’ zur verfuegung. das gelaende einer ehem. gaertnerei (schleissheimer-str. 228) liegt noerdlich der hauptverkehrsachse ackermann-/ karl-theodor-straße und westlich der großen gruenflaeche des luitpoldparks. in unmittelbarer naehe befinden sich saemtliche einrichtungen, nutzungen und bauformen einer gemischten, tradierten stadtstruktur. daraus resultiert ein hohes potential fuer den entwurf eines ‚stadtbausteins’. aufgabe auf dem grundstueck an der schleissheimer-straße in muenchen-schwabing soll eine gebaeudekonfiguration fuer das allochthoneum – haus der kulturen muenchen (house of the cultures munich) entwickelt werden, die in ihrer architektonischen erscheinung, ihrer integration in die umgebung und ihrer inneren struktur den anspruch eines kulturbaus erfuellt. die programmvorgaben bzw. die funktionsvorschlaege sind so angelegt, dass eine bauliche struktur fuer eine spezifische kulturelle einrichtung entstehen kann. ziel der aufgabenstellung ist ein bau hoechster architektonischer qualitaet und nachhaltigkeit; ein bau, der das stadtraeumliche gefuege in schoenster weise ergaenzt und ihm zu einem einpraegsamen ensemble muenchens verhilft. oberstes anliegen der aufgabe ist nicht, das baurecht auszureizen, sondern eine vertraegliche, leistungsfaehige struktur zu finden, die den standort angemessen behandelt, seine qualitaeten nutzt und steigert, den besonderen ort definiert und eine eigene identitaet entwickelt. 133 Allochthoneum STADTRAUM Die Schleißheimerstraße – eine der größten Straßen Münchens – ist eine wichtige Einfallsstraße von Norden ins Münchner Stadtzentrum. Trotz ihrer Bedeutung wird sie kaum wahrgenommen, da sie an keiner Stelle eine Aufenthaltsqualität generiert. Daher soll mit dem ALLOCHTHONEUM ein Landmark gesetzt werden um einen bis dato nicht vorhandenen Ort zu erzeugen. Der Entwurf bezieht sich lediglich mit seiner „Schnauze“ auf den Kontext. Sie stellt eine Verbindung in Richtung Westen zum Olympiapark her. Ansonsten wird auf den Kontext keine Rücksicht genommen. Denn das ALLOCHTHONEUM ist in seiner Form und Gestalt selbst allochthon. Somit solidarisiert es sich mit den Menschen für die es geplant wurde. Dazu kommt, dass das Grundstück von unattraktiven Gebäuden umgeben ist. Daher setzt es den Maßstab für die Zukunft. ENTWURF UND KONZEPT Für den Entwurf war das Möbius-Band die Ausgangsform. Sein verbindlich Unverbindliches, sowie seine ästhetische Form ist Basis für das Gebäude. Aus der Einfachheit dieses Prinzips entstand ein offener Raum, der vier verschiedene Nutzungsbereiche mit differenzierten Anforderungen beherbergt, aber dennoch als ein Gebäude für jeden Menschen gilt. Das Möbius-Band wurde in Form von Rampen umgesetzt, die als Aorta des ALLOCHTHONEUMS fungieren. Sie sind Haupterschließungs- sowie wichtigstes Gestaltungselement des Gebäudes. Von jedem Standpunkt aus bieten sie Einblicke in die verschiedenen Bereiche. So findet die gewünschte Kommunikation zwischen seinen Besuchern statt. Denn durch das Rampen-Prinzip queren sich alle Wege und man ist im ständigen Kontakt mit seiner Umgebung. AUSSENBEREICH Die Freiflächenplanung ist ein wichtiger Faktor. Aus dem Gebäude heraus verlaufen Linien ins Freie, bilden Plätze und Rampen und lassen so eine Interaktion zwischen Innen und Außen, aber auch zwischen Außen und der angrenzenden Umgebung entstehen. Sie fungiert quasi als „Anker“ und lässt das Gebäude an diesem Ort ankommen und Wurzeln schlagen. Der Bau nördlich ist ein wichtiger Antipode des ALLOCHTHONEUMS. Dort findet man internationale Geschäfte, Cafés, Restaurants und Institutionen. Dazwischen entsteht eine kleine Straße – nur für Fußgänger und Radfahrer – die einen in den Luitpoldpark führt. Der Passant soll das Gefühl eines „Erlebnisses“, von internationalem Flair erfahren wenn er diesen Weg wählt - auf der einen Seite die Erscheinung des Kulturhauses mit seinen Menschen und auf der anderen Seite Essen, Trinken, und Gegenstände aus aller Welt. 134 Christine Gentsch 135 ArchitekKulturkommunikation Interkulturelle Kommunikation ist der formbeherrschende Parameter, der Gebäudekörper. Interkulturelle Kommunikation basiert auf Körpersprache, Architektur ist hier Mittel zum Zweck, sie versteht sich als Sprachrohr/Kommunikator, zwischen multikulturellen Besuchern/Stadtbewohnern. Zeichenhafte klar lesbare Gebäudelinien erklären den Komplex. Die Geometrie der Faltung als formbildendes Element generiert ein Modell der Transformation im urbanen Raum. Die Faltung schafft hier vielfältigste Möglichkeiten um den Raum nicht mehr in Kategorien oben, unten, außen, innen zu klassifizieren, Raumkontinuen beseitigen die Grenzen des Öffentlichenraums und bilden so die benötigten Zwischenräume. Allochthoneum! Um eine klar lesbare städtebauliche Aussage zu formulieren organisiert sich der verbindende Streifen zwischen den beiden Parks, mit Hilfe der Falte von der Fläche zum Körper, und so zu einer plausiblen Architektur. 136 Nicolas Neumann 3 Körper verknüpft mit Hilfe der Faltung und der gleichen Architektursprache bilden das Allochthoneum. Um kulturübergreifende Dialoge zu schaffen wird, wie schon oben erwähnt, mittels der Faltung ein vielfältiges Raumkontinuum generiert, welches keine Klassifizierungen hierarchischer oder nationaler Art erlaubt. Architektur als Brückenschlag der Kulturen. Organisation der Gebäude ist inszeniert durch Sichtbeziehungen zum Olympia – und Luitpoldpark, sowie den prominenten Treppenaufgängen der mehrgeschossigen Bauten. Ein Erschließungskern in allen drei Gebäuden organisiert die Verkehrsflächen und ist mit verantwortlich für die Statik. 137 Allochthoneum Matthias Röckers ERLÄUTERUNG STÄDTEBAUKONZEPT Mit dem Neubau des Allochthoneum - Haus der Kulturen München - soll eine Neustrukturierung des Grundstückes einer alten Gärtnerei an der Schleißheimer Straße geschaffen werden. Durch das Entschleunigen der Lerchenauer Straße wird der Verbindungsachse von Olympiapark und Luitpoldpark mehr Aufmerksamkeit geschenkt und die Verbindung tritt optisch hervor. Diese Verbindungsachse wird genutzt, um den vorhandenen Grünstreifen in den städtischen Raum einzubinden. Die „Verzahnung“ von städtischem Straßenraum und Parklandschaft findet nun in einem fließenden Übergang auf der Verbindungsachse statt. Die Gebäude fügen sich als kompakte Baukörper in die Verbindungsachse ein, treten von der Schleißheimer Straße zurück und unterbrechen so bewusst die Straßenflucht. Dies kann auch als Abfolge in Bezug auf das Nordbad gesehen werden, an dem die Flucht der Schleißheimer Straße auch bewusst unterbrochen ist um den Gebäuden so einen besonderen Stellenwert zu geben. So entsteht ein attraktives Ensemble mit Außenraumbezügen zu den vorhandenen Grünräumen, wie dem Luitpoldpark, und dem städtischen Raum der Schleißheimer Straße. ERLÄUTERUNG GEBÄUDEKONZEPT Der kompakte Baukörper weist im Foyerbereich einen Atriumcharakter auf, der Sichtbeziehungen zwischen den einzelnen Nutzungsbereichen des Gebäudes zulässt und so zur offen Kommunikation der Kulturen beiträgt. Auch die Glasfassade des Gebäudes trägt zu vielfältigen Sichtbeziehungen bei. So ist aus dem Kulturtreff das Treiben im Foyer und vor dem Cafè zu beobachten und Bibliotheksbesucher können beim Lernen oder Lesen den Ausblick ins Grüne des Luitpoldparks genießen. Der Saal ist auf Erdgeschossniveau im Osten des Gebäudes platziert. Durch die zum Luitpoldpark orientierte Terrasse vor dem Saal sind auch Veranstaltungen mit Außenbezug oder kleine Freiraumtheater möglich. Das Cafè / die Lounge ist im Süden des Gebäudes angeordnet und soll, auch durch außenliegende Sitzgelegenheiten, mit dem vorgeschlagenen gegenüberliegenden Ladenbereich kommunizieren und einen belebten städtischen Raum mit Parkcharakter schaffen. Die Versorgungsräume wie Küche und Anlieferung sind im Norden des Gebäudes angeordnet. Sie bilden zusammen mit der Tiefgaragenzufahrt den Rücken des Gebäudes. Insgesamt tragen Innen- und Außenraum zu einem identitätstiftenden Ensemble bei. ANLIEFERN - TIEFGARAGE Ansicht West 1:200 138 MÜLL - LAGER KINDERBETREUUNG EINGANG CAFÈ FUSSGÄNGER - CAFÈ TERRASSE B ZUFAHRT TIEFGAR AGE ANLIEFERN KÜNSTLER Lichtsäulen Müll / Wertstoffe 27.04 m² Catering 83.74 m² Bandumkl. 36.14 m² Bandaufenthalt 39.52 m² Lager Catering 27.04 m² Kühlung Fahrräder Fahrräder WC H 26.62 m² Pumi Bühnenbereich / mobile Bühne Kinderbetreuung 57.20 m² WC B WC D 26.62 m² Abstell 13.00 m² Saal 447.93 m² VORPLATZ SAALTERRASSE AUSSENVERANSTALTUNG Blick in Luitpoldpark ALLOCHTHONEUM Foyer 160.28 m² WF A A Garderobe / Info 21.06 m² Lager Cafè 19.59 m² Cafè / Lounge 172.00 m² CAFÈ B CAFÈ Stuhllager / Medien 55.39 m² TERRASSE Ladenzone + 12,15 DACHAUFBAU Extensivbegrünung Wärmedämmung Stahlbetondecke Akustikdeckensegel Kühlung Bauteilaktivierung FASSADE KUNDENBEDIENBEREICH vorgehängtePfosten-Riegel Konstruktion in Structural Glazing Ausführung offene Bereiche mit Sonnenschutzverglasung + 8,10 geschlossene Bereich mit getönten Glaspaneelen FENSTER Öffnungselemente zum klappen (evtl. Nachtauskühlung) GRUPPENTREFF Blick auf Vorplatz + 4,05 WINDFANG ± 0,00 139 ALLOCHTHONEUM HAUS DER KULTUREN // MÜNCHEN Der Kreis ist in jeder Kultur und Religion fest verankert, wie zum Beispiel durch den Ring, die Münze, oder das Rad. Die im gleichen Abstand um das Zentrum angeordneten Punkte bilden eine ideale, geometrische Figur, die mit der menschlichen Hand nur annähernd gezeichnet werden kann. Vom Kreis leiten wir vieles ab, vom Heiligenschein, über die Sonnenscheibe bis hin zur Mündung eines Gewehrlaufes. Die Offenheit und uneingeschränkte Zugänglichkeit zu allen Bereichen waren vvon Anfang an die wichtigsten Ziele des Entwurfs. Die Aufhebung der physischen Grenze zwischen Innen- und Außenraum lässt das Gebäude mit dem Stadtraum verschmelzen. Durch die markante Form tritt es hervor und bildet somit einen besonderen Ort in der Stadt. Die vertikale Addition der einzelnen Funktionen lässt den Betrachter an einen Spaziergang durch verschiedene Stadtteile, mit ihren wechselnden Fassaden, den unterschiedlichen Charakteren der Straßenzüge, den Plätzen und Parks erinnern. Die offenen Grundrisse bedienen keine speziellen Funktionen, viel mehr lassen sie Raum für die unterschiedlichsten Aktivitäten. Die städtebauliche Situation an der Schleißheimerstraße Ecke Lerchenauerstrasse ist sehr diffus. Die Blockrandbebauung wurde größtenteils aufgegeben und ein Städtebau, der klar von der Moderne geprägt ist, schafft einen zergliederten Stadtraum. Das Ziel ist, neben dem Kulturzentrum einen Stadtbaustein zu formen, dessen dichte, urbane Struktur als Vorbild für zukünftige Projekte in der Umgebung dienen soll. Einzelne, schmale Stadthäuser für mehrere Parteien bilden einen geschlossenen Block. Alle Wohnhäuser haben die gleiche Höhe, werden jedoch durch singuläre Gebäude, die aus den Blöcken emporragen, differenziert. Sie beinhalten weitestgehend gewerbliche Nutzungen. Ein Parkhaus ist ebenfalls in den Block integriert. Darin befinden sich unter anderem die Parkplätze der Mitarbeiter des Kulturzentrums. Der geschlossene Block auf der Seite des Kulturzentrums schafft eine klare Kante zwischen Stadt und Park. Dadurch wird die Idee der Moderne, ein Wohnhochhaus im Grünen, verneint. 140 Maximilian Kamlah 141 Master 03 Projektstudio II Prof. Johann Ebe urwaldakademie sheramentsa in ecuador 142 der auszug der indios aus den urwaeldern suedamerikas schreitet in dem maß voran, in dem durch die einfluesse aus der westlichen zivilisation direkt & indirekt ihre lebensgrundlagen obsolet werden: sei es durch landnahme fuer rodung & intensivierung der viehwirtschaft, abholzung & inanspruchnahme großer flaechen fuer die oelfoerderung, sei es durch den unumkehrbaren wunsch der einheimischen das naturverbundene & aber auch auf ebendiese natur beschraenkten leben aufzugeben & an den (vermeintlichen & tatsaechlichen) segnungen der modernen zivilisation teilzuhaben. die stiftung <amazonica> - hervorgegangen aus der <indio-hilfe e.v.>hat es sich zum ziel gesetzt, den bewohnern des 120-seelen-dorfes sharamentsa, im urwald der region pastaza in ecuador zu einer oekonomischen lebensgrundlage zu verhelfen, die es ihnen ermoeglicht, in ihrem dorf zu bleiben & trotzdem an die moderne angeschlossen zu sein. als naheliegende erwerbsquelle draengt sich zunaechst der tourismus auf, wobei er in der form, wie er vielerorts im amazonasgebiet ueblich geworden ist - eine art abenteuerurlaub fuer wohlhabende - jedoch nicht ohne extreme banalisierung & kommerzialisierung auskommt & in verbindung mit den investoren-interessen, die meist von außerhalb des urwaldes kommen, die probleme nicht loest, sondern neue schafft: durch gewinnmaximierung & -abschoepfung & abfluss der gewinne nach „draussen“ fallen fuer die indigene bevoelkerung in der regel nur minderqualifizierte jobs & souvenirproduktion ab & sind ueberfremdung & proletarisierung der indios vorprogrammiert. durch das projekt der stiftung, das gemeinsam mit der tourismusfakultaet der hochschule muenchen entwickelt wurde, soll sogenannter wissenschafts-tourismus etabliert werden - es werden nur touristen angesprochen & in den urwald geholt, die ein uebergeordnetes - im weiteren sinne wissenschaftliches interesse an ethnografischen, oekologischen, botanischen, zoologischen fragestellungen verfolgen. fuer diesen personenkreis - lt. untersuchungen der tourismus-fakultaet handelt es sich um ein weltweit wachsendes tourismus-segment - sollten zusammen mit den betroffenen indios unterkuenfte fuer studenten & gastprofessoren&-wissenschaftler entworfen werden. der entwurf ist bestimmt durch die klimatischen bedingungen - des tropischen regenwaldes, die besonderheit des ortes - am rion pastaza mit atemberaubender aussicht nach westen bis zu den anden - & die vor ort verfuegbaren materialien materialien: lehm, bambus & holz. die lehreinrichtung besteht aus mehreren unterrichtsraeumen unter einem zusammenfassenden flaechentragwerk aus bambus mit folienbespannung & in 2 geschwungen angeordneten baukoerpern, einen gemeinschaftlichen hof bildenden unterkunftsgebaeuden. 143 urwaldakademie sheramentsa in ecuador Im Mai 2009 hatten wir die Möglichkeit, Entwürfe für eine Urwaldakademie im tropischen Regenwald von Ecuador zu entwickeln. Diese soll im 90 Seelendorf Sharamentsa im Amazonasbecken, nahe der peruanischen Grenze, entstehen. Zum einen könnte sie dem Austausch der Indio- Völker untereinander dienen, zum anderen Ausgangspunkt für die Forschung durch kleine Studentengruppen aus der ganzen Welt werden. Der Entwurf des Akademiegeländes beginnt mit einer Begehung des Grundstückes. Anders als gewohnt, ist hier die Fläche komplett von Vegetation eingenommen und kaum überschaubar. Ein Fortschreiten ist nur mit Einheimischen und deren Macheten möglich. Da das Grundstück sich direkt am Rio Pastaza befindet, steht schnell fest, dass der Bezug zum Wasser ein wesentlicher Punkt unseres Entwurfes werden soll. Zunächst versuchen wir die Baukultur der Achuar genauer kennen zu lernen. Dazu steht eine Baustellenbesichtigung eines Wohnhauses und Gespräche mit Dorfangehörigen auf der Tagesordnung. Die folgenden Tage versuchen wir die ortstypische Bauweise auf ihre Vor- und Nachteile bezüglich Struktur und Materialien zu untersuchen. Um die Logistik des Projektes realistisch zu gestalten, müssen primär Baustoffe aus der näheren Umgebung verwendet werden. Dabei stellt sich heraus, dass der reichlich vorhande¬ne Lehm als Baustoff bisher nur in gebrannter Form, also als Ziegel in Erwägung gezogen wurde. Im ungebrannten Zustand, vermengt mit Stroh, benötigt dieser jedoch keine Herstellungsenergie. Bambus wird bisher lediglich als Unterkonstruktion der Dächer benutzt, obwohl dieser auch die Dachhaut ausbilden kann. Dadurch kann auf das wöchentliche Räuchern der Wohnräume als Schutz vor Parasiten verzichtet werden. Läuft alles nach Plan, kann bereits 2010 mit dem Bau des ersten Abschnittes, den Unterkünften, begonnen werden. 144 Korbinian Kainz, Andres Rodrigues, Carina Obermair 145 Diplomstudiengang Entwerfen II / III LB Franz Wimmer Entwurf einer Kartause Wohnen und Arbeiten Individualität und Gemeinschaft 146 Sakralbau als Inspirationsquelle Im ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts unternahm der 20-jährige Charles-Edouard Jeanneret, der sich später Le Corbusier nennen wird, eine ausgedehnte und für seine weitere Entwicklung folgenreiche Studienreise nach Italien. In der Nähe von Florenz, beim Ort Galluzzo im Tal des Flusses Ema, besuchte er das Kloster der Kartäuser-Mönche und entdeckte dort eine Raumorganisation, welche die Individualität der Mönche in ihren „Wohnzellen“ auf ideale Weise mit dem kontemplativen Gemeinschaftsleben der Ordensbrüder verbindet. Le Corbusier sah in dieser Erkenntnis und der Entdeckung des Klosterbaus die Wurzeln seines gesamten späteren Schaffens: „Der Anfang meiner Forschungsarbeiten fällt zusammen mit dem Besuch der Kartause von Ema bei Florenz im Jahre 1907. In dieser musikerfüllten Landschaft der Toskana habe ich eine moderne Stadt gesehen die den Hügel krönt. (…) Ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal eine so heitere Interpretation des Wohnens kennenlernen würde. (..) Diese „moderne Stadt“ stammt aus dem 15. Jahrhundert. Ihre strahlende Vision ist für immer gegenwärtig geblieben“ (Le Corbusier, Feststellungen zur Architektur) Aufgabe Entwurf eines modernen Gebäudekomplexes einer Kartause an einem selbstgewählten Ort. Eine Gemeinschaftsanlage dieser Art funktioniert im Grunde genommen wie eine kleine kompakte Stadt. Das Raumprogramm sieht neben individuellen Wohnhäusern mit Arbeitsbereichen vor allem auch Gemeinschaftseinrichtungen wie eine Bibliothek, Lesesaal (Kapitelsaal), Speisesaal (Refektorium), eine Kirche, Gemeinschaftsunterkünfte und Wirtschaftsgebäude vor. 147 Kartause, Wohnen und Arbeiten, Individualität und Gemeinschaft ZUR ORTSWAHL Als Ort wurde der Berg Okit in Kroatien gewählt. Üblicherweise sind Kartausen an solch abgeschiedenen Orten vorzufinden. Zusätzlich befindet sich die Kirche der Mutter von Karmela auf dem Berg Okit, die immer wieder durch Kriege zerstört wurde. Nikola Basic gewann 1992 den Wettbewerb zum Wiederaufbau dieser Kirche. Der Entwurf wurde nach dem Jugoslawienkrieg umgesetzt. Das milde Klima und die freundliche, fruchttragende Landschaft ermöglichen die Realisierung einer kleinen Einsiedelei eher. KONZEPTERLÄUTERUNG Grundform des Entwurfs ist eine durchgehende strenge Linie, die zusammen hält, die Raum schafft, die eine Grenze zum Berg bildet, die unendlich in Richtung Meer weitergeführt werden kann. Es wurde die Bergseite zum Meer als Standort gewählt. Die Kartause hat zwei Blickbezugsrichtungen. Einmal die zum Meer und einmal die zum Berg. Die drei Bereiche sind im Konzept gut voneinander zu unterscheiden. (Anfangs der Wirtschaftsteil in drei Gebäudezeilen, in der Mitte der zentrale gemeinschaftliche Bereich mit dem zentralen Platz, hinten der individuelle Wohnbereich in Viererreihenhäuser) Zur Betonung der Form des Berges herum und zur Raumqualitätserzeugung war eine Dehnung des Konzeptes notwendig. Dabei entstanden Freiflächen innerhalb des Komplexes. Thematisiert wurde bei dieser Kartause ganz stark der Anfang und das Ende. Die Pforte als einladender Eingang; damit befindet man sich nicht plötzlich mitten in der Kartause. Als Endpunkt die Kapelle. Lageplan 148 Katarina Juran Grundriss EG gemeinschaflicher Bereich: Ansicht zum Berg gemeinschaflicher Bereich: Schnitt B-B 149