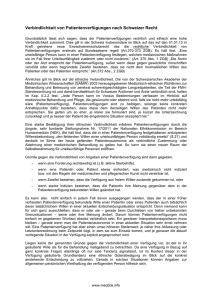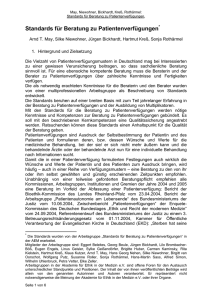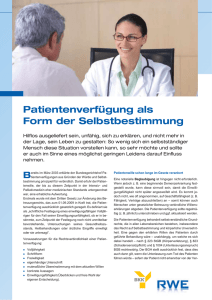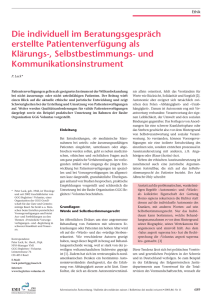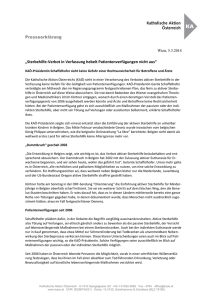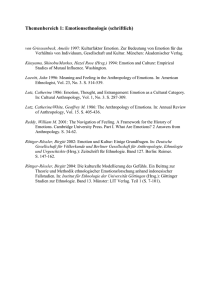Michi Knecht, Humboldt-Universität zu Berlin
Werbung

Michi Knecht Jenseits von Kultur: Sozialanthropologische Perspektiven auf Diversität, Handlungsfähigkeit und Ethik im Umgang mit Patientenverfügungen Deutsche Zusammenfassung: In Anerkennung der für Gegenwartsgesellschaften konstitutiven Diversität ihrer Bevölkerungen diskutieren Bioethik und Medizin verstärkt die kulturelle Relativität ihrer eigenen Voraussetzungen, die Kulturspezifik "anderer" Positionen und die Möglichkeiten kulturübergreifender Orientierungen. Dabei kommt häufig ein Kulturbegriff zum Einsatz, der aus der Perspektive der aktuellen Sozial- und Kulturanthropologie zu statisch, zu homogenisierend und zu sehr auf Differenz und Abgrenzung hin orientiert ist. Der Beitrag diskutiert zunächst Konzepte von Kultur, die solche Verkürzungen zu vermeiden suchen. Sie betonen hingegen Verflechtungszusammenhänge unter dem Vorzeichen intensivierter Globalisierung und deuten Kultur aktiv und reflexiv, als Ressource menschlichen Tuns, und nicht deterministisch als Kausalfaktor. Anschließend wird der ethnographische Forschungsstand zu Patientenverfügungen in westlichen Gesundheitssystemen zusammengefasst. Zeitintensive, qualitative Forschung verdeutlicht die Gefahr einer Kulturalisierung sozialer Ungleichheiten, die spezifische Positionalität bioethischer Prämissen und die Vielfalt und Komplexität im Umgang mit Patientenverfügungen. Der Beitrag schließt mit Hinweisen darauf, wie Diversität in Entscheidungsprozessen am Ende des Lebens jenseits von Kultur analysiert werden kann. Schlüsselwörter: Kultur, Ethnographie, kulturelle und soziale Diversität, Sterbeprozesse, Patientenverfügungen, Entscheidungen am Lebensende Beyond culture. Perspectives from social anthropology on diversity, agency and ethics in dealing with advance health care directives Definition of the problem: In acknowledgement of diversity as a constitutive dimension of contemporary societies, bioethics and biomedicine increasingly reflect on the cultural relativity of ethic presuppositions, on the cultural specificity of "other" positions and on the possibility of universal orientations. From the perspective of contemporary cultural and social anthropology, however, the concept of culture used in this debates often appears to be too static, too homogenizing and exceedingly oriented towards difference and demarcation. Arguments: The article discusses concepts of culture that try to avoid such reductionisms. They instead foreground the hybridity and entangledness of all cultures, and view culture as active and reflexive, as a resource for human agency rather than a deterministic, causal force. Subsequently, ethnographic research on advance care directives in Western health systems is reviewed and evaluated. Conclusion: Intensive qualitative research reveals the complexities and pluralities in dealing with advance care directives. It further demonstrates the positionality of bioethics premises and points to the dangers of culturalizing social differences. The article concludes with a sketch of analytic possibilities to explain diversity in end of life decisions making beyond the concept of culture. 1 Key words: Culture, ethnography, social and cultural diversity, processes of dying, advance care directives, decision making in end-of-life situations Lange Zeit hat sich vor allem das deutsche Gesundheitssystem schwer getan mit der Anerkennung der Tatsache, dass durch zunehmende Mobilität, Globalisierung und Migration auch die Akteure im medizinischen Feld – Patientinnen und Patienten genauso wie Pflegeprofessionen, Ärztinnen und Ärzte, Forschende – nachhaltig heterogenisiert werden. Konfrontiert mit einer ausgeprägten Pluralität von Lebensstilen, Wertehorizonten und, Identifikationen sowie mit steigender sozialer Ungleichheit in Bezug auf materielle Ressourcen und Bildungszugänge stellt sich für Medizin, Pflege und Bioethik die Frage nach dem professionellen Umgang mit Diversität im Medizinbereich gegenwärtig mit Dringlichkeit. Damit verbunden ist die Frage, welche Relevanz Kultur und der Anerkennung einer kulturellen Relativität von Werten im Rahmen professionellen medizinischen Handelns und innerhalb der Strukturen des Gesundheitssystems zukommt oder zukommen sollte. Als Spezialdisziplin für kulturellen Pluralismus, Alltag und "fremde" Kulturen werden an diesem Punkt auch die Konzepte und Perspektiven der Sozial- und Kulturanthropologie nachgefragt.1 Das Fach soll – und will das aus seinem Selbstverständnis als kritische Sozialund Kulturwissenschaft heraus auch – beitragen zu einem angemessenen Umgang mit Alterität und Relativismus. Es soll gesellschaftliches Wissen über "kultursensible" oder "kulturspezifische" Themen verbessern und zur Übersetzung und zum Wissenstransfer zwischen "anderen" und "westlichen" Kulturen – in beiden Richtungen – beitragen. Mein Beitrag skizziert in drei Punkten, mit welchen epistemologischen und theoretischen Vorbehalten, mit welchen empirisch-ethnographischen Forschungsdesigns und Ergebnissen und mit welchen Ideen zu einer Neukonzeption des Problems die Sozial- und Kulturanthropologie auf die Nachfrage nach disziplinärer Kompetenz im Forschungsfeld "Patientenverfügungen und Entscheidungsprozesse am Ende des Lebens“ in den letzten Jahren reagiert hat. In einem ersten Punkt erläutere ich, warum das Fach auf die Nachfrage nach Auskünften über "kulturelle Differenz" oder das „kulturspezifische“ Verhalten bestimmter Gruppen in International und vor allem im englischen Sprachraum ist die Bezeichnung „Sozial- und Kulturanthropologie“ üblich. Im deutschen Sprachraum wird auch der Name „Ethnologie“ noch häufig verwendet, sowohl in einer Fokussierung auf europäische wie auf außereuropäische Kulturen. Älteren Datums sind die Bezeichnungen „Volkskunde“ (für eine empirische Alltagsforschung in der eigenen Kultur, die vor allem die Lebensweisen der „Vielen“ und der unteren Schichten oder Klassen beschreibt) und „Völkerkunde“ (für die empirische Alltagsforschung überwiegend zu außereuropäischen und schriftlosen Kulturen). Die in den deutschsprachigen Ländern immer noch existierende institutionelle Trennung von „europäischer“ und „außereuropäischer“ Ethnologie ist in anderen Ländern unüblich. In diesem Artikel verwende ich die Bezeichnungen „Sozial- und Kulturanthropologie“ und „Ethnologie“ synonym. 1 2 biomedizinischen Situationen in den letzten Jahren immer kritischer, um nicht zu sagen: murrend und überdrüssig reagiert. Die Sozial- und Kulturanthropologie führt einen regelrechten Abwehrkampf gegen naive, utilitaristische und reduktionistische Kulturkonzepte, gegen Vorstellungen von Kultur als etwas, das im Inneren einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, einer ethnischen oder religiösen Gruppe permanent verwurzelt ist und das die Entscheidungen von Menschen kausal determiniert. Das zeitgenössische Kulturkonzept, mit dem die Sozial- und Kulturanthropologie heute arbeitet, reflektiert die komplexen Orientierungen von Menschen unter Globalisierungsbedingungen und begreift Kultur immer als eine dynamische, relationale Konstellation. Es eignet sich, so mein Argument, kaum, um dem legitimen Wunsch nach Handlungsanleitungen für den Umgang mit kultureller Pluralität im medizinischen Bereich auf einfache Art und Weise zu entsprechen. In einem zweiten Punkt fasse ich ergebnisorientiert zusammen, was zeitintensive, ethnographisch-sozialanthropologische Forschung mit ihren die Relevanzen der Akteure privilegierenden empirischen Methoden bislang zum Umgang sehr heterogener Gruppen von Menschen mit Patientenverfügungen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Hospizen, erforscht hat. Die ethnographischen Beiträge machen Vorstellungen von der "Kulturspezifik", aber auch von der „autonomen Entscheidbarkeit“ und noch genereller: der Planbarkeit der Prozesse am Ende des Lebens auf den Tod hin zu eher komplexer als einfacher. Sie demonstrieren, dass es ganz bestimmte, sozial verortete Erfahrungen und Interessen sind, die sich in den verallgemeinerten bioethischen Idealvorstellungen selbstbestimmten Sterbens in Patientenverfügungen manifestieren. Und sie beschreiben eindringlich strukturelle Ambivalenzen, sich verändernde Temporalitäten und unabsehbare Wendungen, die sich im Verlauf des Sterbens in den Interaktionsgeflechten zwischen Patienten, medizinischem Fachpersonal, Angehörigen, Behandlungsformen und Pharmazeutika und in der Auseinandersetzung mit Makro-Einflüssen, beispielsweise der zunehmenden Ökonomisierung von Krankheit und Tod, herausbilden. In meinem dritten Punkt skizziere ich ein theoretisches Angebot zur Rekonzeptualisierung von Entscheidungsfähigkeit in biomedizinischen Settings am Lebensende, das eine einfache Gleichsetzung von Wissen, Subjektivität und Bewusstsein mit Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit hinterfragt und die Dichotomie von „individualistischen“ in Abgrenzung zu „kollektivistischen“ Autonomiekonzepten unterläuft. Es betont vielmehr die Interaktivität und unvermeidbare Kontextabhängigkeit von agency und weitet die Perspektive auch auf medizinische Infrastrukturen, Technologien und Materialitäten aus. Das Kulturkonzept ist hier nicht von primärer Bedeutung. Auf diese Weise wird "jenseits von Kultur" noch einmal anders und neu untersuchbar, was eine Patientenverfügung in pluralisierten Gesundheitssystemen eigentlich „macht“ und bewirkt. 3 1. Von Kultur als Programm zu Kultur als Problem Bislang ist es der Sozial- und Kulturanthropologie und der Europäischen Ethnologie kaum gelungen, ihre analytischen Konzepte, ihre methodischen Zugänge und ihr fachspezifisches Reflexionsuniversum für aktuelle Bioethikdiskussionen im Bereich der Medizin relevant zu machen. Diese Aussage gilt ganz besonders für den deutschsprachigen Wissenschaftsraum. In der Schweiz, Deutschland und Österreich zählt die Ethnologie zu den "kleinen Fächern", ihr Theorie bildendes und Themen setzendes Vermögen spielt im Vergleich zu prominenteren Sozial- und Kulturwissenschaften nur eine untergeordnete Rolle. Eine eigenständige ethnologische Medizin- und Bioethikforschung wird entsprechend der schmalen institutionellen Gesamtsituation nur an wenigen Universitäten und Forschungseinrichtungen im deutschsprachigen Raum betrieben.2 In der internationalen Sozial- und Kulturanthropologie, besonders im englisch- und französischsprachigen Wissenschaftsraum, ist die Situation anders. Hier zählen Sozial- und Kulturanthropologie vielerorts zu den breit ausgebauten Grundlagenfächern; die kulturvergleichende Medizinanthropologie und die Sozialanthropologie der Biomedizin und der Bioethik sind seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts systematisch entwickelt und breit institutionalisiert worden.3 Die längst kulturelle und nationale Grenzen überschreitende, transnationale Bioethik wird hier als Parallelphänomen von Biomedizin und biotechnologischer Expansion analysiert, als Teil eines Prozesses, in dem das Normale und das Pathologische als ethische Dimensionen artikuliert und Interventionen am Beginn und Ende des Lebens problematisiert werden, als „Raum konkreter Probleme, Gefahren und Hoffnungen, die gleichermaßen aktuell wie emergent und virtuell“ sind [26, S. 53]. In der Öffentlichkeit und in den Nachbarwissenschaften wird die Sozial- und Kulturanthropologie primär als diejenige Disziplin wahrgenommen, die für die Erforschung des "Exotischen" der kulturellen Vielfalt Europas zuständig ist. Medizin und Bioethik erwarten von der Ethnologie Expertise für den Umgang mit kultureller Diversität. Entsprechend dem hohen Handlungsdruck in klinischen Settings werden möglichst klare Modelle für eine "kultursensible medizinische Praxis" erhofft, vielleicht sogar Checklisten über kulturspezifische Krankheitsvorstellungen und "kulturbedingte" Einstellungen gegenüber 2 Am Max-Planck-Institut für Sozialanthropologie in Halle arbeitet seit 2006 eine Forschergruppe zu Medizin, Wissenschaft und Technik in Afrika. An der Universität Basel, der Freien Universität Berlin und der Universität Heidelberg haben sich kleinere Zentren für Medizinanthropologie etablieren können; Arbeitsgruppen innerhalb der ethnologischen Fachverbände ermöglichen die überregionale Zusammenarbeit. An der Humboldt-Universität zu Berlin fördert das "ColLaboratory Social Anthropology and Life Sciences" interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Schnittstelle von Sozial- und Kulturanthropologie und interdisziplinärer Wissenschafts- und Technikforschung. 3 Zu den einflussreichen Vertreterinnen und Vertretern sozial- und kulturanthropologischer Medizin- und Wissenschaftsforschung zählen in Kanada u.a. Margaret Lock und Allan Young; in den USA Lawrence Cohen, Paul Farmer, Marcia Inhorn, Arthur Kleinman, Emily Martin und Paul Rabinow; in Frankreich Didier Fassin und in Großbritannien Sarah Franklin und Cecil Helman 4 dem Gesundheitssystem. Dass das Fach auf diese Nachfrage grosso modo nicht wirklich aktiv reagiert, hat vor allem zwei Ursachen. Zum einen lokalisiert die Ethnologie ihre disziplinäre und kognitive Identität nicht mehr – oder jedenfalls nicht mehr exklusiv – in einer Zuständigkeit für "fremde" Kulturen. Für den größten Teil des Zwanzigsten Jahrhunders war dies die konventionelle Selbstbeschreibung des Faches. Unter dem Signum intensivierter Globalisierung ist die strikte Trennung von eigener und fremder Kultur jedoch zunehmend problematissch geworden. Gegenwärtig sehen sich Ethnologinnen und Ethnologen eher als Philosophen des Alltags und Analytiker des Common Sense [12, Vorwort S. x Seitenzahl?] unabhängig von jedweder regionalen Eingrenzung. Der rigide Isomorphismus von Raum, Sprache und kultureller Identität, die Annahme also, dass ein bewohntes Gebiet, eine gesprochene Sprache und geteilte Wertvorstellungen und Orientierungsmodelle im Regelfall deckungsgleich sind, hat sich als viel zu simples Modell erwiesen, um kulturelle Dynamiken und Verflechtungszusammenhänge in Gegenwartsgesellschaften angemessen zu theoretisieren. Entsprechend definiert die britische Sozialanthropologin Marilyn Strathern kontemporäre ethnologische Kompetenz als das Vermögen, gleichzeitig die kulturspezifischen Herkünfte der eigenen, auch wissenschaftlichen und bioethischen, Konzepte zu rekonstruieren und ihre interkulturelle Anwendbarkeit zu demonstrieren [28, S. 293]. Hier wird eine sehr feine Linie bestimmt – und gleichzeitig eine radikale Mittlerposition eingenommen – zwischen den sonst so häufig dichotom konzipierten Polen „Universalismus“ und „Partikularismus". Nicht nur ist das Fremde niemals nur fremd; vor allem erfordert auch das Eigene Selbstaufklärung. Typisch für die gegenwärtige Haltung der Ethnologie ist deshalb ein „eingeschränkter und engagierter Relativismus“ [14, S. 64], der Gemeinsamkeiten aller Menschen und Kulturen als konstitutiv für seinen wissenschaftlichen Handlungshorizont begreift, diese jedoch nicht voraussetzt, sondern als Ergebnis von Kommunikation und Interaktion, als negotiated universals [20] oder Dimensionen eines "gemeinsamen Fonds" [19] erwartet. Zum anderen hat sich die ethnologische Arbeit mit dem Konzept "Kultur" weit von dem entfernt, was in der Öffentlichkeit, in Mediendiskursen und gesellschaftlichen Deutungsdebatten unter Kultur verstanden wird. Mit festen, unveränderlichen "Eigenschaften", die Personen als "Kulturmerkmale" qua Sozialisation scheinbar lebenslang innewohnen, individuelles Verhalten determinieren und allen oder den meisten Mitgliedern einer Gruppe gemein sind, hat Kultur aus der Perspektive der Ethnologie heute weniger denn je zu tun. In aktuellen Theoriedebatten des Faches wird Kultur unhintergehbar als prozessual und beweglich konzipiert. Kultur gilt als Ressource oder Wissensform, die individuelles Handeln nicht kausal bestimmt, sondern die von Akteuren stets aktiv und reflexiv angeeignet wird. Als Serie von Kommunikations-, Interaktions- und Distinktionsakten stellt sie ein relationales und unabgeschlossenes Phänomen dar, ist gleichermaßen Produkt wie Modus von 5 Begegnungen. Kultur ist in ihrem Kern und nicht nur an ihren Peripherien heterogen, konfliktreich und umstritten und als Ergebnis von Austauschprozessen, Beziehungen und Verflechtungen immer hybride, niemals rein. Ein solcher Zugang steht in eklatantem Widerspruch zu statischen, homogenisierenden und verdinglichenden Konzepten von Kultur. Er versteht sich als Warnzeichen vor der Gefahr, durch verallgemeinerte, kulturelle Differenzbehauptungen neue wie alte Stereotype zu (re)produzieren. Diese Gefahr existiert auch im Medizin- und Gesundheitssystem, wenn "Kultur" nicht als Chance für neue Reflektionsformen über das Verhältnis von Medizin und Gesellschaft verstanden sondern möglichst reibungslos in bereits existierende Konzepte und Forschungsprogramme eingemeindet wird, als sei Kultur ein zusätzlicher Bedingungsfaktor analog etwa zu Bluthochdruck und anderen Risiken. Ernüchtert resümiert die amerikanische Medizinanthropologin Susan DiGiacomo: "Bioscientific uses of the concept of culture have led, disappointingly, to its reification as ‚belief’ and its incorporation into the naturalistic epistemology of Western institutional medicine. The unfortunate consequence is the medicalization of culture understood as ‘difference’ which often stands in for social class" [7, S. 354]. Symmetrische Forschungsdesigns und die Fallstricke "kultureller Differenz" Wenn Kultur Form und Folge sozialen Austauschs ist, wenn sie überhaupt erst in und aus Interaktion entsteht und ausschließlich relational gedacht werden kann, dann hat das selbstverständlich auch Konsequenzen für die Forschungsstrategien, mit denen die Sozialund Kulturanthropologie biomedizinische Situationen in kulturell und sozial heterogenen Gesellschaften untersucht.4 Aus der Interaktivität und Relationalität von Kultur leitet sich zum einen ab, dass ethnologische Forschungsdesigns in der Regel symmetrisch (vgl. ausführlich [5] und [19]) aufgebaut sind und alle signifikanten Verflechtungen und Beziehungen in einer zu erforschenden Situation zu berücksichtigen versuchen. Kultur wird also nicht lediglich auf einer Seite der Interaktion lokalisiert, etwa als persönliche Geschichte, biographischer Hintergrund und wahrnehmbare "Andersheit" von Patientinnen und Patienten im Gesundheitssystem. Kultur wird auch auf der Seite der medizinischen Professionen und Kliniken verortet, im Herzen von Naturwissenschaften, Bioethik und Biomedizin selbst [1995, S.59]. Die scheinbar transpositionale Objektivität von Bioethik und Biomedizin soll Sofern solche Studien kontroverse medizinische Interventionen adressieren – Konzepte und Praxen von Gehirntod in verschiedenen Gesellschaften (vgl. ausführlich [21]), die Grenzen des biotechnischen Imperatives im Falle lebensbedrohender Krankheiten (beispielsweise [25]), das soziale Leben prädiktiven genetischen Wissens [17], usw. – sind sie implizit oder explizit immer auch Studien über den bioethischen Umgang mit Krankheit, Gesundheit und medizinischer Praxis.. 4 6 durch eine Beschreibung positionierter und heterogener Perspektiven im sozialen Raum der Medizin und der Gesundheitssystem ersetzt werden [14, S. 55]. Diese doppelte oder sogar multiple Optik kann sicher nicht in jedem einzelnen Forschungsprojekt in voller empirischer Breite realisiert werden; sie kennzeichnet aber die ethnologische Grundhaltung im Forschungsfeld und orientiert die Forschungsdesigns auch da, wo ihr empirischer Fokus thematisch eingeschränkt werden muss. Die zweite analytische Forderung für die Konstruktion ethnographischer Forschungsdesigns, die sich aus einem offenen, beweglichen, relationalen und unvermeidlich hybriden Kulturbegriff ableitet, zielt auf die Problematisierung des Common-Sense-Verständnisses von "kultureller Differenz". Hier ist die Beziehungshaftigkeit der Sache, um die es geht, ja bereits in der Begrifflichkeit selbst expliziert: Denn different kann etwas nur in Bezug auf etwas anderes sein. Niemand ist aus sich selbst heraus "fremd"; das "kulturell Differente" ist immer ein Phänomen der Konstellation und der Relation, der Abgrenzung und des Vergleichs, der Perspektive und der Deutungsmacht. Dennoch wird kulturelle Differenz immer wieder auch so verhandelt, als entstünde sie vor aller Interaktion als ein Konglomerat von Normen und Werten, das manche Menschen wie ein festgewachsenes Gepäckstück zeitlebens mit sich herumschleppten. Natürlich gibt es kulturelle Unterschiede, habituelle Prägungen, milieuspezifische Alltagsroutinen, sozial und kulturell gelernte Umgangsweisen mit Krankheit und Körperlichkeit, Sterben und Tod. Je selbstverständlicher diese erscheinen, desto effektiver sind sie häufig in der Mitgestaltung sozialer Situationen. Zu zeigen – und nicht vorempirisch vorauszusetzen – wäre jedoch, wie kulturelle Kosmologien und Haltungen von sozialen Akteuren in eine Situation eingebracht werden; wie kulturelle Deutungshorizonte von aktiven und reflexiven Subjekten eingesetzt werden und gleichzeitig Verhaltensweisen, Deutungsmuster und Subjektpositionen strukturieren. Welche Rolle beispielsweise Orientierungen und Deutungsmuster der Herkunftskultur spielen, wenn Migrantinnen oder Migranten in Beziehung mit den Gesundheitssystemen ihrer Einwanderungsgesellschaften treten, ist eine theoretisch wie empirisch grundsätzlich offene Frage. Es gilt zu untersuchen, ob vor dem Hintergrund bisheriger Migrationserfahrungen und langfristig transnationaler Lebensformen in einer medizinischen Krisensituation Kenntnisse und Einsichten aus den Herkunftskulturen interaktiv akzentuiert, zugespitzt und radikalisiert werden oder ob diese ganz im Gegenteil partiell oder gänzlich ihre Relevanz verlieren und ganz anderen Orientierungen Platz machen. Auskunft hierzu können Untersuchungen geben, die die interaktiven Qualitäten kultureller Deutungsmuster einzufangen, zu beschreiben und zu theoretisieren in der Lage sind. 2. Sozial- und medizinanthropologische Forschungsbeiträge zur bioethischen Diskussion über Patientenverfügungen 7 Ethnographen reden nicht nur mit den Menschen, deren Lebenswelten sie zu verstehen suchen, sie beteiligen sich auch an ihrem Alltag und werden so Teil der sozialen Netze und Austauschbeziehungen, die sie erforschen. Dieses methodische Vorgehen ist weit offen für die Relevanzen der Untersuchten und die Dynamiken des Forschungsprozesses. Es ermöglicht, auch unerwartete Zusammenhänge und Bezüge wahrzunehmen oder zu "entdecken". Ethnographien zielen in der Regel nicht darauf ab, repräsentative Aussagen über spezifische Bevölkerungsgruppen zu machen. Es geht vielmehr darum, die Vielschichtigkeit und Komplexität eines Falles angemessen zu erforschen. Die Generalisierungen, die ethnographische Fallstudien ermöglichen, beziehen sich deshalb immer nur auf ähnlich gelagerte, vergleichbare Fälle. Ethnographische Forschung eignet sich darüber hinaus zur genaueren Erforschung von Zusammenhängen, die durch andere Studien etabliert, aber noch nicht sinnvoll erklärt werden konnten; zur Verbesserung unterkomplexer Forschungstheorien und zur Exploration neuer Forschungsfelder. Im Folgenden lege ich den ethnographischen Forschungsstand zum Umgang mit und zur Bedeutung von Patientenverfügungen hinsichtlich zweier Fragen dar. Ich fasse erstens, zusammen, welche Einsichten die Ethnographie aus der Perspektive von Patientinnen und Patienten sowie ihren Angehörigen in tatsächliche Praxen des Umgangs mit Patientenverfügungen ermöglicht . Ich skizziere, zweitens, Beobachtungen und Hinweise der ethnographischen Forschung zu Patientenverfügung in multikulturellen klinischen Settings und zu kultureller Diversität. Sozialer Kontext und die soziale Positioniertheit von Patientenverfügungen Der qualitative Forschungsstand zu Sterbeprozessen in Kliniken, Hospizen und Pflegeheimen fällt insgesamt dünn aus (vgl. ausführlich [13]). Detaillierte ethnographische Studien zum Umgang mit Patientenverfügungen liegen ausschließlich für englischsprachige Länder (vgl. u.a. [8, 10, 11, 15, 16, 24, 27]), die Niederlande [29] und Japan (u.a. [21, 22, 23]) vor.5 Die publizierten ethnographischen Untersuchungen beleuchten vor allem die immense Kontextabhängigkeit und soziale Relationalität von Entscheidungen im Sterbeprozess. Sie zeigen, dass die Konstellationen und Gefüge, die in Sterbeprozesse hineinspielen, weit über die face-to-face Beziehungen der direkt Beteiligten hinaus gehen und auch Krankenkassen und Ärzteverbände, Ökonomien und Biopolitiken, verfügbare Infrastrukturen und Pflegemöglichkeiten umfassen. Die "gleichschwebende Aufmerksamkeit“ der Ethnologin oder des Ethnologen arbeitet gegen eine selektive Hervorhebung der Bedeutung von Patientenverfügungen und verschiebt den Blick auf Sterben und end-of-life living als Prozess. Dadurch werden auch Fragen nach der Qualität der Pflege und des 5 Eine sehr aufschlussreiche ethnographisch-ethnologische Studie zu Sterbeprozessen als Lebensform und zu den damit verbundenen Autonomievorstellungen und Kommunikationsmustern in einem deutschen Hospiz hat vor kurzem Nicholas Eschenbruch (2007) vorgelegt; der Umgang mit Patientenverfügung wird hier jedoch nicht behandelt. 8 gesamtgesellschaftlichen Umgangs mit Sterben relevant. Ethnographische Forschung unterstreicht die strukturellen Ambivalenzen und Diskontinuitäten von Entscheidungen im Sterbeprozess und zwar auch dort, wo sehr genaue oder sogar optimale diagnostische und prognostische Informationen vorhanden sind: Patientinnen, Patienten und ihre signifikanten Anderen wissen oft auf eine sehr existentielle Art und Weise nicht, was sie wollen (vgl. pointiert hierzu [1]), sie ändern ihre Entscheidungen in kurz- oder langfristigen Intervallen (Beispiele in [8, 15], vgl. auch [3]) und lassen sich durch unvorhergesehene Wendungen und Ereignisse in ihren Positionen irritieren oder erschüttern (vgl. ausführlich [29]). Die ethnographischen Untersuchungen machen darüber hinaus deutlich, dass die Erwartungen und Hoffnungen, die sich an die Nutzung von Patientenverfügungen knüpfen und die impliziten wie expliziten Wertsetzungen, die in ihre Erstellung und Logik einfließen, sozial und kulturell spezifische Positionen und Lebenserfahrungen markieren. Beispielhaft seien hier die Arbeiten von Anne-Mei The et al (Ergebnisse in [29]) zu Sterbeprozessen von Demenzkranken in niederländischen Pflegeheimen und die ethnographisch-interdisziplinären Untersuchungen von Theresa Drought und Barbara König [8] in einer MedicAid Klinik in Oakland, Kalifornien vorgestellt. Beide Untersuchungen problematisieren empirisch die Autonomie von Entscheidungen in Sterbeprozessen, auch wenn klar formulierte Patientenverfügungen vorliegen und individuelle Autonomie als hohes Gut sehr geschätzt wird. Sie zeigen eindringlich: 1. Für Entscheidungen im Sterbeprozess ist eine hohe kommunikative und interaktive Dichte kennzeichnend. Da, wo die Ärztinnen und Ärzte, orientiert am Patientenwillen, diesen nicht sicher wahrnehmen können, erweisen sich Patientenverfügungen oft als hilfreich. Die Ethnographien berichten aber auch davon, dass Patientenverfügungen bisweilen keine ausreichende oder nicht die einzige Grundlage von Entscheidungen bilden. Andere Elemente – ärztliches Ethos, die von Angehörigen und Pflegepersonal wahrgenommene Lebensqualität und situative Intentionalität der Patienten – spielen ebenfalls eine bedeutsame Rolle. In einer dichten Folge von Absprachen und Abwägungen zwischen allen Beteiligten werden immer wieder auch Entscheidungen getroffen, die den in einer Patientenverfügung geäußerten Wünschen nicht entsprechen (können). 2. Patienten und ihre Angehörige nehmen häufig auch dort keine Wahlmöglichkeiten wahr, wo diese ganz offenbar vorhanden sind, etwa in der Frage der Fortsetzung bestimmter Behandlungsschemata. Die Gründe, die hiefür angegeben werden, sind vielfältig: Wenn Krankheiten als unumkehrbar tödlich diagnostiziert wurden, scheint die Unmöglichkeit, das Leben zu wählen, "Wahl" als Option generell zu entwerten. Beschrieben werden auch Situationen, in denen das körperliche und emotionale Erleben eine so imperative Dringlichkeit erhält, dass "Wahl" als Idee obsolet erscheint. Patienten und Angehörige können sich auch so vollkommen auf die 9 Interpretation und Repräsentation der medizinischen Situation durch Ärztinnen und Ärzte angewiesen fühlen, dass sie keine Wahlmöglichkeit wahrnehmen. 3. Vorstellungen von Patientenautonomie fächern sich in ein breites Spektrum unterschiedlicher Ideen und Umgangsweisen auf. Die amerikanische Kulturanthropologin Barbara König, die unter anderem auch mit Fallgeschichten unterschiedlicher Patientinnen und Patienten arbeitet, porträtiert in einem dieser Narrative einen 59-jährigen, weißen US-Amerikaner als paradigmatischen "idealen Nutzer" von Patientenverfügungen [15].6 Es handelt sich um einen gut ausgebildeten, berufstätigen Mann, der Zeit seines Lebens eine unabhängige Existenz jenseits familiärer Strukturen bevorzugte und aus der Perspektive seiner medizinischen Betreuer nach einer Krebsdiagnose bewundernswert, aber eben auch a-typisch, "selbständig" und "rational" agiert, eine Patientenverfügung abfasst, seine zukünftige Pflege und sein Begräbnis plant und eine Fortsetzung kaum Erfolg versprechender Behandlungsmethoden von einem relativ frühen Zeitpunkt an konsistent ablehnt. König zeigt aber auch, dass andere Patientinnen und Patienten einen anderen Autonomiebegriff leben, etwa Entscheidungsprozesse innerhalb einer Gruppe der sie Betreuenden bevorzugen. Die Ethnographien beschreiben ein breites Spektrum von Reaktionen, mit denen Patienten den normativen Ideen von Autonomie, die mit Patientenverfügungen verknüpft sind, begegnen. Die Verteilung dieser unterschiedlichen Positionen im sozialen und kulturellen Raum lässt sich jedoch nicht entlang eindeutiger "ethnischer", "kultureller" oder sozialer Gruppenzugehörigkeiten nachzeichnen. Patientenverfügungen in multikulturellen klinischen Feldern Meinungsumfragen und sozialwissenschaftliche Untersuchungen kommen immer wieder zu dem Ergebnis, dass Kultur oder Ethnizität einen relevanten Indikator zur Erklärung von unterschiedlichen Meinungen über und Umgangsformen mit Patientenverfügungen darstellt.7 Quantitative Korrelationen der Art, dass Menschen mit Migrationshintergrund seltener als die einheimische Bevölkerung Patientenverfügungen befürworten, können alleine jedoch meist nicht erklären, welche Zusammenhänge für die gemessenen Differenzen verantwortlich sind. Es bleibt offen, ob und inwieweit kulturelle Orientierungen oder Misstrauen gegenüber den 6 Für die USA liegen eine Reihe repräsentativer Untersuchungen vor, die statistisch hoch signifikant zeigen, dass in erster Linie weiße Angehörige der Mittelschichten ab dem fünften Lebensjahrzehnt Patientenverfügungen als Gestaltungsoption annehmen und ausfüllen (vgl. u. a. [8, 11]). Für Deutschland zeigen Meinungsumfragen eine auffallende Kluft: Während eine Mehrheit der Bevölkerung Patientenverfügungen generell befürwortet hat nur ein kleiner Teil eine solche Verfügung tatsächlich unterschrieben ([4]; im hier zitierten Gesundheitsmonitor lag die allgemeine Zustimmungsquote bei über 60 Prozent, der Anteil der Befragten, die eine Patientenverfügung unterschrieben hatten, bei 10 Prozent). 7 Ethnizität ist ein schillernder Begriff, der von unterschiedlichen Autoren, theoretischen Schulen und in diversen öffentlichen Diskursen sehr verschieden eingesetzt wird. Gemeint ist in der Regel eine Identifikation mit oder die Zugehörigkeit zu bestimmten Sprach-, Religions-, Regional- oder Herkunftsgruppen unterhalb der Ebene von Staat und Nation. Für die empirisch-ethnographische Forschung besonders relevant sind die Unterscheidung von Selbst- und Fremdzuschreibungen sowie die Anerkennung hybrider und heterogener Identifikationsmuster. 10 medizinischen Systemen, Erfahrungen von Diskriminierung, ökonomische Faktoren, Bildung, stratifizierte Informationszugänge, Sprache oder andere Aspekte der sozialen Situation, mehrere dieser Faktoren oder jede mögliche Mischung eine Rolle spielen (vgl. [11, S. 405]). Am Beispiel einer Studie der amerikanischen Ethnologin Geyla Frank und ihrer Forschungsgruppe [11] soll kurz erläutert werden, welche Einsichten ethnographische Studien an dieser Stelle liefern können. Frank und ihr Team führten Mitte der 90er Jahre eine multidisziplinäre, mehrjährige Studie zum Umgang mit Patientenverfügungen bei 800 über 65jährigen Amerikanerinnen und Amerikanern durch. Mit jeweils 200 Personen, die sich selbst einer der vier Bevölkerungsgruppen "Euroamerikaner", "Afroamerikaner", "koreanische Immigranten" oder "mexikanische Immigranten" zuordneten, wurden mündlich Fragebogeninterviews durchgeführt. Die Auswertung ergab, dass 28 Prozent der Euroamerikaner, aber nur 10 Prozent der Mexican Americans, zwei Prozent der Afroamericans und keiner der in Korea geborenen Interviewpartner eine Patientenverfügung (advance care directive) unterschrieben hatte. Diese Zahlen wurden durch ethnographische Untersuchungen ergänzt und qualifiziert. Es wurde Kontextwissen generiert, das die Situation der Interviewten in dichten Fallstudien beschrieb und die erhobenen Interviewdaten in weitere Lebensumstände einbettete. So stellte sich beispielsweise heraus, dass die meisten der erst vor kurzem eingewanderten Koreanerinnen und Koreaner das Konzept der Patientenverfügung überhaupt nicht kannten. Nahezu alle hatten sich jedoch bereits auf andere Art und Weise mit ihrer eigenen Endlichkeit auseinandergesetzt. Sie waren Mitglieder in so genannten "Begräbnisgenossenschaften", das sind von koreanischen Immigranten organisierte Gemeinschaften, die im Sterbefall Kredite vergeben, gegenseitige Hilfe organisieren und die Hinterbliebenen absichern. So lange sie nicht akut erkrankten und in direkten Kontakt mit dem US-amerikanischen Gesundheitssystem kamen, waren Patientenverfügungen für diese Personengruppe einfach kein Thema. Auch hinsichtlich der Annahme einer "kultursensiblen" Bioethik, laut der beispielsweise Koreanerinnen und Koreaner Entscheidungen in medizinischen Krisenfällen und in Sterbeprozessen nicht im Rahmen einer auf das Individuum, sondern einer auf die Familie ausgerichteten persönlichen Ethik treffen, ermöglicht die ethnographische Forschung Einsichten (im Folgenden ein weiteres Beispiel aus[11]): Bei der Auswertung der Fragebogenstudie waren die Antworten der 65-jährigen, vor 12 Jahren in die USA eingewanderten Frau Kim als "widersprüchlich" und nicht verständlich markiert worden. Sie hatte im Interview reanimierende und lebensverlängernde medizinische Interventionen stark befürwortet, solche Maßnahmen für sich selbst jedoch gleichzeitig entschieden abgelehnt und zudem angegeben, dass im "gegebenen" Moment ohnehin ihre Kinder, und nicht sie selbst, 11 über alle medizinischen Behandlungsformen entscheiden würden. "I am the one who is going to die" gab Frau Kim zu Protokoll, "so I don't control the situation" [11, S. 404]. Frank und ihre Kolleginnen und Kollegen arbeiteten zum einen heraus, dass Frau Kims Sterben als einen körperlichen und zutiefst sozialen Prozess begreift, für den ein sukzessiver, sich fortsetzender Verlust von Autonomie und Kontrolle konstitutiv ist. Alles, was mit Krankheit und Tod verbunden ist, erscheint ihr keineswegs nur für sich selbst relevant, sondern auch für ihre Verwandten, insbesondere ihre Kinder. Sollten sich diese beispielsweise noch nicht ausreichend von ihr verabschiedet haben, so wäre es ihrer Meinung nach gerechtfertigt, wenn sie sich zusammen mit den Ärzten für lebensverlängernde Maßnahmen entscheiden, auch wenn Frau Kim selbst ein schnelles Ende lieber wäre. Was lässt sich auf der Basis einer solch singulären ethnographischen Vignette folgern oder erklären? Dass soziale, familiäre Beziehungen für Frau Kim wichtiger sind als ihre eigenen, individuellen Meinungen und Wünsche? Eine solch dichotome Lesart scheint hier nicht wirklich zu greifen. Eher sprechen die Aussagen von Frau Kim dafür, dass Sterben in ihrer Sicht ein Prozess ist, in dem sich der Körper und die sozialen Beziehungen einer Person sowohl verändern als auch identisch bleiben, dass es ein Kontinuum gibt. Hier von einem "relationalen Verständnis von Autonomie" in Abgrenzung zu einem "individualistischen Autonomiekonzept" zu sprechen, halte ich für irreführend. Zu groß erscheint die Gefahr, durch diese Begrifflichkeit einen Gegensatz zu konstruieren, der aus Frau Kims Perspektive nur bedingt relevant ist. Zudem würde hier eine Differenz zwischen koreanischen und anderen Amerikanerinnen und Amerikanern konstruiert, die in Zeiten zunehmender Hybridisierung und Heterogenisierung auch von Diasporagemeinden nicht gerechtfertigt erscheint. 3. Jenseits von Kultur: Eine alternative Untersuchungsperspektive Die wenigen ethnographischen Beispiele, die ich hier anführen kann, deuten aus einer empirischen Perspektive einige Probleme differenztheoretischer Kulturkonzepte an, auf die ich im ersten Teil dieses Beitrages bereits aus theoretischen Überlegungen heraus aufmerksam gemacht hatte. Statt die Berücksichtigung "kultureller Besonderheiten" in medizinischen und bioethischen Programmen zu fordern, formieren sich innerhalb der Ethnologie deswegen gegenwärtig Stimmen, die die Erklärung von Diversität und Differenz unter Globalisierungsbedingungen jenseits kultureller Deutungsmuster vorschlagen. Ein theoretischer Zugang über Wissenspraktiken (vgl. [2]) und Wissenswege erlaubt möglicherweise genauere Rekonstruktionen individueller Positionen von Akteuren im medizinischen Feld, als es der Kulturbegriff noch vermag. Der Wissensbegriff suggeriert weniger Totalität, Homogenität und Kohärenz, als der Kulturbegriff. Mit einem Fokus auf Wissenspraktiken lassen sich die täglich neu entstehenden bricolagen des Wissens, die aus diversen Quellen zusammengebastelten Orientierungsmodelle von Menschen, gut beschreiben. Diversität wird hier nicht einseitig aus der kulturellen und sozialen Herkunft eines Menschen erklärt, sondern auch als Effekt stratifizierter Zugänge zu Wissen, 12 Information, Bildung, als auszuhandelnde Größe und als kontextabhängiges Phänomen. Unterschiedlichkeit wird dadurch zu einer weniger kategorischen als graduellen Dimension. Vor allem aber geht es der Ethnographie um ein Verständnis der Interaktionen in biomedizinischen Settings, um das Anliegen, auch solche Dynamiken und Entwicklungen nachzuzeichnen, die nicht allein von den Einstellungen und Haltungen der beteiligten Akteure geprägt sind, um den Versuch, auch Relationalität und Autonomie als Effekte von Interaktion zu fassen. Eine wichtige methodische Frage hierzu lautet: Wenn ich erklären möchte, was für eine Rolle eine vorhandene oder eben nicht-vorhandene Patientenverfügung im komplexen, von strukturellen Ambivalenzen gekennzeichneten Sterbeprozess unter Bedingungen der High-Tech-Medizin oder moderner Pflege spielt, reicht es da, die Intentionen und Meinungen der Beteiligten zu kennen? Die theoretisch-analytische Frage zu diesem Anliegen lautet: Wie kann ich die Herausbildung von Handlungsfähigkeit und Bedeutungsgebung in Kontexten analysieren, in denen unterschiedliche Akteure (Patienten, Angehörige, Pflegende, Ärzte, Krankenkassen, Gesundheitspolitiker, Patientenselbsthilfegruppen), Infrastrukturen, Technologien und Regularien zusammenwirken, und zwar so, dass jenseits und neben der Gemengelage von Intentionen, Interessen und Wünschen eine Interaktionsdynamik entsteht, die selbst Handlungsfähigkeit bestimmt? Der französische Wissenschaftsforscher Michel Callon [6] hat zur Analyse von Situationen, in denen Akteure, Technologien und Infrastrukturen sich gegenseitig in Dienst nehmen und verändern, den Begriff des agencement vorgeschlagen. Er verschmilzt darin den Begriff der Ordnung oder des "Arrangements" mit dem des "Agenten/Akteurs", um bezeichnen zu können, dass Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit sich aus der situativen Interaktion aller beteiligten Elemente entwickelt und nicht exklusiv oder allein in einzelnen menschlichen Akteuren verankert ist. Eine solche Konzeption würde tendenziell die harte Unterscheidung zwischen "individuellen" und "relationalen" Autonomievorstellungen unterlaufen. Verschiedene Autonomiebegriffe, so wäre die Argumentation, existieren, eher in Abstufungen und Mischungsverhältnissen als in klar geschiedenen Formen. Alle müssen sozial verhandelt und anerkannt werden, um sozial wirksam zu werden. Ihre Realisierung ist von komplexen Interaktionen und Zusammenhängen abhängig, von menschlichen wie nichtmenschlichen Akteuren und Infrastrukturen, und nicht allein von Intentionalität, Bewusstsein und Wissen. Patientenverfügungen wären diesem Argument zu Folge ein wichtiges Medium, um den Willen einer Person zu einem bestimmten Moment zu klären, und – in fixierter Form – zu vertreten, auch dann, wenn die Person selbst nicht mehr kommunikationsfähig ist. Sie würden aber in ihrem Potential zur Klärung komplexer und schwieriger Entscheidungsprozesse am Lebensende nicht überschätzt. Sterben geriete als strukturell ambivalenter, von widerstrebenden Impulsen, Kontinuitäten und Veränderungen strukturierter, sozialer wie körperlicher Prozess in den Blick, in dem menschliche Akteuren, pharmazeutische Stoffe, 13 medizinische Technologien, eine Vielzahl ökonomischer, pragmatischer, kultureller und sozialer Logiken, institutionelle Infrastrukturen und eine sich verschlechternde Körperlichkeit zusammenwirken. Neben der Frage nach einer Patientenverfügung wäre vor allem auch über die Ressourcen nachzusinnen, die in diesen Prozess eingehen, die er benötigt: Zeit, Menschen, medizinische Möglichkeiten und Hilfen, Prozessverständnis, Berührungen, Töne, Gerüche, Sprache und Aufmerksamkeit. Literatur: 1 Aronowitz, RA, Asch, DA (1998) Cursing the darkness. Are there limits to end-of-life research? Journal of General Internal Medicine 13: 495–496 2 Barth, F (2002) An anthropology of knowledge. Current Anthropology 43 (1):1–18 3 Bateson, MC (2000) Sechs Tage Sterben. Systhema 14: 293–301 4 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2005) Pressemitteilung: „Studie: Deutsche Bevölkerung befürwortet Patientenverfügung. Online verfügbar unter http:/idwonline.de/pages/de/news?print=1&id=105804. Gütersloh 5 Bourdieu, P, Wacquant LJD (1996) Reflexive Anthropologie. Suhrkamp: Frankfurt am Main 6 Callon, M (2005) Why virtualism paves the way to political impotence. A reply to Daniel Miller`s critique of “The Laws of the Markets.” Economic Sociology, European Electronic Newsletter 6 (2), <http://econsoc.mpifg.de/archive/esfeb05.pdf> (Accessed 12.12.2007) 7 DiGiacomo, SM (1999) Can there be a cultural epidemiology? Medical Anthropology Quarterly 13: 436–457 8 Drought, TS, König, BA (2002) “Choice” in the end-of-life decision making: Researching fact or fiction? The Gerontologist 24, Sonderausgabe III: 114–128 9 Eschenbruch, N (2007) Nursing Stories. Life and Death in a German Hospice. Berghahn, New York, Oxford 10 Frank, G, Blackhall, LJ, Murphy, ST, Michel, V, Azen, SP, Preloran, HM, Browner, CH (2002) Maintaining hope yet anticipating death: Disclosure preferences and narrative practices among elderly Mexican Americans in Los Angeles. Cambridge Quarterly of Health Care Ethics 11: 117–126 11 Frank, G, Blackhall, LJ, Michel, V, Murphy, ST, Azen, SP, Park, K (1998) A discourse of relationships in bioethics: Patient autonomy and end-of-life decision making among elderly Korean Americans. Medical Anthropology 12: 403–423 14 12 Herzfeld, M (2001) Anthropology. Theoretical Practice in Culture and Society. Blackwell Publishers, Malden 13 Jones, K (2005): Diversities in approach to end-of-life: A view from Britain of the qualitative literature. Journal of Research in Nursing 10: 431–454 14 Kleinman, A (1995) Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and Medicine. University of California Press, Berkeley 15 Koenig, B (1997) Cultural diversity in decision-making about care at the end of life. In: Field, MJ, Cassel, CK (Hrsg) Approaching Death. Improving Care at the End of Life. Institute of Medicine, National Academy Press, Washington, S 363–382 16 Koenig, B, Hern Jr, HR, Marshall, PA (1998) The difference that culture can make in end of life decision-making. Cambridge Quarterly of Health Care Ethics 71: 27–40 17 Konrad, M (2005): Narrating the New Predictive Genetics Ethics, Ethnography and Science. Cambridge University Press, Cambridge 18 Latour, B (1998) Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropologie. Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main 19 Latour, B, Jullien, F (2008) Das neue Gemeinsame. Andersheit, Ungedachtes und Universalisierendes in den Kulturen. Lettre International 80: 63-66 20 Lepenies, W (Hrsg) Entangled Histories and Negotiated Universals. Center and Peripherie in a Changing World. Campus, Frankfurt am Main 21 Lock, M (2001) Twice Dead: Organ Transplantation and the Reinvention of Death. University of California Press, Berkeley 22 Long Orpett, S (2005) Final Days. Japanese Culture and Choice at the End of Life. University of Hawai'i Press, Honulu 23 Long Orpett, S (2004) Cultural scripts for a good death in Japan and the United States: Similarities and differences. Social Science and Medicine 58: 913–928 24 Marshall, PA, BA König, DB Barnes, AJ Davis (1998) Multiculturalism, bioethics, and end-of-life care: Case narratives of Latino care patients. In: Thomasma, DC, Monagle, JF (Hrsg) Health Care Ethics. Issues for the 21st Century. Aspen, Gaisthersburg, Maryland, S 421–431 25 Nelson, RM (2000) The ventilator/baby as cyborg. A case study in technology and medical ethics. In: Brodwin, PE (Hrsg) Bioetechnology and Culture. Bodies, Anxieties, Ethics. Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis, S 209–223 26 Rabinow, P (2004) Anthropologie der Vernunft. Studien zu Wissenschaft und Lebensführung. Herausgegeben und übersetzt von Carlo Caduff und Tobias Rees. Suhrkamp, Frankfurt am Main 15 27 Slomka, J (1992) Negotiation of death: Clinical decision making at the end of life. Social Science and Medicine 35: 251–259 28 Strathern, M (1997) Partners and consumers: Making relations visible. In: Schrift, AD (Hrsg) The Logic of the Gift. Toward an Ethic of Generosity. Routledge, New York, London, S 292-–311 29 The, AM, Pasman, R, Onwuteaka-Philipsen, B, Ribbe, M, van der Wal, G (2002) Withholding the artificial administration of fluids and food from elderly patients with dementia: An ethnographic study. In: BMJ, Dec. 7; 325 (7376): 1326 16