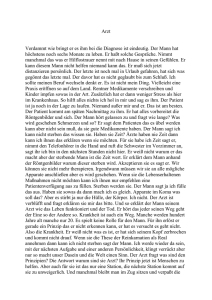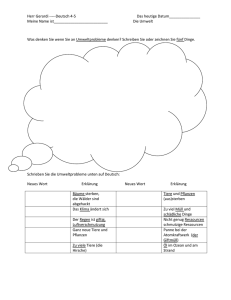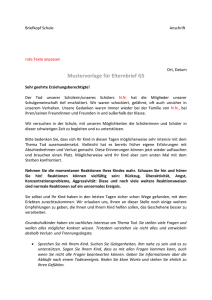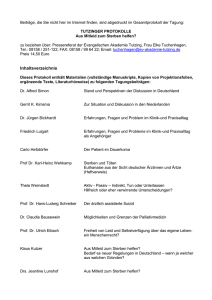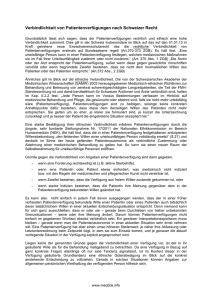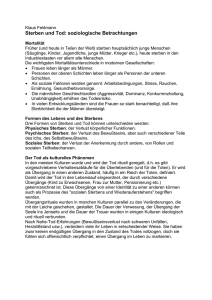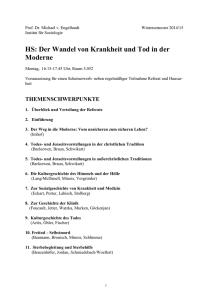Garantieren Patientenverfügungen würdevolles Sterben?
Werbung
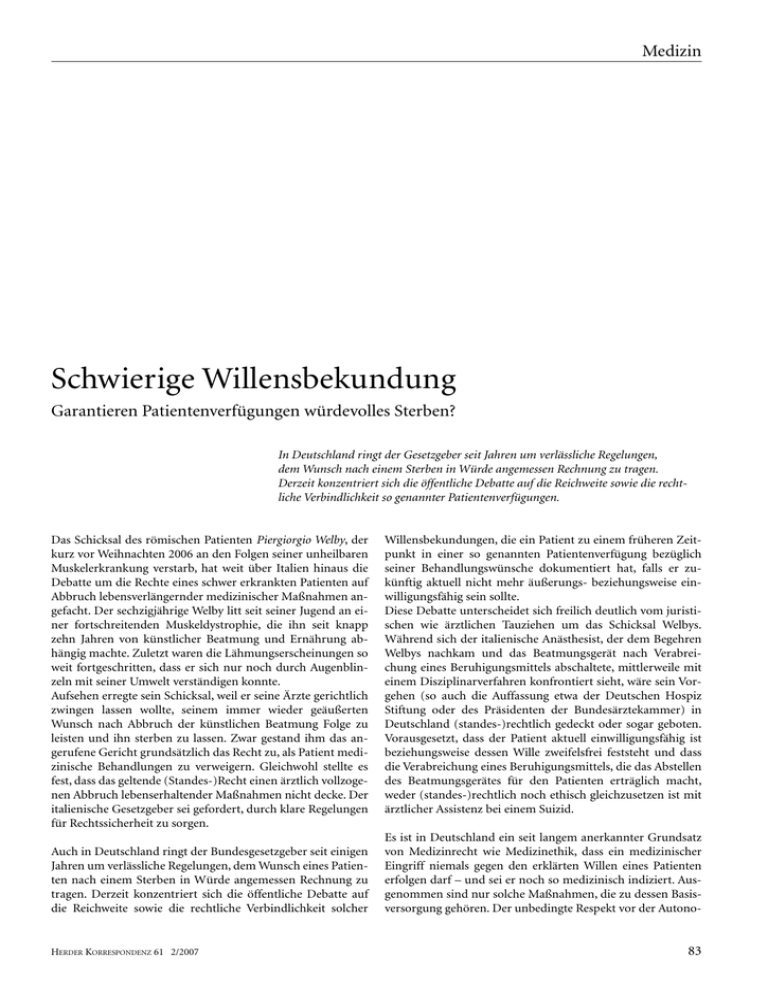
Medizin Schwierige Willensbekundung Garantieren Patientenverfügungen würdevolles Sterben? In Deutschland ringt der Gesetzgeber seit Jahren um verlässliche Regelungen, dem Wunsch nach einem Sterben in Würde angemessen Rechnung zu tragen. Derzeit konzentriert sich die öffentliche Debatte auf die Reichweite sowie die rechtliche Verbindlichkeit so genannter Patientenverfügungen. Das Schicksal des römischen Patienten Piergiorgio Welby, der kurz vor Weihnachten 2006 an den Folgen seiner unheilbaren Muskelerkrankung verstarb, hat weit über Italien hinaus die Debatte um die Rechte eines schwer erkrankten Patienten auf Abbruch lebensverlängernder medizinischer Maßnahmen angefacht. Der sechzigjährige Welby litt seit seiner Jugend an einer fortschreitenden Muskeldystrophie, die ihn seit knapp zehn Jahren von künstlicher Beatmung und Ernährung abhängig machte. Zuletzt waren die Lähmungserscheinungen so weit fortgeschritten, dass er sich nur noch durch Augenblinzeln mit seiner Umwelt verständigen konnte. Aufsehen erregte sein Schicksal, weil er seine Ärzte gerichtlich zwingen lassen wollte, seinem immer wieder geäußerten Wunsch nach Abbruch der künstlichen Beatmung Folge zu leisten und ihn sterben zu lassen. Zwar gestand ihm das angerufene Gericht grundsätzlich das Recht zu, als Patient medizinische Behandlungen zu verweigern. Gleichwohl stellte es fest, dass das geltende (Standes-)Recht einen ärztlich vollzogenen Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen nicht decke. Der italienische Gesetzgeber sei gefordert, durch klare Regelungen für Rechtssicherheit zu sorgen. Auch in Deutschland ringt der Bundesgesetzgeber seit einigen Jahren um verlässliche Regelungen, dem Wunsch eines Patienten nach einem Sterben in Würde angemessen Rechnung zu tragen. Derzeit konzentriert sich die öffentliche Debatte auf die Reichweite sowie die rechtliche Verbindlichkeit solcher HERDER KORRESPONDENZ 61 2/2007 Willensbekundungen, die ein Patient zu einem früheren Zeitpunkt in einer so genannten Patientenverfügung bezüglich seiner Behandlungswünsche dokumentiert hat, falls er zukünftig aktuell nicht mehr äußerungs- beziehungsweise einwilligungsfähig sein sollte. Diese Debatte unterscheidet sich freilich deutlich vom juristischen wie ärztlichen Tauziehen um das Schicksal Welbys. Während sich der italienische Anästhesist, der dem Begehren Welbys nachkam und das Beatmungsgerät nach Verabreichung eines Beruhigungsmittels abschaltete, mittlerweile mit einem Disziplinarverfahren konfrontiert sieht, wäre sein Vorgehen (so auch die Auffassung etwa der Deutschen Hospiz Stiftung oder des Präsidenten der Bundesärztekammer) in Deutschland (standes-)rechtlich gedeckt oder sogar geboten. Vorausgesetzt, dass der Patient aktuell einwilligungsfähig ist beziehungsweise dessen Wille zweifelsfrei feststeht und dass die Verabreichung eines Beruhigungsmittels, die das Abstellen des Beatmungsgerätes für den Patienten erträglich macht, weder (standes-)rechtlich noch ethisch gleichzusetzen ist mit ärztlicher Assistenz bei einem Suizid. Es ist in Deutschland ein seit langem anerkannter Grundsatz von Medizinrecht wie Medizinethik, dass ein medizinischer Eingriff niemals gegen den erklärten Willen eines Patienten erfolgen darf – und sei er noch so medizinisch indiziert. Ausgenommen sind nur solche Maßnahmen, die zu dessen Basisversorgung gehören. Der unbedingte Respekt vor der Autono- 83 Medizin mie des Patienten gilt auch dann, wenn Ärztin oder Pfleger die der Willensbekundung des Patienten zugrundeliegende moralische beziehungsweise weltanschaulich-religiöse Überzeugung nicht teilen, sondern aufgrund der eigenen Überzeugung anders entscheiden würden oder sogar müssten. Natürlich hat das Selbstbestimmungsrecht des Patienten eine Grenze. Insbesondere darf es keinesfalls andere, etwa den Arzt oder die Angehörigen, gegen deren Überzeugung zu bloßen Erfüllungsgehilfen eigener Wünsche instrumentalisieren. Darüber hinaus unterscheidet in Deutschland das Straf- wie Standesrecht zwischen aktiver und passiver beziehungsweise indirekt-aktiver Sterbehilfe. Passive wie indirekt-aktive Sterbehilfe umfassen alle Maßnahmen, die den bevorstehenden Tod eines Menschen nicht mehr aufhalten oder das Sterben eines Menschen durch palliativ-medizinische Versorgung erträglich gestalten, auch wenn sie das Eintreten des Todes beschleunigen sollten. Diese Formen der Sterbehilfe sind nicht nur erlaubt, sondern gegebenenfalls sogar geboten. Weil sie nicht Hilfe zum, sondern Hilfe im Sterben leisten, werden sie sinnvoller zunehmend als Sterbebegleitung bezeichnet. Demgegenüber sind alle Formen aktiver Sterbehilfe, die – wie das Töten auf Verlangen – den Sterbeprozess eines Menschen erst veranlassen, derzeit ausnahmslos verboten. Die Beziehung zwischen Arzt und Patient muss über jeden Zweifel erhaben bleiben Auf eine Ausnahme zielt freilich die Forderung, die der letzte Deutsche Juristentag im Jahr 2006 zur Lockerung des standesrechtlichen Verbotes der Mitwirkung am freiverantwortlichen Suizid einer schwer leidenden Patientin erhoben hat. Diese Ausnahmeregelung würde die Grenze von passiver zur aktiven Sterbehilfe überschreiten. Denn während die passive Sterbebegleitung maximaltherapeutische Maßnahmen begrenzt oder abbricht, um den Patienten in der Phase seines unumkehrbaren Sterbens wirklich sterben zu lassen, geht es bei der Mitwirkung des Arztes beim freiverantwortlichen Suizid eines Patienten um die Mitwirkung bei der Einleitung, also beim Veranlassen eines Sterbevorgangs. Zwischen Sterben lassen und Sterben veranlassen besteht aber ein handlungstheoretischer und damit ethisch bedeutsamer Unterschied. Und auch eine Mitwirkung ist eine Mitwirkung, also ursächlich und notwendig bei der Veranlassung eines Prozesses, hier also des Sterbens durch einen (freiverantwortlichen) Suizid. Eine auch nur begrenzte (standesrechtliche) Zulassung dieser Form der Mitwirkung des ärztlichen oder pflegerischen Personals würde massiv das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Patient und seinen Ärztinnen und Pflegern belasten. Die Beziehung zwischen Arzt und Patientin muss aber aufgrund ihrer einzigartigen Dichte wie ihres einseitigen Abhängigkeitsverhältnisses über jeden Zweifel an einer achtsamen wie sorgenvollen Behandlung der Patientin erhaben sein. 84 Was im Falle einer vorliegenden Einwilligungsfähigkeit des Patienten mit Blick auf seine willenskonforme Behandlung für relativ klare Verhältnisses sorgt, wird bei einem nicht mehr einwilligungsfähigen Patienten zum Problem: Seine nicht mehr verfügbare aktuelle Willensbekundung muss durch die stellvertretende Entscheidung anderer hilfsweise ersetzt, Andreas Lob-Hüdepohl (geb. also gewissermaßen substitu1961) ist Gründungsmitglied des Berliner Instituts für iert werden. Nach deutschem christliche Ethik und Politik Recht trifft diese Entscheisowie seit 1997 Rektor der dung im Regelfall ein gerichtKatholischen Hochschule für lich bestellter Betreuer oder Sozialwesen Berlin. Er war eine vom Patienten persönVorsitzender der ZdK-Arbeitslich mandatierte Gesundgruppe, die eine Ende letzten heitsbevollmächtigte. Strittig Jahres veröffentlichte Erklärung des Laiengremiums zur ist, wie verbindlich und wie Regelung der Patientenverweit der stellvertretende Entfügung („Leben und Sterben scheider an Willensbekunin Würde“) erarbeitet hat. dungen gebunden ist, die der Patient zu einem früheren Zeitpunkt getätigt hat. Hier trennen sich die derzeit rechtspolitisch diskutierten Wege, die in diesem Frühjahr vermutlich in zwei verschiedenen Gruppenanträgen von Mitgliedern des Deutschen Bundestages münden und zur Abstimmung gestellt werden: Die einen wollen ihn durch jene Willensbekundung substituieren, die ein Patient im Rahmen einer Patientenverfügung dokumentiert hat, und zwar – wenn man dem Entwurf des Bundesjustizministeriums zur Änderung des Betreuungsrechts (vgl. §1901 BGB) aus dem Jahre 2005 folgt – in einer besonders starken Weise. Demnach hätte der Betreuer oder die Gesundheitsbevollmächtigte den im Rahmen einer Patientenverfügung dokumentierten Willen nicht nur zu beachten – das müssen beide schon nach geltendem Recht. Sie müssten ihm bei Eintritt der antizipierten Fallkonstellation sogar ohne Abstriche zur Durchsetzung verhelfen. Der Charme dieser Lösung besteht darin, dass – zumindest auf den ersten Blick – nur diese hohe Verbindlichkeit einer Patientenverfügung die Selbstbestimmung des Patienten unverfälscht respektiert und eindeutige Verhältnisse schafft. Das macht sie in der öffentlichen Debatte wie im Gesetzgebungsverfahren ungemein attraktiv. Diese Attraktivität ist aber teuer erkauft. Sie lebt nämlich von der sachlich irrigen wie für die betroffene Patientin höchst riskanten Fiktion, dass das Substitut, nämlich die vorausverfügende Willensbekundung von früher, mit einer aktuellen Willensbekundung faktisch für identisch erklärt werden kann. Träfe dies zu, dann hätte tatsächlich niemand das Recht, anders als die in der Patientenverfügung dokumentierte Willensbekundung zu entscheiden. Solche Identifizierung ist aber sowohl juristisch abwegig wie ethisch unbefriedigend. Anders als ein Testament ist die früher vorausverfügende Willensbekundung weder eine rechtsgeschäftliche und damit zwingend bindende Willensbekundung. HERDER KORRESPONDENZ 61 2/2007 Medizin Noch kann sie in einem ethisch befriedigendem Maße jene Situation antizipieren, in der der urteilende Mensch unter gänzlich anderen, also durch Krankheit oder Behinderung beeinträchtigten Umständen seine Lage beurteilen und im Lichte dieses Urteils über die Zulassung oder die Abweisung ihn betreffender medizinischer Eingriffe entscheiden würde. Höchst riskant ist die fiktive Identität von früherer und aktueller Willenserklärung für den Patienten deshalb, weil er faktisch keine Chance hat, seine früher erfolgte Willensbekundung bei Eintreten der antizipierten Fallkonstellation zu revidieren. Der andere Weg, den nicht mehr verfügbaren aktuellen Willen hilfsweise zu ersetzen, nutzt die Logik des bestehenden Betreuungsrechts. Dieses Recht greift – zunächst unabhängig von einem konkreten Krankheitszustand – in allen Fällen, wo ein Mensch nicht mehr oder zumindest vorübergehend nicht seine persönlichen Angelegenheiten selbst besorgen und erforderliche Entscheidungen bezüglich seiner Lebensführung (damit auch Einwilligungen im Krankheitsfalle) treffen kann (vgl. bes. §§ 1901 ff. BGB). In dieser Situation ist er auf die stellvertretende Entscheidung eines Betreuers angewiesen. Die stellvertretende Entscheidung des Betreuers hat sich ausschließlich an den Interessen und dem Wohl des Betreuten zu orientieren. Zu dessen Wohl, so fordert es das Betreuungsrecht, gehört auch, seine artikulierten Wünsche einschließlich früher geäußerter Willensbekundungen einzubeziehen. Gerade früher geäußerte Willensbekundungen dokumentieren nämlich die „Lebensphilosophie“ des Betreuten und geben damit beachtliche Hinweise auf die Art und Weise seiner Lebensgestaltung, zu der er sich vermutlich entscheiden würde, wenn er dazu noch in der Lage wäre. Damit kommen Patientenverfügungen eine besondere Bedeutung und Beachtlichkeit zu. Denn in der Regel setzen sich Personen, die eine Patientenverfügung verfassen, im Lichte ihres höchstpersönlichen Lebensentwurfes intensiv mit zukünftig möglicherweise eintretenden Lebenslagen und ihren diesbezüglichen Einschätzungen auseinander. Dies gilt unbeschadet der Tatsache, dass sie das Zukünftige nie vollständig und angemessen antizipieren können. Trotz der hohen Beachtlichkeit früher eigens dokumentierter Willensäußerungen respektiert die Logik des Betreuungsrechts die bleibende Differenz zwischen früheren und aktuellen Willensbekundungen. In der Situation schwerster Erkrankung kann sie diese Lücke dadurch überbrücken, dass die Betreuerin mit weiteren Bezugspersonen des betreuten Patienten (Angehörige, das medizinisch-pflegerische Personal u. a.) den mutmaßlichen Willen des Patienten ermittelt und auf dieser Grundlage in seinem Sinne für ihn entscheidet. Auch diese stellvertretende Entscheidung kann eine authentische Entscheidung, so sie noch vom Patienten getroffen werden könnte, verfehlen, denn auch der gemutmaßte Wille ist nur annäherndes Substitut, niemals identisch mit einer aktuellauthentischen Willensbekundung des Patienten. HERDER KORRESPONDENZ 61 2/2007 Aber er ist Teil eines skrupulösen Beratungs- und Entscheidungsprozesses, der möglichst viele biographisch relevante Gesichtspunkte ermittelt und so der Tragweite über einen Behandlungsabbruch einigermaßen Rechnung tragen kann. Darin liegt auch der Vorteil, wenn der Patient frühzeitig einen Gesundheitsbevollmächtigten mandatiert. Dieser Gesundheitsbevollmächtigte genießt das besondere Vertrauen des später Betreuten, sonst würde dieser ihm vermutlich nicht die Gesundheitsvollmacht übertragen. Zudem steht er oftmals schon über einen langen Zeitraum hinweg mit dem Patienten in einer Gesprächsbeziehung, was die Güte seiner stellvertretenden Entscheidung beträchtlich absichern hilft. Welchen Einfluss haben Angehörige und das gesellschaftliche Klima? Wenn man diese Logik des Betreuungsrechts ernst nimmt, dann wird deutlich: Es geht nicht um die Frage, ob man das Selbstbestimmungsrecht des Patienten respektiert oder nicht, sondern wie man es in einer Weise schützt und stärkt, dass ein Mensch in Würde stirbt und sterben kann. Dazu gehört nicht nur, jede Form von äußerer Fremdbestimmung zu unterbinden, sondern auch die oftmals subtilen Formen selbstinduzierter Fremdbestimmung einzugrenzen. Eine selbstinduzierte, also vom Patienten selbst bewirkte beziehungsweise in Kauf genommene Fremdbestimmung liegt dann vor, wenn im Falle einer fiktiv unterstellten Identität von früher vorausverfügendem Willen und aktueller Willensbekundung faktisch keine Revisionsmöglichkeit mehr besteht und allein das äußere Eintreten der antizipierten Fallkonstellation über das weitere Schicksal des Patienten entscheidet und nicht eine erneute und aktuelle Abwägung der in Frage stehenden Güter und Optionen („negative Selbstbindung“). Eine selbstinduzierte Fremdbestimmung liegt bereits auch dann vor, wo eine einwilligungsfähige Person mit ihrer Patientenverfügung vorrangig der Erwartungshaltung von Angehörigen oder des gesamtgesellschaftlichen Klimas nachgibt („prophylaktische Selbstentsorgung“). Jede rechtliche Regelung von Patientenverfügungen, die im Falle einer krankheitsbedingten Nichteinwilligungsfähigkeit eines Patienten dessen nicht mehr verfügbaren aktuellen Willen substituieren will, muss den qualitativen Unterschied zwischen einem Sterbenlassen und einem Sterbenveranlassen (und sei dies nur im Modus einer Mitwirkung durch Assistenz) beachten. Infolgedessen muss sich die Reichweite der Bindungswirkung einer Patientenverfügung auf die Phase irreversiblen Sterbens beschränken. Wäre sie nicht darauf beschränkt, so würde der Betreuer zu einer stellvertretenden Entscheidung entweder genötigt oder aber (im Sinne der besonderen Beachtlichkeit einer Patientenverfügung) zumindest aufgefordert, die das Veranlassen eines Sterbeprozesses durch das medizinisch-pflegerische Personal nach sich ziehen würde. 85 Medizin Damit wäre handlungslogisch und folglich ethisch die Grenzlinie in Richtung aktiver Sterbehilfe überschritten. Derselbe Unterschied zwischen Sterbenlassen und Sterbenveranlassen ist auch der maßgebliche Grund dafür, dass demente und so genannte wachkomatöse Patienten kategorisch von der Reichweite von Patientenverfügungen ausgenommen werden müssen, solange sie sich nicht in einer unumkehrbar verlaufenden Sterbephase befinden. Selbst wenn der Betreuer sicher sein könnte, dass der demente oder wachkomatöse Mensch in seiner Situation mutmaßlich für sein Sterbenwollen entscheiden würde, die Entscheidung zum Abbruch seiner Versorgung würde dennoch sein Sterben von fremder Hand veranlassen und nicht nur einfach zulassen. Demente wie wachkomatöse Patientinnen sind keine Sterbenden, sondern Menschen mit zum Teil schwersten Behinderungen. Damit wird ihre Lebenslage weder verharmlost noch beschönigt. Aber an der Frage, wie eine Gesellschaft mit der äußerst zugespitzten Lebenslage dieser Menschen umgeht, zeigt sich letztlich, woran sie den Status eines menschlichen Lebens festmacht. Muss ein Mensch über solche Formen des Bewusstseins und der Selbstbestimmung oder über solche Fähigkeiten zur Wahrnehmung eigener Interessen sowie zur Wertschätzung eigener Lebenszufriedenheit (aktuell oder wenigstens später wieder) verfügen können, die für durchschnittlich ausgestattete und in diesem Sinne normale Menschen vertraut und liebgeworden sind? Wie, wenn sich die Erkenntnis als gesichert erweist, dass die subjektiv empfundene Lebenszufriedenheit der Betroffenen bei fortschreitender Demenz eher zu- als abnimmt? Oder könnte sich menschliche Personalität auch in solchen dialogischen Beziehungen und Kommunikationsformen ereignen, zu denen „Normalen“ nur der Zugang erschwert oder vielleicht sogar versperrt ist? Wird menschliches Bewusstsein zum entscheidenden Kriterium? Mit Blick auf die aktuelle Debattenlage in den Fraktionen des Deutschen Bundestages ist allerdings zu erwarten, dass selbst Befürworter einer gesetzlichen Regelung, die Patientenverfügungen in die bestehende Logik des Betreuungsrechts einbindet sowie deren Reichweite grundsätzlich auf die irreversible Sterbensphase begrenzt, eine Ausnahme vorsehen: Für Patienten, die an schwerer Demenz oder am apallischen Syndrom (Wachkoma) leiden, soll dann eine Begrenzung auf die Sterbensphase wegfallen, wenn für sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Aussicht mehr auf die Wiedererlangung des Bewusstseins besteht. Damit zeichnet sich eine gesetzliche Regelung ab, die für eine zahlenmäßige nicht unerhebliche Gruppe von Erkrankten faktisch die ethisch bedeutsame Grenze in Richtung aktiver Sterbehilfe überschreitet. 86 Die Fragwürdigkeit einer solchen Regelung wird besonders darin deutlich, dass die grundsätzliche Beschränkung der Verbindlichkeit von Patientenverfügungen und der Reichweite auf die unumkehrbare Sterbephase von vielen gerade mit der besonderen Schutzpflicht des Staates für das Recht auf Leben (vgl. Art. 2 II GG) begründet wird. Die Aufweichung dieser besonderen Schutzpflicht des Staates für Personen, die keine Aussicht mehr auf die Wiedererlangung des Bewusstseins haben, vermeidet nur dann einen gravierenden Widerspruch, wenn das menschliche Bewusstsein – und sei es nur als Fernziel – zum entscheidenden Kriterium für die uneingeschränkte Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens gemacht wird. Das wird niemand wollen können. Denn er müsste die enormen Konsequenzen verdrängen, die sich aus der Einteilung in Bewusstseinsfähige und Nichtbewusstseinsfähige für demente und wachkomatöse sowie für alle schwer erkrankten und behinderten Menschen zwangsläufig ergeben, die nie (mehr) über die gewohnten Bewusstseinszustände verfügen. Piergiorgio Welby ist offensichtlich eine kirchliche Bestattung mit der Begründung verweigert worden, dass sein Todeswunsch im Gegensatz zur Lehre der katholischen Kirche stehe. Nicht jedem erschließt sich unmittelbar, dass der sterbende Italiener von einer Todessehnsucht getrieben wurde. Viele werden eher eine Sehnsucht nach dem Leben verspürt haben, die – auch nach kirchlicher Überzeugung – ein Sterben in Würde mit einschließt. Diese Sehnsucht spiegelt die Grundintuition der meisten Menschen, die das Instrument einer Patientenverfügung als zentrale Vorsorgemaßnahme für einen würdevollen Abschluss ihres Lebens nutzen wollen. Der aktuelle Streit um die Verbindlichkeit wie Reichweite von Patientenverfügungen ist nur zu verstehen vor dem Hintergrund weit verbreiteter Ängste: der Angst vor einer entmenschlichenden Apparatemedizin, der Angst vor dem Verlust der Selbstkontrolle und damit vor den Entscheidungen Anderer und Fremder, ja nicht zuletzt der Angst vor einem gravierenden Verlust der Lebensqualität unter den besonders beschwerlichen Bedingungen eines fortgeschrittenen Alters, einer Krankheit oder einer Behinderung. Es mag sein, dass manche dieser Ängste übertrieben sind oder medial nur aufgeladen werden. Gleichwohl wäre es überheblich und zynisch, wenn man sie achtlos beiseite schieben würde. Denn sie geben zugleich jene zutiefst humanen Sehnsüchte zu erkennen, die viele Menschen mit einem Leben und Sterben in Würde verbinden: die Sehnsucht, an einem vertrauten Ort zu sterben; die Sehnsucht, mit vertrauten Menschen zu kommunizieren; die Sehnsucht, unzumutbare Belastungen von Angehörigen oder auch anderer sozialer Netze zu vermeiden, und nicht zuletzt die Sehnsucht, ohne unerträgliche körperliche oder seelische Schmerzen den eigenen und nicht nur einen medizintechnisch diktierten Tod zu sterben. Vor diesem Hintergrund verblasst die Bedeutsamkeit von Patientenverfügungen, und andere Notwendigkeiten rücken in HERDER KORRESPONDENZ 61 2/2007 Religion den Mittelpunkt: besonders die palliativ-medizinische wie palliativ-pflegerische Ausbildung und Versorgung. Die palliative Begleitung sterbender Menschen und ihrer Angehöriger hilft, wie die Erfahrungen gerade der ambulanten wie stationären Hospizarbeit belegen, nicht nur jenen Beziehungsreichtum zu kultivieren, aus dem allein ein Sterben in Würde möglich ist. Sie ist vor allem empfindlich für Therapieziele, die den Stationen eines endenden Lebensweges angemessen sind. Die Medizin kennt zunehmend das Phänomen iatrogenen Leidens; eines Leidens von Menschen, das sich als solches erst in der HERDER KORRESPONDENZ 61 2/2007 Begegnung mit dem Arzt, besser: mit dem modernen medizinischen Versorgungssystem ergibt. Die immer ausgefeilteren Instrumente intensivmedizinischer beziehungsweise maximaltherapeutischer Versorgung können neben dem Segen, den sie für viele Menschen unzweifelhaft bedeuten, auch solches iatrogene Leiden verursachen. Diese Ambivalenz gilt es sorgfältig im Auge zu behalten, um ein Sterben in Würde zwar nicht zu garantieren, wohl aber zu begünstigen – eine vermutlich weitaus bessere Vorsorge, als alle noch so ausgeklügelten Regelungen zu Patientenverfügungen. Andreas Lob-Hüdepohl 87