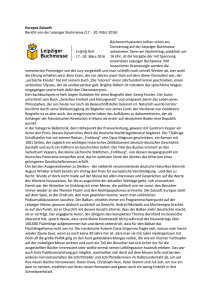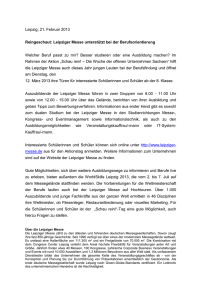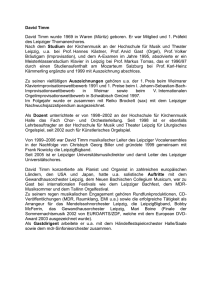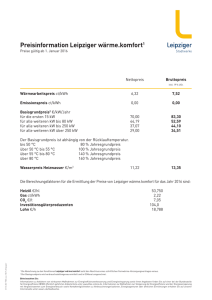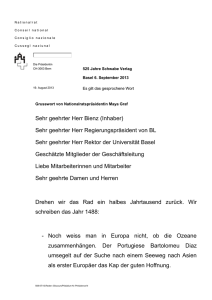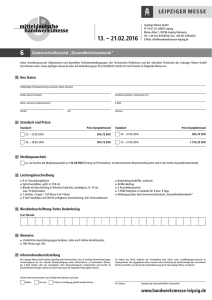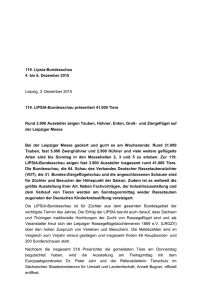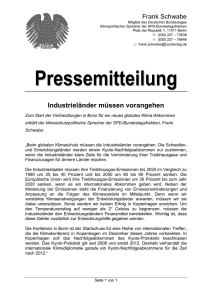Tragik und Zärtlichkeit - Hans
Werbung

12 | KULTUR FREITAG, 20. MÄRZ 2015 | NR. 67 Er kramte 35 Jahre in der Rumpelkammer Auf dem Podium im Zeitgeschichtlichen Forum (v.l.): Moderatorin Alexandra Gerlach, Frank Richter, Antje Hermenau, Hans-Joachim Maaz und Jan Emendörfer. Willi Schwabe wäre morgen 100 Jahre alt geworden Fotos: Wolfgang Zeyen Von norbert Wehrstedt Er sah aus wie ein Grandseigneur. Silberweißes, Haar, streng gekämmt und scharf gescheitelt, Hornbrille, dezenter Anzug, Krawatte. Undenkbar, dass Willi Schwabe sich in Jeans gezwängt hätte. Er wirkte in den 60ern, 70ern wie einer, der aus anderen Jahrzehnten kam. Was sicher auch an jenem monatlichen Gang in die Adlershofer„Rumpelkammer“ lag, den er seit 1955 machte. 387 Mal schloss er bis 1990 die Bodentür auf, um dahinter in ein Reich aus staubigen Requisiten, Anekdoten und Erinnerungen an alte, deutsche Filme einzutauchen. Das machte er mit einer sonoren Stimme, die launig über Entdeckungen plauderte und voll sanfter Ironie steckte. Er mochte hörbar das, was er da auskramte, auch wenn er Distanz wahrte. Nazi-Unterhaltungsfilme waren schließlich keine so einfache Ware, auch wenn sie Montag für Montag im DDR-Fernsehen liefen. Hinter dem Mann mit Laterne und im altertümlichen Tagesrock, der die „Rumpelkammer“aufschloss, verschwand allerdings der Theater-Schauspieler Willi Schwabe. Vielleicht, weil er immer ein Ensemble-Spieler blieb. Vielleicht, weil er bei der Defa und im Fernsehen nur in Nebenrollen auftrat. Die aber machte er in kurzen, präzisen Auftritten zu Charakteren. So wie den Hofmarschall Kalb in Martin Hellbergs „Kabale und Liebe“. Oder jenen gerissenen Soldaten-Werber in „Mutter Courage und ihre Kinder“. Nur in etwas über 20 Filmen hat Willi Schwabe vor der Kamera gestanden – von „Kleinen Muck“, „Kein Hüsung“, „Leuchtfeuer“ über „Thomas Müntzer“ und „Lissy“ bis zu „Chronik eines Mordes“, „Der Mann, der nach der Oma kam“ und „Zwei schräge Vögel“. Willi Schwabe, der Bühnenbildner lernte, privat Schauspielunterricht nahm, mit Wanderbühnen umherzog, in kleinen Rollen am Deutschen Theater auftrat, nach Rückkehr aus britischer Kriegsgefangenschaft und Zwischenstationen 1949 am Berliner Ensemble landete, war vor allem Theatermann. Einer, der noch das Sprechen beherrschte und mit Sprache Figuren zeichnete, der jede Menge Brecht spielte und bis 1990 am BE blieb. Daneben reiste er mit musikalisch-literarischen Programmen, die seine wunderbare Vielseitigkeit jenseits des TV-Filmentdeckers zeigten. Da gingen wohl viele in diese Auftritte nur, weil Willi Schwabe ein TV-Star war – und erlebten einen ganz anderen, mitreißend komischen und hinreißend quicken Willi Schwabe. Am 21. März vor 100 Jahren wurde der Sohn von Opernsängern, der 1991 starb, geboren. Seit 2002 trägt eine Straße in Adlershof seinen Namen. Willi Schwabe öffnete von 1955 bis 1990 die „Rumpelkammer“ 387 Mal. Und wie klang der berühmte Rumpelkammer-Trailer? Bitte Foto scannen. Foto: Archiv Der empörte, unzufriedene Bürger, der mitreden will Im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig wurde über Pegida, Politik und Medien diskutiert Von norbert Wehrstedt Es geht ein Gespenst um in Deutschland. Das Gespenst hat viele Namen: Unbehagen, Unsicherheit, Verunsicherung, Unzufriedenheit. Hinter dem Gespenst steht der empörte Bürger, der nicht mehr länger dem deutschen Michel die Treue hält, sondern auf die Straße geht. Auf Pegida komm raus. Woher kommen Wut, Frust, Enttäuschung, Desillusionierung? Wie gehen Politiker und Medien damit um? „Da hatte sich ein Gefühl der Ohnmacht angestaut“, sagt Frank Richter, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, der sein Haus in Dresden – nicht unumstritten – für erste Dialoge geöffnet hatte. Nun plädierte er bei einer Diskussion im Zeitgeschichtlichen Forum, das in Ko- Dessau-Rosslau. Der scheidende Generalintendant des Anhaltischen Theaters, André Bücker, übernimmt Ende des Jahres die Regiearbeit zu „Eine Familie“ in Koblenz. Das sagte Bücker, dessen zum Ende der Spielzeit in Dessau-Roßlau auslaufender Vertrag nicht verlängert wurde. „Eine Familie“ ist die deutsche Adaption des preisgekrönten Theaterstücks „August: Osage Country“ des US-amerikanischen Dramatikers Tracy Letts. Vom Anhaltischen Theater verabschiedet sich Bücker mit einer Inszenierung des Schauspiels „Götz von Berlichingen“, die heute (19.30 Uhr) Premiere feiert. tig zu machen: „Die Leute wollen aber mitreden.“ Es sei vielleicht Zeit für Elemente einer direkten Demokratie, für Volksentscheide. Die Kaste der Politiker sieht HansJoachim Maaz in Hinsicht auf Vertrauen in den mündigen Bürger skeptisch. Für jeden, der in die Politik gehe, gebe es große Risiken: Es geht um Macht, Autorität und darum, recht zu haben: „Keiner sagt: Ich weiß jetzt nicht, wie’s weitergeht, ich brauche Austausch. Wer so denkt, kommt in keine Machtposition.“ Es habe sich da eine Elite herausgebildet, sagte Jan Emendörfer, Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung, die wie ein Ufo über den Leuten kreise. Daraus entstehe eine generelle Unzufriedenheit mit dem System, die sich auch in so absurden Losungen wie „Ami go Zum 100. Geburtstag des Pianisten Swjatoslaw Richter Von Gerald Felber Der Mann habe, sagte mal eine Radiokollegin, die ihn persönlich kannte und zum Deftigen neigte, „Hände wie Klodeckel“. Die berühmte Pianistenpranke also, Signum eines spezifisch maskulinen Musizierens; was ja auch völlig außer Frage steht, wenn man Swjatoslaw Richter etwa mit Beethoven, vor allem aber mit Prokofjew hört – jenem Komponisten, mit dem er unter seinen Zeitgenossen vielleicht am engsten verbunden war und von dem er drei seiner späten Solosonaten zur Uraufführung brachte. Da gibt es granitharte Akkorde und stählern dröhnende Ostinati, einen wilden und dennoch disziplinierten Zugriff ins Tastenfeld: enorme Kraft, kultiviert durch einen nicht weniger eisernen Formwillen. Und dennoch konnte Richter auch zärtlich sein, romantische Andantes lyrisch verströmen lassen, Schubert-Impromptus oder Sonaten in entgrenzte Meditationen verwandeln. Sicher, das Grazile, elfenhaft-Elegante lag ihm nun wirklich nicht. Es wäre aber vielleicht auch eine Art Kunst-Lüge gewesen – nicht nur angesichts der spezifischen physischen Voraussetzungen dieses Spätstarters, der heute vor 100 Jahren geboren wurde, eigentlich Maler oder Dirigent werden wollte und erst mit 22 Pianist Swjatoslaw Richter im Jahr 1966 in Charkow. Jahren zu dem genialen Talente-Former Heinrich Neuhaus (nebenbei mit einem deutschen Vorfahrens-Zweig und ukrainischen Kinder- und Jugendjahren ausgestattet wie Richter selbst auch) ans Moskauer Konservatorium kam; sondern auch vor dem Hintergrund einer tragischen Biographie unter der Gewalt des stalinistischen Repressions-Regimes: Richters Vater wurde als deutscher Spion verdächtigt und hingerichtet, zur ins Exil gegangenen Mutter war fast zwei Foto: Yuri Shcherbinin/Wikimedia Commons Jahrzehnte jede Verbindung unterbrochen, und der Künstler selbst durfte erst als Mittvierziger außerhalb des sozialistischen Lagers reisen und auftreten. Dann allerdings wurde er, vorher eine Geheimtipp-Legende, schnell und endgültig zu einer tatsächlichen, zumal er das „Live-Gen“ hatte: obwohl im Auftreten eher scheu und linkisch, fern jeder Star-Attitüde und vor allem in späteren Jahren (Richter spielte noch bis in sein letztes Lebensjahrzehnt, bevor der 1997 in Moskau starb) lieber in kleineren Sälen und Veranstaltungsorten zu Hause als in den großen Metropolen, wirkte seine enorme physisch-klangliche Präsenz weltweit elektrisierend auf das Publikum. Die leidenschaftliche Motorik und das weitgreifende Pathos seines Spiels bedienten die Sehnsucht nach großen Gefühlen – und das kam im direkten Kontakt mit den Hörern ungleich besser an als über Plattenstudios, mit denen er lebenslang fremdelte; schlimmer als beflissene Produzenten waren dem enorm selbstkritischen großen Schweiger gegenüber nur noch die Journalisten dran. Ich selbst habe Richter im (alten) Leipziger Gewandhaus ein einziges Mal gehört – doch das in einer höchst bezeichnenden Situation: als einen von fünfzehn Mitwirkenden in Alban Bergs Kammerkonzert, einem spröden, sich vor den Hörern eher verschließendem Stück jenseits aller Kulinarik, bei dem der Weltklassepianist – es mag Ende der 70er gewesen sein – vordergründig zunächst nur durch die Größe seines Instruments aus dem Ensemble hervortrat. Dennoch spürte man, dass eben bei ihm das geistige Zentrum der Aufführung lag, ohne dass er sich irgendwie herausgestrichen und ungebührlich präsent gemacht hätte: So muss große Kunst wirken. „Jetzt ist die Jugend dran“ Franckesche Stiftungen feiern Unesco-Antrag André Bücker übernimmt Regie in Koblenz Globalisierung mit ihren neuen Verunsicherungen. Es gebe eine anhaltende Suche nach Werten und Orientierung, die nicht allein materiell sind: „Was ist am Westen nicht in Ordnung? Das ist die Frage. Da sind wir Ostdeutschen viel offener.“ Der außerparlamentarische Protest sei auch hilfreich, damit über verdrängte Themen gesprochen wird. Problematisch bleibe, dass nicht über Inhalte geredet, sondern lieber abgewertet und in die rechte Ecke gestellt werde. Für Antje Hermenau, die sächsische Ex-Grüne, macht sich in den Pegida-Demonstrationen „eine große Enttäuschung Luft“. Die Leute auf der Straße fühlten sich nicht gehört mit ihren alltäglichen Sorgen. Das Diskussionsklima sei inzwischen vergiftet, da die politischen Eliten darauf beharren, alles rich- Tragik und Zärtlichkeit Kurz gemeldet Halle. Die Franckeschen Stiftungen feiern von heute bis Sonntag die traditionelle Francke-Feier mit zahlreichen Veranstaltungen anlässlich des Geburtstags von August Hermann Francke (1663–1727). Unter anderem wird ein Wohnwagen vorgestellt, der als Botschafter der Stiftungen künftig durch die Lande ziehen soll. Neben dem Geburtstag des Gründungsvaters der Stiftungen wird auch der Beginn des neuen Jahresprogramms gefeiert. In diesem Jahr steht es im Zeichen des Unesco-Antrags. 2016 wollen die Franckeschen Stiftungen in die Liste der Welterbestätten aufgenommen werden. operation von Deutschlandfunk und Leipziger Volkszeitung stattfand und live übertragen wurde, für den positiven Blick: „Ich haben den Osten seit 25 Jahren nicht mehr so politisiert gesehen.“ Pegida nehme das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung wahr und treibe die politischen Eliten vor sich her: „Aber ich fordere dabei mehr Konstruktivität.“ Das blieb die Kernfrage der Debatte. Die Demonstranten wollen nicht mit der Politik reden. Und die Politik? Schlägt die nur mit der rechten Keule zurück? Stimmt etwas nicht am System? Der Psychotherapeut Hans-Joachim Maaz („Der Gefühlsstau“) führt die Unzufriedenheit, die Pegida trägt, auf jene naive Illusionen zurück, die glaubten, mit der Wende gehe es rasch allen besser. Die seien enttäuscht worden und träfen nun auf die Der Leipziger Grafiker, Zeichner und Maler Arnd Schultheiß wird 85 Von thomas mayer „Ich bin Widder, ich liebe Schafe …“, sagt Arnd Schultheiß und ließ sich vor wenigen Tagen gut gelaunt neben einer Plastik des Leipziger Bildhauers Olaf Teichmann fotografieren. In bemerkenswert gelassener Stimmung begeht Schultheiß, Maler, Zeichner, Grafiker, Collagekünstler, am Sonntag seinen 85. Geburtstag. Kunst war sein Leben. Seit gut einem Jahr blickt er dabei nur noch auf das zurück, was er in vielen Jahrzehnten schuf. Denn seit er eines Morgens in einen kleinen Spiegel schaute, sich dachte: Selbstporträts hast du aber lange nicht geschaffen – und dann auf einem kleinen Blatt Papier als finales von zahlreichen Bildnissen eins mit Totenschädel und Blindenbrille entstand, da wusste er: „Das war’s. Ich hab’ genug gemacht.“ Malen, Zeichnen war für Arnd Schultheiß seit früher Kindheit Lebensinhalt. Friedrich Nietzsche lieferte ihm die Maxime: „Wir haben die Kunst, um im Leben nicht zu Grunde zu gehen.“ So gab es zahlreiche Ereignisse, ja Sternstunden, die er nie vergessen wird. 1951, gerade mal fertig mit dem Studium, bot ihm der Leipziger Kunsthändler Engewald die Chance einer ersten Ausstellung. Eines Tages kam die Mitteilung, Er liebe Schafe, sagt Arnd Schultheiß, auch dieses (gebrannter Ton, 2011) von Olaf Teichmann in der Ausstellung „Natur & Figur“ im Kunstverein Panitzsch e.V . Foto: Armin Kühne Bildermuseums-Direktor Johannes Jahn habe drei Tier-Zeichnungen erworben. Der junge Mann war glücklich. Wie Schultheiß erst jetzt erfuhr, waren diese Blätter die erste Neuerwerbung des Museums nach dem Krieg. Der Künstler wurde vor allem auch mit seinen Zeichnungen aus dem Konzertsaal prominent. Mit Gewandhauskapellmeister Vaclav Neumann begann 1968 sozusagen ein Zusammenspiel, das seinen Höhepunkt mit Schultheiß Besuch 1985 in der West-Berliner Philharmonie hatte. Über Kontakte zu Wolfgang Stresemann, Intendant des Orchesters, gab es die Genehmigung, den berühmten Herbert von Karajan zu zeichnen. Schultheiß durfte den Maestro live mit dem Zeichenstift aufs Papier bringen. Karajan beim Anblick seines Bildes: „Was, das soll ich sein?“, erzählt Schultheiß. Und die Philharmoniker: „Genau, das ist er, wie leibt und lebt.“ Die vorerst letzte Ausstellung mit Arbeiten von Arnd Schultheiß fand im vergangenen Jahr in der Villa der ehemaligen Musikbibliothek in der LassalleStraße statt. Hier hatte er vor rund 70 Jahren das Musische Gymnasium besucht, hier hatte er „in Zeiten des Verderbens das Elysium erlebt“. Schultheiß’ Werk ist geordnet: 150 Originale der Konzertsaalstudien sind im Besitz des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig, die erotischen Zeichnungen und Collagen sind Bestandteil der Spezialsammlung von Schloss Mohlsdorf bei Erfurt. Sein schriftlichen Archiv wollte die Berliner Akademie der Künste haben. Schultheiß gab gern und weiß es dort in guten Händen. In 36 Museen und weiteren Sammlungen ist er mit seiner Kunst präsent. Er malt und zeichnet zwar nicht mehr, ist aber dennoch oft im Atelier. Ordnen, Systematisieren heißen nun die Aufgaben, noch sind die Schränke mit Kunst gut gefüllt. Mit Büchern unter den Titeln „Resümee“ I bis V, erschienen im Passage Verlag, hat er sein Leben für die Kunst niedergeschrieben und abgebildet. „Jetzt ist die Jugend dran“, sagt Schultheiß. home“ artikuliere. Bei der Berichterstattung über die Pegida-Demonstrationen treffe keiner der gern erhobenen, pauschalen Vorwürfe gegen die Medien die Leipziger Volkszeitung. Es wurden die 19 Punkte von Pegida ebenso abgedruckt wie ganze Seiten für Lesermeinungen frei geräumt: „Aber wenn’s zu extrem wird, können wir es nicht mehr drucken. Da gibt es eine klare Grenze.“ Wie nun also weiter im holprigen Dialog mit den Unzufriedenen, für den Frank Richter vehement plädierte? Eine Aufgabe für Politiker? Davon hält Antje Hermenau gar nichts: „Das funktioniert nicht, da fühlen die Politiker sich nur angegriffen. Vielleicht sollte man es wie im Herbst 1989 machen und die Kirchen öffnen. Die können ja die Sorgen des Nächsten aushalten.“ Beziehungen im digitalen Zeitalter Bruno Cathomas inszeniert am Leipziger Schauspiel Von dimo riess Wäre „Eigentlich schön“ kein Theaterstück, sondern eine Seminararbeit, würde sie vielleicht „Soziale Beziehungen im Zeitalter der digitalen Kommunikation“ heißen. Oder so ähnlich. Denn darum geht es letztlich in Volker Schmidts Text, den das Studio der Schauspielstudenten am Leipziger Schauspiel heute auf der „Diskothek“-Bühne zur Uraufführung bringt. In der Regie des renommierten Schauspielers Bruno Cathomas, derzeit engagiert am Schauspiel Köln, zuvor Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne. Für den Deutschen Filmpreis war er auch schon nominiert. Und mit Schmidts „Eigentlich schön“ verbindet ihn einiges. „In einer Rolle kann man mich erkennen“, sagt Cathomas. Der Schweizer Schauspieler und der österreichische Autor sind sich freundschaftlich verbunden. Schmidt hat Cathomas zur Vorlage einer seiner sechs Charaktere gemacht. Figuren, die Fernbeziehungen leben und Freundschaften über Facebook pflegen. Echte Welt und digitaler Kontakt fallen auseinander, Identitäten wandeln oder vervielfältigen sich. Die Angst vor der Einsamkeit wird mühsam überspielt, Statusmeldungen ersetzen tiefgehenden Austausch. Schmidt beschreibt eine rastlose und entwurzelte Gesellschaft. Und Schauspieler passen mit ihren wechselnden Engagements und Wohnorten fast zwangsläufig ins Bild. „Man kann im Innersten sehr allein sein, obwohl man ständig mit vielen Leuten zu tun hat“, skizziert Cathomas die Situation. Er selbst leide an der Einsamkeit von Hotelzimmern und wähle reflexhaft das Hintergrundrauschen des Fernsehers. Er sieht Tendenzen zu einer Gesellschaft, die es weder aushält, allein zu sein, noch in der Lage ist, sich ganz auf einen Partner einzulassen. Cathomas hat „Eigentlich schön“ dem Schauspiel selbst zur Aufführung vorgeschlagen. Für die Premiere der Studioinszenierung mit sechs Schauspielstudenten verspricht er maximale Distanz vom aktuell grassierenden, statischen Textaufsage-Theater. Ästhetisch soll die ungeordnete Informationsfülle der digitalen Welt reflektiert werden. Mit mehreren Spiel- und Bedeutungsebenen, die teilweise parallel ablaufen. Cathomas spricht von einer „systematischen Überforderung“ des Publikums. Und von viel Energie auf der Bühne, die von den jungen Schauspielern in der gemeinsam erarbeiteten Choreografie verbreitet werde. Cathomas: „Ich liebe es, mit Studenten zu arbeiten.“ „Eigentlich schön“: Premiere, heute, 20 Uhr; z Schauspiel „Diskothek“; Kartentelefon: 0341 1268168; weitere Aufführungen: 25. März und 10. und 14. April