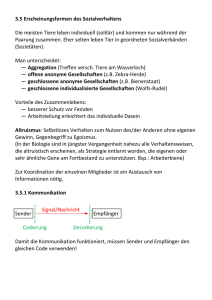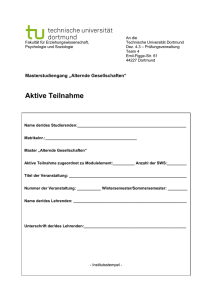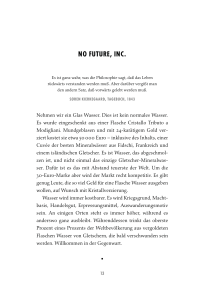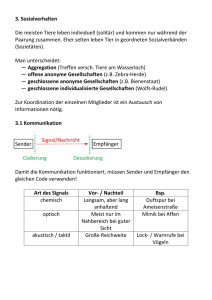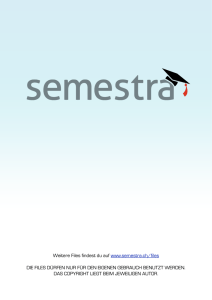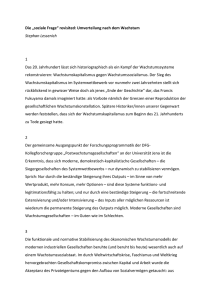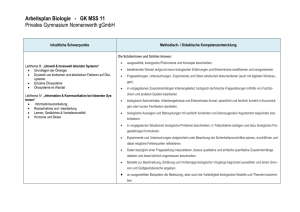Demokratisch – gerecht – nachhaltig
Werbung

»verdanken« haben. Kurz gesagt, »erste Natur« im Sinne des alten Cicero gibt es nicht mehr. Die frühe, vormenschliche Welt der Natur, die selbstverständlich ihre eigene Evolution durchlaufen hat, ist – so weit das Auge reicht – ein für alle Mal verändert und verwandelt, ganz so, wie es Serge Moscovici, einer der Pioniere der politischen Ökologie in Frankreich, vor vierzig Jahren vorausgesehen hat. Was wir »Umwelt« nennen, ist heute ununterscheidbar eins mit der »zweiten Natur«3 , die der Mensch wenn schon nicht nach seinem Bilde, so doch wenigstens für seine Zwecke geformt hat. Nach neueren Berechnungen haben die Menschen bis zum Jahr 1700 nur 5 Prozent des Bodens in der Biosphäre für ihr eingreifendes Tun beansprucht (Landwirtschaft, Städte); 45 Prozent blieben damals noch in einem halb natürlichen Zustand und 50 Prozent ganz und gar unberührt. Im Jahr 2000 dagegen beansprucht der Mensch für sein Eingreifen 55 Prozent des Bodens, während 20 Prozent im halb natürlichen Zustand und 25 Prozent unberührt bleiben.4 »Der Mensch ist gleichermaßen Geschöpf und Schöpfer seiner Umwelt«, mahnte schon 1972 die Konferenz von Stockholm in ihrer Schlussdeklaration. Um zum Kern unserer Sache vorzustoßen, wollen wir noch einen Schritt weiterdenken: Wenn es stimmt, dass heute die gesamte Natur abhängig von uns Menschen ist, dann wird für die Entwicklung der Ökosysteme und der in ihnen beheimateten Arten entscheidend sein, wie wir unsere Gesellschaften organisieren. Mit anderen Worten, aus den ökologischen sind soziale Probleme geworden. Wie lässt sich ein Begriff von den komplizierten Beziehungen zwischen Sozial- und Ökosystemen gewinnen? Die Letzteren bilden den oftmals unsichtbaren Hintergrund der menschlichen Gesellschaften. Außerdem hat man sie hier und da als Metapher, ja als Modell für Gesellschaftssysteme verwendet, nicht selten allerdings im Dienst gefährlicher5 oder dubioser6 Ideologien und fast immer zum Zweck einer Naturalisierung gesellschaftlicher Probleme7 . Aber da wir vermehrt in umgekehrter Richtung denken müssen, gilt es zu begreifen, wie sich die Evolution der Gesellschaftssysteme auf die Dynamik der Ökosysteme auswirkt. Dass uns diese Frage unter den Nägeln brennt, steht außer Zweifel: Wir müssen uns, ob wir wollen oder nicht, mit einer Reihe ernsthafter Probleme befassen, die wir ebenso sehr geschaffen haben, wie wir von ihnen heimgesucht werden, und die daher in keiner Weise »natürlich« sind, weder was ihre Ursachen noch was ihre Folgen angeht. Im derzeit üblichen Diskurs verbirgt sich jedoch ein irritierendes Paradox: Je mehr der Menschheit, ganz zu Recht, die Beschleunigung der heutigen Umweltkrisen zur Last gelegt wird, umso pessimistischer wird das Urteil über ihre Fähigkeit, diese Krisen zu lösen. Zutiefst ernüchtert, konstatierten unlängst einige hochrangige Wissenschaftler, zwar habe die menschliche Erkenntnis der Ökosysteme in den vergangenen Jahrzehnten rasante Fortschritte gemacht, aber gleichwohl sei die Lage dieser Systeme schlimmer als je zuvor.8 Es empfiehlt sich also, zwei zentrale Fragen noch einmal neu zu stellen: Wie konnte der Funktionsmechanismus der menschlichen Gesellschaften solche reellen und potenziellen Katastrophen hervorbringen? Und wie kann er ihre fatalen Folgen abschwächen? Für eine offene Auseinandersetzung mit diesen Fragen spielen die Sozialwissenschaften, die ja das Verständnis menschlicher Gesellschaften zum Ziel haben, im Gegensatz zu den strengen (Natur)Wissenschaften eine alles andere als marginale Rolle. Ganz im Gegenteil, sie rücken wieder ins Zentrum: Mit ihrer Hilfe nämlich können wir uns einen