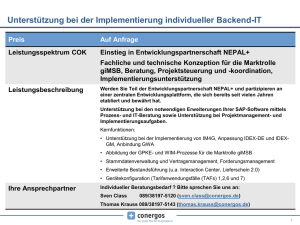Professor Dr. Marita Krauss Historikerin im Gespräch mit Dr
Werbung

Sendung vom 7.3.2017, 20.15 Uhr Professor Dr. Marita Krauss Historikerin im Gespräch mit Dr. Michael Appel Appel: Verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zum alpha-Forum. Unser Gast ist heute Professor Marita Krauss. Herzlich willkommen, Frau Krauss. Krauss: Vielen Dank für die Einladung. Appel: Frau Krauss, Sie unterrichten europäische Regionalgeschichte und haben sich dabei zwar ein bisschen auf Schwaben und Bayern spezialisiert, unterrichten aber doch alles, was sozusagen in Europa an Regionalem zu finden ist. Da drängt sich mir eine Frage auf: Die Hälfte der Menschheit lebt in Städten, und dies zunehmend mehr. Die Globalisierung ist ein Prozess, der von vielen mit großem Zweifel und großer Skepsis betrachtet wird, der aber doch unumkehrbar ist. Ist da eine Regionalhistorikerin so etwas wie eine Nachlassverwalterin, also eine Wissenschaftlerin, die die Gene einer aussterbenden Art untersucht? Oder stehen Sie da in einem Prozess, den man wirklich noch real greifen kann? Krauss: Das ist eine wichtige Frage, denn ich glaube, es geht genau anders herum: Je globaler wir werden, umso wichtiger wird die Region. Denn die Menschen orientieren sich einfach immer an ihrem Nahraum. Das ist wirklich greifbar, denn als in Europa die Grenzen weggefallen sind, ist in dem Moment das Bedürfnis, sich in der Region zu orientieren, viel größer geworden, und zwar gerade deswegen, weil man wieder Grenzen sucht – und wenn es auch nur die Grenzen des eigenen Lokalen, Regionalen sind. Die Städte gehören da natürlich mit dazu: München und Oberbayern, ich bitte Sie, das ist doch eine Region! Die Münchner fühlen sich total München zugehörig – die meisten zumindest. Und das ist natürlich auch Regionalgeschichte. Ich habe ja auch sehr viel zur Geschichte Münchens gearbeitet und mache das nach wie vor: Da merke ich dann rasch, was für eine Strahlkraft so eine Stadt hat, was für ein Identifikationspotenzial. Und genau dort setzt auch die Regionalgeschichte an, egal wo in Europa. Ich bin ja mit meinem Lehrstuhl vor allem für die bayerische und schwäbische Landesgeschichte zuständig, habe aber immer schon weiter ausgegriffen mit verschiedenen Themen, die ich bearbeitet habe. Ich denke, das ist auch eine große Chance, das Kleine im Großen zu zeigen. Im Umgang mit den Studierenden ist es genauso: Wenn man denen den Dreißigjährige Krieg erklären will und man würde das nur anhand von irgendwelchen großen Konstellationen machen, dann wären alle Studierenden irgendwie unglücklich, wenn sie versuchen, sich das alles zu merken. Wenn man jedoch sagt, was dieser Krieg vor Ort angerichtet hat und wie viele Opfer es vor Ort gegeben hat und dass freie Reichsstädte wie Isny danach zu 80 Prozent ausgelöscht waren, nämlich durch Seuchen, durch Kriegsereignisse, durch Hunger usw., dann bekommt das eine enorm große Kraft. Ich denke daher, sowohl für diejenigen, die das unterrichten, wie für diejenigen, die an bestimmten Themen arbeiten, ist die Regionalgeschichte oft ein hervorragender Ausgangspunkt, um das Große zu verstehen. Appel: Ich stimme Ihnen da durchaus zu. Wenn ich so darüber nachdenke, muss ich auch sagen: Mir sind so viele Berliner begegnet, die, was weiß ich, nie aus dem Wedding raus und z. B. nach Kreuzberg gehen würden, sodass sich quasi auch in der Stadt immer wieder ein Dorf bildet. Krauss: Das Lokale ist einfach unglaublich stark. Im Zweifelsfall werden ja Leute dann mehr oder weniger eingemeindet. Es gibt ja kaum jemand, der "erst" seit 15, 20 Jahren in München lebt und sich nicht selbst als Münchner bezeichnen würde. Die großen Städte haben also noch einmal eine ganz eigene Strahlkraft. Appel: Sie sind aber auch ein Kosmos für sich, eine Region für sich. Krauss: Ja, das stimmt, sie sind eine Region für sich. Aber sie gehören natürlich schon auch in ihr Umland. Im Fall von München ist das ja sehr greifbar. Das gilt aber auch für andere Städte, denn z. B. auch Augsburg oder Nürnberg haben selbstverständlich ihren "Fanclub", der sich dort zu Hause fühlt. Ich habe ja auch Hamburg untersucht: Das ist natürlich eine Stadt, die allein durch diesen Stadtstaatstatus eine ganz eigene Form der Identifikation mit dieser Region besitzt. Appel: In welcher Form? Krauss: Ich war sieben Jahre lang in Bremen und dort hat man das ebenfalls: Die Bremer sind natürlich mit hohem Selbstbewusstsein ausgestattet. Appel: Das sind die Hanseaten, die Kaufleute. Krauss: Ja, und dadurch ergibt sich natürlich ein Bezug auf die lange Vergangenheit und vor allem auch auf den Hafen. Der Hafen war in Hamburg immer das Identifikationsmerkmal schlechthin. Als es nach dem Krieg um den Wiederaufbau ging, waren alle vor allem am Wiederaufbau des Hafens interessiert und natürlich auch sehr, sehr stark transatlantisch orientiert. Das hatte schlicht damit zu tun, dass über diesen Hafen und die Schifffahrt die Existenz dieser Stadt verbunden war. In Bremen war es genauso. Appel: Als 1992 der Vertrag von Maastricht ausgehandelt worden ist und 1993 dann ratifiziert wurde, kam im Zuge der wachsenden politischen Integration Europas auch der Begriff vom "Europa der Regionen" auf. In diesem Sinne würden Sie da wohl mitziehen und sagen, dass Regionen im Gegensatz zu Staatsgrenzen nie verschwinden werden? Krauss: Nun ja, das ist natürlich schon eine mutige Aussage, denn auf der anderen Seite gibt es natürlich schon auch immer mehr Schlafstädte. Das heißt, es gibt viele Menschen, die sich irgendwo in einer Stadt oder in einem Dorf ansiedeln, wo sie eigentlich nur wohnen, aber nicht wirklich Wurzeln schlagen und wo es teilweise gar keine Wirtshäuser mehr gibt. Die Wirtshäuser sind ja einer der wichtigsten Treffpunkte und Identifikationsorte. Diese Menschen haben teilweise ein Problem, ihre Region wirklich als Identifikationspotenzial zu nutzen. In Fremdenverkehrsgegenden ist das natürlich anders. Gehen Sie nach Lindau, gehen Sie an den Starnberger See, gehen Sie in wunderschöne Gegenden in Franken, die natürlich ebenfalls vom Tourismus mit belebt werden: Dort ist das Regionalbewusstsein um einiges größer, weil man natürlich auch etwas anzubieten hat und weil auch Leute in diese Region kommen und die Menschen nicht nur aus dieser Region abwandern. Appel: Da gibt es dann die seltsame Situation, dass das sowohl modern ist, weil es da ja im Hintergrund Marketingaspekte gibt, wie auch vergangenheitsorientiert, weil da Traditionspflege betrieben wird. Krauss: Ja, ja, mein lieber Geografiekollege hat immer gesagt: "Region ist das, was die Tourismuswerbung zur Region erklärt." Insofern ist da also schon etwas Wahres dran. Denn die Regionen hatten aufgrund ihrer Geschichte ja auch teilweise ganz andere Verbindungen, heute hingegen sind sie regelrecht zusammengeschweißt. Man kann hier als Beispiel das Allgäu nehmen und andere, die sich gemeinsam vermarkten. Und das ist ja auch gut so. Appel: Wenn man die "Region Allgäu" mal unter touristischen Gesichtspunkten sieht, ist es ja so, dass sie sich, weil das eben so populär war, größenmäßig unglaublich entwickelt hat: Da wurde eine kleine Region aus Marketinggründen auf einmal zu einer riesengroßen Region, die davor vollständig parzelliert gewesen ist. Krauss: Auch Schwabing ist ja unglaublich groß geworden in München: Was da alles noch als zu Schwabing gehörig bezeichnet wird! Weil alle in Schwabing wohnen wollen, gehört auf einmal alles zu Schwabing. Appel: Das ist gut für die Immobilienpreise. Krauss: Das stimmt, das ist gut für die Immobilienpreise, aber auch gut für einen Zusammenschluss. Ich würde das also doch recht entspannt sehen wollen. Dass sich die Region Bodensee nun gemeinsam vermarktet, finde ich schon in Ordnung, ebenso wie bei der Region Allgäu usw. Regionen sind ja im Fluss, Regionen sind nicht auf ewig festgeschrieben … Appel: … mit festen Grenzen versehen … Krauss: Es ist ja das Schöne an den Regionen, dass sich die Region – und so wird "Region" ja auch definiert – nicht über irgendwelche staatlichen Vorgaben konstituiert, sondern schon auch über die Selbstidentifikation. Ich bin ja auch Landeshistorikerin, d. h. ich betreibe gleichzeitig Regionalgeschichte und Landesgeschichte: Die Landesgeschichte hat natürlich stärkere Grenzen, die sozusagen durch den Staat vorgegeben sind. Aber machen Sie mal eine Landesgeschichte von BadenBindestrich-Württemberg oder von Schleswig-Bindestrich-Holstein oder von Nordrhein-Bindestrich-Westfalen, wo das ja noch viel krasser ist: Das sind Bundesländer, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind und die sich daher sehr viel stärker als Bayern selbst definieren müssen. Denn Bayern hat doch viele Grenzen beibehalten im Laufe seiner Geschichte und kann mit seinem altbayerischen Kern diesbezüglich immer gut punkten. Aber ich bin ja jetzt in Augsburg am Lehrstuhl und dort in Augsburg erkennt man natürlich sehr viel stärker als in München, dass der Blick auf Bayern von Augsburg oder von Nürnberg aus ganz anders aussieht als von München aus. Wenn man von München hinausschaut, hat man schnell das Gefühl: "Ja, das ist ja alles Bayern!" In Augsburg hingegen fühlt man sich schon noch sehr stark dem Lokalen, der lokalen Tradition und natürlich auch den alten Traditionen einer freien Reichsstadt verpflichtet, sodass man eigentlich auf München herabschaut und sagt: "Ach München, du bist doch nur ein Newcomer, ein Emporkömmling." Appel: "Wir waren im Gegensatz zu dir schon vor 500 Jahren wer!" Krauss: So ist es. Appel: Sie haben soeben Nordrhein-Westfalen erwähnt; in diesem Zusammenhang dürfen wir ein Thema nicht vergessen: Sie haben sich ja auch mit Bayern und Preußen und mit der jeweiligen Verwaltungsgeschichte befasst. Das dürfen wir nicht vergessen, aber ich möchte trotzdem zuerst noch ein wenig bei der Region und den Veränderungen in der Region bleiben. Zwei Ihrer Schwerpunkte waren ja die Migration und die Globalisierung. Konzentration hat ja immer etwas mit der Attraktivität von Räumen, von Städten, von Regionen zu tun und zieht damit quasi automatisch Migration nach sich. Migration produziert ja auch immer Angst vor der Migration und vor der missglückten Integration. Ist das eine Dauererscheinung in der Geschichte oder ist das etwas, das wir heutzutage besonders vor Augen haben, diese Angst, dass sich z. B. muslimische Zuwanderer in irgendetwas, was wir als christlichen Kulturraum bezeichnen mögen, nicht integrieren könnten? Krauss: Migration ist jedenfalls ein Phänomen, das es immer schon gegeben hat: Es sind ganz definitiv immer schon Menschen von einem Ort an einen anderen gewandert. Wir kennen ja auch den Ausdruck "Völkerwanderung": Es inzwischen bekannt, dass nicht alles, was mit diesem Begriff verbunden wird, historisch auch tatsächlich so abgelaufen ist. Dennoch hat das, was damals an Wanderungen geschehen ist, Europa überhaupt erst konstituiert. Man muss sich also inhaltlich nicht mehr darüber streiten, ob Migration in der Geschichte der Normalzustand war oder nicht: Es gab immer Migration, das ist immer schon ein ganz normales Phänomen in der Geschichte. Die Migrationsbewegungen waren und sind daher nicht der Ausnahmezustand. Von denen, die bereits ansässig sind, wird die Migration allerdings oft als Ausnahmezustand wahrgenommen. Appel: Weil sich etwas ändert. Krauss: Und weil es natürlich so ist: Man hat sich vor Ort etwas aufgebaut – das war vor ein paar Hundert Jahren genauso wie heute –, man hat Privilegien erworben, man hat eigenen Grund und Boden, und nun kommen welche von woanders dazu. Da gibt es dann die Sorge, dass die, die neu kommen, einem das wegnehmen. Das ist ebenfalls ein Phänomen, das man durch die gesamte Geschichte hindurch verfolgen kann: dass diejenigen, die ansässig sind, Angst haben, dass ihnen die Zuwanderer Grund und Boden, Privilegien oder sonst etwas abspenstig machen. Das ist offensichtlich mit dem Menschen verbunden – wie auch immer. Aber die Frage, wie man damit umgeht, wird eben sehr unterschiedlich beantwortet. Man kann feststellen: In Situationen, in denen man die Zuwanderer braucht, ist man natürlich viel freundlicher … Appel: Wenn man sie als Arbeitskräfte braucht. Krauss: Genau, wenn man sie als Arbeitskräfte ruft, wie das bei uns in Deutschland seit 1955 sehr stark der Fall gewesen ist, als zuerst die Italiener, dann die Spanier und andere aus südeuropäischen Ländern als Arbeitskräfte angeworben wurden. Das ging bis zu muslimischen ausländischen Arbeitnehmern aus der Türkei. Wenn man aber in die frühe Neuzeit zurückgeht, stellt man fest: "Der Türke" war natürlich seit den Türkenkriegen auch ein Schreckgespenst. Da gab es wirklich etliche große landesherrliche Dekrete, in denen es geheißen hat: "Wenn ihr nicht das Fluchen, das Saufen und das Rauchen aufhört, dann kommt der Feind der Christenheit, der Türke über euch." Das stand wirklich so in diesen landesherrlichen Dekreten drin. Ich denke daher, diese alte Tradition des christlichen Abendlandes wirkt natürlich fort in der Sorge vor dem Islam. Das ist sicherlich noch einmal ein besonderer Fokus. Andererseits denke ich, dass sich unsere Gesellschaft inzwischen sehr stark geändert hat, d. h. wir sind unglaublich weltläufig geworden. Ich kenne kaum jemanden, der selbst dann, wenn er wirklich aus einem ganz kleinen, abgelegenen Dorf kommt, nicht schon mal auf großen Reisen gewesen ist. Wir haben das Fernsehen, wir sind mit der ganzen Welt verbunden, wir können alles beobachten, was in der Welt, egal an welchem Ort, passiert an Schrecklichem, an Kriegen usw. Es gibt ja auch diese große Spendenbereitschaft der Deutschen, die dazu führt, dass diese immer dann, wenn irgendwo eine Katastrophe passiert – meinetwegen in Namibia – sofort aktiviert werden kann. Genau an diesem Punkt muss man natürlich anfangen und sagen: Diejenigen Menschen, die heute zu uns kommen, fliehen ja gerade vor all dem Schrecklichen, das wir jeden Tag im Fernsehen sehen. Und das ist ja auch etwas, was sich in dem spiegelt, was wir an Hilfsbereitschaft erleben, und dies nicht nur in der Willkommenskultur am Bahnhof, sondern bis heute in vielen, vielen Dörfern – egal ob in Oberbayern oder im tiefsten Bayerischen Wald. Überall gibt es heute diese Helferkreise. Das halte ich für eine sehr, sehr positive Entwicklung. Es sind auch nicht so viele Flüchtlinge, die zu uns kommen und bei uns bleiben, dass allein ihre Anzahl in irgendeiner Form unsere Kultur oder unser Leben wirklich infrage stellen würde. Das ist eben einfach auch ein Populismus, der dahintersteckt, dass damit Politik gemacht wird. Appel: All diese Dörfer haben ja nach dem Krieg selbst eine unglaubliche Zuwanderung in der Folge von Flucht und Vertreibung erlebt. Krauss: So ist es; damals haben sich Dörfer in ihrer Einwohnerzahl oft regelrecht verdoppelt. Ich habe das am Beispiel meines Heimatortes Pöcking, wo ich wohne, untersucht. Appel: Historisch untersucht? Krauss: Ja, historisch untersucht. Da gibt es genaue Zahlen für das Jahr 1946 für alle Menschen im Ort über 18 Jahre. Dem ursprünglichen Kerndorf Pöcking mit 555 Einwohnern standen da im Jahr 1946 489 Neuzuzügler gegenüber. Das war ein völlig anderes Verhältnis als heute mit den Flüchtlingen. In den kleinen Dörfern rund um Pöcking waren das damals sogar noch mehr. München und andere große Städte haben sich damals hingegen zu Zentren des Wohnraumbedarfs, wie das geheißen hat, erklärt und haben sich abgeschottet und nur Facharbeiter reingelassen. Deswegen saßen die Flüchtlinge und Vertriebenen damals alle auf dem flachen Land. Auch alle Sozialhilfeempfänger unter den Flüchtlingen und Vertriebenen saßen auf dem Land. Frauen mit Kindern, die Alten usw. waren alle auf dem Land untergebracht. Appel: Dort gab es aber auch keine Arbeitsplätze. Krauss: Genau, bzw. es gab nur in der Landwirtschaft Arbeitsplätze. In den ersten Jahren waren das ganz schlimme und schwierige Verhältnisse auf dem Land – natürlich für beide Seiten. Denn diese Menschen waren ja in den Häusern einquartiert und nur bedingt in irgendwelchen Lagern. Sie waren wirklich in den meisten Fällen in den Häusern auf dem Dorf untergebracht, sodass alle zusammenrücken mussten. Das muss man sich aus heutiger Sicht mal vorstellen! Wie eng das war! Wie sieht es aus, wenn man die Situation in Pöcking heute anschaut? Pöcking hat heute ungefähr 4200 Einwohner im Kerndorf: Dort gibt es gerade mal 141 Asylbewerber – aber auch 100 Helfer! Denn diese Zahl mit den Helfern muss man immer hinzufügen. Das ist natürlich eine völlig andere Situation als nach 1945 und insofern bin ich der Meinung, dass diese positive Entwicklung, die es bis heute gegeben hat auf diesem Gebiet, nicht hinter diesen Stammtischparolen verschwinden darf, wie sie teilweise in der Politik ausgetauscht werden. Appel: In dieser Zeit, von der Sie gerade gesprochen haben, aber auch in der Zeit davor waren sich die Christen untereinander ja auch nicht grün. Damals war ja ein evangelischer Zuwanderer in einem katholischen Dorf oder ein katholischer Zuwanderer in einem hauptsächlich evangelischen Gebiet auch schon ein Skandal. Krauss: So war es. Und diese Menschen wurden teilweise auch wirklich ganz schlecht behandelt. Aus diesem Grund sind diese Menschen teilweise auch weitergewandert, wenn ihnen das möglich war. Aber diese Vertriebenentransporte unmittelbar nach dem Ende des Krieges, also diese organisierte Vertreibung, lief ja mit fester Ortszuweisung ab, d. h. man konnte als Vertriebener sich nicht einfach einen Ort eigener Wahl aussuchen. Stattdessen mussten die Vertriebenen dort bleiben, wo sie hingekommen waren – egal ob sie im "falschen" Ort gelandet waren oder nicht. Aber das alles hat natürlich auch dazu beigetragen, diese konfessionelle Durchmischung voranzubringen. Ich selbst bin als evangelisches Mädchen in einem katholischen Ort in Oberbayern aufgewachsen, d. h. ich befand mich da eindeutig in der Minderheit. Aber wir Evangelischen waren eben bereits eine eigene Gruppe, wohingegen so ein Dorf noch 30, 40 Jahre vorher rein katholisch gewesen wäre. Appel: Es wäre 30, 40 Jahre früher undenkbar gewesen, dass Sie Ihrer Religion auch praktisch hätten nachgehen können, also z. B. einen Gottesdienst hätten besuchen können, denn so etwas gab es nicht. Krauss: Es wurden eben auch erst in den 60er Jahren die protestantischen Kirchen gebaut in Oberbayern. Das gilt für Franken umgekehrt genauso. Wenn man "die anderen" wirklich und unmittelbar kennenlernt, dann führt das ja immer zu mehr Toleranz. Heute ist das auch so: Den "eigenen" Türken, den man kennt, den "eigenen" Muslim, den man kennt, nimmt man aus von all den bösen Beschuldigungen. So war es natürlich auch in Franken und in Oberbayern, als man auf diesem Wege gelernt hat, dass der konfessionell Andere nicht der böse Feind ist. Das hat sicherlich sehr stark zur Toleranz beigetragen. Appel: Wir sprechen hier ja nicht von einem reinen und abgeschlossenen Stück Vergangenheit, wenn wir über diese Zeit kurz nach dem Krieg sprechen. Man muss sich ja nur einmal ansehen, wie vital die Auseinandersetzung mit Flucht und Vertreibung z. B. in Tschechien heute ist: Das ist dort bis heute ein Thema, genauer gesagt ist es sogar so, dass das heute endlich erst ein Thema geworden ist. Daran kann man erkennen, wie lebendig all diese Dinge bis heute sind. Sie haben ja auch sehr viel zur Geschichte der Vertriebenen und der Vertreibung geforscht: Wie haben Sie das in Ihren Kontakten nach Tschechien erlebt? Krauss: Das ist ein unglaublich spannender Prozess gewesen. Als Historikerin ist man ja häufig mit der Vergangenheit beschäftigt – das ist sozusagen der selbstgewählte Normalfall. Und je weiter man zurückgeht in die Historie, desto länger sind die Leute tot, mit denen man sich beschäftigt. Bei diesem Thema war ich hingegen ganz nah dran, ganz nah an dem dran, wie Geschichte passiert. Das hat mich absolut fasziniert und bewegt. Appel: Das müssen Sie uns genauer erklären: Was meinen Sie mit "Geschichte passiert"? Krauss: In Tschechien findet ja ein Entwicklungsprozess statt. Ich selbst war beteiligt an der Erarbeitung des Sudetendeutschen Museums und habe in diesem Zusammenhang ein Konzept gemacht, das sehr grenzüberschreitend gedacht war und sich eben nicht nur auf die Tatsache bezogen hat, dass es da Menschen gibt, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo gelebt haben, dann gewaltsam vertrieben wurden und nun hier bei uns leben. Stattdessen habe ich den Blick auch immer wieder zurück über die Grenze geworfen. Ich hatte zwei tschechischsprachige Mitarbeiter, die auch Interviews in Tschechien geführt haben. Denn wir haben ein großes Interviewprojekt gemacht mit insgesamt 120 Interviews mit Hilfe von Geldern des Landtags: mit Sudetendeutschen. Wir haben aber auch über die Grenze hinweg deren Geschichte in Tschechien erarbeitet und dort eben auch Menschen interviewt, die teilweise sogar noch Vertriebene gekannt haben. Wir haben aber auch mit den Ortshistorikern, mit den Bürgermeistern usw. Interviews gemacht. Dabei haben wir gemerkt, dass diese Geschichte in Tschechien keineswegs vergangen ist. Man hatte ja in den tschechoslowakischen Geschichtsbüchern die sudetendeutsche Geschichte, also die eigene deutsche Vergangenheit, wenn Sie so wollen – denn das war ja immerhin ein Drittel der Bevölkerung – über Jahrzehnte hinweg fast komplett getilgt. Wir haben uns diesbezüglich mit der wunderbaren Bürgerinitiative "Antikomplex" zusammengetan, die aus einer Studenteninitiative erwachsen ist und längst schon ein etabliertes Element der tschechischen Gesellschaft ist. Mit denen zusammen haben wir zwei Bücher gemacht, auch deutsch-tschechisch, eines davon ist jetzt ins Tschechische übersetzt worden. Es trägt den Titel "Erinnerungskultur und Lebensläufe" und es geht darin genau um diese Brückenschläge. Denn die Tschechen wissen oft nicht, was mit "ihren" Deutschen passiert ist, nachdem sie über die Grenze abgeschoben worden waren. Und umgekehrt wissen Hiesige oft nicht, was mit den Landstrichen dann weiter passiert ist, aus denen die Vertriebenen gekommen sind. In einem zusammenwachsenden Europa diese Brückenschläge zu machen, fand ich unglaublich interessant, wichtig und auf den Punkt gebracht notwendig. Gerade mit diesen Museumskonzepten sind wir sehr gut vorangekommen. Eigentlich klingt das ja nach Musealisierung, aber in Wirklichkeit holt das natürlich die Frage, wie man mit all dem umgeht, unmittelbar an die Oberfläche. Appel: Wie gehen denn die Tschechen damit um? Krauss: Sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich auch … Appel: Bei uns ist das ja auch so. Krauss: Wir kennen das ja in unserem Europa leider sehr gut: Es gibt überall Hardliner und Falken, die nichts wissen wollen von all dem, die auch von einer Umwandlung der Beneš-Dekrete nichts wissen wollen, die sich trotz des zusammenwachsenden Europas mit dem Thema auf diese Art und Weise nicht auseinandersetzen wollen. Und es gibt natürlich auch die andere Seite. All diese Begriffe wie "rechts" und "links" sind ja inzwischen längst obsolet geworden, aber auf jeden Fall sind das Menschen, die z. B. versuchen, auch die Landschaft wieder zu entdecken. Das war ein wirklich verrückter Prozess. Wir haben z. B. auch junge Tschechen eingeladen, sich der Geschichte ihres Ortes, der inzwischen rein tschechisch ist, über Postkarten usw. wieder anzunähern. Diese jungen Leute haben wir auf dem Sudetendeutschen Tag zusammengebracht mit den Leuten, die aus diesem Ort stammen und die natürlich z. B. auch alte Fotos von diesem Ort besitzen. Die einen haben nicht Tschechisch, die anderen haben nicht Deutsch verstanden, aber sie haben Fotos ausgetauscht. Appel: Sie hatten sozusagen ein verbindendes Element. Sie haben soeben die Museumsarbeit schon angesprochen: An diesem Thema kann man erkennen, dass es da nicht nur um ein Stück Vergangenheit geht, sondern dass das alles ganz vital ist und mit dem Heute verbunden. Sie haben sich ja auch mit der sogenannten Erinnerungskultur befasst. München war ja über Jahre hinweg das Zentrum der NSDAP schlechthin: Bis Hitler Reichskanzler wurde und Berlin diese große Bedeutung im NS-Staat übernommen hat, war München die Wiege der NSDAP. Dennoch hatte München bis vor Kurzem keinen Erinnerungsort, kein Museum für diese Geschichte. Mir drängt sich da folgende Frage auf: Wenn wir vor allem auch im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus von Erinnerungskultur sprechen, was ist daran bitte Kultur? Geht es da nicht ausschließlich oder doch zumindest im Wesentlichen um Information, damit wir Bescheid wissen, was war? Krauss: Die Information ist immer der Anfang. Aber diese Information muss ja auch ankommen, muss emotional bei uns ankommen. Ich habe mich häufig bemüht, solche Dinge mittels einzelner Menschen zu erzählen, über Geschichten von einzelnen Menschen. Denn solche Geschichten können wir viel eher akzeptieren als irgendwelche rein dokumentarischen Wahrheiten – so wahr sie auch sind. Appel: Sie erzählen also ganz konkret die Geschichte einer einzelnen jüdischen Familie, die verfolgt und dann ermordet wurde, statt der blanken, reinen Zahlen und Daten. Krauss: Die Zahlen helfen uns nicht weiter. Ich denke, man muss dort ansetzen, wo man vielleicht auch die Geschichte der ganz normalen Mitläufer erzählt, die Geschichte der ganz normalen Begeisterten. Denn das sind die Geschichten, die wir eigentlich in unseren Familien haben. Keiner aus unseren Familien stand an der Rampe von Auschwitz, denn das ist ja eine so unvorstellbare Geschichte. Viele wehren sie auch genau aus diesem Grunde ab … Appel: Sie sagen: "Das gehört nicht zu mir." Krauss: Sie sagen: "Das gehört nicht zu mir! Das kann nicht sein, das ist einfach nicht möglich!" Das ist ein Abwehrreflex, der wohl einfach mit dem zusammenhängt, was für Menschen noch erträglich ist und was nicht. Dennoch, diese Information müssen wir natürlich immer wieder an die Menschen heranbringen. Wichtig ist aber auch, dass die Menschen sehen, wie im städtischen Alltag die ganz normale kleine Korruption passiert, wie der gebeugte Rücken zustande kommt, der eben nicht das gerade Rückgrat bedeutet, wie man sich in der NS-Zeit an einem Nachbarn bereichert hat, denn die Leute haben sich gesagt: "Der Nachbar ist doch weg. Wenn ich nicht sein Geschirr nehme, dann nimmt es ein anderer." Das sind all diese Geschichten, die auch mein Kollege Götz Aly in seinem großartigen Buch über die Profiteursgesellschaft dargestellt hat: Auch diese Geschichten will man ja nicht so richtig wissen. Denken Sie an diesen tollen Film von Verhoeven, der das ebenfalls dokumentiert hat. Da geht es um diese kleinen Dinge, die bis heute überall in den deutschen Haushalten stehen. Es geht mir also jeweils um die konkreten Geschichten. Nun zu Ihrer Frage nach der Erinnerungskultur. Die Geschichte ist ja eigentlich nie so richtig vergangen, sondern die Geschichte holt uns auf verschiedenen Wegen immer wieder ein – und sei es nur bei "Kunst & Krempel", um es mal auf eine gegenständliche Ebene zu reduzieren. Oder es gibt die Fotoalben, die etwas erzählen, weil anhand dieser Alben die Oma von ihren jüdischen Klassenkameradinnen erzählt, die irgendwann weg waren. Es gibt natürlich auch einige großartige Zeitzeugen und Zeitzeuginnen. Mein Mann und ich haben die Geschichte der Rosenfelds erforscht, also die Geschichte von Else Behrend-Rosenfeld, ihrem Mann Siegfried Rosenfeld und deren Kindern. Else Behrend-Rosenfeld saß in München in Berg am Laim im Deportationslager und war dort als Wirtschafsleiterin eingesetzt. Sie konnte danach im Untergrund überleben und schließlich noch 1944 in die Schweiz entkommen. Wir kennen auch ihre Tochter Hanna, die in England lebt und jetzt weit über 90 Jahre alt ist. Sie kann erzählen und sie erzählt auch: Sie hat als 16-Jährige die Pogromnacht in München erlebt. Sie berichtet ganz ohne Schnörkel, wie es ihr in ihrer Klasse gegangen ist: dass in Icking die anderen Kinder nach ihr und ihrem Bruder plötzlich mit Steinen geworfen haben. Wir haben in Icking ein Gespräch veranstaltet, zu dem Hannah auch eingeladen war. Mit anwesend war auch ein alter Klassenkamerad von ihr, der gesagt hat: "Ja, ich erinnere mich noch genau daran. Wir hatten dabei kein gutes Gefühl, aber wir haben das halt so wie alle gemacht." Plötzlich kommt da so eine Konfrontation mit den eigenen Schwächen heraus. Das hat ganz viel mit Kultur zu tun, mit der Kultur des Erinnerns, mit der Kultur des Wahrnehmens und des Akzeptierens im Bewusstsein, dass wir Menschen von heute aus der Vergangenheit lernen müssen, dass wir uns genau anschauen müssen, wie das möglich gewesen ist. Ich gehöre zu denen, die glauben, dass man aus der Geschichte lernen kann. Andere Kollegen beantworten das ja bekanntermaßen anders. Ich denke jedenfalls, dass man diese Brücken zum Heute sehr wohl schlagen kann, dass man fragen muss: Wie muss man heute damit umgehen, damit nicht wieder Ähnliches passiert? Appel: Was ist Ihr Angebot dabei? Wie soll man damit umgehen, gerade bei diesem Beispiel mit der jüdischen Familie, die Sie genannt haben? Krauss: Das, was die Helferkreise heute bei den Flüchtlingen machen, ist ja im Grunde genommen das: Man geht auf diejenigen zu, die zu uns kommen, die geflohen sind, die ausgegrenzt werden, die marginalisiert sind. Man geht auf sie zu, versucht Brücken zu bauen und ihnen zu helfen und ihnen sozusagen als Pate zur Verfügung zu stehen in einem für sie neuen Lebensabschnitt. Das ist im Grunde genommen das, was man aus solchen Dingen lernt. Appel: Damals gab es ja auch viele unbegleitete Kinder und Jugendliche, nämlich die jüdischen Kinder und Jugendlichen, die damals alleine in England angekommen sind. Krauss: Genau, das waren damals diese Kindertransporte. Zu diesen Kindertransporten gibt es ja auch ganz großartige Filmdokumentationen. In einem dieser Filme ist übrigens Ursula Rosenfeld, die Schwiegertochter von Else Rosenfeld, eine wesentliche Protagonistin, weil auch sie damals mit einem Kindertransport nach England gekommen ist. Damals durften 10000 jüdische Kinder aus dem Deutschen Reich nach England kommen, weil dort die jüdischen Gemeinden und auch die Quäker mit je 50 Pfund für diese Kinder gebürgt haben. Heute wären diese 50 Pfund ungefähr 1500 Euro – pro Kind! Sie haben dafür gebürgt, diese Kinder zu versorgen und sie unterzubringen. Das sind wirklich Dinge, die wir uns für heute zum Vorbild nehmen können, wenn wir auf Syrien schauen, wenn wir auf Konflikte in Afrika schauen. Appel: Und das ist ja auch schon ein Stück weit Wirklichkeit geworden, wie Sie gesagt haben. Das wäre sozusagen dieses praktische Lernen aus der Geschichte. Krauss: Ja, das ist praktisches Lernen aus der Geschichte. Ich bin der Meinung, hier kann man wirklich ansetzen. Appel: Wobei man freilich unterstellen darf, dass viele Helfer in diesen Helferkreisen diese ihre Arbeit nicht direkt aufgrund ihres historischen Wissens oder ihrer historischen Erfahrung machen, sondern einfach aus Herzensnotwendigkeit. Krauss: Das ist ja auch eine Kultur. Appel: Ja, selbstverständlich. Jetzt würde ich mich doch trauen, Sie, liebe Zuschauer, ein wenig weiterzuführen und einzulösen, was ich vorhin bereits versprochen habe. Kommen wir also zu Ihrem Themenschwerpunkt "Bayern und Preußen", Frau Krauss. Sie haben ja über die Strukturen der Verwaltung und der Regierungsarbeit in diesen beiden Ländern habilitiert. Mich interessiert das aus einem ganz bestimmten Grund ganz besonders. Bayern kennen wir nämlich recht gut, Bayern ist präsent, Preußen jedoch ist verschwunden. Dieses seltsame Verhältnis dieser beiden Länder, dieses meistens ungleiche Verhältnis, in dem sich die Bayern sozusagen immer untergebuttert gefühlt haben, ist nicht mehr existent, weil Preußen nicht mehr existiert. Ist das nicht auch für Sie als Historikerin, die Sie uns nun schon so weit durch die Geschichte geführt haben, eine ganz außergewöhnliche Situation, dass ein Land einfach vom Erdboden verschwindet? Krauss: Nun ja, in der Geschichte hat es das ja immer wieder mal gegeben. Wobei man aber sagen muss, dass dieses Preußen tatsächlich sehr dominant gewesen ist. Es war dann eine klare Entscheidung, zu sagen: Ohne die Auflösung Preußens kann man den deutschen Militarismus nicht zerschlagen! Appel: Preußen wurde ja auch benannt als "eine Armee, die sich einen Staat leistet". Krauss: Das ist sicherlich ein Punkt, über den man sich historisch streiten kann. Das lässt sich nicht so eindimensional betrachten, denn in Preußen war auch die Aufklärung zu Hause und das protestantische Pfarrhaus. Das heißt, es gab in Preußen eben nicht nur den Militarismus. Aber letztlich ist ja den Alliierten die Zerschlagung dieses deutschen Militarismus erfolgreich gelungen, d. h. so ganz verkehrt kann dieser Weg nicht gewesen sein. Ich habe ja die Zeit so um die Mitte des 19. Jahrhunderts untersucht, eine Scharnierzeit quasi: Da merkte man einfach, dass dieses Preußen wirtschaftlich und auch militärisch völlig anders aufgestellt war als Bayern. Die bayerischen Könige haben ihr Geld halt immer gerne in andere Sachen investiert als ins Militär – was ich übrigens sehr sympathisch finde. Sie haben nicht die Armee zu ihrem Spielzeug gemacht, sondern haben gebaut. Appel: War das wirklich so? Ist das tatsächlich mehr als nur ein Klischee? Krauss: Ja, das stimmte schon. Das preußische Militär war seit Friedrich dem Großen einfach eine wirkliche Größe, die nach den Napoleonischen Kriegen dann auch wieder aufgebaut worden ist, nachdem die Niederlagen gegen Napoleon das preußische Selbstbewusstsein natürlich enorm hatten einbrechen lassen. Es kam dann zur Einführung der Wehrpflicht usw. und zur Ausbildung dieses preußischen Militärgeistes, mit dem man dann wieder große Schlachten siegreich geschlagen hat. Wenn man sich diese Zeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts näher anschaut, also diese Zeit der Konfrontation mit Frankreich, die der Reichsgründung 1871 vorausgegangen ist, stellt man fest, dass Preußen in dieser Zeit unglaublich stark aufgerüstet hat. Preußen hat die Hälfte des kompletten Staatshaushaltes für das Militär ausgegeben. Das muss man sich heute mal vorstellen! Alle Rechte, die sich das Parlament im Laufe der Zeit erkämpft hatte, hat Bismarck einfach weggewischt, um die Parlamentarier, die dagegen waren, mundtot zu machen und um diese Aufrüstung derart vorantreiben zu können. Diese Aufrüstung hat ja auch zu den Erfolgen im Deutschen Krieg geführt, also im Krieg zwischen Preußen und dem Deutschen Bund unter der Führung Österreichs, in dem Bayern ja bei dieser berühmten Niederlage von 1866 bekanntermaßen auf der österreichischen Seite gestanden hatte. Und dann gab es eben auch den Sieg Preußens im preußisch-französischen Krieg, der zur Reichsgründung geführt hat, zur preußisch-deutschen Reichsgründung. Die Debatten, die zwischen 1866 und 1870/71 stattgefunden haben, deuten überhaupt nicht darauf hin, dass das eine Reichsgründungsphase nach preußischem Motto war. Denn da gab es viele Modelle, die wir heute föderalistisch nennen würden, viele Debattenteilnehmer, die gesagt haben, dass man den Einzelstaaten viel mehr Macht und Rechte geben müsse. In Richtung auf eine Reichsgründung nach preußischem Muster wurde da überhaupt nicht diskutiert. Zur Reichsgründung hat dann nämlich nur das preußische Heer geführt, diese preußische Militärmacht, die dann immer stärker alles andere in ihren Sog genommen hat. Appel: Das preußische Militär hat sich die Politik sozusagen untertan gemacht. Heute ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz fast schon das letzte Überbleibsel Preußens. Diese Stiftung repräsentiert eben die andere Facette Preußens, den Kulturstaat Preußen. Krauss: Wir haben jetzt über das Militär in Preußen gesprochen. Wenn man von der Kultur in Preußen in der damaligen Zeit spricht, dann fallen einem natürlich vor allem diese großartigen Bauwerke ein. Auch die Aufklärung an sich fand in Preußen eine Heimat: Das protestantische Pfarrhaus ist dafür sozusagen immer das passende Symbol. Aufgrund dieser preußischen Dominanz über viele Jahre hinweg ist natürlich auch die Rolle des Südens unterschätzt worden. Damit meine ich aber nicht nur Bayern, sondern all das, was im Rheinbund zusammengeschlossen war und was vom Code civil, also vom französischen Recht, das Napoleon eingeführt hatte, beeinflusst war. Die linksrheinische Pfalz hatte den Code civil ja bis zum Schluss. Das war schon auch ein Einfluss, der noch einmal eine ganz andere Liberalität ermöglicht hat. Das Verrückte ist ja, dass man immer sagt, Montgelas habe Bayern zu einem zentralistischen Gebilde gemacht. Wenn man sich aber diese Zeit nach Montgelas anschaut – ich habe vor allem die Zeit zwischen 1848 und der Reichsgründung 1871 in den Blick genommen –, stellt man fest, dass in Preußen viel stärker durchregiert worden ist. Wenn ein Regierungspräsident in Mittelfranken nach München geschrieben hat: "Bei uns wird diese Sache aber so und so gesehen und so und so interpretiert", dann hieß es von München aus immer: "Gut, du bist vor Ort, also entscheide du." Wenn dasselbe zur selben Zeit ein preußischer Oberpräsident im Rheinland nach Berlin geschrieben hat, dann stellt man fest, dass da in Berlin ganz anders gedacht und gehandelt wurde als in München: An den Rändern eines solchen Aktenstücks kann man nämlich sehr gut all die roten Striche und Fragezeichen sehen, die davon zeugen, dass diese Art von Selbständigkeit nicht gewünscht war. Ich denke daher, dass dieser bayerische Zentralismus eigentlich eine Mär ist. Und wir sehen ja auch, wie bis heute in Bayern die Regionen in der Regierungsverantwortung überall mit einbezogen werden: Das zeugt davon, wie stark der regionale Aspekt in Bayern ist. Das war in Preußen jedoch keineswegs der Fall: Dort wurde sehr viel deutlicher durchregiert. Und man hatte in Preußen natürlich sehr viel mehr wirtschaftliche und militärische Macht. Die Bayern haben ja nicht selbstlos auf die Durchsetzung eines starken Zentralismus' verzichtet: Sie hätten gar nicht genügend Militär aufstellen können, um eine unbotmäßige Provinz in die Schranken zu weisen, sie gefügig zu machen. Appel: Ich muss sagen, es macht richtig Spaß, mit Ihnen sozusagen eine Deutschlandreise zu machen und von Region zu Region zu ziehen. Lassen Sie uns daher auf der Landkarte noch ein Stück weiter nach Norden gehen und in das von Ihnen bereits erwähnte Hamburg und Bremen schauen. Dort gibt es ja diesen großen Begriff des "ehrbaren Kaufmanns", der, glaube ich, in Hamburg mitgeboren wurde und dort auch schon in Vereinsform niedergelegt war. Dieser ehrbare Kaufmann – wir sprechen hier in der Tat so gut wie ausschließlich von Männern – ist ja sozusagen Kult gewesen: Das gehörte zum Selbstbewusstsein und zum Regionalbewusstsein der Menschen dort. Sie, Frau Krauss, hat besonders interessiert, wie es diesbezüglich in Bayern ausgesehen hat. Dazu muss ich jetzt mal diesen sehr schweren Band von Ihnen zur Hand nehmen, denn Sie haben in diesem Buch die bayerischen Kommerzienräte untersucht, also Figuren einer Wirtschaftselite: "Die bayerischen Kommerzienräte. Eine deutsche Wirtschaftselite von 1880 bis 1928." Diese Figuren gab es natürlich nicht nur in Bayern, sondern eben auch und vor allem im hanseatischen Bereich, wo sie überhaupt zum ersten Mal wahrnehmbar waren. Was hat Sie an diesen Kommerzienräten interessiert? Krauss: Um mal beim ehrbaren Kaufmann anzufangen. Man muss sich vorstellen, dass beim Handel mit Hilfe von Schiffen immer ein großes Maß von gegenseitigem Vertrauen vorhanden sein musste. Wenn man eine Ware mit dem Schiff losschickt, dann muss man darauf vertrauen können, dass diese Ware auch bezahlt wird, wenn sie beim Empfänger in einem anderen Hafen ankommt. Diese Grundlagen – die übrigens ja auch heute immer stärker in Leitlinien z. B. von Industrie- und Handelskammern ihren Niederschlag finden und auch in noch größere Kontexte integriert werden – hängen natürlich intensiv zusammen, da das einfach die Voraussetzungen kaufmännischen Tuns ist und war. In den Hansestädten hatte das eben eine längere Tradition als z. B. in Bayern. München war ja vor allem eine Residenzstadt und Bayern hatte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt doch sehr stark in der Landwirtschaft. Deswegen haben sich in Bayern diese kodifizierten Grundlagen kaufmännischen Handelns erst so nach und nach herausgebildet. Der richtige, echte, endgültige wirtschaftliche und industrielle Takeoff in Bayern beginnt erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Erst so ab 1880 fängt die Hochindustrialisierung in Bayern an und das ist auch diese Zeit, die ich in diesem Buch vor allem untersucht habe. Mir ist in der bayerischen Geschichte immer wieder aufgefallen, dass es zwar jede Menge Zahlen gibt – wie viele Maschinen laufen, wie viele Spindeln irgendwo im Einsatz sind, wie hoch die wirtschaftlichen Erträge sind –, dass aber die Menschen, damit sind wir wieder bei den Menschen, über die wir ja schon gesprochen haben … Appel: Ja, genau, bei den Geschichten. Krauss: … dass also die Menschen dahinter und deren Geschichte, dass die Menschen, die das teilweise mit hohem persönlichen Risiko verantwortet und in Gang gesetzt haben, eigentlich vollkommen verschwinden hinter diesen reinen Fakten und Daten. Meine Idee war, eine bestimmte Gruppe von Männern in den Blick zu nehmen, eine Gruppe, die sich auch fassen lässt, nämlich diese bayerischen Kommerzienräte. Dieser Titel wurde seit 1880 verliehen und bekommen haben diesen Titel die großen Wirtschaftsbürger, also Industrielle, Großhändler, Großkaufleute usw. Denn diese Kommerzienräte kann man nämlich auch sehr gut in den staatlichen Akten greifen: Viele große Unternehmen, die wir heute noch kennen, sind ja irgendwann von anderen Besitzern oder Aktionären übernommen und dann erneut verkauft worden usw. Diesen Familienunternehmer aber, der das mal gegründet hat, hat man dadurch natürlich nicht mehr im Blick, der verschwindet – insofern er nicht im Namen des Unternehmens irgendwie weiterlebt. Solche großen Industriemagnaten wie Krupp in Essen sind natürlich in aller Munde, aber es gab in Schweinfurt z. B. die großen Kugellagerhersteller, die natürlich auch alle den Titel "Kommerzienrat" verliehen bekommen haben: Das waren Leute wie Schäfer usw., die von der wirtschaftlichen Bedeutung her in Schweinfurt fast mit Krupp gleichgezogen haben. Ich habe mir also gedacht, diese Gruppe könnte man doch mal sichtbar machen: in ihrem Lebensstil, in ihrer Art zu handeln. Ich wollte aber auch ihre ihnen immer sehr wichtige Art der Philanthropie aufzeigen. Denn das ist ja etwas, was heute sehr aus dem Blick gekommen ist. Wenn die Menschen heute das Wort "Unternehmer" hören, dann denken viele sofort an "Heuschrecken": Das sind die Bösen, die irgendwelche Firmen übernehmen … Appel: … die keine Steuern zahlen wollen usw. Krauss: Das ist ja auch bei vielen dieser multinationalen Konzerne fraglos der Fall. Aber wir haben, wie ich gerade von Schwaben her sagen kann, denn das ist der Einzugsbereich, in dem ich mich besonders intensiv bewege, ganz viele mittelständische Unternehmer, die ihre Firmen immer weiterentwickelt haben und heute teilweise weltweit exportieren. Ein wunderbares Beispiel dafür ist Pfeiffer in Memmingen: Dieses Unternehmen entstammt einer Seilerei aus dem 16. Jahrhundert, hat aber z. B. die berühmten Drahtseile des Olympiastadions in München hergestellt. Solche Seile verkauft dieses Unternehmen heute weltweit: Das sind heute natürlich keine Hanfseile mehr wie im 16. Jahrhundert, sondern Seile aus Stahl, aus modernen Materialien. Mit einer sehr diversifizierten Produktpalette hat dieses Unternehmen heute auf dem Weltmarkt eine sehr große Präsenz. Dennoch ist das nach wie vor ein mittelständisches Unternehmen. Ich habe festgestellt, dass dort bis heute ein sehr großes Ethos des ehrbaren Kaufmanns, des ehrbaren Unternehmers gültig ist, d. h. diese Unternehmer fallen eben nicht unter diese klischeehaften Kategorien. Appel: Sie sind als Mäzene vor Ort tätig, sie … Krauss: Sie versorgen ihre Arbeiter und sind natürlich fast schon ein bisschen paternalistisch oder patriarchalisch für ihre Leute da und sehen genau darin auch ihr Erfolgsrezept. Kommerzienräte gab es natürlich auch in Preußen, in Thüringen und in Sachsen, aber am Beispiel der Kommerzienräte im damaligen Bayern hat mich eben doch etwas Bestimmtes interessiert. Insgesamt haben damals in diesen 50 Jahren 1850 Unternehmer diesen Titel verliehen bekommen: Ich habe sie jeweils mit einer Kurzbiografie gewürdigt und dann vor allem gezeigt, was sie für die Landeserschließung getan haben. Ein Unternehmer wie Michael Poschinger von Frauenau hat damals z. B. mitten im Bayerischen Wald eine Glashütte eröffnet, hat dorthin eine Eisenbahn gebaut, ein E-Werk gebaut und diesen ganzen Landesteil überhaupt erst erschlossen. Das waren Unternehmer, die das alles natürlich auf eigenes Risiko gemacht haben, also nicht mit staatlicher Förderung oder staatlicher Absicherung. Mir war es ein großes Anliegen, diese besondere Wirtschaftselite und deren Werte und Stiftungen usw. sichtbar zu machen. Ich wollte sie aus der Anonymität der Unternehmer herausholen, in die sie oft geraten sind. Appel: Sie sahen in dieser Gruppe von Männern also Werte wie "der gute Hausvater" und sprachen ja selbst schon davon, dass das Verhalten dieser Männer teilweise paternalistisch gewesen ist, d. h. so jemand war halt der Chef vor Ort und weniger der Ausbeuter. Krauss: Dieser Titel "Kommerzienrat" wurde ja vom Staat verliehen, und bis es so weit war, durchlief ein Kandidat viele, viele Prüfverfahren. Das heißt, diejenigen, die diesen Titel bekommen haben, hatten damit ein staatliches Gütesiegel: Sie mussten gute Steuerzahler sein, sie mussten sich mit den Behörden gut verstehen. Und es wurde auch immer verlangt, dass so jemand eine Stiftung oder Ähnliches gegründet hat. Sie mussten z. B. Arbeiterwohnungen gebaut haben oder massiv für die Kunst gespendet haben … Appel: Sie mussten z. B. eine Bibliothek gegründet haben. Krauss: Sie mussten also unter Beweis gestellt haben, dass sie auch für das Gemeinwohl arbeiten. Max Schmederer z. B. hat alle seine Krippen dem Nationalmuseum gestiftet: Das ist eine europaweit wirklich einmalige Krippensammlung gewesen. Das heißt, da ging es nicht nur um den wirtschaftlichen Erfolg und um das soziale Engagement, sondern schon auch um die Kultur. Aber gerade diese Sache mit den Arbeiterwohnungen war wichtig. In diesen Orten waren diese Unternehmer oftmals kleine lokale Könige: Jeder hat bei Ihnen gearbeitet, sie haben die Schule gestiftet, sie haben das Waisenhaus gestiftet und saßen im Gemeinderat usw. Das heißt, an diesen Männern kam man nicht vorbei. Oft haben sie aber auch wirklich die Entwicklung dieses Ortes vorangetrieben. Appel: Ich muss Ihnen gestehen, dass mich der Umfang dieses Buchs nicht abgeschreckt hat, auch wirklich interessiert darin zu lesen. Krauss: Das freut mich. Appel: Eine wunderbare Geschichte darin ist z. B., dass das bayerische Königshaus zu einer Brauerdynastie zum Kegeln ging. Krauss: Das ist natürlich eine Besonderheit. Ich habe mir diesen Artikel über München noch einmal genauer angeschaut vor der Sendung. Da geht es u. a. um diese Großfamilie Sedlmayr von der Brauerei Spaten: Das war eine weit ausgreifende Familie, zu der die Lederhandschuhfabrik Roeckl gehörte, aber auch die Firma Haindl-Papier oder Holzhey-Textilien in Schwabmünchen. Diese Familie war wirklich so eine Art oberbayerischschwäbisches Gesamtunternehmen. Vom Finanzvolumen her hat diese Familie wohl ungefähr ein Siebtel aller Kommerzienratsvermögen auf die Waage gebracht. Das war also eine wirklich reiche und einflussreiche Familie. Mit zu dieser Familie gehörten aber auch die Seidls: Die Bäckerei Seidl gibt es ja heute noch und diese Familie Seidl hat auch die großen Architekten Gabriel und Emanuel von Seidl hervorgebracht. Deren Bruder Anton war Bäcker in der Tradition des Vaters und hat diese Kegelbahn weiter betrieben. Auf dieser Kegelbahn kegelte am Mittwoch die "Allotria", das waren die Lenbachs, die Kaulbachs usw., also die Künstler von München, am Samstag kegelte die Verwandtschaft und Bekanntschaft, das waren die Kommerzienräte und diejenigen, die das noch werden sollten und wollten. Und am Montag kegelten die Wittelsbacher Prinzen, darunter auch der spätere Prinzregent Luitpold, der spätere Ludwig III., Kronprinz Rupprecht usw. Appel: Eine köstliche Geschichte, die auch zeigt, dass Geschichte keine Sache von Daten und von Aktenstücken alleine, sondern immer und überall lebendig ist. Leider ist die Lebendigkeit unseres Gesprächs doch so groß gewesen, dass wir nicht alle Themen berühren konnten, die Sie in Ihrer Historikerkarriere mit großem Interesse verfolgt haben. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Professor Krauss, für diesen wunderbaren Spaziergang durch die deutsche Geschichte und die deutschen Regionen. Ich danke Ihnen, verehrte Zuschauer, für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen. © Bayerischer Rundfunk