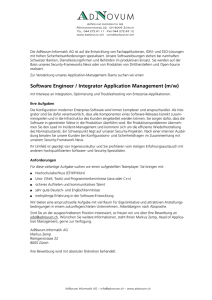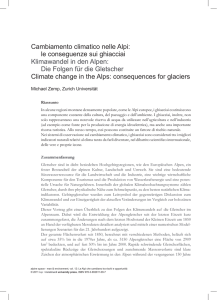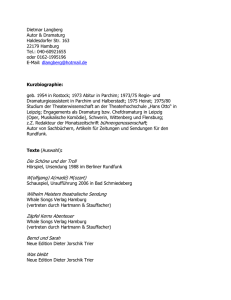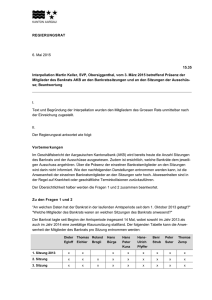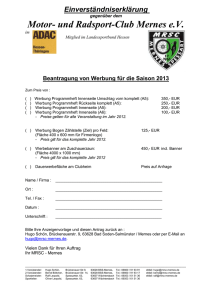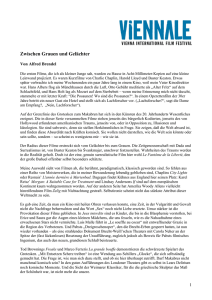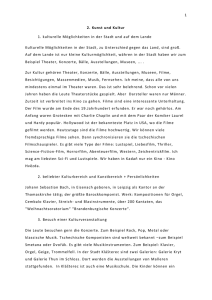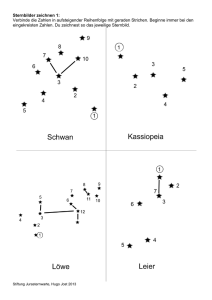Die Erforschung des Ächten : Besuch bei Hugo Zemp - E
Werbung

Die Erforschung des Ächten : Besuch bei Hugo Zemp und Sylvie Bolle-Zemp Autor(en): Schaub, Martin Objekttyp: Article Zeitschrift: Du : die Zeitschrift der Kultur Band (Jahr): 53 (1993) Heft 7: Der Sound des Alpenraums : die neue Volksmusik PDF erstellt am: 19.08.2017 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-306278 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Die Erforschung des Ächten Besuch bei Hugo Zemp und Sylvie Bolle-Zemp. Martin Schaub Von Zufall hat ein Ahnenritual ist, eine Ehrerbietung an die Herkunft. Obwohl einige Ausstellungsräume ziemlich verstaubt sind, sagen alle Gegenstände: Alles ist Gegenwart, vor allem die Vergangen¬ und das selber Zemp zum Musikethnologen gemacht, EinZufälle, die inHugo seinem schwer finanzierbaren Forschungsgebiet herrschen, haben den in Basel geborenen Zemp, der die französische Staatsbürgerschaft angenommen hat, zu den drei «Feldern» seiner Tätigkeit geleitet: an die Elfenbeinküste, auf die Salomon-Inseln sowie in die Schweiz und nach Georgien - Afrika, Ozeanien, Europa, ein gewaltiges Dreieck. Fünf Jahre insgesamt hat Hugo Zemp in den drei «Feldern» verbracht, der Rest, rund 25 Jahre, war Auswertung und Publikation - Aufsätze, Bücher, Filme, Schall¬ platten. Seit 1966 arbeitet Hugo Zemp am Centre National de Recherches Scientifiques (CNRS), wo er alle möglichen Vertrags¬ stufen durchlaufen hat, Auftrag, Forschungsstagiaire, Forschungs¬ assistent, beauftragter Forscher, Forschungsdirektor schliesslich. Er ist zuständig für die Plattenpublikationen des Instituts. Das CNRS ist ein staatlicher Betrieb, eine Errungenschaft des kurzen Volks¬ frontregimes in Frankreich, welche die späteren Regierungen nicht kassiert, sondern ausgebaut haben. Zur Zeit arbeiten 27000 Wissen¬ schaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen, Techniker und Verwalter für den grossen und unübersichtlichen staatlichen Forschungsapparat. Neidisches Staunen ist begründet, besonders aus der Perspektive der Nachbarländer und der Vereinigten Staaten von Amerika, welche die Forschung der ihren Konjunkturschwan¬ kungen unterworfenen Wirtschaft und den (von der Wirtschaft gesponserten) Universitäten überlassen und freie Forschungsaufga¬ ben immer nur punktuell fördern. In der Schweiz gibt es, obwohl sich das Land seiner eigenen vielfältigen musikalischen Tradition rühmt, keine einzige volle Stelle für Musikethnologie. Dabei ist Musikethnologie, wenn sie sich mit traditioneller Musik befasst, eine dringliche Forschung geworden. Alles verschwindet, man musste sich beeilen. Alle wissen es, und niemand tut etwas. Der Musikethnologe, der sich bis jetzt am intensivsten mit schweizerischer Volksmusik auseinandergesetzt heit. In der musikethnologischen Sammlung des Musée de l'Homme sind neben Instrumenten aus aller Welt und aus allen Zeiten Tausende von Tonaufnahmen aufbewahrt und katalogisiert, seit der Wachswalzenzeit. Die Tonlabors sind auf dem letzten Stand der Technologie; jeder menschenmögliche Ton kann analysiert werden. * Für den Musikethnologen gilt viel mehr als für die Generalisten unter den Völkerkundlern, dass ihre praktische Arbeit ein Nehmen und Geben sein muss. Was Hugo Zemp in den siebziger Jahren bei den Antipoden auf den Salomon-Inseln aufgenommen hat, ist auch daselbst deponiert. In diesem Punkt nimmt er es, auch was seine Filmarbeit angeht, vielleicht noch genauer als andere Kollegen. Ge¬ wisse Äusserungen und Aufsätze scheinen geradezu für das Unheil einer kolonialistischen und zuweilen rassistischen «Völkerkunde» späte Abbitte leisten zu wollen. Der Töne- und Bildernehmer Hugo Zemp ist ein äusserst skrupulöser Mensch. Diesen Skrupeln opfert er auch Eleganz und Glanz. In dem 1990 publizierten Aufsatz «Ethi¬ sche Probleme des ethnomusikalischen Filmens» versucht er den Kopf aus jeder Schlinge zu ziehen, welche das kaufkraftmässige und technologische Gefälle zwischen Filmendem und Gefilmten auslegt. Die grundlegende Bedenklichkeit der Film- und Tonauf¬ nahme - die Bedenklichkeit des Nehmens eben - vermag er nicht auszuräumen, aber er versucht es wenigstens. Wie kommt jemand dazu, sein Leben der Erforschung traditioneller Musik zu verschreiben? Ist es eine romantische Regung? Oder ein sozusagen anarchischer Schub, Auflehnung gegen die extreme Re¬ duktion und Systematisierung der europäischen Musik? «Es war ein Zusammentreffen verschiedener Umstände», sagt Hugo Zemp. Der junge Jazzdrummer der fünfziger Jahre studiert am Konserva¬ torium Basel und wird Orchestermusiker. Sein Studium verdient er als Schlagzeuger eines Tanzorchesters. Der Jazzdrummer hört eine vom Musée de l'Homme herausgegebene Platte, «Batteries afri¬ caines», kauft sie und will seine beiden Kollegen auf eine Tournee in den (damals belgischen) Kongo begleiten, landet schliesslich allein an der Elfenbeinküste. Mit der Hilfe des Schweizer Konsuls, der ein Transportunternehmen betreibt, gelangt er endlich in die Kleinstadt, wo der französische Musikethnologe André Schaeffner und die Ethnologin Denise Paulme arbeiten. Auf eigene Faust geht er fasziniert zu den Dan, zu den Senufo. Und auf der zwölftägigen Rückreise, bei der er zufällig wieder auf die beiden Musikethno¬ logen trifft, fällt der Berufsentscheid: Abschluss des Konsi, Ethno¬ logiestudium in Basel bei dem charismatischen Professor Alfred Bühler, Fortsetzung in Paris, insgesamt zwei Jahre Feldforschung an der Elfenbeinküste. 1964 die erste Publikation, 1965 die erste von fünf Schallplatten und 1971 die Dissertation «Musik der Dan. Die Musik im Denken und im sozialen Leben einer afrikanischen Ge¬ sellschaft»; sie ist ein Standardwerk der Musikethnologie gewor¬ den, weil Zemp anthropologische und soziale Perspektive kombi¬ niert. hat, Max Peter Baumann, wirkt in Berlin. Es verhält sich ähnlich wie bei der Volkskunde. Gäbe es in der Schweiz beispielsweise einen Paul Hugger und die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde nicht, existierte wohl keiner der zahl¬ reichen Filme über aussterbende Berufe. Paul Hugger hat das Geld für seine wissenschaftlichen Filme regelrecht zusammenbetteln müssen. Das Wort «Notfilmungen» stammt von ihm; zum Teil haben Huggers fast ehrenamtliche Filmer (alle mit klingenden Namen übrigens: Yves Yersin, Renato Berta, Hans Ulrich Schlumpf, Claude Champion, Jacqueline Veuve, Friedrich Kappeier usw.) gewisse Techniken und Vorgänge bereits rekonstruieren müssen. Der Film über den Geschirrflicker («Beckibüetzer») im Entlebuch wurde mit dem letzten Berufsmann gedreht. Auch Hugo Zemp hat rekonstruiert, zusammen mit melanesischen Musikern, deren Erinnerung er hat auf die Sprünge helfen müssen. Vielleicht war es der letzte Moment, dem Gedächtnis der Menschheit die polytheistische Ahnenmusik eines verlorenen Atolls an der Peripherie Polynesiens zu retten. Die musikethnologische Gruppe des CNRS ist ins Programm des «Musée de l'Homme» eingebunden. «Museum des Menschen»: ein von französischem Rationalismus geprägter stolzer Name. In Frankreich haben die Menschen, ihre Zivilisationen, ihre Lebens¬ stile und ihre Ahnen- und Todesrituale ein nationales Museum, 32 Der Häuserbau, die gesellschaftliche Organisation der Völker, ihre Nahrungsbeschaffüng und -Zubereitung, ihr Kunsthandwerk, ihre Kunst, ihre Sprache und ihre Musik gehören zum Erbe der Menschheit. Hugo Zemp brauchte keine andere Motivation für seine Arbeit des Sammeins und des Bearbeitens, und doch geht seine Tätigkeit über das rein Wissenschaftliche oder Museologische hin¬ aus. Er sei kein Missionar der Tradition, sagt er, aber er tut zum Beispiel alles, um das Ansehen traditioneller Musik im eigenen Land zu heben. Seine Tonaufnahmen von den Salomon-Inseln hat er den Radiostationen der Insel zur Verfügung gestellt, die ihr Publikum ebenso wie auf der ganzen Welt mit «internationaler Variété-Musik» - und das heisst hawaiischer und amerikanischer - überschwem¬ men; die Schulen haben Musikaufnahmen bekommen, und mit den Einkünften der 15 Platten und Reeditionen hat er Batterieton¬ anlagen gekauft, damit sich die Urheber selber hören können. Die belächelten Musiker sind im eigenen Land nicht gerade Stars gewor¬ den - es war noch nicht die Zeit der «World Music», doch ausgelacht wurden sie und ihre Bambusinstrumente nicht mehr. Zemp hat freilich nicht verhindern können, dass auf den Salomon-Inseln Generatoren gekauft wurden, die nicht Licht in die Hütten brach¬ ten, sondern elektrische Gitarren, Verstärker und Lautsprecher betrieben und die oft sehr zarten und verletzlichen Bambusflötenund Trompetentöne wegfegten. Wichtig, ja zentral ist ihm die Visualisierung der Musik gewor¬ den. Seinen ersten eigenen Film hat Zemp 1973 gedreht; gegen¬ wärtig stellt er zwei Filme über georgische Musik fertig. Die Filme sind zuerst einmal wertungslose Dokumente, doch in der Nach¬ bearbeitung verfolgt der Musikethnologe zwei Linien: einerseits visualisiert er mit ausgeklügelten Techniken die Töne (ein quasi synästhetisches Projekt), andererseits erhellt er mittels Montage und kommentierenden Titeln ihren sozialen Kontext. Ein solches Projekt hat ihn 1983/84 ins schweizerische Muotatal geführt. Schon vorher hatte Zemp einmal in der Schweiz gearbeitet. Die Darstellung des appenzellischen Naturjodeis, «Zäuerli, Yodel d'Appenzell», halte ich nicht für besonders grundlegend, sie scheint mir eine, zwar verdienstvolle, Gelegenheitsarbeit zu sein. Von ganz anderem Kaliber sind die Publikationen - Artikel, Filme und Platte über die Musik des Muotatals. Hugo Zemp greift mit wissenschaftlicher Kühle in ein Wespen¬ nest, er macht die Spannungen zwischen «Naturjodel» und «Jodel¬ kultur» zum Thema. Der erste und der letzte der insgesamt etwas über zwei Stunden dauernden vier Filme stellen die musikalische Landschaft in relativer Komplexität dar. In seiner Bestandesauf¬ nahme geht es um den traditionellen «Juuz» und um seine vom re¬ gionalen Mitgliedverein des Eidgenössischen Verbands kultivierte Form, den «Jodel». Man solle doch beide gelten lassen, sagen Zemp und sein Mitarbeiter, der Lehrer im Tal, Peter Betschard. Doch inter¬ essanter für sie, fremdartiger, «archaischer» ist selbstverständlich der Juuz, ist sein Umgang mit dem tonalen Tonsystem, mit der 4. Stufe (der Tonleiter) und vor allem die neutrale dritte und siebente Stufe, die in den Ohren von geschulten Vereinsjodlern falsch klingen. Wie in den Appenzeller «Zäuerli» und «Ruggusserli» gehört das «Alphorn-fa» zum Formeninventar, kein f, kein fis, sondern «etwas da¬ zwischen», etwa eine Viertelnote höher als die perfekte Quarte. Dar¬ über hinaus werden wie in gewissen zentralafrikanischen Gesängen die Schlusstöne nicht gehalten oder messerscharf abgebrochen, sondern fallen gelassen, sie schleifen hinunter zum tiefsten Ton des Registers der Sängerin oder des Sängers (Bruststimme). Das dauernde Kippen von Bruststimme in die Kopfstimme (Falsett), dieses vitale Hin und Her von «O» und «U» findet auch im Jodel statt, in den interessantesten Partien, den Refrains von doch mei¬ stens fast unerträglich heimattrunkenen Jodelliedern, doch da tönt alles «richtig», wie wenn jemand alle Sängerinnen und Sänger mit der Stimmgabel temperiert hätte. Hugo Zemp lässt Bauern, Hirten, Holzarbeiter, einen Camion¬ neur, einen Schreiner und Cafetier, eine Bäuerin und ihre Kinder juuzen. Von weit her scheinen ihre Töne zu kommen, «schön» LÖFFEL Unter die dorlichen instru¬ menta zählt Sebastian Virdung in seiner 1511 in Basel erschienenen Musica gelutscht auch das BritschenAuffdem h afin, ein Haushaltsinstrument. diesen Kombinations¬ Zu auf. 1975 fielen erstmals junge Städterinnen auf, die ihre eigenen Löffel an ein Ländlerfest mitbrach¬ Der Aufschwung des Löffelspiels in letzter Zeit ten. mentare Schlagzeuge wie in Zeitungs¬ berichten über den Löffe¬ Kochtöpfe, Ffannendeckel, das Waschbrett, Koch- ler-Wettstreit, tier seit 1977 jeden Herbst in instrumenten zählen ele¬ lässt sich und Esslöffel. Giswil (Obwalden) durch¬ Johann Gottfried Ebel beschreibt das Löffelspiel 1798 in «Schilderung der geführt wird, beobachten. Klapperten die Kandi¬ Gebirgsvölker der Schweiz»: «Auch hörte ich von zwei Knaben Lieder singen, die ihren Gesang mit dem Geklapper von zwei hölzernen Löffeln begleiteten, welche sie daten in den siebziger Jah¬ ren noch häufig mit metal¬ lenen Suppenlöffeln oder Salatbestecken und nur vereinzelt mit eigens zum Löffelspiel geschnitzten Holzlöffeln, trat 1986 kein einziger Löffler mehr Aus zwischen den Fingern fast ebenso hielten und beweg¬ mit ten wie die Spanier ihre haltsinstrument ist in der bekannten Kastagnetten, Schweiz ein Modeschlag¬ zeug geworden, das alle grösseren Musikhäuser an wenn sie den Fandango tanzen.» Bis in die Mitte der siebziger Jahre unseres Jahrhunderts wurden für dieses traditionelle Löffel¬ ausnahmslos me¬ Tischbesteck auf. dem bescheidenen Haus¬ Lager führen. Löffelspieler, die auf sich halten, bestel¬ len ihr Instrument aber bei eigens spezialisierten spielfast tallene Suppenlöffel ver¬ wendet, die sich Männer Löffelschnitzern. Beat Kollegger, Musi¬ ker und Instrumenten¬ in Gaststätten vom macher in Alvaneu, bei¬ spielsweise, versieht seine Ser¬ vierpersonal erbaten, wenn es galt, einen Schwyzermit Löffelrhythmen örgeler zu begleiten. Zum Spiel wird das Löffelpaar ober- und un¬ terhalb des Zeigefingers an den Griffen gehalten und auf Unterarm, Oberschen¬ kel, an die freie Hand, seltener auf Unterschenkel, Brust und Kopfgeschla¬ gen. Neben dem traditio¬ nellen Spiel mit Suppen¬ oder - seltener - Kaffee¬ löffeln kam in den siebzi¬ 33 ger Jahren das Löffeln mit hölzernen Salatbestecken Löffel mit Abziehbildern und kann die enorme Nachfrage nur noch unter Mitarbeit einer Behindertenwerkstätte befriedigen. B.B.-G. klingen diese Tonfolgen in den Ohren jener, die mit Dirigent und Stimmtraining im Jodelchor musizieren, nicht. Eine richtige querelle des anciens et des modernes ist im Gange: Anton Bühler erzählt, dass ihn die Preisrichter der Jodlerfeste schlecht benoteten, solange er so juuzte, wie es im Tal hinten schon immer üblich gewesen war, und dass er gleich in die erste Kategorie promoviert wurde, als er den letzten Ton nicht mehr fallen liess und die klassischen Harmonien rein intonierte. «Der kann's ja», werden sich die hohen Preisrichter gesagt haben. Und nun, nach dem Beweis, darf Anton Bühler sogar bei feierlichen Gesangswettbewerben ab und zu die wilden Töne einfliessen lassen. Selbstverständlich wird die Harmonisierung des Urchigen als Fortschritt betrachtet; die Verluste nimmt - ausser dem Musikethnologen und den immer weniger werdenden Juuzerinnen und Juuzern - niemand wahr. «Mir händ üsi Art, diä andere händ iri Art, und so wird's eifach bliibe», sagt einer. Aber so, wie er im letzten Satz eine Futurumform braucht, die seine Mundart nicht vorsieht, so etwa wird der tempe¬ rierte Jodel den Juuz noch ganz verdrängen. Dass man die Juuzer jetzt schon auslacht, ist ein sicheres Zeichen. Auch das dokumentieren Zemps Filme, vor allem der Teil «Glattalp»: Der Filmer konnte nicht einfach einem Alpaufzug fol¬ gen und die «Chuereiheli» (Kuhreihen) aufnehmen, in der Hütte wurde am Abend der Filmaufnahmen nicht gejuuzt, und beim Mel¬ ken schon gar nicht, da hält einen die Melkmaschine in Trab. «Glatt¬ alp» ist eine idealisierende, fiktive Rekonstruktion, was Zemp mit einem riesigen Zwischentitel - «avertissement» - offenlegt. Die gesamte musikalische Landschaft dokumentiert der Teil «Die Hochzeit von Susanna und Josef», ein einziges Glissando von «Ur» zu «U», von Juuz (und Geisslä-Chlepfä) zu Jodel und Ländler, wie man sie auch in den Fernsehsendungen von Wisel Gyr hätte hören können. Während die bereits zweimal aufgelegte Schallplatte den Juuz und die Büchel-Melodien - der Büchel ist das «kurze Alp¬ horn» - in Reinkultur präsentiert, illustrieren die Filme die musi¬ kalische Situation in ihrer Dynamik, im Formwandel. Einigen Leu¬ ten im Tal habe der Film nicht sehr gefallen; er zerstört die Illusion der Intaktheit, an der Konservative oft wider besseres Wissen spürbare Kameramensch, der Aufzeichner, der sich nie versteckt und der nie sagt: «Tut so, als ob ich gar nicht da wäre.» In Fachkreisen sind Zemps Filme hochgeschätzt. Auch das wäre ein Grund für eine Ausstrahlung, für die Schweizer TV-Volkstümler allerdings kein zureichender. Einer von Hugo Zemps meistzitierten Aufsätzen betrifft die Meta¬ sprache von Musikern der Salomon-Inseln («Aspects of Are Are Mu¬ sical Theory», 1979). Zemp hat während seiner insgesamt zwei Jahre dauernden Forschungsaufenthalte nicht nur die Sprache erlernt, sondern auch das Spiel der gebräuchlichsten Instrumente. Er hat die von kalifornischen Musikethnologen entwickelte Technik der Bi¬ Musikalität praktiziert und damit erfahren und beschreiben können, wie die Musiker über Musik sprechen. Sein Aufsatz widerlegt die ge¬ läufige Auffassung, dass traditionelle Musik lediglich durch Imita¬ tion tradiert wird. Eine musikalische Metasprache ist auch Voraus¬ setzung für die Kreativität einer traditionellen Musik, das heisst für die Erfindung neuer Stücke. Im Muotatal war er nicht bi-musikalisch. Juuz und Jodel waren dem ursprünglich aus dem Entlebuch stammenden Forscher fremd und dem ehemaligen Jazzmusiker eher befremdlich, wenn nicht gar verdächtig gewesen. Was hat ihn denn in das 3000-Seelen-Tal ge¬ führt? Ein rein wissenschaftliches Interesse. Der deutsche Musik¬ ethnologe Wolfgang Sichardt hatte 1936 im Muotatal Aufnahmen gemacht und drei Jahre darauf das Buch «Der alpenländische Jodler und der Ursprung des Jodeins» publiziert; darin war vom abfallen¬ den Schlussglissando, von der neutralen Intonation der Terz und der Erhöhung der vierten Stufe der Tonleiter (Alphorn-fa) die Rede. Den Wissenschaftler interessierte zunächst nur das; immerhin war er geistesgegenwärtig genug, um in seinen Filmen die Konfliktsitua¬ tion darzustellen. Er selber weist auf die inspirierende Rolle der Arbeiten seiner Frau, Sylvie Bolle-Zemp, hin, die sich mit den Pro¬ zessen der Fabrikation und der Identifikation eines musikalischen Erbes (oberes Greyerzerland) befassen. Verteidigt er wirklich nichts? In zwei Gesprächen ist oft der Begriff «World Music» gefallen, seinerseits immer mit einem ab¬ schätzigen oder doch skeptischen Unterton; dem amerikanischen Musikimperialismus und dem riesigen Geschäft mit regional eingefârbter Rockmusik kann Zemp nichts abgewinnen. Er ist der Erforscher versinkender musikalischer Welten, allenfalls des ersten Folkloreschubs. Er begrüsst die Versuche traditioneller afrikanischer Musiker, ihre Tonfolgen und Instrumentierungen international rechtlich zu schützen, obwohl er natürlich weiss, dass man den Moog Synthesizer nicht verbieten kann, dass das ein Kampf gegen hangen. Eine beträchtliche Anzahl von Anekdoten sind mit den Feld¬ aufnahmen Hugo Zemps in einem der letzten Réduits der tradi¬ tionellen Musik in der Schweiz verbunden. So haben die Dörfler den juuzenden Nachbarn geneckt, der auf dem Plattencover - mit dem rechten Zeigefinger im Ohr - abgebildet ist... wegen seines geflickten Hirtenhemds. Und der hat sich mit dem Hinweis auf beträchtliche Tantiemen «gerettet». Man juuzt im Muotatal eben sozusagen hinter vorgehaltener Hand. Jene, die es noch können und manchmal, allerdings wesentlich seltener als früher, tun, hatte Windmühlen ist. Zemps einheimischer Mitarbeiter gekannt. Die Arbeit im Muotatal muss als «dringliche Musikethnologie» bezeichnet werden, es waren Notaufnahmen, Notfilmungen. Denn das, was die noch immer oder erneut in der schweizerischen «gei¬ stigen Landesverteidigung» steckenden Konservativen heute unter Tradition und Bodenständigkeit verstehen und entsprechend pfle¬ gen, hat oft null und nichts zu schaffen mit den wirklichen tradi¬ tionellen Kulturformen einer alpinen Zivilisation. Die Konserva¬ tiven geben immer den domestizierten Formen den Vorzug, vor dem anarchisch Urwüchsigen haben sie Angst. In dieses Bild gehört auch die Tatsache, dass das Deutschschwei¬ zer Fernsehen keinen der vier Filme Zemps gezeigt hat, während der Westschweizer Sender immerhin einen programmierte. Dass sie nicht alle technischen Normen erfüllen, dass ihre Kamerafüh¬ rung und Montage nicht über jeden Zweifel erhaben sind, ist nicht zu bestreiten. Zemps Filme verhalten sich zu den volkstümlichen Sendungen des Monopolmediums wie ein Juuz zu einem geschlif¬ fenen und frisierten Jodel. Als Filmer hat Hugo Zemp eine Kantig¬ keit bewahrt, die sein Lehrmeister und Vorbild Jean Rouch abgelegt hat. Er filmt in Einstellungssequenzen, oft mit handgehaltener Kamera, er löst die Szenen kaum auf, sondern bleibt immer der Appenzell Ausserrhoden und das Muotatal sind kurze Episoden in Hugo Zemps wissenschaftlicher Arbeit gewesen, weitere schwei¬ zerische Projekte hat er nicht. Seine aus dem waadtländischen Bex gebürtige Frau will ihre musikethnologische Bestandesaufnahme in der Haute-Gruyère jedoch weiterführen und auf andere westschwei¬ zerische regionale Traditionen ausdehnen, sobald und sofern sie weitere Feldforschungen finanzieren kann. Sylvie Bolle-Zemp bewegt sich in einem Gebiet, in dem es ausser vielleicht der Kuhglockenmusik im Grunde oder am Grunde gar keine traditionelle Musik gibt. Einer Region, in der man Trans¬ formationen für das Ursprüngliche hält, beispielsweise die Stücke selbst den «Ranz des vaches» - des Abbé Bovet oder die Glocken¬ spiele der Dorfkirchen. Eine vorläufige Bilanz ihrer Forschung, die sie dank der Unterstützung durch den Nationalfonds durchführen konnte, zieht ihre Dissertation «Le Réenchantement de la mon¬ tagne. Aspects du folklore musical en Haute-Gruyère» (1992, Georg Editeur, Genf). Aufschrift und Tritt begegnet die Autorin der Ideologisierung von Musik und, «hinter der Musik», einer ländlichen Lebensweise. Der Senn (1'armailli) besitzt eine «klare Stimme» (une voix claire), eine der Höhenlage seiner Alp entsprechende Tenorstimme, weil 34 er während der Alpzeit so viel klare und reine Bergluft atmet. Im Ernst! Wohlhabende Familien haben eher die «klare Stimme» als weniger wohlhabende; solches sagen die weniger Bemittelten; das Timbre erscheint ihnen quasi erblich. Das Volkslied, zum grossen Teil geschrieben und getextet von Abbé Joseph Bovet, vor allem das Chorlied, wirbt für die ländliche Schweiz, vor allem für die höhergelegenen Regionen, und für ihre konservativen Werte. Die Klage über ihren Verlust und der Wunsch nach ihrer Wiederherstel¬ lung gehen Hand in Hand. Wenn von «Reinheit» und von «Sauber¬ keit» und von «Einfachheit» des Chorgesangs die Rede ist, schwin¬ gen die christlichen Werte mit. Sylvie Bolle-Zemp spricht in den Schlussfolgerungen ihres Buchs von einem resistenten «Exotismus von innen», und sie unterlässt es auch nicht, auf den Chauvinismus, den Antiinternationalismus, die Abneigung gegen alles Proletarische des Abbé Bovet sowie auf eine besondere Spielart («Renaissance Fribourgeoise») der geistigen Landesverteidigung hinzuweisen, die einerseits für den Faschismus recht offen und andererseits fast nahtlos in die Touris¬ muswerbung übergegangen ist. Kurz, sie ist daran, ein mythisches Gewebe («texture mythique») aufzuzeigen, das nicht nur der Ruralität eigen ist, sondern ebensosehr von der urbanen Gesellschaft fabriziert wird. HALSZITHER In der Schweiz sind drei andern Saiteninstrumen¬ Halszithertypen bekannt, die sich an äussern Merk¬ malen unterscheiden las¬ ten wie Konzertzither, Bassgeige sen. Nach den Gebieten ihrer Herstellung und Ver¬ wie Halszitherklänge und Krienser Hausmusik wendung heissen sie: Em¬ gespielt. Die Pflege der mentaler, Toggenburger Emmentaler Halszither, sie wird auch Hanottere genannt, ist bis auf ein¬ und Krienser Halszither. Der Emmentaler und Toggenburger Halszither gemeinsam ist ein flacher, Sylvie Bolle-Zemp breitet ihr Material mit jener gelassenen Objek¬ aus, die in der wissenschaftlichen Arbeit und in ethnomusikalischen Publikationen gefordert ist, aber die kompetent heraus¬ gearbeiteten Befunde könnten auch Grundlage für eine politische Polemik sein, ja sie bieten sich nach der Abstimmung über einen Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum vom 6. Dezember 1992 geradezu dafür an. Diese Abstimmung hat die Abneigung der «dörflichen Schweiz» gegen eine europäische Inte¬ gration deutlich gemacht. Der Abstimmungskampf war auch eine Auseinandersetzung der (Selbst-)Bilder, und zu dem Bild, das ein Volk von sich macht, gehört auch die Musik (des Volkes). Die Chor¬ sängerinnen und Chorsänger des Greyerzerlandes verstehen sich oft als eine Verkörperung des «Schweizertums» (der suissité); sie sind ein nicht allzu fernes Echo jener Zeit, in der Schweizervolk und Schweizermusik und Schweizerliteratur und Schweizerfilm in einem Wort geschrieben worden sind. Das Schweizerhaus ist eine Alphütte, was auch immer geschehen mag; sie steht wie eine hei¬ melige und sichere Festung in der bösen Welt. (Ich erinnere mich an Bunker aus «Reduit»-Zeiten, auf welche als Tarnung Holzfassaden geklebt waren, und mir kommt auch die Bauordnung von Gstaad in den Sinn, die nur das Chalet zulässt. Geistige Landesverteidigung und Tourismus wieder Hand in Hand, als ewige Stafettenläufer.) Volksmusik und ihre ideologische Besetzung sind eine der vielen «Masken» (Sylvie Bolle-Zemp), die sich das konservative Sonder¬ falldenken aufsetzt. Also: Nichts wie hinein in die «World Music», in die «Mestizisierung», Abschied von einer alpenländischen überheblichen My¬ thologie der reinen, einfachen, aufrichtigen «Volksmusik», der «drei S» des Abbé Joseph Bovet: sobre, simple et sincère? Nur weg mit dem verheerenden ideologieträchtigen Bild vom Oben und vom Unten, von den Schweizern auf ihren Bergen, die näher bei Gott leben als die Flachländer? Stephan Eicher, «Patent Ochsner» und «Züri West» als grosse Erleichterung, als Befreiung vom überheb¬ lichen Sonderfalldenken, als Abschied von dieser stickigen und tivität sind als am Hals, sowie ein griffbrettbelegter Hals, es der Birne ähnlicher Reso¬ mit einem offenen Wirbelkasten versehen ist. Toggenburger Halszithern sind mit einer gedrechsel¬ ten Rosette, Emmentaler Halszithern mit einem geschnitzten Tier- oder Frauenköpfchen bekrönt. Nach ihrer doppelchörigen Besaitung (je zwei gleich gestimmte Saiten), nach dem mit Metallbünden unterteilten Griffbrett, nach Saitenbefestigung und Steg zu schliessen, zählt die Krienser Hals¬ zither ebenfalls zu diesem Cistertyp. Auf den ersten tung geistlicher Lieder, wie die Aussage einer Watt- wilerin bezeugt. Diese be¬ hauptete um 1910, auf einer Halszither dürften keini Lumpeliedli, sondern nurfrommi Liedli er¬ klingen. Hinter dem Begriff Cither verbirgt sich ein In¬ strument der Renaissance¬ musik, das in Frankreich eis tre, in England cittern und in Italien cetera hiess. Niederländische Gemälde aus dem 17. Jahrhundert dokumentieren die Halszi¬ ther als populäres Musik¬ instrument lustiger Gesell¬ schaften im Wirtshaus Blick ist sie aber der Gitarre ähnlich und wird oder als stilles Saitenspiel im häuslichen Kreis. mit Bildliche Darstellun¬ gen aus der Schweiz wie eine Holzskulptur von 1600 am Hochaltar von Peter Spring in der Frei¬ burger Augustinerkirche und ein musizierender Engel aus Paul Stockers diesem grössern Chordophon auch leicht ver¬ wechselt. Krienser Hals¬ zithern weisen ein leeres Schalloch, Toggenburger Halszithern neben einer zentralen Rosette zwei in Tropfenmustern ein¬ geschnittene seitliche 35 zelne Spielleute aus dem nanzkasten, Zargen, die am Unterklotz schmaler ten ¦ in Ensembles Folkrevival ausgestorben. Die Toggenburger Hals¬ zither diente im 19. Jahr¬ hundert frommen Frauen und Mädchen zur Beglei¬ dem Umriss einer halbier¬ unerträglichen Enge? Diese Erleichterung aber kann nicht heiter sein, dafür sorgt die Dominanz der amerikanischen Elemente der «World Music»; das politische und kulturelle dezentrale Denken hat erst begonnen, vielleicht wird es das nächste Jahrhundert bestimmen. In der heu¬ tigen «World Music» kann man keine Region werden, sondern bloss eine Provinz, wenn nicht gar eine Kolonie. theorbierter Laute und Deckengemälde von 1661 Schallöffnungen auf. Die Krienser Hals¬ im Zurlaubenhof in Zug zither wird zwar seltener als früher, aber in un¬ gebrochener Tradition zu¬ sammen mit Gitarre und zither sei hierzulande schon im 17. Jahrhundert als Kunstmusikinstrument lassen vermuten, die Hals¬ bekannt gewesen. B.B.-G.