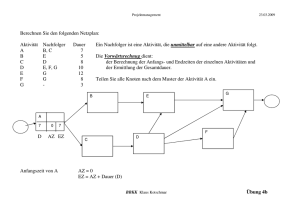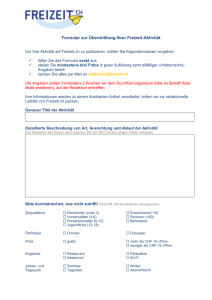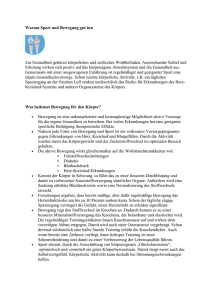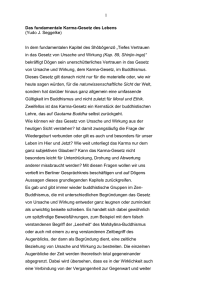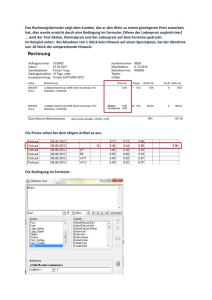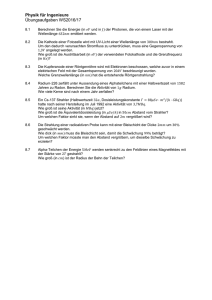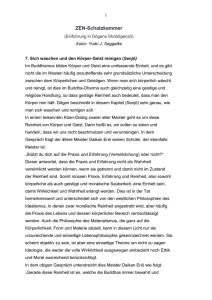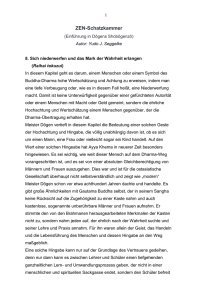Der Verlust der Aktion in der Re
Werbung

Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Die Reaktion, die niemals reagiert, sondern stets agiert. Ellen Wilmes Inhalt 1. Einführung ...........................................................................2 2. Auflösung der Re-aktion in der Aktion ......................................3 3. Die be-ding-ungs-lose Be-ding-ung der Möglichkeit als Aktion und nicht als Reaktion .......................................................................7 4. Die Los-igkeit als Freiheit der Aktion als Aktivität .................... 11 5. Der Wandel: Der Verlust der Reaktion bedeutet Lust der Aktion 14 Literaturverzeichnis ................................................................... 18 1 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes 1. Einführung Die Auseinandersetzung mit der Frage nach Aktion und Reaktion wird in der Regel der Psychologie zugeordnet. Reiz-Reaktion-Schemata werden untersucht, analysiert, Schlüsse gezogen und in einer Auswertung dem Prozess des Schemas ein Wert zugeordnet, der sich in der Realität wiederspiegelt. Zum Beispiel schreibt Jeremy Hayward in seinem Buch über die Erforschung der Innenwelten mit den Worten von Professor Norman Dixon, Professor für Psychologie an der Universität London: „Diese Resultate, […], sind so verläßlich, daß sie jetzt bei den Ausleseverfahren für Norwegens Schwedens Luftstreitkräften und künftige Piloten […] als bei den Test für unbewußte Abwehrmechanismen eingesetzt werden.“1 Das heißt, Untersuchungen an Probanden haben ein bestimmtes Verhalten auf bestimmte Reize ausgelöst. Die Ergebnisse der Untersuchungen wurden im Anschluss integriert in den Alltag der Menschen. Was hier geschieht, bedarf einer philosophischen Reflektion. Denn stellt sich hier nicht die Frage, inwieweit der Mensch sich selbst Grenzen setzt? Braucht er diese Grenzen? Ist eine von Menschen ausgedachte Untersuchungsform für Menschen menschenwürdig? Doch bleiben wir bei der Aktion und Reaktion. Der Tier- und Pflanzenwelt wird eine nicht bewusste Reiz-Reaktion zugewiesen. Schopenhauer nennt dies: „Handeln […] ohne Motiv […] der Wille auch ohne alle Erkenntniß thätig ist.“ 2 Der Mensch hebt sich durch seine Bewusstseinsaktivität davon ab. Er führe „jede Handlung aus der Wirkung des Motivs auf den Charakter mit strenger Nothwendigkeit“ 1 2 3 3 aus, sagt Schopenhauer. Doch belegen zum Beispiel Jeremy Hayward 1996, S. 123. Schopenhauer 2009, S. 117. Schopenhauer 2009, S. 116. 2 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes jene Untersuchungen von Professor Dixon in London, dass der menschliche Proband Handlungen vollzieht und Reaktionen zeigt, die von unbewussten, „subliminale[n] Reize[n]“4 beeinflusst sind. Unseren Reaktionen geht also „etwas“ voraus. Und hier setzt die Frage dieser kleinen Untersuchung an. Was ist dieses „etwas“, das voraus geht? Ist die Reaktion wirklich Reaktion? Ist das, was vorausgeht und das, was scheinbar folgt, ein Beziehungsgefüge? Gibt es noch eine andere Möglichkeit der Beschreibung dieses Geschehens, dieser Erscheinung? 2. Auflösung der Re-aktion in der Aktion Wenn Wissenschaft behauptet, dass Strömungen in Religion wie zum Beispiel Christentum, Buddhismus, Mystik, in der Psychologie Behaviorismus, Tiefenpsychologie, Kognitivismus, in der Philosophie Antike, Scholastik, Aufklärung bis hin zur analytischen Philosophie, in den Naturwissenschaften Naturalismus, Kosmologie, Chemie, Medizin bis hin zur Quantenphysik, eine Reaktion ist, dann wird stillschweigend und ohne Thematisierung vorausgesetzt, dass dort „etwas“ ist, was dem vorausgegangen ist. Eine Reaktion ist eine Antwort, die eben eine Frage voraussetzt. Doch ist das Christentum, die Mystik oder der Buddhismus wirklich eine Reaktion? Gibt es wirklich ein Voraus, auf dass re-agiert wird? In der buddhistischen Gleichzeitigkeitsauffassung ist die Existenz eines Voraus nicht möglich, weil gäbe es ein Voraus, dann würde sich die Gleichzeitigkeit aufheben und ad absurdum führen. Die kleine Vorsilbe -re- kommt aus dem Lateinischen und steht für: „re-u […] 1. zurück […]; 2. wieder […]; 3. in den früheren Zustand, in den richtigen Stand; 4. […] entgegen, wider. “5 Aktion kommt ebenfalls aus dem Lateinischen und bedeutet: „āctus […] 4.a) 4 5 Jeremy Hayward 1996, S. 122. Hau 1999, S. 870. 3 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes Körperbewegung, […]; 6. Bewegung, Tätigkeit, Tun, Verrichtung“6 und bezieht sich auf das Verb agere: „āgō, agere […] 1.a) bewegen, in Bewegung setzen, treiben […]; 2.a) tun, ausführen.“7 Was bringt uns die Betrachtung dieser Worte im Zusammenhang mit unserer Ausgangsfrage? Bei einer Re-aktion handelt es sich offensichtlich um eine Bewegung, die auf etwas Früheres zurückgreift. Es ist eine Zurück-bewegung und dabei ein Tun tun, das sich dem Zurück entgegen bewegt. Somit ist es eine Bewegung der Ab-wehr, weil sie stellt sich entgegen, definiert ein –wider-. Bei dieser Wortherkunftsanalyse wird klar, dass eine Reaktion niemals allein steht, sondern immer eine Beziehung unterhält zu einem Vorausgegangenen, einem „früheren Zustand“. Doch ist es überhaupt möglich, auf einen früheren Zustand zurückzugreifen, um dann daraufhin eine Bewegung auszuführen, die eine Art Bogen schlägt vom Ausgangspunkt zum Jetztpunkt oder auch umgekehrt? Welche Annahme setzen wir, ohne sie zu diskutieren? Ist eine Re-aktion überhaupt existenzhaft möglich? Wenn nach der Bedingung der Möglichkeit einer Reaktion gefragt wird, dann ist die Antwort scheinbar logisch, die Aktion, die dieser vorausgeht. Doch drehen wir uns hier nicht im Kreis? Aktion-Reaktion-Aktion-Reaktion. Wissenschaftler beschäftigen sich in Systemtheorien mit genau derartigen Kreisläufen. Sie untersuchen Aktion-Reaktionen in Bezug zu ihren Verhältnissen. Dabei entstehen Beziehungsfelder, Beziehungsebenen, Beziehungsorte, Beziehung überhaupt. Vogd beschreibt kybernetische System wie folgt: „Kybernetische Gedächtnisse repräsentieren keine Erlebnisse, sondern mit jeder Interaktion verändert sich ihre interne strukturelle Dynamik und damit ihre Funktionsweise. Es findet in diesen Systemen also kein Speichern von Informationen statt, […]. 6 7 Die Gedächtnisleistung beruht vielmehr auf der Hau 1999, S. 16. Hau 1999, S. 39. 4 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes geschichtsabhängigen Änderung der Input-Output-Funktion, also auf einer veränderten relationalen Dynamik des Systems. Wider den Common Sense beruht sie also gerade nicht auf der Aufnahme und Ablage von dinghaften Informationen. Der neurobiologische Konstruktivismus überträgt diese Perspektive letztlich auf alle kognitiven Leistungen des Gehirns. Informationen können deshalb nicht mehr als etwas angesehen werden, das im Nervensystem liegt. Sie lassen sich vielmehr nur noch relational, das heißt im Sinne einer holistischen Netzwerkdynamik fassen, welche durch die jeweilige Geschichte der Beziehungen von System und Umwelt konditioniert wird.“ 8 Doch entspricht dies nicht nur einer begrenzten Auffassung von bewegtem Tätigsein? Eine Bewegung in einer Zeit? Setzt dies nicht immer die Vorstellung einer Zeitachse voraus? Muss nicht bei jeder Bewegung davon ausgegangen werden, dass diese Bewegung, die gerade in diesem einen Moment an einem bestimmten Ort genau jetzt also geschieht, in ihrer Einmaligkeit unverwechselbar ist? Würde sie eine andere Aktivität9, ein Aktion voraussetzen, wo bliebe dann ihre Einmaligkeit? Wenn diese Bewegung stets in ein Beziehungsgefüge einer Re-aktion eingeordnet wird, würde sich die Freiheit der Einmaligkeit dieser Bewegung dann nicht in einen kompletten Determinismus begeben? Ist Aktion nicht die Antwort auf jede Frage, aber niemals eine Re-aktion, weil es diese gar nicht geben kann, weil eine Aktion ein Tun ist? Ist Bewegung, Tun nicht stets absolute Gegenwart? Setzen wir die Bewegung zu etwas in Beziehung, so setzen wir eine Vorstellung um auf eine Bewegung. Ein rein gedanklicher Vollzug stülpt sich über die Aktion und ent-fernt sie von der Aktion als Aktivität als Bewegung. Eine Vorstellung ist keine Bewegung im Sinne eines Tuns. Nach Kant haben: „alle Vorstellungen […] eine notwendige Beziehung auf ein mögliches empirisches Bewußtsein: denn hätten sie 8 9 Vogd 2014, S. 40. Aktivität verstanden als ein Tun. 5 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes dieses nicht, […]: so würde das so viel sagen, sie existierten gar nicht.“10 Kant spricht hier aus, welche Möglichkeit es noch gibt, beschäftigt sich aber nicht weiter mir ihr, weil die Möglichkeit einer Nicht-existenz im klassisch traditionellen Sinne würde sein System zusammenfallen lassen. Dennoch ist dies genau die Stelle, an der die Reaktion zerfällt. Setzen wir die Aktion gleich der Reaktion entfällt die Vorstellung auf eine Beziehung zu einem „empirischen Bewußtsein“. Dōgen schreibt im Shōbōgenzō, dass „die kraftvolle Aktivität des Geistes selbst […] von nichts anderem erzeugt [wurde], […] und wird von keinem Objekt beeinflusst.“11 Auf diese Weise drückt Dōgen das von Kant kurz genannte „ so existierten sie gar nicht“ als ein gefülltes Nichts aus. Es ist eine Aktivität, eine Handlung, die voller Kraft ist, die auf nichts zurückfällt, die von nichts Antwort oder Reaktion wäre. Daher existiert auch keine Beziehung, die jeweils unterstützt wird durch eine Empirie wie Kant darlegt. „Hier waltet die eine absolute Dharmaheit; welche absolute Indifferenz und absolute Gleichheit ist. […] Hier gibt es keine Relation mehr, kein »Sich« und keinen »Anderen«, kurz keine »Person« und kein »persönliches Verhältnis«.“ 12 Objektverneinung liegt hier nicht vor, denn sie wird weder bestritten noch bekämpft. Es geht zuerst einmal lediglich um die Anerkennung, dass eine Aktivität Bestand hat, die keinerlei Beziehung unterhält, die also die Möglichkeit beinhaltet, keinerlei Form von Re-aktion zu sein. Wichtig an diesem Punkt ist, dass auf diese Weise die Subjekthaftigkeit eines Individuums die Möglichkeit erhält seine Form als Re-aktion verlassen zu können. Es ist nicht weiterhin ein Subjekt, das heißt untergeordnet einem Prozess, der als Reaktion auf irgendetwas, auf eine gesetzte Beziehung eine Antwort ist. Das heißt, durch die Akzeptanz einer möglichen Nicht-Beziehung schlüsselt sich das allumfassende Gesetz von Subjekt-Objekt-Relation auf. Nishida drückt 10 11 12 Kant 1974, S. 174, Bd.1, A 117,118. Dōgen Zenji 2013d, S. 307, Bd.4. Keiji Nishitani 2014, S. 251. 6 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes dies wie folgt aus: „Ein Einzelnes im Sich-wechselseitig-Bestimmen unzähliger Einzelner ist ein Er.[…] Daß wir das bewußtseinsmäßige Selbst verneinen und uns auf den Standpunkt des handelnden Selbst stellen, heißt, daß das Ich sich auf den Er-Standpunkt stellt, daß das Ich ein Er wird. […] Auf dem Er-Standpunkt sehen wir subjektivobjektiv Dinge.“13 Im „Er-Standpunkt“, in der Auflösung der SubjektObjekt-Relation zerbricht die Getrenntheit von Subjekt und Objekt an der Bedingung der Möglichkeit der „kraft-vollen Aktivität des Geistes selbst“ 14, die Aktion als Aktivität ist. 3. Die be-ding-ungs-lose Be-ding-ung der Möglichkeit als Aktion und nicht als Reaktion Als vor ca. dreihundert Jahren Kant die Bedingung der Möglichkeit jeglicher Erkenntnis hinterfragte und diesen Begriff ins sprachliche Leben aller Denker setzte, ahnte er wahrscheinlich nicht um dessen Wirkung. Sein „nur dadurch, daß ich eine gegebene Anschauung in Absicht auf die Einheit des Bewußtseins, darin alles Denken besteht, bestimme, kann ich irgend einen Gegenstand erkennen“15, setzt Intentionalität, setzt eine Anschauung als Gegebenheit voraus, setzt das Bewusstsein als Denkmittel ein, ohne dass es keinerlei Erkennen gäbe. Bis in unsere Tage hinein, folgt jegliche Untersuchung diesem Prinzip. Welcher Bedingung bedarf es für die Möglichkeit? Es wird gefragt nach Intentionalität, Intentionen, nach Gegebenheiten, nach der Herkunft von Denken und Erfahren. Erkennen wird bestimmt als reiner Denkakt. Wenn Kant festlegt, dass das „Bewußtsein an sich […] eine Form [der Vorstellung, E.W.]. […] die Bedingung unter der ich 13 14 15 Nishida 2014, S. 91. Dōgen Zenji 2013d, S. 307, Bd.4. Kant 1974, S. 346, Bd.2, B 407,408. 7 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes überhaupt denke“16 ist, so gibt er dem Leben die Bedingung des Bewusstseins. Er erweiterte diese Vorstellung noch durch die Aussage: „Wir sind uns a priori der durchgängigen Identität unserer Selbst in Ansehung aller Vorstellungen, […], bewußt, als einer notwendigen Bedingung der Möglichkeit aller Vorstellungen.“17 Doch, was geschieht hier? Hier wird eine Setzung vorgenommen, dass a priori dies oder jenes schon gegeben ist, wodurch die Frage im Raum bleibt, von was und wie gegeben? Aber wird diese Vorstellung des a priori und des Bewusstseins für Erkennen einmal einfach losgelöst von dieser Vorstellung, ist eine Hinwendung zum gesamten Körper-Geist-Raum18 als ein Ungetrenntes frei. Dōgen beschreibt dies so: „Das Ganze der Existenz überschreitet [Begriffe wie] »anfängliches Sein«, »ursprüngliche Existenz«, »wunderbares Sein« und so fort. Wie viel weniger könnte es eine bedingte Existenz sein? […] Deshalb geht Subjekt und Objekt, die das Ganze der Existenz aller Lebewesen sind, […] über das bedingte Entstehen der Phänomene, über den so genannten »Dharma«, […] und die Praxis und Erfahrung hinaus.“19 Dōgen spricht also von einer bedingungslosen Existenz, von einem Entstehen ohne Bedingung. Wenn Michel Henry darlegt: „Die Phänomenologie [ist] eine transzendentale Philosophie mit dem Bemühen, […] bis zur letzten Möglichkeit des Phänomens zurückzugehen“20 und weiter „weil das Leben die Bedingung der Möglichkeit des Fleisches ist, ist das Fleisch, jedes Fleisch, […], nur möglich im Leben“21, so begegnen wir der Struktur Kants jedoch Kant 1974, S. 344, Bd.2, B 404,405/ A 346. Kant 1974, S. 173-174, Bd.1, A 115,116. 18 Körper-Geist-Raum ist der Körper als Raum und dieser Körper ist gleichzeitig eine Funktion, die als Geist beschreibbar ist. Dies bedeutet, dass es sich nicht um einen intellektuellen Geist handelt, sondern das Handeln in diesem Körper Geist ist. Geist ist Bewegung nicht im Körperraum, nicht mit dem Körperraum, sondern dieser Geist ist Körperraum. 19 Dōgen Zenji 2013b, S. 18, Bd.2. 20 Henry 2002, S. 127. 21 Henry 2002, S. 212. 16 17 8 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes weiterhin. Denn, was ist das Letzte oder Erste? Womit wird es erreicht, mit dem Bewusstsein, mit dem Denken? Doch, was heißt eigentlich „Bedingung“? Was heißt eigentlich „Möglichkeit“? Ist eine Bedingung nicht eine Setzung; steckt doch in dem Wort „Bedingung“ das Wort Ding? Ein Ding ist eine Setzung, weil es ist durch die Definition des Wortes Ding an einen Ort gefesselt ist. Aus seiner Wortherkunft herrührend, ist Ding ein Thing, eine Vollversammlung an einem bestimmten Ort, zu dem vom König geladen wurde. Dort wurde das verhandelt, was es zu besprechen galt.22 Eine Bedingung setzt also offensichtlich einen Ort fest, der die Möglichkeit wiederum ist, ein Etwas zu diskutieren. Eine Bedingung ist also nicht nur Umstände setzen und einen Rahmen schaffen, sondern selbst eine Möglichkeit, denn durch das Setzen der Bedingung - ist Möglichkeit. Wenn die Bedingung nicht reduziert wird auf eine Bedingung einer „Möglichkeit für“ oder „zu“, sondern die Bedingung selbst sich öffnet als Möglichkeit, so ermöglicht sie jegliches, was möglich ist. Und, was ist möglich, machbar, wahrscheinlich, eventuell23? Ist nicht jegliche Aktion als Aktivität24 als Körper-GeistHandlung25 möglich? Ist nicht jegliches Erleben, Erfahren, Begreifen, Erkennen, Denken, Erfühlen, Fühlen usw. eine Aktion als Aktivität? Sind diese Wortbeschreibungen von körperlichem Tun nicht Bedingungen oder eben auch Möglichkeiten zugleich? Wenn wir etwas Ein Thing war die Volksversammlung, http://www.etymologie.info/~e/s_/seismen_.html, Zugriff am 30.12.2015, 15.15 Uhr. 22 23 frz. eventuel von lat. eventus -Ereignis, evenire- heraus-kommen, „ē-veniō, ēvenire […] 6. […] heraus-, hervorkommen“ Hau 1999, S. 347. Aktion und Aktivität scheinen sich zu unterscheiden in der Aktion als Geschehen als Ereignis und der Aktivität, die in diesem Geschehen stattfindet. Doch bei genauerer Betrachtung lösen sich Aktion und Aktivität in dem einen Akt des gerade stattfindenden Tuns auf. Das französische Wort activité wird auch mit Betätigung übersetzt. Aktion wird mit Handeln gleichgesetzt. (http://de.pons.com/Übersetzung/französisch-deutsch/activité und http://www.duden.de/rechtschreibung/Aktion Zugriff am 31.12.13.00 Uhr) Beide Wörter haben den gleichen Wortstamm Akt und stehen für das Tun. Daher erfährt mein Text die Gleichstellung von Aktion und Aktivität im Sinne des von sich ungetrennten handelnden Augenblicks. 25 Verweis siehe Fußnote 18 24 9 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes fühlen, tut unser Körper dann nicht etwas? Ginge er in eine Re-aktion müssten wir fragen, worauf reagiert der Körper? Doch lösen wir das Erfühlen als Fühlen, das Begreifen als Greifen, das Erkennen als Kennen, das Erleben als Leben auf, ist Re-aktion nicht mehr akt-uell, sondern aktuell ist die Aktualität als die jetzige Aktion als gerade die nun getane Körper-Geist-Aktivität26. Die Aktion als Raum eines Geschehens mit einer in ihr enthaltenen Aktivität erlischt an dieser Stelle und wird zu einem Raum. Dieser Raum ist ein unbesetzter freier Körper-Geist-raum, weil wenn Bedingung und Möglichkeit jederzeit gleich sind, dann gibt es kein Ding mehr, das als Bedingung der Möglichkeit vorausgesetzt werden könnte. Dōgen sagt: „Der Raum selbst [ist] unendlich vielfältig. […] Vor allem solltet ihr wissen, dass der Raum [so konkret wie] ein Grashalm ist.“27 Körper-Geist-Raum ist eine Zugleichheit. Der konkrete Körper wie zum Beispiel der Grashalm ist dennoch zugleich Vielfalt und Unendlichkeit, den der Geist in und mit seinem gesamten Körper-Geist-Raum präsentiert. In der Gleichheit und Zugleichheit von Bedingung und Möglichkeit existiert kein Ding mehr als Bedingung der Möglichkeit vor der Gleichheit. Täte es dies, gäbe es ein Ding als Bedingung zur Möglichkeit und dies würde die Gleichheit von Bedingung und Möglichkeit aufheben. Daher kann auch nicht von Gleichheit von Körper und Geist oder von Gleichheit von Bedingung und Möglichkeit gesprochen werden, weil jegliches „von“ und „und“ als Wörter schon eine Trennung aussprechen, die nicht zur Gleichheit passt.28 Die Gleichheit „Bedingung Möglichkeit“ und „Körper Geist“ kann jedoch nur als unbesetzter Raum erfahren werden. Jegliche Besetzung wäre Fest-legung und somit wieder eine Bedingung der Möglichkeit und wir drehten uns im Kreis. Erst die bedingungslose Verweis siehe Fußnote 18 Dōgen Zenji 2013c, S. 31,Bd.1. 28 Sprachlich sind wir an dieser Stelle noch eingeschränkt, aber sprachliche Komponenten wachsen, wie die Sprache immer wieder belegt. Es gibt in ihr keinen Anfang und kein Ende, weil sie selbst Körper-Geist ist. Noch einmal Verweis auf Fußnote 18 26 27 10 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes Bedingung als Möglichkeit selbst befreit die Aktion aus der Reaktion und macht sie zu dem, was sie ist, nämlich reaktionslos. Nishida sagt, wenn wir die „hundert Verneinungen aufhören lassen“, dann beginnt das Tun, „die ganz konkrete, mit unserem Leben unmittelbar verbundene Sache.“29 Diese unmittelbar verbundene Sache ist ohne Reaktion, sondern einfache unmittelbare Aktion als Aktivität als Körper-Geist-Hand-lung oder Körper-Geist-Raum. 4. Die Los-igkeit als Freiheit der Aktion als Aktivität Eine Aktion als Aktivität entsteht daher nur, wenn eine Bedingungslosigkeit und eine Reaktionslosigkeit begriffen werden können. Diese Los-igkeiten legen ein Problem offen. Wenn wir von Losigkeiten sprechen, bedeutet dies in der Alltagssprache, dass ein Etwas abgelöst ist, „getrennt ist von“, dass es ein Etwas gibt, dass „nicht da“ ist. Die Los-igkeiten beschreiben eine Situation, einen Raum, der nicht den Vorstellungen preisgegeben entspricht wird. Wörter und wir der Nicht-vorhandenheit „phantasie-los, ideen-los, bestimmungs-los“ usw. bedeuten ein - nicht vorhanden sein von -, denn die Phantasie ist in „phantasie-los“ nicht vorhanden, die Ideen sind in „ideen-los“ fort, die Bestimmungen in „bestimmungs-los“ gibt es nicht. Das bedeutet, Los-igkeiten stehen für Be-freiungen, sind somit Freiheiten. Begrenzungen Los-igkeiten befreite sind Aktivitäten, Unbesetztheiten, zum Beispiel sind das von Wort „erbarmungs-los“. Es zeigt diese unbegrenzte, freie Aktivität sogar sichtbar werdend. Wie ist dies zu verstehen? Erbarmen setzt in unserer Vorstellung ein Tun voraus; ein Tun, das sich erbarmt; erbarmt eines Anderen30. Es handelt sich daher um ein aktives Tun, ein Hand-eln. Bezeichnen wir einen Umstand als „erbarmungs-los“, so legen wir fest, 29 30 Keiji Nishitani 1985, S. 20. Andere hier: Jegliches Existierendes und Nicht-Existierendes! 11 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes dass genau die von uns vorgestellte Bedingung als Tun nicht stattfindet. In der Regel wird in unserem alltäglichen Leben dieses „los“ als ein Negativum empfunden. Doch betrachten wir die Losigkeiten doch einmal aus dem Blickwinkel ihrer Freiheit, das heißt in ihren Unbelegtheiten, in ihren Nichtvoraussetzungen, in ihrer bedingungslosen Bedingung der Möglichkeit. Wenn die Los-igkeiten zur Möglichkeit selbst werden, weil jegliche Bedingung als eine Voraussetzung nicht mehr festgelegt ist, dann entsteht in den Losigkeiten ein „Raum“, der eben los-ge-löst ist von allen Belegungen. Bewertungen als Voraussetzungen von Los-igkeiten spielen keine Rolle mehr. Bewertungen zielen auf einen Wert, jedoch geben die Losigkeiten keinen Wert mehr her. Sie sind eben be-freit von Werten und Be-werten. Das bedeutet, wenn wir von „erbarmungs-los“ sprechen, dann entsteht ein Erbarmen, das befreit ist, das losgelöst ist von jeglichem Wert. Das Erbarmen ist nun frei in seiner Aktivität, so dass zum Beispiel der Schuss, der das Tier tötet, so gut oder so schlecht ist, wie die Aufzucht von vom Aussterben bedrohter Tierarten. Hier sei deutliche darauf hingewiesen, dass das Erbarmen kein abstraktes Wort darstellt, sondern die Aktivität, die Aktion, die Körper-Geist-Handlung, die bereits Erbarmen ist. Gäbe es einen Unterschied zwischen Erbarmen und Aktivität im Rahmen einer Wertung, dann müssten wir uns fragen, wie dieser aussehen mag. Wenn wir uns in den Unterscheidungen von Erbarmen und Aktivität verlieren, dann bereiten sich Voraussetzungen aus, Bedingungen, Relationen, Intentionen, Begriffe, Gedanken-Aktionen und erschaffen einen Raum, der angefüllt ist mit durch Denken produzierte Interaktionen; eben zwischen den Aktionen Stehendes wird aufgebaut. In diesem Bereich befindet sich derzeit sämtliche Wissenschaft. Dies ist nicht zu verurteilen, sondern die bedingungslose Bedingung als Möglichkeit zu sehen, ist lediglich ein Hinweis, dass der Körper-Geist-Raum eines Menschen mehr und gleichzeitig weniger ist als gemeinhin aufgefasst wird. Gleichzeitig weniger, weil die Aktion ohne Reaktion existiert. Mehr, weil die Aktion 12 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes auch Reaktion umgreift. Doch belassen wir das Erbarmen als Aktivität (das Erschießen eines Tieres, die Aufzucht eines Tieres) als Aktion einfach bestehen als Los-igkeit, dann ist eine freie Hand-lung möglich. „Dōgen kommentiert: »Wir können [Erleuchtung] erfahren, wenn es uns leiblich gelingt, für die Dauer des Gesprächs nicht zu hören.[…], es gibt in der ›Reinheit‹ der Aktivität auch kein Moment der Transformation.«“31 Hand-lung als Bewegung der Körper-Geist-Handlung verstanden, wie zum Beispiel das erwähnte Gespräch bei Dōgen, bezieht diese Losigkeit als Freiheit vollständig in sich ein. Jegliche Bedingung beschränkt Möglichkeit. Eine beschränkte Möglichkeit ist im eigentlichen Sinne keine Möglichkeit mehr, sondern eine Schranke der eigenen Begrenzung, eine sterbende Möglichkeit. Das Zulassen der Los-igkeit als Bedingungslosigkeit und Reaktionslosigkeit eröffnet den Raum der absoluten Freiheit der Bewegung der Körper-Geist-Handlung. In ihrer Unbegrenztheit schafft sie Aktion als Aktivität, die ein Tun tut und genau dadurch zu dem „los“, zu dem „kein“, zu dem „nicht“ wird. Wenn Kant schreibt: „Alle Vorstellungen haben eine notwendige Beziehung auf ein mögliches empirisches Bewußtsein: denn hätten sie dieses nicht, […]: so würde das so viel sagen, sie existierten gar nicht“32, dann deutet er genau auf diesen Bereich des „los“ oder „kein“ oder „nicht“ hin. Fallen die Vorstellungen, fallen die Beziehungen, fällt das Bewusstsein, so wird seine Existenz existenz-los. Los-igkeiten sind einfach. Ein Tun, das bedingungslos ist, ist einfach. Es ist eine stete Anwesenheit der Aktion als Aktivität in ihrer absoluten Freiheit. Befreit sein und Freiheit entsteht aus der Einfachheit heraus. Jegliche Form von Re-aktion, die sich re-flektierend zurückwirft, ist ein Denken, das Antworten auf Fragen sucht. Doch ist die Aktion als Aktivität keine Antwort, sondern sie ist einfach ein Ge-löstes, eben eine Los-igkeit. Ein Denken denkt. Ein Fühlen fühlt. Ein Sehen sieht. Ein Hören hört. Ein 31 32 Müller 2013, S. 314. Kant 1974, S. 174, Bd.1, A 117,118. 13 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes Sprechen spricht. Genau diese Körper-Geist-Handlung ist einfach. Sie ist nicht einmal ein sie selbst, denn das wäre schon ein erneuter gesetzter Bezug. Dies zu begreifen, ist nach Dōgen nicht denkbar, sondern nur erfahrbar. „Wie könnte das gewöhnliche Denken das Wirken des Dharmas erkennen, bei dem Körper und Geist sich verbinden? Niemand kann die Grenzen von Körper und Geist klar erkennen.“33 Erkennen wollen ist ein Wollen, ist begierig sein nach Antworten, ist daher nicht einfach. Los-igkeiten sind kein Wollen, kein Erkennen mehr. Sie sind eben durch und durch klar. Dōgen stellt die Lösung dieses Problems wie folgt dar: „Ihr [solltet] wissen, dass diese Art der Klärung stattfindet, wenn ihr das Augenscheinliche klar seht. Um diese Grundwahrheit wirklich zu begreifen, […], [solltet] ihr lernen, wie der Geist beschaffen ist. “34 Dōgen empfiehlt den Geist zu studieren, somit den Körper zu studieren und Los-igkeit zu werden, was Einfachheit impliziert. Einfachheit steht für Unbesetztheit und Freiheit, die den Raum freigibt für eine offene Körper-Geist-Handlung. Mit dieser Freiheit entsteht Freude am Tun im Tun, weil das Tun einfach tut; losgelöst von Vorstellungen, Intentionen und gedachten Wahrheiten. 5. Der Wandel: Der Verlust der Reaktion bedeutet Lust der Aktion Mit der Be-freiung der Aktion von der Reaktion entsteht so viel Bewegung wie sie eben unvorstellbar, nicht denkbar ist. Geben wir der Aktion ihren Raum zurück, der derzeit verstellt ist mit Reaktionen, so entsteht ein Raum, der wie folgt beschreibbar ist. Aktion ist Handeln. Aktivität ist handelnde Bewegung. Handeln ist Hand und steht für das 33 34 Dōgen Zenji 2013c, S. 147, Bd.3. Dōgen Zenji 2013d, S. 307, Bd.4. 14 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes körperliche Tun. Jedoch ist das körperliche Tun nicht begrenzt. Das heißt, keine Vorstellung, keine Intention belegt es. Das körperliche Tun ist als freier Geist im Sinne der oben beschriebenen Los-igkeiten unterwegs. Die Hand-lung oder der körperliche Ausdruck ist sowohl dem körperlichen als auch dem geistigen Tun handelnd gleichgesetzt. Zusammenfassend lässt sich mit Dōgen sagen: „Es ist die Einheit der wirklichen Zeit mit den Ursachen und Umständen selbst. Es ist das Überschreiten der [nur gedachten] Ursachen und Umstände, es ist die Buddha-Natur35 selbst, die sich von ihrer eigenen Substanz gelöst hat.“36 Nur wenn das körperliche Tun sich vom freien Geist trennt, entsteht Re-aktion, weil dann das Handeln sich aufspaltet in Hand und denkendem, sich vorstellendem oder re-flektierendem Geist. Bleibt jedoch das körperliche Tun mit seinem von Reaktionen befreiten Geist in seiner unbegrenzten Möglichkeit, entsteht der unbesetzte unbegrenzte freie Körper-Geist-Raum, der sich als Los-igkeit, eben von allem losgelöst, bewegt. Bewegung ist jedoch genau dieses Handeln des freien Körper-Geist-Raumes. Bewegung ist nicht ein Weg von A nach B, weil in dem Wort Bewegung Weg enthalten ist. Dies ist es auch, aber Bewegung ist auch zugleich die bedingungslose Bedingung der Möglichkeit schlechthin. Nishida schreibt: „Der Ausdruck ist in unserem Handeln enthalten. Umgekehrt gibt es ohne Ausdruck kein Handeln unsererseits. Ausdruck ist etwas ganz und gar uns Bewegendes.“37 Das Hand-eln als Aus-druck ist Be-weg-ung und gleichzeitig „uns Bewegendes“. Michel Henry sagt: „Das Leben [ist] eine Bewegung, […], ohne sich jemals von sich zu trennen.“38 Das heißt, wir als Lebendige sind Bewegung, stets ungetrennt. Rombach erörtert es so: „Nichts »ist«, alles muß »sich tun«. Alles […] ist somit an jedem Punkt 35 36 37 38 Buddha-Natur als Alles, das gleichzeitig für Leere steht. Dōgen Zenji 2013b, S. 20, Bd.2. Nishida 2014, S. 74. Henry 1997, S. 223–224. 15 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes präsent.“39 Jegliches Tun ist daher als Hand-lung genau der Augenblick des JETZT. Dieses JETZT ist bedingungslose, befreite, losgelöste Aktion als Aktivität – eine Los-igkeit. Es zählt einzig und allein diese Aktivität, die sich beschreiben lässt, im Gegensatz zum Verlust als Lust. Diese Lust ist keine Gier und somit ein Wollen wollen oder eine Leidenschaft, die sich erleidet und leidet. Diese Lust ist eher ein zugeneigt sein, eine Neigung, wie es die germanische Herkunft des Wortes „lutan“ bezeichnet.40 Eine Neigung, die der Hand-lung zugeneigt ist. Die Aktion ist als Aktivität ein „geneigt sein“, ein „möglich sein“, eine Hinwendung und damit schließt sich der Kreis der Gedanken. Jede Aktion als Aktivität ist eine Möglichkeit, deren es keiner Bedingung bedarf. Sie ist Körper-Geist-Handlung als eine Hinwendung, die ungetrennt ist. Sie ist im Sinne des Wortes „Neigung“ eine Neigung, die so niedrig ist, dass keine Grenze mehr existiert und somit jegliche Reaktion von vornherein ausgeschlossen ist oder total eingeschlossen. Die Aktion als Aktivität ist eine Los-igkeit, die einfach sie ist. Sie geht in ihrem Tun auf, eben zugeneigt. Doch ist dieses Tun nicht ausgrenzend, denn dann würde es Trennungen setzen auch für sich selbst. Dieses Tun ist so offen, wie es offen sein kann. In seiner Unbegrenztheit ist jegliches Andere eingeschlossen, eben um die Begrenzung gelöst zu halten. Jede Bedingung setzt ein Ding als Anfang, aber täte dieses geneigte Tun als Aktion als Aktivität dieses, dann setzte es sich eine Grenze und wäre somit nicht mehr frei und gelöst. Die Bedingungslosigkeit ist somit die Bedingung der Möglichkeit der Aktion, die befreit ist von der Reaktion. Auch wenn nun Bedingungslosigkeit als Bedingung aufgeführt ist, so ist diese Bedingung wie es die Bedingungslosigkeit aussagt, eine befreite, eine losgelöste Bedingung, eben eine Los-igkeit im oben beschriebenen Sinne. Dies scheint ein Widerspruch zu sein, doch ist bei genauerer 39 Betrachtung diese bedingungslose Bedingung die Rombach 1994, S. 65. 40 Specht beschreibt, dass das Wort Lust nicht einmal in großen Nachschlagewerken zu finden ist. 16 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes Bedingung, die jeglichem Möglichen den Raum öffnen kann. Setzt die Menschheit sich selbst in die Aktion-Reaktionskette, so beraubt sie sich dem freien Möglichen und damit ihr inständig eigenes Sein, das nichts anderes als genau dieses freie Tun als Aktion als Aktivität als KörperGeist-Handlung als Losigkeit ist. Eine Aktion-Reaktionskette sucht stets und findet niemals eine Antwort, weil die Suche sucht, statt einfach anzukommen. Ankommen ist jedoch das JETZT, das sich als Aktion zeigt, sich tut, einfach ist. Sie ist die Antwort, die jegliche Frage beantwortet, weil sie ist einfach, das, was sie ist – Aktion – Aktivität – genau JETZT. Dōgen sagt: „Das Universum existiert »hier und jetzt«. Es wartet nicht auf die Verwirklichung, und es entzieht sich nicht der Zerstörung. »Diese« drei Welten [des Begehrens, der Form und der Nicht-Form] existieren: Es gibt keinen Rückzug daraus und sie sind nicht nur Geist. »Der Geist« existiert als Hecken und Mauern, er wird nicht schlammig oder nass und wurde niemals künstlich erzeugt.“41 In diesem Sinne also ein Hoch auf die Reaktion, die niemals reagiert, sondern stets agiert. 41 Dōgen Zenji 2013a, S. 78-79, Bd.1. 17 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes 6. Literaturverzeichnis Dōgen Zenji (2013a): Shōbōgenzō. 4 Bände. Heidelberg-Leimen: Kristkeitz (Band I). Dōgen Zenji (2013b): Shōbōgenzō. 4 Bände. Heidelberg-Leimen: Kristkeitz (Band II). Dōgen Zenji (2013c): Shōbōgenzō. 4 Bände. Heidelberg-Leimen: Kristkeitz (Band III). Dōgen Zenji (2013d): Shōbōgenzō. 4 Bände. Heidelberg-Leimen: Kristkeitz (Band IV). Hau, Rita (1999): Pons-Wörterbuch für Schule und Studium. [Globalwörterbuch]. 2., neubearb. Aufl., Nachdr. Stuttgart: Klett. Henry, Michel (1997): "Ich bin die Wahrheit". Freiburg Breisgau, München: Alber. Henry, Michel (2002): Inkarnation. Freiburg im Breisgau: Alber. Jeremy Hayward (1996): Die Erforschung der Innenwelten. Neue Wege zum wissenschaftlichen Verständnis von Wahrnehmung, Erkennen und Bewußtsein. 1. Auflage. Frankfurt a.M.: Insel-Verl. Kant, Immanuel (1974): Kritik der reinen Vernunft. 2 Bände. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Keiji Nishitani (1985): All-Einheit als eine Frage. In: Dieter Henrich (Hg.): All-Einheit. Wege eines Gedankens in Ost und West, Band 14. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 13–21. Keiji Nishitani (2014): Vom Wesen der Begegnung. Unter Mitarbeit von Übersetzt vom Verfasser in Zusammenarbeit mit Hartmut Buchner. In: Ryōsuke Ōhashi (Hg.): Die Philosophie der KyotoSchule. Texte und Einführung. 3., Aufl. Freiburg im Breisgau: Alber (Welten der Philosophie, 2), S. 242–257. 18 Der Verlust der Aktion in der Re-aktion Ellen Wilmes Müller, Ralf (2013): Dōgens Sprachdenken. Historische und symboltheoretische Perspektiven. Orig.-Ausg. Freiburg, München: Alber (Welten der Philosophie, 13). Nishida, Kitarō (2014): Selbstidentität und Kontinuität der Welt. Unter Mitarbeit von übersetzt von Elmar Weinmayr. In: Ryōsuke Ōhashi (Hg.): Die Philosophie der Kyoto-Schule. Texte und Einführung. 3., Aufl. Freiburg im Breisgau: Alber (Welten der Philosophie, 2), S. 56–114. Rombach, Heinrich (1994): Der Ursprung. Freiburg im Breisgau: Rombach. Schopenhauer, Arthur (2009): Die Welt als Wille und Vorstellung. Vollst. Ausg., nach der 3., verb. und beträchtlich verm. Aufl. von 1859. Köln: Anaconda. Vogd, Werner (2014): Welten ohne Grund. Buddhismus, Sinn und Konstruktion. 1. Aufl. Heidelberg: Carl Auer Verlag (Systemische Horizonte). 19