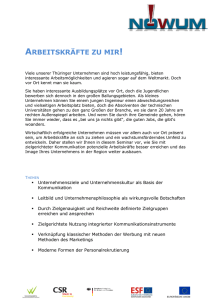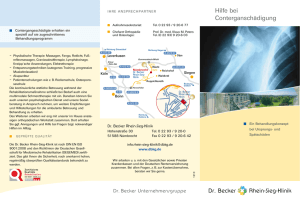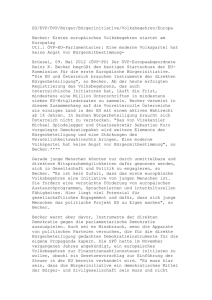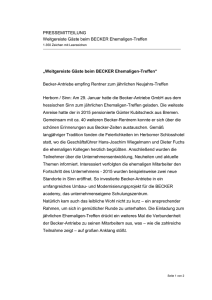Grenzen und Räume – Formen und Wandel
Werbung

Joachim Becker – Andrea Komlosy Grenzen und Räume – Formen und Wandel Grenztypen von der Stadtmauer bis zum „Eisernen Vorhang“ Grenze erweckt vielfältige Assoziationen. Gartenzäune, Stadtmauern, Zollstationen, Sperranlagen stellen ganz unterschiedliche Formen von Grenze dar, die im Menschen positive wie negative Gefühle ansprechen können. Grenze steht – nicht zuletzt bedingt durch jene Seite, von der aus man sie betrachtet – gleichermaßen für Schutz und für Ausgrenzung, für Ein- und für Ausschluss. Auch ihr Gegenteil, die Grenzenlosigkeit, kann sowohl mit Freiheit und Offenheit als auch mit der Einebnung von Vielfalt und Differenz gleichgesetzt werden. Fest steht: Grenzen konstitutieren die soziale Welt und existieren sowohl in der Wirklichkeit als auch in deren Interpretation und Aneignung. Als historisches Phänomen unterliegen ihre Verläufe, ihre Ausgestaltung und ihre Handhabung permanentem Wandel. Eine spezifische Grenze lässt sich errichten, verschieben oder abschaffen, als allgemeines Phänomen ist Grenze jedoch immer vorhanden. So gesehen ist Grenze eine universale Kategorie, die Mensch, Natur und Gesellschaft betrifft. Damit ruft sie geradezu nach vergleichender Betrachtung. Wenn Grenze allgegenwärtig ist, haftet ihr dennoch ganz und gar nichts Natürliches an. Oft decken sich Grenzen mit Küstenlinien, Bergkämmen oder Wasserläufen, weil diese naturräumlichen Barrieren die Siedlungstätigkeit der Menschen beeinflusst haben. Wenn die Natur als Argument für einen Grenzverlauf beansprucht wird, dann stehen in der Regel gleichwohl handfeste politische Interessen dahinter. Aus der Perspektive eines Staates, dessen Territorium über solche geographisch vorgegebenen Barrieren hinausreicht, wird die Natürlichkeit der Grenzen niemals als Argument angeführt. Grenzziehungen und Grenzveränderungen zwischen politischen Einheiten sind das Resultat innerer und äußerer Kräfteverhältnisse. Jede räumliche Verschiebung dieser Kräfteverhältnisse spiegelt sich im Verlauf der Grenze wider. Raum und Grenze müssen also immer in ihrer Wechselwirkung betrachtet werden (Febvre 1988:32; Prescott 1987). Jeder politische, wirtschaftliche und kulturelle Raum wird durch soziales Handeln konstituiert. Dabei muss der soziale Zusammenhalt nicht unbedingt ein flächenhafter sein, sondern kann sich auf Personen und punktuelle Orte beziehen, also ein Raumfragment darstellen. Fragmentiertes Territorium impliziert andere Formen der Grenzziehung als flächenhaftes Territorium. Tendenziell lässt sich mit der Herausbildung moderner Formen der Staatlichkeit eine flächenhafte Ausgestaltung des Territoriums, die Akzentuie- 22 Joachim Becker – Andrea Komlosy rung von dessen Außengrenze und eine Linearisierung der Grenze beobachten. Es gibt aber immer auch gegenläufige Tendenzen. Weiters übt die flächenhafte Territorialisierung von Staatlichkeit einen maßgeblichen Druck zur Anpassung wirtschaftlicher und kultureller Gemeinsamkeiten aus. Wo herrschaftliche, wirtschaftsräumliche, sprachliche und religiöse Grenzen nicht mit den Staatsgrenzen übereinstimmen, brechen Spannungsverhältnisse auf, die einerseits die Expansion des staatlichen Territoriums bis an die Grenzen der Kultur- und Wirtschaftsräume, andererseits die Assimilierung von ethnischen und religiösen Minderheiten mit einer dominierenden Staatssprache oder Staatsreligion verlangen. Der vorliegende Beitrag nähert sich der Einheit von Raum und Grenze zunächst von der Grenze aus. Dabei werden Eigentumsgrenzen, politische Grenzen, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Grenzen, Wohlstands-, Block- und Systemgrenzen berücksichtigt. In jedem Fall interessieren uns Ausgestaltung und Verlauf, Steuerungsinteressen, Geltungsbereich, Durchlässigkeit und Kontrolle. Neben dem trennenden Aspekt der Grenze wird die Frage nach ihren verbindenden Funktionen gestellt. In der Praxis lassen sich, wie die nachfolgenden Beiträge zeigen werden, die einzelnen Funktionen der Grenze nicht klar auseinanderhalten. Grenzen sind multifaktorielle Phänomene, deren einzelne Elemente einander verstärken, aber auch miteinander in Konflikt stehen können. Für die Analyse konkreter Grenzziehungen erweist es sich jedoch als nützlich, das Bündel zusammengesetzter Faktoren auf seine Einzelbestandteile hin zu untersuchen (Heigl 1978). Der zweite Teil des Beitrages erschließt Grenze schließlich vom Staat aus, dessen historischer Formwandel und unterschiedliche Ausprägungen in den Zentren und Peripherien der Weltwirtschaft chronologisch dargestellt werden. Die Außengrenze des Staates steht in engem Zusammenhang mit innerstaatlichen Grenzen und trans- oder supranationalen Formationen. Ebenso lässt sich die Staatsgrenze nicht auf ihren politischen Aspekt reduzieren, sondern spiegelt ökonomische Kräfteverhältnisse innerhalb und zwischen den Staaten und vermittelt soziale und kulturelle Unterschiede. Auch dieser Teil versteht sich als Grundlage zum besseren Verständnis und zur Einordnung der verschiedenen Beispiele von Grenzziehungen, die örtlich und zeitlich je unterschiedliche Formen des Zusammenspiels von Raum und Grenze zutage bringen. Typologie und Chronologie wollen dazu beitragen, die vorgestellten Fallbeispiele in einem raum-zeitlichen Systemzusammenhang wahrzunehmen. Typen von Grenzen Grenzsteine und Stadtmauern „My home is my castle“, kann als anthropologische Grundkonstante gelten, denn jeder Mensch braucht Haus, Heim und abgegrenzte soziale Räume zum Leben. Unabhängig von Lebensform und Gesellschaftssystem spielen Mauer und Schwelle des Hauses eine zentrale Rolle und vermitteln Schutz und Sicherheit (Greverus 1969; Weichhart 1999). Zum Haus kommt die kollektive Abgrenzung der menschlichen Siedlung zur Wildnis hinzu (Strohmeier 1995). Eine anthropologische Begründung privaten Eigentums lässt sich aus den Feldforschungen in Stammesgesellschaften nicht ableiten. Sobald wir jedoch Gesellschaften betrachten, in denen es Privateigentum gibt, dienen Grenzen nicht Grenzen und Räume – Formen und Wandel 23 nur zur Abgrenzung von Lebensbereichen, sondern auch von Besitz. Grundstücksgrenzen, Herrschaftsgrenzen, Gemeindegrenzen bilden den zentralen Gegenstand von Vertrag, Markierung, Konflikt und Rechtssprechung. Dennoch hat die lineare Grenze des Mittelalters nichts mit der modernen Grenzlinie zu tun (Komlosy 1995:387f; Medick 1993:199; Schmale/Stauber 1998:13ff). Die Stadtgrenze als die – wohl augenscheinlichste – Grenze des Mittelalters umgab zwar einen bestimmten Raum, betraf in ihrer rechtlichen Bedeutung jedoch nur jene Bewohner der Stadt, die als Bürger galten. Sie war linear, aber keineswegs exklusiv. Sie legte positive Rechte für Bürger fest, die für andere Stadtbewohner nicht galten. Damit verband sich die räumliche mit einer sozialen Grenze. Ökonomische, soziale und kulturelle Grenzen Bei ökonomischen, sozialen und kulturellen Grenzen fallen uns Natur- und Wirtschaftsräume ein, die Regionen eine bestimmte Prägung verleihen; wir denken auch an die Einzugsgebiete von Märkten, die über den Handel räumlich begrenzte Handlungshorizonte eröffnen; an den Geltungsbereich von bestimmten Währungen; an Ethnie, Sprache, Religion und andere kulturelle Praktiken, die unter den Angehörigen einer Gruppe ein Wir-Gefühl erzeugen, das sie von anderen unterscheidet. Ökonomische, soziale und kulturelle Grenzen unterscheiden sich prinzipiell von Staatsgrenzen. Meist sind sie weniger eindeutig gezogen, sondern zeichnen sich durch Abstufungen, Schattierungen und fließende Übergänge aus, die ihre Formen unter neuen Rahmenbedingungen rasch ändern. Auch wenn sie scharf und exklusiv gezogen sind, ist ihr Verlauf in erster Linie sach-, kontext- oder personenbezogen (Komlosy 2003:210-220). Solche Grenzen können zwischen gesellschaftlichen Gruppen verlaufen, die sich in Bezug auf Reichtum, Beruf oder kulturelle Ausdrucksformen unterscheiden und müssen keinen räumlichen Bezug haben. Es gibt aber auch viele Beispiele für ökonomische und kulturelle Grenzen mit klaren räumlichen Zuordnungen, wie etwa ein klar umgrenztes, naturräumlich bestimmtes landwirtschaftliches Produktionsgebiet, eine Region mit ganz bestimmtem Brauchtum oder eine homogene Sprachinsel. Die lineare Grenze ist in allen diesen Fällen anlassbezogen: Sie gilt für ein bestimmtes Phänomen, für andere Belange ist sie ohne Bedeutung. So gesehen ist die soziale Welt von einem Netz vielfältiger, inkongruenter Grenzen durchzogen. Wenn in Bezug auf alle beliebigen gesellschaftlichen Unterschiede von „Grenze“ gesprochen wird, läuft diese aber auch Gefahr, zu einem Allerweltsphänomen zu werden. Ohne Bezugnahme auf naturräumliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Grenzen ergibt die Diskussion um politische Grenzen im Raum allerdings keinen Sinn. Denn einerseits spiegeln Verlauf und Handhabung politischer Grenzen naturräumliche Voraussetzungen für Siedlung und Befestigung, historische Festsetzungen und Veränderungen sowie politische Macht- und ökonomische Kräfteverhältnisse wider. Politische Grenzen kamen in der Geschichte meist ohne Rücksicht auf jeweils bestehende wirtschaftliche und kulturelle Gemeinsamkeiten zustande. Selbst wenn sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt deckten, entwickelten sich politische, wirtschaftliche und kulturelle Grenzen in unterschiedlicher Weise weiter. Andererseits bedürfen politische Territorien zu ihrer Legitimierung identitätsstiftender Eigenschaften. Im Zeitalter der Fürstenstaaten stand dabei der dynastische Anspruch im Vordergrund, der durch Gründungslegenden und religiösen Auftrag legitimiert wurde. Auch natürliche Grenzen, gemeinsame Kultur und 24 Joachim Becker – Andrea Komlosy zivilisatorische Aufgaben wurden bemüht, um Herrschaft und Expansion zu rechtfertigen. Es bestand allerdings kein Anspruch auf Deckungsgleichheit zwischen Staats-, Wirtschafts- und Kulturraum. Erst die Bemühungen zur Schaffung eines Staatsbürgerverbandes unter einheitlicher zentraler Verwaltung erforderte die Legitimierung der staatlichen Zugehörigkeit durch ein Gemeinschaftsgefühl, das politisch (Staatsbürgerschaft und bürgerliche Rechte), wirtschaftlich (Nationalökonomie) oder sprachlich-kulturell (gemeinsame Sprache und Kultur), in der Regel jedoch durch eine Kombination all dieser Faktoren begründet wurde. Die nationalen Grenzen sollten per definitionem einen Staat umgeben, in dem politische Macht, wirtschaftliche Integration und gemeinsame Kultur übereinstimmten (Anderson 1996:18-26; am französischen Beispiel: Braudel 1989:316-36; Guenée 1986:26; Nordman 1986). Kaum ein Staat entsprach dem Idealbild des Nationalstaates. Die Herrschenden waren jedoch bemüht, Anspruch und Wirklichkeit zur Übereinstimmung zu bringen: durch Assimilierung anderssprachiger Bewohner, z.B. die Bewohner der Bretagne oder des Languedoc in Frankreich; durch Umsiedlung oder Missionierung von Andersgläubigen, wie der Protestanten oder der Griechisch-Orthodoxen in der Habsburgermonarchie; sowie allerorts durch Vereinheitlichung des Binnenmarkts und der Rechtsnormen. Die Maßnahmen unterschieden sich je nach Heterogenität, wirtschaftlichem Entwicklungsstand und Rolle des Staates in der internationalen Arbeitsteilung. Ein voller Erfolg war nirgends beschieden. So klafften die ökonomischen und sozialen Unterschiede sowohl innerhalb als auch zwischen den Staaten auseinander und beflügelten soziale Bewegungen dazu, nach Umverteilung und nachholender Entwicklung zu verlangen. Ein zweiter Impetus für soziale Bewegungen entstand aus dem Auseinanderklaffen von Staatsgrenzen und Sprachgrenzen, insbesonders wenn sich Letztere mit ökonomischen und sozialen Entwicklungsgefällen verbanden. Die Folge war die Entstehung nationaler Bewegungen, welche die Kongruenz politischer und ethnisch-sprachlicher Grenzen forderten – innerhalb des Staates, wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Habsburgermonarchie, oder zwischen den Staaten, indem einzelne Volksgruppen ihre Territorien nationalisierten, das heißt vom bisherigen staatlichen Zusammenhang abspalteten. Dieser Prozess begann in Ost- und Südosteuropa in Griechenland (1821) und Serbien (1830) und erlebte weitere Wellen der Unabhängigkeitswerdung nach 1878 (Berliner Kongress), 1918 (Friedensschlüsse nach dem Ersten Weltkrieg) und 1989 (Ende des realen Sozialismus) (Anderson 1996:37-76; Hofbauer/Komlosy 2000). Dem erklärten Ziel der Nationalbewegungen, politische, wirtschaftliche und kulturelle Grenzen zur Übereinstimmung zu bringen, kamen die neuen Staaten nicht wirklich näher. Neue Grenzziehungen schufen neue Minderheitenprobleme. Wieder anders stellt sich das Auseinanderklaffen zwischen sozialen und kulturellen Grenzen und Staatsgrenzen in jenen Staaten Afrikas, Asiens und Lateinamerikas dar, wo ererbte Kolonialgrenzen scharf in wirtschaftliche und soziale Lebensräume sowie in bestehende Herrschafts- und Siedlungsgebiete eingeschnitten haben (Anderson 1996:77105; Bornträger 1999:29-60). Aufgrund der mangelnden Fähigkeit der kolonialen und später der abhängigen Staaten, ihren Bürgern ein genügendes Auskommen zu gewährleisten, greifen diese auf Subsistenzwirtschaft und informelle Sektoren zurück, deren Räume nicht mit den Staatsgrenzen übereinstimmen. Während staatliche Eliten die Legitimität des Staates durchsetzen wollen, was die Anerkennung der Grenzen voraus- Grenzen und Räume – Formen und Wandel 25 setzt, operieren traditionelle und informelle Netzwerke grenzüberschreitend (Altvater/ Mahnkopf 2002). Wohlstandsgrenzen Betrachten wir nun Grenzen unter dem Aspekt von Trennung und Verbindung. Nur in wenigen Ausnahmen dienen Grenzen dazu, ein bestimmtes Gebiet oder eine Gruppe von Menschen völlig von anderen zu trennen. In der Regel legen sie das Verhältnis zwischen beiden Seiten fest und bestimmen durch ihre Ausgestaltung über die Bedingungen des Kontakts, des Überschreitens und der Durchlässigkeit (Heigl 1978:46; Seger/ Beluszky 1993:14-25). Dabei stellt sich die Frage, ob Grenzen Gleiches oder Ungleiches verbinden. Wenn Grenzen den politischen Raum in Staaten, Provinzen und Bezirke unterteilen, stehen einander auf jeder Ebene gleichartige Raumeinheiten gegenüber. Dasselbe gilt für wirtschaftliche und kulturelle Grenzen, die Regionen nach wirtschaftlicher Spezialisierung, nach Klima und Naturraum und die Menschen nach Ethnie, Sprache, Religion oder Beruf gruppieren. Die gegenseitige Abgrenzung zielt auch hier auf die gleichen Kategorien. In der Praxis zeigt sich, dass zwischen Räumen und sozialen Gruppen keine Gleichheit herrscht, sondern Differenz, die in unterschiedlichen Niveaus von Einkommen und Wohlstand zum Ausdruck kommt. Treten diese Einheiten miteinander in Beziehung, entsteht Interdependenz, die aufgrund der ungleichen Kräfteverhältnisse ein mehr oder weniger starkes Ungleichgewicht darstellt. Damit wird die Grenze, die zwischen den ungleichen Nachbarn verläuft, zur Wohlstandsgrenze – sie dokumentiert ein Gefälle. Im Fall von sozialen Gruppen vermittelt sie zwischen unterschiedlichen Klassen, die durch Abhängigkeit oder Ausbeutung verbunden sind. Im Fall von Räumen vermittelt sie zwischen Zentren und Peripherien, die durch ein Entwicklungsgefälle und den Werttransfer von der Peripherie ins Zentrum geprägt sind. Hier interessiert uns die Frage, wie eine Staatsgrenze zwischen Nachbarn vermittelt. Grundsätzlich hat ein Staat die Möglichkeit, den grenzüberschreitenden Waren-, Kapital- und Personenverkehr zu regulieren (Beschränkungen von Ein- und Ausfuhr, Ein- und Ausreise), zu besteuern (Zölle, Gebühren) und auf diese Art und Weise dessen Auswirkungen auf die Binnenökonomie zu beeinflussen. Der Ort, an dem diese Maßnahmen umgesetzt werden, ist seit über 200 Jahren in der Regel die Grenze; selbst wenn Zollämter, Pass- und Einwanderungsbehörden im Landesinneren liegen, markiert die Grenzlinie den Geltungsbereich der staatlichen Politik. Theoretisch ist es möglich, dass es sich bei zwei Nachbarstaaten um zwei gleich starke Entitäten handelt, die das gleiche Interesse an der Durchlässigkeit bzw. dem Einsatz der Grenze als Steuerungsinstrument haben. In diesem Fall vermittelt diese zwischen gleichen Partnern und ermöglicht ein ähnliches Ausmaß von Durchlässigkeit in jede Richtung. Im Extremfall kann die Grenze völlig offen, ungeschützt und unkontrolliert sein, wie dies lange Zeit etwa zwischen den Beneluxstaaten der Fall war und heute im Verkehr zwischen den Schengen-Staaten üblich ist. Der gegenteilige Fall ist gegeben, wenn die Grenze den Kontakt zwischen den Nachbarn völlig unterbindet. Dies war – mit Ausnahme der beiden Koreas – nicht einmal in den Jahren des „Kalten Krieges“ der Fall, da Waren- und Personenverkehr zwischen Ost und West in eingeschränkter Form immer stattfand; der Kontakt war jedoch zu Zeiten des „Eisernen Vorhangs“, 26 Joachim Becker – Andrea Komlosy vor allem was den Kapitalverkehr und die Reisefreiheit anbelangt, extrem eingeschränkt. Abschottung bzw. Boykott werden im zwischenstaatlichen Verkehr immer wieder eingesetzt und führen dazu, dass manche Teile der Welt für andere gänzlich unzugänglich sind. In diesem Fall ist die Grenze undurchlässig. Die Praxis zeigt meistens Mischformen. Erstens ist eine Grenze in der Regel für manche Beziehungen offen, während sie bei anderen Einschränkungen durchsetzt. Zweitens hat die Frage von Offenheit oder Geschlossenheit eine soziale Komponente, das heißt bestimmte Regeln gelten nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen, z.B. Mittellose, während Wohlhabende frei passieren können. Drittens stellt sich die Durchlässigkeit für jede Seite der Grenze unterschiedlich dar. Ein Staat möchte beispielsweise seine qualifizierten Arbeitskräfte im Land halten und beschränkt daher deren Ausreise, der andere ist an billigen ausländischen Arbeitskräften interessiert, öffnet ihnen seine Grenzen und unternimmt sogar Anwerbeaktionen. Ähnlich divergierende Interessen lassen sich für Waren- und Finanzströme bestimmen. Die unterschiedliche Interessenlage spiegelt den unterschiedlichen Entwicklungsstand der beiden Nachbarn wider. Je höher der Entwicklungsstand eines Landes, desto eher ist es an offenen Grenzen, also Freihandel, und freiem Kapital- und Personenverkehr interessiert. Weniger entwickelte Staaten hingegen benötigen Protektionismus, um Wirtschaft, Know-how und/oder gesellschaftliche Modelle entwickeln zu können. Politik mit der Grenze Offene Grenzen erlauben den Unternehmen der wettbewerbsfähigen Ökonomien, nach Belieben Waren aus peripheren Ökonomien einzuführen, Kapital zu exportieren und die Arbeitskräfte vor Ort oder – als Fremd- oder Gastarbeiter – im eigenen Land einzusetzen. Auf diese Art und Weise bleibt die periphere Ökonomie freilich abhängig vom Ausland; sie trägt durch ihr niedriges Lohnniveau zum Wachstum der Zentren bei und bleibt selbst abhängig auf diese bezogen. Unter den Bedingungen kolonialer Herrschaft kann sie diesem Verhältnis wenig entgegensetzen. Formelle staatliche Souveränität erlaubt es, der Abhängigkeit durch Förderung der Wirtschaft und Regulierung der Außenwirtschaftsbeziehungen politisch gegenzusteuern. Dadurch ergibt sich auch für den peripheren Staat formal die Möglichkeit, die Grenze als politisches Instrument einzusetzen. Diese Möglichkeit wird durch die Außenorientierung, die aus der peripheren Integration entstanden ist, freilich real erheblich reduziert. Der Spielraum bleibt also trotz Souveränität beschränkt. Die Regierung eines peripheren Staates kann im Prinzip zwischen einem assoziativen und einem dissoziativen Weg wählen (Senghaas 1982:41-58; Menzel 1988:9-24). Assoziation bedeutet eine periphere Anbindung an die entwickelten Staaten. Anstatt auf nachholende Industrialisierung setzt sie auf die Wahrnehmung von Zulieferfunktionen, die periphere Ökonomien für die Zentren erbringen können: die Lieferung von Rohstoffen und Nahrungsmitteln, der Export von Arbeitskräften oder, in jüngerer Zeit, die Bereitstellung von Erholungslandschaft und touristischen Dienstleistungen für die Bewohner der Zentren. Im Gegenzug bezieht eine abhängige Ökonomie Waren aus den (post)industrialisierten Staaten, für deren kostengünstige Herstellung sie allenfalls auch günstige Produktionsbedingungen anbietet. Ein solches Modell stellt andere Anforderungen an die Durchlässigkeit der Grenze: Die Peripherie darf keine Bedingungen für Grenzen und Räume – Formen und Wandel 27 Waren- und Kapitalverkehr aus den Zentralräumen stellen und muss ihren Arbeitskräften ohne Auflagen den Wegzug in die Hochlohnländer gestatten – was freilich nicht bedeutet, dass diese dort unquotiert und unkontrolliert zum Einsatz kommen. Im Gegenzug erhofft man sich Einnahmen aus dem Rohstoffexport, Investitionen in arbeitsintensive Sektoren und Rückflüsse aus Gastarbeiter-Ersparnissen. Die Alternative zum assoziativen Weg besteht in einer nationalen Industrialisierungsstrategie, die die Auslandsabhängigkeit abbaut, Kapitalflüsse, Gewinnabflüsse, ungleichen Tausch und brain drain reduziert. Die Geschichte zeigt, dass die erfolgreichen westlichen Staaten am Beginn der Industrialisierung auf Dissoziation gesetzt hatten. Fast alle späteren Industriestaaten bauten ihre Industrie gegen indische und chinesische Konkurrenten auf, die bis ins 18. Jahrhundert die Weltindustrieproduktion beherrschten und erst durch imperialistische Vorstöße vom Weltmarkt verdrängt wurden (Frank 1998; Wallerstein 1998). Und sie verteidigten ihren Vorsprung gegenüber anderen Mitbewerbern mit merkantilistischen Methoden. Der Freihandel wurde immer erst dann zum Leitbild erkoren, wenn ein Staat marktbeherrschend geworden war. Das war in Großbritannien in der Mitte des 19. Jahrhunderts, in den USA in der Mitte des 20. Jahrhunderts der Fall; während des eigenen Aufstiegs zur Führungsmacht setzten beide Staaten zur Förderung der nationalen Industrie auf Protektionismus und Zollschutz (Bairoch 2001). In der Folge wurde der Schutz der nationalen Industrialisierung von rückständigen europäischen Staaten und – nach Unabhängigkeitswerdung und Entkolonialisierung – auch von den jungen Staaten der europäischen Peripherien, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas betrieben. Sie setzten die Staatsgrenze zum Schutz der nationalen Industrie ein und versuchten gleichzeitig zu verhindern, dass einheimische Arbeitskräfte in Länder mit höherem Lohnniveau auswanderten. Wenn Regierungen der Peripherie die westlichen Strategien zum Vorbild nehmen und ihrerseits Protektionismus betreiben, wird ihnen von den Zentren Störung der internationalen Ordnung vorgeworfen. Diese wurde, um den freien Handel im Sinne der starken Industriestaaten durchzusetzen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in hohem Maße durch internationale Finanz- und Handelsorganisationen wie Weltbank, IWF, GATT oder WTO ausgeformt und abgesichert. Entwicklungsländern wird gleichzeitig die Regulierung ihrer Grenzen im nationalen Interesse untersagt. Die Wettbewerbsregeln der internationalen Finanzorganisationen gestatten im Dienste der freien Konkurrenz und damit der transnationalen Konzerne jede (Markt-)Eroberung. Indem die entwickelten Staaten ihre Interessen verstärkt mittels internationaler Finanzorganisationen sichern, dient dies nicht zuletzt dazu, Staaten der Peripherie eine eigenständige „Politik mit der Grenze“ unmöglich zu machen. Sie machen „Grenzenlosigkeit“ und „Grenzüberschreitung“ zum ideologischen Bekenntnis. Die „Grenzenlosigkeits“-Ideologie richtet sich gegen die Versuche peripherer Staaten, die innere soziale und wirtschaftliche Entwicklung durch eine in ihrem Interesse liegende Ausgestaltung von Durchlässigkeit und Übertrittsbedingungen der Staatsgrenze zu regulieren. Die Grenze als Instrument staatlicher Entwicklungspolitik und nachholender Entwicklung einzusetzen ist damit zum Tabu geworden. Damit hat sich unter dem Deckmantel der „Grenzenlosigkeit“ ein Grenzregime durchgesetzt, das Grenzen im Interesse der starken Kapitale öffnet, ohne den Entwicklungsländern zu gestatten, auf die Bedingungen der internationalen Kapitalbewegungen Einfluss zu nehmen (Gill 1995; Brand u. a. 2000). Allerdings muss die Einflussnahme nicht unbedingt über inter- 28 Joachim Becker – Andrea Komlosy nationale Organisationen wie die WTO, regionale Blöcke oder die geplante Freihandelszone für die Amerikas (ALCA) laufen. Es ist auch durchaus möglich, dass über bilaterale Handels- und Investitionsabkommen eine eigenständige Grenzpolitik unterbunden wird. Der Bilateralismus ermöglicht es Zentrumsstaaten, die jeweilige Machtasymmetrie sehr wirkungsvoll zum Einsatz zu bringen und Vorteile für das jeweilige „nationale“ Kapital herauszuschlagen. Im Fall Lateinamerikas ist beispielsweise eine Tendenz zu einer bilateralen Vertragspolitik seitens der USA erkennbar (Claes/d3e 2003). Selektive Abkoppelung und nachholende Industrialisierung stehen nur in bestimmten historischen Situationen auf der Tagesordnung. Eine günstige Voraussetzung ergibt sich immer dann, wenn die Staaten des Zentrums durch militärische Niederlagen und gesellschaftliche Umbruchssituationen nach Kriegen am expansiven Zugriff auf die Peripherie gehindert werden (Becker 1996). Auch Wirtschaftskrisen zwingen unter gewissen Bedingungen zur Rücknahme der internationalen Verflechtung. Das mangelnde Interesse der Metropolen an den Peripherien kann für diese einen Freiraum eröffnen. Eine Chance auf Abkoppelung und die Umsetzung nationaler Entwicklungsstrategien entsteht dabei freilich nur für jene Staaten, die über eine ausreichende Ressourcenbasis, eine einheimische Bourgeoisie, ein klares Entwicklungsziel sowie eine starke politische Führung verfügen. Für Brasilien, Argentinien, Mexiko und die Türkei eröffnete die Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre die Möglichkeit einer importsubstituierenden Industrialisierung, welche die einheimischen Unternehmungen vor überlegener ausländischer Konkurrenz schützte. Die Schwäche des Binnenmarkts sowie die Abhängigkeit von Kapital, Technologie, Know-how und Absatzmärkten für Cash Crops setzte der Abschottung vom Weltmarkt jedoch klare Grenzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete die Entkolonialisierung auch für zahlreiche ehemalige Kolonien die Möglichkeit, mittels einer staatlichen „Politik der Grenze“ das Verhältnis zum Ausland neu zu regeln. Die starke Außenabhängigkeit der jungen Staaten erschwerte jedoch die Abnabelung von der ehemaligen Kolonialmacht bzw. wurde rasch durch neue Weltmarktzwänge ersetzt. Es gab jedoch zahlreiche Fälle, wo protektionistische Maßnahmen gesetzt wurden, um die Exportorientierung durch den Aufbau einheimischer wirtschaftlicher Kapazitäten zu ersetzen (z.B. Indien, Tanzania, Jugoslawien). Die entscheidende Wende erfolgte im Anschluss an die Weltwirtschaftskrise der 1970er-Jahre. Diese führte zu einer verstärkten Globalisierung der Produktion und der Finanzmärkte, die in den Staaten der Peripherie den Spielraum für eigenständige Wirtschaftspolitik immer mehr einschränkte. Unter diesen Umständen hatten Ansätze einer radikalen Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie im sandinistischen Nicaragua oder in Mosambik, nur mehr geringe Chancen, sich zu behaupten (Coraggio/ Deere 1987a; Becker 1988). Im Grunde standen die ost- und südosteuropäischen Regionen nach Erlangung der Unabhängigkeit 1918 vor dem gleichen entwicklungspolitischen Problem wie die ehemaligen Kolonien (Hofbauer/Komlosy 2000; Szlajfer 1990; Teichová 1988). Eine Ausnahme stellte lediglich die Tschechoslowakei dar, deren westliche Landesteile zu den wirtschaftlichen Kernräumen der Habsburgermonarchie gezählt hatten. Alle anderen Länder waren überwiegend Agrarstaaten, deren Wirtschaftsstruktur auf den Export von Cash Crops nach Zentral- und Westeuropa ausgerichtet war. Die Situation war eine klassisch postkoloniale. Innerhalb der Führungsschichten wurde um Assoziation oder Dis- Grenzen und Räume – Formen und Wandel 29 soziation gerungen. Für eine Fortsetzung der Rohstoff- und Exportorientierung traten vor allem die Großgrundbesitzer ein, die in den meisten Staaten eine dominante gesellschaftliche Position innehatten. Sie hatten Interesse an offenen Grenzen und niedrigen Zöllen. Das einheimische Bürgertum und die Arbeiterorganisationen hingegen plädierten für die Überwindung der Zulieferrolle und den Aufbau und Schutz einheimischer Industrie. Gleichzeitig traten sie für eine Landreform ein, was ihnen die Unterstützung der Bauern und Landarbeiter sicherte. Protektion spielte also in den nationalen Entwicklungsstrategien eine zentrale Rolle. Den eigenständigen Entwicklungsbemühungen war in der Zwischenkriegszeit nur geringer Erfolg beschieden. Neben der Außenabhängigkeit und den innenpolitischen Auseinandersetzungen war dafür vor allem die Weltwirtschaftskrise verantwortlich, die in Ost- und Südosteuropa keine importsubstituierende Entwicklung begünstigte. Sie drückte auf die Preise und versperrte den Produkten aus den europäischen Peripherien den Zugang zu westlichen Märkten. Die Misserfolge brachten allerorts autoritäre Regime an die Macht. Die Tschechoslowakei, Polen und Jugoslawien wurden Opfer der NS-Expansion; Ungarn, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Kroatien hofften, ihre nationalen Ambitionen im Bündnis mit NS-Deutschland zu realisieren. Tatsächlich wurden sie aber zu Vasallen reduziert, die Soldaten und Nahrungsmittel lieferten. Eine neue Situation ergab sich mit dem Kriegsende 1945. Die geostrategische Lage im Einflussbereich der Sowjetunion schuf eine neuartige Ausgangsposition. Eine Mehrheit für eine sozialistische Regierung gab es nur in der Tschechoslowakei, die – vergeblich – darauf setzte, ihren Weg zum Sozialismus eigenständig zwischen den beiden Blöcken anzusiedeln. Allen anderen Staaten wurde das sowjetische Gesellschaftsmodell ohne eigenes Zutun übergestülpt. Während dieses in der Eigentums- und in der Religionsfrage auf Ablehnung stieß, eröffnete es in wirtschaftlicher Hinsicht die Möglichkeit einer nachholenden Industrialisierung, wie sie seit der Staatsgründung angestrebt worden war. Als Schutz gegen die Abhängigkeit vom Westen diente nunmehr nicht die Staatsgrenze, sondern die durch den „Eisernen Vorhang“ bestimmte Systemgrenze. Block- und Systemgrenzen Wenn Staaten in wirtschaftlicher, politischer oder militärischer Hinsicht ein dauerhaftes Bündnis eingehen, lässt sich dies als Blockbildung fassen. Die Grenzen eines solchen Blocks werden durch die Zugehörigkeit bzw. Mitgliedschaft in diesem Bündnis gebildet. Die Blockaußengrenzen sind mit den Staatsgrenzen der Mitglieder identisch. Blockzugehörigkeit ist nicht notwendigerweise flächenhaft; in den meisten Fällen haben die Blöcke jedoch regionalen Charakter. Als Beispiele für Militärblöcke sind NATO und Warschauer Pakt zu nennen; für Wirtschaftsblöcke die Europäische Gemeinschaft/Europäische Union, EFTA, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW-COMECON), die Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA) oder die von den USA und Japan getragene Asiatisch-Pazifische Kooperation (APEC). Eine „Blockbildung“ anderer Art, die sich explizit gegen die bipolare Beherrschung der Welt richtete, war die Bewegung der Blockfreien, der Staaten aus allen Teilen der Dritten Welt, aber auch Jugoslawien angehörten. Daneben gab und gibt es Regionalblockbildungen in verschiedenen Teilen der Dritten Welt (Verband Südostasiatischer Staaten ASEAN in Südostasien, Ostafrikanische Gemeinschaft EAC, SADCC im südlichen Afrika, Gemeinsamer Zentral- 30 Joachim Becker – Andrea Komlosy amerikanischer Markt MCCA in Zentralamerika, CARICOM in der Karibik, Mercosur in Südamerika etc.). Diese folgten je nach politischer und wirtschaftlicher Konjunktur unterschiedlichen Zielen. So hatte die SADCC anfänglich vordringlich ein politisches Anliegen, nämlich die Minderung der infrastrukturellen und wirtschaftlichen Abhängigkeit von Apartheid-Südafrika. Die Integrationspolitik im Lateinamerika der 60erund 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts war vor allem auf die Stützung der importsubstitutierenden Industrialisierung gerichtet, während sie in den 90er-Jahren stärker auf eine Positionsverbesserung bei der Weltmarktintegration orientiert war (siehe Altvater/ Mahnkopf 1996, Dietrich 1998, Becker 1998). Unter einem System versteht man eine Gruppe von solchen Staaten, die einem bestimmten wirtschaftlichen und politischen Gesellschaftsmodell verpflichtet sind. Der Begriff entstand in der Periode der bipolaren Systemkonkurrenz von Kapitalismus und Sozialismus und schloss die Staaten ein, die dem westlichen oder dem östlichen Gesellschafts- bzw. Bündnissystem angehörten. Die Systemkonkurrenz wird oft auch allgemeiner als Gegensatz zwischen demokratisch verfassten Staaten und Diktaturen gefasst. Auch Weltzivilisationen, deren kulturelle und religiöse Traditionen sehr unterschiedliche Auffassungen von wirtschaftlicher und politischer Organisation hervorbrachten, werden immer wieder als Systeme begriffen. Aktuell ist diese Betrachtungsweise durch den US-amerikanischen Präsidentenberater Samuel Huntington belebt worden, der nach dem Ende der Systemkonkurrenz zwischen Kapitalismus und Sozialismus einen weltweiten „Kampf der Kulturen“ anbrechen sah. Die jeweils konkurrierenden Systeme werden mit abwertenden Attributen belegt. Systeme basieren auf weltanschaulicher und/oder kultureller Zugehörigkeit und nicht auf Mitgliedschaft. Sie sind daher von keiner formellen Grenze umgeben. Eine physische Trennlinie wird nur an jenen Orten wahrgenommen, wo die Systeme direkt aufeinander prallen, wie z.B. am 53. Breitengrad zwischen Nord- und Südkorea oder an der europäischen Teilungslinie. Eine Systemgrenze ist am augenscheinlichsten, wenn sie nicht einfach zwischen Staaten, sondern zwischen Bündnisblöcken verläuft, wie dies am „Eisernen Vorhang“ der Fall war. Blöcke bilden sich aufgrund von gemeinsamen Interessenslagen heraus, die politisch, strategisch und/oder militärisch bedingt sind. Sie umfassen große und kleine, mächtige und schwache Staaten mit unterschiedlichem Entwicklungsstand. Die eingegrenzte Form der Zusammenarbeit erfordert keine homogene Rolle ihrer Mitglieder in der internationalen Gemeinschaft. Blöcke und Systeme weisen ausgeprägte innere regionale Disparitäten auf und beinhalten Kern- und Randstaaten. Der reale Sozialismus verkörperte nicht nur eine andere Ideologie, sondern ein Modell nachholender Entwicklung für periphere Staaten, das sich von anderen Versuchen nachholender Entwicklung durch Verstaatlichung, Umverteilung und zentrale Planung unter der Leitung einer kommunistischen Partei unterschied (Bettelheim u.a. 1969; ChaseDunn 1982; Frank 1992; Hofbauer/Komlosy 2000:488f; Senghaas 1982:275-320). Diese nachholende Entwicklung in staatssozialistischem Gewande wurde von den kapitalistischen Mächten besonders vehement bekämpft, weil ein Erfolg nicht nur andere periphere Gesellschaften bestärkt, sondern möglicherweise auch einen Systemwechsel in den westlichen Staaten begünstigt hätte. Die Folge war, dass die Systemgrenze zwischen West und Ost zur hochgerüstetsten Grenze der Welt wurde. Sie war Staats-, Block- und Systemgrenze in einem und deckte Grenzen und Räume – Formen und Wandel 31 sich in ihrem Westabschnitt weitgehend mit der alten Wohlstands- und Kulturgrenze zwischen dem westlichen und östlichen Europa, „als hätten Stalin, Churchill und Roosevelt peinlich genau den Status quo der Epoche Karls des Großen am 1130. Todestag des Kaisers studiert“ (Szücs 1991:15). Während Westeuropa zum Zentrum des kapitalistischen Weltsystems aufstieg, gehörten Ost- und Südosteuropa zu dessen Peripherien. Hier fanden in verschiedenen staatlichen Rahmen und unter verschiedenen politischen Vorzeichen seit dem 19. Jahrhundert Versuche nachholender Entwicklung statt. In Russland eröffnete die Oktoberrevolution einen Sonderweg, der durch die Frontstellung am Ende des Zweiten Weltkrieges auf die osteuropäischen Satellitenstaaten ausgeweitet wurde. Sie bildeten den so genannten Ostblock, dem auf westlicher Seite die OEEC (Organisation of European Economic Cooperation)-Staaten gegenüberstanden, deren Integration durch den Empfang von Marshallplan-Geldern begründet wurde. Weder die östliche noch die westliche Seite waren ganz einheitlich. Neben Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) und Warschauer Pakt als geschlossenem System unter Führung der Sowjetunion entstand China als eigener staatssozialistischer Pol. Der Westen zeichnete sich durch unterschiedliche Bündnisse und Zusammenschlüsse aus, die aufgrund der führenden Stellung der USA den gesamten euro-atlantischen Raum umfassten. Beide Seiten rangen in der Dritten Welt um Verbündete. In der Peripherie wurde der „kalte“ wiederholt zum „heißen“ Krieg – Korea, Indochina, Zentralamerika, Afghanistan, Angola, Mosambik etc. Hauptprotagonisten in der Konflikteskalation waren meist westliche Regierungen. Kam es zu sozialrevolutionären oder auch nur zu ausgeprägt reformistischen Umschwüngen, sahen sie „Kommunisten“ am Werk und intervenierten durch ökonomischen Druck, militärische Destabilisierung oder direkte Intervention. Hieraus folgte oft eine weitere Internationalisierung des Konfliktes im Sinne der Blockkonfrontation (Halliday 1984; Halliday 1989; Coraggio/Deere 1987b:44ff). Der „Eiserne Vorhang“ als besonderer Typus von Grenze Unser Bild vom „Eisernen Vorhang“ ist durch die hochgerüstete Grenzsperre bestimmt, die seit 1949 an der ungarischen, der tschechoslowakischen und der Westgrenze der DDR errichtet wurde und 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer höchste Symbolkraft erlangte (Kernic 1991; Komlosy 1999; Varga 1999). Die Grenzkontrollen vereinigten politische und militärische mit ökonomischen Funktionen und ermöglichten den Behörden und Wachorganen, jede Bewegung und jede Beziehung zu kontrollieren, die über die Demarkationslinie zwischen Ost und West hinwegging. Metallgitterzaun und Überwachungsanlagen waren aber nur die Spitze des Eisberges. Darunter lag der Gegensatz zwischen Ost und West, der sowohl auf dem Antagonismus zwischen Kapitalismus und Sozialismus als auch auf dem Entwicklungsgefälle zwischen dem westlichen Zentrum und der östlichen Peripherie beruhte. Durch die Ausgestaltung des realen Sozialismus als Instrument nachholender Entwicklung verbanden sich die beiden Differenzen zu einer unauflöslichen Einheit. Der Grenzlinie, an der die Gegensätze aufeinander trafen, kam praktische wie symbolische Bedeutung zu. Sie wurde im Zusammenwirken beider Seiten geformt. Wenn nach dem Zweiten Weltkrieg US-Hilfsprogramme und Marshallplan-Förderung nur den politisch zuverlässigen westeuropäischen Staaten zugute kamen und Osteuropa und die Sowjetunion nicht in die Wiederaufbauhilfe einbanden, ist dies dem 32 Joachim Becker – Andrea Komlosy Systemgegensatz und der Entwicklungsdisparität gleichermaßen geschuldet: Investitionen in die peripheren osteuropäischen Ökonomien versprachen einerseits keinen wirtschaftlichen Nutzen, andererseits wollte man dem politischen Gegner keine Hilfe angedeihen lassen (Lunestadt 1986:67f). Das von den USA überwachte COCOM-Embargo, das allen europäischen Marshallplan-Empfängern in weiten Bereichen den Austausch mit den osteuropäischen Nachbarn verbot, sollte das sozialistische System treffen und isolieren (Adler-Karlsson 1971; Hofbauer 1992:83-92). Es konstituierte einen „Eisernen Vorhang“, bevor von östlicher Seite die technischen Grenzsperren in Angriff genommen wurden. Der Sowjetunion, welche die größten Kriegsschäden zu verzeichnen hatte, war nach dem Krieg an der Fortsetzung eines kooperativen Verhältnisses zu den ehemaligen Kriegsalliierten gelegen – in der Hoffnung auf US-amerikanische Wiederaufbaukredite und Unterstützung ihrer Forderungen nach gesamtdeutschen Reparationen (Haberl 1986:76). Diese kooperative Haltung, die im Wunsch der Sowjetunion zur Teilnahme an Weltbank, Internationalem Währungsfonds und Marshallplan zum Ausdruck kam und Embargo und militärische Blockbildung zurückwies, resultierte aus der wirtschaftlichen Schwäche der Sowjetunion: Das Entwicklungsgefälle legte ihren Führern nahe, den Dialog mit dem Westen nicht abzubrechen. Die USA hingegen betonten – nicht zuletzt aus innenpolitischen Gründen, um die Ausgaben für den Marshallplan zu legitimieren – den Systemgegensatz. Sie ließen beim Pariser Außenministertreffen im Juni 1947 die Verhandlungen mit der Sowjetunion über den Marshallplan platzen, was der Blocklogik gemäß auch die Teilnahme der osteuropäischen Verbündeten unmöglich machte (Komlosy 1999:273; Lunestadt 1986:63). Gleichzeitig entzogen die USA der Sowjetunion durch die Aufnahme des westdeutschen Teilstaates in das europäische Wiederaufbau-Programm die Chance auf gesamtdeutsche Reparationen, wie sie die Kriegsalliierten im August 1945 auf der Potsdamer Konferenz vereinbart hatten. Dies war ein klarer Schritt zur Isolierung der Sowjetunion, der die Eskalation des Kalten Krieges zur Folge hatte. Ein symbolischer Akt, um die Gründung eines gegen die Sowjetunion gerichteten westlichen Militärbündnisses zu verhindern, war der Aufnahmeantrag der Sowjetunion in die NATO 1949, zwei Tage vor Unterzeichnung des Bündnisvertrags, und erneut 1954 (Komlosy 2001:44f; Siegler 1963:354ff). Zu diesem Zeitpunkt hatte die sowjetische Führung bereits mit der Abkoppelung der Sowjetunion und der Staaten innerhalb ihrer Einflusssphäre vom Westen begonnen. Die kommunistische Planwirtschaft wurde in ein Instrument nachholender Entwicklung transformiert. Gestützt auf die eigenen Kräfte und mit den Mitteln der sozialistischen Transformation wurde – ungeachtet des westlichen Boykotts – ein gewaltiges Industrialisierungsprogramm in Angriff genommen. Wichtige Voraussetzung dieser nachholenden Industrialisierung war nun gerade der Abbruch der Beziehungen mit dem kapitalistischen Westen. Die Waffe, die sich gegen die wirtschaftliche Erholung der Sowjetunion und ihrer Partner gerichtet hatte, wurde so in ein propagandistisches Instrument der Entwicklung umfunktioniert: Durch die Abkoppelung ließen sich die Produktivkräfte der sozialistischen Länder aufbauen, ohne permanent an der höheren Produktivität des Westens gemessen zu werden, welche die eigenständigen Entwicklungsanstrengungen aufgrund dessen wirtschaftlicher Überlegenheit in Frage gestellt hätte. Ein strenges Grenzregime erlaubte es, Waren-, Kapital- und Arbeitskräfteströme unter Kontrolle zu halten und den Markt als Maßstab für die Existenzberechtigung einzelner Grenzen und Räume – Formen und Wandel 33 Produktionsbereiche außer Kraft zu setzen. Ein beabsichtigter Nebeneffekt des Grenzregimes bestand freilich auch in der Blockade von Ideen und Entwicklungsvorstellungen, die nicht dem sowjetischen Fortschrittsmodell entsprachen. Die Grenzbefestigungen des „Eisernen Vorhangs“ nahmen einen zentralen Stellenwert im Maßnahmenpaket der aktiven Abkoppelung ein, die allen Ländern des sozialistischen Ostens – ob es in ihrem Interesse lag oder nicht – auferlegt wurde (vgl. Komlosy 1999:282). Indem Stalin die ungewollte Ausschließung durch den Westen in eine aktive Entwicklungsstrategie transformierte, gewann er an Macht. Nicht nur gegenüber dem Westen, sondern auch gegenüber den ost- und südosteuropäischen Partnern, die – unter dem zum Schutzschild umgewandelten Embargo – in die Sowjetisierung getrieben wurden. Diese führte schließlich auch in jenen Staaten, die bis 1947/48 demokratische Verhältnisse aufwiesen, zur Machtergreifung durch die kommunistischen Parteien. So entpuppten sich das Embargo und das sowjetische Modell nachholender Industrialisierung als eine Art Dialog, den die Großmächte im Rahmen des „Kalten Krieges“ miteinander führten. Ein Argument im Rahmen dieses Dialoges war die Beschaffenheit der Grenze. Indem die USA mit dem Embargo Druck auf die Sowjetunion und Osteuropa ausübten, vertieften sie die ökonomische Kluft zwischen West- und Osteuropa. Dadurch, dass die Sowjetunion die Grenzen schloss und mit dem „Eisernen Vorhang“ ein totales Grenzkontrollregime errichtete, gewann sie die politische Kontrolle über die Grenze zurück. In der Charakteristik dieser Grenze stand damit nicht mehr das unterschiedliche Niveau der wirtschaftlichen Entwicklung im Vordergrund, sondern die Zugehörigkeit zu zwei unterschiedlichen Systemen der gesellschaftlichen Ordnung. Sobald die Grenzlinie von östlicher Seite mit Draht, Minen und Signalanlagen hochgerüstet wurde, verknüpfte sich der ursprünglich viel breiter anlegte Begriff „Eiserner Vorhang“ mit den die staatssozialistischen Länder umgebenden Grenzsperren (Komlosy 2001:279). Blockgrenzen nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ Mit dem Zusammenbruch des realen Sozialismus und der Westorientierung der ost- und südosteuropäischen Staaten verlor die Systemgrenze ihren spezifischen Charakter. Gleichzeitig gewann sie ihre Funktion als Wohlstandsgrenze zurück, die in der staatssozialistischen Zeit aufgrund der nachholenden Modernisierung im realsozialistischen Gewande in den Hintergrund getreten war. Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ wurde der Entwicklungsunterschied wieder deutlicher sichtbar. Er resultierte keineswegs nur aus den Defiziten der Planwirtschaft, sondern entsprach dem historischen Wohlstandsgefälle zwischen dem entwickelten Westen und dem rückständigen Osten des Kontinents. An die Stelle der Systemgrenze trat also eine herkömmliche Wohlstandsgrenze. Diese Transformation der Grenze erfolgte allerdings nur in Europa, nicht jedoch im Verhältnis von China zu seinen Nachbarn. China hat eine andere Transformationsstrategie und eine viel selektivere Politik der Grenzöffnung verfolgt als die früheren RGW-Länder und war damit auch wirtschaftlich weit erfolgreicher. Mit der Selbstauflösung des RGW und des Warschauer Paktes (1991) hörte auch die Blockgrenze auf, zwei Blöcke voneinander zu trennen. Da gleichzeitig die Europäische Union durch den Ausbau der supranationalen Ebene ihre Blockintegration vorantrieb, entstand ein extremes Ungleichgewicht. Dieses bewirkt eine enorme Sogkraft des 34 Joachim Becker – Andrea Komlosy Zentrums und setzt die Peripherie einem starken Anpassungsdruck aus. Auf der einen Seite der ehemaligen Systemgrenze bildete sich ein supranationaler, zunehmend auch außen- und sicherheitspolitisch agierender Regionalblock mit gemeinsamer Außengrenze, auf der anderen Seite befand sich eine – durch Sezession und Zerfall ansteigende – Vielzahl von kleinen Nationalstaaten, die nach dem Zerfall des RGW nur ein Ziel kannten: eine möglichst rasche Assoziierung an die Europäische Union und/oder die NATO. Die Aufnahme in die NATO folgt militärstrategischen Überlegungen der USA, die neue Mitgliedsstaaten als Stützpunkte, als Beteiligte an internationalen Einsätzen und als Puffer gegenüber Russland begrüßen. In Bezug auf die Europäische Union waren die Anforderungen höher; die Erweiterung des EU-Regionalblocks wurde erst in Angriff genommen, nachdem die Planungs- und Umverteilungsmechanismen in den Gesellschaften zerschlagen und die Eigentumsverhältnisse im Interesse der westeuropäischen Konzerne geregelt waren (Bohle 2003; Hofbauer 2003:185-189). Die Bedingungen für den Beitritt wurden von der Europäischen Union vorgegeben und mit jedem Beitrittswerber gesondert vereinbart. Innerhalb der Staaten brachen Gegensätze zwischen relativen Wohlstandsregionen, die meist im Westen lagen, und marginalisierten und zunehmend peripherisierten Regionen im Osten auf. Die Blockgrenze ist auf diese Art und Weise nicht verschwunden, sondern durch die Erweiterung nach Osten verschoben worden. Derzeit ist sie zwischen den neuen EUMitgliedern und deren östlichen Nachbarn im Aufbau begriffen. Die Fortifikation der EU-Außengrenze entspricht dem heutigen Stand der Technik; sie setzt viel mehr elektronische Formen der Überwachung ein als der „Eiserne Vorhang“, der dem Entwicklungsstand der Nachkriegsära entsprach. An Effektivität und Exklusionskraft ist sie diesem allerdings weit überlegen. So genannte Drittstaats-Angehörige werden durch Visumpflicht und erschwerten Zutritt zum Arbeitsmarkt an der Einreise und am Aufenthalt in den EU-Staaten gehindert; gleichzeitig werden die Staaten am Limes der Europäischen Union mit der Perspektive der Assoziierung dazu angehalten, einen vorgelagerten Sicherheitsgürtel um die Europäische Union zu bilden, der bei Bedarf und Wohlverhalten auch ihren zukünftigen Beitritt zur Folge haben kann. Die Staffelung der Mitgliedschaft in der NATO, der Europäischen Union und den Schengen-Vertragsstaaten umgibt den europäischen Kernraum mit einem konzentrischen Ring von vorgelagerten Staaten, die als wirtschaftliche Peripherien, als militärische Verbündete oder als strategische Puffer abgestufte Aufgaben im Interesse des Zentrums erfüllen. Die osteuropäische Peripherie wird damit zu einer flexiblen, unterschiedlich eng an das Zentrum angebundenen Grenzzone gegenüber Russland, dessen Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO nicht zur Debatte steht. Die Situation weist frappante Parallelen zum römischen Limes auf, den Jean-Christophe Rufin folgendermaßen charakterisierte: „Der Limes ist in dem Maße, wie sich das römische Bürgerrecht erweitert, ein Ort zunehmender Ungleichheit. Nach Caracalla trennt er zwei Welten voneinander, die in jeder Hinsicht vereint sind, die unaufhörlich Menschen und Güter austauschen, zwischen denen aber ein erheblicher Rechtsunterschied klafft. (…) Es handelt sich um eine Diplomatie der Apartheid im Weltmaßstab.“ (Rufin 1993:246) Grenzen und Räume – Formen und Wandel 35 Formen von Raum und Staatlichkeit Bislang haben wir verschiedene Formen von Grenzen dargestellt. Nun möchten wir uns dem Zusammenhang zwischen Veränderung der Staatlichkeit und der Grenzziehungen zuwenden. Die bürgerliche Form des Territorialstaates und der entsprechenden Grenzlinien hat ihren Ursprung in Europa und ist durch die europäische Expansion anderen Weltregionen meist gewaltsam aufgezwungen worden. Diesen Prozess wollen wir nachzeichnen. Daher diskutieren wir die vorkolonialen Formen der politischen Herrschaft und Grenzziehung hier nicht. Sie wurden bis auf wenige Ausnahmen durch die koloniale Besetzung zerstört. In einigen Fällen ermöglichte allerdings eine weit fortgeschrittene Form der staatlichen Zentralisierung und der technischen und militärischen Entwicklung, eine direkte Kolonialherrschaft abzuwenden (Japan), die direkte Besetzung auf einige Exklaven – bei allerdings erheblichem Einfluss auf die gesamtstaatliche Politik – zu begrenzen (China) oder die Epoche der Kolonialherrschaft wenigstens sehr kurz zu halten (Äthiopien). Allerdings kam es auch in diesen Fällen zur Übernahme wesentlicher Elemente des europäischen Staatsmodells, wenn auch in einer stärker selbstbestimmten Weise. Vorkapitalistische Buntscheckigkeit Vorkapitalistische Gesellschaften zeichneten sich durch eine räumliche Buntscheckigkeit aus. Ein Großteil der Produktion war auf die Subsistenz ausgerichtet. Ein Mehrprodukt wurde über direkte politische Herrschaft abgepresst. Wenn überhaupt, fand die Akkumulation von Kapital nur am Rande der Gesellschaften statt. Märkte waren kein zentrales gesellschaftliches Phänomen. Im Fall des mittelalterlichen Europa unterlagen sie je nach Charakter des Handels – Fern- oder Lokalhandel – sehr unterschiedlichen Regularien (Pirker 2003:86f; Polanyi 1990:87ff). Ähnlich sah es mit dem Geld aus. Vielfach benutzten unterschiedliche gesellschaftliche Klassen unterschiedliche Gelder. Geld in kleinen Einheiten für die ärmeren Klassen hatte oft „informellen“ Charakter und wurde von lokalen Kaufleuten oder Städten ausgegeben. In andere Währungen war es oft schwer tauschbar. Das gilt gerade auch in Hinblick auf die höherwertigen Währungen der begüterten Klassen. Auch der räumliche Geltungsbereich von Währungen war oft nicht klar abgegrenzt (Helleiner 2003: Kap. 1). Entsprechend fragmentiert war, speziell im mittelalterlichen Europa, die politische Herrschaft. Weder Grundherrschaften noch die europäischen Fürstenstaaten selbst zeichneten sich durch geschlossene territoriale Einheit aus (Komlosy 2003:57ff). Adelige Herrschaftsträger übten über ihre Untertanen persönliche Herrschaftsrechte, Verwaltungs-, Gerichts- sowie Polizeihoheit aus. Die Zentralgewalten wirkten eher als lose Klammer. Die Bevölkerung war sprachlich, ethnisch und meist auch religiös gemischt zusammengesetzt. Das heißt, die politische Herrschaft war wenig homogenisierend, die Gesellschaft nicht durchstaatlicht. Entsprechend vielfältig sahen die Grenzziehungen aus. Mit Ausnahme der Grundherrschaften, die ihre räumlichen Besitzansprüche mit klaren Linien abgrenzten, muss man sich die Grenzen zwischen den mittelalterlichen Reichen als Zonen überlappender Einflüsse und Herrschaftsrechte vorstellen (Guenée 1986:18ff; Komlosy 1995:387). Für die freie Bewegung von Waren und Personen stellten Grenzen in der Regel keine Schranke dar. Die Einhebung von Zöllen und Mauten, die direkt in der Hand der 36 Joachim Becker – Andrea Komlosy Landesfürsten lag oder an unterschiedliche Herrschaftsträger übertragen wurde, erfolgte nicht an den Grenzen, sondern an Zollstationen, die an zentralen Orten bzw. an strategischen Plätzen entlang der Transportwege gelegen waren (Bowman 1950; Hassinger 1987; Komlosy 2003:44ff). Der Personenverkehr unterlag keiner staatlichen Regulierung und Kontrolle. Während Untertanen an die Scholle gebunden waren, reisten Adelige, Diplomaten, Händler, Handwerker und Fahrende unter dem Schutz – und mit den Passdokumenten – ihrer Schutzherren, Standes- oder Berufsorganisationen (Komlosy 2003:161ff). Herausbildung des absolutistischen Staates und der Grenzlinie Die moderne Form der Staatlichkeit und damit letztlich auch die moderne Form politischer Grenzen entstand aus der Krise des europäischen Spätfeudalismus. Der Konflikt um das (agrarische) Mehrprodukt verschärfte sich. Die Bauern wehrten sich gegen die steigenden Lasten. Als Reaktion kam es zu einer zunehmenden Zentralisierung der landesfürstlichen Macht im Zuge der militärischen Niederschlagung der Bauernaufstände, der auch der Adel zustimmte. Dies führte in der Tendenz, aber nicht durchgängig, zur Herausbildung des absolutistischen Staates. Dieser wies einen höheren Grad der Vereinheitlichung politischer Herrschaft als seine Vorgänger auf (siehe Anderson 1979; Wallerstein 1984: Kap. 3). Sein Ressourcenbedarf war wegen des Ausbaus der militärischen Schlagkraft ebenfalls höher. Dieser Ressourcenbedarf wurde über Steuern, also in monetärer Form, befriedigt. Hiervon ging ein erster Impuls zu einer Stärkung staatlicher Währung und einer Vereinheitlichung des Währungssystems aus. Zu einer Herausbildung territorialer Währungen kam es allerdings erst im 19. Jahrhundert (Helleiner 2003:91ff). Der fiskalische Finanzbedarf bedeutete auch eine zunehmende Abhängigkeit der absolutistischen Macht vom guten Gang der Geschäfte und damit von der Bourgeoisie. Damit verschoben sich auch die Kräfteverhältnisse vom Feudaladel zur (oft städtischen) Bourgeoisie. Mit der Herausbildung der absolutistischen Staaten ging ein erster Schub innerer Vereinheitlichung einher, der aber noch nicht bis in alle Fasern der Gesellschaft reichte. Nach außen erkannten sich die so entstehenden Territorialstaaten mit dem Westfälischen Frieden (1648) wechselseitig als souverän an. Hiermit Hand in Hand ging die Anerkennung klar definierter Grenzlinien. Im „langen“ 16. Jahrhundert erlebte die europäische Staatlichkeit eine erste Phase äußerer Expansion. Absolutistische Territorialstaaten und städtische Handelsbourgeoisie verbanden sich bei der kolonialen Expansion. Den einen ging es um die Erschließung neuer Steuerquellen, den anderen um eine Ausweitung der Geschäftsfelder (Boris 1992). In Asien und Afrika beschränkte sich die überseeische Aktivität zunächst vor allem auf die Gründung von Handelsniederlassungen und die Anbahnung von Handelsgeschäften. In Lateinamerika, im 17. Jahrhundert auch in Nordamerika, implementierten die Kolonialmächte eine abhängige Version des Territorialstaates, den Kolonialstaat. Der spanische und portugiesische Kolonialstaat organisierte die Unterwerfung der autochthonen Bevölkerung unter die neue Herrschaft und deren Ausbeutung zum Nutzen und Frommen externer Interessen. Die Ausbeutung erfolgte in verschiedensten Formen unfreier Arbeit. Hierbei wurde nicht allein auf die lokalen Arbeitskräfte zurückgegriffen, vielmehr wurden auch AfrikanerInnen versklavt und zur Zwangsarbeit nach Lateinamerika verfrachtet. Die Sklaverei hatte kommerziellen Charakter. SklavInnen wurden vor Grenzen und Räume – Formen und Wandel 37 allem in der Exportproduktion eingesetzt. Allein 38 Prozent aller SklavInnen, die lebend in den Häfen der Amerikas eintrafen, wurden in Brasilien angelandet (Gorender 2000:33). Die Sklaverei bestand vielfach über die Kolonialepoche hinaus und vererbte, wie am Fall Brasilien sehr augenfällig wird, den heutigen Gesellschaften extreme soziale und politische Ungleichheit sowie einen sehr gewaltsamen Charakter der gesellschaftlichen Verhältnisse (siehe Gorender 2000: Kap. VII & VIII). Die früheren Grenzen zwischen „Freien“ und „Unfreien“ wirken heute subtiler als Grenzen ethnischer Ungleichheit fort. Ein etwas anderes Modell stellte die britische Kolonisierung in Nordamerika im 17. Jahrhundert dar. In Großbritannien war die Herausbildung bürgerlicher Verhältnisse weiter vorangeschritten als in Spanien oder Portugal, so dass auch der Kolonialstaat einen stärker bürgerlich-kapitalistischen Einschlag hatte. Formen unfreier Arbeit – von relativ milder Ausprägung bei Weißen bis hin zu völliger Rechtlosigkeit bei schwarzen SklavInnen – kamen auch hier zum Einsatz (Ringer 1983: Kap. 2 & 3). Auch hier wirkte die Sklaverei lange in Form juristischer Ungleichheit und bis heute in sozialer Diskriminierung fort. Bürgerlicher Staat und territoriale Homogenisierung Von der Kolonisierung gingen neue Impulse für den internationalen Handel aus. Bei den beiden zunächst führenden Kolonialmächten – Spanien und Portugal – führte der Ressourcenzufluss allerdings zunächst nicht zu einer kapitalistischen Transformation, sondern zu einer Festigung der absolutistischen Ordnung. In Nordwesteuropa hingegen verbanden sich Ausweitung des internationalen Handels und langsame Zersetzung der spätfeudalen Ordnung. Kapital sickerte aus Handel und Finanzwesen allmählich in die Produktion ein. Damit gewannen Formen formal „freier“ Arbeit an Bedeutung. Die Arbeitskräfte waren in doppelter Hinsicht frei – frei von feudalen Abhängigkeiten und frei von Subsistenzmitteln. Die Bedingungen für die Verbreitung der Lohnarbeit wurden politisch-rechtlich durch den Staat geschaffen. Sowohl die Befreiung von feudalen Fesseln wie auch die Trennung der künftigen ProletarierInnen von den Subsistenzmitteln wurden über staatliche Politik hergestellt. Der sich transformierende Staat sorgte auch künftig dafür, dass auf der einen Seite Eigentumsrechte für eine Minderheit festgeschrieben wurden und andererseits für die Mehrheit von der Eigentumslosigkeit bei Produktionsmitteln der stumme Zwang zur Lohnarbeit ausging. Die Trennung der ArbeiterInnen von den Produktionsmitteln muss allerdings als ein langfristiger Prozess angesehen werden, in dem freie Lohnarbeit mit anderen Formen von Arbeit koexistierte bzw. in den Haushalten spezifische Verbindungen freier und unfreier, bezahlter und unbezahlter Arbeit hervorbrachte (Komlosy u.a. 1997; Wallerstein 1984). Teilweise war der Verlust von Subsistenzmitteln, vor allem Boden, zwar nicht vollständig, aber doch so stark, dass es einen Zwang zur Aufnahme von Lohnarbeit gab. Konnten die LohnarbeiterInnen ihren Unterhalt zum Teil mit eigenen Subsistenzmitteln bestreiten, so brauchte der Lohn nicht die gesamten Lebenshaltungskosten zu decken. Dies erlaubte es der Kapitalseite, die Löhne niedrig zu halten. Zumindest für einen Teil der Branchenkapitale war eine solche Konstellation durchaus einträglich. In Westeuropa erfolgte die weitgehende Trennung der Arbeiterschaft von den Subsistenzmitteln im Verlaufe des 19. Jahrhunderts, abgeschlossen wurde dieser Prozess aber meist erst im 20. Jahrhundert. Die Mobilisierung von Arbeitskräften erfolgte nicht al- 38 Joachim Becker – Andrea Komlosy lein im nationalstaatlichen Rahmen, sondern – abhängig von der jeweiligen Konjunktur – auch über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus. Im Rahmen einer ungleichen Arbeitsteilung wurden bestimmte Regionen faktisch Arbeitskräftereservoire. Die zwischen- und die innerstaatliche Migration wurde einerseits von der Stellung der Regionen in der ungleichen überregionalen Arbeitsteilung, der Möglichkeit der Menschen, in ihren Heimatregionen Arbeit und Einkommen zu finden, sowie der Nachfragesituation auf den Arbeitsmärkten bestimmt. Andererseits unterlag sie staatlicher Regulierung durch Einwanderungs- und Auswanderungsgesetze, Pass- und Aufenthaltsbestimmungen (Komlosy 2003). Die Herausbildung nationaler Binnenmärkte basierte auf einem – immer wieder konfliktträchtigen – Kompromiss zwischen der staatlichen Zentralmacht, den adeligen Grundbesitzern und der Waren produzierenden Bourgeoisie. Eine wesentliche Rolle in diesem Kompromiss spielte die flächenhafte Ausgestaltung des staatlichen Territoriums. Im Gegenzug für die Anerkennung staatlicher Zugriffsrechte auf Untertanen und Steuerkraft unterstützte der Staat die Möglichkeit zur Kapitalakkumulation. Er setzte mit zahlreichen Reformen die vorindustriellen Regelwerke außer Kraft, die lokale Marktorte und regionale Produzenten gegenüber der überregionalen Konkurrenz begünstigten. Dies erlaubte Industriellen und Agrarunternehmern, die auf überregionale Märkte ausgerichtet waren, wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg. Deren Verbindung mit der Staatsmacht führte dazu, dass sich staatlicher Raum und wirtschaftliche Aktivität zunehmend deckten. An die Stelle der mittelalterlichen Städtenetzwerke und Großhandelsverbindungen traten im Laufe des 16. bis 19. Jahrhunderts flächenhaft verfasste Nationalökonomien. Dabei rückten Binnenzölle und Mauten vom Landesinneren an die Außengrenzen der Staaten. Im Gegensatz zum Staat hatten Industrielle prinzipiell die Möglichkeit, über Staatsgrenzen hinaus zu agieren; beim Bezug von Rohmaterialien, beim Zukauf von Vorleistungen und beim Warenabsatz war dies oft unerlässlich und wurde im Sinne der merkantilistischen Philosophie auch staatlich gefördert. Widersprüchliche Ansichten bestanden in der Frage, ob der staatliche Eingriff durch koloniale Besitzungen formal ausgeweitet werden sollte oder ob der Zugriff auf periphere Märkte und Arbeitskräfte besser ohne Kolonisierung zu bewerkstelligen sei. Während bis ins 18. Jahrhundert formelle Kolonisierung selektiv erfolgte und im Wesentlichen auf Amerika und Südostasien beschränkt blieb, eröffnete die Staatenkonkurrenz um Rohstoff- und Absatzmärkte im 18. und 19. Jahrhundert einen Wettlauf um Kolonien (Rothermund 2003). Die Grenze zwischen Mutterland und Kolonie wurde durch die direkte Herrschaft jedoch niemals aufgehoben – weder was die wirtschaftliche Rolle, die Rechtsnormen noch was den Zutritt von kolonialen Waren und Untertanen zur Metropole anlangte. Insofern umfasste die Herausbildung der Nationalökonomien nur die Mutterland-Territorien. Diese unterlagen nicht nur in Bezug auf Wirtschaftsaufbau und Infrastrukturerschließung, sondern – mit gewisser zeitlicher Verzögerung – auch in Bezug auf die Rekrutierung der Arbeitskräfte einer nationalstaatlichen Territorialisierung. Menschen wurden im Zuge der Trennung von ihren Subsistenzmitteln sukzessive aus der örtlichen Bindung an den Grundherrn befreit und ermächtigt, Arbeit an anderen Orten anzunehmen (Komlosy 2003:77ff). Gleichzeitig wurde diese Mobilisierung durch Auswanderungsrestriktionen unterschiedlicher Art in die Grenzen des Staates verwiesen; diese Grenzen und Räume – Formen und Wandel 39 Restriktionen bezogen sich entweder nur auf Fachkräfte, wie in Großbritannien, oder betrafen die gesamte Bevölkerung, wie in der Habsburgermonarchie, wo bis 1867 ein generelles Auswanderungsverbot herrschte (Komlosy 2003:154). In vielen Staaten wurde auch die innere Migration mit Hilfe von Pass-, Reise- und Aufenthaltsgesetzen, die auf verschiedenen räumlichen Ebenen wirksam waren, kanalisiert. Diese brachten den staatlichen Anspruch auf das Monopol auf Ermächtigung, Selektion und Kontrolle von Wanderungen zum Ausdruck. Wanderungen sollten nicht verhindert werden, sondern den Anforderungen der Wirtschaft nach verfügbaren und disziplinierten Arbeitskräften angepasst werden. Reisen, die diesem Anspruch nicht entsprachen, wurden erschwert und zurückgedrängt – unabhängig davon, ob sie adelige Kavalierstouren, fahrende Berufe oder Bettler betrafen. Die Einwanderung wurde in der Regel liberaler als die Auswanderung gehandhabt; Einwanderungsrestriktionen wurden erst eingezogen, wenn die Einwanderung in Konflikt mit dem internen Arbeitskräfteangebot geriet. Dies war im Wesentlichen erst um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und verstärkt nach dem Ersten Weltkrieg der Fall. Das 19. Jahrhundert hingegen kannte nur wenige Freizügigkeitsbeschränkungen zwischen den europäischen Industriestaaten sowie den Destinationen in Übersee (Fahrmeir/Faron/Weil 2003). Die europäischen Grenzen konnten freilich nur deshalb so weitgehend offen gelassen werden, weil die Überseemigration, insbesondere in die USA, ein Ventil für die europäischen Arbeitsmärkte darstellte. Die Gleichzeitigkeit von innerund zwischenstaatlichen Ein- und Auswanderungen ermöglichte so eine Anpassung der europäischen Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur an die Erfordernisse der modernen Industriegesellschaft. Nach einer Periode intensiver Arbeitskräftemobilität innerhalb und zwischen den Staaten, die ihren Höhepunkt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erreichte, waren Arbeitsmärkte und nationale Wirtschaftsräume in der Zwischenkriegszeit weitgehend deckungsgleich geworden. Die Ausbreitung der Warenform, speziell in die Sphäre der Arbeitskraft, machte auch die Ausweitung der Rechtsform erforderlich (Paschukanis 1970). Die sozialen Verhältnisse wurden seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zunehmend verrechtlicht. Formalrechtlich wurden so einheitliche Regeln geschaffen, die sich allerdings auf materiell ungleiche Verhältnisse bezogen und diese auch festigten. Das aufstrebende Bürgertum suchte direkten Einfluss auf Rechtsgebung und Politik zu gewinnen. Damit gewannen politische Rechte, insbesondere das Wahlrecht, sowie die Kompetenzen des Parlaments an Bedeutung. Relativ bald versuchte das Bürgertum die politischen Rechte an ein bestimmtes Mindesteigentum zu binden. Dies implizierte einen doppelten Ausschluss: der ArbeiterInnenschaft und der Frauen (siehe Eley 1996:307ff; Rossi-Doria 1996:9ff; Sauer 2001:147ff). Arbeiter- und Frauenbewegung kämpften hingegen – teils getrennt, manchmal vereint – für eine Ausweitung der politischen Rechte. Das allgemeine und gleiche Männerwahlrecht wurde im Regelfall vor dem Frauenwahlrecht durchgesetzt (Juráňová 2002). In der Zivilgesellschaft – also den widerstreitenden politischen, sozialen und religiösen Interessengruppen (Gramsci 1996:1502) – und in den staatlichen Institutionen wurde dann auch um die Ausgestaltung sozialer Rechte gerungen. Hierbei ging und geht es nicht zuletzt auch darum, wer an einem bestimmten Ort soziale Rechte wahrnehmen konnte und darum, ob diese beispielsweise an die Staatsbürgerschaft, an das Heimatrecht in einer Gemeinde oder an das Arbeitsverhältnis gebunden waren. Dies 40 Joachim Becker – Andrea Komlosy bedeutet unterschiedliche Ausprägungen des Ein- und Ausschlusses von bestimmten Rechten. Insgesamt war die Durchsetzung der bürgerlichen Staatlichkeit mit einer vereinheitlichenden rechtlichen Normierung innerhalb staatlicher Grenzen und damit auch einer Homogenisierung der jeweiligen Räume verbunden. Aber auch der staatliche Verwaltungsapparat wurde vereinheitlicht und rationalisiert. Allerdings waren und sind die Grenzziehungen zwischen den Nationalstaaten, die Kompetenzaufteilungen zwischen subnationalen, nationalen und übernationalen Entscheidungsinstanzen nicht für alle Male fix, sondern – speziell in Krisensituationen – Gegenstand politischer Konflikte. Denn Raum- und damit Grenzfragen sind immer auch Machtfragen. Soziale und politische Akteure sind in verschiedenen Räumen unterschiedlich artikulations- und durchsetzungsfähig; entsprechend agieren sie politisch. So war Ende des 19. Jahrhunderts für das Bündnis von Industrie und Großgrundbesitz im Deutschen Reich bei ihrer Strategie der konservativen Modernisierung die preußische Machtbasis besonders wichtig. Daher privilegierten sie eine starke Stellung der Länder, speziell Preußens, im Deutschen Reich (siehe Nipperdey 1998:108f). Im neu gegründeten Nationalstaat Italien hingegen fürchteten die Kräfte der konservativen Modernisierung lokal basierte Widerstände und favorisierten daher einen zentralisierten Staat (siehe Banti 1996:21f). Mithin hängen die Machtstrategien von der jeweiligen Machtkonstellation ab. Auch die Privilegierung der internationalen Regulierung durch die Kapitalseite in den letzten drei Jahrzehnten ist Ausdruck von Machtstrategien. Denn die Kapitalseite ist international aktionsfähiger als andere soziale Klassen und verspricht sich daher Vorteile von der internationalen Festschreibung bestimmter Normen. Gleichzeitig ist die Kapitalseite strukturell relativ mobil und produziert häufig so, dass die einzelnen Schritte des Produktionsprozesses in unterschiedlichen Regionen bzw. Staaten angesiedelt sind (Wallerstein 1984:23ff). Sie war historisch daher oft an einem Grenzregime interessiert, das grenzüberschreitenden Kapitalbewegungen geringe Hürden in den Weg legt. Dies ermöglicht es dem Kapital auch, sich politischen Kompromissen durch Kapitalflucht zu entziehen (Becker 1996; Becker 2002:281f). Umgekehrt forderten bestimmte Kapitalfraktionen immer wieder protektionistische Maßnahmen zum Schutz der nationalen Märkte. Für die ökonomische Homogenisierung war das Vermittlungsmedium des Geldes von besonderer Bedeutung. In kapitalistischen Gesellschaftsformationen geht es um die Akkumulation von Kapital, also die Spirale Geld – Ware – (mehr) Geld. Damit gewann das Geld als ein allgemeines Wertäquivalent, das verschiedene Privatarbeiten in Raum und Zeit verbindet, zunehmend an Relevanz. In der zeitlichen Dimension stellen Inflation und Deflation Probleme dar, in der räumlichen Dimension ist der Tausch von einer Währung in die andere eine Hürde. Auch Währungsgrenzen sind fundamentale Grenzen. Bestehen innerhalb eines politischen Territoriums Währungsgrenzen, ist der Akkumulationsprozess fragmentiert und es besteht die Unsicherheit des Wechselkurses. Eine Vereinheitlichung des Währungsgebietes dagegen reduziert Unsicherheit. Wird abhängige Arbeitsleistung entlohnt, bedeutet dies eine Eingliederung der Arbeitskräfte in die Geldkreisläufe. Auch dies machte letztlich eine Aufgabe sozial geschichteter Spezialwährungen zugunsten territorial vereinheitlichter Geldnormen erforderlich. Die Durchsetzung einer territorial vereinheitlichten Währung ermöglichte über Beschränkungen der Konvertibilität bzw. die Manipulation der Paritäten auch den Schutz der jeweiligen Grenzen und Räume – Formen und Wandel 41 territorialen Ökonomie. Und auch fiskalische Erwägungen sprachen für die Etablierung territorialer (meist zentralstaatlicher) Währungen, wie sie im 19. Jahrhundert, teils aber auch erst gegen Anfang des 20. Jahrhunderts erfolgte (Helleiner 2003). Die nationale Währung wurde zum Symbol nationaler Vereinheitlichung, manchmal sogar der nationalen Sinnstiftung. Zu denken wäre hier an die D-Mark als Symbol des bundesdeutschen Wirtschaftswunders und damit der BRD-Identität (siehe Pointon 1998; Lohoff 1998:6). Auch Währungsgrenzen sind veränderbar. Dies gilt nicht allein im Hinblick auf das monetäre Grenzregime – also Regeln der Konvertibilität und des Wechselkursregimes –, sondern auch im Hinblick auf die geographische Grenzziehung. Die Konvertibilität – also Tauschbarkeit – von Währungen kann politisch beschränkt werden, was speziell in Krisenphasen historisch auch immer wieder der Fall war. Aber auch das Wechselkursregime – fixe oder mehr oder weniger „frei“ schwankende Wechselkurse – stellt mit dem damit verbundenen Maß an Unsicherheit der Wechselkursentwicklung eine monetäre Grenze dar. Veränderungen der geographischen Geld-Grenzziehungen hat es ebenfalls wiederholt gegeben. Der wohl weitreichendste Fall der jüngsten Vergangenheit ist die Schaffung einer europäischen Währung, die mit der aktuellen Herausbildung einer europäischen Staatlichkeit einhergeht. In diesem Fall können wir von der Schaffung eines neuen Währungsterritoriums sprechen. Im Fall eines schleichenden Vertrauensverlustes in die nationalen Währungen oder von offenen Finanzkrisen kann es aber auch zur Durchlöcherung des monetären Territoriums kommen. Einerseits können lokale oder regionale Währungen von unten entstehen (beispielsweise zur Schaffung von Liquidität im Fall einer Deflation; siehe Schuldt 1997), andererseits kann es sein, dass die nationale Währung durch eine wertbeständigere ausländische Währung verdrängt wird (Fiori 1999). Die (teilweise) Ersetzung der einheimischen durch eine ausländische Währung impliziert auch den weitgehenden Verlust nicht nur monetärer, sondern auch allgemeiner politischer Autonomie. Die Normierung war aber nicht auf Rechts- und Geldnormen beschränkt. Arbeitsdisziplin, der Umgang mit Gesetzen, allgemein die Akzeptanz der bürgerlichen Gesellschaftsordnung sollten auch verinnerlicht werden. Auch hierbei spielten staatliche Institutionen wie Schulen, Behörden und Militär eine Rolle. Gerade diesen Institutionen stellte sich auch die Frage nach der zu verwendenden Sprache. Im Fall einer bereits relativ vereinheitlichten Sprachnorm war das für den bürgerlichen Staat keine sehr explosive Frage, anders stellte sich die Sache im Falle eines mehrsprachlichen Staates dar. Denn dann waren mit der Festschreibung der Amtssprache(n) manifeste Vorteile für die jeweilige(n) Sprachgruppe(n) verbunden, wurde die Sprache potenziell zum Medium einer politischen Vereinheitlichung innerhalb der Sprachgruppe – und zum Definitionsmerkmal der Abgrenzung innerhalb des staatlichen Territoriums und damit der potenziellen Abspaltung. Als solche spielte sie als Legitimation der Abspaltung neuer Nationalstaaten von den multiethnischen Staaten Zentral- und Osteuropas eine Rolle (Gellner 2003: Kap.7). Im Gegensatz zum westeuropäischen Regelfall eines durch hohen Assimilationsdruck bewerkstelligten Staatsnationalismus nahm in Zentral- und Osteuropa die nationale Bewegung die Form eines Sprach- oder Kulturnationalismus an (Hobsbawm 1991). Im Fall Deutschlands und Italiens strebte sie die Vereinigung von Kleinstaaten an, während es im Fall der Reiche Zentral- und Osteuropas um Autonomie oder im Fall der Radikalisierung der nationalen Bewegungen um die Abspaltung von Nationalstaa- 42 Joachim Becker – Andrea Komlosy ten ging. In den multiethnischen Reichen wurden innere Sprachgrenzen von der nationalen Bewegung politisiert, auf die realen Grenzziehungen nach ihrem Zerfall hatten aber die militärischen und diplomatischen Kräfteverhältnisse – nicht nur vor Ort, sondern auch zwischen den jeweiligen Verbündeten – maßgeblichen Einfluss (siehe Schultz 2002:113). Die Auflösung multiethnischer Staaten, Grenzverschiebungen bzw. „nachholende“ sprachliche Homogenisierung waren vielfach auch mit Vertreibungen und „Bevölkerungsaustausch“, wie es zuweilen euphemistisch hieß, verbunden. „Ethnische Säuberungen“ sowie geregelte Bevölkerungstransfers erfolgten vor allem während oder unmittelbar nach Bürger- oder zwischenstaatlichen Kriegen (z.B. Haas 1995; Naimark 2001). Ethnische oder religiöse Gruppen – speziell Sinti und Roma bzw. Juden – wurden in bestimmten Perioden auch intern systematisch ausgegrenzt. Diese Ausgrenzung erfolgte auf Grundlage von Rechtsnormen und systematisierten Identitätszuschreibungen, die aber auch Ausnahmeregelungen und Assimilation zuließen. Das faschistische Deutschland radikalisierte die Ausgrenzungspolitik bis hin zum bürokratisch akribisch organisierten Völkermord an Juden sowie Sinti und Roma (Bauman 2002). Kolonialer Staat und koloniale Grenzen In Asien, Afrika und den Amerikas folgte die endogene Entwicklung politischer Herrschaft nicht dem europäischen Modell. Vielmehr gab es sehr unterschiedliche Formen politischer Herrschaft – von äußerst geringer Zentralisierung politischer Macht bis hin zur Staatsbildung mit zentralen Herrschaftsorganisationen wie Bürokratie und Militär. Als autonome Formen politischer Herrschaft wurden diese meist zerschlagen, nur wenigen Staaten wie Japan oder China gelang es zumindest, die formelle politische Unabhängigkeit zu bewahren. Aber auch sie sahen sich durch den äußeren Druck zu starken Veränderungen in Wirtschaft, Politik und Grenzregime gezwungen. Über die Kolonialpolitik wurde ausgehend vom europäischen Ursprungsraum das Grundmodell territorialer Staatlichkeit und damit verbundener Grenzlinien auch anderen Weltregionen aufgenötigt. Kam internationaler Handel noch ohne koloniale Landnahme aus, so erforderte die kapitalistische Inwertsetzung neuer Regionen deren militärische Besetzung und politische Unterwerfung. Kapitalistische Ausbeutung bedurfte der Aneignung der Ressourcen durch die kolonialen Interessen und der juristischen Festschreibung der Eigentumsrechte. Auch die Arbeitskräfte mussten zugunsten der kolonialen Unternehmungen mobilisiert werden. Bei der Mobilisierung der Arbeitskräfte wurde auf zwei Grundmodelle zurückgegriffen. In einem Modell wurde die Ursprungsbevölkerung im Rahmen der kolonialen Eroberung so stark dezimiert, dass Arbeitskräfte von außen rekrutiert werden mussten. Dies war das Grundmodell vieler Siedlerkolonien – speziell in Nordamerika, Australien und Teilen Lateinamerikas. Bei den von außen ins Land gebrachten Arbeitskräften sind „freie“ Siedler – selbstständige Siedler und LohnarbeiterInnen – einerseits und „unfreie“ Arbeitskräfte, im Fall der Amerikas aus Afrika verschleppte SklavInnen sowie in unterschiedlicher Weise zwangsverpflichtete MigrantInnen aus Europa und Asien andererseits zu unterscheiden (Hoerder 2002). In Nordamerika erfolgte ein Großteil der Immigration von LohnarbeiterInnen allerdings erst nach der politischen Unabhängigkeit im Gefolge der Industrialisierung. In Lateinamerika immigrierte der Großteil von LohnarbeiterInnen nach dem Agrarexportboom in den La-Plata-Staaten und Brasilien gegen Ende des 19. und zu Grenzen und Räume – Formen und Wandel 43 Beginn des 20. Jahrhunderts. Die „freien“ Siedler erhielten relativ bald die üblichen Bürgerrechte, während die Nachfahren der „SklavInnen“ sich politischen und sozialen Diskriminierungen ausgesetzt sahen und sehen. Insofern wirkt die frühere Grenze zwischen „frei“ und „unfrei“ als innere gesellschaftliche Grenze bis heute fort. Im zweiten Grundmodell wurden vor allem einheimische Arbeitskräfte rekrutiert. Dies wurde teils durch mittelbaren Zwang – Erhebung kolonialer Steuern und/oder Enteignung von Grund und Boden –, teils durch unmittelbare Zwangsarbeit bewerkstelligt. Dieser Prozess der abhängigen „ursprünglichen Akkumulation“ wurde von der Metropole und ihrem kolonialstaatlichen Ableger zugunsten externer kolonialer Interessen in Gang gesetzt. Hierbei konkurrierten Staaten des Zentrums um die koloniale Landnahme. Grenzziehungen erfolgten entsprechend den militärischen und diplomatischen Kräfteverhältnissen. Beim Abstecken der Grenzen war den Kolonisatoren das neu abgegrenzte Territorium oft kaum bekannt (Weiss/Mayer 1984:140). Die materiellen Erwartungen der Kolonisatoren erfüllten sich in vielen Fällen nicht. Die kolonialen Ökonomien wurden auf die jeweilige Metropole ausgerichtet. Es entstanden kapitalistische Enklaven, die Trennung der Arbeitskräfte von den Subsistenzmitteln war jedoch nicht vollständig. Den (männlichen) Lohnarbeitern wurde meist nur ein Lohn ausgezahlt, der für den Unterhalt ihrer eigenen Person ausreichte. Frauen, Kinder und Alte sollten sich über die Subsistenzproduktion durchbringen (Komlosy u.a. 1997; Wallerstein 1984:18ff). Das heißt, die Ökonomien wurden oft nicht völlig durchkapitalisiert, sondern mehrere Produktionsweisen waren miteinander verbunden. Auf diese Art und Weise erlangte das Kapital Zugriff auf deformierte traditionelle oder informelle Sektoren und ihre ProduzentInnen, die mit ihrer un- oder unterbezahlten Arbeit die Lohnarbeitskräfte mitversorgten und im Fall von Krankheit, Arbeitsplatzverlust oder Alter unterstützten. Dieser Werttransfer hält die Lohnkosten im formellen Teil der Peripherie-Ökonomien vergleichsweise gering, die Existenz großer Teile der Bevölkerung, die nicht (direkt) von Lohnarbeit leben, schafft eine „Reservearmee“, die verbrauchte Arbeitskräfte im modernen Sektor jederzeit durch neue ersetzen kann (Komlosy 2002:50). Besonders radikal waren die Enteignungen im Fall von Siedlerkolonien. Über diese wurde den Kolonisierten nicht nur die materielle Existenzgrundlage beschränkt oder genommen, sondern sie wurden aus Gründen der politischen Kontrolle auch in ihrem Siedlungsgebiet und in ihrer Mobilität stark eingeschränkt. Dies gilt gerade auch für jene Siedlerkolonien, in denen die ursprüngliche Bevölkerung weiterhin die Mehrheit (oder doch eine große Minderheit) stellte. Im Fall der Siedlerkolonien des südlichen Afrika wurden die Kolonisierten vom jeweiligen siedlerkolonialen Staat in städtischen Townships und ländlichen Homelands, Tribal Trust Lands etc. zusammengepfercht und einer strikten Kontrolle ihrer Mobilität unterworfen (Wolpe 1976). Im Fall Israels gilt die politische Segregation zwar nicht für das eigentliche Staatsgebiet, wohl aber für die besetzten Gebiete (siehe den Beitrag von Waltz). Die Zuordnung zu den Kolonisierten erfolgte aufgrund strikter Klassifikationen. Teils wurden die Kolonisierten auch noch bestimmten ethnischen Gruppen mit entsprechenden Wohngebieten zugeordnet und damit ihre „Identität“ fixiert. Siedlerkolonien zeichneten sich durch besonders rigide innere Grenzziehungen und räumliche Segregation aus. Die Kolonialmächte nahmen eine juristische Trennung zwischen kolonialem Untertan und kolonisierendem Staatsbürger vor. Die Kolonisierten waren einerseits dem 44 Joachim Becker – Andrea Komlosy Kolonialrecht, andererseits oft dem so genannten „Gewohnheitsrecht“ unterworfen. Der Kolonialstaat band oftmals lokale Gruppen über die indirect rule in die Herrschaftsausübung ein, in besonders perfektionierter Weise im britischen Fall (Mamdani 1996). Teils wurden für eine anpassungs- und aufstiegswillige Minderheit der Kolonisierten, die so genannten „Evolués“, Sonderrechte eingeführt. Es galten in den Kolonien also keine vereinheitlichten juristischen (und politischen) Normen, sondern Doppelstandards. Disziplinierung erfolgte nicht allein über Gewalt und Repression, sondern auch über Schule und Missionierung. Meist erfolgte die „zivilisatorische“ Mission in einer Fremdsprache. Aufstieg in der Kolonialgesellschaft war an die Kenntnis der kolonialen Amtssprache gebunden. Vielfach waren die Aufstiegsmöglichkeiten zudem von ethnischen Zuschreibungen abhängig. So galten beispielsweise in der kolonialen Stereotypenbildung bestimmte Ethnien als besonders gefügig oder „intelligent“ und wurden daher bei der Stellenvergabe durch private Unternehmen oder kolonialstaatliche Stellen bevorzugt. So schreibt Anderson (1988:129) im Hinblick auf die französische Praxis in Indochina: „Die Franzosen hielten mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg, dass die Vietnamesen trotz ihrer Unzuverlässigkeit und Habgierigkeit entschieden strebsamer und intelligenter als die ‚kindlichen‘ Khmer und Laoten seien. Dementsprechend setzten sie vietnamesische Funktionäre sehr oft im westlichen Indochina ein.“ Auch im kulturellen Bereich kann letztlich nicht von einer einheitlichen Normierung gesprochen werden. Bestimmte Sprach- und Verhaltensnormen mussten allerdings für einen – begrenzt möglichen – Aufstieg im kolonialen Staatsapparat erfüllt werden. Die Bildungsnormen waren dem europäischen Beispiel entlehnt, „das Bildungssystem war nicht auf Afrika, sondern auf Europa ausgerichtet. Schulbücher wurden in den Hauptstädten der Metropolen verfasst und veröffentlicht; die Studenten legten ihre Examina an den Universitäten der metropolitanen Universitäten ab.“ (First 1970:66) Außenorientiert war auch die Geldnorm. Die Kolonialmächte verdrängten die lokalen Währungen und ersetzten sie durch koloniale Währungen mit territorialer Gültigkeit. Insofern kam es zwar zur Vereinheitlichung der Geldnorm, doch war diese auf den Bedarf der Metropole zugeschnitten. Sie ermöglichte im Gegensatz zu den nationalen Währungen der Zentrumsstaaten auch keinen Außenschutz. Vielmehr sicherte die koloniale Geldverfassung ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse ab (Byé/de Bernis 1987: 842ff; Helleiner 2003: Kap. 8). Zusammenfassend können wir festhalten, dass die Durchkapitalisierung und Durchstaatlichung der kolonialen Gesellschaften schwächer ausgeprägt war als in den Zentrumsstaaten. Die formale Normierung war weniger einheitlich als in den Metropolen, trotzdem wurde eine neue Form der Räumlichkeit und der inneren wie äußeren Grenzziehung durch die Kolonialmetropolen durchgesetzt. Postkoloniale Kontinuitäten Die antikolonialen Bewegungen bezogen sich oft auf das Uneingelöste der bürgerlichdemokratischen Losung „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“. Auch wenn kontinentale Freiheitsutopien eines Bolivarismus, eines Pan-Afrikanismus oder Pan-Arabismus entworfen wurden, orientierten sich die antikolonialen Bewegungen sowohl im frühen 19. (Lateinamerika) wie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Asien und Afrika) real mehrheitlich an einer Unabhängigkeit im kolonial vorgeprägten territorialen Rahmen Grenzen und Räume – Formen und Wandel 45 (siehe Kaplan 1991; Anderson 1988: Kap. 6; Davidson 1964:58ff; Davidson 1992). „Die Verknüpfung der jeweiligen Ausbildungs- und Verwaltungsfahrten lieferte“, so Anderson (1988:140), „die räumliche Grundlage für neue ‚vorgestellte Gemeinschaften‘, in welchen die ‚Eingeborenen‘ dazu gelangten, sich als ‚Staatsbürger‘ zu verstehen. Der Kolonialstaat lud die ‚Eingeborenen‘ in die Schulen und Amtsstuben ein, der Kolonialkapitalismus schloß sie gleichzeitig von den Vorstandszimmern aus; so wurde eine einsame, zweisprachige Intelligenz, die der bodenständigen örtlichen Bourgeoisie nicht verbunden war, in bisher unbekanntem Maß zur frühen Schlüsselfigur des Nationalismus in den Kolonien.“ Das Band der formalen politischen Abhängigkeit wurde mit der Unabhängigkeit zerschnitten, die territoriale Grenze wurde auch zur Staatsgrenze gegenüber der Kolonialmetropole. Doch blieb es meist bei einer starken ökonomischen, politischen und kulturellen Orientierung auf die Metropole (First 1970:50f; Davidson 1992). Selbst in den Fällen, in denen die neue Staatsmacht tatsächlich eine sozio-ökonomische Transformation anstrebte, gingen oft ererbte koloniale Praktiken und Planungen in die neue Staatsroutine ein (z.B. Schiefer 1986). Es erwies sich als äußerst schwierig, die Außenorientierung der Ökonomie abzubauen. Aufgrund der Auslandsverschuldung und der fiskalischen Abhängigkeit nicht nur von Steuern, sondern von „Auslandshilfe“ war der postkoloniale Staat oft im Spagat zwischen inneren und äußeren Legitimierungszwängen gefangen. Die Geldnorm blieb oft stark außengeprägt. Am augenfälligsten ist dies in der Zone CFA zwischen Frankreich und seinen afrikanischen Ex-Kolonien erkennbar. Damit waren die postkolonialen Gesellschaften oft durch eine Außenorientierung und eine nur begrenzte, seit den 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts oft sogar rückläufige Durchstaatlichung der Gesellschaften gekennzeichnet. Gleichzeitig lebten die kolonial ererbten Spannungen zwischen Ethnien oder Religionsgemeinschaften innerhalb der postkolonialen Territorialstaaten fort oder wieder auf, welche die Kolonialmächte gemäß der Devise „stärken, was trennt“ gefördert hatten. Daher ist ihre Territorialstaatlichkeit fragil, die Grenzen zu den Nachbarstaaten sind oft porös, und aufgrund der Abhängigkeiten wollen oder können sie oft auch kein schützendes Grenzregime gegenüber den früheren Kolonialmetropolen aufbauen. Die wirtschaftliche Krise hat zuweilen – vor allem, aber nicht nur im subsaharischen Afrika – zu einer Krise des Staates geführt. Mehrprodukt wird hier nicht mehr privat über die juristisch fixierten Eigentumsverhältnisse abgeschöpft. Der Staat ist auch kaum mehr zur Steuererhebung in der Lage, seine Beschäftigten beziehen nur mehr ein geringes und oft auch unregelmäßig gezahltes Gehalt. Stattdessen bilden sich bewaffnete Gruppen heraus, die sich Mehrprodukt mit unmittelbarer Gewalt aneignen. Gewinnen sie den lokalen Zugriff auf Rohstoffe, klinken sie sich in internationale Handelsnetzwerke ein. Manche dieser militärisch-politischen Gruppen sind grenzüberschreitend aktiv. Dies galt beispielsweise für die Soldateska von Charles Taylor in Liberia, die sich mit der Revolutionary Unity Front (RUF) in Sierra Leone verband. Oft kleiden sich militärische Gruppen in ein ethnisches oder religiöses Gewand. Dies ist aber nicht immer der Fall. Die RUF wurde beispielsweise durch politisch an den Rand gedrängte Intellektuelle gegründet und rekrutierte ihre Kämpfer aus deklassierten, arbeitslosen Jugendlichen (Rozès 2003; Le Billon 2003:154; siehe auch Ruf 2003:24ff). In Extremfällen – wie Somalia, Liberia oder Sierra Leone – ist vom Staat nur die äußere Hülle geblieben. Aber auch staatliche Armeen spielen im Konflikt um Einflusszonen und Ressourcen zuwei- 46 Joachim Becker – Andrea Komlosy len eine Rolle. Einen bezeichnenden Fall stellt der Kongo dar. Hier unterstützten verschiedene Regierungen die Koalition von Laurent-Desiré Kabila beim Sturz des MobutuRegimes und suchten sich im Gegenzug Einflusszonen im Kongo zu sichern. In diesen Zonen bemühten sie sich auch um den – teils vertraglich verbrieften – Zugang zu Rohstoffvorkommen (siehe Braeckman 1999). In diesem Fall ist der Staat stark fragmentiert, seine Territorialität ist stark geschwächt. Es gibt kein staatliches Gewaltmonopol, aber immerhin noch eine politische Instanz, die punktuell Grenzen setzt. Alle diese Konflikte drehen sich im Kern um den Ein- und Ausschluss bei der Nutzung materieller Ressourcen. In dem Maß, in dem die bürokratisch ordnende Hand des Staates schwächer wird, gewinnt die bewaffnete Hand militärischer Gruppen an Bedeutung. Auch die militärisch-politischen Gruppen etablieren Formen der räumlichen Kontrolle, nicht aber formalisierte Normen oder einen entsprechenden Verwaltungsapparat. Ist die Staatsmacht in Gegenden mit geostrategischer Bedeutung oder wichtigen Rohstoffen stark geschwächt, so nutzen dies westliche Regierungen als Vorwand für militärische Interventionen und für die Etablierung einer quasi-kolonialen Kontrolle (Ruf 2003). Zu offiziellen Grenzänderungen haben diese Konflikte bislang kaum geführt, da die Bedeutung der formellen Staatsgrenze in diesen Fällen mehr als relativiert worden ist. Wandel von Räumen und Grenzen Mithin ist deutlich, dass Territorien keine abgeschlossenen Container sind. Sie weisen zwar über bestimmte Normen eine innere Homogenisierung auf, doch werden sie überlagert von (meist asymmetrischen) Interaktionsmustern verschiedener Akteure. Politische Akteure wirken oft nicht nur in einem, sondern in mehreren Territorien. Waren, Kapital und Arbeitskräfte fließen von einem Ort zum anderen, nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen Territorien. So entstehen auch Verflechtungsräume (Becker 2002:242ff; Novy 2001:35ff; vgl. auch Komlosy 1995:394f). Diese Verflechtungsräume können mehr oder weniger territorialen Charakter haben; oft erfolgt die Interaktion in Form von Netzwerken und nimmt keine flächenhafte Gestalt an. In beiden Fällen sind sie durch (innere und äußere) territoriale Grenzen und Grenzregime (Zölle, Kapitalverkehrskontrollen, Pass- und Einwanderungsbestimmungen etc.) konditioniert. Sie nehmen damit eine transnationale Form an, in der nationalstaatliche Grenzen mit den grenzüberschreitenden Bewegungen im Verflechtungsraum koexistieren. Staatliche Politik ist – abgesehen von der Außenpolitik – per definitionem auf das staatliche Territorium begrenzt, während transnationale wirtschaftliche Aktivitäten in ihrer Reichweite nicht auf einen Staat fixiert sind. Dies bedeutet, dass Letztere in der Standortkonkurrenz die Bedingungen einzelner Staaten gegeneinander ausspielen können. Gleichzeitig versichern sie sich aber auch der Unterstützung ihres Herkunftsstaates zur Durchsetzung ihrer Interessen im Ausland und auf internationalen Märkten. Raum, Grenzziehungen und Grenzregime sind weder im Fall der Staaten noch der transnationalen Verflechtungsräume ein für alle Mal fixiert, sondern veränderlich. Gesellschaftliche Akteure suchen Grenzziehungen und Integrationsintensität politisch zu beeinflussen, da dies auf die Machtbeziehungen, ihre wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten Einfluss hat. Die Veränderungen von Machträumen, Grenzlinien und -regimen kann entlang zweier grundlegender Konfliktlinien kapitalistisch geprägter Gesellschaften bewerkstelligt wer- Grenzen und Räume – Formen und Wandel 47 den: der Konkurrenz und dem Klassenkonflikt (Becker 2002: Kap.3.6 und 5.5). Konkurrenz ist dabei nicht allein auf Konkurrenz zwischen Einzelkapitalen beschränkt; auch in anderen sozialen Klassen herrscht Konkurrenz. So konkurrieren beispielsweise Arbeitskräfte um Arbeitsplätze, vor allem solche, die gut bezahlt und sicher sind. Dies hat Auswirkungen auf die Ausgestaltung von Einwanderungsbedingungen, bei der einheimische mit zuwandernden Arbeitskräften konkurrieren. Bei der Konkurrenz wird auch der Staat in Dienst genommen, um die jeweilige Konkurrenzposition zu verbessern. Insofern hat Konkurrenz auch eine politische Komponente. Hierbei organisieren sich Gruppen auch aufgrund bestimmter Merkmale wie Sprach- oder Religionszugehörigkeit. Diese können dann auch als Bezugspunkt für die Formulierung ethnischer oder nationaler Forderungen dienen. Damit gewinnen sie oft einen explizit räumlichen Bezug; beispielsweise dann, wenn Autonomie oder Unabhängigkeit gefordert wird, damit staatliche Einrichtungen der eigenen ethnischen oder nationalen Gruppe besondere Förderung angedeihen lassen können. Tatsächlich haben Grenzregime und der Verlauf von Grenzlinien erhebliche Wirkungen auf die Konkurrenzverhältnisse. So drängen starke Kapitalfraktionen oft auf freien Waren-, Kapital- und Personenverkehr, da sie so ihre Konkurrenzposition in einem weiten Raum ausspielen können. Hingegen wünschen schwächere Kapitalfraktionen oft eher ein restriktives Grenzregime bei Handel (und Kapitalverkehr), da ihnen dieses einen gewissen Schutz vor überlegener Konkurrenz verspricht. Auch beim Personenverkehr favorisieren weniger konkurrenzfähige Kapitalfraktionen – und auch Staaten in schwacher Konkurrenzposition – zuweilen Maßnahmen, die der Abwanderung vor allem der qualifizierten einheimischen Arbeitskräfte ins Ausland entgegenwirken. Es ist kein Zufall, dass erfolgreiche nachholende Industrialisierung oft mit einem protektionistischen Grenzregime verbunden war (Bairoch 2001; Chang 2002). Ähnlich ist die Perspektive etablierter Lohnarbeiter, die auf den jeweiligen nationalen (oder früher auch lokalen) Arbeitsmarkt verwiesen sind. Auch sie wünschen Abschottung nach außen zum Schutz vor Konkurrenz. Sie stärken so auch ihre Verhandlungsposition gegenüber der Kapitalseite. Hier geht es also nicht allein um Konkurrenz, sondern auch um den Klassenkonflikt. Anders ist die Perspektive von Arbeitskräften, die schlechter Bezahlung und hoher Arbeitslosigkeit individuell durch einen Ortswechsel entkommen möchten. Ihnen ist an durchlässigeren Migrationsgrenzen gelegen, zumindest bis sie sich selbst etabliert haben. So haben sie paradoxerweise das gleiche Interesse an offenen Grenzen wie die starken Kapitale der Grenzen, obwohl diese für ihre besondere Form der Ausbeutung als ArbeitsmigrantInnen verantwortlich sind. Eine Veränderung der Grenzziehung kann Konkurrenzverhältnisse verändern. Insoweit nur die Karten neu gemischt werden, es aber nicht zu einer neuen Phase wirtschaftlicher Entwicklung und einer Veränderung der Stellung in der internationalen Arbeitsteilung kommt, könnte man von einer nicht-transformativen Form des Wirtschaftsnationalismus sprechen (Szlajfer 1990:80). Diese ist zu unterscheiden von einer Veränderung der Grenzziehung oder einem Grenzregime, das einer Veränderung der sozioökonomischen Verhältnisse und einer Modifizierung der Position in der internationalen Arbeitsteilung den Weg bereitet. Eine nicht-transformative Form des Wirtschaftsnationalismus war in den Nachfolgestaaten der Habsburgermonarchie zu erkennen. Das Eigentum wurde – beispielsweise über Nostrifizierungen – in die Hände der jetzt dominanten „nationalen“ Gruppe überführt. Aber die Außenabhängigkeit wurde in der Ten- 48 Joachim Becker – Andrea Komlosy denz nur von Wien oder Budapest nach Paris oder London verlagert und eine Transformation der wirtschaftlichen Strukturen unterblieb (siehe Becker/Odman in diesem Band). Ähnlich verhielt es sich im jüngsten Fall der Auflösung Jugoslawiens. Hier versprachen sich die dominanten Gruppen in den jugoslawischen Republiken – zumindest in den reicheren – von einer Abspaltung einen besseren Zugriff auf den Staatsapparat und damit auf den Verlauf der ursprünglichen Akkumulation und die Privatisierung (siehe Barša 1999; Hofbauer in diesem Band). Auch die Entkolonisierung zog nicht notwendigerweise eine Transformation der ökonomischen Strukturen nach sich. Vielfach führte sie nur zu einer (geringfügigen) Verschiebung der Eigentumsverhältnisse und zu einer Besetzung des Verwaltungsapparates mit nationalen Kadern. Räumlichkeit und Grenze haben aber auch Konsequenzen für die Kräfteverhältnisse zwischen Klassen. Auffällig ist, dass historisch eine starke Schwächung des Weltmarktzusammenhanges und beschränkter Kapitalverkehr eine günstige Konjunktur für revolutionäre Veränderungen bzw. progressiven Reformismus geboten haben. So kam es zu ersten sich anti-kapitalistisch verstehenden Revolutionen nach dem Ersten Weltkrieg (Russland) bzw. war eine Wende zu eigenständigeren Entwicklungswegen bzw. einer sozialreformistischen Politik im Gefolge der Krise der 30er-Jahre bzw. nach dem Zweiten Weltkrieg festzustellen. In den unabhängigen Staaten der Dritten Welt konnte mit der großen Krise der 30er-Jahre das außenorientierte Modell nicht fortgesetzt werden. Daher kam es zu einer Neuausrichtung auf den Binnenmarkt, importsubstituierende Industrien wurden mit staatlicher Unterstützung ins Leben gerufen. Der soziale Block an der Macht erfuhr eine Erweiterung um die Industriebourgeoisie und Gruppen des Kleinbürgertums, auch Teile der Arbeiterschaft konnten eine politische Aufwertung und materielle Besserstellung durchsetzen (Feldbauer u.a. 1995). Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde teils durch die innere gesellschaftliche Dynamik (China, Korea, Vietnam, Jugoslawien, mit Abstrichen die Tschechoslowakei), teils durch die sowjetische Politik (in diversen osteuropäischen Staaten) ein staatssozialistisches Modell durchgesetzt, das sich für einige Jahrzehnte auch konsolidieren konnte. Im Kontext der Systemkonkurrenz und der geschwächten Weltmarktbeziehungen kam es auch in Westeuropa zur Etablierung eines stärker binnenmarktorientierten Wirtschaftsmodells und zu einem Ausbau des Sozialstaates. In diesen Konjunkturen wurde eine eigenständigere Politik nicht gleich durch internationalen ökonomischen Druck erstickt. Im Fall einer sozialreformistischen Politik konnte sich die Bourgeoisie sozialen und politischen Kompromissen nicht durch Kapitalflucht entziehen, da wenige Möglichkeiten zur Kapitalanlage im Ausland bestanden und im Gefolge des Krieges und des Nachkriegsaufbaus der Kapitalverkehr strikten Kontrollen unterlag. Damit war ihr die Exit-Option versperrt. Eine annähernde Deckungsgleichheit zwischen politischem Territorium und dem Verflechtungsraum verdichteter Wirtschaftsbeziehungen scheint daher für die Durchsetzung und Stabilisierung progressiver reformistischer Politik günstig (Becker 1996). Aus diesem Begründungszusammenhang rührt auch die gegenwärtige Forderung nach einer De-Globalisierung durch Teile der globalisierungskritischen Bewegung her. Umgekehrt setzen die Kräfte des Kapitals auf einen freien Kapitalverkehr, da ihnen dieser einen größeren Aktionsraum und den Hebel der Kapitalflucht gibt. Auch für die sozialen Rechte der Beschäftigten erweist sich die Deckungsgleichheit von politischem Territorium und dem Einzugsbereich des Arbeitsmarktes als günstige Grenzen und Räume – Formen und Wandel 49 Voraussetzung. Diese wurde allerdings seit den 1960er-Jahren aufgebrochen, als die entwickelten westeuropäischen Industriestaaten und die USA Arbeitskräfte aus meist nahe gelegenen Peripherie-Ökonomien importierten. Diese Initiative ging von jenen Kapitalen aus, die so Lohnkosten senken und die Flexibilität der Beschäftigung erhöhen wollten und stand im Widerspruch mit den Interessen der organisierten Arbeiterbewegung in den Industrieländern, die die „Gastarbeiter“ als Lohndrücker ansahen. Aus der Perspektive der Entsendestaaten spiegelt die – zunächst meist als vorübergehend konzipierte – Abwanderung die Schwächen der nationalen Ökonomie und der politischen Gegensteuerung wider. Den Staaten der Peripherie ging durch die Abwanderung der jungen und dynamischsten Bevölkerungsgruppen Humankapital verloren. Da die Ostblock-Staaten der Arbeitsmigration ihrer Bevölkerung einen politischen Riegel vorschoben, konzentrierte sich die westeuropäische Arbeitskräfterekrutierung auf Südeuropa, Jugoslawien und die Türkei, bis der Zusammenbruch des realen Sozialismus auch die ehemaligen RGW-Staaten als Arbeitsmarkt für die westeuropäischen Zentralräume öffnete. Die Regierungen der GastarbeiterInnen-Exportstaaten bemühten sich vergeblich, über Entsendeverträge Einfluss auf Quoten und Beschäftigungsbedingungen zu erlangen, wurden durch den Nachfragesog aus den westeuropäischen Industrieländern jedoch an den Rand gedrängt; ähnlich stellt sich die Situation zwischen den USA und Mexiko dar (vgl. Imhof in diesem Band). Im Gegensatz zur geforderten Begrenzung der Kapitalmobilität gilt die Arbeitskräftemobilität in Teilen der globalisierungskritischen Bewegung als Indikator persönlicher Freiheit. Hierbei wird allerdings übersehen, dass Einwanderungsquotierung, wie sie verstärkt seit den 1990er-Jahren betrieben wird, Fremdengesetze und fremdenfeindliche Haltung in der Bevölkerung gegenüber ArbeitsmigrantInnen nicht bewirken, dass tatsächlich weniger Einwanderung stattfindet. Vielmehr werden ArbeitsmigrantInnen auf diese Weise in „legal“ und „illegal“ Anwesende unterteilt, die auf unterschiedlichen Segmenten des Arbeitsmarktes eingesetzt werden können. Auch die Kompetenzverteilung zwischen verschiedenen territorialen Ebenen hat Einfluss auf die sozialen Kräfteverhältnisse, denn die politischen Vertretungen unterschiedlicher sozialer Interessen sind auf den verschiedenen räumlichen Ebenen unterschiedlich artikulations- und durchsetzungsfähig. So waren für die Arbeiterbewegung historisch die nationalen Parlamente zur Durchsetzung arbeits- und sozialrechtlicher Forderungen sehr wichtig. Hingegen erweist sich die EU-Ebene mit ihrer Exekutivlastigkeit (extrem starke Stellung der EU-Kommission) für die europäischen Konzerne als besonders viel versprechende Handlungsebene. Bei Veränderungen der Räumlichkeit und damit der Grenzziehungen können sowohl konkurrenz- als auch klassenpolitische Überlegungen eine Rolle spielen. Das sei am Beispiel der aktuellen Europäisierung der Geldpolitik illustriert. Von der Einführung einer europäischen Währung versprachen sich die maßgeblichen politischen Kräfte sowohl eine Stärkung im internationalen Konkurrenzkampf mit dem US-Dollar als auch eine Schwächung progressiver wirtschafts- und sozialpolitischer Impulse in den europäischen Ländern durch die restriktiven Bedingungen des so genannten Stabilitätspaktes, der mit der Einführung des Euro verbunden war. Generell war in den letzten zwei, drei Jahrzehnten sowohl eine Veränderung der Grenzregime als auch der Kompetenzverteilungen zwischen den verschiedenen territo- 50 Joachim Becker – Andrea Komlosy rialen Ebenen festzustellen. ProtagonistInnen dieser Veränderungen waren das transnationale Kapital und die mit ihm liierten politischen Kräfte. Der grenzüberschreitende Kapitalverkehr wurde immer freier, während Arbeitskräftemigration eher restriktiveren Regularien unterworfen wurde. In der Tendenz wurden die Kompetenzen globaler oder regionaler Institutionen mit schwacher demokratischer Legitimierung gestärkt. Über restriktive globale oder regionale Vertragswerke suchten liberale Kräfte Nationalstaaten, aber auch Kommunen auf lange Sicht auf eine liberale Regulierung festzulegen. Sie waren bemüht, diese Politik über vorgebliche Wettbewerbszwänge zu legitimieren. Regionaler oder lokaler Wohlstandschauvinismus war oft das Echo. So will die Lega Nord los vom ärmeren Süditalien, wünschen die katalanischen Nationalisten mehr Autonomie, spaltete sich Slowenien als erste Republik von Jugoslawien ab. Hier geht es um die Loslösung privilegierter Regionen von bisher bestehenden nationalen Ausgleichs- und Solidaritätsverpflichtungen. Die nationalstaatliche Grenze wird – beispielsweise durch die Forderung nach De-Globalisierung – aber auch als Schutz thematisiert. Literatur Adler-Karlsson, Gunnar (1971): Der Fehlschlag. 20 Jahre Wirtschaftskrieg zwischen Ost und West. Frankfurt am Main/Zürich Altvater, Elmar/Mahnkopf, Birgit (1996): Die Grenzen der Globalisierung. Ökonomie, Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. Münster Altvater, Elmar/Mahnkopf, Birgit (2002): Globalisierung der Unsicherheit. Arbeit im Schatten, schmutziges Geld und informelle Politik. Münster Anderson, Benedict (1988): Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts. Frankfurt am Main/New York Anderson, Malcolm (1996): Frontiers. Territory and State Formation in the Modern World. Cambridge Anderson, Perry (1979): Lineages of the Absolutist State. London Bairoch, Paul (2001): Les leçons de l’histoire. In: Commerce internationale et développement soutenable, Hg. Michel Damian/Jean-Christophe Graz. Paris: 57-79 Banti, Alberto M. (1996): Storia della borghesia italiana. L‘ età liberale. Rom Barša, Pavel (1999): Národnostní konflikt a plurální identita. In: Národní stát a etnický konflikt, Hg. Pavel Barša/Maxmilián Strmiska. Brno: 9-172 Bauman, Zygmunt (2002): Dialektik der Ordnung. Modernität und Holocaust. Hamburg Becker, Joachim (1988): Angola, Mosambik und Zimbabwe. Im Visier Südafrikas. Köln Becker, Joachim (1996): Fenster für die Linke. Umbrüche in der Weltwirtschaft und alternative Gesellschaftsprojekte in der (Semi-) Peripherie. In: Kurswechsel, Nr. 2: 8-25 Becker, Joachim (1998): Regionale Integration und Regulation: EU und Mercosur im Vergleich. In: Journal für Entwicklungspolitik 14 (2): 119-138 Becker, Joachim (2002): Akkumulation, Regulation, Territorium. Zur kritischen Rekonstruktion der französischen Regulationstheorie. Marburg Bettelheim, Charles u. a. (1969): Zur Kritik der Sowjetökonomie. Berlin Bohle, Dorothee (2003): Osterweiterung der EU – Neuer Impuls oder Rückschlag für die europäische Integration? In: „Eurokapitalismus“ und globale politische Ökonomie, Hg. Martin Beckmann u. a. Hamburg: 144-168 Boris, Dieter (1992): Ursprünge der europäischen Welteroberung. Heilbronn Bornträger, Ekkehard W. (1999): Border, Ethnicity and National Self-determination. Wien. Grenzen und Räume – Formen und Wandel 51 Bowman, Benjamin (1950): Das Mautwesen des 18. Jahrhunderts im heutigen Niederösterreich (unveröff. Phil. Diss. Wien) Braeckman, Colette (1999): L’enjeu congolais. L’Afrique centrale après Mobutu. Paris Brand, Ulrich u. a. (2000): Global Governance. Alternative zur neoliberalen Globalisierung? Münster Braudel, Fernand (1989): Frankreich 1. Raum und Geschichte. Stuttgart. Byé, Maurice/de Bernis, Gérard Destanne (1987, 5., völlig überarb. Aufl.): Relations économiques internationales. Paris Chang, Ha-Joon (2002): Kicking Away the Ladder. Development Strategy in Historical Perspective. London Chase-Dunn, Christopher (Hg.) (1982): Socialist States in the World-System. Beverly Hills-London-New Delhi Claes/d3e (2003): Las sombras del ALCA. Procesos y realidades en las negociaciones de libre comercio en las Américas. Montevideo Coraggio, José Luis/Deere, Carmen Diana (1987a): La transición difícil. La autodeterminación de los pequeños paises periféricos. Managua Coraggio, José Luis/Deere, Carmen Diana (1987b): Introducción: las condiciones de la transición en los pequeños paises periféricos. In: La transición difícil. La autodeterminación de los pequeños paises periféricos, Hg. José Luis Coraggio/Carmen Diana Deere. Managua: 15-49 Davidson, Basil (1964): Which Way Africa? The Search for a New Society. Harmondsworth Davidson, Basil (1992): The Black Man’s Burden. Africa and the Curse of the Nation-State. New York Dietrich, Wolfgang (1998): Periphere Integration und Frieden im Weltsystem. Ostafrika, Zentralamerika und Südostasien im Vergleich. Wien. Eley, Geoff (1996): Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth Century. In: Habermas and the Public Sphere, Hg. Calhou Craig. Cambridge: 289-339 Fahrmeir, Andreas/Faron, Olivier/Weil Patrick, Hg. (2003): Migration Control in the North Atlantic World. The Evolution of State Practices in Europe and the United States from the French Revolution to the Inter-War Period. New York/Oxford Febvre, Lucien (1988): „Frontière“ – Wort und Bedeutung. In: Das Gewissen des Historikers, Lucien Febvre. Berlin: 27-38 Feldbauer, Peter u. a., Hg. (1995): Industrialisierung. Entwicklungsprozesse in Afrika, Asien und Lateinamerika (= HSK 6). Frankfurt am Main/Wien Fiori, José Luis (1999): Estados, moedas e desenvolvimento. In: Estados e moedas no desenvolvimento das nações, Hg. José Luis Fiori. Petrópolis: 49-85 First, Ruth (1970): The Barrel of a Gun. Political Power in Africa and the Coup d’État. Harmondsworth Frank, Andre Gunder (1992): Economic Ironies in Europe: a world economic interpretation of East-West European politics. In: Europe in the Making. Global and Regional Perspectives. International Social Science Journal 131. Southampton 1992: 41-56 Frank, Andre Gunder (1998): Re-Orient. Global Economy in the Asian Age. Berkeley Gellner, Ernest (2003): Nacionalismus. Brno Gill, Stephen (1995): Theorizing the Interregnum: The Double Movement and Global Politics in the 1990s. In: International Political Economy. Understanding Global Disorder, Hg. Robert W. Cox/Ernest Gellner. London u.a.O.: 65-99 Gorender, Jacob (2000): Brasil em preto & branco. São Paulo Gramsci, Antonio (1996): Gefängnishefte. Bd. 7. Hamburg/Berlin Greverus, Ina (1969): Grenzen und Kontakte. Zur Territorialität des Menschen. In: Kontakte und Grenzen. Probleme der Volks-, Kultur- und Sozialforschung. Festschrift für Gerhard Heilfurth zum 60. Geburtstag, Hg. Hans Friedrich Foltin/Ina Greverus u. a. Göttingen: 11-26 52 Joachim Becker – Andrea Komlosy Guenée, Bernard (1986): Des Limites féodales aux Frontières Politiques. In: Les Lieux de Mémoire II: La Nation, Hg. Pierre Nora. Paris: 11-33 Haas, Hanns (1995): Das Ende der deutsch-tschechischen Symbiose in Südmähren. Muster und Verlauf ethnischer Homogenisierung unter Zwang (1938–1948), In: Kulturen an der Grenze. Waldviertel-Weinviertel-Südböhmen, Hg. Komlosy Andrea/Bu° žek Václav/Svátek František. Wien: 311-322 Haberl, Othmar (1986): Die sowjetische Außenpolitik im Umbruchsjahr 1947. In: Der MarshallPlan und die europäische Linke, Hg. Othmar Haberl/Lutz Niethammer. Frankfurt am Main: 75-98 Halliday, Fred (1984): Frostige Zeiten. Politik im Kalten Krieg der 80er Jahre. Frankfurt am Main Halliday, Fred (1989): From Kabul to Managua. Soviet-American Relations in the 1980s. New York Hassinger, Herbert (1987): Geschichte des Zollwesens, Handels und Verkehrs in den österreichischen Alpenländern vom Spätmittelalter bis in die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, Bd. 1, 1. Stuttgart Heigl, Franz (1978): Ansätze zu einer Theorie der Grenze. Ihre Merkmale und Eigenschaften als Elemente der Raumplanung. Schriftenreihe der österreichischen Gesellschaft für Raumplanung 26. Wien Helleiner, Eric (2003): The Making of Territorial Money. Territorial Currencies in Historical Perspective. Ithaca Hobsbawm, Eric J. (1991): Nations and Nationalism Since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge u.a.O. Hoerder, Dirk (2002): Cultures in Contact. World Migrations in the Second Millennium. London Hofbauer, Hannes (1992): Westwärts. Österreichs Wirtschaft im Wiederaufbau. Wien Hofbauer, Hannes (2003): Osterweiterung. Vom Drang nach Osten zur peripheren EU-Integration. Wien Hofbauer, Hannes/Komlosy, Andrea (2000): Capital Accumulation and Catching-up Industrialization in Eastern Europe. In: Review Fernand Braudel Center XXIII 4: 459-502 Juráňová, Jana (2002): Volebné pravo žien. In: Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky. Bratislava: 102-107 Kaplan, Marcos (1991): Formación del estado nacional en América Latina. Lima Kernic, Franz (1991): Der „Eiserne Vorhang“. Zur Geschichte des Stacheldrahtzaunes zwischen Ost- und Westeuropa. In: Der Truppendienst 6. Wien: 514-522 Komlosy, Andrea (1995): Räume und Grenzen. Zum Wandel von Raum, Politik und Ökonomie vor dem Hintergrund moderner Staatenbildung und weltwirtschaftlicher Globalisierung. In: Zeitgeschichte 11/12. Wien: 385-404 Komlosy, Andrea/Parnreiter, Christof/Stacher, Irene/Zimmermann, Susan (Hg.) (1997): Ungeregelt und unterbezahlt. Der informelle Sektor in der Weltwirtschaft. Frankfurt am Main/Wien Komlosy, Andrea (1999): Der Marshall-Plan und der Eiserne Vorhang. In: 80 Dollar. 50 Jahre ERP und Marshall-Plan in Österreich, Hg. Günter Bischof/Dieter Stiefel. Wien/Frankfurt am Main: 261-296 Komlosy Andrea (2001): Die Grenzen Österreichs zu den Nachbarn im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW). In: Grenzen im Ostblock und ihre Überwindung, Hg. Helga Schultz. Berlin: 37-80 Komlosy, Andrea (2002): Das Werden der „Dritten Welt“. Geschichte der Nord-Süd-Beziehungen. In: Internationale Entwicklung. Eine Einführung in Probleme, Mechanismen und Theorien, Hg. Karin Fischer/Irmtraut Hanak/Christof Parnreiter. Frankfurt am Main: 42-55 Komlosy, Andrea (2003): Grenze und ungleiche regionale Entwicklung. Binnenmarkt und Migration in der Habsburgermonarchie. Wien Grenzen und Räume – Formen und Wandel 53 Le Billon, Philippe (2003): Natürliche Ressourcen und die politische Ökonomie des Krieges. In: Politische Ökonomie der Gewalt. Staatszerfall und die Privatisierung von Gewalt und Krieg, Hg. Werner Ruf. Opladen: 144-164 Lohoff, Ernst (1998): Vom Geld der Gelder. Aufstieg und Fall der Weltwährung Nummer zwei. In: Fünfzig Jahre DM, Hg. LAKS Hessen. Berlin: 6-15 Lunestadt, Geir (1986): Der Marshall-Plan und Osteuropa. In: Der Marshall-Plan und die europäische Linke, Hg. Othmar Haberl/Lutz Niethammer. Frankfurt am Main: 59-74 Mamdani, Mahmood (1996): Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton Medick, Hans (1993): Grenzziehung und die Herstellung des politisch-sozialen Raumes. Zur Begriffsgeschichte und politischen Sozialgeschichte der Grenzen in der Frühen Neuzeit, In: Grenzland. Beiträge zur Geschichte der deutsch-deutschen Grenze, Hg. B. Weisbrod. Hannover: 195-211 Meillassoux, Claude (1986): Die wilden Früchte der Frau. Über häusliche Produktion und kapitalistische Wirtschaft. Frankfurt am Main Menzel, Ulrich (1988): Auswege aus der Abhängigkeit. Die entwicklungspolitische Aktualität Europas. Frankfurt am Main Naimark, Norman M. (2001): Fires of Hatred. Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Cambridge (Mass.)/London Nipperdey, Thomas (1998): Deutsche Geschichte 1866–1918. Bd. II. Machtstaat vor der Demokratie. München Nordman, Daniel (1986): Des limites d’état aux frontières nationales. In: Les lieux de mémoire II: La Nation 2, Hg. Pierre Nora. Paris: 35-61 Novy, Andreas (2001): Brasilien: Die Unordnung der Peripherie. Von der Sklavenhaltergesellschaft zur Diktatur des Geldes. Wien Paschukanis, Eugen (1970, 3. Aufl.): Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. Versuch einer Kritik der juristischen Grundbegriffe. Frankfurt am Main Pirker, Reinhard (2003): Märkte als Regulierungsformen sozialen Lebens. Habilitationsschrift an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wien Pointon, Marcia (1998): Bureau De Non Change. Geldscheine und ihre Konstruktion nationaler Identität. In: Fünfzig Jahre DM, Hg. LAKS Hessen. Berlin: 42-53 Polanyi, Karl (1990, 2. Aufl.): The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen. Frankfurt am Main Prescott, John Robert Victor (1987): Political Frontiers and Boundaries. London Ringer, Benjamin B. (1983): „We the People“ and Others. Duality and America’s Treatment of its Racial Minorities. New York/London Rossi-Doria, Anna (1996): Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia. Firenze Rothermund, Dietmar (2003): Seehandel und Kolonialherrschaft. In: Vom Weltgeist beseelt. Globalgeschichte 1700–1815, Hg. Margarete Grandner/Andrea Komlosy. Wien: 25-44 Rozès, Antoine (2003): Finances des guerres civiles africaines. In: Guerre et économie, Hg. JeanFrançois Daguzan/Pascal Lorot. Paris: 121-143 Ruf, Werner (2003): Einleitung. Politische Ökonomie der Gewalt. Staatszerfall und Privatisierung von Gewalt und Krieg. In: Politische Ökonomie der Gewalt. Staatszerfall und Privatisierung von Gewalt und Krieg, Hg. Werner Ruf. Opladen: 9-47 Rufin Jean-Christophe (1993): Das Reich und die neuen Barbaren. Berlin Sauer, Birgit (2001): Die Asche des Souveräns. Staat und Demokratie in der Geschlechterdebatte. Frankfurt am Main/New York Schiefer, Ulrich (1986): Guiné-Bissau zwischen Weltwirtschaft und Subsistenz. Bonn Schmale, Wolfgang/Stauber, Reinhard, Hg. (1998): Menschen und Grenzen in der frühen Neuzeit (= Innovationen. Bibliothek zur Neueren und Neuesten Geschichte Bd. 2). Berlin 54 Joachim Becker – Andrea Komlosy Schuldt, Jürgen (1997): Dineros alternativos para el desarrollo local. Lima Schultz, Helga (2002): Self-Determination and Economic Interest: Border Drawing after the World Wars. In: National Borders and Economic Disintegration in Modern East Central Europe, Hg. Uwe Müller/Helga Schultz. Berlin: 109-124 Seger, Martin/Beluszky, Pal, Hg. (1993): Bruchlinie Eiserner Vorhang. Regionalentwicklung im österreichisch-ungarischen Grenzraum (Südburgenland/Oststeiermark – Westungarn) (= Studien zu Politik und Verwaltung Bd. 42). Wien/Köln/Graz Senghaas, Dieter (1982): Von Europa lernen. Entwicklungsgeschichtliche Betrachtungen. Frankfurt am Main Siegler, Heinrich, Hg. (1963): Wiedervereinigung und Sicherheit Deutschlands Bd. I (1944–1963). Bonn/Wien/Zürich Strohmeier, Gerhard (1995): Schöpfung, Verklärung, Distanznahme. Zur Wahrnehmung von Natur und Landschaft an der Grenze. In: Kulturen an der Grenze. Waldviertel-Weinviertel-Südböhmen-Südmähren, Hg. Komlosy Andrea/Bu° žek Václav/Svátek František. Wien: 17-34 Szlajfer, Henryk (1990): Economic Nationalism of the Peripheries as a Research Problem. In: Economic Nationalism in East-Central Europe and South America, 1918–1939, Hg. Henryk Szlajfer. Genf Szlajfer, Henryk (Hg.) (1990): Economic Nationalism in East-Central Europe and South America 1918–1939. Genf Szücs, Jenö (1991): Die drei historischen Regionen Europas. Frankfurt am Main Teichová, Alice (1988): Kleinstaaten im Spannungsfeld der Großmächte. Wirtschaft und Politik in Mittel- und Südosteuropa in der Zwischenkriegszeit. Wien Varga, Eva (1999): Technische und mentalitätsgeschichtliche Aspekte des Eisernen Vorhangs an der österreichisch-ungarischen Grenze. In: Grenze im Kopf. Beiträge zur Geschichte der Grenze in Ostmitteleuropa, Hg. Peter Haslinger. Frankfurt am Main: 19-27 Wallerstein, Immanuel (1984): Der historische Kapitalismus. Berlin Wallerstein, Immanuel (1998): Das moderne Weltsystem Bd. 2 – Der Merkantilismus. Europa zwischen 1600 und 1750. Wien Weichhart, Peter (1999): Territorialität, Identität und Grenzerfahrung. In: Grenze im Kopf. Beiträge zur Geschichte der Grenze in Ostmitteleuropa, Hg. Peter Haslinger. Frankfurt am Main: 28-40 Weiss, Ruth/Mayer, Hans (1984): Afrika den Europäern. Von der Berliner Konferenz 1884 zum Afrika der neuen Kolonisation. Wuppertal Wolpe, Harold (1976): Kapitalismus und billige Arbeitskraft in Südafrika: von der Rassentrennung zur Apartheidspolitik. In: Wanderarbeit im Südlichen Afrika. Ein Reader. Francis Wilson u. a. Bonn: 99-141