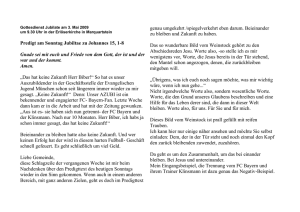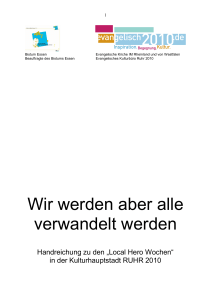Predigt Jubilate
Werbung
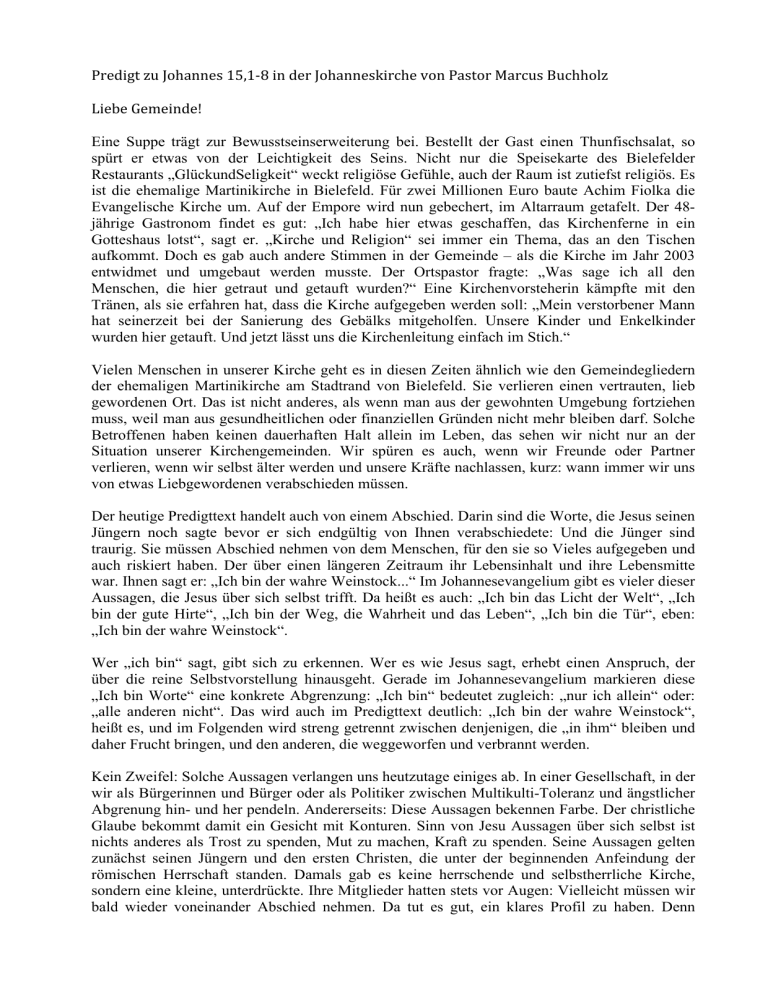
Predigt zu Johannes 15,1‐8 in der Johanneskirche von Pastor Marcus Buchholz Liebe Gemeinde! Eine Suppe trägt zur Bewusstseinserweiterung bei. Bestellt der Gast einen Thunfischsalat, so spürt er etwas von der Leichtigkeit des Seins. Nicht nur die Speisekarte des Bielefelder Restaurants „GlückundSeligkeit“ weckt religiöse Gefühle, auch der Raum ist zutiefst religiös. Es ist die ehemalige Martinikirche in Bielefeld. Für zwei Millionen Euro baute Achim Fiolka die Evangelische Kirche um. Auf der Empore wird nun gebechert, im Altarraum getafelt. Der 48jährige Gastronom findet es gut: „Ich habe hier etwas geschaffen, das Kirchenferne in ein Gotteshaus lotst“, sagt er. „Kirche und Religion“ sei immer ein Thema, das an den Tischen aufkommt. Doch es gab auch andere Stimmen in der Gemeinde – als die Kirche im Jahr 2003 entwidmet und umgebaut werden musste. Der Ortspastor fragte: „Was sage ich all den Menschen, die hier getraut und getauft wurden?“ Eine Kirchenvorsteherin kämpfte mit den Tränen, als sie erfahren hat, dass die Kirche aufgegeben werden soll: „Mein verstorbener Mann hat seinerzeit bei der Sanierung des Gebälks mitgeholfen. Unsere Kinder und Enkelkinder wurden hier getauft. Und jetzt lässt uns die Kirchenleitung einfach im Stich.“ Vielen Menschen in unserer Kirche geht es in diesen Zeiten ähnlich wie den Gemeindegliedern der ehemaligen Martinikirche am Stadtrand von Bielefeld. Sie verlieren einen vertrauten, lieb gewordenen Ort. Das ist nicht anderes, als wenn man aus der gewohnten Umgebung fortziehen muss, weil man aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen nicht mehr bleiben darf. Solche Betroffenen haben keinen dauerhaften Halt allein im Leben, das sehen wir nicht nur an der Situation unserer Kirchengemeinden. Wir spüren es auch, wenn wir Freunde oder Partner verlieren, wenn wir selbst älter werden und unsere Kräfte nachlassen, kurz: wann immer wir uns von etwas Liebgewordenen verabschieden müssen. Der heutige Predigttext handelt auch von einem Abschied. Darin sind die Worte, die Jesus seinen Jüngern noch sagte bevor er sich endgültig von Ihnen verabschiedete: Und die Jünger sind traurig. Sie müssen Abschied nehmen von dem Menschen, für den sie so Vieles aufgegeben und auch riskiert haben. Der über einen längeren Zeitraum ihr Lebensinhalt und ihre Lebensmitte war. Ihnen sagt er: „Ich bin der wahre Weinstock...“ Im Johannesevangelium gibt es vieler dieser Aussagen, die Jesus über sich selbst trifft. Da heißt es auch: „Ich bin das Licht der Welt“, „Ich bin der gute Hirte“, „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“, „Ich bin die Tür“, eben: „Ich bin der wahre Weinstock“. Wer „ich bin“ sagt, gibt sich zu erkennen. Wer es wie Jesus sagt, erhebt einen Anspruch, der über die reine Selbstvorstellung hinausgeht. Gerade im Johannesevangelium markieren diese „Ich bin Worte“ eine konkrete Abgrenzung: „Ich bin“ bedeutet zugleich: „nur ich allein“ oder: „alle anderen nicht“. Das wird auch im Predigttext deutlich: „Ich bin der wahre Weinstock“, heißt es, und im Folgenden wird streng getrennt zwischen denjenigen, die „in ihm“ bleiben und daher Frucht bringen, und den anderen, die weggeworfen und verbrannt werden. Kein Zweifel: Solche Aussagen verlangen uns heutzutage einiges ab. In einer Gesellschaft, in der wir als Bürgerinnen und Bürger oder als Politiker zwischen Multikulti-Toleranz und ängstlicher Abgrenung hin- und her pendeln. Andererseits: Diese Aussagen bekennen Farbe. Der christliche Glaube bekommt damit ein Gesicht mit Konturen. Sinn von Jesu Aussagen über sich selbst ist nichts anderes als Trost zu spenden, Mut zu machen, Kraft zu spenden. Seine Aussagen gelten zunächst seinen Jüngern und den ersten Christen, die unter der beginnenden Anfeindung der römischen Herrschaft standen. Damals gab es keine herrschende und selbstherrliche Kirche, sondern eine kleine, unterdrückte. Ihre Mitglieder hatten stets vor Augen: Vielleicht müssen wir bald wieder voneinander Abschied nehmen. Da tut es gut, ein klares Profil zu haben. Denn diesen ersten Christen spricht der Predigttext zu: „Ihr seid auf dem richtigen Weg, auch wenn es nach außen hin gar nicht so scheint.“ Und in der Tat: Aus lauter kleinen im römischen Reich versprengten Gemeinden ist eine große Kirche geworden. Der Text blickt nach vorne, in die Zukunft. Eine Zukunft – um im Bild des Textes zu bleiben – mit vielen reifen Früchten. Zugleich höre ich aber auch die kritischen Stimmen, wenn der Text in der heutigen Zeit gelesen wird: „Worüber sollen wir denn jubeln? Damals, als der Predigttext geschrieben wurde, da wuchsen die Gemeinden. Wir dagegen werden immer weniger, immer älter. Unsere Kirche schrumpft, wir müssen uns von lieb gewordenen Gebäuden trennen. Wir erleben, wie sich die Gemeinschaft auflöst.“ An dieser Stelle greift der Schlüsselsatz des Predigttextes, die Wendung: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Ob eine Gemeinde wächst oder Frucht bringt, hängt eben nicht ausschließlich von der Bereitschaft ihrer Mitglieder ab, sich einzusetzen oder aufzubauen. Es sind nicht unser Aktionismus und unser Planen, die über den Fortbestand unserer Kirche entscheiden. Das Leben einer christlichen Gemeinde wächst nicht dank der Tatkraft ihrer haupt- und ehrenamtlichen Mitglieder. Es wächst allein in Christus. Ein Beispiel: Vor einigen Wochen wurde ich zu einem Notfalleinsatz gerufen. Ein Mann ist in seiner Küche verstorben. Die Angehörigen baten um einen Pastor. Nachdem die organisatorischen Dinge geklärt waren, haben sich die Angehörigen ins Wohnzimmer gesetzt. Gemeinsam haben wir den Psalm 23 gesprochen: Der Herr ist mein Hirte. Gemeinsam haben wir das VATER UNSER gebetet. Die Angehörigen haben Abschied genommen von einer lieben Person aus der Familie – mit Gebet und Worten der Bibel. Hier ist Sinn ins „Abschied-Nehmen“ gekommen. Hier ist die Kraft Gottes in Gebet und Wort ins Spiel gekommen. Die Kraft, die von den Worten ausgeht: „Ich bin“. So gesehen führen die letzten Worte Jesu zurück zu den Wurzeln, „back to the roots“. Gerade in diesen für die Kirche schwierige Zeiten ist es wichtig, sich darauf zu besinnen, was eigentlich das Wesen ihrer Existenz ausmacht. Es ist nicht ihre Größe, auch nicht ihre öffentlichkeitswirksame Aktivität und schon gar nicht die Anerkennung von außen. Es ist Ihr „Sein in Christus“, das vielfältig Frucht bringt und auch in Zukunft bringt. Wenn wir etwa mit einer groß angelegten Spendenaktion für die Orgel sammeln, wenn wir ein Tauffest organisieren, zu dem sich rund 15 Täuflinge anmelden, wenn wir ausgefallene Gottesdienste anbieten, wenn wir mit dem Gospelchor Menschen ansprechen, die sonst nicht in die Kirche kommen – dann ist das der Kreativität und dem Einsatz der Verantwortlichen zu danken. Vor allem aber hat es nur Bestand, wenn die Basis vor Augen ist: „Ich bin der wahre Weinstock.“ Mit dieser Perspektive bekommt die Restaurant-Idee von Gastronom Achim Fiolka aus Bielefeld einen ganz anderen Anstrich. Denn seine Restaurant-Idee ist auffällig kirchentreu: Die Mystik des Kirchengebäudes nutze er, um seinen Gästen eine Oase mitten im stressigen Alltag zu bieten. Frei nach dem Motto von Martin Luther: Die Geschichte Gottes kann überall erzählt werden unter jedem Strohdach oder in jedem Saustall. Und erst recht in einer ehemaligen Kirche, die jetzt ein Restaurant ist. Und auch für so manches Kirchenmitglied ist das Restaurant ein Treffpunkt: Zusammen Mittag essen oder ein Feierabendbier genießen. Denn: Gemeinschaft – die sollte in einer Kirche immer sein. Auch wenn das Gotteshaus auf den ersten Blick einem anderen Zweck dient. Drei Wochen nach dem Osterfest spricht Jesus uns im Predigttext noch einmal deutlich zu, dass wir Kraft und Mut aus seinen Worten schöpfen sollen. Lasst uns deshalb nicht mutlos werden, nicht resignieren, wenn wir sehen, das manches lieb gewordene zerbricht und vergeht. Unser Blick in die Zukunft darf hoffnungsvoll sein, wenn wir auf die Worte vertrauen: „Ich bin der wahre Weinstock“. Amen