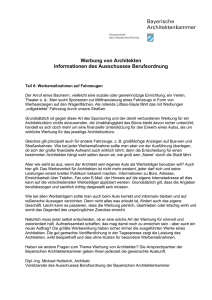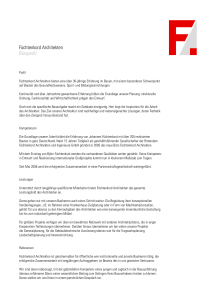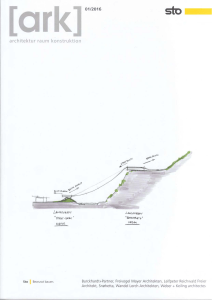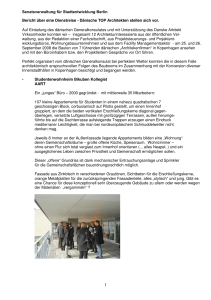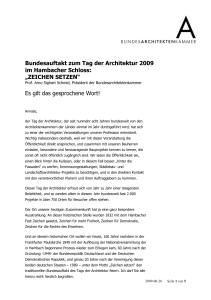VELUX Daylight and Architecture Ausgabe 16
Werbung

DAY A LIGHT & ARCHITECTURE ARCHITEKTURMAGAZIN VON VELUX HERBST 2011 AUSGABE 16 10 EURO LEBENSZYKLEN HERBST 2011 AUSGABE 16 LEBENSZYKLEN DAY A LIGHT & ARCHITECTURE ARCHITEKTURMAGAZIN VON VELUX VELUX EDITORIAL LEBENSZYKLEN Wenn uns die Ereignisse der vergangenen Jahre eines vor Augen geführt haben, dann dieses: Die Zukunft lässt sich nicht voraussagen. Jede noch so genaue Analyse von Vergangenheit und Gegenwart bewahrt uns nicht vor Fehleinschätzungen der eigenen Zukunft. Das gilt auch und gerade für Gebäude – doch gerade diese Unsicherheit macht eine Beschäftigung mit ihren Lebenszyklen so interessant. Gebäude und ihre Bewohner durchlaufen einen gemeinsamen, fortlaufenden Zyklus des Lernens, Wohnens, Planens und Sanierens. Auch Daylight/Architecture 16 gliedert sich daher in drei Abschnitte, die sich den Themen ‚Lernen’, ‚Wohnen’ und ‚Planen’ widmen. Im ersten Abschnitt, ‚Vom Leben lernen’, beschreiben Juhani Pallasmaa, Adam Sharr und Adrian Forty mit den Fragen, wie Gebäude und ihre Nutzer zusammenfinden, wie ein Haus zur Heimat für den Menschen wird und wie es dessen Leben in allen Phasen des Bewohnens und Alterns bereichern kann. Jedes Gebäude altert unterschiedlich. Die einen gleichen einem Strauß von Schnittblumen: Sie bieten für kurze Momente ein Feuerwerk fürs Auge und verwelken bald darauf. Andere Gebäude wiederum erblühen erst im Laufe ihrer Nutzung zu vollem Leben. Würdevoll tragen sie die Spuren ihres Alters und bieten dem Leben in all seiner Unvollkommenheit Raum. Michael Weselys Fotografien von Blumensträußen auf den kommenden Seiten sind eine treffende Metapher hierfür: Sie zeigen verwelkende Schönheit, aufgenommen über mehrere Tage hinweg – gleichsam eine radikale Beschleunigung der ‚Still’leben des 17. Jahrhunderts mit zeitgenössischen Mitteln. Für den zweiten Abschnitt dieser Ausgabe, ‚Nachhaltig wohnen’ haben unsere Autorinnen Anneke Bokern, Karine Dana und Amelie Osterloh drei Gebäude in Europa kurz vor, während und nach ihrer Sanierung aufgesucht und mit den Bewohnern gesprochen. Dabei standen für sie weniger technische und ästhetische Aspekte im Vordergrund, sondern das Kalei- doskop des Lebens, das sich in diesen Gebäuden ohne jede Einwirkung eines Architekten oder Planers entfaltet. Die Spuren der Erinnerung, die Veränderung der Gebäude und Stadtquartiere im Laufe der Jahrzehnte, die Zukunftshoffnungen, die die Bewohner an die Sanierungen knüpfen – all dies waren zentrale Themen in den Interviews. Der dritte Abschnitt von Daylight/ Architecture 16, ‚Lebenszyklen planen’, thematisiert ein Dilemma, das Stewart Brand in seinem Buch ‚How Buildings Learn’ so umrissen hat: „Alle Gebäude sind Prognosen. Alle Prognosen sind falsch.“ Weitsichtige Investoren und Planer haben dies inzwischen erkannt und begonnen, für eine ungewisse Zukunft zu planen. Sie statten ihre Gebäude, um es in den Worten Rem Koolhaas’ auszudrücken, mit „überschüssiger Kapazität” aus, die sich räumlich, konstruktiv und nicht selten auch atmosphärisch manifestiert. Doch solche Gebäude sind selten, weil kostspielig – und sie befreien uns nicht von der Notwendigkeit, Gebäude und ihren Alltagsgebrauch durch die Bewohner wesentlich genauer zu beobachten als bisher. Mit dieser Einsicht und mit dem Interview mit Fionn Stevenson und Bill Bordass am Ende dieses Hefts schließt sich der Kreis: Auf jede Planung muss eine Phase des Bewohnens, Beobachtens und Lernens folgen, bevor es an die Planung des nächsten Neu- oder Umbaus geht. Monitoringprogramme und Nutzerfeedback sind daher auch ein wichtiger Bestandteil des Programms ‚Model Home 2020’ der VELUX Gruppe, aus dem wir in dieser Ausgabe von Daylight/Architecture das LichtAktiv Haus in Hamburg vorstellen. Denn erst wenn diese Lernprozesse überall stattfinden und das daraus gewonnene Wissen weitergegeben wird, können wir Anspruch darauf erheben, wirklich nachhaltige Gebäude zu schaffen. Viel Spaß bei der Lektüre! VELUX 1 HERBST 2011 10 17 ZU HAUSE IN DER ZEIT WOHNEN MIT MARTIN HEIDEGGER Ob Gebäude in Würde altern und wie sie die Sinne ansprechen, ist maßgeblich für ihre langfristige Überlebensfähigkeit. In seinem Beitrag übt Juhani Pallasmaa scharfe Kritik an den visuellen Reinheitsgeboten der Moderne und plädiert für eine Architektur, die das Leben mit all seiner Unvollkommenheit ernst nimmt. Martin Heidegger gehört zu den von Architekten meistzitierten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Doch wie relevant sind seine Ansichten heute noch, da der Massen-Wohnungsbau längst seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat? Sie sind hochgradig aktuell, glaubt Adam Sharr: Nur wo das Bauen mit dem Wohnen – und mit der Lebenserfahrung und Wahrnehmung des Einzelnen – verbunden bleibt, können Häuser zur Heimat für Menschen werden. AUSGABE 16 INHALT VELUX Editorial Inhalt VOM LEBEN LERNEN Zu Hause in der Zeit Wohnen mit Martin Heidegger Das Leben des Nutzers NACHHALTIG WOHNEN Montfoort Paris Hamburg LEBENSZYKLEN PLANEN Zeitbasierte Architektur und Mischnutzung Auch schlechte Nachrichten können wertvoll sein Multioptionales Wohnen 10 2 2 4 9 10 17 23 28 32 56 72 96 100 109 119 17 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 23 32 56 72 DAS LEBEN DES ‚NUTZERS’ MONTFOORT PARIS HAMBURG Lange Zeit galt der ‚Nutzer’ in der Architektur als Teil einer anonymen Masse, deren statistisch ermittelte Bedürfnisse es zu befriedigen galt. Das hat sich geändert, schreibt Adrian Forty in seinem Beitrag: Schon immer hatten die Bewohner aktiven Anteil an der Produktion, Aneignung und Zerstörung von Gebäuden. Inzwischen wird diese Tatsache auch von Architekten und Wohnungsbaugesellschaften beherzigt. Zehn Reihenhäuser, die stellvertretend für Millionen andere in den Niederlanden stehen, sollen in den kommenden Monaten zu ‚Aktivhäusern’ umgebaut werden. Anneke Bokern hat sich auf den Weg nach Montfoort gemacht und mit den Bewohnern über ihre Erfahrungen und die Erwartungen gesprochen, die sie mit den Gebäuden verknüpfen. Haben Frankreichs Banlieues eine Zukunft? Wenn ja, könnte diese im Pariser 17. Arrondissement zu suchen sein. Dort haben Frédéric Druot und Lacaton & Vassal den Tour Bois-le-Prêtre, ein Wohnhochhaus von 1959, für das 21. Jahrhundert ertüchtigt. Karine Dana war für Daylight/Architecture vor Ort und entdeckte ein Gebäude, das Zukunftsperspektiven bietet, ohne seine Vergangenheit zu negieren. Eine sanierte Hamburger Doppelhaushälfte weist den Weg in die Zukunft des Wohnens: Das ‚LichtAktiv Haus’ im Stadtteil Wilhelmsburg ist CO2-neutral, offen für Tageslicht und frische Luft – und für Lebensstile künftiger Generationen. Anneke Bokern hat das Haus zur Probe bewohnt und die Nachbarn über Traditionen und Veränderungen von Wohnbedürfnissen befragt. 56 72 3 100 108 119 ZEITBASIERTE ARCHITEKTUR UND MISCHNUTZUNG AUCH SCHLECHTE NACHRICHTEN KÖNNEN WERTVOLL SEIN MULTIOPTIONALES WOHNEN Gebäude, die langlebig sein sollen, müssen sich verändern können – dieses scheinbare Paradox hat sich schon in der Vergangenheit immer wieder bestätigt. In seinem Beitrag analysiert Jasper van Zwol die gesellschaftlichen Triebkräfte, die wandlungsfähige Gebäude erforderlich machen, und die Entwurfsstrategien, mit denen sie sich realisieren lassen. Was wissen wir über die wahren Bedürfnisse der Bewohner von Gebäuden? Noch immer viel zu wenig, glauben Bill Bordass und Fionn Stevenson vom britischen Usable Buildings Trust. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, mehr über die Alltagstauglichkeit von Gebäuden zu erfahren und Bauherren und Planer für dieses Thema zu sensibilisieren. Die sozialen Bindungen in unserer Gesellschaft lockern sich, Lebensformen sind im Wandel – nur im Wohnungsbau herrscht seit über 50 Jahren Stillstand, wie Günter Pfeifer konstatiert. In seinem Beitrag beschreibt er mögliche Auswege aus dem Dilemma. Der wichtigste davon: ein neues Denken der Investoren und Planer, das den Bedarf an neuen Wohnformen aktiv weckt, statt ihn fortwährend zu verkennen. 108 54 4 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 FÜR JEDEN TAG DES LEBENS Von Jakob Schoof Tun wir das Richtige, wenn wir heute ein Haus bauen oder sanieren? Und werden wir auch in 50 Jahren noch rückblickend behaupten können, dass es ‚das Richtige’ war? Die Frage ist spekulativ, gewiss – so wie alles Bauen letztlich eine Wette auf die Zukunft ist. Doch sie weist darauf hin, dass Gebäude nicht für den Augenblick errichtet werden. Sie sollen über Jahrzehnte zum Wohl der Menschen und der Umwelt beitragen – also auch dann noch, wenn der Investor und der Architekt, der sie entwarf, sie womöglich längst vergessen haben. Nicht umsonst gewinnen die Lebenszyklen von Gebäuden derzeit in der Fachwelt immer mehr an Aufmerksamkeit. Eigentlich ist dies eine längst überfällige Entwicklung: Rund die Hälfte aller Gebäude in Mitteleuropa stammt aus der Zeit zwischen 1945 und 1980 und hat nun ein Alter erreicht, in dem grundlegende Sanierungen anstehen. Um diese Gebäude wirklich nachhaltig sanieren zu können, müssen Architekten, Planer und Bauunternehmer, aber auch Bauherren und Bewohner über die Lebenszyklen von Menschen und Gebäuden Bescheid wissen. Sie müssen lernen, wie diese Zyklen miteinander interagieren. Das Leben sollte die Baupraxis prägen, so wie Gebäude unser Leben prägen. Schon Winston Churchill erkannte dies, als er den vielleicht berühmtesten Satz eines Nicht-Architekten über Architektur prägte: „Erst formen wir unsere Gebäude, und anschließend formen sie uns.“ Dabei gilt es auch, Rollen zu überdenken. Was – und wer – macht aus einem Haus ein ‚Zuhause’? Der Architekt in der Planungsphase - oder der Bewohner in den Jahrzehnten danach, mit seinen Alltagsdingen und Erinnerungen? Schon für Martin Heidegger bestand der eigentliche Wert eines Wasserkrugs nicht im Krug selbst, sondern in dessen Inhalt. Das gleiche gilt für Gebäude: Sie müssen den Rahmen für das Leben in ihrem Inneren schaffen und zugleich an den Lebenszyklen der Natur teilhaben. Sie können ihren Bewohnern jedoch auch Perspektiven eröffnen und räumliche Qualitäten vermitteln, die diese zuvor nicht wahrgenommen hatten. Eine kritische Betrachtung bisheriger Planungsstrategien und Kriterien in der Architektur ist ebenfalls erforderlich. Gebäude dürfen nicht länger – und sie durften eigentlich noch nie – nur für den Moment ihrer Übergabe an den Bauherren entworfen werden, sondern für ihren Betrieb. Wie tragen sie zur Gesundheit der Menschen und zum Wohl der Umwelt bei, nachdem sie übergeben worden sind? Wie werden sie in späteren Zeiten ihres Lebens angepasst und umgenutzt? Wie können wir sicherstellen, dass sie auch nach 50 Jahren noch wertgeschätzt werden? Aus der Diskussion um Nachhaltigkeit entwickeln sich neue Methoden und Instrumentarien, um die Lebenszyklen von Gebäuden zu planen und zu optimieren. Die wissenschaftliche Lebenszyklusanalyse, die die Umweltwirkungen von Gebäuden während deren gesamter Lebensdauer bewertet, ist eine davon. Aber die derzeitige Fokussierung auf Leistungskriterien und Messbarkeit birgt auch Risiken: Nicht messbare Werte von Architektur und Lebensqualität drohen vernachlässigt zu werden, und oft dienen Zahlen – die ja eigentlich Transparenz schaffen sollen - lediglich dazu, eine Politik des ‚Weiter so’ wissenschaftlich zu untermauern. Die Grenze zum ‚Greenwashing’ ist schnell überschritten und nicht für jeden Laien gleich erkennbar. Wichtig ist es daher, die Grenzen quantitativer Leistungskriterien anzuerkennen und allzu eng fokussierte Planungsperspektiven zu vermeiden. Denn nur dann entstehen Gebäude, die das Leben fördern und nicht nur ‚umweltfreundlich’ sind, Gebäude für alle Sinne und nicht nur für das Auge – kurz: Gebäude für jeden Tag des Lebens. 5 Michael Wesely Stillleben (25.1. – 1.2.2011) 6 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 7 „Im Grunde genommen ist Imperfektion essenziell für alles, was wir vom Leben wissen. Sie ist Lebenszeichen im sterblichen Körper, ein Zeichen von Veränderung und Wandel. Nichts, was lebt, ist oder kann absolut perfekt sein; ein Teil verfällt, ein anderer ist im Entstehen […] Und alle lebendigen Dinge zeigen gewisse Unregelmäßigkeiten und Mängel, die nicht nur Zeichen des Lebens, sondern auch Quell der Schönheit sind.“ John Ruskin in: The Lamp of Beauty: Writings On Art by John Ruskin, 1980 8 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 VOM LEBEN LERNEN 9 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 Stillleben (9.2.–15.2.2008) 2008 ZU HAUSE IN DER ZEIT In unserer schnelllebigen Zeit strebt die Architektur wie besessen nach Neuem und optischen Reizen, vernachlässigt dabei jedoch Emotion und Atmosphäre. Die Zeit ist reif für eine Rückbesinnung auf alternative Traditionen der Moderne: auf Gebäude, die alle Sinne ansprechen, Materialien und Strukturen betonen und im Wissen um die Unvollkommenheit des Lebens tief in ihrer Zeit verankert sind. Von Juhani Pallasmaa Fotos von Michael Wesely Von Menschenhand geschaffene Umgebungen und Strukturen, seien sie materieller oder mentaler Art, verwandeln homogenen, grenzenlosen und sinnfreien ‚natürlichen’ Raum in individuelle Orte mit spezieller kultureller Geschichte und Bedeutung. ‚Wilder’ Raum wird durch die Architektur zu kulturellem Raum domestiziert, der unser Verhalten, Denken und Fühlen ausdrückt und bestimmt. Architektonischer Raum vermittelt zwischen Natürlichem und Künstlichem, Weite und Enge, Gemeinschaft und Individualität, Vergangenheit und Zukunft. Indem wir uns in das ‚Fleisch der Welt’ (im Sinne Maurice Merleau-Pontys) einfügen, werden wir Teil des Raums, und der Raum wird Teil von uns. „Ich bin der Raum, wo ich bin“, schreibt der Dichter Noël Arnaud. 1 So, wie wir im Raum verweilen, müssen wir auch die Zeit ,zähmen‘ und uns in ihren Lauf einfügen. Der Philosoph Karsten Harries hat dies einmal so ausgedrückt: „Architektur dient nicht nur der Domestizierung des Raums, sondern auch der nachhaltigen Verteidigung gegen den Schrecken der Zeit. Die Sprache der Schönheit ist im Grunde die Sprache zeitloser Wirklichkeit.“ 2 Die unermessliche und endlose Zeit des Universums ist dem Menschen unerträglich; so muss auch die Dimension der Zeit auf menschliche Maße und Deutungen ‚gestutzt’ werden. Zeit ist das größte Mysterium der physikalischen Welt. Zum fundamentalen Geheimnis der Zeit formulierte der heilige Augustinus pointiert: „Was ist Zeit? Wenn man mich nicht danach fragt, weiß ich es. Wenn man mich danach fragt, weiß ich es nicht.“ 3 Es gibt diverse gänzlich verschiedene Zeitskalen – die kosmologische Zeit, die geologische Zeit, die evolutionäre Zeit, die kulturelle Zeit, die biologische Zeit, die atomare Zeit usw. So ist auch eine architektonische Zeit denkbar, welche Mittler zwischen diesen verschiedenen Zeitskalen und Ausdruck des zeitlichen Bereichs ist, in dem wir als biologische und kulturelle Lebewesen existieren. Städte, Orte und Dörfer alter Kulturen wegen ihrer menschlichen Wärme und der haptischen Empfindung von Geschichte, Zeit und gelebtem Leben, die durch die Schichten ihrer Patina dringt. Unser eigener Lebensraum wird von visuellen Reizen dominiert, während wir die von uns geliebten historischen Stadtbilder nicht nur mit dem Auge, sondern gleichermaßen durch Hören, Berühren und Riechen wahrnehmen. architektur in schnelllebigen zeiten Architektur manipuliert und speichert, materielle imagination und verlangsamt und fragmentiert die Zeit; atmosphäre sie bringt sie zum Stillstand und setzt sie Wir besitzen eine erstaunliche Fähigkeit, die Atmosphäre eines Ortes oder Raums bisweilen sogar zurück. In der heutigen Welt ständiger Hetze hat sich die Zeit zu erfassen. In Städten, Landschaften schwindelerregend beschleunigt. Dem oder Räumen erkennen wir deren Wesen scheint selbst die Architektur Tribut zu und Eigenschaften in Sekundenbruchteizollen. In verblüffender Ähnlichkeit zu len, noch bevor wir irgendwelche Details Literatur und Film ‚erzählt’ Architektur erfasst oder begriffen haben. Tatsächlich scheint unsere Wahrnehmung der Umebenfalls temporale Geschichten, wenn auch selten in gleicher Absicht wie diese. gebung vom Ganzen zu den Einzelheiten So, wie wir am ‚Fleisch der Welt’ Anteil zu verlaufen und nicht, wie oft behauphaben, haben wir auch Anteil an ihren tet, umgekehrt. Im letzten Jahrhundert strebte die moderne Architektur nach zeitlichen Rhythmen. Die moderne Perfektion in Raum, Form und Detail, woWelt ist besessen von allem, was neu und zeitgemäß ist; unsere Besitztümer bei die Gesamtatmosphäre in den Hinterund Gebäude sollen am besten immer grund rückte. Das Element von Zeit und neu bleiben. Wir haben die Realität des Dauer, kombiniert mit dem Gespür für Alterns und Sterbens an den Rand unseres Bewusstseins verdrängt und dem Tod den Rücken gekehrt. In der unbewussten „Architektur dient nicht nur der Angst vor Verfall möchten wir alle Spuren des Alters auf unseren Körpern eli- Domestizierung des Raums, sondern auch der nachhaltigen minieren und alle Zeichen von Zeit und Verteidigung gegen den Schrecken Gebrauch an unseren Gegenständen und in unserer Umgebung unterdrücken. der Zeit. Die Sprache der SchönZunehmend nutzen wir Materiali- heit ist im Grunde die Sprache en, die keine Verschleißerscheinungen zeitloser Wirklichkeit.“ zeigen. Gleichzeitig empfinden wir moderne Umgebungen als befremdlich Karsten Harries in: Perspecta, The Yale oder gar nekrophil und bewundern die Architectural Journal, Ausgabe 19, 1982 11 „Es scheint, als reagiere der Raum – in dem Bewusstsein, [...] der Zeit unterlegen zu sein – mit der einzigen Eigenschaft, die der Zeit fehlt: mit Schönheit.” Joseph Brodsky in: Watermark, 1997 menschliches Leben, ist deutlich enger mit peripheren, unbewussten atmosphärischen Erfahrungen verbunden als mit der fokussierten und bewussten Wahrnehmung von Formen. Gaston Bachelard unterscheidet zwischen ‚formaler Imagination’ und ‚materieller Imagination’ und behauptet, dass Bilder, die aus der Materie entstehen, eine stärkere emotionale Wirkung erzeugen als Bilder von Formen. 4 Bemerkenswert ist, dass die historische Architektur überall in der Welt die Erfahrung von Materialien, Strukturen und dem Wechselspiel von Licht und Schatten betont, während die moderne Architektur klare geometrische, häufig weiße und glatte Formen bevorzugt. Erstere ‚berührt’ den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes und vermittelt eine Fülle zeitlicher Botschaften, Letztere wird vom Optischen dominiert und tendiert dazu, Gebrauchsund Zeitspuren als Fehler oder Mängel anzusehen. Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen einer Architektur, die Gebrauchsspuren willkommen heißt, und einer solchen, die von Zeit und Verschleiß möglichst unberührt und unangetastet bleiben will. Die gemeinhin weiße modernistische Ästhetik birgt strenge moralisierende Untertöne. Laut Le Corbusier „dient das Weiß dem Auge der Wahrheit“. 5 Die moralischen Bedeutungen des Weißen bringt er auf sonderbare Weise zum Ausdruck: „Weiß ist extrem moralisch. Man stelle sich vor, alle Räume in Paris müssten per Erlass weiß getüncht werden. Ich denke, das wäre eine polizeiliche Aufgabe großen Ausmaßes und Ausdruck höchster Moral, das Zeichen eines großen Volkes.“ 6 Im Allgemeinen reflektiert die Moderne dieses Ideal von Reinheit und Reduktion, während „die andere Tradition moderner Architektur“, um Colin St John Wilson zu zitieren, 7 sich in Materialität und Vielfalt struktureller Formen sowie im Licht- und Schattenspiel manifestiert 12 und, im Gegensatz zu den formalen Idealen und der Perfektion der klassischen Moderne, auf die Projektion atmosphärischer Eigenschaften abzielt. die polyphonie der Sinne In einer Vorlesung im Jahr 1936 regte Erik Gunnar Asplund, enger Freund und Mentor Alvar Aaltos, den Wandel der Ideale namhafter nordischer Architekten Mitte der 30er-Jahre an: „Die Vorstellung, nur visuelle Darstellung könne Kunst sein, ist sehr eingeschränkt. Nein, alles, was unsere Sinne durch unser menschliches Bewusstsein erfassen und das die Fähigkeit besitzt, Sehnsucht, Freude oder Emotionen hervorzurufen, kann ebenfalls Kunst sein.“ 8 Merleau-Ponty unterstreicht die Wichtigkeit der Einbindung aller Empfindungsbereiche: „Meine Wahrnehmung ist nicht die Summe einzelner visueller, taktiler und akustischer Gegebenheiten: Ich nehme allumfassend mit meinem ganzen Sein wahr: Ich erfasse die besondere Struktur einer Sache, eine besondere Art des Seins, die all meine Sinne zugleich anspricht.“ 9 Der Philosoph beschreibt hier ganz offensichtlich eine übergreifende atmosphärische Erfahrung, nicht die bloße Wahrnehmung der Form. Gaston Bachelard nennt diese sensorische Interaktion die „Polyphonie der Sinne“.10 Unsere Gebäude sind Teil desselben ‚Fleisches der Welt’ wie wir als physische Lebewesen. Jedes Gebäude besitzt spezielle auditive, haptische, olfaktorische und sogar gustatorische Eigenschaften, die der visuellen Wahrnehmung ein Gefühl von Fülle und Leben verleihen, ähnlich wie auch das Meisterwerk eines Malers all unsere Sinne anspricht. Man denke nur an das Empfinden einer warmen und feuchten Brise, sanfter Klänge und des Duftes von Pflanzen und Seegras, auf magische Weise erzeugt von Henri Matisse durch das Gemälde einer offenen Balkontür in Nizza. Aufgrund ihrer überwiegend konzeptionellen und formalen Ideale tendiert die zeitgenössische Architektur dazu, Umgebungen für das Auge zu schaffen, die in einem einzigen Moment entstanden zu sein scheinen und ein Empfinden verflachten Zeitgefühls und mangelnder Lebendigkeit auslösen. Visuelle Wahrnehmung und Immaterialität verstärken das Gefühl von Gegenwärtigkeit, während Materialität und haptische Empfindungen den Eindruck zeitlicher Tiefe und Kontinuität vermitteln. Unvermeidliche Alterungs-, Verwitterungsund Abnutzungsprozesse werden gemeinhin nicht als bewusste und positive Gestaltungselemente betrachtet, da das architektonische Artefakt vermeintlich im zeitlosen Raum angesiedelt ist. Dies ist jedoch eine idealisierte und künstliche Vorstellung ohne Bezug zur empirischen Wirklichkeit von Zeit und Leben. Die moderne Architektur strebt danach, eine Aura von Alterslosigkeit und ewiger Gegenwärtigkeit zu vermitteln. Die Ideale von Perfektion und Vollständigkeit entfernen das architektonische Objekt zusätzlich von der realen Zeit und Nutzung. Infolge der Vorstellung zeitloser Perfektion sind unsere Gebäude anfällig für die negativen Auswirkungen der Zeit, sozusagen der Rache der Zeit ausgesetzt. Statt die positiven Eigenschaften würdigen Alters zu betonen, greifen Zeit und Gebrauch unsere Gebäude in negativer und destruktiver Weise an. In den letzten Jahrzehnten wurde Neuartigkeit als eigenständiges Kunstkriterium und Wert an sich zur Obsession. Doch wahre künstlerische Qualität erwächst aus anderen Eigenschaften als lediglich dem Reiz des Neuen. hin zu einer architektur der imperfektion Das Streben nach Abstraktion und Perfektion lenkt die Aufmerksamkeit auf die Welt immaterieller Ideen; Materie, D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Michael Wesely: Stillleben, 2008-2011 Unten Stilleben (14. – 22.6.2008) 2008 Zeit ist die wesentliche, stets wiederkehrende Dimension in Michael Weselys Fotografien. Mit Belichtungszeiten von einigen Minuten bis zu mehreren Jahren macht er sichtbar, was üblicherweise nie auf einen Blick zu erfassen ist: Prozesse des Wachstums und Verfalls, Zyklen der Natur, die Sonnenbahn am Himmel oder die minimalen Bewegungen, die selbst scheinbar unbewegliche Menschen und Objekte im Laufe der Zeit vollführen. In seinen Blumen- und Obst-Stillleben interpretiert Wesely ein Jahrhunderte altes Sujet neu und bringt damit erst dessen ursprüngliche Intention zum Ausdruck. Denn bereits die Stillleben des ‚Goldenen Zeitalters’ der niederländischen Malerei verstanden sich ja als Vanitassymbole, als Gleichnisse auf die Vergänglichkeit alles Irdischen. Schleichender, aber allgegen- wärtiger Verfall erhält in Weselys Blumenbildern eine ungeahnte Dynamik, indem er zu einem einzigen Bild komprimiert wird. of Modern Art in New York, dem Kunstmuseum Bonn und dem Gemeentemuseum Den Haag zu sehen. Michael Wesely (*1963) studierte an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie und an der Akademie der Bildenden Künste in München und lebt heute als Fotograf in Berlin. Seine Werke waren und sind unter anderem im Museum © Michael Wesely/ VG Bild-Kunst Bonn, 2011 mit freundlicher Genehmigung von Nusser & Baumgart, München 13 14 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 Stillleben (3.4. – 13.4.2007) 2007 „Die moderne Architektur strebt danach, eine Aura von Alterslosigkeit und ewiger Gegenwärtigkeit zu vermitteln. [...] Infolge der Vorstellung zeitloser Perfektion sind unsere Gebäude anfällig für die negativen Auswirkungen der Zeit, sozusagen der Rache der Zeit ausgesetzt. ” Juhani Pallasmaa Verwitterung und Verfall hingegen ver- die riesigen Skulpturen Richard Serras stärken die Erfahrung von Kausalität, und Eduardo Chillidas aus SchmiedeZeit und Wirklichkeit. Es klafft ein fun- und Walzeisen Gewicht und Schwerkraft geradezu körperlich erfahrbar machen. damentaler Unterschied zwischen der idealistischen Vorstellung menschlicher Diese Werke sprechen unser KnochenExistenz und unseren tatsächlichen Le- und Muskelsystem direkt an; sie sind Mitbensbedingungen. Das wahre Leben ist teilung der Muskeln des Bildhauers an die immer ‚unrein’ und ‚chaotisch’; fundierte des Betrachters. Wolfgang Laibs Werke aus Bienenwachs, Pollen und Milch beArchitektur schafft einen Spielraum für diese ‚Ungereimtheiten’ des Lebens. schwören spirituelle und rituelle Bilder John Ruskin argumentierte: „Im und verkörpern ökologisches Bewusstsein. Bei Andy Goldsworthy und Nils-Udo Grunde genommen ist Imperfektion verschmelzen Natur und Kunst mit Hilfe essenziell für alles, was wir vom Leben wissen. Sie ist Lebenszeichen im sterb- natürlicher Materialien, Prozesse und Inlichen Körper, ein Zeichen von Verän- halte zu ‚biophilen’ Kunstwerken. derung und Wandel. Nichts, was lebt, ist Die immer größere Bedeutung ökolooder kann absolut perfekt sein; ein Teil gisch unbedenklicher Werte und Lebensverfällt, ein anderer ist im Entstehen … weisen legt zweifellos eine neue ArchitekUnd alle lebendigen Dinge zeigen gewis- tur nahe, die Materialien, Prozesse und Zeitzyklen nicht nur bewusst einsetzt, se Unregelmäßigkeiten und Mängel, die nicht nur Zeichen des Lebens, sondern sondern zu Merkmalen einer neuen auch Quell der Schönheit sind.“ 11 Schönheit macht. Joseph Brodsky fordert Alvar Aalto griff Ruskins Idee auf, als er mit der Sicherheit eines großen Poeten: vom „menschlichen Fehler“ sprach und „Der Zweck der Evolution ist, glaubt es die Suche nach absoluter Wahrheit und oder nicht, die Schönheit“. 14 Perfektion kritisierte: „Der menschliche Fehler war vermutlich immer schon Teil der Architektur. Eigentlich war er sogar unverzichtbar, um Gebäuden die Fähigkeit zu verleihen, die Fülle und positiven Werte des Lebens auszudrücken.“ 12 Materialität, Erosion und Destruktion stehen im Vordergrund der zeitgenössischen Kunst, angefangen von Arte Juhani Pallasmaa arbeitet seit den 60er-JahPovera und Gordon Matta-Clark bis hin ren als Architekt, Autor und Universitätsprofeszu Anselm Kiefer. Sie sind in den Filmen sor. Seit er 1997 seine Position als Professor und von Andrei Tarkowski ebenso präsent wie Dekan der Technischen Universität Helsinki aufin zahllosen Kunstwerken, die mit mate- gab, lehrte er als Gastprofessor an verschiedenen rialgebundenen Bildern und Prozessen Universitäten im In- und Ausland, derzeit an der Catholic University of America in Washington, arbeiten. „Zerstören und Aufbauen sind gleich wichtig, uns muss beides am Her- D. C. Er veröffentlichte eine Vielzahl von Schrifzen liegen …“, sagt Paul Valéry, und tat- ten, hauptsächlich zur Bedeutung menschlicher Wahrnehmung in Kunst und Architektur, sowie sächlich sind Motive von Destruktion und Essays über diverse Künstler und Architekten. Verfall in der heutigen Kunst auffällig po- Zu seinen jüngsten Publikationen gehören The 13 pulär. In der Installationskunst von Jan- Embodied Image (London 2011), The Thinking nis Kounellis kommen Träume und Er- Hand (London 2009), The Eyes of the Skin (Loninnerungen durch rostigen Stahl, Kohle don 1995, 2005) und The Architecture of Image: existential space in cinema (Helsinki, 2001, 2005). und Sackleinen zum Ausdruck, während Anmerkungen 1. zitiert in Gaston Bachelard: The Poetics of Space. Beacon Press, Boston, 1969, S. 137. 2. Karsten Harries: Building and the Terror of Time. In Perspecta: The Yale Architectural Journal, Ausgabe 19, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1982. 3. zitiert in Jorge Luis Borges: This Craft of Verse. Harvard University Press, Cambridge/Massachusetts und London, 2000, S. 19. 4. Gaston Bachelard: Water and Dreams: An Essay on the Imagination of Matter. The Pegasus Foundation, Dallas, Texas, 1983, S. 1. 5. zitiert in Mohsen Mostafavi and David Leatherbarrow: On Wheathering. The MIT Press, Cambridge/Massachusetts, 1993, S. 76. 6. Le Corbusier: L’art decorative d’aujourd’hui. Paris, Edition G. Grès et Cie, 1925, S. 192. 7. Colin St John Wilson: The Other Tradition of Modern Architecture: The uncompleted project. Black Dog Publishing, London, 2007. 8. Erik Gunnar Asplund: Konst och Technik [Kunst und Technik], in: Byggmästaren 1936. Zitiert in Stuart Wrede: The Architecture of Erik Gunnar Asplund. The MIT Press, Cambridge/Massachusetts, 1980, S. 153. 9. Maurice Merleau-Ponty: The Film and the New Psychology. In Maurice Merleu-Ponty: Sense and Non-Sense. Northwestern University Press, Evanston/Ilinois., 1964, S. 48. 10. Gaston Bachelard: The Poetics of Reverie. Beacon Press, Boston, 1971, S. 6. 11. The Lamp of Beauty: Writings On Art by John Ruskin. Hrsg.: Joan Evans. Cornell University Press, Ithaca. N.Y., 1980, S. 238. 12. Alvar Aalto: The Human Error. In Göran Schildt (Hrsg.:) Alvar Aalto in His Own Words. Otava Publishers, Helsinki, 1997, S. 281. 13. Paul Valéry: Eupalinos der der Architekt. In: Paul Valéry Dialogues. Pantheon Books, New York, 1956, S. 70. 14. Joseph Brodsky: An Immodest Proposal, On Grief and Reason. Farrar, Straus and Giroux, New York, 1997, S. 207. 15 Andreas Gefeller: Supervisions, 2002–2005 Unten Ohne Titel (Rasen 2) Düsseldorf, 2002 Dem Augenschein nach zeigen die Fotografien der Serie ‚Supervisions’ menschliche Lebens- und Arbeitsräume aus der Vogelperspektive. Doch der Schein trügt: Die ‚unmöglichen’ Perspektiven, die hier zu sehen sind, bestehen tatsächlich aus Hunderten von Einzelfotografien, die sich zu einem patchworkartigen Gesamtbild fügen. Menschen sind auf keiner der Aufnahmen zu sehen und haben doch auf allen ihre Spuren hinterlassen. Ihre Ordnungs- und Zeichensysteme sowie die Verschleißspuren des Alltags zeugen von dem schier unbegrenzten Einfallsreichtum unserer Spezies, wenn es darum geht, den Lebensraum den eigenen Vorstellungen von Nutzbarkeit zu unterwerfen. 16 Andreas Gefeller (*1970) studierte Fotografie an der Universität Essen und wurde 2001 in die Deutsche Fotografische Akademie berufen. 2004 erhielt er den Kunstpreis der Stadt Nordhorn, 2005 wurde er mit dem LeadAward Hamburg ausgezeichnet. 2010 erhielt Andreas Gefeller ein Stipendium in der Reihe ‚European Eyes on Japan’. Von Andreas Gefeller sind vier Fotobücher erschienen: ‚Soma’ (2002), ‚Supervisions’ (2005), ‚Andreas Gefeller – Photographs’ (2009) und ‚The Japan Series’ (2011). Alle Aufnahmen mit freundlicher Genehmigung von Thomas Rehbein Gallery Cologne und Hasted Kraeutler New York D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 WOHNEN MIT MARTIN HEIDEGGER Moderne Gesellschaften haben sich daran gewöhnt, dass der Wohnungsbau den Gesetzen der Massenproduktion folgt und von Architekten ohne Ortsbezug und ohne Kenntnis der zukünftigen Bewohner geplant wird. Der Philosoph Martin Heidegger fragte in den 1950er-Jahren, ob aus dieser Form der Unterbringung jemals ein zufriedenstellendes Heim entstehen könne. Seine Fragen zum Bauen und Wohnen haben bis heute nichts an Relevanz eingebüßt. Von Adam Sharr Fotos von Andreas Gefeller Am 6. August 1951 sprach der Philosoph Martin Heidegger anlässlich der Konferenz ‚Mensch und Raum’ in Darmstadt vor Architekten und Ingenieuren zur nachkriegsbedingten Wohnungsfrage. Durch die Zerstörungen des Krieges und den Beginn des Kalten Krieges lebten in Deutschland viele Heimatvertriebene und Wohnungslose. Auf der Konferenz sollten daher die Probleme des Wiederaufbaus diskutiert werden. In den darauf folgenden sechzig Jahren erlangte die Rede des Philosophen, die als Aufsatz unter dem Titel Bauen Wohnen Denken veröffentlicht wurde, große Bedeutung für Architekten und Architekturtheoretiker. Bauen ist Wohnen und Wohnen ist Bauen Heideggers Rede erscheint heute so eigenwillig wie 1951. Auf den ersten Blick wirkt sein Rückgriff auf die Etymologie, also auf die alten Bedeutungen alltäglicher Worte, seltsam archaisch. Heidegger hoffte, auf diese Weise zu zeitlosen Erkenntnissen über das Wohnen und die gelebten Formen des Wohnens zu gelangen. Er zeigt in seiner Sprachanalyse, dass die Worte ‚bauen’ und ‚wohnen’ eine gemeinsame Wurzel haben. Und was noch wichtiger ist, in ihnen drücke sich ein und dieselbe Idee aus,. Bauen sowohl als das Herstellen eines Heims als auch als das Bestellen des Bodens (daher das Wort ‚Bauer’ für Landwirt) seien früher einmal durch alltägliche Riten und Rituale eins gewesen. Es sei selbstverständlich gewesen, das Haus einfach zu erweitern, wenn durch ein weiteres Kind mehr Raum benötigt wurde, mit den zur Verfügung stehenden Materialien zu bauen und in seinem Inneren Platz für Persön- liches und Lebenserinnerungen vorzusehen. Für Heidegger stellten sich Bauen und Wohnen als eine Einheit dar durch die unmittelbare Präsenz der Materialien sowie die Überzeugungen, Werte und Gewohnheiten, die mit ihnen verbunden waren ( und die er in eigenwilliger Weise als ‚Geviert’ aus ‚Erde, Himmel, Göttlichen und Sterblichen’ bezeichnete). Erst in jüngster Zeit, so Heidegger, hätten Experten, Gesetze und Richtlinien das ‚Bauen’ vom ‚Wohnen’ getrennt, indem sie das Bauen durch industrielle Prozesse und mit einer eigenen Expertensprache professionalisierten und das Wohnen als ein wissenschaftliches Problem darstellten. Der Philosoph schloss seinen Vortrag mit dem Beispiel eines 200 Jahre alten Schwarzwaldhofes. Dessen Bewohner lebten einst in enger Verbindung zur umliegenden Natur, ihr Leben wurde strukturiert von Feiertagen und Jahreszeiten, Beerdigungen und Geburten. Das Haus bestimmte ihr tägliches Leben mit seinen Handlungen und wurde seinerseits von diesen geformt. Heidegger betonte die Rolle der Bewohner: Das Haus wurde vom Leben der Menschen entworfen. Dies galt nicht nur für die Konstruktionspläne, sondern auch für die alltägliche Aneignung durch ihre Handlungen. Ein Haus, so Heidegger, werde mit den Sinnen, den Händen und durch die Atmosphäre darin wahrgenommen, nicht mathematisch-kalkulatorisch. Die Menschen kennten spontan nicht die Größe der Grundfläche oder der Fenster ihres Hauses. Sie wüssten aber sehr genau, wie sich die Handläufe und Türklinken anfühlen, wie die Schatten durch die Zimmer wandern und wie gemütlich es neben dem Kamin ist. Damit stellte Heidegger die damals vorherrschende 17 Ohne Titel (Straße) Hongkong, 2004/2006 “Meine Wohnung, mein Haus: das ist die dichteste persönliche Herausforderung, die Architektur überhaupt leisten kann. Genau genommen ist es gar nicht Architektur, was mich dabei so sehr erregt und befriedigt, sondern das Konglomerat meiner eigenen Spuren darin.” Wolfgang Meisenheimer in: Das Denken des Leibes, 2000 wissenschaftliche Herangehensweise an das ‚Wohnproblem’ in Frage, der es beim Thema Hausbau nur um Zahlen ging: Anzahl der Räume, Größen, Flächen, Kosten und Bauzeit. Indem Architekten und Ingenieure die Dimensionen und Mengen betonten, verlören sie den Blick für die wirklichen Fragen des Wohnens und übersähen, was ein Haus sein könnte oder sollte. Heidegger achtete sehr genau darauf, nicht das Wort ‚Architektur’ zu verwenden, bei dem sehr viel Expertenwissen und die Traditionen einer klassischen Vergangenheit mitschwingen. Er betonte stattdessen, dass das Schaffen von Wohnraum wieder als ein ‚Bauen’ betrachtet werden sollte, das zugleich auch das ‚Wohnen’ mit einbezieht. Bauen als Industrie Heideggers Argumente gegen eine ‚Bauindustrie’ – nicht nur gegen die industriellen Prozesse, sondern grundsätzlich gegen die Vorstellung, Bauen ließe sich als Industrie organisieren – sind heute so relevant wie damals. Vielleicht ist ihre Bedeutung sogar noch größer, insbesondere in den Bereichen, in denen Projektentwickler und Finanzinvestoren profitorientiert arbeiten. In Begriffen wie ‚Immobilie’, ‚Wohnanlage’ und ‚Nutzer’ wird der Mensch nur aus aufzubewahrende Masse betrachtet, nicht als Individuum, das in Harmonie mit seiner Umwelt leben will. Nur selten kennen die Planer und Entwickler von Wohnanlagen diejenigen, die ihre Objekte bewohnen werden. Die Bewohner werden in Zielgruppen eingeteilt, ‚Senioren’ oder ‚Menschen mit Mobilitätseinschränkungen’ genannt oder mit Kürzeln beschrieben wie ‚Yuppies’ (‚young and upwardly mobile’) oder ‚Dinkys’ (‚dual income, no kids 18 yet’). Deren Bedürfnisse werden quantifiziert und bewertet, um den Verkauf oder die Vermietung sicherzustellen. Das Vermarktungskonzept entsteht häufig zusammen mit dem Entwurf, damit Wohnungen und Häuser für die entsprechenden Zielgruppen als ‚Luxus’, ‚gehoben’ oder ‚erschwinglich’ beworben werden können. Untersuchungen dieser Zielgruppen, durchgeführt von Marktforschungsinstituten anhand von Fragebögen, dienen als Grundlage solcher Konzepte. In Großbritannien ergibt dies beispielsweise häufig ein Haus mit einem ‚traditionellen’ Äußeren aus Ziegeln, da sie mit Sicherheit und Langlebigkeit verbunden werden (obwohl sie häufig nur eine Verkleidung über einer Holz- oder leichten Stahlrahmenkonstruktion sind), und einem ‚modernen’ Innenleben: Küchen mit modernsten Geräten sowie Zimmer, ausgestattet mit Breitband-Internetanschluss. Auf diese Weise wird das Haus ein Produkt – ‚Lebensstil’ zum Kaufen. Natürlich wissen viele derjenigen, die in der Bauindustrie tätig sind, um die Probleme im Zusammenhang mit dem industrialisierten Wohnungsbau für unbekannte Nutzer. Sie propagieren inzwischen den Begriff ‚life-cycle homes’, also Wohnstätten für unterschiedliche Lebensphasen. Jedoch wird dieser häufig sehr eng gefasst, etwa als Gebäude mit Möglichkeiten für den späteren Einbau von Treppenliften, mit barrierefreien Schwellen für ein Mehr an Bewegungsfreiheit oder mit zusätzlichen Steckdosen in Kinderzimmern, damit diese Räume später einmal zu einem HomeOffice umgebaut werden können. Viele Vertreter aus der Praxis erkennen auch die eher entfremdende Wirkung von FerD&A HERBST 2011 AUSGABE 16 19 „Es ist schwer zu quantifizieren, doch die Menschen wissen aus Erfahrung, dass man sich dort zu Hause fühlt, wo Vertrautheit, Nähe und der kaum in Worte fassbare ‚Genius loci’ existieren. ” Adam Sharr tigbauteilen oder Raummodulen, die gerne verwendet werden, weil sie die Bauzeit verkürzen und die Rendite erhöhen. Von der modernen Technik verspricht man sich hier große Potenziale, denn computergesteuerte Prozesse bieten die verführerische Möglichkeit der ‚mass customization’, also der Herstellung ‚individualisierter Massenware’. Heidegger würde jedoch in diesen industriellen Lösungen, so gut sie auch gemeint sind, eine weitere Verschärfung des Problems sehen, da sie die Distanz zwischen ‚Wohnen’ und ‚Bauen’ noch weiter vergrößern. Natürlich sind Heideggers Überlegungen nicht unproblematisch. In mobileren Gesellschaften bleiben nur wenige Menschen ihr Leben lang an einem Ort, und langjährige familiäre Bindungen an einen bestimmten Ort lassen sich kaum aufrechterhalten. Nur selten haben die Menschen die Zeit, das Geld oder die Neigung, für sich selbst zu bauen; oder sie fühlen sich hierzu einfach nicht befähigt. Darüber hinaus erscheinen manchen die rituellen Aspekte der Häuslichkeit langweilig. Sie lehnen Konzepte, die an die Vorstellung der heterosexuellen Familie aus Mann, Frau und 2,4 Kindern angelehnt sind, ab. Heideggers Kritiker stellen auch heraus, dass Probleme gerade da entstehen, wo sich Menschen verwurzelt fühlen – denn aus dieser Verwurzelung entwickeln sich häufig Sturheit, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Aber die Kraft der Wohnung, dem Leben eine Mitte zu geben, lässt sich nicht bestreiten. Es ist zwar schwer zu quantifizieren, doch die Menschen wissen aus Erfahrung, dass man sich dort zu Hause fühlt, wo Vertrautheit, Nähe und der kaum in Worte fassbare ‚Genius loci’ existieren. Die Wohnungen, die sich alle wünschen – und die sich auch am besten verkaufen –, sind diejenigen mit der ‚richtigen’ Atmosphäre. Der Versuch, ihre Qualitäten zu analysieren, scheint jedoch zum Scheitern verurteilt. Sie lassen sich nicht einfach messen oder in eine Kosten-Nutzen-Rechnung hineinkopieren. In einer Zeit, in der sehr viel von Nachhaltigkeit die Rede ist, ist die Vorstellung von einem Heim, für das die Menschen über einen langen Zeitraum hinweg Sorge tragen möchten, dennoch sehr angemessen – selbst wenn der Lebensstil der Menschen heute ein ganz anderer ist als derjenige in Heideggers idealisiertem Schwarzwaldhof. Planer, Bewohner, Orte Wie lassen sich die Expertenmeinungen über Wohnungsbau in Einklang bringen mit Heideggers Vorstellung vom Wohnen und Bauen? Ist es möglich, dem Wohnbau ‚von der Stange’ für anonyme Nutzer zu entkommen? Können standardisierte Wohnungen überhaupt jemals eine wünschenswerte Alternative sein? Lassen sich die Überlegungen zum lebenszyklusgerechten Bauen enger verknüpfen mit den Abläufen des alltäglichen Lebens? Ist es überhaupt möglich, das Entwerfen für fremde Menschen zu lernen? Die Antworten auf diese Fragen sind natürlich nicht einfach. In jedem Fall braucht es dazu Planer und Projektentwickler, die sich als ‚Ermöglicher’ statt als Experten sehen und bereit sind, die Bewohner bereits zu einem frühen Zeitpunkt in den Planungsprozess einzubeziehen. Besonders wenig hilfreich ist es andererseits, einen Bau schon am Tag der Eröffnung für ‚fertig’ zu erklären. Dann nämlich endet die Arbeit am Eigenheim für die Bewohner nicht, sondern sie beginnt erst. Planer, die zu dieser neuen Denkweise fähig sind, können Orte schaffen, die spezifisch sind, ohne Vorschriften zu machen. Diese Orte laden mit jedem Detail zum Bewohnen ein, sie helfen den Menschen, die Potenziale ihrer Umgebung zu erkennen, und erlauben ihnen, Besitztümer und Einrichtungsgegenstände entsprechend ihren Lebensvorstellungen zu arrangieren. Womöglich lassen sich Wohngrundrisse neu konzipieren mit dem Ziel, Orte anstatt Flächen zu schaffen. Vermutlich ist es auch wenig sinnvoll, Räumen bestimmte Funktionen wie ‚Esszimmer’ oder ‚Wohnzimmer’ zuzuweisen, da fließendere, vernetztere Raumkonzepte über mehr Potenzial verfügen. Und ganz sicher führt die zunehmende ‚Gleichmacherei’ der Beleuchtungsstärken, Temperaturen und Luftwechsel dazu, dass Wohnungen an Persönlichkeit und Atmosphäre verlieren. Ließen sich nicht Technologien einplanen, die sich weniger im Hintergrund halten und stattdessen fordernder und lebensbejahender sind? Nur wenige Menschen begeistern sich für einen Heizkörper, aber alle lieben echtes Feuer im Kamin. Am Ende könnte, so wie ich es in meinem Buch Heidegger’s Hut [Heideggers Hütte] darlege, ein Haus zur Wohnstatt werden, die in vielfältiger Weise einen Rahmen schafft für die Bewohner mit ihren wechselseitigen Beziehungen, ihrem Eigentum und ihrem gesellschaftlichen Kontext; eine Bühne für das alltägliche Schauspiel der Passanten vor der Tür, für die Sonne und den Verlauf der Schatten, für Windböen, Regen und Schnee, Flora und Fauna. Ein solches Haus wäre weder zu groß noch unnötig flexibel, sondern würde stattdessen den Bewohnern helfen, persönliche Orte zu gestalten. Es könnte sie zu entschleunigten, nachdenklichen Momenten ermutigen. Durch die Gestaltung der täglichen, wöchentlichen und jahreszeitlichen Routinen könnte ein solches Heim ein fester Bezugspunkt werden, das – gerade weil sein Entwurf auf einer genauen Lebensbeobachtung basiert – jede Form des Lebens wertschätzt und erhält. Am Ende seines Vortrags ‚Bauen Wohnen Denken’ war Heidegger vorsichtig und bot keine ‚Gestaltungsrezepte’ an; vielmehr bat er seine Zuhörer, seine Ideen weiterzudenken. Vermutlich ist ein Denken seiner provozierenden Thesen über Wohnen und Bauen nur möglich, indem man sie lebt und sich bei der Planung für andere von den eigenen Erfahrungen aus dem Alltagsleben leiten lässt. Seine Philosophie mag zwar viele Fragen aufwerfen, aber vielleicht lohnt sich der Versuch, eine gewisse Zeit lang mit Martin Heidegger zu leben. Adam Sharr ist Professor für Architektur an der Newcastle University, Leiter von Adam Sharr Architects und Mitherausgeber von ‚arq: Architectural Research Quarterly’, herausgegeben von Cambridge University Press. Er schrieb unter anderem ‚Heidegger’s Hut’ (MIT Press, 2006) und ‚Heidegger for Architects’ (Routledge, 2007). D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Ohne Titel (Rasen 1) Düsseldorf, 2002 21 22 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Ohne Titel (Plattenbau 4) / Detail. Berlin, 2004 DAS LEBEN DES ‚NUTZERS’ Einst viel diskutiert, dann fast vergessen und schließlich wiederentdeckt – der Begriff ‚Nutzer’ hatte in der Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts viele Bedeutungen. Von einer anonymen Zielgruppe sind die ‚Nutzer’ zu kreativen Kräften mit Einfluss auf die Planung und Zweckbestimmung von Gebäuden avanciert. Von Adrian Forty Fotos von Andreas Gefeller Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts tauchte ein neuer Begriff in der Architektensprache auf: der ‚Nutzer’. Im Gegensatz zu anderen, auf den ersten Blick synonymen Ausdrücken wie ‚Bewohner’ oder ‚Bauherr’ definierte der ‚Nutzer’ ein neuartiges Verhältnis zwischen Architekten und Gesellschaft. Zur Prägung dieses neuen Begriffs trugen in erster Linie die umfangreichen öffentlichen Bauprogramme in den westlichen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg bei, die Wohngebäude, Schulen und Krankenhäuser in einem bislang unbekannten Ausmaß entstehen ließen. Nur in Ausnahmefällen waren den Architekten die Personen bekannt, die die Gebäude beziehen sollten, sodass sie deren mutmaßlichen Ansprüche gewissermaßen erahnen mussten, damit die Gebäude ihren praktischen und ideologischen Zweck erfüllen konnten. Der ‚Nutzer’ erfüllte diese Aufgabe, blieb aber trotzdem stets Fiktion und für die Architekten eine notwendige Abstraktion, um ihre Pflichten gegenüber dem Staat, für den sie arbeiteten, und indirekt gegenüber der Öffentlichkeit, für welche die Gebäude bestimmt waren, zu erfüllen. In den 1970er-Jahren geriet der Begriff in die Kritik; mit dem Rückgang der staatlichen Investitionen in umfangreiche Bauprogramme verlor er seinen Sinn und wurde unpopulär. In den 1990ern tauchte der ‚Nutzer’ im Architekturdiskurs erneut auf, nun allerdings mit gänzlich anderem Zweck: Er sollte das Architekturschaffen nicht mehr unterstützen, sondern in Frage stellen. Des Architekten Diener Den Optimismus und das Interesse, die dem ‚Nutzer’ in den Nachkriegsjahren entgegengebracht wurden, brachte Henry Swain, englischer Architekt im öffentlichen Dienst, in einer Erklärung aus dem Jahr 1961 auf den Punkt: „Die Entwicklung von Techniken, mit deren Hilfe wir die Anforderungen der Gebäudenutzer analysieren können, ist die dringlichste Aufgabe unseres Metiers.“1 Ähnlich wie viele Architekten seiner Zeit vertrat er die Ansicht, dass sich auf der Grundlage einer sorgfältigen und systematischen Analyse der Nutzerbedürfnisse Gebäude entwerfen ließen, die ihren Beziehern nicht nur dienlicher und gefälliger wären, sondern auch die Architekten von überalteten Strickmustern und Konventionen befreiten. Nur durch eine vorbehaltlose Nutzerorientierung könne die Architektur ihrem Anspruch gerecht werden, besseren Lebensraum zu schaffen. Mit der konkreten Analyse der Nutzerbedürfnisse gingen jedoch auch Bedenken im Hinblick auf die langfristige Nutzbarkeit von Gebäuden sowie die Erkenntnis einher, dass sich die Ansprüche der Nutzer oft schneller änderten, als die Gebäude dies zuließen. Demografische Veränderungen – zum Beispiel die Größe der Haushalte – ließen auch die raffiniertesten Entwürfe rasch unbrauchbar werden; Ergebnis war ein riesiger Gebäudebestand, der den sozialen Bedürfnissen der Zukunft nicht gerecht wurde. Die Architekten erkannten die Unmöglichkeit, alle später möglichen Nutzungen eines Gebäudes im Planungsprozess lückenlos vorherzusehen, und suchten nach Möglichkeiten, unbestimmte Elemente in ihre Entwürfe einzubauen, um diese wandlungsfähiger zu gestalten. Während extreme Nutzerorientierung eine exakte Planung begünstigte, ließ Übergenauigkeit die Gebäude nutzlos werden. Dies führte zur Prägung eines neuen Schlagworts in der Architektur der Nachkriegszeit: ‚Flexibilität’ lautete das Gegenmittel zu den übertrieben präskriptiven und gebrauchsorientierten Entwürfen und wurde zum ständigen Begleiter des Begriffs ‚Nutzer’. Flexibilität konnte sich in unterschiedlicher Weise manifestieren, zum Beispiel in Form von Redundanz – um Rem Koolhaas zu zitieren, durch „ Schaffung von Spielräumen und überschüssigen Kapazitäten, die unterschiedliche und sogar gegensätzliche Interpretationen und Nutzungszwecke ermöglichen“2 – oder durch technische Mittel wie herausnehmbare (oder bewegliche) Wände und Böden, die starre Raummuster auflösten. Zu den fortschrittlichsten Varianten gehörten kybernetische Systeme, die auf wechselnde Gebäudenutzungen reagieren konnten. Ein Beispiel hierfür war Cedric Prices Projekt ‚Fun Palace’. Während Einwände gegen die Nutzerorientierung vorrangig von außerhalb der Architektenzunft kamen, wurde Kritik an der ‚Flexibilität’ von den Architekten selbst geäußert. Obwohl der Begriff des Nutzers dem löblichen huma- “Flexibilität [...] hat nur etwas mit Ungewissheit zu tun, mit der Weigerung, sich festzulegen und die Verantwortung zu übernehmen, die unweigerlich mit jeder menschlichen Handlung verbunden ist.” Herman Hertzberger in: Forum, Bd..16, Nr. 2, 1962 23 Ohne Titel (Plattenbau 2) / Detail Berlin, 2004 24 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 „Flexibilität als solche sollte nicht überbetont oder zu einer weiteren abstrakten Architekturmode werden. […] Wir müssen uns vor dem Handschuh hüten, der allen Händen passt, damit aber noch lange keine Hand ist.” Aldo van Eyck in: Forum, Band.16, Nr.2, 1962 nitären Ansinnen entsprang, besseren Lebensraum zu schaffen, geriet er in den 1970ern als eine der Ursachen für die Dehumanisierung des modernen Lebens unter Beschuss. Hierbei ging es um die Verwendungsweise des Begriffs, der die Menschen ihrer Individualität beraubte und ihnen eine zweifelhafte Einheitlichkeit verlieh. Der französische Philosoph Henri Lefebvre etwa schreibt in seinem 1974 erschienenen Buch Die Produktion des Raums: „Das Wort ‚Nutzer’ … hat etwas Vages – und vage Verdächtiges an sich. ‚Nutzer wovon?’, fragt man sich. … Der Raum des Nutzers wird gelebt – nicht repräsentiert (oder erdacht).“ 3 Im Verständnis Lefebvres war die Kategorie des ‚Nutzers’ ein Mittel, mit dem moderne Gesellschaften ihren Mitgliedern die Möglichkeit nahmen, Raum als ein gelebtes Phänomen zu erfahren (indem sie diesen in eine mentale Abstraktion oder ‚Repräsentation’ verwandelten), und mit dem sie die Menschen noch weiter beleidigten, indem sie sie selbst in Abstraktionen verwandelten und ihnen somit die Möglichkeit nahmen, sich selbst in einem Raum zu erkennen. Diesem kurzen Zitat ist allerdings zu entnehmen, dass Lefebvre den ‚Nutzer’ nicht nur negativ sah; vielmehr behagte ihm der Gedanke sehr, dass die Nutzer von ihrem Recht Gebrauch machten, Raum zu bewohnen und ‚mit Leben zu füllen’. Laut Lefebvre ließ sich dies auf vielerlei Weise manifestieren, zum Beispiel durch die frühchristliche Nutzung römischer Basiliken als Kirchen. In seinen eigenen Worten war er „für Aneignung und für Nutzung … und gegen Austausch und Dominanz“ oder, anders ausgedrückt, gegen die Kontrolle durch Marktkräfte und Kapitalherrschaft.4 Genau diese Auffassung des Nutzers, der über ein gewisses Störungspotenzial verfügt, wurde gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts in Architektenkreisen populär. Flexibilität versus Formlosigkeit Die Flexibilität als Mittel, um Gebäude einem unvorhergesehenen Wandel der Nutzerbedürfnisse anzupassen, wurde in den 1950ern und 1960ern nachhaltig propagiert und umfassend erforscht, geriet aber in überraschend heftige Kritik seitens der Architekten selbst. Ihr Haupteinwand war, dass die Räume, die aufgrund ihrer Unbestimmheit eine Vielfalt an Nutzungszwecken ermöglichen sollten, oft fade und neutral waren und jeglicher Charakteristik entbehrten. Der niederländische Architekt Aldo van Eyck bemerkte: „Wir müssen uns vor dem Handschuh hüten, der allen Händen passt, damit aber noch lange keine Hand ist.“ 5 Ähnliche Bedenken äußerte in den frühen sechziger Jahren Herman Hertzberger, ebenfalls niederländischer Architekt: „Flexibilität heißt – in Ermangelung einer bestimmten Lösung, die allen anderen vorzuziehen ist – die völlige Ablehnung eines festen und klaren Standpunkts. Der flexible Plan entspringt der Gewissheit, dass eine passende Lösung für das Problem nicht existiert, weil sich das zu lösende Problem in einem ständig fließenden und somit temporären Zustand befindet. Flexibilität … hat nur etwas mit Ungewissheit zu tun, mit der Weigerung, sich festzulegen und die Verantwortung zu übernehmen, die unweigerlich mit jeder menschlichen Handlung verbunden ist.“ Obwohl Hertzberger die Flexibilität so kritisch sah, galt sein Bestreben doch dem Entwurf von Gebäuden, deren künftige Funktionen und Nutzungszwecke nicht unwiderruflich festgelegt waren. Seine Lösung bezeichnete er als ‚polyvalente’ Formen – „eine Form, die, ohne sich selbst zu verändern, zu jedem Zweck genutzt werden kann und bei minimaler Flexibilität optimale Lösungen gestattet“.6 Ein polyvalenter Raum offenbarte alternative Verwendungsmöglichkei- ten, auch wenn diese vom Architekten gar nicht vorgesehen waren. Ziel war die Schaffung imaginärer Interpretationsräume für die Hausbewohner. Mit diesem Ansatz wurde die Verantwortung den Nutzern überlassen, um diese dazu anzuleiten, die für sie geschaffenen Räume umzugestalten oder, noch radikaler, die vom Architekten geplanten Verwendungszwecke zu untergraben. Hertzbergers Entwürfe für Schulen, Wohnhäuser, Seniorenheime, Bürogebäude und Studentenwohnheime verkörpern diese Strategie, bei der es den Nutzern überlassen bleibt, einem Raum einen bestimmten Zweck zuzuweisen. Die von Hertzberger bereits früh erkannte Möglichkeit des Nutzers, als kreative Kraft in der Architektur zu fungieren, diente als Basis für dessen Rückkehr in die Architekturtheorie der neunziger Jahre. Diese Entwicklung ist im Zusammenhang mit einem generellen Wandel in allen Bereichen der Kunst zu sehen: Man begann, der Rezeption von Kunstwerken größere Aufmerksamkeit zu widmen und die Intentionen der Schöpfer in den Hintergrund zu rücken. So wird mittlerweile in der Literatur dem Akt des Lesens genauso viel Bedeutung wie dem Akt des Schreibens beigemessen, und der Kinogänger ist nicht mehr nur passiver Empfänger der Intentionen des Regisseurs, sondern ein Individuum, das den Film je nach eigener Identität und Bildung interpretiert. Ähnlich verhält es sich in der Architektur: Die letztendliche Bestimmung eines Bauwerks offenbart sich im Wettstreit zwischen den Intentionen des Architekten und des Bauherrn einerseits und dem Nutzer andererseits. Ein solches Verständnis von der Rolle des Nutzers verdankt vieles den Erkenntnissen in der Sprach- und Literaturwissenschaft, wie Hertzberger selbst einräumte. Die starke Analogie zwischen Lesern und Nutzern erkannte schon der fran25 „Flexibilität trägt nicht automatisch zu einer besseren Funktionsfähigkeit der Dinge bei (denn Flexibilität führt in einer gegebenen Situation nie zu den bestmöglichen vorstellbaren Resultaten).” Herman Hertzberger 1967 zösische Literaturtheoretiker Roland Barthes, der in einer Vorlesung zu Semiologie und Urbanismus im Jahr 1967 bemerkte: „Die Stadt ist ein geschriebener Text; derjenige, der durch die Stadt geht, also der Nutzer der Stadt (was wir letztendlich alle sind, Nutzer der Stadt), ist eine Art Leser.“ 7 Diese Interpretation des ‚Nutzers’ als Äquivalent zum ‚Leser’ stieß auf großes Interesse im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert. Der kreative Nutzer Die Kombination älterer Vorstellungen von Flexibilität mit neueren Ansätzen aus der Literaturtheorie erlebt seit den neunziger Jahren in vielerlei Hinsicht ein Comeback. Erneut wurden Versuche gestartet, Gebäude mit eher unspezifischem Verwendungszweck zu entwerfen, die sich den kulturellen und sozialen Veränderungen besser anpassen. Dieser fachübergreifende Interpretationsansatz impliziert allerdings auch eine Kritik an der konventionellen Architekturpraxis, die ‚Architektur’ als bloßes Architektenwerk anzusehen. Architektur wird demzufolge nicht nur von Architekten ‚gemacht’, sondern ergibt sich vielmehr nach Fertigstellung der Gebäude durch die kreativen Handlungen ihrer Nutzer. Einige dieser Ideen formuliert der Architekt und Theoretiker Jonathan Hill im Zuge einer breiter angelegten Kritik an der Professionalisierung der Architektur zugunsten eines kleinen Expertenkreises, die nur möglich war durch die freiwillige Beschränkung der Definition von Architektur auf das Werk von Architekten. Hill möchte die Definition von Architektur um das erweitern, was mit den Gebäuden nach ihrer Ingebrauchnahme geschieht. Interessanterweise zieht Hill den Ausdruck ‚Nutzer’ anderen Alternativen wie ‚Bewohner’ oder ‚Wohnungsinhaber’ vor, weil „er aktives Handeln und das Potenzial missbräuchlicher Verwendung suggeriert“. 8 In die26 ser neuen Formulierung ist der ‚Nutzer’ nicht mehr bloßer Modellbürger, dessen Verhalten und Erwartungshaltungen auf ein normatives soziales Gut fokussiert sind, sondern impliziert auch Personen mit möglicherweise bösartigen oder gar verbrecherischen Absichten. Nach wie vor jedoch bleiben die ‚Nutzer’ Fiktionen, imaginäre Schauspieler, auf die sich die Architekten verlassen, um für ihre Häuser Leben zu ersinnen. Adrian Forty ist Professor für Architekturgeschichte an der Bartlett School of Architecture des University College London und Vorsitzender des European Architectural History Network. Sein Hauptinteresse gilt der Rolle von Architektur und Artefakten im sozialen und geistigen Gesellschaftsgefüge. Seine Forschungen umfassen Arbeiten zur Gestaltung von Konsumgütern, zu Sprache und Architektur sowie zu Architektur und kollektivem Gedächtnis und Vergessen. Adrian Fortys neueste Studien zur Rolle von Beton als globalem Medium erscheinen im Frühjahr 2012. Anmerkungen 1. Henry Swain, ‘Buildings for People’, Journal of the Royal Institute of British Architects, Band 68, November 1961, S.508 2. Rem Koolhaas und Bruce Mau, S,M,L,XL. 010 Publishers, Rotterdam, 1995, S.240 3. Henri Lefebvre, The Production of Space (1974), Übersetzung von D. Nicholson-Smith. Blackwell, Oxford, 1991, S.362. 4. Henri Lefebvre, The Production of Space, S.368 5. Aldo van Eyck, ‘A Step Towards a Configurative Discipline’, in: Forum, Band 16, Nr.2, 1962, S.93 6. Herman Hertzberger, ‘Flexibility and Polyvalency’, in: Forum, Band 16, Nr.2, 1962, S.117 7. Roland Barthes, ‘Semiology and Urbanism’ (1967), in: Joan Ockman (Hrsg.), Architecture Culture 1943–1968. A Documentary Anthology. Rizzoli, New York, 1993, S.417. 8. Jonathan Hill, Actions of Architecture, Architecture and Creative Users. Routledge, London und New York, 2003, S.27. D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Ohne Titel (Plattenbau 1) Berlin, 2004 27 „Mit den Jahren wurde das Haus zum eingeweihten Mitwisser. Es bot ersten Techtelmechteln Raum, sah bei Hausaufgaben über die Schultern, war dabei, als gerade aus dem Krankenhaus eingetroffene Babys zum ersten Mal gewickelt wurden, und fand sich mitten in der Nacht von geflüsterten Gesprächen in der Küche überrascht. […] Auch wenn das Haus für so manches Problem seiner Bewohner keine Lösung anzubieten vermag, lassen seine Zimmer doch ein Glück erahnen, zu dem die Architektur ihren entscheidenden Beitrag geliefert hat.” Alain de Botton in: Glück und Architektur, 2008 28 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 NACHHALTIG WOHNEN 29 Gebäudebestand in Europa Nur etwa ein Prozent des europäischen Gebäudebestands wird jährlich neu errichtet. Die Hälfte des Bestands datiert hingegen aus der Zeit zwischen 1945 und 1980 und hat nun ein Alter erricht, in dem eine umfassende Sanierung ansteht. Grafik: Ungefähre Durchschnittswerte aus den Niederlanden, Frankreich und Deutschland 30% vor 1945 30 50% zwischen 1945 und 1980 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 19% nach 1980 1% Neubau pro Jahr 32 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 WELCHE ZUKUNFT HAT DAS NIEDERLÄNDISCHE REIHENHAUS? Sanierung und Erweiterung von 10 Reihenhäusern Architekten: BowhulpGroep, Utrecht Adresse: Poorterstraat 29-47, Montfoort, NL Baujahr: 1976 33 34 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 BESONDERE NORMALITÄT Im Städtchen Montfoort werden in den nächsten Monaten zehn Reihenhäuser aus den siebziger Jahren zu den ersten Aktivhäusern der Niederlande umgebaut. Abgesehen von dieser Premiere gibt es noch etwas, was das Projekt außergewöhnlich macht: Es handelt sich um Sozialbauten. Von Anneke Bokern Fotos von Torben Eskerod So sieht also die niederländische Bauaufgabe der Zukunft aus: eine verschlafene Wohnstraße am Rande eines Städtchens südwestlich von Utrecht, flankiert von Reihenhäusern aus den siebziger Jahren. Leberwurstfarbener Backstein, hellblaue Stülpschalung, weiße Kunststofffensterrahmen, tief heruntergezogene Ziegeldächer. Niedrige Jägerzäune in allen Varianten, die der Baumarkt hergibt, trennen die zugepflasterten Vorgärtchen von der Straße. Gewöhnlicher geht es kaum – und genau das ist so ungewöhnlich. Denn zehn Reihenhäuser in dieser Straße sollen in den nächsten Monaten zu den ersten Aktivhäusern der Niederlande umgebaut werden. Wenn in den Niederlanden von nachhaltiger Architektur gesprochen wird, geht es meist um millionenschwere Vorzeigeprojekte: solitäre Büroneubauten, die mit allen erdenklichen technischen Finessen ausgestattet werden, oder Stadtentwicklungsprogramme, für die man Cradle-to-CradleGurus als Berater anheuert. Das ist zwar gut fürs Prestige, aber mit der Lebensrealität der meisten Niederländer hat es wenig zu tun. Die Realität ist ein Wohnungsbaubestand aus Millionen schlecht gedämmten, einfach verglasten und ziemlich gesichtslosen Reihenhäusern, die nach dem zweiten Weltkrieg überall aus den Poldern gestampft wurden, denen aber in den vergangenen Jahrzehnten – jenseits der allernötigsten Sa- nierungsmaßnahmen – kaum jemand Aufmerksamkeit schenkte. Geändert hat sich das erst durch die jüngste Wirtschaftskrise, die deutlich gemacht hat, dass man auch in den Niederlanden nicht bis in alle Ewigkeit nur auf kurzfristig profitablen Neubau setzen kann. Die Realität ist die Poorterstraat in Montfoort. Zwischen Polder und Sportplatz Montfoort ist eine Gemeinde mit etwa 13.000 Einwohnern und liegt im ländlichen „grünen Herzen“ des Ballungsraums Randstad. Nur ein paar Minuten nach dem Verlassen der Autobahn passiert man das Ortsschild – und dann kommt erst einmal lange gar nichts, außer Bauernhöfen und Viehweiden. Erst nach einer Weile schiebt sich in der Ferne ein Kirchturm ins Bild. Der Weg in die Poorterstraat führt allerdings am mittelalterlichen Kern des Städtchens vorbei und schnurstracks in eine Wohnsiedlung aus den siebziger Jahren. Dort angekommen, verlässt einen plötzlich jegliches Ortsgefühl, denn so sehen Wohnsiedlungen überall im Land aus, von Roermond bis Groningen und von Breskens bis Heerhugowaard. Hofland heißt das Mitte der Siebziger angelegte Viertel, das aus einem Dutzend ruhiger Wohnstraßen mit Reihenhausbebauung und kleinen Sammelparkplätzen besteht. Im Westen grenzt es direkt an offenes Polderland, im Osten an einen großen Sportpark. Innerhalb Montfoorts hat die Poorterstraat nicht den besten Ruf. Denn obwohl man es auf den ersten Blick kaum sieht, sind die Reihenhäuser der Straße allesamt Sozialbauten. In den meisten anderen Ländern wäre das unmittelbar an der Architektur ablesbar, aber in den Niederlanden galt stets die linksliberale Maxime, dass sozialer Wohnungsbau sich von außen betrachtet möglichst wenig von regulären Eigenheimen unterscheiden sollte. Auf den zweiten Blick jedoch fällt auf, dass auf den Parkplätzen in der Poorterstraat nur Kleinwagen älteren Jahrgangs stehen und dass die Auffahrten mit zusammengeklaubten Gehwegplatten gepflastert sind, zwischen denen sich das Unkraut durchdrückt. Auch den Häusern selber kann man dank billiger Fensterrahmen und lieblos zusammengeschraubter, schlecht gepflegter Fassadenelemente ansehen, dass sie nicht gerade zum gehobenen Preissegment gehören. Dass das nicht viel früher auffällt, ist auf den verhältnismäßig introvertierten Charakter der Gebäude zurückzuführen. Sind die Niederlande sonst für ihre großen, gardinenlosen Wohnzimmerfenster bekannt, die direkt an der Straße liegen und durch die Passanten das gesamte Interieur auf einen Blick erfassen können, so grenzen in der Poorterstraat nur die schlitzartigen Fensterchen der Abstellräume unter der Dachschräge an die Straße, während sich die Hauptfassade mit Küchenfenster jenseits der Auffahrt befindet. Ob dahinter teure Designermöbel stehen oder Billigware aus dem Möbelhaus, bleibt neugierigen Blicken verborgen. Nur der massenproduzierte Nippes, der manch ein Vorgärtchen ziert, verrät etwas über die Bewohner der Straße. „Derzeit erreichen die Häuser mit ihrer schlechten Wärmedämmung und veralteten Heizkesseln nur EU-Energielabel E. Nach der Renovierung soll daraus Energielabel A werden. Die zehn Häuser am Ende der Poorterstraat [...] sollen danach sogar A++ erreichen.” Anneke Bokern Geräumig und doch düster Insgesamt gibt es 92 Häuser dieses Typs, die nun allesamt gründlich modernisiert werden sollen. Derzeit erreichen sie mit ihrer 35 „Im Moment kann man sich noch kaum vorstellen, dass die Poorterstraat in wenigen Monaten einige der fortschrittlichsten Sozialbauten der Niederlande beherbergen soll. Die Häuserzeile scheint in den siebziger Jahren gefangen, als hätte man sie in Aspik gegossen: bewegungsunfähig, aber nur leidlich konserviert.” Anneke Bokern schlechten Wärmedämmung und veralteten Heizkesseln nur EU-Energielabel E. Nach der Renovierung soll daraus Energielabel A werden. Die zehn Häuser am Ende der Poorterstraat, die als Pilotprojekt zu Aktivhäusern umgebaut werden, sollen danach sogar A++ erreichen. Im Inneren der Häuser wird deutlich, weshalb sie sich für einen solchen Umbau eignen: Für niederländische Sozialwohnungen, die in der Regel sehr beengt sind, bieten sie erstaunlich viel Platz. Hinter der Eingangstür befindet sich ein kleiner Windfang. Von dort betritt man direkt Küche und Wohnzimmer, die als ein einziger, etwa 45 Quadratmeter großer Raum angelegt sind, wobei der Wohnbereich zum kleinen Garten hin orientiert ist. Eine Treppe führt in den ersten Stock mit innen liegendem und folglich fensterlosen Badezimmer sowie drei Schlafzimmern, von denen das größte über einen zusätzlichen kleinen Abstellraum unter der Dachschräge verfügt. Der Dachboden dient als Stauraum und ist über eine Einschubtreppe erreichbar. So weit, so gewöhnlich. Bei aller Geräumigkeit wirken die Häuser im Inneren aber doch etwas düster und bedrückend. Das liegt an der Position der Küchenfenster in einem schlecht belichteten Winkel der Gebäude und am mannshoch umzäunten kleinen Garten, aber auch an den recht niedrigen Decken, die mit billigem, lichtschluckendem Spritzputz versehen sind. Das Wohnzimmer mit Küchenecke ist ein schlauchartiger Raum, in dessen Mitte kaum Tageslicht dringt. Es riecht nach Ledersofa und nach dem Essen vom Vortag, aber auch nach dem feuchten Rasen im Garten, denn es hat gerade geregnet, und die Türen stehen offen. Irgendwie verströmen die Häuser eine Siebziger36 jahre-Atmosphäre, an der auch Flachbildschirm und Mikrowelle nichts ändern können. Aus der Ferne hört man Jubelschreie: Im Fernsehen wird ein Fußballspiel des FC Utrecht übertragen. Sonst ist es still in der Poorterstraat. Daseinsberechtigung für die Dachschräge Insgesamt hat man den Eindruck, dass der Architekt mit den Dachschrägen der Häuser, die von außen betrachtet so charakteristisch sind, nicht wirklich etwas anzufangen wusste, denn sie bergen nichts außer Abstellraum und verhindern, dass das Tageslicht in die dahinter liegenden Wohnräume fallen kann. Dabei handelt es sich vom Grundriss her eigentlich um den niederländischen Standardtypus der „doorzonwoning“, also „Durchsonnwohnung“, deren größte Qualität der Lichteinfall von beiden Fronten sein sollte. Ein Hauptziel des Umbaus ist dementsprechend, mehr Licht in die Häuser zu bringen. Das wird vor allem mittels des Ausbaus des Dachgeschosses zum zusätzlichen Wohnraum mit einer Dachterrasse, großen Dachfensterflächen und einer fest eingebauten Treppe geschehen. Durch das neue Treppenhaus kann das Licht bis hinunter ins Erdgeschoss und unterwegs durch ein neues Innenfenster auch in das Badezimmer fallen – was in den Niederlanden eine Seltenheit ist. Ein mindestens ebenso wichtiges Element der Modernisierung ist jedoch die energetische Verbesserung der Gebäude. Fassaden und Geschossböden werden komplett neu gedämmt. Die Fenster erhalten eine Dreifachverglasung, und es wird ein neues, mit Zink gedecktes Dach installiert. Auf diesem Dach werden pro Wohnung 23 Quadratmeter Sonnenkollektoren angebracht. Ergänzt werden diese durch einen Pufferspeicher für die Solarwärme, eine Niedrigener- gieheizung mit Außenluft-Wärmepumpe und eine kontrollierte Lüftung, die über CO2-Sensoren gesteuert wird. Untergebracht wird die Technik größtenteils in der heutigen Abstellkammer im Erdgeschoss. Dass Bäder und Küche komplett erneuert werden, versteht sich von selbst, und natürlich werden die Häuser auch außen generalüberholt. Dafür werden die alten Wandschalen komplett entfernt und durch neues Mauerwerk aus weiß gesintertem Backstein ersetzt. Holzfensterrahmen werden an die Stelle der alten Plastikfenster treten, und unter den Fenstern werden im Obergeschoss hölzerne Brüstungen, im Erdgeschoss anthrazitfarbene Glaspaneele angebracht. Damit dürften die Häuser sowohl innen als auch außen wesentlich freundlicher und heller werden. Obendrein erhalten sie zusätzliche Wohnfläche und verbrauchen viel weniger Energie. Fragt sich nur, wie die Wohnungsbaugesellschaft einen derart aufwendigen Umbau von Sozialwohnungen finanzieren kann? Die Lösung war in diesem Fall eine unkonventionelle Abmachung mit den Bewohnern: Was sie zukünftig an Energiekosten sparen, wird auf die Miete aufgeschlagen. Damit ergibt sich für die Bewohner eine Nullsummenrechnung, während die Wohnungsbaugesellschaft ihre Investition allmählich zurückverdient. Im Moment kann man sich noch kaum vorstellen, dass die Poorterstraat in wenigen Monaten einige der fortschrittlichsten Sozialbauten der Niederlande beherbergen soll. Die Häuserzeile scheint in den siebziger Jahren gefangen, als hätte man sie in Aspik gegossen: bewegungsunfähig, aber nur leidlich konserviert. Tagsüber herrscht völlige Stille in der Wohnstraße. Man kann beinahe hören, wie die Farbe von D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 den Stülpschalungen blättert. Auf die kommende Unruhe deutet nur ein vereinzelter Bewohner hin, der mit einem Stapel Umzugskartons unter dem Arm vom Parkplatz zu seinem Haus läuft. Bald wird es vorbei sein mit der Austauschbarkeit. Wobei man eigentlich hofft, dass viele Wohnungsbaugesellschaften dem Vorbild folgen, sodass die Reihenhäuser in der Poorterstraat in Zukunft wieder genauso in der Masse untergehen, wie sie es in den ersten 35 Jahren ihres Daseins taten. Anneke Bokern ist freie Architekturund Designjournalistin. In Frankfurt/ Main geboren, studierte sie in Berlin Kunstgeschichte und zog 1999 nach Amsterdam. Sie berichtet für deutsche und internationale Medien über Architektur, Kunst und Design aus den Niederlanden. 37 38 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Active House-Diagramm: Reihenhäuser in Montfoort Der Begriff ,Active House’ beschreibt eine Vision von Gebäuden, die ihren Bewohnern ein gesunderes, komfortableres Leben ermöglichen, ohne Umwelt und Klima negativ zu beeinflussen. Der 2011 entwickelte ‚Active House’–Kriterienkatalog versteht sich als Planungshilfe und zugleich als Bewertungsmethode für die Nachhaltigkeit von Gebäuden. Active Houses werden anhand ihrer Energiebilanz, ihres Raumklimas und ihrer Umweltwirkungen beurteilt. Jede der drei Kategorien besteht aus drei bis vier Einzelkriterien (wie zum Beispiel Energiebedarf, Raumluftqualität oder Schallschutz und Akustik), die sowohl anhand quantitativer wie auch qualitativer Aspekte ermittelt werden. Das Active HouseDiagramm zeigt die Bewertungskriterien und ihre Wechselwirkung untereinander. Da die Sanierung der Häuser in Montfoort noch bevorsteht, basiert die Bewertung auf qualifizierten Schätzungen und bisherigen Planungsergebnissen. Die drei Bewertungskategorien des Systems sind: Energie Das Gebäude hat eine optimierte Energiebilanz und nutzt ausschließlich erneuerbare Energien Raumklima Es trägt positiv zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei Umwelt Das Gebäude wurde im Hinblick auf seine Umweltwirkungen und Ressourcennutzung optimiert 2.1 Jährliche Energiebilanz 4.3 Trinkwasserverbrauch und Abwasserbehandlung 2.2 Energiebedarf 4.2 Umweltbelastung durch Emissionen in Luft, Boden und Wasser 2.3 Energieversorgung 3.2 Tageslicht und Ausblicke 4.1 Verbrauch nichterneuerbarer Energieressourcen 3.5 Schallschutz und Akustik 3.3 Thermischer Komfort 3.4 Raumluftqualität 39 „ES GEHT AUCH UM DEN LERNEFFEKT“ Interview mit Peter Korzelius „Aus einem Haus wurden schließlich zehn, die nach der Renovierung ein A++-Label bekommen werden. Damit sind sie, was die Energieeffizienz angeht, besser als ein Neubau.” Peter Korzelius Herr Korzelius, Sie leiten die Wohnungsstiftung Groen West, zu der auch die Stichting Woonbelangen Weidegebied (SWW) als Bauherr des Projekts in der Poorterstraat gehört. Wie setzt sich der Gebäudebestand Ihres Unternehmens zusammen? SWW selbst besitzt insgesamt etwa 5000 Wohnungen und Einfamilienhäuser, davon 800 in Montfoort. Anfang 2011 sind wir jedoch mit einer anderen Wohnungsbaugesellschaft fusioniert und haben jetzt gemeinsam etwa 12000 Wohnungen im gesamten westlichen Teil der Provinz Utrecht. Inwieweit sind die Häuser in der Poorterstraat repräsentativ für Ihren Bestand? Sie sind auf jeden Fall repräsentativ. Wir haben viel Gebäudebestand aus den siebziger und achtziger Jahren, bei dem es nach vierzig Jahren an der Zeit für eine Generalüberholung ist. Damit befassen wir uns derzeit. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Stärken und die Schwachpunkte der Häuser? Die größte Stärke ist, dass es große Häuser mit einem großen Garten sind. Aber ihr bautechnischer Zustand ist nicht besonders gut. Deshalb müssen sie renoviert werden. Da diese Häuser einen besonders hohen Zukunftswert haben, haben wir beschlossen, sie zu Pilotwohnungen zu machen. Was macht den hohen Zukunftswert aus? Sie sind groß, und die Lage ist gut. Normalerweise schreiben wir Wohnungen nach 50 Jahren ab. Aber diese hier können nach der Renovierung sicher nochmals 50 Jahre lang Gewinne abwerfen. Die Gemeinde Montfoort will auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit aktiver werden. Deshalb haben wir vor ein paar Jahren angekündigt: 40 Wir möchten eines der Häuser in der Poorterstraat nehmen und darin alles, was irgend möglich ist, auf den neuesten energetischen Stand bringen. Aus einem Haus wurden schließlich zehn, die nach der Renovierung ein A++-Label bekommen werden. Damit sind sie, was die Energieeffizienz angeht, besser als ein Neubau. Warum haben Sie dieses Pilotprojekt gestartet? Im Prinzip hätten wir natürlich für dasselbe Geld auch Neubauten realisieren können. Wir sehen uns aber damit konfrontiert, dass wir in den nächsten fünf bis sieben Jahren ein Drittel unseres Baubestands – also 4000 Wohnungen – sanieren müssen. Das ist eine enorme Aufgabe. Mit diesem Projekt wollen wir ausloten, was es bedeutet, wenn man das wirklich bis zu den Grenzen des technisch Möglichen treibt: so viel Tageslichteinfall wie möglich bei so wenig Energieverbrauch wie möglich. Darüber haben wir einige interne Diskussionen gehabt. Vor allem nach der Fusion gab es viel Gegenwind, denn es ist ein teures Projekt. Wir investieren immerhin 160000 Euro in jede Wohnung. Aber ich bin mir sicher, dass sich dieses Projekt in zwanzig oder dreißig Jahren als gute Investition erwiesen haben wird. Was wir hier tun, können wir natürlich nicht bei 4000 Wohnungen machen – dafür haben wir, ehrlich gesagt, ganz einfach nicht das Geld. Aber es werden Aspekte dabei sein, die sich als erfolgreich erweisen und die wir bei anderen Renovierungsprojekten wiederholen können. Es geht auch um den Lerneffekt. Was werden die Bewohner von der Verwandlung ihres Hauses in ein Aktivhaus merken? Sie bekommen ein sehr sparsames Haus, das kaum Energie D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 verbraucht. Die Kosten für fossile Brennstoffe werden jedes Jahr höher, und damit steigt auch der Anteil der Energiekosten an den Wohnkosten kontinuierlich. Deshalb lohnt es sich, jetzt in die Reduktion der Energiekosten zu investieren. Hinzu kommt natürlich, dass die Bewohner mit dem Dachgeschoss einen riesigen Raum dazubekommen. Und der Tageslichteinfall wird optimiert. Wie würden Sie dieses Viertel beschreiben? Ich habe gehört, dass die Straße früher einen schlechten Ruf hatte? Ja, die Poorterstraat wurde nicht so geschätzt. Es sind natürlich Sozialbauten. Unsere Zielgruppe sind nun einmal Leute, die ein wenig Unterstützung brauchen und nicht unbedingt kapitalkräftig sind. In einem Städtchen, das hauptsächlich aus Eigenheimen besteht, ist das dem Ruf eines Viertels nicht gerade zuträglich. Oft ist das aber lediglich eine Imagefrage. Die Leute haben eine Meinung über eine Straße und deren Bewohner, die mit der Realität nichts zu tun hat. Deshalb ist es gut, dass ausgerechnet diese Straße jetzt zum Vorzeigeprojekt wird. Peter Korzelius ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Wohnungsstiftung GroenWest. Sie ging im Januar 2011 aus der Fusion mehrerer Wohnungsbaugesellschaften hervor, darunter auch SWW (Stichting Woonbelangen Weidegebied), deren Geschäftsführer Korzelius zuvor war und zu deren Bestand die Häuser in der Poorterstraat gehörten. 41 42 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 „WIR WOLLEN ZEIGEN, WIE WICHTIG NACHHALTIGKEIT IM WOHNUNGSBAU IST“ Interview mit Rob Jonkers Herr Jonkers, Sie sind Beigeordneter für Raumordnung und Wohnen im Gemeinderat von Montfoort. Wie lange sind Sie schon in der Lokalpolitik aktiv? Ich habe von 2002 bis 2006 bereits einmal im Gemeinderat gesessen. Danach habe ich eine Pause eingelegt, und jetzt bin ich seit 2010 wieder dabei. Wohnen Sie selber in Montfoort? Ja, seit fast zwanzig Jahren. Hat die Gemeinde sich in dieser Zeit verändert? Nein, das denke ich eigentlich nicht. Montfoort ist ein ruhiges Städtchen. Wächst oder schrumpft die Stadt? Nun, wir liegen im sogenannten ‚Grünen Herzen’ der Randstad. Das ist ein geschütztes Gebiet, dessen landschaftlicher Charakter bewahrt bleiben soll. Die Provinz gesteht uns deshalb Neubauaktivitäten und Erweiterungsprojekte nur in sehr beschränktem Rahmen zu. Deshalb können wir kaum wachsen, während wir gleichzeitig eine alternde Einwohnerschaft haben. Was für Wohnungen oder Wohnhäuser werden in Montfoort benötigt? Im Rahmen der Überalterung benötigen wir vor allem Seniorenwohnungen. Auch bezahlbare Wohnungen für junge Leute sind ein Thema. Die Wohnungspreise liegen bei uns recht hoch, deshalb haben junge Leute kaum Chancen, eine Wohnung zu kaufen. Gleichzeitig können wir aus den bereits erwähnten Gründen keine bezahlbaren Neubauten realisieren. Meiner Ansicht nach tut der Staat viel zu wenig, um Wohnraum für junge Leute zu schaffen. Wird zurzeit viel saniert in Montfoort? Ja, die Wohnungsbaugesellschaft SWW renoviert viel. Es gibt rund um den historischen Stadtkern einige Viertel aus der Nachkriegszeit, die dringend dem modernen Standard angepasst werden müssen. Das gilt auch für die Wohnungen in der Poorterstraat. Als Gemeinde versuchen wir, den Einwohnern über solche Projekte zu vermitteln, wie wichtig Nachhaltigkeit im Wohnungsbau ist. Charakter ist doch eher dörflich. Die Innenstadt ist hübsch, auch wenn in den achtziger Jahren viele schöne alte Gebäude abgerissen wurden. Wir haben ein lebendiges Vereinsleben, und da Montfoort eine katholische Enklave in protestantischem Gebiet ist, sind wir eine Karnevalshochburg. Es gibt hier jedes Jahr einen großen Karnevalsumzug mit fast hundert Wagen. Was können Sie als Beigeordneter beitragen, um diese Qualitäten zu fördern? Ich möchte vor allem das Vereinsleben fördern und außerdem bewirken, dass die Menschen hier von der Wiege bis zur Bahre wohnen können. Im Moment müssen noch zu viele Leute wegziehen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Welche Bedeutung hat das Projekt in der Poorterstraat in diesem Zusammenhang? Das Projekt ist einzigartig, weil es ja nicht nur um Nachhaltigkeit geht, sondern um Aktivhäuser. Damit ist es nicht nur in Montfoort etwas Besonderes, sondern in den gesamten Niederlanden. Wie würden Sie die Lebensqualität in Montfoort beschreiben? Montfoort ist sehr grün. Mit Utrecht liegt zwar eine Großstadt um die Ecke, aber man fühlt sich wie auf dem Land. Offiziell hat Montfoort Stadtrechte, aber sein Rob Jonkers ist parteiloser Beigeordneter für Raumordnung, Wohnen, Verkehr und Wirtschaft im Gemeinderat von Montfoort. 43 Interview mit Corine van Velzen „Dem braunen Kachelboden werden wir keine Träne nachweinen“ Corine van Velzen wohnt mit ihren beiden Kindern im Teenageralter in der Poorterstraat 31. Sie ist vor drei Jahren in das Haus gezogen, nachdem sie von ihrem Ehemann geschieden wurde. Sie sind vor drei Jahren in die Poorterstraat gezogen. Wie kam es dazu? CV: Naja, wir hatten keine Wahl. Ich war frisch geschieden und bekam von der Wohnungsbaugesellschaft dieses Haus zugewiesen. Wie gefällt Ihnen die Gegend? CV: Ganz gut. Wir haben nicht so viel Kontakt mit den Nachbarn. Das geht alles ein bisschen an uns vorbei. Ich glaube, das sieht man auch, denn wir wohnen nicht so sehr auf der Straße. Die anderen sitzen immer in den Vorgärten und reden miteinander. So sind wir nicht. Kennen Sie die holländischen Filmkomödien aus den achtziger Jahren über die asoziale Familie Flodder? Daran erinnern mich die Nachbarn hier teilweise. Die Straße hat ja keinen guten Ruf. Ist das immer noch so? Ich habe gehört, dass das vor allem früher der Fall war. CV: Also, ich bin wirklich nicht stolz auf meine Adresse. Wenn Leute mich fragen, wo ich wohne, rede ich mich irgendwie raus. desselben Typs in dieser Siedlung gewohnt. Wir wussten also, was uns erwartet. Ich habe auch noch einen Sohn, der heute bei seinem Vater ist. Sein Zimmer ist etwas klein. Aber sonst ist das Haus prima. Mal abgesehen davon, dass das Bad voller Schimmel ist. Bekommt Ihr Sohn nach dem Umbau ein großes Zimmer im neuen Dachgeschoss? CV: Nein, das bekomme ich! Erst hat er protestiert, aber das Zimmer wird keine Tür haben, sondern nur einen offenen Treppenaufgang. Das war ein schlagendes Argument, denn das will er nicht. Was versprechen Sie sich sonst noch von der Renovierung? CV: Viel Licht und eine gute Raumwirkung, sodass das Haus großzügiger wirkt. Wir stehen der Renovierung auf jeden Fall positiv gegenüber. Vor allem dem braunen Kachelboden im Wohnzimmer werden wir keine Träne nachweinen. Und das Haus selber? Fühlen Sie sich hier wohl? CV: Ja, das ist prima. Wir haben früher mal in einem anderen Haus 44 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 45 46 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 Interview mit Ron Vermeulen und Loes Oenema „Ich will eigentlich nicht mehr weg“ Ron Vermeulen wohnt mit seiner Freundin Loes Oenema in der Poorterstraat 37. Sie sind vor vier Jahren in das Haus eingezogen, nachdem ihnen ihre alte Wohnung zu klein geworden war. Warum sind Sie vor vier Jahren in die Poorterstraat gezogen? RV: Ich hatte vorher 15 Jahre lang eine kleine Wohnung in Woerden, da habe ich auch anderthalb Jahre mit meiner Freundin gewohnt. Aber es wurde zu klein, und hier wurde etwas frei. Am Anfang fand ich es schwer, mich hier einzugewöhnen. Aber es ist näher an meinem Arbeitsplatz, und wir haben ein paar nette Nachbarn. Ich will eigentlich nicht mehr weg. Was gefällt Ihnen besonders an diesem Haus? RV: Die Größe. Sonst gibt es eigentlich nichts Besonderes. Haben Sie einen Lieblingsplatz im Haus? RV: Nein, wir sitzen eigentlich überall gerne. Nur die Küche ist etwas unpraktisch. Dabei hat die Wohnungsbaugesellschaft sie damals eigens nach unseren Wünschen eingebaut, denn die Küche der Vormieter hatte überhaupt nicht der Bauverordnung entsprochen. Aber wir haben sie nicht gut geplant, denn am Tisch können wir nur nebeneinander sitzen anstatt einander gegenüber. Deshalb lassen wir jetzt beim Umbau die Küche an die Vorderseite des Raums verlegen. Was haben Sie mit dem zusätzlichen Raum im Dachgeschoss vor? RV: Das wissen wir noch nicht. Wir dachten erst, dass wir dort schlafen würden, aber meine Freundin möchte lieber auf dem Geschoss schlafen, wo die Toilette ist. Finden Sie es gut, dass Ihr Haus zum Pilotprojekt gehört? RV: Einerseits ja, andererseits nein. Für eine einfachere Renovierung hätten wir nicht ausziehen müssen. Und was halten Sie davon, dass die Häuser mit Solarzellen und Wärmepumpen ausgestattet werden? RV: Das ist alles ganz neu für uns. Wir wissen noch gar nicht, wie das wird. Naja, es werden Aktivhäuser, die viele Dinge selber regeln. LO: Oh, je ... Und wenn ich nach Hause komme, ist sicher auch das Essen schon fertig? RV: Ich finde, das ist ein schönes Projekt. Dafür sind wir auch bereit, ein paar Monate auszuziehen. Auch wenn meine Freundin das nur mit enormem Widerwillen tut. 47 Interview mit Marga und Edwin Hamelinck „Behaltet euren Neubau, wir nehmen das Haus!“ Marga und Edwin Hamelinck wohnen mit ihren zwei Söhnen und zwei Töchtern in der Poorterstraat 33. Seit ihrem Einzug vor 17 Jahren haben sie einen großen Teil des Hauses selbst renoviert. Wie lange wohnen Sie hier schon? EH: Gut 17 Jahre. Es war unser erstes gemeinsames Haus, und unsere vier Kinder sind alle hier zur Welt gekommen. Wieso haben Sie sich damals für dieses Haus entschieden? EH: Wir standen auf der Warteliste der Wohnungsbaugesellschaft. Es gab damals eine Reihe von Neubauprojekten in Montfoort, und uns wurde zunächst eine Wohnung in einem neuen Wohnblock angeboten. Dann hieß es, dass auch ein Haus in der Poorterstraat frei sei. Mein Schwager wohnte am Anfang der Straße, deshalb kannte ich die Häuser. Also sagte ich: Alles klar, behaltet euren Neubau, wir nehmen das Haus. Und weshalb? EH: Weil das Haus so groß ist. MH: Ich glaube, das hier sind so ziemlich die größten Mietshäuser in Montfoort. EH: Und sie haben einen ordentlichen Garten. Die meisten Neubaugärten sind sicher zwanzig Quadratmeter kleiner. Natürlich haben wir im Laufe der Jahre einiges am Haus verändert. Aber es ist einfach super, dass man so viel Platz hat. 48 Hat sich die Nachbarschaft verändert, seit Sie hier wohnen? EH: Die Poorterstraat hatte so ihren Ruf. Sie galt als die Asozialenstraße von Montfoort. Wir dachten: Wen interessiert das? Wenn wir die Haustür hinter uns zuziehen, merken wir sowieso nichts davon. MH: Ich habe auch nicht unbedingt mit allen Nachbarn viel zu tun. Ich kann gut dichtmachen, wenn ich jemanden nicht mag. Was halten Sie davon, dass die Häuser nun umgebaut werden? EH: Sehen Sie, die Wohnungsbaugesellschaft hat in den letzten Jahren wenig an den Häusern gemacht. Die Renovierung ist wirklich bitter nötig. Wir haben immer alles selber gemacht. Ich habe die Küche und das Bad selber renoviert, und ich habe das Dachgeschoss zum Schlafzimmer für unsere zwei Söhne ausgebaut. Ich habe sogar die Toilette selber gefliest. Das ist aber alles schon ein paar Jahre her, und wir waren schon am Überlegen, ob wir es nicht wieder mal machen müssten. Da kam die Wohnungsbaugesellschaft mit den großen Renovierungsplänen. Das kam wie gerufen. Ich sagte nur: Prima – dann fangt mal an! Was denken Sie, wie das Haus nach der Renovierung sein wird? EH: Großzügig, hell, ganz anders. Wir fangen nach 17 Jahren wieder völlig von vorne an. Wir verlegen die Küche an eine andere Stelle, damit ein großer Ess- und Wohnraum entsteht. Im Obergeschoss wird nur das Schlafzimmer an der Vorderseite wegen der neuen Treppe etwas kleiner. Naja, und eine feste Treppe zum Dachboden will ich sowieso schon seit Jahren haben. Die wollte ich sogar schon selber bauen, aber so viel will man dann doch nicht in ein Mietshaus investieren. Und wären wir ausgezogen, hätten wir das alles wieder rückgängig machen müssen, weil es nicht der Bauverordnung entsprochen hätte. Für uns ist die Renovierung also ein Geschenk des Himmels. D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 49 50 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 51 Interview mit Pega und Egidio Geerman „Die Haustür steht bei uns immer offen“ Pega und Egidio Geerman wohnen seit 24 Jahren in der Poorterstraat 47. Auch ihre drei Kinder sind in diesem Haus aufgewachsen. Weshalb haben Sie sich für dieses Haus entschieden, als Sie vor 24 Jahren nach Montfoort zogen? EG: Mein Chef in der Fleischfabrik wollte mir ohne Mietvertrag keinen festen Arbeitsvertrag geben. Dieses Haus war unsere einzige Option – weil niemand anders es haben wollte. Es war in fürchterlichem Zustand. Ich habe fünf Jahre gebraucht, um es auf Vordermann zu bringen. Wenn Sie hier schon so lange wohnen, kennen Sie die Nachbarschaft sicher gut, oder? EG: Ja, natürlich. Es gab gute und schlechte Jahre. Im Moment ist es wieder mal ein bisschen schwierig, wegen des Umbaus. Manche Nachbarn sind neidisch, weil ihr Haus nicht zum Pilotprojekt gehört. Dabei können wir ja gar nichts dafür, dass unser Haus ausgewählt wurde. Hat sich die Nachbarschaft im Laufe der Jahre verändert? EG: Ja, in den letzten Jahren schon. Hier wohnen jetzt mehr Zugezogene, die nicht aus Montfoort stammen. Aber das ist überall in den Niederlanden dasselbe. 52 Was mögen Sie besonders an diesem Haus? PG: Dass man vorne und hinten alles öffnen kann. EG: Wir wohnen gerne mit offenen Türen. Die Haustür steht bei uns immer offen, und die Nachbarskinder kommen und gehen einfach. Vielleicht liegt das daran, dass wir von der Karibikinsel Aruba stammen. Dort kann man heutzutage zwar auch nicht mehr die Tür offen stehen lassen, aber früher war das so. Möchten Sie denn hier bleiben? EG: Ja, ich sage immer: Dieses Haus verlasse ich nur noch mit den Füßen zuerst. Ich habe hier drei Kinder großgezogen. Haben Sie einen Lieblingsplatz im Haus? EG: Ja, natürlich: vor dem Fernseher (lacht). PG: Mein Mann ist immer hier unten, und ich bin oben. Ich lese lieber. Haben Sie im Moment das Gefühl, dass dem Haus etwas fehlt oder irgendetwas nicht funktioniert? EG: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Fensterrahmen und ein Teil der Fassadenverkleidung völlig morsch. Oben auch. D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Jetzt bekommen Sie einen Raum im Dachgeschoss dazu. Was haben Sie damit vor? EG: Ich werde ihn vermieten (lacht). Nein, nein. Auf den Zeichnungen sieht der Raum sehr schön aus. Wir wissen noch nicht genau, was wir damit machen. 53 54 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 55 WIE ÜBERLEBEN DIE BANLIEUES VON PARIS? Sanierung eines Wohnhochhauses Architekten: Frédéric Druot, Lacaton & Vassal, Paris Adresse: 5, bd du Bois-le-Prêtre, Paris, F Baujahr: 1959 56 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 57 58 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 DAS WAGNIS DER METAMORPHOSE Der Umbau des Wohnhochhauses Bois le Prêtre sorgt für eine Überraschung in der Pariser Stadtlandschaft. Seine unübersehbare Tragweite stößt die heikle Debatte an, wie sinnvoll die Erneuerung des Sozialwohnungsbestands wirtschaftlich und architektonisch eigentlich ist. Das Projekt beweist, wie spektakulär es sein kann, Lebensqualität durch gute Architektur dort einzuführen, wo sie nie eine Rolle gespielt hat. Von Karine Dana Fotos von Torben Eskerod Das Wohnhochhaus Bois le Prêtre im Norden des 17. Arrondissements, am Rand der Pariser Ringautobahn, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Sein altes Gesicht – trist und bedrückend, wie es die benachbarte Tour Borel noch zeigt – hat ausgedient. Und zwar unbestreitbar. Sein Standort im Grenzgebiet der Gemeinden Paris, Clichy und Saint-Ouen ist ein typisches Beispiel von Stadtrandplanung, das sich über die letzten fünfzig Jahre allmählich entwickelt hat. Die hochgeführte Ringautobahn, der Friedhof von Batignolles, zahlreiche städtische Dienstleister und Sozialwohnungen prägen das Gebiet, dem der Ehrgeiz des Architekten Raymond Lopez in den 50er-Jahren seinen Stempel aufgedrückt hat. Die Nutzungsüberlagerungen verleihen ihm heute den Charakter eines offenen, fragilen und formlosen Raums, in dem jedoch die bevorstehende Neuordnung schon spürbar wird. Denn das rund fünfzehn Hektar große Areal mit seinen rund 1.000 Einwohnern ist Teil des sogenannten „Großen Stadterneuerungsprojekts“ (Grand Projet de Renouvellement Urbain, GPRU), das für elf als vorrangig eingestufte Pariser Viertel aufgelegt wurde. Das Baustellenschild vor Ort macht klar, um welche Dimensionen es geht. Eine Wand aus Büros und Hotels gegenüber der Autobahn, ein neuer öffentlicher Platz, Verlagerung der Dienstleistungsbetriebe, Errichtung neuer Wohnungen, aber auch Abbruch und Neubau der Kinderkrippe an der Tour Bois le Prêtre, Abriss der Tour Borel und des nördlichen Teils des zugehörigen Wohnriegels. Bois le Prêtre blieb hingegen vom Abriss verschont und nimmt damit eine etwas widersprüchliche Position ein, als unfreiwillige Ikone einer bewahrten Erinnerung. Der Wohnturm, dessen Sanierung die allererste Baumaßnahme des Stadterneuerungsprojekts war, wirkt wie ein Kuriosum in diesem Viertel, das angesichts des Ausmaßes der Umgestaltung kaum noch als solches erkennbar ist. Er steht für die Gewissheit, dass man auch heute noch Stadtplanung betreiben könne in der Hoffnung, sie werde dauerhaft zu Zusammenhalt und Ruhe führen. Dennoch fällt es schwer, eine gewisse, keineswegs naive Skepsis zurückzuhalten: Ist für die Kinderkrippe am Bois le Prêtre wirklich kein Platz mehr? Hätte man die beiden Borel-Gebäude nicht erhalten können? Hätte sich der Schlafstadt-Effekt in der Rue Rebière, so ganz ohne Geschäfte und Cafés, nicht vermeiden lassen? Verallgemeinert man die Haltung, die dem Bois le Prêtre zugestanden wurde, drängt sich der Gedanke auf, dass dieser aufwertende und sorgsame Umgang mit dem Bestehenden eben doch auf das gesamte Areal hätte ausgedehnt werden können. An diesem Punkt wäre es noch möglich gewesen, der schweren städtebaulichen Maschinerie zu entkommen, die unweigerlich entwurzelte Milieus hervorbringt. Denn der Umbau der Tour Bois le Prêtre hat eine lange Vorgeschichte. Er ist das Ergebnis einer Debatte, die bereits vor acht Jahren begann, als das Kultusministerium die Architekten Druot, Lacaton & Vassal damit beauftragte, über eine Alternative zu der bis dahin praktizierten, äußerst kostspieligen Politik des Abbruchs und Ersatzneubaus nachzudenken. Die Architekten empfahlen daraufhin einen Umbau der Wohnsiedlungen und zeigten die kulturelle wie wirtschaftliche Absurdität des Vorhabens auf, diesen durchaus qualitätvollen Gebäudebestand abzureißen. Sie wollten beweisen, dass das Resultat eines Umbaus trotz geringerer Kosten – 100.000 € pro Wohnung statt 170.000 € –gelungener und überraschender sein würde als im Falle eines Abbruchs und Neubaus. Der Wintergarten als Ort der Fantasie Und tatsächlich, das Ergebnis fällt kühn aus: Eine heitere Abfolge durchscheinender Anbauten ersetzt die alten Vorhangfassaden mit Doppelbrüstungen aus Asbestfaserzement und Drehflügelfenstern. Das vorhandene, von der ursprünglichen Fassade unabhängige Tragwerk aus Betondecken und -wänden im Raster von 7,5 m besaß ein sehr gutes Umbaupotenzial. Handlungsbedarf bestand beim geringen Wär- mekomfort, der Kleinteiligkeit der Wohnungen und dem Mangel an natürlichem Licht in den Eingangshallen und Gemeinschaftsbereichen. Außerdem fehlte es in dem 50 Meter hohen, 17-geschossigen Hochhaus mit seinen 96 Wohnungen, davon 32 Sechs-, 28 Dreiund 36 Zweizimmerwohnungen, an großen Appartements mit 4 und 5 Zimmern. Vier Wohnungen kamen neu hinzu. Alle bestehenden Wohnungen gewannen durch den Umbau 40% mehr Fläche, indem Wintergärten – ungeheizte, klimaaktive Pufferzonen – vor die Ost- und Westfassaden gesetzt wurden. An den Schmalseiten des Gebäudes im Norden und Süden fügten die Architekten teilweise geheizte Anbauten in Verlängerung der Geschossdecken an. Überall wurden die Elektro- und Sanitärausstattung und die Lüftungsanlagen erneuert. Von unten betrachtet, wenn die Sonne scheint, wirft die glänzende Fassade Fragen auf. Recht schnell wird jedoch klar, dass es keineswegs um ein kunstvolles Verkleiden geht, sondern um die Möglichkeit einer inneren Sensibilität. Die Sonnenschutzvorhänge, aus der Welt der Gewächshäuser entliehen, sind nicht alle zugezogen und lassen eine unerwartete Lebendigkeit und Tiefe erahnen, die durch die Fertigmodule aus einem 7,5 m x 3 m großen Metallgerüst mit Betonboden, aus denen die Wintergärten bestehen, neu hinzukamen. Wie zusätzliche Stückchen Leben. Es braucht schon eine ziemliche Chuzpe, um derart unverhüllt eine „Architektur vor der Architektur“ zu planen ... Für einen Passanten ist es reizvoll, sich geistig in eine dieser ‚Glashütten’ hineinzuversetzen. Sie setzen dem Blick keinen Widerstand entgegen. Nicht alle sind voll in Beschlag genommen. Ihr Eintritt in die Vorstellungswelt der Bewohner ist noch zu frisch. Sie faszinieren, weil man 59 „Indem die Architekten diesen neuen Raum schufen, dessen Status und Klima den Bewohnern überlassen sind, ermutigen sie zu einer Inszenierung des Lebensraums, die sonst häufig mangels räumlicher Flexibilität und ausreichender Flächen auf der Strecke bleibt.” Karine Dana Menschen ausmachen kann, die darin sitzen, kommen und gehen, Blumen gießen, geschäftig sind. Als wären sie in einem kleinen Pavillon. Dies ist keine Fassade wie alle anderen; eigentlich ist es überhaupt keine Fassade, sondern ein städtebauliches Programm. Zusätzliche Aufzüge in der Fassade, die einen stufenlosen Zugang zu den Etagen ermöglichen, führen zu den Wohnungen. Die Eingangshallen und gemeinsam genutzten Bereiche wurden überarbeitet. Auf einmal lohnt es sich, hier den Kopf nach rechts oder links zu drehen. Die Sicherheitstüren sind durchsichtig, genau wie die Querwände. Jeder Treppenabsatz vermittelt das Gefühl eines geschützten Außenbereichs, eines schwebenden Erdgeschosses. Man würde sie gern neu genutzt sehen. Ihre Helligkeit bietet sich dafür an. Sie sind keine ‚Gebäudekerne’ mehr, sondern vollwertige Räume. Dieses Projekt setzt auf Beziehungen von Sympathie und Freude mithilfe des Raums. Beziehungen, die selten im sozialen Wohnungsbau bedacht werden, wo der Schwerpunkt derart aufs Energiesparen gelegt ist, dass das wichtigste Kriterium der Nachhaltigkeit – nämlich die Verbundenheit mit der eigenen Wohnung – weit in den Hintergrund gedrängt wird. Plötzlich ist der Innenraum wie verwandelt Wir betreten eine ursprünglich 45 m2 große, nach einer Seite hin ausgerichtete Zweizimmerwohnung, deren Wohn- und Schlafzimmerboden um einen 18 m2 großen Wintergarten und einen 1 Meter breiten durchgehenden Balkon verlängert wurde. Sie wirkt wie eine Einladung, im Innern einer Dreifachverglasung zu wohnen. Zunächst trat eine erste, raumhohe Glasfassade aus Aluminiumschiebetüren mit eingelassener Schwelle an die Stelle der alten 60 Vorhangfassade. Sie öffnet sich auf einen Zwischenbereich, der durch fest eingebaute und bewegliche Paneele aus transluzentem Polycarbonat gebildet wird. Ein durchgehender Balkon mit transparenter Brüstung schließt die neue Fassade nach außen hin ab und gibt dem Wintergarten die nötige zurückgesetzte Position, um ihm den Rang eines Innenraums zu verleihen. Abgesehen von dem Gewinn an Wohnfläche und Licht lädt das Umbauprojekt zu einer je nach Jahreszeit variierenden Nutzung der Wohnungen ein. Der alte Wohnungsgrundriss ist hier unverändert, die Küche ist im hinteren Teil des Wohnzimmers geblieben. Durch die Öffnung nach außen und den Helligkeitsgewinn wird sie nun zu einem Rückzugsort, gleichsam einem ebenerdigen Belvedere. Das Schlafzimmer, zuvor nur auf einem Weg erreichbar, tritt über den Wintergarten mit dem Wohnzimmer in Verbindung. Es funktioniert jetzt nicht mehr als Sackgasse, sondern als ein Anfang. Der Wintergarten als sensibler Raum, so empfindlich reagierend wie eine Epidermis, dient bei milden Temperaturen als Hauptwohnbereich. In der kalten Jahreszeit werden die Sitzgelegenheiten wohl wieder in das alte Wohnzimmer umziehen, während sich der Wintergarten in einen geschützten ‚Hof’ zum Spielen und Gärtnern verwandelt. Indem die Architekten diesen neuen Raum schufen, dessen Status und Klima den Bewohnern überlassen sind, ermutigen sie zu einer Inszenierung des Lebensraums, die häufig mangels räumlicher Flexibilität und ausreichender Flächen auf der Strecke bleibt. Die Räume animieren dazu, je nach Lust und Laune eine andere Atmosphäre zu schaffen, abhängig vom Stand der Sonne, dem die Vorhänge folgen, von der Luft, die an mehreren Stellen einströmen kann, und von der Intimität der eingerichteten Sofaecke. Sie bieten das geistige Vergnügen, sich an verschiedenen Orten hinsetzen zu können, und laden dazu ein, mit dem innigen Verhältnis zwischen Klima und Mobilität zu experimentieren. Die Einbindung der Bewohner in das Projekt wurde erheblich dadurch begünstigt, dass die Bauarbeiten bei laufendem Betrieb durchgeführt wurden. Ein heikles Unterfangen, das es jedoch ermöglichte, den Kontakt zu den Menschen aufzubauen und nach und nach die künftigen Absichten verständlich zu machen. So konnten die Bewohner erleben, dass die Beziehung zum Neuen umso stärker ist, wenn sie im Verhältnis zum Bestehenden aufgebaut wird. Und so haben sich die Wohnungen, auch ohne eine grundlegende Sanierung erfahren zu haben, alle tiefgreifend gewandelt. Ein äußerst merkwürdiges Phänomen: Der Lebensinhalt ist derselbe, doch er wird durch etwas völlig anderes belebt. Durch den Wintergarten lassen sich 50% der Heizkosten einsparen, und bislang wird er auf die Wohnfläche nicht angerechnet. Während die Heizproblematik in Frankreich noch häufig unter dem Gesichtspunkt von Material und Dämmung angegangen wird, macht die Besichtigung einer Wohnung im Bois le Prêtre klar, wie vielversprechend es heute ist, dieses Thema aus dem Blickwinkel von Öffnung, Licht und Fluss zu betrachten. Natürlich muss man dem Gebäude in ein paar Monaten einen erneuten Besuch abstatten, um zu sehen, was seine Bewohner aus ihm machen. Doch schon jetzt stellt sein Umbau einen Präzedenzfall für den sozialen Wohnungsbau in Frankreich dar. Auf keinen Fall darf er eine Ausnahme bleiben, sondern soll inspirieren, D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Nachahmer finden und ebenso viele Formen zur Steigerung bestehender Kapazitäten eröffnen, wie es Situationen gibt. Es verkörpert die Möglichkeit einer anderen städtischen Ökonomie, wie sie nie zuvor so weit getrieben wurde. Karine Dana, ausgebildete Architektin, war 12 Jahre lang als Ressortleiterin für die französische Architekturzeitschrift amc tätig. Heute arbeitet sie als freie Autorin und kooperiert regelmäßig mit den Architekten Lacaton & Vassal. Zuletzt verfasste sie einen Beitrag für deren neue Monografie, die im Verlag GG erscheinen wird. D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 61 62 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 Interview mit Frau Jean-Charles „Als die Wände eingerissen wurden, wusste ich, es würde großartig werden!“ Frau Jean-Charles, 44 Jahre, wohnt seit 2000 im 16. Stock von Bois le Prêtre. Sie hat das Projekt zum Umbau ihrer Wohnung begeistert aufgenommen und beschreibt, wie sich ihre Lebensgewohnheiten dadurch radikal geändert haben. Wie wurde Ihnen dieses Projekt eines Umbaus bei laufendem Betrieb vorgestellt? Es gab viele Besprechungen, was übrigens die Bewohner enger zusammengebracht hat. Zunächst waren alle skeptisch, und den älteren Leuten machte die Vorstellung Angst, ihre Vergangenheit in Kartons verpacken und sich dabei von einigen Dingen trennen zu müssen. Aber ich war gleich dafür. Das Projekt bedeutete einen Neubeginn. Am Anfang wollte niemand recht daran glauben. Aber damit sich die Bewohner besser vorstellen konnten, was passieren würde, haben die Architekten eine Wohnung zur Musterwohnung umgebaut. Von da an konnten wir uns richtig auf das Projekt einlassen. Wie haben Sie die Bauarbeiten erlebt? Ich war eine der ersten, deren Wohnung umgebaut wurde. Da meine Tochter Asthma hat, haben wir zweieinhalb Monate in einem Ausweichquartier verbracht. Das Leben war schwierig dort, auch wenn wir sehr gut untergebracht und versorgt waren. Was uns hat durchhalten lassen, war der geplante Umbau. Als die Wände eingerissen und die bestehende Fassade entfernt wurde, wusste ich, es würde großartig werden! Während der Bauarbeiten haben mich die Baufirma und die Architekten oft nach meiner Meinung gefragt, wenn es um die Auswahl der Tapeten, Wandfar- ben und Fliesen ging. Wissen Sie, es ist sehr wichtig, die Bewohner mit einzubeziehen, den Leuten das Recht zu lassen, ihr Leben zu ändern. Von den Ratschlägen der Architekten habe ich übrigens auch für die Einrichtung meiner restlichen Wohnung profitiert. Ich habe diesen Austausch sehr genossen. mich um meine Pflanzen, lese und schreibe. Es ist ein sehr friedlicher Ort, meine kleine Zen-Ecke. Ich fühle mich dort ruhig und inspiriert. In mein altes Wohnzimmer gehe ich dagegen überhaupt nicht mehr! Sogar wenn ich Gäste habe, essen wir auf jeden Fall im Wintergarten. Und abends ist der Sonnenuntergang herrlich. Was ist Ihre erste Empfindung, wenn Sie an den Umbau denken? Meine Wohnung war eine der kleinsten im Gebäude, rund 50 m2 groß. Heute haben wir etwa 80 m2, ohne dass sich meine Miete geändert hätte! Der Umbau hat unsere Lebensweise und unsere Art zu wohnen richtig verwandelt. Dabei wurden in unserer alten Wohnung nur sehr wenige Arbeiten vorgenommen. Die Wände wurden frisch gestrichen und das Badezimmer renoviert, das jetzt besser ausgestattet ist. Die Veränderung kommt nur durch diesen angebauten Raum, dieses zusätzliche Zimmer. Jetzt haben wir Platz, was das Wichtigste ist, und viel Licht. Man kommt sich weniger eingeengt vor. Ich stamme vom Land, aus Martinique, und genieße es sehr, diese freie Fläche zu haben. Auch wenn ich nicht weiß, wie wir im Winter in diesem neuen Zimmer wohnen sollen, weil es nicht geheizt wird. Wie behandeln Sie den Raum, was Temperatur und Pflege betrifft? Wenn es draußen warm ist, habe ich das Gefühl, über eine Art natürliche Klimaanlage zu verfügen. Durch die Sonnenschutzvorhänge ist es dort immer kühl. Vorher war das Wohnzimmer bei hohen Außentemperaturen ein Glutofen, einfach unerträglich. Man musste alles dichtmachen. Zur Pflege habe ich einen Dampfbesen für die Fensterflächen gekauft. So geht das Saubermachen ziemlich leicht. Wie nutzen Sie den Wintergarten? Er ist mein Hauptzimmer geworden. Ich frühstücke dort, kümmere Hat dieser neue Raum Ihre Beziehung zur Stadt verändert? Ja, sehr! Durch den weiten Ausblick kann man neue Sachen sehen und sich der Außenwelt näher fühlen. Die Stadt ist für mich jetzt ein ständiges Schauspiel. Ich habe mehr das Gefühl, in ihr zu leben. Wenn ich früher die Fenster aufmachte, wurde mir richtig schwindlig. Ich glaube, wenn man dieses Projekt häufiger wiederholen würde, könnte es die Mentalität der Leute verändern. 63 64 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 „Der Umbau hat unsere Lebensweise und unsere Art zu wohnen richtig verwandelt. Dabei wurden in unserer alten Wohnung nur sehr wenige Arbeiten vorgenommen. Die Wände wurden frisch gestrichen und das Badezimmer renoviert, das jetzt besser ausgestattet ist. Die Veränderung kommt nur durch diesen angebauten Raum, dieses zusätzliche Zimmer.” Frau Jean-Charles 65 Interview mit Frau Dorsemaine „Der Eindruck von Tiefe ist ein völlig anderer“ Frau Dorsemaine, 90 Jahre, wohnt seit über dreißig Jahren im 6. Stock des Hochhauses. Sie empfand die Bauarbeiten zunächst als Störung, genießt aber seit Kurzem die großen Vorteile des Umbaus. Haben Sie sich in die Vorbereitung dieses Projekts eingebunden gefühlt? Ja, ich war vor allem bei den zahlreichen Gesprächsrunden zu dem Projekt sehr aktiv. Ich glaube, ich habe mich zu Recht für die Belange der Bewohner eingesetzt und habe sogar den Eindruck, dass man mich heute dafür respektiert. Meinem Mann und mir fiel es schwer, uns das Projekt vorzustellen. Wir dachten, man kann doch die Wohnungen nicht so ins Leere setzen. Aber da es auch Balkone gab, waren wir beruhigt. Mein Mann ist inzwischen gestorben, er hat das Endergebnis nicht mehr gesehen ... Ich bin vielleicht die einzige, die während der gesamten Bauzeit in ihrer Wohnung blieb. Ich hatte Angst, meine Sachen könnten kaputtgehen. Die Arbeiten liefen zeitlich sehr unregelmäßig ab, und ich habe sehr unter den Einschränkungen durch die Baustelle gelitten, vor allem unter dem Staub, der ständig von überallher kam. Ich fange gerade erst an, meine Wohnung zu genießen und die positiven Aspekte zu sehen. Und welche sind das? Der Hauptraum wurde nicht verändert, aber da er an den Wintergarten grenzt, ist der Eindruck 66 von Tiefe ein völlig anderer. Der Eindruck, dass der Raum größer ist, und vor allem, dass man nicht mehr durch Wände eingeschränkt ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn ich jetzt viele Glasflächen zu putzen habe. Außerdem habe ich da, wo vorher mein Schlafzimmer war, einen Schreibtisch aufgestellt und mein Schlafzimmer zum Wintergarten hin verlegt. So ist es sehr viel angenehmer, weil es sich zu etwas öffnet und man es jetzt auf zwei Wegen erreichen kann. Ist Ihre Wohnung heute komfortabler, vor allem was die Wärme und die Luftqualität betrifft? Ich mag Wärme, sie stört mich nicht. Ich komme also gut mit ihr zurecht. Ich laufe der Wärme hinterher und nicht vor ihr davon. Der kleine äußere Sonnenschutzvorhang genügt bei Weitem zur Wärmeregelung. Den Thermovorhang finde ich unnötig. Den Architekten habe ich auch gleich gesagt, dass ich keinen möchte, weil er nicht meinem Geschmack entspricht. Ich besitze bereits doppelte Vorhänge, die völlig geeignet sind. Ich habe mich in meiner Wohnung eigentlich immer wohl gefühlt. Aber jetzt ist sie anders, luftiger. Ich kann mich an mehreren D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Stellen hinsetzen. Ich kann in ihr herumspazieren. Aber ich fand es immer schön hier, auch vor dem Umbau. Durch den Wintergarten gewinne ich Platz, und das genieße ich. Ich kann dort kleinere Dinge aufstellen, ohne mein Wohnzimmer zu überfrachten. Ich setze mich aufs Sofa oder in den Sessel, pflanze Kräuter, Petersilie und Schnittlauch. Es gefällt mir, diesen kleinen Außenbereich zu gestalten. Ich bewege mich jetzt nach Lust und Laune durch die Wohnung und gehe auch gern auf den Balkon, um die frische Luft zu genießen. Außerdem sehe ich die Außenwelt jetzt anders. Gestern Abend habe ich den Sonnenuntergang betrachtet und konnte den Mont Valérien ganz klar sehen, genau gegenüber. Eigentlich müsste ich ihn mal besteigen, den Mont Valérien. 67 68 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Xx 69 „Ich gehe gern auf den Balkon, um die frische Luft zu genießen. Außerdem sehe ich die Außenwelt jetzt anders. Gestern Abend habe ich den Sonnenuntergang betrachtet und konnte den Mont Valérien ganz klar sehen, genau gegenüber. Eigentlich müsste ich ihn mal besteigen, den Mont Valérien.” Frau Dorsemaine 70 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 71 WIE VIEL WANDEL VERTRÄGT EINE DOPPELHAUSHÄLFTE? Sanierung und Erweiterung einer Doppelhaushälfte Entwurf: Katharina Fey, Technische Universität Darmstadt Fachliche Beratung: Prof. Manfred Hegger, Prof. Klaus Daniels, Prof. Peter Andres, Prof. Karsten Tichelmann u. a. Adresse: Katenweg 41, Hamburg, D Baujahr: 1954 72 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 73 NACHHALTIGE SYMBIOSE AUS ALT UND NEU Mit dem Wohnexperiment „Model Home 2020“ begibt sich VELUX auf die Suche nach dem Haus der Zukunft. Ein bescheidenes Siedlerhaus aus den 1950er-Jahren wurde nach dem Entwurf der Architekturstudentin Katharina Fey zu einem lichtdurchfluteten Nullenergiegebäude. Von Amelie Osterloh Fotos von Torben Eskerod Ein Schwarm von Zebrafinken zwitschert aufgeregt, wenn Besuch das Wohnzimmer betritt. Seine große Voliere nimmt in der kleinen, sorgfältig dekorierten Stube mehr Platz als der Esstisch ein. „Die Vögel können wir nicht abstellen“, sagt Claudia Passlack und lächelt. Mit Haustieren auf engstem Raum zu wohnen kennt sie von klein auf, denn als Siedlerkind ist sie hier im Katenweg schon aufgewachsen. Früher hielten die meisten Nachbarn Hühner, Kaninchen oder Schweine. Vor elf Jahren haben sie und ihr Freund Sven Schult ihre eigene Doppelhaushälfte bezogen. Damals war es ein Haus wie alle anderen in der Straße. Bis der alte Herr aus der anderen Haushälfte starb und der Erbe sein Elternhaus an VELUX verkaufte. Der Dachfenster-Hersteller war auf der Suche gewesen nach einem Siedlungshaus, das beispielhaft zu einem Nullenergiehaus modernisiert werden sollte. Das beschauliche Heim von Claudia Passlack und Sven Schult wurde in diesem Zuge gleich mitsaniert – und auf diese Weise indirekt Teil der ersten Internationalen Bauausstellung (IBA) in Hamburg. Das sogenannte LichtAktiv Haus ist der deutsche Beitrag des Projekts ‚Model Home 2020’ von VELUX, das insgesamt sechs Gebäude in fünf europäischen Ländern umfasst. Während andern- orts neu gebaut wurden, setzte man in Deutschland bewusst auf Modernisierung. „Vierzig Prozent des globalen Energieverbrauchs entfallen heute noch auf Gebäude. Und trotz vieler Neubauprojekte stammt etwa die Hälfte aller deutscher Wohnungen aus der Nachkriegszeit und ist energetisch modernisierungsbedürftig“, sagt Sebastian Dresse, Geschäftsführer von VELUX Deutschland, und sieht damit dringenden Handlungsbedarf. Die Doppelhaushälfte im Katenweg steht auf der Elbinsel Wilhelmsburg im Süden der Hansestadt. 1954 erbaut, ist sie exemplarisch für eine Bauzeit, in der Material teuer, Energie aber noch günstig zu haben war. Dachfenster lassen Licht und Sonnenenergie hinein Putzige Doppelhäuser stehen in der Siedlergemeinschaft Finkenriek Reihe an Reihe, die meisten im Original kaum mehr als sechzig Quadratmeter groß, aber von einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück umgeben. Einfache Leute bekamen hier nach dem Krieg die Chance zur Eigentumsbildung und Selbstversorgung. An den meisten Häusern wurde über die Jahre so viel herumgebaut, dass sie heute kaum noch wiederzuerkennen sind. Mittendrin steht strahlend weiß verputzt das sanierte LichtAktiv Haus. Mit 75 „Licht, Pragmatik, Funktionalität, so sieht die Wohnmaschine von morgen aus. Dieses Haus möchte aktiver Partner statt passive Hülle sein.” Amelie Osterloh hellgrauem Dach und ohne Dachüberstand sieht es fast wie ein Neubau aus. Die Fensterlaibungen sind wegen der zusätzlich aufgebrachten Dämmung etwas tiefer als bei den Nachbarhäusern. Auf den ersten Blick lassen nur die Spitzenvorhänge hinter den Fenstern von Claudia Passlack und Sven Schult erahnen, wie fundamental sich die beiden Haushälften im Inneren unterscheiden. Wo auf der einen Seite noch das typische ehemalige Stallgebäude an das Haupthaus anschließt, erweitert beim Haus Nummer 41 heute ein hochmoderner Gebäuderiegel den Altbau. Er reicht von der Straße bis tief in das Grundstück hinein. Licht und hell empfängt den Besucher der Innenraum. Der Eingang liegt in einem gläsernen Verbindungsstück zwischen Alt und Neu. Geradeaus geht es direkt in den weitläufigen Garten. Raumsparende Schiebetüren führen links in den Altbau. Früher spielte sich hier in kleinen, dunklen Räumen das Familienleben ab. Während der ersten Jahre lebten in dieser Doppelhaushälfte sogar zwei Familien, jede auf einer Ebene. Heute bildet sie den Rückzugsbereich des erweiterten Hauses. Auf drei Ebenen liegen die zwei Kinderzimmer, das Elternschlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank, zwei Bäder und unter dem Spitzdach eine kleine Galerie, die dank Dachfenstern zu beiden Seiten besonders hell ist. Überhaupt, Licht: Der Anteil der Fensterflächen im Haus wurde bei der Sanierung verdoppelt. Erschlossen werden alle Zimmer über das neue, sehr großzügig dimensionierte, offene Treppenhaus. Besonders hier sorgt eine fast fünf Meter hohe Glasfront für üppiges Tageslicht, selbst an trüben Tagen. Verstärkt wird der Effekt durch die weißen Wände und hellen Böden im ganzen Haus. 76 Rechts vom Eingang geht es, wieder durch eine Schiebetür, in den neuen Anbau. Der Wohn- und Essbereich ist ein rechteckiger, großer Raum. Nur zwei Einbauten gliedern die Fläche, ein frei stehender Küchenblock und ein Raumteiler, der auf der Vorderseite die Küchenzeile aufnimmt und auf der Rückseite viel Stauraum bietet. Ihm gegenüber liegen, Richtung Straße, Gäste-WC und Technikraum. ein stilles Haus mit vielen zaungästen Annähernd luft- und schalldicht ist das Haus, wenn alle Fenster verschlossen sind. Wie mucksmäuschenstill es ist, fällt aber erst richtig auf, als die Lüftungsflügel sich öffnen. Erst jetzt hört man den Wind in den Bäumen rauschen, und die S-Bahn, die nicht weit von hier vorüberfährt. Bald wird hier eine Familie und damit der Alltag einziehen. Noch sind die Räume nur knapp mit dem Wichtigsten möbliert: ein großer Esstisch, ein Sofa, Betten und etwas Spielzeug in den Kinderzimmern. Noch ist das Haus mehr Ausstellungsstück als Heim. Vor der Tür macht ein großes Schild mit dem IBA-Logo auf das Besondere an diesem Haus aufmerksam. Eine Gruppe von Fahrradfahrern hält vor dem Schild. Es ist eine geführte IBA-Tour. Alle spähen fachlich interessiert bis in das Innere des vorbildhaften Baus. Noch wird ein Bewohner hier zu einem Teil der Ausstellung. Die Längsseiten des Wohnraums sind raumhoch verglast. Wer zum Wohlfühlen eine Wand im Rücken braucht, ist da schlecht bedient. Doch bestimmt haben Claudia Passlack, Sven Schult und auch die anderen Nachbarn Besseres zu tun, als den Neuen beim Essen zuzusehen, denn Vorhänge zuziehen, bevor es dunkel wird, ist auch keine Lösung. Das Haus von morgen ist eine aktive Wohnmaschine Modernste Technik macht das Haus trotz Nachkriegs-Bausubstanz und großer Glasflächen zum Nullenergiehaus. Die Außenhülle des Altbaus und des Nachbarhauses wurde vom Dachfirst bis zur Sohle dick mit Dämmung eingepackt. Für Passlack und Schult von nebenan hat allein diese Maßnahme in den ersten Monaten nach dem Umbau schon in Sachen Wohnqualität und Heizkosten einen „riesigen Unterschied“ gemacht. Um für die Doppelhaushälfte im Ganzen CO2-neutrales Wohnen zu erreichen, spielt aber auch der Anbau eine Schlüsselrolle. Zur Straße wird er um ein überdachtes Carport erweitert, zum Garten um eine ebenfalls überdachte Terrasse. So entsteht auf dem lang gestreckten, nach Süden orientierten Pultdach eine fast 80 Quadratmeter große Fläche, auf der Photovoltaik- und Solarthermie-Module mit Hilfe einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die benötigte Restmenge an Energie für Haushaltsgeräte, Beleuchtung und Hilfsstrom für die Wärmepumpe produzieren. Damit das Lüftungskonzept optimal funktioniert, müssen alle möglichen Parameter innen und außen überwacht werden. Es sind Dinge, die für den Bewohner kaum spürbar sind, wie zum Beispiel leichte Temperaturschwankungen oder der CO2-Gehalt der Luft. Zu sehen sind lediglich die Messgeräte, die im ganzen Haus verteilt sind und trotz ihrer dezenten Größe in dem minimalistischen Ambiente noch ins Auge fallen: Thermometer, Hygrometer, Luxmeter überwachen jede Schwankung des Raumklimas, und auch sonst wird alles abgespeichert, was die Energiebilanz beeinflusst. Zu lange und zu heiß geduscht? Die halbe Nacht mit großem D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Bildschirm im Internet gesurft? Sonst eine menschliche Regung, die überdurchschnittlich Wärme erzeugt? Nachzulesen sind die Messergebnisse an einem Flachbildschirm, der im Treppenhaus in die Wand eingelassen ist. Licht, Pragmatik, Funktionalität, so sieht die Wohnmaschine von morgen aus. Dieses Haus möchte aktiver Partner statt passive Hülle sein. Wenn die Messgeräte Querlüftung anordnen, obwohl man gerade mitten beim Frühstück sitzt, müssen sich Herr und Haus nur noch ein bisschen aufeinander einspielen. Amelie Osterloh hat Architektur studiert und war acht Jahre lang Redakteurin bei den Zeitschriften „Baumeister“ und „HÄUSER“. Heute lebt sie als freie Autorin und Redakteurin in Hamburg. 77 Active House-Diagramm: LichtAktiv Haus, Hamburg Der Begriff ,Active House’ beschreibt eine Vision von Gebäuden, die ihren Bewohnern ein gesunderes, komfortableres Leben ermöglichen, ohne Umwelt und Klima negativ zu beeinflussen. Der 2011 entwickelte ‚Active House’ –Kriterienkatalog versteht sich als Planungshilfe und zugleich als Bewertungsmethode für die Nachhaltigkeit von Gebäuden. Active Houses werden anhand ihrer Energiebilanz, ihres Raumklimas und ihrer Umweltwirkungen beurteilt. Jede der drei Kategorien besteht aus drei bis vier Einzelkriterien (wie zum Beispiel Energiebedarf, Raumluftqualität oder Schallschutz und Akustik), die sowohl anhand quantitativer wie auch qualitativer Aspekte ermittelt werden. Das Active HouseDiagramm zeigt die Bewertungskriterien und ihre Wechselwirkung untereinander. Da die Evaluierung und das Monitoring des LichtAktiv Hauses noch andauern, basiert die Bewertung auf den bisherigen Planungsergebnissen. Die drei Bewertungskategorien des Systems sind: Energie Das Gebäude hat eine optimierte Energiebilanz und nutzt ausschließlich erneuerbare Energien Raumklima Es trägt positiv zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei Umwelt Das Gebäude wurde im Hinblick auf seine Umweltwirkungen und Ressourcennutzung optimiert 2.1 Jährliche Energiebilanz 4.3 Trinkwasserverbrauch und Abwasserbehandlung 2.2 Energiebedarf 4.2 Umweltbelastung durch Emissionen in Luft, Boden und Wasser 2.3 Energieversorgung 3.2 Tageslicht und Ausblicke 4.1 Verbrauch nichterneuerbarer Energieressourcen 3.5 Schallschutz und Akustik 3.3 Thermischer Komfort 3.4 Raumluftqualität 79 80 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 „Wir spüren, wie sich etwas in der Bautechnologie verändert, und das wird sich sicherlich bei unseren Smart Material Houses oder Smart Price Houses auf der Bauausstellung zeigen, wie das eine neue Ästhetik mit sich bringen kann.“ „DER STÄDTEBAU HAT WIEDER EIN KLARES ETHOS“ Interview mit Uli Hellweg Uli Hellweg Herr Hellweg, Sie waren schon an der Berliner Internationalen Bauausstellung in den 1980er-Jahren beteiligt; jetzt sind Sie Geschäftsführer der IBA Hamburg GmbH, mit der Sie die IBA als typisch deutsches Werkzeug städtischer Planungskultur weiterentwickeln möchten. Dazu müssen wir wissen, was verstehen Sie unter einer IBA? Internationale Bauausstellungen zeichnen sich, auch wenn sie sich in den letzten Jahrzehnten unterschiedlich entwickelt haben, immer durch einen ganzheitlichen Ansatz aus. Und trotzdem waren sie alle sehr unterschiedlich? Ich sehe mehr methodische Gemeinsamkeiten als Differenzen. Natürlich existieren Unterschiede zwischen uns und der gleichzeitig stattfindenden ,ibaStadtumbau‘in Sachsen-Anhalt oder ,iba-See‘ in Brandenburg, denn eine iba muss zunächst immer durch ihre Projekte am jeweiligen Ort überzeugen. Dann erst werden ihre Ergebnisse übertragbar. Unser Alleinstellungsmerkmal ist die einzigartige Landschaft der Elbinseln in zentraler Lage der Freien und Hansestadt Hamburg. Was kann eine Internationale Bauausstellung leisten, was traditionelle, direkt aus der Verwaltung gesteuerte Stadtplanung und -entwicklung nicht können? Eine iba verwaltet nicht die Stadtentwicklung, sie ist eine Art task force, sie kann und muss unkonventionelle Wege gehen, sie soll sich überall einmischen, problemorientiert arbeiten und braucht sich nicht so sehr von etablierten Zuständigkeiten abhängig machen. Die iba hat sich die Entwicklung der Metropole auf drei Feldern zum Thema gemacht: Metrozonen (die „inneren Ränder“ der Stadt), Klimawandel und Kosmopolis (die multi- kulturelle Stadt). Kommt die iba mit dieser Dreiteilung gut zurecht? Ursprünglich spielte das Thema der Kosmopolis eine kleinere Rolle, der Klimawandel tauchte noch gar nicht auf. Wir haben die Themen erst in den letzten Jahren endgültig gewichtet und profiliert. Auf keinem Fall könnte man eines davon weglassen, weil sich diese Themenfelder gegenseitig bedingen, beeinflussen und befruchten. Das soziale Thema einer gemischten multikulturellen Stadt bestimmt die natürliche Entwicklung der Bruchstellen in der Metropole, die wir Metrozonen nennen, und beides ist ganz gewiss von ökologischen Einflüssen im Klimawandel bestimmt. In dieser Themenvernetzung dokumentiert sich unser ganzheitlicher Ansatz. Wilhelmsburg war bis vor wenigen Jahren als hochwassergefährdeter und sozial schwacher Stadtteil stigmatisiert. Sie haben deswegen noch ein weiteres wichtiges Thema auf die Tagesordnung gebracht – die Bildung. Wie weit sind Sie damit derzeit? Die Bildungsoffensive war zwar schon vor der iba in Wilhelmsburg angekommen, sie wird auch nach der iba existieren. Wenn es uns als iba gelingt, den Bildungsprozess deutlich voranzubringen, ihm auch mit dem Bildungszentrum ,Tor zur Welt’ eine gute architektonische Hülle zu geben, dann haben wir viel erreicht, dann wird die Bildung auch anders wahrgenommen, denn Bildung hat auch etwas mit guter Bildungs-Architektur zu tun. Sie haben für die iba ein interdisziplinäres Netzwerk und eine verifizierte Public-private-Partnership zwischen Stadt, Investoren und Unternehmen geschaffen, vor allem auch aus der Bauindustrie. Wie gestaltete sich dieser Prozess? Es ist uns gelungen, durch eine ibaKonvention ein lokales Netzwerk aufzubauen, das jetzt seine Früchte trägt. Alle, die in Wilhelmsburg mit Bauen zu tun haben, sind seit längerer Zeit mit der iba vertraut. Dazu bringt die Ausstrahlung der iba neue Partner von außen, wie zum Beispiel velux, das mit dem LichtAktiv Haus ein eigenes Projekt initiiert hat. Sie arbeiten hier in einem komplizierten Bestand, versuchen eine partizipative Planung von unten, kleinteilig, künstlerisch, anders. Was hat sich denn grundsätzlich in den letzten 20 Jahren im Umgang mit Stadt und Planung geändert? Es hat sich einiges verändert. Vor allem ist die Orientierung wieder klar. Vor 20 Jahren stieg der Neoliberalismus mit einer klaren Deregulierung als Allheilmittel auf und führte zu einem ,everything goes‘ im Städtebau und der Stadtentwicklung, bei dem das private Investment im Grunde wenig hinterfragt wurde und erst einmal überall als gut galt. Und so sahen die Produkte auch aus, die dabei herauskamen. Heute hat der Städtebau wieder ein klares Ethos, und zwar im Bereich der Ökologie, aber auch im Bereich der Ästhetik. Es wurden noch nie soviel Wettbewerbe ausgelobt wie heute. Früher war es sehr unüblich, über Stadt- und Landesgrenzen hinaus gegen lokale Lobbys Architekten einzubinden. Bauen wir heute auch anders? Die Bauwirtschaft ist zwar immer noch sehr träge, aber es gibt eben Ausnahmen, und dazu zähle ich natürlich jene, die sich hier auf der iba engagieren. Wir spüren, wie sich etwas in der Bautechnologie verändert, und das wird sich sicherlich bei unseren Smart Material Houses oder Smart Price Houses auf der Bauausstellung zeigen, wie das eine neue Ästhetik mit sich bringen kann. Die Entwürfe unserer Häuser zeigen dies ja bereits heute. Welche bleibenden Resultate erhoffen Sie sich von der IBA – nicht nur bezogen auf das Sichtbare, Gebaute, sondern auch auf die Sozialstruktur im Viertel und im Bezug auf Bausteine/Werkzeuge der ,Planungskultur‘, von denen Hamburg auch weiterhin profitieren könnte? Ich hoffe, sehr, sehr viele: die Bauten natürlich und dass diese jetzt vorhandene Aufbruchsstimmung in Wilhelmsburg bleibt und sich noch verstärkt. Ich hoffe auf Ausstrahlung in die internationale Baukultur, und ich glaube, dass diese iba gut dafür gearbeitet hat und weiter ausgezeichnet arbeiten wird. Uli Hellweg ist seit 2006 Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung (IBA) Hamburg 2013. Zuvor war er unter anderem als Planungsdezernent der Stadt Kassel und als Geschäftsführer der Wasserstadt GmbH in Berlin tätig. 81 Interview mit Helmuth Poggensee „Viele Leute haben nicht mehr viel Sinn für Gemeinschaft“ Helmuth Poggensee (* 1947) ist Vorsitzender des Vereins Kirchdorfer Eigenheimer e. V. in Hamburg-Wilhelmsburg. Sie sind Vorsitzender des Siedlervereins Kirchdorfer Eigenheimer. Wen vertritt Ihr Verband? HP: Wir vertreten alle Siedler Hamburgs südlich der Norderelbe. Auf Wilhelmsburg gibt es vier Siedlergemeinschaften. Unsere Siedlung, der ,Verein Kirchdorfer Eigenheimer‘, ist mit etwa 650 Häusern die größte. Der Katenweg, in dem das LichtAktiv Haus steht, gehört zur Siedlungsgemeinschaft Finkenriek. Seit wann leben Sie im Quartier? HP: Dieses Haus habe ich 1983 zusammen mit meiner Frau gekauft. Wilhelmsburg-Kirchdorfer bin ich aber schon 1957 geworden. Bis ich zehn war, wohnten wir im Stadtteil St. Georg, in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Aber nach dem Krieg wurde es dort mit drei Kindern zu beengt, sodass meine Eltern entschieden, in Kirchdorf ein Haus zu kaufen. Wann entstanden die Siedlungen? HP: Die älteste Siedlung, Wilhelmsburg-Ost, wurde 1927/28 gebaut. Damals entstand die Idee, die bis dahin unbewohnte Elbinsel zu bevölkern. Unsere Siedlung ist 1935 für Hafenarbeiter gebaut worden. Das sind alles Fachwerkhäuser, viele von ihnen sind von außen verblendet worden, sodass man das heute nicht mehr erkennt. Die Idee der Planer war, dass sich die hier angesiedelten Arbeiterfamilien selbst ernähren sollten. Deshalb hat jedes Grundstück, auch die Grundstücke der Doppel82 haushälften, 1.000 Quadratmeter Fläche. Wurde hier im Krieg viel zerstört? HP: Ja, ich schätze, zehn Prozent der Häuser wurden durch Bombenteppiche zerstört, aufgrund ihrer Nähe zum Hafen. Beim Wiederaufbau wurden die ursprünglichen Häuser etwas verändert. Zum Beispiel liegt bei unserem Haus, das auch zerbombt war, das Treppenhaus jetzt besser. Wie haben sich die Siedlungen über die Jahrzehnte verändert? HP: Die Bebauung hat sich verdichtet. In unserer Siedlung stehen heute fast 15 Prozent mehr Häuser. Viele Grundstücke wurden geteilt. Und die Bevölkerungsstruktur? HP: Unsere Siedlungsgemeinschaft ist überaltert. Was nach uns kommt, ist nicht mehr so homogen. Mein Sohn ist dreißig und wohnt noch bei uns. Es gibt aber viele Häuser, in denen nur eine Person lebt. Vererbt werden die Häuser oft an die Enkel. Die mittlere Generation ist in der Siedlung zu wenig vertreten. Und während früher eben viele Hafenarbeiter hier lebten, sind heute ganz unterschiedliche Berufsgruppen vertreten. Alle haben großzügig angebaut, ziemlich individuell. Es ist keine Einheitssiedlung mehr. Gibt es denn den typischen Siedler überhaupt noch? HP: Nein, den gibt es heute nicht mehr. Früher war typisch, dass man Acker, Obstbäume und Tiere hatte, Hühner, Kaninchen, Schweine und Schafe. Das ist alles vorbei. Inzwischen hat sogar mal ein Anwohner geklagt, weil sein Nachbar einen Hahn hatte, der morgens krähte. Der Kläger wollte dann sogar noch Mitglied im Verein werden. Das haben wir abgelehnt, weil er nicht gemeinschaftsfähig war. Mit welchen Problemen hat Ihr Stadtviertel noch zu kämpfen? HP: Die Leute, die neu hinzuziehen, haben nicht viel Sinn für die Gemeinschaft, sie kapseln sich ab. Das ist ein großes Problem. Unsere Gemeinschaften werden dadurch kleiner. Auch wenn es noch nicht so extrem ist wie in den Hochhaus-Siedlungen in Kirchdorf-Süd. Die Gemeinschaft war immer unsere Stärke, besonders bei übergreifenden Themen wie S-Bahnbau oder Straßenbau. Einmal sollten Anlieger richtig zur Kasse gebeten werden, weil Bäume gepflanzt werden sollten. So etwas kann eine Gemeinschaft enorm schwächen. Was schätzen die Leute an ihren Häusern? HP: Jeder identifiziert sich mit seinem Haus, hat ein Stück Liebe darin, weil er selbst umgebaut, angebaut oder modernisiert hat. Als wir 1957 hierher zogen, hat mein Vater zuerst ein Wasserklosett eingebaut. In den 1970er- und 1980erJahren wurde die ganze Siedlung an das öffentliche Sielsystem angeD&A HERBST 2011 AUSGABE 16 schlossen. Da wurde auch wieder die Gemeinschaft gebraucht, alle haben mitgeholfen. Wo liegen die Schwachpunkte der Häuser? HP: Energetisch sind die Häuser nicht sehr günstig gebaut. Das ist ja auch ein wichtiges Thema der Internationalen Bauausstellung. Wenn man da jedoch etwas tun will, verändern sich die Häuser äußerlich. Jeder versucht es, so gut er kann. Ich persönlich war einer der ersten Umweltschutzberater in Hamburg und habe mein Haus schon 1985 von außen gedämmt. Welche Veränderungen erhoffen Sie sich von der IBA? HP: Es passiert in Wilhelmsburg ja sehr viel, und ich hoffe, dass es einen Umschwung bringt, weg vom negativen Image. Endlich wird einmal positiv über Wilhelmsburg berichtet. Was denken Sie über das Licht Aktiv Haus? HP: Ich bin froh über das Projekt. Der Punkt für uns ist: Keiner unserer Siedler hätte für einen solchen Umbau eine Genehmigung bekommen. Die Bauprüfabteilung lässt viele geplante Anbauten nicht zu. Heute wird aber viel mehr genehmigt als früher. Wir sind in unserer Siedlung stolz auf unsere Anbauten. Aber jetzt kann man hoffen, dass es einfacher wird, größere Pläne auch durchzubekommen. 83 84 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 Interview mit Claudia Passlack und Sven Schult „Die Sanierung macht für uns einen riesigen Unterschied“ Claudia Passlack (* 1971) und Sven Schult (* 1972) teilen sich mit dem LichtAktiv Haus ein Doppelhaus. Die Haushälften wurden gemeinsam modernisiert. Seit wann wohnen Sie hier im Haus? SS: Vor elf Jahren sind wir zur Miete eingezogen. Ich wohnte vorher in Barmbek. Vor drei Jahren haben wir das Haus gekauft. CP: Damals wohnte neben uns noch ein älterer Herr. Als er starb, kaufte velux das Haus von seinem Sohn. Wie hat sich die Siedlung seit Ihrem Einzug verändert? CP: Ich bin hier in der Straße aufgewachsen, ein paar Häuser weiter. In meiner Kindheit haben wir viel auf der Straße gespielt. Ein Auto fuhr hier nur ab und zu. Heute ist es fast eine Durchgangsstraße. Und die Menschen? CP: Sehr positiv ist, dass Nachbarschaftshilfe schon immer großgeschrieben wurde. Die Leute achten aufeinander. Das war damals und ist auch noch heute so. SS: Die Fluktuation ist gering. Heute wohnen in vielen Häusern Witwer oder Witwen. Die meisten Erstsiedler leben hier bis zu ihrem Tod. Was für Leute ziehen neu hinzu? CP: Oft rücken nach dem Tod der Eltern die Erben nach. Man bekommt nicht oft neue Nachbarn. Erst seit ein paar Jahren ziehen öfters einmal Fremde aus einem anderen Stadtteil hierher. Verändert sich dadurch das Miteinander? SS: Nein. Unser Siedlungsvorstand ist recht engagiert und kümmert sich darum, dass Neue gleich in den Verein aufgenommen werden. Bei Siedlerfesten oder im Kegelclub lernt man sich dann kennen. Hatten Sie schon vor dem großen Umbau im Zusammenhang mit dem LichtAktiv Haus etwas an Ihrem Haus umgebaut? SS: Noch nichts, weil wir zuerst zur Miete gewohnt hatten. Aber unser Vermieter hatte vor unserem Einzug schon ein paar Wände entfernt und die Räume so großzügiger gestaltet. Andere Häuser mit dem verschachtelten Originalgrundriss sind deutlich dunkler. Welche Umbauten haben Sie an Ihrem Haus vorgenommen, und aus welchem Grund? CP: Wir hatten auf jeden Fall geplant, das Haus besser zu dämmen. Aber dann sprach VELUX uns im Rahmen des Umbaus der anderen Doppelhaushälfte an, ob wir die Sanierung nicht gemeinsam durchführen wollten, auch um ein einheitliches Erscheinungsbild hinzubekommen. SS: Die gesamte Gebäudehülle wurde wärmegedämmt, das Dach neu gedeckt und ein paar neue Fenster eingebaut. Was hat sich für Sie durch die Sanierung verbessert? SS: Es ist ein riesiger Unterschied. Früher hatten wir hier drinnen im Sommer teilweise 36 Grad. Oben konnte man gar nicht schlafen. Jetzt machen wir an heißen Tagen morgens die Rollläden runter und bekommen maximal 24 Grad. Hatten Sie vorher damit gerechnet, dass es ein so großer Unterschied sein würde? CP: Wir hatten es gehofft, denn wir haben früher wirklich viel Energie verschwendet. SS: Vor der Modernisierung hatten wir eine Gasrechnung von 180 Euro im Monat. Jetzt haben wir die Heizung seit April aus und eigentlich stabil eine Temperatur von 21 Grad. Möchten Sie in Zukunft noch etwas an Ihrem Haus verändern? SS: Im nächsten Winter wollen wir noch den Dachboden ausbauen. Ansonsten nur Kleinigkeiten. Ist der Garten noch ein Nutzgarten? SS: Im Moment ist er durch die Baustelle noch etwas zertrampelt. Aber etwas Gemüse und Obstbäume möchten wir noch pflanzen. Was gefällt Ihnen an Ihrem Haus besonders? CP: Ich finde es hier sehr gemütlich. Was soll ich mit mehr Platz? Wenn Gäste kommen, muss man ein bisschen improvisieren, aber das tue ich gern. Hat es sonst etwas Besonderes? CP: Es gibt keine geraden Wände. Alle sind schief. Sie sehen es an den Bordüren an den Wänden. Bordüren sind keine gute Idee für diese Häuser. 85 „Wie soll man die Dachfenster putzen, wenn man sich keinen professionellen Fensterputzer leisten kann?” Claudia Passlack Wie kommt Ihr Umbau bei den Nachbarn an? SS: Viele finden, das Dach hätte etwas dunkler sein können. Ansonsten finden sie ihn alle toll. Werden Ihnen einige nacheifern? SS: Manche dämmen ihre Fassaden. Aber sie machen es selbst, mit einfachen Mitteln. Und wie kommt das LichtAktiv Haus an? CP: Da sind die Meinungen geteilt. Eigentlich möchte keiner von uns, der es von innen kennt, dort einziehen. Ob es in dem Anbau, der zu allen Seiten offen ist, angenehm zu leben ist? Immer die Vorhänge zuziehen möchte man ja auch nicht. Und das offene Treppenhaus – für Licht und Luftzirkulation mag es günstig sein, aber es wird viel Platz verschenkt, und unpraktisch ist es auch. Wie soll man die Dachfenster putzen, wenn man sich keinen professionellen Fensterputzer leisten kann? SS: Und über das Badezimmer an der Straße, mit Dusche und Toilette direkt hinter dem großen Fenster, amüsieren sich viele. CP: Manche Siedler haben auch ein Problem damit, dass das Haus so ganz anders aussieht als die anderen Siedlungshäuser. Der Anbau ist für viele ein rotes Tuch. Sie müssen wissen: Wenn einer von uns einen Carport oder einen Anbau beantragt, gibt es immer viel Ärger. CP: Ich hoffe, dass alles rechtzeitig fertig wird. Meine Sorge ist, dass sich nach der IBA keiner mehr für Wilhelmsburg interessiert, die Projekte nicht fertiggestellt werden und der Stadtteil dann wieder verkommt. SS: Mir gefällt, dass der Bahnhof modernisiert wird. Der hatte es bitter nötig. Die moderne Architektur der Neubauten gefällt mir. Gespannt bin ich auf die Seilbahn, die für die Gartenbauausstellung kommen soll. CP: Ich bin auf den Bunker gespannt, der gerade zu einem ÖkoKraftwerk umgebaut wird. Und unseren Müllberg, der zum ‚Energieberg’ umgestaltet werden soll. Aber auch da bleibt die Frage, wie die Projekte nach der IBA weiter gepflegt werden. Kann das Projekt als Referenzobjekt bei zukünftigen Umbauwünschen nicht von Vorteil sein? CP: Naja, wir haben vor zwei Monaten beantragt, nur unsere Auffahrt begradigen zu dürfen, und warten immer noch auf eine Antwort. Was denken Sie über all die Aktivitäten, die im Rahmen der IBA Hamburg in Wilhelmsburg im Bau sind oder noch kommen sollen? 86 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 87 88 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 Interview mit Gertrud Bräuninger „Was nicht funktioniert, repariere ich noch selbst“ Gertrud Bräuninger (* 1927) lebt seit 57 Jahren in ihrem Haus in Wilhelmsburg. Sie gehört zu den letzten lebenden Erstsiedlern in der Siedlung Finkenriek. Seit wann wohnen Sie hier im Haus? GB: Seitdem es die Siedlung gibt. Finkenriek war eine der ersten Siedlungen, die nach dem Krieg gebaut wurden, und wir sind am 1. Juli 1954 eingezogen. Wir hatten großes Glück, dass es geklappt hat. Bevor man hier ein Haus kaufen durfte, musste man sich um eine Siedlerstelle bewerben, und die Plätze waren rar. Und weil mein Mann als Flüchtling aus Schlesien kam, konnten wir ein LAG-Darlehen beantragen. In welcher Lebenssituation waren Sie damals? GB: Ich war 27. Wir hatten drei Töchter. Unser Sohn ist dann 1957 hier im Wohnzimmer geboren. Nach der großen Flut 1962 war der Katenweg die einzige Straße in der Gegend, die nicht überflutet war. Da haben wir für einige Jahre noch drei Verwandte aufgenommen. 1966 starb mein Mann, und seit 1983 das letzte Kind geheiratet hat, lebe ich hier allein. Wie hat sich die Siedlung seit ihrer Gründung verändert? GB: Damals waren die meisten Siedler Arbeiter. Es durfte nur einziehen, wer Kinder hatte. Fast alle Frauen waren zu Hause. Wir hatten Hühner und Schweine im Stall. Heute ist das Leben ein anderes. Und es wurde sehr viel angebaut. Welche Umbauten haben Sie an Ihrem Haus vorgenommen, und aus welchem Grund? GB: Am Anfang hatten wir kein Badezimmer und nur ein Plumpsklo. Als erstes hat mein Mann ‚schwarz’ die Spültoilette eingebaut. Und weil wir keine Entwässerung hatten, haben wir auch eine gebrauchte Badewanne heimlich eingebaut. 1961 bekam ich eine Kriegsrente, rückwirkend 20000 Mark. Damit konnten wir im Garten eine Veranda bauen und dort erweitern, wo früher der Stall war. Mein Mann hat alles selbst gemacht, von dem Geld mussten wir deshalb nur Baumaterialien und Lebensmittel kaufen. Außerdem haben wir das Dach ausgebaut, und vor 34 Jahren habe ich den Swimmingpool im Garten bekommen. Würden Sie in Zukunft gern noch etwas an Ihrem Haus verändern? GB: Nein, ich bin jetzt 84. Meine vier Kinder haben alle selbst ein Haus. Und wem von den vielen Enkeln sollte ich es geben? Nach mir die Sintflut. Was gefällt Ihnen an Ihrem Haus besonders? GB: Dass meine Kinder hier so frei aufwachsen konnten, in einer Zeit, in der viele andere keinen Garten hatten. Familien wohnen in ihrem Haus als einzige Deutsche zwischen Moslems. Aber wir Siedler identifizieren uns mit der Siedlung, wir sind die Siedlergemeinschaft Finkenriek. Gibt es etwas am Haus, das weniger funktioniert? GB: Das kann ich gar nicht sagen. Was nicht funktioniert, repariere ich noch selbst. Und was ich nicht kann, machen meine Nachbarn und Kinder. Was denken Sie über all die Aktivitäten, die im Rahmen der IBA in Wilhelmsburg geplant sind und noch kommen sollen? GB: Ich bin ein Mensch, der nicht gleich meckert, weil ich selbst immer froh war, wenn die Nachbarn den Kinderlärm in unserem Garten friedlich hingenommen haben. Aber wir haben durch die IBA schon sehr viele Behinderungen. Gibt es eine besondere Erinnerung oder Anekdote, die Sie mit Ihrem Haus verbinden? GB: Oh, wir haben hier so viele schöne Feste gefeiert. Haben Sie einen Lieblingsplatz im Haus oder Garten? GB: Meinen ‚Faulenzer’ im Wohnzimmer, einen klappbaren Fernsehsessel. Ich handarbeite viel. Und das LichtAktiv Haus? GB: Das gefällt mir überhaupt nicht. Die Innenräume sind so zerrissen, Schlafräume im Altbau, Wohnräume im Anbau, die scharfen Kanten am Treppengeländer, für kleine Kinder ist das nichts. Was gefällt Ihnen an der Gegend besonders? Und was weniger? GB: Ich sage immer, ich komme von der wunderschönen Elbinsel. Wir sind die größte Flussinsel Europas. Aber meine Kinder hatten alle die Nase voll von Wilhelmsburg, wegen der vielen Moslems. Einige 89 90 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 91 92 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 „Am Anfang hatten wir kein Badezimmer und nur ein Plumpsklo. Als erstes hat mein Mann ‚schwarz’ die Spültoilette eingebaut. Und weil wir keine Entwässerung hatten, haben wir auch eine gebrauchte Badewanne heimlich eingebaut.” Gertrud Bräuninger 93 Interview mit Claus Kähler „Früher konnten wir aus unserem Garten bis zum Elbdeich sehen“ Claus Kähler (* 1951) ist in der Doppelhaushälfte aufgewachsen, aus der später das LichtAktiv Haus wurde. Er wohnt heute gegenüber und verkaufte das Haus nach dem Tod der Eltern an VELUX. Wie lange wohnen Sie schon im Katenweg? CK: 1954 bin ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in das damals ganz neue Haus in Nr. 41 eingezogen. Da war ich drei Jahre alt. 1977 bin ich mit meiner Partnerin, die auch aus Kirchdorf stammt, in das Haus Nr. 36 schräg gegenüber gezogen und habe eine eigene Familie gegründet. Wie hat sich die Siedlung seit damals verändert? CK: Damals war Nachkriegszeit, das war ein komplett anderes Leben. Aber meine Kindheit hier war toll. Wir hatten viele gleichaltrige Freunde in der Straße, mit denen wir immer draußen gespielt haben. Die Flächen hinter unserem Garten wurden nach der Flut 1962 für die Erweiterung des Friedhofs Finkenried aufgeschüttet. Vorher war das Gelände noch flach und frei und man konnte kilometerweit bis zum Elbdeich sehen. Wir hatten Tiere, die Schornsteine rauchten. Ich habe es als sehr idyllisch erlebt. Konnten Sie sich selbst versorgen? CK: Weitgehend ja, wir hatten die Grundausstattung für alle Siedler, zehn Hühner und einen Hahn. Neben dem Haupthaus gab es ja einen Stall, dort war ein Abteil für die Hühner. Und dann hatten wir noch Kaninchen im Garten und viel Obst und Gemüse. 94 Was macht Ihre Siedlung heute für Sie aus? CK: Ihre gute Lage. Man ist von hier schnell in Hamburg und schnell in Harburg. Wir liegen mittendrin, haben es aber trotzdem ruhig und grün. Und die Gemeinschaft wird hier noch großgeschrieben. Was schätzen Sie an den Häusern? CK: Sie bieten den Platz, den man braucht, und haben einen schönen Garten. Wir haben am Haus eine sehr schöne Terrasse und drinnen einen Kamin. Es ist einfach ein angenehmes Wohnen. Haben Ihre Eltern im Laufe der Jahre an ihrem Haus etwas umgebaut? CK: Zu Beginn wurde das Doppelhaus von vier Familien bewohnt, zwei oben und zwei unten. Wir wohnten unten auf 60 Quadratmetern. Als die Familie über uns auszog, haben wir das obere Stockwerk für uns ausgebaut. Die Hühner wurden abgeschafft und im Stallgebäude ein Badezimmer eingebaut. Dann ist meine Oma zu uns gezogen. Wie kam es, dass Sie das Haus an VELUX verkauft haben? CK: Als mein Vater vor zwei Jahren starb, habe ich das Haus geerbt und zum Verkauf angeboten. Wir hatten ja ein anderes Haus. Wie gefällt Ihnen das LichtAktiv Haus? CK: Das ist die Zukunft. Auch wenn es optisch schon aus der Siedlung D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 hervorsticht. Viele hier mögen es nicht. Gibt es etwas, das Ihnen beim Altbau besser gefiel? CK: Ich finde das neue Haus mit seinen großen Fensterflächen nicht mehr so gemütlich. Haben Sie an Ihrer Doppelhaushälfte in der Vergangenheit etwas verändert? CK: Ja, unser Haus hatte im Original eine Grundfläche von 6 mal 6 Metern, und wir haben noch ein anderes Haus von 8 mal 12 Metern danebengestellt. Vorher war es mit vier Personen auf 50 Quadratmetern doch ziemlich eng. Haben Sie noch weitere Baupläne? CK: Wir möchten es energetisch verbessern. Gedämmt haben wir die Fassade schon vor längerer Zeit. Jetzt könnte ich mir eine Solaranlage vorstellen. Was halten Sie von den IBA-Aktivitäten in Wilhelmsburg? CK: Die Projekte verbessern merklich das schlechte Image von Wilhelmsburg. Ich bin Immobilienmakler. Die Nachfrage und die Preise steigen spürbar. Ich finde, es soll aber bloß nicht so fein werden wie zum Beispiel Blankenese oder Winterhude. Mit gefällt die Bodenständigkeit hier. 95 „Architektur ist keineswegs ein zeitloses Medium – dies wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend deutlich. Insbesondere in den ausgehenden 1960er-Jahren gab es viele Forschungsanstrengungen für eine Flexibilisierung des Bauens. Häufig führte dies zu neutralen und gesichtslosen Gebäuden. Die neue Herausforderung für Architekten besteht nun darin, für das Unbekannte, für das Unvorhersagbare zu planen. Der Leitsatz ‚form follows function’ weicht neuen Konzepten, die auf Vielfalt und teilweise auf Dauerhaftigkeit setzen.“ Bernard Leupen et al.: Konzept zu “Time-based Architecture”, 2006 96 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 LEBENSZYKLEN PLANEN 97 98 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 99 ZEITBASIERTE ARCHITEKTUR UND MISCHNUTZUNG Das Wort ‚Veränderung’ ist in aller Munde: Die Märkte werden immer volatiler, gesellschaftliche Strukturen sind im Fluss, und über die ökologische Zukunft lassen sich kaum verlässliche Aussagen treffen. Dennoch werden Gebäude meist noch immer so geplant, als würde sich nichts in ihnen und um sie herum verändern. Dieses Dilemma lässt sich lösen – aber dafür sind planerischer Einfallsreichtum, Aufgeschlossenheit und ein Denken in längeren Zeithorizonten notwendig. Von Jasper van Zwol Fotos von Stanley Wong anothermountainman: lan wei liu, 2006 Über seine Fotografien sagt Stanley Wong: „Ich interessiere mich für die Themen der Existenz und für Momente, die verschwinden werden.“ Die Fotoserie ‚lan wei liu’ ist in der südchinesischen Stadt Guangzhou entstanden. Dort waren in der chinesischen Immobilienblase Ende der 90er-Jahre gigantische Immobilien mit rund 16 Millionen Fläche begonnen, aber niemals fertiggestellt worden. Der Titel der Arbeit spiegelt dies wieder: ‚lan’ bedeutet auf Chinesisch ‚verfallen’, ‚wei’ heißt ‚Ende’ und ‚liu’ bedeutet so viel wie ‚Trend’. Wongs Fotografien halten die Überreste des chinesischen Immobilien-Goldrauschs auf eindringliche Weise fest und reflektieren zugleich, wie sich das Konzept des ‚lan wei’ in allen Bereichen des Lebens manifestiert. Stanley Wong (*1960), bekannt auch unter dem Künstlernamen ‚anothermountainman’, lebt und arbeitet als Grafikdesigner, Filmemacher und Fotograf in Hongkong. Erfolgreich war er zunächst in der Werbeindustrie, unter anderem als Regional Creative Director bei Bartle Bogle Hegarty (Asia Pacific) in Singapur und als CEO von TBWA Hong Kong. 2005 vertrat er Hongkong bei der Kunstbiennale in Venedig mit seiner Fotoarbeit ‚redwhiteblue’. Er ist Mitglied bei der Alliance Graphique Internationale, einer Vereinigung der führenden Grafikdesigner der Welt. Wie lassen sich Gebäude für eine nicht vorhersagbare Zukunft entwerfen, mit denen die sich wandelnden Bedürfnisse der Menschen in den nächsten Jahrzehnten dennoch befriedigt werden? Bei den meisten Gebäuden sind Veränderungen bislang nur schwer möglich. Architekten interessieren sich nicht für dieses Thema – und verkennen damit die Realität. In seinem Buch ‚How Buildings Learn’ spürt Stewart Brand den Veränderungsmöglichkeiten in Gebäuden nach. Er schreibt: ‚Ein Gebäude ist nie vollendet, ein Gebäude ist immer ein Anfang.’ Die heutige Gesellschaft verändert sich beständig, Lebensstile und Anforderungen an Räume wandeln sich. Doch noch immer gibt es zu wenig typologische Vielfalt im Wohnungsbau und zu viel Wiederholung der ewig gleichen, unflexiblen Bebauungspläne, die einem monofunktionalen Städtebau Vorschub leisten. Zweifellos setzen ökonomische Zwänge der Veränderbarkeit von Wohnhäusern enge Grenzen. In den meisten Wohnbauten sind die Wohnungstrennwände gleichzeitig die tragenden Wände, und die Einhaltung der Schallschutzanforderungen wird rein über die Baumasse erreicht. Dagegen erleichtern Skelettbauten oder Gebäude, bei denen die tragenden Elemente in die Fassade integriert sind, eine spätere Veränderung. Auf diese Weise ist die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Abrisses aufgrund neuer Nutzungsanforderungen geringer. Dies wiederum hat ökonomische wie ökologische Vorteile. Schließlich stammt noch immer der größte Anteil des gesamten Abfallaufkommens in Europa aus dem Neubau und Abriss von Gebäuden. Derzeit verändert sich jedoch in vielen Ländern Europas die Baupraxis. Die Gründe dafür sind ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit, eine geringere Nachfrage nach Wohnraum und zunehmend kritischere Käufer. Diese bringen sich stärker ein und haben eine größere Auswahl als noch vor zwanzig Jahren. Das Interesse an der weiteren Entwicklung der Gebäude, nachdem sie geplant und übergeben worden sind, wächst. Die Projekte im Wohnungsbau werden in fast allen europäischen Ländern kleiner. Private Bauherrengemeinschaften gewinnen an Bedeutung. Die Rolle der Nutzer erfährt eine Neubewertung. Größere Geschosshöhen, wohlüberlegt positionierte Versorgungsbereiche, unterschiedliche Erschließungssysteme, Fassaden und Tragkonstruktionen für verschiedene Raumprogramme – alle diese Themen sind heutzutage entwurfsrelevant. Werden sie konsequent umgesetzt, entstehen Gebäude, die die Zeit überdauern. Der städtische Kontext Umbauten in Innenstädten gewinnen für Architekten und Stadtplaner zunehmend an Bedeutung. Hafenanlagen werden aus den Stadtzentren heraus und näher ans Meer verlagert. Zurück bleiben in Amsterdam, Rotterdam, London und Hamburg freie Flächen, auf denen attraktive, zentral gelegene Baugrundstücke entstehen. Ehemalige Bahngelände werden zu D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 101 102 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 neuen Orten zum Wohnen und Arbeiten umgenutzt, wie etwa in Paris südlich des Gare d’Austerlitz an der Bibliothèque Nationale. Stimuliert wird diese neue Haltung zur Stadt insbesondere durch die zunehmende Verbindung von Wohnen und Arbeiten. Ihre Pioniere sind oft kleine Betriebe aus der Kreativwirtschaft, die sich als Erste auf umgenutzten Industriearealen ansiedeln. Diversität und Nutzungsvielfalt können die Stadt in mehrfacher Weise voranbringen: – Sie tragen dazu bei, bestehende Wohnumfelder zu erhalten und mehr Vielfalt zu schaffen. – Raum wird intensiv und effizient genutzt. – Das Pendlerverkehrsaufkommen wird reduziert. – Die Sicherheit wird erhöht, und in die Wohnstraßen zieht mehr Leben ein. – Mehr unterschiedliche Raumangebote für Gewerbe und Büros werden möglich. Zukunftssichere Gebäudetypen Ein Gebäudetypus, der besonders viele unterschiedliche Raumprogramme zulässt, wird in den Niederlanden ‚Solid’ (wörtlich: ‚Festkörper’) genannt. Ein ‚Solid’ besitzt eine dauerhafte äußere Hülle, aber variabel nutzbare Innenräume. In diesen Gebäuden folgt die Form nicht länger der Funktion. Sie sind wirtschaftlich nachhaltig, streben aber auch funktionelle, technische und kulturelle Nachhaltigkeit an. Ein klassisches Beispiel ist das typische Amsterdamer Kanalhaus aus dem 17. Jahrhundert, das über die Jahrhunderte vielen verschiedenen Zwecken diente, als Patrizierhaus, Büro, Geschäft und Luxusapartment. Möglich wurde dies durch offene Grundrisse mit großzügig bemessenen Räumen, große Geschosshöhen und überdimensionierte Tragkonstruktionen. Eine ähnliche Umnutzung erfuhren im Laufe der Jahrhunderte viele alte Lagerhäuser und Fabriken, in denen Wohn- und Arbeitsräume entstanden. In den vergangenen Jahren sind in Amsterdam einige wenige neue ‚Solids’ für kombiniertes Wohnen und Arbeiten entstanden: ‚Solid Ijburg’ (Baumschlager & Eberle Architekten, Wien) und ‚Solid Furore’ (Tony Fretton Architects, London). Sie verstehen sich als neue ‚Stadtpaläste’, die beide mithilfe von Natursteinfassaden kulturelle Nachhaltigkeit erzielen wollen (eine eher fragwürdige Strategie, wie ich später zeigen werde). Ein ‚Solid’ setzt sich aus Schichten unterschiedlicher Lebensdauer zusammen. Die Tragkonstruktion und die Erschließungssysteme sind mit rund 100 Jahren am langlebigsten. Es folgen die Glasfassade und die Fenster mit 25 Jahren, die Trennwände mit 20 Jahren und die Innenausstattung mit bis zu 10 Jahren. Beim Entwurf eines ‚Solid’ gilt das größte Augenmerk solchen Komponenten, die die ‚öffentliche’ Qualität des Gebäudes bestimmen und die längste Lebensdauer haben. ‚Solids’ müssen kulturell bedeutsam und beliebt sein, sonst ist ihr Abriss unvermeidbar, sobald sie den aktuellen Standards nicht mehr entsprechen. Aber allein mit der Verwendung von Naturstein und mit einer klassischen Fassadengestaltung wird man dies kaum erreichen. Langfristig sind andere Aspekte im Bereich der architektonischen Qualität wichtiger. Ein Beweis hierfür ist beispielsweise das Zonnestraal-Sanatorium von Jan Duiker in Hilversum – ein Gebäude mit vielen Defiziten, das dennoch sehr beliebt war und kürzlich mit großem Aufwand saniert wurde. In der letzten Zeit ist die Zahl der ‚Solids’-Bauprojekte aufgrund der Finanzkrise zurückgegangen. Ihre Baukosten sind höher als bei Standardgebäuden, da unter anderem die Konstruktionen für höhere Lasten ausgelegt werden und die Geschosse höher sind. Hierdurch wird die Freiheit für Nutzungsänderungen in der Zukunft überhaupt erst möglich. Steigen dürfte die Zahl der ‚Solids’ jedoch erst dann wieder, wenn die Investoren ihren Zeithorizont erweitern und längere Amortisationszeiten für ihre Investitionen akzeptieren. Eine weitere Möglichkeit, um mehr Diversifikation in kompakt bebauten Städten zu erreichen, bieten Gebäude, in denen die Bewohner einen oder mehrere Teilbereiche erwerben können und deren flexible Innenraumgestaltung nur von der vertikalen Erschließung, der Tragkonstruktion, der Fassade und den Versorgungsschächten beschränkt wird. So erhielte man Einheiten ab etwa 65 m2, aber auch große Bereiche, in denen Wohnen und Arbeiten kombiniert werden kann. Die technische Ausstattung und die Leitungsverlegung in Gebäuden dieser Art müssen sorgfältig geplant sein. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt ‚Schiecentrale 4b’ in Rotterdam von Mei Architects and Urban Planners. In den oberen acht Geschossen dieses Gebäudes stehen Wohn- und Arbeitsbereiche unterschiedlicher Größen zur Verfügung, die kombinierbar sind und nach Bedarf auch später noch verändert werden können. Eine neue Tendenz bei der Sanierung alter innerstädtischer Häuserblocks ist die Beschränkung der Renovierungsarbeiten auf den Rohbau und die Fassaden. Die Bewohner können dann den Innenausbau selbst organisieren. Projekte dieser Art mit dem Titel ‚Eén Blok Stad’ wurden in Amsterdam (Marnixkade) und Rotterdam (Oude Noorden, Oude Westen) realisiert. Für junge Leute, die zum ersten Mal eine Wohnimmobilie kaufen, erleichtert ein solches Vorgehen die ersten Schritte. Sie müssen ihre Wohnung nicht sofort ‚fertigstellen’, sondern können nach und nach am Ausbau arbeiten. Andererseits können auch ältere Menschen durch den Einbau entsprechender Hilfen (wie kleiner Aufzüge) länger in ihren Wohnungen bleiben. Zu guter Letzt sollten auch Wohnräume neu definiert werden. Häuser brauchen mehr große, nutzungsneutrale Bereiche und weniger Räume, die entsprechend den angenommenen Bedürfnissen der Standardfamilie festgelegt sind. Große Räume ohne vordefinierte Zweckbestimmung können von Familien ebenso genutzt werden wie etwa von einer Einzelperson mit einem Start-up-Unternehmen. Die Versorgungsräume und festen Elemente, wie Treppenaufgänge und Bäder, sollten in einem Bereich konzentriert sein, damit mehr Raum frei bleibt für variable Nutzungen. 103 Anforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft Welche Entwicklungen in der Gesellschaft, in den Nutzerbedürfnissen und im urbanen Umfeld machen neue Entwurfsstrategien erforderlich? Sich wandelnde Lebensstile und die Unwägbarkeiten, die sie für das Wohnen mit sich bringen Rund 54 % der Haushalte in Amsterdam sind inzwischen Einpersonenhaushalte. Die Menschen leben länger, und die Durchschnittsfamilie hat weniger Kinder als in den vergangenen Jahrzehnten. Die Scheidungen nehmen zu, und der Bedarf an Stauraum steigt. Unterstützt durch die neuen Kommunikationstechnologien, arbeiten immer mehr Menschen zu Hause. Gebaut wird jedoch noch immer eine endlose Wiederholung von DreiZimmer-Wohnungen für die Kernfamilie. Diese aber bieten langfristig nur geringe Möglichkeiten, die neuen Wohnformen und Lebensstile mit den unterschiedlichsten Kombinationen von Wohnen und Arbeiten unterzubringen. Notwendig sind daher eine größere Vielfalt und mehr Anpassungsmöglichkeiten, sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Aufteilung der Wohnungen. Der instabile und sich rasch verändernde Markt für Bürogebäude Zeitgenössische Gebäude und die Prozesse, in denen sie entworfen und gebaut werden, passen nicht in den sich rasch verändernden Immobilienmarkt. Noch vor dem Bau eines Gebäudes muss ein Investor häufig dessen Zweckbestimmung ändern. Erforderlich sind daher Gebäude ohne vorbestimmte Nutzung, in denen sich innerhalb eines beständig flexiblen Systems Wohnungen ebenso wie Büros unterbringen lassen und deren Nutzung auch später noch veränderbar bleibt. Nur so können längere Leerstände oder der Abriss der Gebäude verhindert werden – eine unabdingbareVoraussetzung, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Die Zunahme von Monofunktionalität in der Stadt infolge unflexibler Flächennutzungspläne 104 Industrie- und Gewerbegebiete, in denen nicht auch eine Wohnbebauung möglich ist, tragen weder zu einem sicheren Lebensumfeld noch zu einer dynamischen Stadtlandschaft bei. Mit einer flexibleren Flächennutzungsplanung lässt sich dagegen schneller auf Veränderungen reagieren. Steigende Mobilität und sich daraus ergebende Probleme für den Pendlerverkehr Durch mehr Home-Office-Tätigkeiten lassen sich Verkehrsstaus in den Hauptverkehrszeiten reduzieren. In Japan und China feiern SOHOs (Small Office-Home Offices) große wirtschaftliche Erfolge wie z. B. das Jian Wai SOHO in Beijing von Riken Yamamoto. Durch sie entsteht ein sehr dynamischer Typus kollektiven Wohnens mit hoher Raumqualität in den Wohnungen. Die neue Herausforderung Noch sind viele Gebäude zu unflexibel, um in angemessener Weise für den anstehenden Bedarf umgerüstet zu werden. Um auf den beständigen Veränderungsdruck reagieren zu können, müssen Gebäude mehr Nutzungen unter einem Dach vereinen können oder sich leicht und schnell abbauen lassen, mit der Folge, dass sie weniger kosten dürfen und beim Rückbau weniger Abfälle verursachen dürfen. Wir müssen Gebäude entwerfen, für die bereits im Vorfeld eine Nutzungsdauer von 5, 10, 50 oder 200 Jahren definiert wird. Ich selbst habe einmal mehrere Pavillons entworfen, deren Lebensdauer vorab auf 15 Jahre festgelegt wurde. Für diese Gebäude wurden Konstruktionstechniken und Materialien aus der LKWHerstellung verwendet, da diese eine ähnliche Lebensdauer besitzen. Am Ende ihres kurzen Lebens waren die Pavillons leicht zu demontieren. Wir müssen Gebäude entwerfen, die vielen Anforderungen gerecht werden können und ohne Umbaumaßnahmen Flexibilität bieten: Gebäude mit eher neutralen Räumen, die vielfältige Nutzungen ermöglichen und in denen die Bewohner ihr eigenes Umfeld mit Hilfe von Schiebewänden und beweglichen Möbelstücken schaffen können. Wir müssen Gebäude entwerfen, die sich sowohl innen wie auch außen leicht verändern lassen. Dabei muss der Rohbau weitgehend vom Innenausbau getrennt sein. Große Krankenhäuser etwa sind ein extremes Beispiel für Bauten mit sich stark und schnell wandelnden Anforderungen. Sie müssen auf den technischen Fortschritt und die sich ändernden Organisationsformen im Gesundheitswesen reagieren, sodass im Prinzip ständig (Um-)Baumaßnahmen notwendig sind. Auch im Gebäudebestand ist ein Umdenken notwendig. Aufgrund der Alterung der Gesellschaft und der Finanzkrise der vergangenen Jahre entstehen in Europa immer weniger Neubauten. Einzelne Untersuchungen besagen sogar, dass die Flächen in den bereits vorhandenen Gebäuden auch für die nächsten 50 Jahre ausreichend sind. Glücklicherweise werden immer weniger alte Gewerbebauten und Bürogebäude abgerissen – selbst in China: Im Pekinger Stadtteil Dashanzi erlebte ein ehemaliges Gewerbegebiet innerhalb weniger Jahre eine Renaissance als ‚Kunst-Viertel 789’. 2002 begannen Künstler und Kulturorganisationen die Fabrikräume aufzuteilen, zu vermieten und zu sanieren und bauten sie nach und nach zu Galerien, Kunstzentren, Ateliers, Restaurants und Bars um. Die Verwandlung dieser Gebäude in dynamische Orte zum Wohnen und Arbeiten, die einen Nährboden für die Kreativwirtschaft bilden, ist ein inspirierendes Vorbild für viele andere Neu- und Umbauten, die in ihrer Wandelbarkeit ein Zeichen unserer Zeit sein könnten. Jasper van Zwol ist Assistenzprofessor an der Architekturfakultät der Technischen Universität von Delft, wo er den Fachbereich Architektur und Wohnen leitet. Daneben arbeitet er als Architekt im Büro van Zwol Architects in Delft. Mit Bernard Leupen und René Heijne gab er 2005 das Buch ‚Time-based Architecture’ heraus. Weitere Veröffentlichungen von Jasper van Zwol sind ‚Time-based Architecture International’, Band 3 (2008) und ‚Het Woongebouw’ (2009). 2006 war Jasper van Zwol Hauptredner bei der Konferenz ‚Mixed-Use Schemes’ in London. D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 105 106 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 107 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 „AUCH SCHLECHTE NACHRICHTEN KÖNNEN WERTVOLL SEIN” Jeder Architekt weiß, wie man ein Haus baut – aber über den tatsächlichen Nutzwert von Wohngebäuden ist nur wenig bekannt. Initiativen wie der Usable Buildings Trust in Großbritannien wollen dies ändern und entwickeln neue Planungs- und Lernprozesse, die wesentlich zur Verbesserung der Qualität unseres Wohnumfelds beitragen könnten. Interview mit Fionn Stevenson & Bill Bordass Fotos von Lars Tunbjörk Innenarchitektur von Jacob Hertzell Sie sind beide aktiv im Bereich der PostOccupancy Evaluation (POE), der nutzungsorientierten Erfolgsüberprüfung von Gebäuden. Anders als etwa bei Bürogebäuden ist über den tatsächlichen Nutzwert von Wohnhäusern immer noch sehr wenig bekannt. Wie kommt das? FS: Ein Grund liegt sicherlich in der Komplexität einer systematischen POE. Es ist relativ einfach, eine eher oberflächliche Massenumfrage unter den Bewohnern vorzunehmen oder ein breit angelegtes Gebäudemonitoring. Viel schwieriger ist es jedoch, die Zustimmung der Nutzer für eine wirklich umfassende Untersuchung zu erhalten. Wir müssen zum einen den persönlichen Energieverbrauch und die Wohnungsdaten messtechnisch erfassen, was nicht jedem recht ist, zum anderen die tatsächliche Nutzbarkeit der Wohnung beurteilen. Hierzu müssen wir die Wohnungen betreten, was eine viel größere Verletzung der Privatsphäre bedeutet als zum Beispiel in Bürogebäuden oder öffentlichen Gebäuden. Zudem spielen im Wohnsektor große Unterschiede in der Demografie der Bewohner, in der Gebäudetypologie und in den Besitzverhältnissen eine Rolle. Inwieweit ist das Interesse an der POE im Wohnsektor gestiegen? FS: In der Vergangenheit zeigte die private Baubranche in Großbritannien wenig Interesse an der Bewertung ihrer Produkte nach dem Verkauf. Das ändert sich jetzt langsam. Einige – vor allem größere – Wohnungsbauunternehmen haben mittlerweile erkannt, dass ihnen die POE Marktvorteile einbringen kann. Interessanterweise beginnen sie nun inmitten der Rezession, sich mit dem Thema zu befassen, um für kommende Zeiten besser gewappnet zu sein. Zudem setzt der Staat durch Fördermittel und Veranstaltungen Anreize für Baufirmen und Projektentwickler, um sich mit dem Thema zu befassen. Das Problem sind, so denke ich, nicht die renommierten Unternehmen, sondern all diejenigen, denen die finanziellen Mittel fehlen, um in diese Art des Wissenstransfers zu investieren. Wie stehen Architekten und Ingenieure zu diesem Thema? FS: Meiner Erfahrung nach sind Wohnungsbauunternehmen oftmals eher bereit als Architekten, die Wahrheit über ihre Produkte zu erfahren. Das überrascht mich eigentlich. Viele Architekten verhalten sich ziemlich defensiv, was mit der momentanen Marktsituation zu tun haben mag: Die Unternehmen beauftragen Architekten zunehmend mit mehreren Objekten auf einmal, und diese streben folglich ‚Wiederholungsgeschäfte’ mit demselben Auftraggeber an. Die Architekten und Planungsteams sind nervöser geworden – denn falls Projekte nicht reibungslos funktionieren und Folgeaufträge ausbleiben, resultiert das natürlich in umso größeren Einnahmeverlusten. Lars Tunbjörk und Jacob Hertzell: Puppenhaus, 2011 Der schwedische Fotograf Lars Tunbjörk lässt in seinen Fotografien die soziale Wirklichkeit und die Ambitionen seiner Mitmenschen aufeinanderprallen. Von Ikea bis zu chinesischen Nachtklubs, von Shopping-Malls bis zu den Bürointerieurs unserer Zeit – Tunbjörk hat (fast) alle Orte besucht, an denen Menschen sich freiwillig in den Dienst der Konsumgesellschaft stellen. Seine Agentur ‚Vu’ bezeichnete Tunbjörks Fotografien einmal als ‚zugleich urkomisch und todtraurig.’ Von sozialer Realität und Repräsentation, menschlichen Ambitionen und Zukunftshoffnungen handeln auch die Interieurs eines Puppenhauses, die Lars Tunbjörk für Daylight/ Architecture fotografiert hat. Die Entwürfe hierzu stammen von dem schwedischen Architekten, Innenarchitekten und Stylisten Jacob Hertzell. Sie zeigen ausschnitthaft, wie Wohnen in drei Epochen – 1960, heute und im Jahr 2050 – ausgesehen hat und künftig aussehen könnte. Lars Tunbjörk (*1956) begann seine Karriere als Pressefotograf bei der Zeitung Stockholms-Tidningen und anderen schwedischen Zeitungen und Magazinen, bevor er sich mit den Büchern ‚Landet Utom Sig’ (‚Ein Land außer sich’), ‚Office’ und ‚Home’ auch international einen Namen als freier Kunstfotograf machte. Heute lebt Lars Tunbjörk in Stockholm und ist Mitglied der französischen Fotoagentur ‚Vu’. 2005 erhielt er den World Press Photo Award in der Kategorie ‚Arts and Entertainment: Stories’. Jacob Hertzell studierte Kunstwissenschaften und Ideengeschichte an der Universität Stockholm sowie Design am Beckmans College of Design in Stockholm. Er betreibt sein eigenes Büro für Innenarchitektur und arbeitet als Stylist unter anderem für Zeitschriften wie die New York Times, Vogue Living und Architectural Digest. 109 110 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 111 „Leider […] haben wir trotz der Dringlichkeit immer noch nicht gelernt, den Feedback-Kreis zu schließen und den Nutzwert unserer Gebäude radikal zu verbessern. Oftmals heißt es: ‚Das wissen wir alles’, doch dann wiederholen sich die Missgriffe.” aus Adrian Leaman, Fionn Stevenson & Bill Bordass (2010): Building evaluation: practice and principles. Building Research & Information, 38:5, S. 564–577 BB: Ingenieure scheinen schlechte Nachrichten besser zu verkraften. In unseren ‚Probe’-Studien zwischen 1995 und 2002, bei denen wir den Nutzwert von zwanzig Neubauten beurteilt und die Ergebnisse veröffentlicht hatten, drohten uns zwei potenzielle Gerichtsklagen. Beide kamen von Architekten, obwohl bei unseren Untersuchungen eigentlich die Gebäudetechnik im Mittelpunkt stand. FS: Meiner Meinung nach hat dies auch etwas mit der Ausbildung der Architekten zu tun. Sie werden darin geschult, ein Produkt zu liefern, aber haben wenig Ahnung vom Herstellungsprozess eines Gebäudes oder dessen tatsächlicher Nutzung. Einige unserer Kollegen beim Usable Buildings Trust arbeiten deshalb intensiv daran, die POE in die Lehrpläne einfließen zu lassen. Architekten müssen verstehen, dass auch die Überprüfung und Beurteilung der eigenen Produkte Bestandteile ihrer Dienstleistung sind. Welche Vorteile hat die Erfolgsüberprüfung von Gebäuden – vor allem für die Entwerfer? BB: Als wir in den achtziger Jahren begannen, die Ergebnisse von POE-Studien publik zu machen, wurden sie in der Branche wie radioaktives Material behandelt. In den letzten fünf Jahren haben sich einige führende Planungsbüros jedoch näher mit der Materie befasst und eingesehen, dass ihre Gebäude häufig nicht die gewünschte Leistung bringen. Ihre Überlegung lautete: „Wenn wir uns diesem Problem nicht stellen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir in fünf oder zehn Jahren unsere Marktposition einbüßen.“ Interessanterweise kann sogar die Veröffentlichung schlecher POE-Ergebnisse positive Konsequenzen haben. Ich kenne zwei führende britische Ingenieurbüros, die beide systematisch Nutzerfeedback einholen. Das eine veröffentlicht die Ergebnisse, auch wenn sie schlecht sind, das andere nicht. Im Endeffekt hat das erste Büro an Glaubwürdigkeit gewonnen und Berichten zufolge seinem Konkurrenten sogar Marktanteile abgenommen. 112 Schlechte Ergebnisse zu übermitteln ist sicher keine einfache Aufgabe? BB: Wir tun dies schon seit geraumer Zeit mit Erfolg. Wichtig ist, sich auf Fallstudien konkreter Gebäude zu stützen, wenn man häufig wiederkehrende Probleme erläutern will. So kann jeder die Abläufe nachvollziehen und eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten erkennen. Problematisch wird es, wenn Dritte – Medien, Politiker und Bürokraten – diese Informationen nutzen, um Sensationsartikel zu schreiben oder die Beteiligten an den Pranger zu stellen. Feedback – ob gut oder schlecht – ist eine notwendige Lernerfahrung und dient dazu, die Produkte und Dienstleistungen der Baubranche zu optimieren. Zudem unterstützt es Bauherren dabei, ihre Ansprüche präziser zu formulieren. FS: Einige interessante Ansätze in Großbritannien versuchen, das Problem des ‚Anprangerns’ zu überwinden. Dazu zählt zum Beispiel die Website www.carbonbuzz.org. Hier können Entwerfer die Energieeffizienz und CO2-Emissionen ihrer Gebäude anonym angeben und die in der Planung ermittelten Werte den tatsächlichen Verbrauchswerten gegenüberstellen. Hier werden zumindest Messdaten publiziert – allerdings noch, ohne die ‚Geschichten’ dahinter zu enthüllen. BB: Wahlweise können die Teilnehmer jetzt schon ihre Identität preisgeben. In absehbarer Zeit werden also auch die Ergebnisse namentlich genannter Projekte auf dieser Seite einsehbar sein, und je nach Möglichkeit wird es auch Links zu weiteren Projektinformationen geben. Entscheidend ist nämlich, dass hinter jedem guten Ergebnis der jeweilige Kontext sichtbar wird – und dieser wiederum hat meist viel mit den für das Projekt verantwortlichen Personen zu tun. Seit einigen Jahren unterstützt der Usable Building Trust die Entwicklung des sogenannten ‚Soft Landings‘-Prozesses. Damit sollen sich Gebäude im Hinblick auf ihre tatsächliche Nutzung optimieren lassen. Wie funktioniert Soft Landings konkret? BB: Mit Soft Landings lässt sich jeder Beschaffungsprozess für alle Bauprojekte weltweit begleiten. Die Vorgehensweise zielt darauf ab, Planung, Bau und Betrieb eines Gebäudes besser miteinander zu verknüpfen. Sie bringt sowohl Bauherren als auch Entwerfer und Bauunternehmen dazu, sich stärker auf die Ergebnisse zu konzentrieren und nicht nur auf die technischen Spezifikationen in der Ausschreibung. Das 2009 veröffentlichte Framework identifiziert fünf Hauptphasen von Soft Landings: 1. Projektvorbereitung und Beauftragung. In dieser Phase wird mehr Gewicht als bisher gelegt auf die prognostizierten Ergebnisse und ihren Vergleich mit den Leistungen anderer, ähnlicher Gebäude 2. Erwartungsmanagement bei Planung und Bau. Hierbei wird der Fortschritt des Projekts ständig anhand der ursprünglichen Intentionen überprüft 3. Vorbereitung der Übergabe und Gewährleistung einer erhöhten Bezugsbereitschaft von Gebäude und Nutzern 4. anfängliche Nachbetreuung zur Unterstützung des Nutzers, zur Feineinstellung der Systeme und zum Einholen von Feedback 5. längerfristige Nachbetreuung und POE nach normaler Ingebrauchnahme des Gebäudes. Laufende Fallstudien von Soft Landings belegen, wie wichtig die Unterstützung durch den Bauherren von Beginn an ist. Noch vor ihrer Beauftragung wissen alle Mitglieder des Planungs- und des Bauteams, dass es sich um ein Soft-LandingsProjekt handelt, bei dem großer Wert auf Ergebnisse und Nachbetreuung nach der Fertigstellung des Gebäudes gelegt wird. So können alle Beteiligten ihre Arbeiten dementsprechend ausrichten. Das Ganze ist eher eine Frage der Organisation als des Zeit- und Geldaufwands, zumindest bis zur fünften Phase. Lediglich für die längerfristige Nachbetreuung und POE entstehen zusätzliche Kosten – normalerweise für den Bauherren, da das Bauvorhaben zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen ist. D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 Mit Fortschreiten des Projekts ist der Einsatz einer Person (wir nennen ihn oder sie ‚Champion’) hilfreich, die die Ergebnisse im Auge behält und das Projektmanagement hinterfragt, um eine einseitige Fokussierung auf Kosten und Zeitpläne zu verhindern. Der Champion ist keine externe Person, vielmehr kann diese Funktion von jedem Teammitglied übernommen werden. Ein Projekt kann auch mehrere Champions haben: jeweils einen für den Bauherren, das Entwurfsteam, den Bauunternehmer und eventuell für den späteren Nutzer. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Vorteile von Soft Landings? BB: Die Neubauten und Sanierungen werden nicht kostspieliger, sondern eher preisgünstiger als andere vergleichbare Gebäude; sie kosten zudem im Unterhalt weniger (in einer Schule halbierte sich zum Beispiel der Stromverbrauch) und bringen bessere Leistungen für ihre Nutzer. Wenn wir bei einer POE in einem Neubau ein Problem festgestellt haben, lag dies selten an Geldmangel; das Geld wurde lediglich an der falschen Stelle ausgegeben. Oftmals lassen sich bessere Ergebnisse erzielen, wenn man Dinge vereinfacht und für eine angemessene Nachbetreuung sorgt. So lässt sich sicherstellen, dass alles funktioniert und man Erfahrungen für zukünftige Projekte sammelt. In erster Linie aber bringt der Prozess eine veränderte Arbeitsauffassung mit sich: Der Bauprozess findet seinen Abschluss nicht mehr länger in der Fertigstellung des Bauobjekts, sondern in dessen Ingebrauchnahme. Abgesehen von der POE-Phase bedeutet dies im Normalfall nicht mehr Arbeit, sondern nur mehr Konzentration. Für ein Unternehmen impliziert die anfängliche Lernphase natürlich einen erhöhten Kosten- und Zeitaufwand. Im Idealfall kommen hierfür die Bauherren auf, bei vielen aber stößt man auf Widerstand. Dennoch haben zahlreiche Entwerfer und Bauunternehmen mittlerweile erkannt, wie wichtig es ist, vorhersehbare Ergebnisse zu liefern. Kommen wir auf die Beurteilung von Wohngebäuden zurück. Lassen sich aus den bisherigen Studien allgemeine Erkenntnisse ableiten über die Präferenzen der Nutzer und darüber, was ‚funktioniert’ und was nicht? 113 FS: Die vorrangigen Kriterien für ein Haus oder eine Wohnung sind die Lage und die Kosten. Eine gute Lage und ein günstiger Preis lassen die Menschen oft sehr tolerant werden gegenüber anderen Nachteilen des Gebäudes. Wichtig ist aber auch die Atmosphäre eines Gebäudes, bei der zum Beispiel die Entwurfsqualität, die räumliche Beschaffenheit und das Tageslicht eine Rolle spielen. Wenn diese Bedingungen zufriedenstellend sind, kommen die Nutzbarkeit und somit Aspekte wie Bedienelemente und Funktionalität ins Spiel. Viele Bewohner sind mit der Küchengestaltung unzufrieden. Noch häufiger aber betreffen die Klagen einen Mangel an Abstellräumen, die in modernen Häusern offenbar nie ausreichend sind. Zwar sind sich darüber eigentlich alle – Bauunternehmer, Architekten und 114 Nutzer – einig, das Problem beheben sie aber nicht, vermutlich, weil zusätzlicher Stauraum höhere Kosten mit sich bringt. Wie sieht es mit der technischen Ausrüstung und deren Nutzung aus? BB: Gebäude werden im Namen der Energieeffizienz mit zunehmend komplexer Technologie überfrachtet. In der Praxis steht diese Verkomplizierung oftmals der Handhabung eines Gebäudes im Wege und beeinträchtigt dessen Leistungsfähigkeit. Das Problem liegt in den Verheißungen der Technik, in der machtvollen Lobby hinter der Technologie und in der Faszination der Menschen von der Technik, die nicht selten der Funktionalität und Nutzbarkeit abträglich ist. FS: POE-Studien in Wohngebäuden zeigen, dass die Bewohner häufig nicht mehr intuitiv in der Lage sind, ihr Eigenheim effizient zu betreiben. Viele machen sich nicht einmal mehr die Mühe, die Heizung zu regulieren oder können mit der Thermostat-Skala von 1 bis 5 nichts anfangen. Ebenso ist es weithin unbekannt, dass die meisten gebäudetechnischen Systeme in einem Sommer- bzw. Wintermodus arbeiten. Hier spielt auch eine Reihe demografischer Faktoren eine Rolle, wie zum Beispiel das Alter: Jüngere Leute kennen sich im Allgemeinen besser mit den Bedienelementen in ihrer Wohnung aus, während die ältere Generation einfach kapituliert. Auch das Geschlecht ist ein Aspekt: In vielen Haushalten übernimmt der Mann ‚das Steuer’, während Frauen sich vor diesen Dingen oft scheuen. D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 „Dem Architekten steht […] eine ganze Reihe von Erkenntnismöglichkeiten offen: Das eigene Erleben und dessen Reflexion, die Beobachtung des Verhaltens anderer Nutzer, das Ziehen von Schlüssen aus den langfristigen materiellen Folgen des Verhaltens. […] Der Nutzen einer derartigen individuellen Auseinandersetzung mit Gebäuden unterschiedlichster Art steht außer Frage.” Riklef Rambow and Jörg Seifert in: Graz Architecture Magazine 03, 2006 Wie reagiert die Industrie auf diese Erkenntnisse? FS: Die Hersteller ‚aktiver’ Technologien wie etwa Heizungssteuerungen scheinen sich des Problems zumindest bewusst zu sein. Hingegen gibt es in Wohngebäuden oft große Probleme mit der Bedienbarkeit von ‚Low-Tech’-Standardelementen wie Fenstern – also mit Dingen, die man eigentlich für selbstverständlich halten sollte. Es ist mir zum Beispiel schon mehrfach gelungen, ein Drehkippfenster komplett aus dem Rahmen heben! BB: Es ärgert mich, dass manche Designer und Hersteller die Leute für dumm erklären, wenn diese mit ihren Produkten nicht zurechtkommen. Stattdessen sollten sie die Gestaltung und Funktionsfähigkeit ihrer Produkte hinterfragen. FS: Die wenigsten Hersteller testen die eigenen Produkte in realen Gebäuden an Endverbrauchern. Oft finden Tests allenfalls mit Arbeitern im eigenen Werk statt. So etwas ist natürlich nicht aussagekräftig, weil die Fabrikarbeiter mit dem Produkt viel besser vertraut sind und sich vielleicht auch bei ihrem Arbeitgeber beliebt machen wollen. Spielt es für die Nutzbarkeit eine Rolle, ob ein Haus oder eine Wohnung speziell für die jeweiligen Bewohner geplant wurde? FS: Nicht wirklich, weil sich die Einbeziehung des Endnutzers meist auf die Auswahl einiger weniger Ausstattungselemente beschränkt. Viel mehr hängt von der Nutzbarkeit der Produkte selbst und ihrer Zweckmäßigkeit im Gesamtkontext ab. Bedienelemente sollten zum Beispiel gut zugänglich platziert werden. Der Übergabeprozess hingegen kann für die Nutzbarkeit genauso wichtig sein wie die Planung selbst. Hier gibt es noch einen großen Schulungsbedarf, vor allem im Hinblick auf neue Technologien. Nicht selten kennen diejenigen, die den Bewohnern die Belüftungs- und Heizsysteme erklären sollen, deren Funktionen und korrekte Bedienung selbst nicht genau. Das ist wirklich bedenklich. Wie viel und welche Art der Anpassungsmöglichkeit und Flexibilität erwarten die Nutzer von ihren Wohnungen? FS: Moderne Wohnungen in Großbritannien bieten sehr wenig Flexibilität oder Anpassungsmöglichkeit. Unserer Erfahrung nach würden viele Bewohner eine offenere Gestaltung und mehr ‚Fluss’ in ihrem Zuhause bevorzugen. Außerdem möchten sie elektronische Geräte überall dort nutzen, wo sie möchten. Doch weder die Regierung noch die Bauindustrie haben dies bisher begriffen. Zumindest in Großbritannien herrscht noch immer die althergebrachte Vorstellung, dass jemand, der daheim arbeitet, ein Büro braucht – dabei benötigt er lediglich flexibel nutzbare Räume! Die Bewohner wissen es zu schätzen, einen Raum auf verschiedene Weise nutzen zu können. Trotzdem ist die Bauindustrie noch meilenweit davon entfernt, diese Marktnachfrage mit ihren Produkten zu bedienen. BB: Die flexibelsten Häuser in Großbritannien sind womöglich die städtischen Reihenhäuser des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. Ich wohne selbst in solch einem Haus und finde es ganz außergewöhnlich, als wie anpassungsfähig sich die sehr einfachen Grundrisse immer wieder erweisen. In modernen Häusern gibt es so etwas selten: Hier haben Räume und Technologien eine einschränkende Wirkung. Dr Bill Bordass ist Wissenschaftler und begann seine Karriere in der Baubranche bei RMJM London, wo er für die Bereiche Gebäudetechnik und Energiedesign verantwortlich zeichnete. Anschließend gründete er das Unternehmen William Bordass Associates, das leistungsbezogene Untersuchungen und Fehleranalysen an bestehenden Gebäuden durchführt. Zudem ist er als Forschungsbeirat und politischer Berater des Usable Buildings Trust tätig (www.usablebuildings. co.uk). 2008 wurde er mit dem CIBSEEnergieeffizienz-Preis ausgezeichnet. Dr Fionn Stevenson ist Professorin für Nachhaltiges Entwerfen an der Universität Sheffield und Director of Technology an der dortigen Architekturfakultät. Sie begann ihre Karriere als Architektin mit Schwerpunkt Wohnungsbau, erkannte jedoch rasch die Notwendigkeit, mehr Gewicht auf die praktische Gebrauchstauglichkeit von Gebäuden zu legen. Heute ist sie Spezialistin für Gebäudenutzwert und Feedback-Analyse und als Beraterin für diverse Regierungsbehörden tätig. Es gibt einen Unterschied zwischen ‚flexiblen‘ Gebäuden mit beweglichen Elementen und solchen, bei denen die Räume variabel nutzbar sind. Welcher Ansatz bietet Ihrer Meinung nach mehr Potenzial? FS: Die Anpassungsmöglichkeiten, wie wir sie von Baukastensystemen mit beweglichen Wänden und Böden kennen, werden nur selten von den Bewohnern ausgeschöpft. Für wirkliche Flexibilität ist es wichtiger, dass die Räume groß genug sind, damit der Nutzer sie ohne Veränderung der Bausubstanz umgestalten kann. Dies erfordert geringen Arbeitsaufwand, keine spezialisierten Handwerker und schafft mehr Gestaltungsfreiraum. Für mich als Architektin liegt die Zukunft deshalb in der intensiven Beschäftigung mit den Möglichkeiten, den gleichen Raum auf ganz unterschiedliche Weise zu nutzen. 115 116 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 117 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 MULTIOPTIONALES WOHNEN Die gegenwärtige, multioptionale Gesellschaft generiert eine Vielfalt zuvor ungekannter Lebensstile und Lebensphasen. Doch im Wohnungsbau herrscht – mit wenigen Ausnahmen – seit 50 Jahren Stillstand. Lösungsansätze sind selten, doch es gibt sie: Kybernetische Strukturen könnten den Weg weisen hin zu einer Architektur, die dem Lebenszyklus des Menschen gerecht wird. Von Günter Pfeifer Fotos von Lars Tunbjörk Innenarchitektur von Jacob Hertzell Lebensabschnittsgemeinschaften, Patchworkfamilien, Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern, junge Singles, alte Singles und freie Wohngemeinschaften – die gesellschaftliche Realität unterschiedlicher Lebensentwürfe lässt sich im Wohnungsbau nicht abbilden. Singles benötigen je nach Wirtschaftskraft kleine Wohnungen im urbanen Umfeld; junge Familien preiswerte Wohnungen mit drei oder mehr Zimmern in einer kinderfreundlichen Nachbarschaft. Geschäftige Karrieremenschen hingegen brauchen die großzügige Stadtwohnung; die „Best Ager“ mit den angesammelten Lebensschätzen ebenso. Erst ältere Menschen, in der diskriminierenden Form ‚Nogos’ genannt, beginnen – nicht nur wegen äußerer Umstände – die Lebensschätze zu reduzieren, müssen mit kleineren Wohnungen auskommen. Doch diese sind meist an andere Randbedingungen geknüpft, die man unter dem Begriff Barrierefreiheit subsumiert: Aufzugserschließung, breite Türen in allen Räumen, schwellenfreie Duschen, behindertenfreundliche WCAnlagen. Idealerweise sehnt sich diese immer größer werdende Bevölkerungsgruppe nach Gemeinschaft und Nachbarschaft in unmittelbarer Nähe. Wenn es noch gelänge, die eigene Wohnung mit einer kleinen Wohnung für eine Pflegeperson zu koppeln oder eine Wohngemeinschaft mit einem Gleichgestellten und -gesinnten zu finden, wäre dies ein glücklicher Zufall. Für alle diese vorgenannten Szenarien gibt es nur spezielle Wohnungsangebote, die selten genug an „Im Lebenszyklus stellt jeder den richtigen Orten liegen. Nun kann man einfach die Frage stel- Lebensabschnitt eine eigene kleine len: Warum zieht ihr nicht um, wenn sich Sinnwelt mit spezifischen Wohndie Lebensumstände ändern? Statt einer und Lebensstilen dar. In einer Antwort stelle man sich die Gegenfrage: Gesellschaft des langen Lebens Warum sollte man? Warum kann sich werden die Wohnformen wesentnicht die Wohnung anpassen? Hier stößt lich von solchen wechselnden man unweigerlich auf des Pudels Kern: Lebensphasen bestimmt und sind Varianz und Anpassung, wenigstens eine immer weniger nur eine Frage des Annäherung an die Veränderung der LeMilieus […], des Geldes oder des benszyklen finden im Wohnungsbau keinen Ausdruck. Nach wie vor muten Anspruchsniveaus […] Mit jeder wir dem Wohnungsbau Strukturen zu, Lebensphase ändern sich die von denen wir wissen, dass diese nur be- Lebensstile – aber nicht die stimmte Lebensphasen überdauern. Menschen.” Vom Lebens-Raum ins Korsett des Wohnens Ein Blick in die Geschichte lohnt sich, denn das war schon einmal – wenigstens unter den damaligen Umständen – anders. Der Wohnungsbau der Gründerzeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts schuf vor allem in den Großstädten, aber auch in den Mittelzentren Wohnungstypen, die sich heute noch großer Beliebtheit erfreuen. Sieht man einmal davon ab, dass es sich bei diesen Wohnungen um großzügig geschnittene 120–140 qm handelte, fällt auf, dass die Grundrissstruktur eine grundsätzliche Eigenart hatte: Die meisten Räume waren nutzungsneutral. Es gab nicht das determinierte Schlaf- oder Kinderzimmer oder den repräsentativen Wohnraum. Die Versorgungsstruktur schuf natürlich den festen Platz für Bad, WC und Küche, doch Letztere war meist Horst Opaschowski in: Besser leben – schöner wohnen?, 2005 119 „Jeder Wohnungsneu- und umbau, bei dem der Bauherr nicht zugleich der spätere Nutzer ist, ist ein prognostisches Experiment, eine gebaute These dazu, wie wir in Zukunft wohnen wollen bzw. wohnen sollen. […] Unser prognostischer Instrumentenkasten ist darauf ausgerichtet, die Markttrends in einem weitgehend gleich bleibenden Ordnungssystem zu erkennen und dem Markt dann – mit oder ohne staatliche Hilfen - zu geben, was er braucht. Wenn die Zukunft aber durch Marktversagen und Brüche – man kann auch sagen: Paradigmenwechsel – bestimmt wird, ist diese Methode weitgehend unbrauchbar. Wir müssen den Wohnungsmarkt der Zukunft nicht beliefern, sondern gestalten.” Armin Hentschel: Wohnen im Wandel, in: landschaftsarchitekten 3/2010 120 ein ebenso großer Raum wie die übrigen. Wohnformen für Alte und Behinderte Meist war um eine stattlich große Diele sind die Anforderungen in entsprechenein Kranz gleich großer Räume angeord- den Gesetzen verankert. Zusammennet, die wiederum untereinander mit Tü- genommen haben diese Verordnungen jedoch keine grundsätzliche Strukturänren verbunden waren. Die Varianz innerhalb dieser Woh- derung ausgelöst. Ökokomische Zwänge nungsgrundrisse war erstaunlich groß. und die unter den Bauträgern übliche Einstellung – wir wissen, was der Markt Befördert wurde dies noch durch die zusätzliche Erschließung eines Zim- verlangt – sowie das enge Korsett der öffentlichen Förderungen haben eine mers direkt vom Treppenhaus. Damit konnten ein oder mehrere Zimmer zu- grundsätzliche Evaluation des Wohsammengefasst eine gesonderte Einheit nungsbaus ausgeschlossen. bilden. Der externe Zugang ermöglichte eine bescheidene Geschäftsnutzung oder Gesucht: Gebäudestrukturen für eine Untervermietung. Zu alledem kam alle Lebensformen die angenehme Besonderheit, dass diese Man kann also mit Fug und Recht beWohnungen über andere Geschosshöhen haupten, dass sich die Lebenszyklen verfügten. Die lichte Höhe der Innenräu- im Wohnungsbau nicht abbilden. Das me betrug meist über drei Meter, in weni- führt aus verschiedenen Gründen zu gen Fällen sogar bis zu vier Metern. Damit der Forderung, dass wir radikal andere konnte die Belichtung tief in das Hausin- Wohnformen brauchen. Wohnformen, in denen sich der Individualismus genauso nere eindringen. In der innen liegenden wiederfindet wie die immer changierenDiele, die wegen der Größe oftmals auch als Essplatz verwendet wurde, konnte de und wechselnde Möglichkeit, unterman, je nach Lage, in der Morgensonne schiedliche Gemeinschaften zu bilden frühstücken. und die sich ändernden Lebensumstände Dieses Prinzip wurde in der Hektik des ohne große Umbau- und damit UmzugsWiederaufbaus nach dem Krieg und un- maßnahmen realisieren zu lassen. ter dem Diktat der sozialen Gerechtigkeit Doch wie können solche Wohnuneinem anderen Prinzip geopfert: dem pa- gen aussehen? Lernen wir aus anderen Kulturen und fassen Altes und Neues triarchalisch geordneten Grundriss. Das zusammen, ergeben sich durchaus neue repräsentative Wohnzimmer als größter Raum in der Wohnung, die Küche als ‚Ar- Parameter: beitsraum der Hausfrau’ (eine authentische Beschreibung aus der Neufertschen – Grundrissstrukturen, in den sich die Grundrisslehre), das Schlafzimmer der determinierten Räume nur auf die Eltern mit den üblichen Abmessungen, Nutzung Bad/Dusche/WC und Küche beziehen. Alle anderen Nutzungen Doppelbett plus Bettumrandung. Das kleinste Zimmer war das Kinderzimmer, sind raumneutral auszurichten – Besonnung, Belichtung, Proportionen oftmals kaum größer als 8 Quadratmeter. Aus ökonomischen Gründen schrumpfte und Größe – und somit nicht deterdie Wohnungsgröße auf standardisierte miniert. 75 Quadratmeter für die Dreizimmer- – Wohnungseinheiten müssen komwohnung und 85 Quadratmeter für die binierbar und koppelungsfähig sein. Wohnungen mit vier Zimmern. Zudem Dies erreicht man mit einem Mehrwurden die Geschosshöhen auf 2,50 Meaufwand von Erschließungen und Haustechnik-Installationen. ter lichte Höhe beschnitten. Auffallend, ja geradezu grotesk ist die – Doppelte Kodierung von interaktiven Tatsache, dass sich diese strukturelle EiRäumen. Erschließungs- und Koppgenart im Wohnungsbau so festgefahren lungsräume können vielseitig genutzt hat, dass innerhalb der letzten 50 Jahre werden. Sie dienen zum Aufenthalt kaum nennenswerte Veränderungen pasund zur Kommunikation, und sie siert sind. Sicher wurde die sogenannte fördern die Interaktion der GemeinBarrierefreiheit eingeführt, und in den schaft. D&A HERBST 2011 AUSGABE 16 – Die abgeschlossene Wohnung ist nur Gebäudeerweiterungen mit integrierten noch bedingt zeitgemäß. Gemein- Energiegärten, in Zwischenräumen oder schaft und Intimität haben in der heu- Dachausbauten energiesammelnde und -speichernde Maßnahmen so integriert tigen Zeit andere Ausdrucksformen. werden, dass diese das alte Gebäude Zukünftige Gebäudestrukturen werden mitversorgen. Idealerweise wird man die eine andere Art der Vernetzung leisten Ergänzungen soweit aufrüsten können, müssen. Dabei muss man mit den al- dass diese wie ein System kommunizierender Gefäße – das eine bedingt das anten Vorstellungen vom umbaufähigen dere interdependent – funktionieren, um Grundriss aufräumen. Denn zu dieser damit Neu und Alt zu einer typologischen Art Vernetzung gehören immer mehr oder weniger aufwendige handwerkli- und energetischen Einheit werden lassen. che Maßnahmen. Nein, diese Umbaumaßnahme muss sich mit dem Öffnen Den Bedarf wecken, statt ihn einer bislang verschlossenen Tür begnü- zu verkennen gen, im Zweifelsfall mit dem Aushängen Mit den Vorstellungen einseitig ausgedes Türblatts. Vergleichsweise ist die richteter Bauträger und Wohnungsbaukommunikative Art der Vernetzung mit gesellschaften werden solche Strukturen nicht zu realisieren sein. Hier wird man WLAN anzuführen, die schon längst zu den praktizierten Strukturen der Netz- ähnlich wie Steve Jobs, der Querdenker werkgesellschaft gehört und den Alltag von Apple, denken müssen, der einmal vollkommen umgekrempelt hat. Über- philosophierte: „Es ist nicht die Aufträgt man dieses System, so entstehen gabe der Verbraucher, zu wissen, was jene differenzierten Ebenen und Vo- sie wollen.“ Damit lässt sich der ewige lumen, die innerhalb einer baulichen Hinweis auf die Bedingungen des WohStruktur Bereiche mit den verschiedens- nungsmarktes allemal entkräften. Beten Intimitäts- und Öffentlichkeitsab- dürfnisse zu wecken ist schon lange das stufungen schaffen, die von den Nutzern Geschäftsgeheimnis von Apple, aber mal variabel, mal fest benutzt werden auch der Autoindustrie. Denn sie hat es können. Die abgeschlossene Wohnung geschafft, Bedürfnisse erst zu produzieist in diesem System genauso möglich ren, um sie dann auch mit eigenen Waren wie ein offenes Geflecht von Interakti- zu befriedigen. Wenn man bedenkt, dass onsvolumina und Rückzugsräumen mit das Automobil längst andere Funktionen unterschiedlichen Größen und Zonie- erfüllt als die der Mobilität, dass es zum rungsdichten. Die Größe der Gebäude- einzigen und wirkungsvollsten Transstruktur kann so ausgelegt werden, dass port versteckter Emotionen – Prestige, sich wechselnde Gruppengrößen mit Macht, Unabhängigkeit, Modernität – taugt, dann kann man den Gedanken mal unterschiedlichen Bedürfnissen und Ausrichtungen – gesellschaftlich, kultu- zu Ende spinnen. Nomadentum ist nichts rell, soziologisch – generieren können. anderes als die Sehnsucht nach Freiheit Diese Systeme sind kybernetisch kodiert, und Ungebundensein. Die Wirklichkeit das heißt, sie sind interdependent mit ist aber die fest gefügte Sesshaftigkeit. allem vernetzt und verwoben und bedin- Im Wechselspiel von Nomadensehngen sich gegenseitig. sucht und heimatlicher Verwurzelung Das Gleiche gilt auch für die Sanie- bedient die Autoindustrie das Freie und die Wohnungswirtschaft das Unfreie. rungsstrategie der Altbauten. Zum Glück, kann man sagen, sind die Bauten Heimat hat nie etwas mit Bewegung der Gründerzeit bislang wegen ihrer be- und Aufbruch zu tun; vielmehr mit dem sonderen Fassadengestaltung von Wär- Gegenteil: Zuflucht und Rückzug. Offenmedämmverbundsystemen verschont sichtlich braucht man diesen Gegensatz. geblieben. Die zuvor beschriebenen Para- Aber müssen deshalb Wohnungstypen in meter lassen sich auch auf Erweiterungen einer Beharrlichkeit erstarren, die jedwede andere Entwicklung als unrealistische und Ergänzungen von Altbaugrundrissen anwenden. So könnten in Anbauten und Utopie brandmarkt? Dies mag sich alles irgendwie theoretisch anhören. Modelle dieser Art sind jedoch in den Niederlanden zu besichtigen, auch im Schweizer Wohnungsbau, wenn auch noch nicht mit der letzten Konsequenz des zuvor Beschriebenen. Planerisch sind diese Überlegungen schon längere Zeit in Bearbeitung – nicht zuletzt am Fachgebiet Entwerfen und Wohnungsbau der TU Darmstadt, an dem der Autor dieses Artikels als Professor tätig ist. Die Herausforderung an Architekten und Ingenieure wird deshalb die Entwicklung komplex hybrider und kybernetischer Systeme sein. Der Einwand, dass das alles kaum zu bezahlen sei, ist nicht überzeugend. Nimmt man die Bemühungen um Nachhaltigkeit ernst und gleicht diese mit den heutigen Standards für Wohnungsbauten ab, bietet die Wirklichkeit ein ziemlich trostloses Bild. Abgesehen von einem sehr fernen und besonders schlanken Silberstreif am Horizont gibt es keine Visionen, kein Neuland, kaum Neugierde und null Experimente. Jedenfalls in Deutschland. Günter Pfeifer, Jahrgang 1943, beschäftigt sich seit 1972 mit Wohnungsbau, zurzeit mit seinem Büro Pfeifer Kuhn Architekten in Freiburg. Seit 1992 lehrt er an der Technischen Universität Darmstadt, zuerst im Fachgebiet Entwerfen und Hochbaukonstruktion, seit 2001 im Fachgebiet Entwerfen und Wohnungsbau. Den Schwerpunkt seiner Lehre bilden neue Gebäudetypologien auf der Grundlage kybernetischer Strukturen, die von autochthonen Gebäudetypen abgeleitet sind. Günter Pfeifer ist Autor zahlreicher Fachbücher und Träger zahlreicher nationaler und internationaler Architekturauszeichnungen. 2009 erhielt er den Gottfried Semper Preis. 121 122 D&A AUTUMN 2011 ISSUE 16 123 DAYLIGHT & ARCHITECTURE ARCHITEKTURMAGAZIN VON VELUX HERBST 2011 AUSGABE 16 Herausgeber Michael K. Rasmussen Website www.velux.de/Architektur VELUX Redaktionsteam Per Arnold Andersen Christine Bjørnager Lone Feifer Torben Thyregod E-Mail [email protected] Redakteur, Institut für Internationale ArchitekturDokumentation Jakob Schoof Übersetzungen Sprachendienst Dr. Herrlinger Norma Kessler Bildredaktion Torben Eskerod Art Direction & Layout Stockholm Design Lab ® Per Carlsson Lisa Fleck Björn Kusoffsky www.stockholmdesignlab.se ISSN 1901-0982 Dieses Werk und seine Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Wiedergabe, auch auszugsweise, bedarf der Zustimmung der VELUX Gruppe. Die Beiträge in Daylight & Architecture geben die Meinung der Autoren wider. Sie entsprechen nicht notwendigerweise den Ansichten der VELUX Gruppe. © 2011 VELUX Gruppe. ® VELUX und das VELUX Logo sind eingetragene Warenzeichen mit Lizenz der VELUX Gruppe. Umschlagbild Lars Arrhenius Innenseite Umschlag Torben Eskerod 124 D&A HERBST 2011 AUSGABE 16