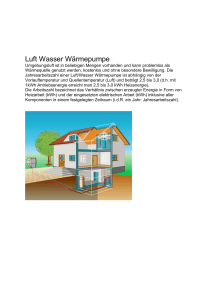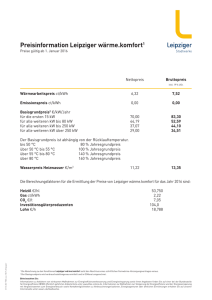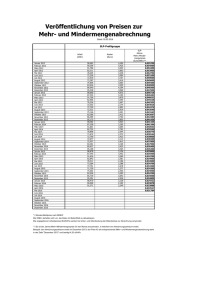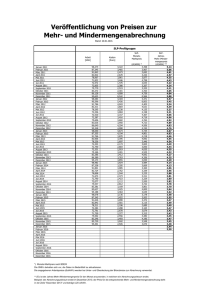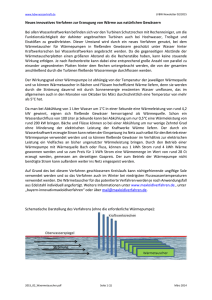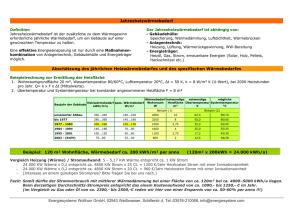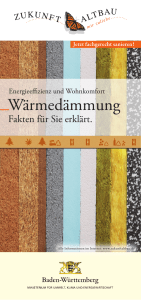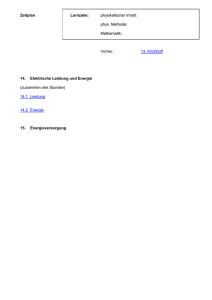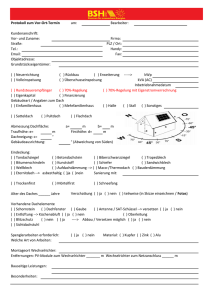Praxisinformation Energieeinsparung. Eine
Werbung

Bauforschung Praxisinformation Energieeinsparung Eine Handlungsanweisung für Architekten F 1912 Fraunhofer IRB Verlag F 1912 Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um die Kopie des Abschlußberichtes einer vom Bundesmini sterium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen -BMVBW- geförderten Forschungsarbeit. Die in dieser Forschungsarbeit enthaltenen Darstellungen und Empfehlungen geben die fachlichen Auffassungen der Verfasser wieder. Diese werden hier unverändert wiedergegeben, sie geben nicht unbedingt die Meinung des Zuwendungsgebers oder des Herausgebers wieder. Dieser Forschungsbericht wurde mit modernsten Hochleistungskopierern auf Einzelanfrage hergestellt. Die Originalmanuskripte wurden reprotechnisch, jedoch nicht inhaltlich überarbeitet. Die Druckqualität hängt von der reprotechnischen Eignung des Originalmanuskriptes ab, das uns vom Autor bzw. von der Forschungsstelle zur Verfügung gestellt wurde. © by Fraunhofer IRB Verlag Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Verlages. Fraunhofer IRB Verlag Fraunhofer-Informationszentrum Raum und Bau Postfach 80 04 69 70504 Stuttgart Nobelstraße 12 70569 Stuttgart Telefon (07 11) 9 70 - 25 00 Telefax (07 11) 9 70 - 25 08 E-Mail [email protected] www.baufachinformation.de Schriftenr2ihe "Bau- und Wohnforschung" des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 04. Praxisinformation Energieeinsparung 19B2 Eine Handlungsanweisung für Architekten I• -S2 0000 - 2 1 o =^ > 4 2 Im Auftrag des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Bonn, bearbeitet von der Bundesarchitektenkammer, Bonn INHALTSUIIRGI[[INSPARUNC VERZEICHNIS Eine Veröffentlichung der Bundesarchitektenkammer, gefördert durch den Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 0 Einleitung Stadtplanung 1 1.1 Planungskriterien 1.2 Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen 2 Grundlagen 2.1 Bauphysik 2.2 Energiebilanz von Gebäuden Seite 11 17 21 29 3 Gebäudeplanung 3.1 Gesamtkonzeption 39 3.2 Hausmodernisierung und Instandsetzung 49 Baukonstruktionen 4 4.1 Wände 4.2 Dächer und Decken 4 . 3 Erdberührende Rauteile 4.4 Fenster 5 Technischer Ausbau 5.1 Technische Gesamtkonzepte 5.2 Wärmequellen 5.3 Steuerung und Regelung 5.4 Heizkostenmessung, -verteilung und -abrechnung 59 67 77 81 89 99 113 117 5 Eine Veröffentlichung der Bundesarchitektenkammer, gefördert durch den Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1. Grundlagen des Forschungsantrages Es ist bekannt, daß zum Thema Energieeinsparung eine sehr große Zahl von Forschungsergebnissen vorliegt, die von den verschiedensten Institutionen gefördert wurden. Die Ergebnisse dieser Arbeiten, die nur z. T. veröffentlicht wurden, erreichen die Baupraxis nur unzureichend. Darüber hinaus wird bei wissenschaftlichen Forschungen auf den direkten Praxisbezug nicht immer geachtet. Bauschäden durch falsch vorgenommene Dämmmaßnahmen bzw. unwirtschaftliche Maßnahmen bestätigen dies. Daher wurde es notwendig, Bauforschungsergebnisse in praxisgerechte Arbeitshilfen für Architekten umzusetzen. Für die praktische Anwendung sollten kurzgefaßte „Handlungsanweisungen" entwickelt werden, die den Anwender in die Lage versetzen, ohne umfangreiche und zeitraubende Studien die Forschungsergebnisse zu übernehmen. Die Erkenntnisse sollten praxisorientiert formuliert, gegliedert und leicht verständlich dargestellt werden. Die Folge der Veröffentlichung der „Handlungsanweisungen" soll eine bessere Information der Architekten über die Möglichkeiten und Maßnahmen zur Energieeinsparung, und damit auch Verhinderung falscher Anwendung und Minimierung von Bauschäden sein. Die vorhandenen Mittel zur Energieeinsparung sollen gleichzeitig wirtschaftlicher verwendet werden. Insbesondere war bei dem Forschungsvorhaben der Zusammenhang Energieeinsparung und Architektur mit dem Bezug zum Städtebau, Neubau und der Altbaumodernisierung zu berücksichtigen. Dazu waren bereits vorliegende Ergebnisse eines Bundesarchitektenkammer-Expertengespräches zur energiebewußten Architektur zu berücksichtigen. Die Bearbeitung sollte sich am Planungs- und Bauablauf orientieren und vor allem in der Konstruktion und technischen Ausrüstung praktische Möglichkeiten aufzeigen. Dies sollte zu einem qualifizierten und systematischen Vorgehen zur Energieeinsparung führen. Die Einschaltung von Praktikern war beabsichtigt, um deren Erfahrungen in die geplanten Informationen einzubeziehen. 2. Energieeinsparung beim Bauen Die Energieeinsparung ist kein neues Problem. Sie ist aber verstärkt in den Vordergrund gerückt, nachdem die Energiekosten einen ständig steigenden Faktor bei den Nutzungskosten darstellten. Die Energiesituation zwang zu neuen Überlegungen und führte zu den Regelungen der Wärmeschutzverordnung, die gegenüber vergangenen Jahren erheblich höhere Anforderungen an den Wärmeschutz stellt. Eine weitere Erhöhung der Anforderungen ab 1. Januar 1984 ist gefordert. Aus fachlicher Sicht ist ein erhöhter Wärmeschutz unproblematisch, verlangt jedoch bauphysikalische Kenntnisse, die über die Lehrinhalte an den Architekturausbildungsstätten hinausgehen. Dieser Tatsache mußte in dem Umsetzungsvorhaben dadurch Rechnung getragen werden, daß bauphysikalische Grundlagen aufgearbeitet und vereinfachte Berechnungsmethoden dargestellt werden. Die volkswirtschaftliche Notwendigkeit der Energieeinsparung bei Neubauten ist unumstritten. Besondere Berücksichtigung in bezug auf die erhöhten Nutzungskosten muß die Energieeinsparung aber auch in der Altbausubstanz finden. Dazu war es notwendig, Abhängigkeiten darzustellen, die sich aus Veränderungen der baulichen und technischen Substanz ergeben. Die Wirtschaftlichkeit dieser Veränderungen mußte untermauert werden. Zusätzlich tragen neue Ideen für eine energiebewußte Architektur zur Energieeinsparung bei. Besonders die passive Nutzung der Sonnenenergie steht dabei im Vordergrund. 3. Informationsdienstleistung für Architekten Die Bundesarchitektenkammer übernahm gemeinsam mit der Architektenkammer Niedersachsen das Vorhaben zur Förderung der Energieeinsparung als Informationsdienstleistung für Architekten. Die Information über die Ergebnisse erfolgte durch das Deutsche Architektenblatt. Zielgruppe sind damit mehr als 60000 Architekten in der Bundesrepublik, die mit den Informationspaketen Anregungen und Anwendungshilfen erhalten. Es ist beabsichtigt, die Ergebnisse zu aktualisieren und zusätzlich realisierte Vorhaben mit architektonischen, baukonstruktiven und technischen Auswirkungen darzustellen. Dies ist eine Aufgabe, die die Kammern in Zukunft übernehmen wollen. 4. Umsetzung von Forschungsergebnissen Nach einer Sammlung bereits fertiggestellter und noch in Arbeit befindlicher Forschungsvorhaben wurde eine Gruppenbildung vorgenommen, die aufgrund einer vorgegebenen Systematik eine Einordnung der Ergebnisse zuließ. Die systematische Aufarbeitung der Gruppen erbrachte Zusammenhänge und Verbindungen der einzelnen Maßnahmen, die der Erarbeitung der Informationspakete zugrundegelegt wurden. Zudem flossen die Erfahrungen der verschiedenen von der Bundesarchitektenkammer beauftragten Forscher ein. Für die Koordinierung der Arbeiten wurde ein besonderer Auftrag vergeben. Dadurch wurde sichergestellt, daß die einzelnen Zusammenhänge berücksichtigt wurden. Es konnten in den wenigsten Fällen die Ergebnisse der Forschung direkt übernommen werden. Die in der Forschung dargestellten Probleme und Lösungen mußten vielfach noch aufbereitet werden. Wichtig war, daß der Architekt in die Lage versetzt wurde, aufgrund von Beispielen Entscheidungen zu treffen, die auch Zusammenhänge und Folgewirkungen einbeziehen. Aus dem Material mußten abgesicherte Erkenntnisse von theoretischen Überlegungen getrennt werden. Besonders im Bereich des Städtebaus wurde klar, daß Handlungsanweisungen oft nicht direkt, sondern nur indirekt über die Darstellung der Problematik gegeben werden können. 7 Die Reihenfolge der Bearbeitung der verschiedenen Informationspakete konnte auch nicht entsprechend der Gliederung eingehalten werden, sondern mußte so erfolgen, daß Voraussetzung und Folge zur Erkenntnis der Zusammenhänge berücksichtigt wurden. Die Systematik der Erfassung und Bearbeitung praxisrelevanter Aussagen der Forschungsergebnisse mußte, abgesehen von der Koordinierung, weitgehend den Erfahrungen der Forscher überlassen werden. So werden in der Regel auch nicht Forschungsergebnisse zitiert, sondern Einzelheiten und Zusammenhänge neu formuliert und interpretiert. Für das Vorhaben konnte den einzelnen Forschern also nicht durchgängig eine Methode an die Hand gegeben werden. Dies hätte die Themen sicher einseitig eingeschränkt und die Ergebnisse in ihrer Qualität nur von den vorgegebenen Forschungsergebnissen abhängig gemacht. Es war interessant zu erkennen, daß die beteiligten Personen und Institutionen Forschungsergebnisse in jedem Fall mit den eigenen Erfahrungen verglichen und die Zuordnung der Ergebnisse entsprechend eigenen Überlegungen vornahmen. So sind Informationspakete enlslanden, in denen die Zusammenfassung der Forschung in den wenigsten Fällen direkt abzulesen ist. Dies dürfte auch für die Zukunft einen Grundtatbestand der Umsetzung von Forschungsergebnissen bilden. Es kann am Ergebnis festgestellt werden, daß es nicht ausreicht, abgeschlossene Forschungsvorhaben zu erfassen und zu veröffentlichen, sondern Zusammenhänge und Abhängigkeiten der einzelnen Ergebnisse darzustellen und in einer planungsorientierten Systematik zu veröffentlichen. Einzelne Vorhaben können nur dann direkt der Praxis übergeben werden, wenn die fachliche Begleitung des Vorhabens praxisorientiert unter Hinzuziehung angrenzender Bereiche vorgenommen wird. Das wichtige Ziel der Praxisorientierung und der Praxisnähe der Ergebnisse orientiert sich stark am Forscher. Bei zukünftigen Vorhaben müssen wissenschaftliche und praxisbezogene Formulierungen getrennt und durch honorierte Begleitungen abgesichert werden. Forschung der Hochschulen und reiner Forschungsinstitutionen sollte stets durch Beteiligung von Praktikern ergänzt werden. Bauforschung muß sich grundsätzlich als praxisorientierte Forschung darstellen, da eine Rationalisierung des Planungs- und Bauprozesses bzw. die Optimierung realer Projekte im Vordergrund stehen. Die Akzeptanz der Ergebnisse wird zudem vielfach von der Anerkennung des Forschers abhängen. 5. Darstellung der Ergebnisse Für die Darstellung der Ergebnisse wurde die Form in sich abgeschlossener Informationspakete gewählt, die die isolierte Betrachtung dieser Bereiche ermöglichen. Dadurch ergeben sich zwar gewisse Überschneidungen, die aber nur bei der durchgehenden Lektüre erkennbar werden. Die Darstellung mußte übersichtlich in Schrift und Bild erfolgen, da durch die rein schriftliche Darstellung die Akzeptanz der Ergebnisse als nicht gegeben angesehen werden muß. Die bildlichen Darstellungen geben Anlaß, die Beschreibung zu lesen. Durch das Herausheben von Schlagwörtern bzw. Stichwörtern soll die Übersichtlichkeit erhöht werden. Dies gilt ebenfalls für die Verwendung jeweils nur einer Farbe, die die Abbildungen leichter überschaubar macht. Die teilweise kleinformatige Dar8 stellung wurde bewußt in Kauf genommen, um den Umfang der einzelnen Informationspakete zu mindern und damit schon mit der Seitenzahl die Lesbarkeit zu verbessern. So beschränken sich die Abbildungen in vielen Fällen auf eine symbolhafte Darstellung, die zum Studium der Einzelheiten anregen soll. Ein durchgängiges Layout als Grundvoraussetzung für das leichte Verständnis der Abbildungen wurde angestrebt, denn ein ständig neues Einschauen bzw. Lesen in verschiedenartige Darstellungsformen könnte Ablehnung hervorrufen. 6. Umsetzung durch verschiedene Fachleute Vorgesehen war die Bearbeitung der einzelnen Informationspakete nur durch Architekten, da damit die Praxisnähe einfacher gegeben schien. Es hat sich erwiesen, daß dies in einigen Fällen nicht möglich war, zumal dann, wenn zu erwarten war, daß bei einer Forschungsinstitution oder einer Hochschule die umfassenderen Erfahrungen vorliegen. In diesen Fällen mußte die Praxisnähe durch den Koordinator bzw. durch die begleitende Arbeitsgruppe der Architekten gesichert werden. Das galt in diesen Fällen auch für die Auswahl der einzelnen angesprochenen Themen. Es war festzustellen, daß in der Praxis mit Lösungen gearbeitet wird, die ohne Zusammenhang mit theoretischen Überlegungen nicht zu optimalen Ergebnissen führen, so daß schon deshalb die Kombination von Theorie und Praxis dem Ergebnis förderlich ist. 7. Ergebnisse der Informationspakete Die Arbeit wurde in folgenden Schritten durchgeführt: o Erarbeitung eines Systems zur Einordnung energiesparender Maßnahmen in den Planungsund Bauprozeß, O Sichtung bereits vorhandener Forschungsergebnisse im Hinblick auf den Maßnahmenkatalog, O Auswahl der umzusetzenden Ergebnisse. Die einzelnen Forscher wurden um folgende Arbeiten gebeten: o Aufstellung einer Prioritätenliste für die Umsetzung, O Auswahl der wesentlichen Erkenntnisse aus den Forschungsergebnissen, O Formulierung von Informationspaketen als Handlungsanweisungen mit zeichnerischer Darstellung und Erläuterungen zu wichtigen Einzelheiten der Ergebnisse. Entsprechend diesen Überlegungen wurde die gesamte Information folgendermaßen gegliedert: 1. Stadtplanung 1.1 Planungskriterien 1.2 Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen 2. Grundlagen 2.1 Bauphysik 2.2 Energiebilanz von Gebäuden 3, Gebäudeplanung 3.1 Gesamtkonzeption 3.2 Hausmodernisierung und Instandsetzung Baukonstruktionen 4. 4.1 Wände 4.2 Dächer und Decken 4.3 Erdberührende Bauteile 4.4 Fenster Technischer Ausbau 5. 5.1 Technische Gesamtkonzepte 5.2 Wärmequellen 5.3 Steuerung und Regelung 5.4 Heizkostenmessung, -verteilung und -abrechnung B. Ergebnisse 8.1 Stadtplanung Den zur Stadtplanung vorliegenden Forschungsergebnissen ist gemein, daß sie sich mit einem Thema auseinandersetzen, dem in früherer Zeit kaum Beachtung geschenkt wurde. Die Festlegung der Siedlungsstruktur war Aufgabe der Architekten und Städteplaner, Wärmeversorgungsplanung war Aufgabe der Versorgungsunternehmen. Die Einführung einer Vielzahl neuartiger und weiterentwickelter Versorgungsalternativen hat dazu geführt, daß die gegenseitigen Wechselwirkungen dieser Planungsbereiche immer deutlicher wurden. Man erkannte, daß Planungsentscheidungen des einen Bereiches positive oder negative Rahmenbedingungen für den anderen Bereich scha ffen und damit zur Energieeinsparung oder Energieverschwendung beitragen. Nach Durchsicht der vorliegenden Forschungsergebnisse schien es erforderlich, den Planer in die Lage zu versetzen, Entscheidungen vor dem Hintergrund der versorgungstechnischen Folgewirkungen zu fällen. So wurde im wesentlichen versucht, dem Planer einen Einblick in die relativ fremdartige Problematik zu geben, um überhaupt Entscheidungen zu ermöglichen. Die Information geht daher nicht in die Tiefe, sondern in die Breite. Das Ergebnis ist hauptsächlich an einer systematischen Darstellung der Einflüsse orientiert. Es wurde Wert gelegt auf die Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten, die sowohl die. Gesamtsituation wie auch das einzelne Gebäude beeinflussen. Die Optimierung der Wärmeversorgungssysteme und der Wärmeverteilung wurden in bezug auf diese lokalen Einflüsse angesprochen. Sicher ist, daß die Energieversorgungsplanung in Zukunft einen erheblichen Einfluß auf die Stadtplanung haben wird und eine optimale Energieeinsparung über die Wärmeversorgung und die passive Sonnenenergienutzung beim einzelnen Gebäude schon durch die Stadtplanung gesteuert wird. 8.2 Grundlagen Es erwies sich als unumgänglich, bauphysikalische Grundlagen und vereinfachte Berechnungsverfahren darzustellen, die die Überprüfung der Maßnahmenvorschläge sowie die Kontrolle vorgegebener Werte ermöglichen. Nach der Erfahrung wurde diese Materie an den Hochschulen bisher vernachlässigt. Eine verbesserte Information ist erst in den letzten Jahren zu beobachten. Es muß aber davon ausgegangen werden, daß die Grundlagen jedem Architekten in der vorliegenden vereinfachten Form zugänglich gemacht werden müssen. Das gilt insbesondere für die Begriffsdefinitionen sowie die bauphysikalischen Einheiten. Auf die Definition der „Behaglichkeit", d. h. den spürbaren Einfluß für den Menschen, wurde besonderer Wert gelegt. Die vorliegende Grundlagenforschung sowie entsprechende spezielle Veröffentlichungen wurden berücksichtigt. Die Energiebilanz von Gebäuden als Gesamtbetrachtung ist der besonderen Aufmerksamkeit empfohlen. Die ganzheitliche Betrachtungsweise kommt dem Architekten bei seiner Planung sehr entgegen, da energiebewußte Architektur nur über diese Gesamtbetrachtung möglich ist. Dieses Kapitel hat erhebliche Diskussionen verursacht, da die Theorie hier überwiegt, muß aber dennoch als unverzichtbar bezeichnet werden. Die Komplexität des Themas drückt sich im Umfang des Informationspaketes aus. Die Vorstellung, daß die rechnerische Erfassung der Energiebilanz nur von Fachleuten vorgenommen werden kann, wird durch vereinfachte Rechenmethoden widerlegt, obwohl nicht angenommen wird, daß sich die Berechnungsmethoden bei allen Planern schnell einführen lassen. Im Grunde ist dies für den Planer eine Betrachtung, die sich erst in der Zukunft stärker durchsetzen wird. 8.3 Gebäudeplanung Bevor Einzelheiten der Energieeinsparung besprochen werden, wurde auch in diesem Kapitel eine ganzheitliche Betrachtung der Architektur im Zusammenhang mit der Technik vorgenommen. Diese ganzheitliche Betrachtung macht es möglich, die folgenden Detailüberlegungen einzuordnen und ihren Erfolg auf das Gesamtkonzept zu bewerten. Die Überlegungen entsprechen dem Konzept „Energiebewußte Architektur", das die Bundesarchitektenkammer in einem Expertengespräch aufgegriffen hat. Bedauerlicherweise liegen reale Ergebnisse gezielter Planung noch nicht vor, so daß bei der Darstellung der Gesamtkonzepte mit bewerteten Entwürfen und Beispielen aus dem Ausland gearbeitet werden mußte. Speziell in diesem Bereich ist eine Weiterarbeit und eine Vorstellung nicht nur bewerteter Entwürfe sondern gemessener Ergebnisse notwendig. Der Bezug auf die Hausmodernisierung läßt sich einfacher und praxisbezogener darstellen. Hier liegen wesentlich umfangreichere Erfahrungen vor, die eine stärker praxisbezogene Darstellung zulassen. Auch die Forschung ist in diesen Bereich besonders mit der Darstellung von Einzellösungen stärker eingedrungen. Dies wohl vor allen Dingen deshalb, weil vielfach auch nur Einzellösungen gefragt sind, obwohl der Zusammenhang nicht aus dem Auge verloren werden darf. Dies wird insbesondere deutlich bei den Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, die für das Gesamtkonzept dargestellt wurden. 8.4 Baukonstruktionen Die Darstellung der Baukonstruktionen sprechen den Architekten besonders an, da die Ergebnisse leicht nachvollziehbar sind. Im Informationspaket „Wände" werden zunächst die beim Konzipieren konstruktionsrelevanten Einflußgrößen behandelt. Neben dem winterlichen Wärmeschutz werden Aspekte des sommerlichen Wärmeschutzes, Schallschutzes, Brandschutzes, Witterungsschutzes und Feuchtigkeitsschutzes einbezogen. Dem Witterungsschutz und dem Feuchtigkeitsschutz, Einflußgrößen, die bei den Außenwänden besonders wichtig sind, werden besondere Beachtung geschenkt, da feuchte Baustoffe Wärme sehr viel besser leiten als trockene und damit über durchfeuchtete Bauteile erheblich mehr Wärme verloren gehen kann. Das Informationspaket „Dächer und Decken" unterscheidet grundsätzlich die Systeme und geht vor allem auf das bauphysikalische Verhalten bei der Anbringung von Dämmstoffschichten, Dampfsperren und Unterspannbahnen ein. Besonders auf die Belüftung wird zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und zur Erhaltung der Funktions9 fähigkeit hingewiesen. Decken gegen nicht beheizte Dachgeschosse bzw. Kellerräume sind Bestandteile der wärmeübertragenden Umfassungsfläche und müssen entsprechend gegen Wärmeverluste geschützt werden. An Wohnungstrenndecken sind zwar derzeit nur relativ geringe Anforderungen hinsichtlich des Wärmeschutzes gestellt, doch wird man künftig einer erhöhten Wärmedämmung dieser Bauteile mehr Augenmerk schenken müssen, um Wärmeverluste innerhalb des Gebäudes und von Geschoß zu Geschoß zu verhindern. Keller werden immer häufiger zu Zwecken genutzt, die die Wohnfunktionen ergänzen. Aus diesem Grunde muß zur Abdichtung gegen Wasser auch noch eine Wärmedämmung kommen. Besonderes Interesse hinsichtlich Feuchtigkeitsschutz und Wärmedämmung muß auch der Bauwerkssohle geschenkt werden. Die Wärmeverluste der Bauwerkssohle, soweit das Gebäude unterkellert ist, sind gleichmäßig verteilt und relativ gering. Es muß aber bei nicht unterkellerten Gebäuden der Randzone erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden. „Fenster" stellen einen besonders wichtigen Teil des Gebäudes dar, da durch sie nicht nur Energie verloren geht, sondern auch zusätzliche Wärme durch Ausnutzung der Sonnenenergie gewonnen werden kann. So wurde in dem Informationspaket einleitend auch auf das energetische Verhalten des Fensters besonders eingegangen. Auf zusätzliche Schutzvorrichtungen zur Verbesserung der Energiebilanz wie Jalousien und Klappläden zum 10 temporären Wärmeschutz sowie Sonnenschutzvorrichtungen wird hingewiesen. Die Lüftungswärmeverluste und ihre Reduzierung stellen ein wichtiges Thema dar, über das z. Z. noch mehrere Forschungsprojekte durchgeführt werden. 8.5 Technischer Ausbau Der technische Ausbau hat sich im letzten Jahrzehnt sprunghaft in Richtung sparsame Energieverwendung entwickelt. Solarenergie und Wärmerückgewinnung waren die Schlagworte. Regelung und Steuerung trugen zur Minimierung des Energieeinsatzes bzw. -verbrauchs bei. Der technische Ausbau kann in seinen Einzelheiten isoliert betrachtet werden, bedarf aber eines Überblicks, um die Zusammenhänge und Abhängigkeiten aufzuzeigen. So wurde im ersten Informationspaket versucht, Technik im Zusammenhang im Gebäude und mit der baulichen Substanz darzustellen. Die Aussagen der weiteren Informationspakete sind im Gesamtsystem insoweit untergeordnet, ais sie isolie rte Darstellungen bringen, die punktuell Anwendung finden können. Der Architekt wird in Zukunft nicht nur das Bauen planen, sondern auch zur Energieverwendung und -einsparung beraten. Diese Beratung kann selbstverständlich im technischen Bereich nicht ohne den Fachingenieur vorgenommen werden, jedoch muß der Architekt die Zusammenhänge im Gebäude oder Bauwerk erkennen können und die Anpassung der Bereiche koordinieren. Eine Veröffentlichung der Bundesarrivairktgrrxarrtmer. gefördert durch den Bundesminister fur Raumordnurnn.. Bauwesen tind Stmkttetwu Verfasser; Prof V. Nikotic, Dr.-Jng. A. Dütz Ziele einer rationellen Energieverwendung im Städtebau In der Regel handelt es sich bei städtebaulichen Maßnahmen zur Energieeinsparung um eine Unterstützung energetisch günstiger Gebäudekonzeptionen. Sonnenenergienutzung ist beim Einzelgebäude nur dann möglich, wenn durch die städtebaulichen Maßnahmen „Gebäudeanordnung" und Gebäudeorientierung" Verschattungsfreiheit und Südorientierung gewährleistet ist. Die Standortwahl ist allerdings bei den meisten Bauaufgaben nicht mehr frei. Falls jedoch noch eine Entscheidungsfreiheit hinsichtlich der Standortplanung besteht, sollten vorerst folgende klimatologischen und topographischen Gesichtspunkte beachtet werden: Ö Mikroklima, 0 Luftqualität (belasteter Standort?) Städtebauliche Maßnahmen können nicht losgelöst von den Entscheidungen über die bauliche Realisierung der Einzelgebäude (und umgekehrt) erfolgen. Ebenso ist eine Abstimmung der städtebaulichen Planung mit der Entscheidung für die günstigste Wärmeversorgungsart erforderlich. Städtebau bzw. Stadtplanung haben zahlreiche Ziele zu verfolgen. Der rationelle Umgang mit Energie ist dabei nur ein Kriterium unter vielen. Die Stadt- und Gebäudepianung wird immer von den engsten Restriktionen bestimmt. Energie ist seit 1973 zu einer immer enger (weil teurer) werdenden Rahmenbedingung der Planer geworden und es ist zu erwarten, daß sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren konsequent fortsetzt. Zusammenarbeit mit einem Landschaftspla- Bei der Standortwahl sollten stets—evtl. in ner-- die örtlichen Gegebenheiten analysiert werden, um die energetisch günstigere Entscheidung treffen zu können. Sollten mehrere Alternativstandorte den anderen städtebaulichen Kriterien in gleicher Weise genügen, sollte die Entscheidung zugunsten des Standortes fallen, der die besten Voraussetzungen bietet, energiesparend zu bauen. Berücksichtigung mikroklimatischer Verhältnisse Der Standort neuer Gebäude sollte so gewählt werden, daß er sich den natürlichen topographischen Verhältnissera anpaßt. Gerade die in einer Gegend typischen historischen Bauformen zeigen in der Regel eine gute Anpassung der Architektur an die speziellen klimatischen Bedingungen des StandStädtebauliche Maßnahmen orts. Stadtplanung spielt sich immer in einer beDie Topographie beeinflußt stark die mikrostimmten örtlichen Situation ab. Sie hat daklimatischen Bedingungen, insbesondere die her in erster Linie die lokalen Gegebenheiten örtlichen Temperaturverhältnisse und den zu berücksichtigen und weniger allgemeinen Windeinfluß. Zielvorstellungen zu folgen. Tiefere Bodentemperaturen sind in Talsenkungen und Hügellagen möglich. [1] Standortwahl Wichtig ist die Einholung von entsprechenVerschiedene Standorte weisen o ft eine unden Informationen (Daten- und Kartenmaterial über bestimmte Klimadaten) bei den örtliterschiedliche Eignung zur Berücksichtigung energiesparender städtebaulicher Maß- chen Verwaltungen vor der Planungsentscheidung. nahmen auf. Ebenes Gelände Mulde, Kaltluftsee Klimatologische und topographische Gesichtspunkte Kuppenlage Südhanglage • Wärmeverluste und Temperaturunterschiede in Abhängigkeit von der Lage im Gelände, Temperaturangaben nach Geiger u. a. Zusammenarbeit mit einem Landschaftsplaner Örtliche Temperaturverhältnisse und Windeinfluß Beracksichtigung der standortspezifischen Luftqualität Stark verunreinigte Außenluft kann dazu führen, daß eine natürliche Fensterlüftung nicht mehr genügend Frischluft gewährleisten kann und daher eine energetisch ungünstige Klimatisierung des Gebäudes vorgenommen werden muß. Verbesserung innerstädtischer Luftqualität ist durch eine Reduzierung des Straßenverkehrs und des Hausbrandes möglich. Die Emissionsbelastung durch Hausbrand kann durch zentrale Wärmeversorgungssysteme erheblich reduziert werden (wie schwedische Untersuchungen zeigen).[3], Schwedischer Immissions-Grenzwert I Västeras I i 100 000 E ^ Linkoping 80 000 E Uppsala 90 000 E I Niedrige Bepflanzung kann die notwendige Mindestdurchlüftung beeinträchtigen und im Tal Kaltluftseen hervorrufen I Norrköping100 000 E Trollhä ttan 35 000 E j I I Uddevalla 35 000 E 1 to 8 ^ Eskilstuna 65 000 E aE g • Surdsva!i . 60 000E 50 75 100 125 150 i^ 175 200 uglm3 SO2 Immission 2 Geeignete Hanglagen Vermeidung von Nordhangbebauungen! Frosttaschen hinter zu dichter Bepflanzung Gefahr von Kaltluftstellen durch zu dichte Bepflanzung in Hanglagen Windgeschwindigkeiten Einfluß auf die Windintensität haben: Gegebenenfalls müssen bei ungünstigen Luftströmungen, die den Wärmegewinn durch Südorientierung erheblich verringern können, geeignete Windschutzmaßnahmen getroffen werden. Dabei ist zu beachten, daß die Bepflanzung nicht zu dicht gewählt wird, um Kaltluftstellen zu vermeiden. O Geographische Lage des Ortes (Küstennähe oder Landesinnere), O Lage der Siedlung in der Landschaft (exponierte oder geschützte Lage), O Höhe über Geländeoberkante, O Gebäudeform, O Stellung des Gebäudes zur Hauptwindrichtung. Abb. 5 zeigt die Auswirkung auf den Wärmeverlust eines Gebäudes nach seiner Lage im Gelände.[1] Wärmeverluste durch Wind können je nach Lage und Ausführung des Gebäudes bis zu 50% des Heizenergiebedarfs ausmachen 5 12 Kanteneffekt Tordurchfahrt Windintensität bei der Umsträmung eines Gebäudes 6 Abb. 6 zei t verschiedeneVVindintenoitöten Abb. 7 zeigt schließlich verschiedene strödiedurohUnnatrömungenvonGeb&udenauf- mungsgünstige und strömungsungünstige tretankönnen.|nden sogenannten Totwas- Gebaudetypen imiVNnd serräu men hinter Gebäuden, an Gebäudeekken ken oder in Tordurchfahrten können bis zu dreifache Strömungsgeschwindigkeiten auftretax. Gebäudeformen im Windkanal Die Abbildung i deutlich die verschieden großen Totwasserräume Verschiedene Windintensitätendurch Umstromung von Gebäuden Strömungsgünstige und strömungsungünstige Gebäudetypen 7 13 Gebäude- und Straßenanordnung 1 STADTRANU NG Planungskriterien Ausrichtung von Straßen- und Gebäudeachsen nach Himmelsrichtung Abschirmung der Gebäude von der Hauptwindrichtung Orientierung Gebäude- und Straßenachsen sind nur bei Neubaugebieten in der Regel noch frei zu wählen. Aus energetischen Gründen sollte dabei darauf geachtet werden, daß 0 die Straßen- und Gebäudeachsen zu den Himmelsrichtungen ausgerichtet werden, die in den unten näher dargestellten Gesetzmäßigkeiten der Sonnengeometrie eine optimale Besonnung der Gebäude ermöglichen. 0 die Gebäude von den Hauptwindrichtungen abgeschirmt werden und trotzdem eine ausreichende Durchlüftung der Siedlungen gewährleistet ist. Abb. 8 zeigt ein Beispiel aus USA für einen Windschutz von Einfamilienhaussiedlungen durch eine massierte Bebauung in der Hauptwindrichtung [4]. Gleiche Effekte können evtl. noch besser- durch geeignete Landschaftsgestaltung erreicht werden. Reduktion der windbedingten issions- und Tra swärmeLü vertuste igh Hauptwindrichtung im Winter Bei komplexen städtebaulichen Situationen empfiehlt sich eine Überprüfung der Beschattungssituation durch Schattenplan oder fotografische Aufnahmen. Wind 100 .— o, 80 ß U(,) 60 r ....Laubholz im Winter I I LEE o Nadelholz m c 40 LUV ^ c ^� 20 u_ � 8 52 0 10 0 5 5 10 15 20 25 30 Vielfaches der Schutzstreifenhöhe Wirkung eines Windschutzstreifens in Abhängigkeit und seiner Durchlässigkeit 10 Reduzierung von Windgeschwindigkeiten Die historischen Methoden des Windschutzes sollten zur Reduktion der windbedingten Transmissions- und Lüftungswärmeverluste auch bei Neubausiedlungen beherzigt werden: O O O O besondere bauliche Formen, Windschutzpflanzungen, Geländemodellierung, Lage von Ortschaften bzw. Gebäuden in besonders windgeschützten Lagen O Laubholz bietet einen besseren, weil länger wirkenden Windschutz als Nadelholz ° p0°OOOOOOOO°O°^ 000°o M^o^ 000ö Ö° ° 000 ^ o(o°a°o°°) °00 0 0 o- -- ---^ 8 Verschattungsfreiheit Vermeidung von Verschattung Verschattungsfreiheit ist die Voraussetzung zur Ausnutzung des Sonnenwärmegewinns bei geeigneten Gebäudekonzepten. Sie muß also in enger Abstimmung mit der Gebäudeplanung erfolgen. Planungsgrundlage bilden in diesem Fall Diagramme zur Sonnenbahn und Neigungswinkeln der Sonneneinstrahlung. Entfernung = 2x Höhe 1 2x Höhe /N i J/^ OAVA0V Bis zu 40% weniger Verlust Bis zu 95% wehiger Verlust A B. 90 Siedlungsstruktur Gebäudeabstände Um Verschattungen zu vermeiden, sollte die Siedlungsstruktur so angeordnet werden, daß die höheren Gebäude im Norden liegen. Die Festlegung der Gebäudeabstände richtet sich nach den niedrigsten Sonneneinfallswinkeln. OM JJ! 50% mehr Verlust als bei A C a = Sonnenstand 21. XII. (Höhenwinkel) H = Gebäudehöhe D 40° A = Abstand Firstlinie zur Nachbarfassade { A Ermittlung von mind. Gebäudeabständen nach Sonnenstand r refl., iv 60% mehr Verlust als bei A 4 I /, 25% weniger Verlust als bei A 11 zur Sicherung verschattungsfreier Fassaden Die Gebäudeabstände können durch geeignete Wahl der Dachform zusätzlich reduziert werden (z. B. Pultdachformen). 14 Beispiele für die große Beeinflussung der Lüftungswärmeverluste durch Windschutzbepflanzungen und durch die Stellung der Gebäude gegen die Hauptwindrichtung. Verwendung geeigneter Gebäudetypen Reduzierung von Transmissionsflächen durch Auswahl und Gruppierung von günstigen Gebäudetypen. Einfluß der Gebäudeform und Gebäudegliederung auf das AN-Verhältnis bei konstanten Volumen (A=Area= Fläche, V=Volumen 13500 m3) 12 I 1 i I w -F — 175 W-m 2K — KG= 0.45 W'm2K KG= 0,80 W m 2K — 0,80 KD 0,50 KG 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 9:1 7:1 5:1 3 Gebäudeproportionen Höhe: Länge 90% 110% 1:2 14 6 1.8 80% , nr 4or Relativer Transmissionswärmeverlust in Abhängigkeit von der Baukörperproportion für Gebäude mit quadratischem Grundriß und gleichem Volumen 13 Energetisch günstige Siedlungskonzepte mit kompakten Gebäudegruppierungen können sowoh I architektonisch als auch wirtschaftlich günstige Lösungen darstellen. [5] [8] Eine verdichtete Bebauung ist auch in städtischen Randzonen einer freistehenden Einfamilienhausbebauung aus energetischen Gründen vorzuziehen. [6] Siedlungstyp A/V Nutzwärmehöchstleistung (bei gleicher baulicher Ausführung) Freistehende Einfamilienhäuser 0,6-1,0 160-180 W/m2 Dichte Einfamilienhausbebauung 0,55-0,65 100-130 W/m2 Reihenhausbebauung 0,5-0,6 100-110 W/m 214 Fled{aZkerrJr6g vorn TIralf3IV1E ssioCFsfPäclhen Berücksichtigung der Aspekte der Wärmeversorgung bei der Bewertung städtebaulicher Maßnahmen Architekten und Stadtplaner werden und sollen sich nicht im einzelnen mit den Problemen der örtlichen Wärmeversorgung auseinandersetzen. Die neueren Forschungsarbeiten zeigen jedoch sehr deutlich, daß zur Erarbeitung einer energetisch günstigen Gesamtlösung das Zusammenspiel von städtebaulichen, baulichen, anlagentechnischen und versorgungstechnischen Maßnahmen erforderlich ist. [6] Daraus folgt: O Der beteiligte Architekt oder Stadtplaner hat bei Neuplanungen und Sanierungsmaßnahmen die Erfordernisse und Möglichkeiten der Wärmeversorgun .gzu berücksichtigen und seine Planung so durchzuführen, daß die Verwendung energetisch günstiger Systeme begünstigt wird. O Die Stadtplanung darf kein unverrückbares Datum für die Energieversorgung sein und umgekehrt. Dies erfordert eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit der Beteiligten. • Architekt und Stadtplaner müssen aktiv darauf hinwirken, daß wie beim Einzelgebäude auch bei der Stadtplanung eine koordinierte Planung baulicher und versorgungtechnischer Maßnahmen durchgeführt wird. Reduzierung von Transportenergie Etwa 21% des Energiebedarfs bzw. 30% des' Ölbedarfs der Bundesrepublik Deutschland entfielen 1978 auf den Verbrauchssektor Transport und Verkehr. Davon werden ca. 43% für Transporte zwischen Wohn- und Arbeitsstätte, zum Einkaufen und zu sonstigen Dienstleistungseinrichtungen (Verwaltungen usw.) benötigt. In Großstädten werden sogar 45% für den Berufsverkehr und 15% für den Einkaufsverkehr aufgebracht. Dieser relativ hohe Energiebedarf ist in erheblichem Umfang auf die stark gestiegene Mobilität der Bevölkerung und den Trend zu monofunktionalen Stadtquartieren (Wohnen, Arbeitstätten, Einkaufszentren) zurückzuführen. Diese Transportenergie (und zeit) kann durch eine verstärkte Mischung verschiedener Nutzungen im städtischen Raum reduziert werden. 15 der isidgficlh^ der WanmeversExgauarg Vensend ung ener/{ g„^ n strger System ^ Ycoorrdrumiierte G=Naceuun-tag braraltiidleerr Eunad vers orguragstechn iMeneir rrrerr Reduzierung eon ^^ 1fs‚ging lierschiedenw' ^idat^anrrgern ^ städ^r woven Room ‚II' STADMANUNG Planungskriterien Solche Mischungen lassen sich nicht überall realisieren. Zahlreiche Nutzungen müssen aus anderen wichtigen Gründen (z. B. Umweltbelastung) in eigenen Arealen angesiedelt sein. Die Verringerung von Transportenergie stellt ein wichtiges Argument dar,-in der Stadtplanung verstärkt auf stärker gemischte Siedlungsstrukturen hinzuarbeiten. ungen Quellen: [1]Energiebewußte Architektur, Wanderausstellung der Bundesarchitektenkammer, konzipiert von Dipl.-Ing. B. Faskel, Berlin (Abb. 1, 5). [2]Bauen und Energiesparen, ein Handbuch zur rationellen Energieverwendung im Hochbau für Bauherren, Architekten, Ingenieure, Battelle-Institut, Frankfurt, Hrsg. der Bundesminister für Forschung und Technologie, Verlag TÜV Rheinland, Köln, 1979 (Abb. 7). [3]Dipl.-Ing. H. P. Winckens, Fernwärme—Energiesparer und Umweltschützer in Der Landkreis, Zeitschrift für kommunale Selbstverwaltung, Heft 8-9/79, A 14-15 (Abb. 2). [4]Energy Conservation — Design Resource Handbook, The Royal Architectural Institute of Canada, Ottawa, 1979 (Abb. 4, 6, 8, 11). [5] Rationelle Energieverwendung im Planungsgebiet Erlangen-West, Battelle-Institut, Frankfurt, Hrsg. Bundesminister für Forschung und Technologie, TÜV-Verlag Köln, 1980 (Abb. 9, 10). [6]Ueli Roth u. a., Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen, Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministers für Bauwesen, Raumordnung und Städtebau, MFPRS 1977.10, Bonn 1980 (Abb. 14). [7]Planungshilfe Energiesparendes Bauen, Staatliche Bauverwaltung Nordrhein-Westfaleh, 1979, Düsseldorf (Abb. 12). [8] Fraunhoferstudie, Energietechnik GmbH, 1977, Studie i. A. des Bundesministers für Forschung und Technologie (Abb. 13). [9]Möglichkeiten und Grenzen der Fernwärmeversorgung im Wohnungsbau, R. Jank und A. Dütz, Forschungsprojekt im Auftrag des Innenministers NRW, 1979-80, bisher unveröffentlicht. Monostruktur und Mischstruktur 15 Ausblick — Tendenzen Energiebewußte Stadtplanung als Voraussetzung zur sinnvollen Verwirklichung esparender Geen und Wärmebä ver rgungskonzepte Aufgabe der Architekten und Stadtplaner- ---- Die Betrachtung städtebaulicher Maßnahmen zur Energieeinsparung ist noch relativ jung. Erst in letzter Zeit wurden hier erste wichtige quantitative Ergebnisse vorgelegt, die nachweisen, daß hier ein großes Einsparungspotential liegt, für welches in der Regel nur planerische Anstrengungen, aber keine finanziellen Mittel investiert werden müssen. Eine energiebewußte Stadtplanung bildet die Voraussetzung zur sinnvollen Verwirklichung energiesparender Gebäude und Wär meversorrungskonzepte. Sie erfordert ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten von Stadtplanern, Architekten, Versorgungsplanern und Haustechnikern. Dabei ist es die Aufgabe des Architekten und Stadtplaners, Plänungsamter,Auftraggeber und Fachleute der Versorgungswirtschaft von einer ener^lebewußten Stadtplanung zu überzeugen. Er ist daher einerseits verpflichtet, sich selbst über den Stand der Technik zu informieren und seine Erkenntnisse, verbunden mit dem Spezialwissen der Fachingenieure, zur Erarbeitung von guten Lösungen nutzbringend anzuwenden. Eine energiebewußte Stadtplanung ist Teil eines optimierten örtlichen Versorgungskonzepts, sie bildet die Basis für eine auch in Zukunft wirtschaftliche Form der Wärmeversorgung. Die Bedeutung einer energiebewußten Stadtplanung wird bei der zunehmenden Energieverknappung weiter an Bedeutung gewinnen. Die Beispiele haben gezeigt, daß diese Tatsache den Städtebau dabei nicht ärmer macht, sondern vielmehr bewußt Erfahrungen früherer Baumeister nutzbar macht— Erfahrungen aus einer Zeit, in der Energie auch noch einen wertvollen Rohstoff darstellte. 16 Ausgewählte Literatur zum Thema Ueli Roth u. a., Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen, Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministers für Bauwesen, Raumordnung und Städtebau, MFPRS 1977.10, Bonn 1980. Rationelle Energieverwendung im Planungsgebiet Erlangen-West, Battelle-Institut, Frankfurt, Hrsg. Bundesminister für Forschung und Technologie, TÜV-Verlag Köln, 1980. Rationelle Energieverwendung im Rahmen der Stadterneuerung unter besonderer Berücksichtigung des StBauFG und ModEnG, Büro Sieverts und Volwahsen, Bonn, Ueli Roth, Zürich, Forschungsprojekt im Auftrag des Bundesministers für Bauwesen, Raumordnung und Städtebau, MFPRS 78.16, 1. unveröffentlichter Zwischenbericht, 1979. Rationelle Energieverwendung im Rahmen von neuen Siedlungsvorhaben, Battelle-Institut, Frankfurt, Studie im Auftrag des Bundesministers für Bauwesen, Raumordnung und Städtebau, MFPRS, 1978.17, 1. unveröffentlichter Zwischenbericht, 1979. Möglichkeiten und Grenzen der Fernwärmeversorgung im Wohnungsbau, Dr. R. Jank, Dr. A. Dütz, Forschungsprojekt im Auftrag des Innenministers NRW, 1979, bisher unveröffentlichter Schlußbericht. Energy Conservation — Design Resource Handbook, The Royal Architectural Institute of Canada, Ottawa, 1979. Kurzbiographie der Autoren: Prof. Dipl.-Ing. Vladimir Nikolic, Architekt BDA— Gesamthochschule Kassel — Konstruktives Entwerfen — freischaffender Architekt — Schwer Wohnungsbau — energiesparendes Bauen — For-punkt schung — rationelle Energieverwendung. Dr.-Ing.. Armand Dütz, Koordinator des interministeriellen Arbeitsprogramms „örtliche und regionale Energieversorgungskonzepte" an der Kernforschungsanlage Jülich, Projektleitung Nichtnukleare Energieforschung (PLE). Verfasser: Redaktionelle Bearbeitung und Layout Dipl.-Ing. Bernd Faskel, Koordination Vladimir Nikolic PIIAXISINIONMA11 ENERGICEINS Eine Veröffentüehung der Bundesarchitektenkammer gefordert durch den Bundesminister für riaumordnong Bauwesen und Städteba, Wärmeversorgung als Teil der kommunalen Entwicklungsplanung Architekten und Stadtplaner werden und sollen sich nicht im Detail mit den Problemen der örtlichen und regionalen Wärmeversorgung auseinandersetzen. Die neueren Forschungsarbeiten zeigen jedoch sehr deutlich, daß zur Erarbeitung einer energetisch günstigen Gesamtlösung das Zusammenspiel von städtebaulichen, baulichen, anlagentechnischen und versorgungstechnischen Maßnahmen erforderlich ist. den NU ' ' ° MIMING Vertasser Dr,-Ing. Armand Dirt; Einzelgebäude Baukonzeption ^ 4 Juli 19e1 Wärmeversorgungssysteme Unter Wärmeversorgungssystemen werden im wesentlichen alle technologischen Möglichkeiten verstanden, ein Gebäude bzw. ein Bebauungsgebiet mit Wärme zu versorgen. Wichtigstes Unterscheidungskriterium aus technologischer Sicht ist dabei der Grad der Leitungsgebundenheit und die Lage der Energie-(Wärme-)Erzeugung zum Verbraucher. Energetisch günstige Gesamtiösungen Grad der Leitungsgebundenheit Energieträger und technische Anlagen bei zentralem Produzenten beim Verbraucher Städtebauliche Konzeption ^'^^em en }Holz Biogas ._)I-Sammelheizung onnenkollektoren Wärmerückgewinnung Energie- (Wärme) Versorgungssystem Heizungssystem Närmepumpe ; Elektrische Speicherheizung Gas-Sammelheizung ':;!feiße Fernw. ab Blockheizkraftw., gasbetr. ,1. Kalte Fernwärme ^^; Heiße Fernw. ab Heizkraftw. od. therm. Kraftw. Grad der Leitungsgebundenheit Schwergewicht der technischen Anlagen und Einsatzo rt der Energieträger bezüglich Verbraucher/P ro duzenten ntegrierte Wärmeversorgungskonzepte Abhängigkeiten zwischen den Einflußgrößen örtlicher Wärmeversorgung „Technisch ist unter einem integrierten örtlichen Wärmeversorgungskonzept der optimale Einsatz der verfügbaren Primär- und SeDaraus folgt: kundärenergieträger unter Verwendung der Der beteiligte Architekt oder Stadtplaner hat geeigneten Umwandlungs-, Auskopplungs-, bei Neuplanung und Sanierungsmaßnahmen Transport-, Verteilungs- und Anwendungsdie Erfordernisse und Möglichkeiten der techniken zur Deckung des vorhandenen Wärmeversorgung zu berücksichtigen und Nutzenergiebedarfs zu verstehen. Wahl und seine Planung so durchzuführen, daß die Mischung der örtlich und regional geeigneVerwendung energetisch günstiger Systeme ten Versorgungstechnologien müssen dabei begünstigt wird. insbesondere folgenden Kriterien genügen" (Quelle 8): Die Stadtplanung darf kein unverrückbares Datum für die Energieversorgung sein und O Übergeordnete politische Rahmenbedinumgekehrt. Dies erfordert eine intensive intergungen wie Ölsubstitution und rationelle disziplinäre Zusammenarbeit der Beteiligten. Energieverwendung, O Abwägung betriebswirtschaftlicher und Architekt und Stadtplaner müssen aktiv darvolkswirtschaftlicher Interessen, auf hinwirken, daß wie beim Einzelgebäude O Planungsorganisation, auch bei der Stadtplanung eine koordinierte Planung baulicher und versorgungstechniO Akzeptanz der Wärmeversorgungssysteme scher Maßnahmen durchgeführt wird. in der Bevölkerung, O Ökologische Gesichtspunkte (wie z. B. Schadstoffbelastu ng), Begriffsdefinitionen O Rahmenbedingungen aus der vorhandeSiedlungsstruktur nen und geplanten Siedlungsstruktur (inkl. Aspekten der Stadterneuerung), Unter Siedlungsstruktur wird in diesem Zu0 Vorhandene und geplante Heizungsstruksammenhang die Summe der baulichen und tur, städtebaulichen Erscheinungs- und AuspräO Verfügbarkeit und Einsetzbarkeit bestimmgungsformen gesehen, wie z. B. Gebäudetyter Versorgungssysteme, pen, Gebäudeausrichtung, Gebäudealter, O Berücksichtigung der Einsparungsmögbaulicher Zustand, Zuordnung der Gebäude, lichkeiten durch Bauleitplanung und Bebauungsdichte, Gebäudenutzung, Art und Hochbauplanung. Zustand der Heizungssysteme usw. 17 integriertes ortiiches Wärmeversorgungskrtnzept Knterien fur Wärmeversorgungskonzepte _.. Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Wechselwirkungen zwes,:nerr Siedlungsstrryktu^^ unC WatnueversorgungssyslemPm SiiedlungiryQen Raum- und Siedlungsstruktur Wärmeversorgungssysteme Obwohl eine Wärmeversorgungsplanung sich immer an den konkreten gegebenen Planungsrandbedingungen des Untersuchungsraums orientieren muß, kann eine Typologie bestimmter Siedlungsmerkmale die Zuordnung von geeigneten Wärmeversorgungssystemen erleichtern. Die von Roth eingeführte Einteilung in neun Siedlungstypen hat sich für die weitere Betrachtung bisher als relativ günstig erwiesen. Wärmeversorgungssysteme kann man nach folgenden Gesichtspunkten unterteilen: 000 0000 0 0 Ein- u. Mehrfarn , haussiiedlung niedriger Dichte uie nI1 PtrI.' I fJJJ C7 9 w L P.n .......d Zeilenbebauung mittlerer. Dichte 11 i.• s.. n.iiUU n.", 9 Citybebauung ..., • • . c nnn r6r ^ Dorf kernedluangEinfam.- tt^ tNReihen-^ 6 haussi t J haussiedlung (^, hoher Dichte CC CI P 8 ab Mitte 19. Jahrhundert Pl.,. Zeilenbebauung hoher Dichte und Hochhäuser INC^^^./MIA• Blockbebauung 0 !i[m^t'11'1n ##w - If11 Hlt1I' 7A ,y M ittelalterl i che .Altstadt A Si., Industrie- und La,ergebäude -. 3 Die neun Siedlungstypen nach Roth alaalr-r*,tser Al,. w Neben diesen Siedlungstypen lassen sich folgende Raumtypen unterscheiden: RT 1 Kernstädte von Stadtregionen, RT 2 Außenzonen von Stadtregionen, RT 3 Mittelstädte von Stadtregionen, RT 4 Ländliche Gebiete. Die Gesamtsumme der Wohngebäude und die beheizten Nutzflächen verteilen sich nach statistischen Erhebungen wie folgt auf die Siedlungstypen. 40% ' ^ Legende: RT 4 RT 3 RT 2 RT 1 30% 30 Für den Planer sind neben den übergeordneten energetischen, ökonomischen und ökologischen Kriterien insbesondere die Leitungsgebundenheit eines Wärmeversorgungssystems und die Lage der Wärmeerzeugung für die Planungsentscheidung von ,Bedeutung. 2a ^'': s?'?f'tE@;•' _':^ . .. 1. Verwendeter Primärenergieträger (z. B. Kohle, Heizöl EL, Erdgas, Uran) 2. Energiewirtschaftliche Beurteilung (z. B. Verhältnis von eingesetzter Primärenergiemenge zu erhaltener Nutzerenergie) 3. Lage der Energie- (Wärme-) Erzeugung (innerhalb oder außerhalb des Bebauungsgebiets) 4. Nutzung von Wäremquellen außerhalb des Bebauungsgebiets (z. B. bei industrieller und Kraftwerksabwärmenutzung) 5. Nutzung von Wärmequellen innerhalb des Bebauungsgebiets (z. B. Grundwasser, Luft, Abwärme aus mittleren bzw. kleineren Industriebetrieben) 6. Leistungsgebundenheit des Versorgungssystems 7. Flächenbedarf für Erzeugungs- und Verteilungsanlagen B. Auswirkungen auf das Unterverteilungssystem (z. B. bei einem zentralen Verteilungssystem innerhalb des Bebauungsgebiets, wie es bei einem Blockheizkraftwerk erforderlich ist) 9. Auswirkungen auf das vorhandene oder geplante Heizungssystem 10. Ökologische Auswirkungen (z. B. Schadstoffbelastung) 11. Durchsetzbarkeit der Wärmeversorgungssysteme bei der Bevölkerung 12. Wirtschaftlichkeit der Wärmeversorgung (kurz-, mittel- und langfristig) 13. Ölsubstitution 14. Organisatorische Rahmenbedingungen am Standort (Energieversorgungsunternehmen, Sparten- oder Verbundunternehmen Lieferbedingungen für verschiedene Versorgungsarten, Rahmenbed ingungen aus der Bauleitplanung) 15. Subventionsmöglichkeiten (z. B. über Zukunftsinvestitionsprogramm) II . ki Eirazeiraumneizung i$011iU ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Gesamtsumme der Wohngebäude nach Raumund Siedlungstypen Beheizte Nutzfläche nach Raumtypen (RT) und Siedlungstypen (ST) Etagenheizung Haussammelheizung 4 Für diese Siedlungstypen existieren Kenngrößen für städtebaulich und energetisch relevante Kriterien wie z. B. Geschoßflächenzahl, beheizte Nutzflächen, A/V-Verhältnis, Fensterflächenanteil, mittlere Wärmedurch lal3widerstände, Nutzwärmehöchstleistung, Anschlußwert nach DIN 4701, welche die Grundlage für die Zuordnung bestimmter Wärmeversorgungssysteme zu diesen Siedlungstypen bilden. 18 Sammelheizung ' r mehrere - i aue :• Blockh•': i z i.;ng ''^, r einen c,.^;,:_^:,•.,,.,; m ,.. stem -.tuc^]wser- Men ... -,......,.,:ngsgetre4, Ci,n- .. •:^yur,y^S:ctem 9dt9i' er^&b cycs Beispiele Kohleofen, Ölofen, Gasofen, elektr. Nachtspeicherheizung Gasetagenheizung Koksheizung, Ölheizung, Kachelofenheizung, elektr. Wärmepumpe (evtl. in Verbindung mit Solarkollektoren), Warmluftheizung dieselmotorbetriebene Wärmepumpen Blockheizkraftwerk, gasmotorbetriebene Wärmepumpe, Blockheizkraftwerk in Kombination mit dezentralen Elektrowärmepumpen Fernwärme (aus Kraftwärmekopplung-Kraftwerke oder industrielle Prozesse) „Kalte" Fernwärme (Abwärmenutzung auf niedrigem Temperaturniveau und zusätzliche Erwärmung im Gebäude durch Wärmepumpen) Wärmeversorgungssysteme nach der Lage der Wärmeerzeugung zum Verbraucher 5 Roth betrachtet in seiner Arbeit (Quelle 1) folgende Versorgungssysteme und ihre Eignung für die verschiedenen Siedlungsstrukturen: LEITUNGSGEBUNDENHEIT WÄRMEVERSORGUNGSSYSTEM: Strom Gas Wärmeverteilung Niedrig Temp. Hohe Temp, Mehrere Leitungsanschl. Fernwärme Holzschnitzelfeuerunq Blockheizkraftwerk n. Gaswärmepumpe Gaskessel INC Betriebswirtschaftliches Optimierungsverfahren Eine Optimierung kann nur dann durchgeführt werden, wenn man sich an einer Zielgröße orientiert. Roth hat in seiner Arbeit (Quelle 1) den betriebswirtschaftlichen Ansatz gewählt. Für die verschiedenen Siedlungstypen und Wärmeversorgungssysteme lassen sich kostengünstige Kombinationen ermitteln. Der Vergleich von verschiedenen Wärmeversorgungssystemen für einen bestimmten Siedlungstyp anhand der unterschiedlichen Gesamtkostenkurven führt zur Auswahl günstiger und ungünstiger Kombinationen. Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen Kostengunstige Kombinationen für Siedlungstypen und Wä r meversorgungstiysteme Ölkessel Elektrospeicher Wärmepumpe `. Solarspeicher mit Ölkessel Biogasanlage Leitungsgebundenheit von verschiedenen Wärmeversorgungssystemen Die sogenannten alternativen Wärmeversorgungsarten wie z. B. Biogas und Holzschnitzelfeuerung erfordern bei der Beschaffung des Brennstoffes oft bedeutende organisatorische Anstrengungen. Nutzt man das gesamte Potential aus, ergibt sich ein Gesamtwärmepotenial von ca. 4,7 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten. Dies entspricht in etwa dem zu erwartenden Einsparpotential durch einen verstärkten Fernwärmeausbau (Quelle 3). Diese Versorgungssysteme können also nicht von vornherein abqualifiziert werden. Sie werden allerdings in erster Linie im ländlichen Raum wirtschaftlich und organisatorisch realisierbar sein. Der Planer wird im wesentlichen mit den in Abb. 5 dargestellten Systemen konfrontiert werden. Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen Die Wechselwirkung zwischen baulichen, städtebaulichen, heizungstechnischen und versorgungstechnischen Maßnahmen besteht im wesentlichen darin, daß durch bauliche und städtebauliche Maßnahmen einerseits der Energiebedarf der Gebäude erheblich beeinflußt (reduziert) werden kann, andererseits die verschiedenen Versorgungssysteme bestimmte anlagentechnische und verteilungstechnische Wirkungsgrade aufweisen, welche von der Höhe und der zeitlichen und räumlichen Verteilung des Wärmebedarfs abhängen. In der Regel wird durch bauliche und städtebauliche Maßnahmen der rationellen Energieverwendung der Wärmebedarf einer Siedlung reduziert, während die meisten Versorgungssysteme bei größeren Leistungsbereichen bzw. bei größeren Wärmebedarfsdichten Kostendegressionen aufweisen. Die Aufgabe eines integrierten Wärmeversorgungskonzepts besteht nun darin, unter Abwägung der übrigen Rahmenbedingungen die begrenzten Mittel für Energieeinsparungsmaßnahmen und für die Wärmebereitstellung so einzusetzen, daß energetisch als auch ökonomisch ein Optimum erreicht wird. ` Y iIMnly/1nM/10 Hohe Gesamtkostenminima NICHT KONKURRENZFÄHIG Tiefe Gesamtkostenminima KONKURRENZFÄHIG Vergleich der Gesamtkosten- kurve verschiedener Versorgungssysteme — Gesamtkosten •••• Wärmeschutzkosten — Heizkosten 7 Alternati ve Maccneve?sc rgungsarten Aufbauend auf diesen Systemen kann bestimmt werden, wie sich zusätzliche Rahmenbedingungen (z. B. zusätzliche Investitionen für Energieeinsparungsmaßnahmen) auf das Gesamtergebnis auswirken. Grundsätzlich kann man festhalten, daß etwas höhere Aufwendungen für Energieeinsparungsmaßnahmen einen überproportionalen Energiegewinn erbringen. Gesamtkosten mimalkosten. Erhöhung der Mittel für :.; Einsparun g . gegenüber kostenminimaler Lösung Zusätzlicher Einsparungseffekt gegenüber kostengünstiger Lösung 8 Für die verschiedenen Siedlungstypen ergibt sich folgende Eignung der wichtigsten Wärmeversorgungssysteme. Siedlungstyp ST 1 ST 21 ST 3 ST 4 ST 5 ST6 ST7 ST 8 ST 9 Geschoßflächenzahl (GFZ) Anschlußwerte nac 0,02 0,1- 0,2- 0,4- 0,8- .0,5- 1,0- 1,5- Q80,18 0,5 0,4 0,8 ^1,2 1,5 30 45 1,2 i 210- 130- 135- 145- 95 Fernwärme 1: ^ DIN 4701 (W/mz) Blockheizkraftw. ,,Kalte" Fernwärme Wärmepumpe 01-/Gasheizung 100- 50- 50- 90- 0 ^nn^Gn 21 - O!/13/91ERN !!r^••,,!!^!!^!^!!^ 0 0.... M 250 170 145 155 115 70 70 105 _ El ^ 0 gut I OW MED MI1 geeignet 10 bedingt geeignet MIP schlecht geeignet Einsatzmöglichkeiten verschiedener Versorgungs Systeme in den neuen Siedlungstypen 9 19 Optimum von energetrSther und okOnomrSCher Wärmebere,t&teHung Restriktionen bei der Optimierung eines Versorgungssystems STADT Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen Die Wärmeversorgung eines Versorgungsgebiets kann nicht nur nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten optimiert werden. Zusätzliche Rahmenbedingungen schränken die Entscheidungsfreiheit;erheblich ein. Soziale Kosten/Nutzen 7 • Zusätzhche enbedtngungen Stadtstruktur Erneuerungsprozeä Planungsämter 7 Energetisch günstige Lösung Betriebswirtschaftl. günstige Lösung Energieversorgungssystem Veränderbarkeit ' Organisation Allgem. politische (volkswirtschaftl.) Prämissen Organisation VersorgungsUnternehmen Randbedingungen der Wärmeversorgung 10 VÖtksw n rischattticiie Aspekte Unter Berücksichtigung der übergeordneten volkswirtschaftlichen Aspekte Ölsubstitution, verstärkter Nutzung einheimischer Energiequellen, rationeller Energieverwendung und ökologischen Rahmenbedinungen sind Planungsmethoden und organisatorische Voraussetzungen zu entwickeln, die einen Ausgleich der verschiedenen Interessen und Zielvorstellungen ermöglichen (Quelle 8). 4 4 Raum möglicher Lösungen 1 Betriebswirtschaftlich-energetische Betrachtungsweise 2 Randbedingungen aus Stadtstruktur und Erneuerungsprozelt 3 Randbedingungen aus dem Energieversorgungssystem und dessen Veränderbarkeit 4 Randbedingungen aus der Organisationsform der Planungsämter und der Versorgungsunternehmen 5 Randbedingungen unter dem Gesichtspunkt der sozialen Kosten/Nutzen Einschränkung des Handlungsspielraums durch zusätzliche Randbedingungen 11 Zusammenfassung Energieversorgungsplanung muß in Zukunft verstärkt ein Teil der kommunalen Entwicklungsplanung werden.°Dabei ist die Berücksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen, das heißt zwischen baulichen, städtebaulichen, heizungstechnischen und versorgungstechnischen Maßnahmen erforderlich. Erste Ergebnisse von Forschungsarbeiten, die sich in erster Linie mit der energetischen und ökonomischen Optimierung der Energieversorgung befassen, liegen vor. In Zukunft müssen verstärkt die in der Praxis Analyse Juno Besedigurng on Restrrktkanen auftretenden Restriktionen (Interessenskonflikte und organisatorische Hemmnisse) analysiert und beseitigt werden. Wie bei der Gebäudeplanung ist die verstärkte Kooperation von Planern, Entscheidungsträgern und Fachingenieuren erforderlich. Auf städtebaulicher Ebene sind die Probleme und Zusammenhänge zwischen Maßnahmen und Entscheidungen auf verschiedenen Ebenen allerdings noch wesentlich vielschichtiger als bei Planung eines einzelnen Gebäudes. Um seine Aufgabe innerhalb dieser interdisziplinären Planung erfüllen zu können, muß der Planer sich Informationen über die Systemzusammenhänge, die auftretenden InSystemzusammenhänge teressenkonflikte und mögliche Lösungsmeund Lösungsmethoden thoden verschaffen. 20 Quellen: Wechselwirkungen zwischen der Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen, U. Roth, 1980, Schriftenreihe des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 06.044 (Abb. 2, 3, 4, 7). Möglichkeiten Grenzen der Fernwärmeversorgung im Wohnungsbau, R. Jank, A. Dütz, Studie im Auftrag des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen, 1980, wird in der Schriftenreihe des ILS veröffentlicht (Abb. 1, 9, 10). Energetisch relevante Kriterien für die Stadtplanung zur Berücksichtigung bei städtebaulichen Wettbewerben — dargestellt am Beispiel Berlin-Heiligensee, Studie im Auftrag des Senators für Wissenschaft und Forschung, Berlin, peb-Planung, Energie, Beratung, 1981, noch nicht veröffentlicht (Abb. 5). Rationelle Energieverwendung und Siedlungsplanung, Dokumentation eines Seminars des Instituts für Städtebau, Hagen, 28. bis 31. Mai 1979, A. Volwahsen, Die Berücksichtigung der rationellen Energieverwendung bei der Stadterneuerung an Beispielen (Abb. 11). Rationelle Energieverwendung und Siedlungsplanung, Dokumentation eines Seminars des Instituts für Städtebau, Hagen, 28. bis 31. Mai 1979, H. H. Krummlinde, Energieversorgungssysteme im Vergleich. Ausgewählte Literatur 1. Wechselwirkungen zwischen der Siedlungsstruktur und Wärmeversorgungssystemen, U. Roth, 1980, Schriftenreihe des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 06.044. 2. Rationelle Energieverwendung im Rahmen der kommunalen Entwicklungsplanung, Arbeitsgemeinschaft Sieverts+Volwahsen, Bonn-U. Roth, Zürich, 1980, Schriftenreihe des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 3. Möglichkeiten und Grenzen der Fernwärmeversorgung im Wohnungsbau, R. Jank, A. Dütz, Studie im Auftrag des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen, 1980, wird in der Schriftenreihe des ILS veröffentlicht. 4. Gesamtstudie Fernwärme, AGFW, Studie im Auftrag des Bundesministersfur Forschung und Technologie, 1978, Schriftenreihe des BMFT. 5. Rationelle Energieverwendung und Siedlungsplanung, Seminar des Instituts für Städtebau, Berlin und der Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Hagen 1979, Hrsg. 1980, Dokumentation der Vorträge. 6. Rationelle Energieverwendung im Planungsbereich Erlangen-West, Battelle-Institut, 1980, Studie im Auftrag des Bundesministers für Forschung und Technologie, TÜV-Verlag. 7. Energetisch relevante Kriterien für die Stadtplanung zur Berücksichtigung bei städtebaulichen Wettbewerben — dargestellt am Beispiel Berlin-Heiligensee, Studie im Auftrag des Senators für Wissenschaft und Forschung, Berlin, peb-Planung, Energie, Beratung, 1981, noch nicht veröffentlicht.. B. Arbeitsprogramm „Örtliche und regionale Energieversorgungskonzepte", gemeinsames Arbeitsprogramm von BMFT und BMBau, A. Dütz, W. Bahr, K.-G. Jacobs u. a., 1980, erhältlich bei der KFAJülich, Projektleitung Energieforschung, Koordinationsstelle ÖVK. 9. Rationelle Energieverwendung und Siedlungsplanung, Dokumentation eines Seminars des Instituts für Städtebau, Hagen, 28. bis 31. Mai 1979, A. Volwahsen, die Berücksichtigung der rationellen Energieverwendung bei der Stadterneuerung an Beispielen. 10. wie 9, aber H. H. Krummlinde, Energieversorgungssysteme im Vergleich. Kurzbiografie des Autors Dr.-Ing. Armand Dütz, Koordinator des interministeriellen Arbeitsprogramms „örtliche und regionale Energieversorgungskonzepte" an der Kernforschungsanlage Jülich, Projektleitung Nichtnukleare Energieforschung (PLE). Redaktionelle Bearbeitung und Layout Dipl.-Ing. Bernd Faskel, Koordination Vladimir Nikolic. 2 (NEIIGI[EINSPAHIING GRONDLA& Ein Forschungsvorhaben der 8undesarchitektenkammer durchgeführt pm Auftrage des Bundesministeriums für Städtebau. Raumordnung und Bauweser. Die Bauphysik umfaßt alle von der Physik beeinflußten Aufgabenbereiche innerhalb der Bautechnik, besonders die Gebiete Wärmesch utz, Feuchtigkeitsschutz, Schallschutz, Brandschutz. Den Grad der Erwärmung bezeichnet man als Temperatur. Die physikalische Größe für die Temperatur ist die sogenannte thermodynamische Temperatur T mit der Einheit Kelvin (K). Doch richten sich Temperaturangaben nach wie vor nach der Celsius-Skala, während Temperaturdifferenzen in K ausgedrückt werden. Als Formelzeichen wird der griechische Buchstabe tU verwendet, wodurch im Gegensatz zum gleichfalls gebräuchlichen Symbol t, mit dem die Größe „Zeit" beschrieben wird, Mißverständnisse ausgeschlossen werden. Da 0°C 273,15 K entsprechen und Celsiuswie auch Kelvin-Skala die gleiche Schrittweite aufweisen, besteht der folgende Zusammenhang: [°C] = T - 273,15 [K] erungswitt schutz Schallschutz Akustik Verfasser_ Dipl.-Ing. Witfrie d Zap Brandschutz 11 1- I Die Bauphysik und ihre Aufgabenbereiche Energiebewußtem Bauen, vor allem dem baulichen Wärmeschutz, kommt unter Beachtung klimatischer, physiologischer und wirtschaftOcher Aspekte zentrale Bedeutung zu. Die einzuhaltenden bauphysikalischen Anforderungen sin d in einer Reihe von Gesetzen, Verordnungen und DIN-Normen g_eregelt. In diesem Zusammenhang sind zu nennen: O Energieeinsparungsgesetz (EnEG) vom 22. Juli 1976, O Wärmeschutzverordnung vom 11. August 1977 und 24. Februar 1982, O Heizungsanlagen-Verordnung vom 24. Februar 1982, O Heizungsbetriebs-Verordnung vom 22. September 1978, O Verordnung über Heizkostenabrechnung vom 23. Februar 1981, O DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau" Ausgabe August 1981, O DIN 4701 (Entwurf) „Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs in Gebäuden" Ausgabe März 1978, O VDI 2067 (Entwurf) „Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen" Blatt 1 und 2, Ausgabe Dezember 1979. Um die Temperatur eines Stoffes zu erhöhen, muß ihm Wärme zugeführt werden; umgekehrt führt Wärmeentzug zur Temperaturabnahme. Wärmedämmen bedeutet demnach, den Wärmestrom, d. h. den Temperaturausgleich, vom Ort der höheren Temperatur zum Ort der niedrigeren Temperatur durch die Wahl von Baustoffen mit hinreichend großem Wärmedämmvermögen zu verlangsamen. Es ist jedoch nicht möglich, den Wärmestrom völlig zu unterbinden und damit, wie man häufig sagt, ein Bauteil gegen Wärmeverluste zu isolieren. Wärmetransport Unterschiedliche Energiezustände haben bekanntlich das Bestreben, sich auszugleichen. Das bedeutet, daß unter dem Einfluß eines Temperaturgefälles in jedem Falle ein irreversibler Wärmestrom in Richtung dieses Gefälles entsteht. Oberflächen- temperatur auf der Innenseite toi Oberflächen- temperatur auf der Außenseite U oa • Wärmestrom Wärme und Temperatur Wärme ist eine Energieform, die Größen Wärmemenge und Energie sind Größen gleicher Art. Die Maßeinheit für die Wärmemenge ist Wattsekunde (Ws) oder Joule (J) anstatt der bislang üblichen Kilokalorie (kcal). Es gilt: 1 Ws =1 J = 2,39 • 10 -4 kcal. Wärmeleitung in einer Außenwand 21 Bleiben die Oberflächentemperaturen konstant, erfolgt die Wärmeübertragung stationär, das heißt in gleichen Zeiträumen wird durch die gleiche Fläche die gleiche Wärmemenge transportiert. Verändern sich hingegen die Oberflächentemperaturen in Abhängigkeit von der Zeit, wie dies zum Beispiel bei Aufheiz- und Abkühlvorgängen der Fall ist, so verändert sich die Größe des Wärmestromes. Die Strömung ist dann instationär. Für Berechnungen des winterlichen Wärmeschutzes im Sinne einer wärmeschutztechnischen Bemessung der wärmeübertragenden Bauteile reicht die Annahme stationärer Verhältnisse aus. Wärme kann übertragen werden durch: O Wärmeleitung, O Konvektion, O Wärmestrahlung. Wärmeleitung In festen Körpern sowie in ruhenden Flüssigkeiten und Gasen wird die Wärme von einem Molekül zum anderen weitergegeben. Es gibt gute Wärmeleiter (Metalle) und schlechte (Holz). Konvektion Bewegte Gase und Flüssigkeiten, die entweder durch den Druckunterschied aufgrund von Temperaturdifferenzen oder äußere Kräfte umgewälzt werden, führen Wärme mit sich fort. Eine Wärmeleitung von Molekül zu Molekül ist dabei überlagert. Wärmestrahlung Unter Strahlung versteht man die Übertragung von Wärme ohne materiellen Wärmeträger in Form elektromagnetischer Wellen. Beim Auftreffen auf einen Körper wird diese Strahlungsenergie absorbiert, wobei sich schwarze und rauhe Körper stärker erwärmen als solche mit hellen und glatten Oberflächen. Wärmeleitfähigkeit A Es gibt Stoffe, die Wärme gut leiten, das heißt viel Wärme durchlassen (z. B. Metalle), und Stoffe mit einer geringeren Wärmeleitung, zum Beispiel Wärmedämmstoffe. Dies unterschiedliche Verhalten wird durch die Wärmeleitfähigkeit Abeschrieben. Kleine A-Werte stehen für schlechte Wärmeleitung und damit! gute Wärmedämmung. Die Wärmeleitfähigkeit ist die wesentliche Ausgangsgröße für wärmeschutztechnische Berechnungen. Sie ist eine stoffspezifische Größe und wird mit genormten Meßverfahren festgestellt. Dabei wird die Wärmemenge in Wattsekunden (Ws) ermittelt, die in einer Sekunde durch 1 m 2 einer 1 m dicken homogenen Stoffschicht senkrecht zu den Oberflächen hindurchfließt, wenn der Temperaturunterschied 1 Kelvin (K) beträgt. Damit lautet die Einheit: W/(m K). Je nach Zweckbestimmung sind in DIN-Normen und anderen Publikationen A-Werte 22 durch unterschiedliche Indizes gekennzeichnet. Für Berechnungen des Wärmeschutzes sind nur die Rechenwerte AR verbindlich. Sie sind für die gängigen Baustoffe in DIN 4108, Teil 4, enthalten. Abweichungen hiervon müssen im Bundesanzeiger* bekanntgemacht worden sein, bevor sie in der Praxis angewendet werden dürfen. Gleiches gilt für nicht genormte Baustoffe. I a. r _ _ ^. ^.^ iqo ^[1Tr""- =1 S lt A 5 =1 K 1m Wärmeleitfähigkeit ) 3 Beispiel: Kupfer A = 380 W /(m-K) Stahlbeton A = 2,10 W /(m•K) Nadelholz A = 0,14 W/(m-K) Wärmedämma = 0,04 W/(m-K) stoff Vakuum A = 0,00 W/(m•K) Wärmedurchlaßkoeffizient A Der A-Wert ist stets auf eine 1 m dicke Stoffschicht bezogen. Demnach ist die Wärmedurchlässigkeit ein und desselben Stoffes bei verschiedenen Dicken s unterschiedlich groß. Diese Abhängigkeit wird durch den Wärmedurchlaßkoeffizienten A = A/s gekennzeichnet. Die Einheit ist: W/(m2K). Wärmedurchfaßkoeffizient A Wärmedurchlaßwiderstand 1/A Der Kehrwert von A, also 1/A, beschreibt den Widerstand, den ein bestimmter Baustoff der Wärme beim Durchgang durch ein Bauteil entgegenbringt. Die Einheit beträgt: m2K/W. In DIN 4108, Teil 2, Tab. 1 und 2, sind für einzelne Bauteile von Gebäuden Mindestwerte des Wärmedurchlaßwiderstandes angegeben, die von der vorhandenen Konstruktion zumindest erreicht werden müssen. * Bezug durch Bundesanzeiger-Verlagsgesellschaft, Postfach 10 80 06, 5000 Köln 1 4 Je größer der vorhandene Wärmedurchlaßwiderstand ist, desto besser ist der Wärmeschutz und um so größer die Energieersparnis. Bei Stoffen mit kleinen A-Werten genügen bereits geringe Dicken, um die Mindestwerte zu erreichen; Stoffschichten mit größeren Werten müssen entsprechend dicker sein. memenge in Wattsekunden (Ws) in 1 Sekunde durch 1 m 2 eines Bauteils der Dicke s hindurchgeht, wenn der Temperaturunterschied zwischen den beiderseits angrenzenden Luftschichten 1 Kelvin (K) beträgt. Wärmeübergangskoeffizient a Für die Berechnung des gesamten Wärmedurchganges ist auch der Einfluß der an das Bauteil grenzenden Luftschichten zu berücksichtigen. Dies geschieht durch die Wärmeübergangskoeffizienten a mit der Einheit W/(m K). Wärmedurchgangskoeffizient k Wärmeübergangskoeffizient a Der Wärmeübergangskoeffizient hängt ab O von der Lage der Bauteiloberfläche (innen oder außen), O bei waagerechten Bauteilen von der Richtung des Wärmestromes (von oben nach unten bzw. von unten nach oben). Wärmeübergangswiderstand 1/a Analog dem Kehrwert von A kann der Kehrwert von a, also 1/a, gebildet werden. Er wird als Wärmeübergangswiderstand mit der Einheit m 2 K/W bezeichnet. Die Werte für verschiedene Wärmeübergangswiderstände sind in DIN 4108, Teil 4, Tab. 5, festgelegt. Wärmedurchgangswiderstand 1/k Wärmedurchgangskoeffizient k Der Wärmedurchgangswiderstand 1/k errechnet sich als Summe aus dem Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils 1/A, der sich seinerseits durch Addition der Wärmedurchlaßwiderstände der einzelnen Bauteilschichten ergibt, und den Wärmeübergangswiderständen 1/a i und 1/a a zu beiden Seiten des Bauteils. 1 + 1 + 1 `-h-i2 1 Tc = a; n aa W Die Größe 1/k ist also die Summe aller Widerstände, die ein Bauteil dem Wärmedurchgang vom warmen Luftraum durch das Bauteil hindurch bis zum kälteren Luftraum entgegensetzt. Durch Kehrwertbildung erhält man den Wärmedurchgangskoeffizienten k = 1)k mit der Einheit W/(m 2 • K). Der sogenannte k-Wert ist die für alle weiteren Betrachtungen entscheidende Kenngröße und gibt an, welche Wär- Zur Einbeziehung von Strahlungsgewinnen das gilt insbesondere für die Fenster, die bekanntlich vergleichsweise große Wärmeverluste verursachen, andererseits aber auch als Sonnenkollektoren wirken - hat man den äquivalenten Wärmedurchgangskoeffizienten kä q definiert (vgl. Info 2.2 „Energiebilanz von Gebäuden"). Der äquivalente k-Wert ergibt sich als Differenz aus dem die Wärmeverluste kennzeichnenden k-Wert und einem die durchschnittlichen Strahlungsgewinne während der Heizperiode berücksichtigenden Ausdruck im Sinne einer Wärmebilanzierung für das Bauteil. Zusammenfassung Rechenwerte der Wärmeleitfähigkeit Dicke der Stoffschichten tiR [ W/ (mK)] s [W/ Schichtdicke s^ 1 Wärmeleitfähigkeit A l — Wärmedurchlaßwiderstand 1/A 1 [m2K/W] Schichtdicke 2 Wärmeleitfähigkeit Wärmedurchlaßwiderstand 1/A 2 [m2K/W] ._ •- s2 _ WärmedurchlaßwiderSchichtdicke 3 Wärmeleitfähigkeit A. 3 - stand 1/A 3 [m2K/Wl Man erhält durch Addition den Wärmedurchlaßwiderstand des Bauteils 1/A (m2K/W] Wärmeübergangswiderstand innen 1/a, [m2K/W] Man addiert die beiden Wärmeübergangswiderstände Wärmeübergangswiderstand außen 1/aa [m2 K/W] Und erhält den Wärmedurchgangswiderstand 1/k [m2K/W] Durch Kehrwertbildung ergibt sich der Wärmedurchgangskoeffizient k [W/(m2 K)] Behaglichkeit 2.1 GRUNDLAGEN Bauphysik Die Behaglichkeit wird von sehr unterschiedlichen Einflußfaktoren bestimmt, und zwar O thermischen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit, Bekleidung), O hygienischen (Lüftung, Luftverunreinig ung), O optischen (Tageslicht, Kunstlicht, Farben), O akustischen (Innengeräusche, Außengeräusche), O biophysikalischen (elektr. Gleich- und Wechselfelder, Ionisation der Lu ft). Was als behaglich empfunden wird, unterliegt naturgemäß sehr stark persönlichen Bewertungen. Dennoch lassen sich auf der Grundlage der physiologischen Vorgänge Kriterien für das Zustandekommen eines bestimmten Behaglichkeitsempfindens angeben. Luftfeuchtigkeit Thermische Behaglichkeit Unter dem Aspekt der Energieeinsparung kommt vor allem der thermischen Behaglichkeit Bedeutung zu. Im Zustand der thermischen Behaglichkeit besteht Gleichgewicht zwischen der Abgabe der durch Stoffwechselvorgänge produzierten Körperwärme an die Umgebung und der Wärmeeinwirkung durch die Umgebung auf den Menschen. Störungen dieses Gleichgewichts können durch entsprechende Bekleidung oder durch Beheizen der Räumlichkeiten beseitigt werden. Die thermische Behaglichkeit wird im wesentlichen durch folgende eng miteinander verknüpfte physikalische Größen bestimmt: O Temperatur der Raumluft, O mittlere Temperatur der Raumumschließungsflächen (Wände, Decke, Fußboden), • Raumufttemperatur Lüfit= geschwin cttgkeit Empfirlclungstemperatur O relative Luftfeuchte im Raum, O Luftbewegung im Raum. Physiologische Untersuchungen haben gezeigt, daß die Lufttemperatur in Wohnräumen zwischen 20 und 22°C liegen muß. In Schlafräumen sind Lufttemperaturen zwischen 17 und 20°C zu empfehlen, und im Sommer sollte die Raumlufttemperatur in der Regel 24°C nicht überschreiten. Die in Abschnitt 6, Tabelle 3, der DIN 4701E „Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden" angegebenen Norm-Innentemperaturen für beheizte Räume sind dagegen sogenannte empfundene Temperaturen und scharf von den Räüm't"uittemperatureri zu trennen. Die vom Menschen empfundene Temperatur wird sowohl von der Raumlufttemperatur als auch der mittleren Temperatur der Raumumschließungsflächen bestimmt und kann nur dann behaglich sein, wenn die Temperaturdifferenz von Raumluft und Raumumschließungsflächen hinreichend klein ist. Als Richtgröße kann gelten, daß die durchschnittliche Temperatur der Raumumschließungsflächen 2 bis 3 K von der Raumlufttemperatur abweichen darf. Bild 8 zeigt, daß z.B. bei einer Lufttemperatur von +22 °C eine mi ttlere Temperatur der Raumumschließungsflächen von +18 bis +20°C nötig ist, um ein behagliches Raumklima zu schaffen. Um Temperaturdiffe24 30 °C 26 24 ^ 22 m > 5 20 ^ t 18 ^ E 16 3 ^^ 14 g ^ 12 I or ^ 10 12 14 6 18 20 22 24 °C 28 IN MI lizzam NOV IN IIII 1111 Ma. 1110 ^U NNW I,E . 11111111. kw' ^ _ 0 MENE11.110 IBINOMMOILI Raumlufttemperatur Behaglichkeitsfeld für das Wertepaar Raumlufttemperatur und Raumumschließungsflächentemperatur 8 renzen in der genannten Höhe zu erreichen, sollte der Wärmedurchgangskoeffizient k von Außenbauteilen möglichst kleiner als 1,0 W/(m2K) sein. Die Wirkung der relativen Luftfeuchtigkeit der Raumluft zeigt BiTd9. Luitfeuchtigkeiten zwischen etwa 35 und 70%, wie sie sich in der Regel in Wohnräumen einstellen, liegen im behaglichen Bereich und werden in den meisten Fällen nicht mehr differenziert wahrgenommen. 100 o^ 80 70 TD Y 60 m ° 50 mor, ir moreeri' imarmmai Mt NM" NM 'MI NM 11111 MR II MIL 1 11111111k A ^ LL C INEMMIONNI 0 12 14 16 18 20 22 24 °C 28 Raumlufttemperatur Behaglichkeitsfeld für das Wertepaar Raumlufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Raum 9 Luftbewegungen im Raum entziehen dem menschlichen Körper Wärme, besonders an den entblößten Stellen. Beispielsweise sollte bei einer Raumtemperatur von 20 bis 22°C die Luftgeschwindigkeit nicht größer als 0,20 rn/s sein. 20 16 18 22 24 °C 26 Raumlufttemperatur Behaglichkeitsfeld für das Wertepaar Luftgeschwindigkeit und Raumtemperatur in Abhängigkeit von der Art der Tätigkeit 10 Folgerungen Um ein behagliches Raumklima zu gewährleisten, sind grundsätzlich drei Aspekte zu beachten: 1. Der Bewohner muß die Raumlufttemperaturin Abhängigkeit von der mittleren Temperatur der Raumumschließungsflächen so empfinden, daß der Körper seine Wärmewederzu schnell (Kältegefühl) noch zu langsam (Hitzegefühl) an die Umgebung abgibt. 2. Die Wärmeabgabe sollte nach allen Seiten des Raumes möglichst gleichmäßig erfolgen. Dieser Idealzustand wird natürlich in der Praxis nicht erreicht, da Außen- und Innenwände, Fenster und Türen durch unterschiedlichen Wärmeabfluß das Gleichgewicht stören. Doch können Maßnahmen des Wärmeschutzes das Raumklima stabilisieren. Damit sinkt der Wärmebedarf des Raumes, und es ergibt sich zwangsläufig eine Annäherung von Raumlufttemperatur und mittlerer Temperatur der Raumumschließungsflächen. 3. Aufgabe der Heizung ist es, die über die Außenflächen an die Umgebung abgegebene Wärme neu zuzuführen. Dabei sollten statt kleiner Heizflächen mit hoher Temperatur große Heizflächen mit niedrigerer Temperatur (Niedertemperaturbetrieb) gewählt werden. Das führt zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Raumtemperatur und damit auch zu einheitlicheren Temperaturen der Raumumschließungsflächen. elemente sind auf der einen Seite die eingesetzten Energien wie Brennstoffe für Heizung und Warmwasserbereitung, elektrischer Strom für Beleuchtung und Geräte, die Sonnenwärme sowie die Wärmeabgabe der Bewohner und auf der anderen Seite die Umwandlungsverluste bei Heizung und Warmwasserbereitung, die Transmissionswärmeverluste, die Lüftungswärmeverluste und zum geringen Teil Wärmeverluste über das Abwasser. Inwieweit Wärmegewinne durch Sonneneinstrahlung, Beleuchtung u. ä. zur Verringerung des Wärmeverbrauchs beitragen, hängt wesentlich von der Speicherfähigkeit (vgl. Info 4.1 „Baukonstruktion Wände") vor allem der Innenbauteile ab. 1 Sonnenwärme 2 Wärme durch Beleuchtung und Geräte 3 Wärmeabgabe der Bewohner 4 Heizung und Warmwasser 5 Umwandlungsverluste bei Heizung und Warmwasser 6 Lüftungswärmeverluste 7 Transmissionswärmeverluste 8 Wärme im Abwasser Energiezufuhr und Wärmeverluste 11 Arbeit, Energie, Leistung Energie im physikalischen Sinne ist gespeicherte Arbeit. Beispielsweise muß zum Aufziehen eines Uhrwerks eine bestimmte Arbeit verrichtet werden, die in der Uhrfeder als Energie gespeichert wird und während des Entspannens der Feder Arbeit in der Uhr verrichtet. Energie wird wie Arbeit berechnet und hat daher die gleichen Maßeinheiten. Sie tritt in zahlreichen Erscheinungsformen auf, unter anderem als Wärme (Wärmeenergie, Wärmemenge) mit der Einheit „Wattsekunde" (Ws). Unter Leistung versteht man den Quotienten aus verrichteter Arbeit und der dazu benötigten Zeit: Leistung = Arbeit Zeit Folglich heißt die Einheit für die Leistung: Watt (W). Andere Bezeichnungen für den physikalischen Begriff „Leistung" sind Energiestrom oder Wärmestrom. Diese Begriffe geben an, wieviel Energie bzw. Wärme pro Zeiteinheit, zum Beispiel in einer Sekunde, fließt. Energiebilanz Energiebilanzen (vgl. Info 22 „Energiebilanz von Gebäuden") sind zwar noch nicht allgemein üblich, haben aber in der Vergangenheit bei der haustechnischen Planung häufig ihre Nützlichkeit unter Beweis gestellt und werden zukünftig bei Entwurf, Planung und Ausführung von Wohngebäuden unter dem Aspekt sparsamer und rationeller Energieverwendung einenfesten Platz einnehmen. Bilanz- Wärmeverluste Es werden zwei Arten von Wärmeverlusten unterschieden: Transmissionswärmeveri ust /AMU liff 12 O Transmissionswärmeverluste entstehen dadurch, daß Wärme infolge der unterschiedlichen Temperaturen außen und innen über die Gebäudehülle nach außen strömt. Ermittelt werden diese Verluste über die k-Werte der die Gebäudehülle bildenden Bauteile. Je kleiner der k-Wert ist, desto weniger Wärme geht verloren. Je größer die Dicke der wärmedämmenden Schicht und je kleiner ihre Wärmeleitfähigkeit ist, um so kleiner und damit besser wird der k-Wert, 25 O Bei Fenstern und Türen tritt zu den Transmissionswärmeverlusten der Lüftungswärmeverlust über die Fugen als eine Art „Dauerlüftung" hinzu. Die Durchlässigkeit der Fugen wird als aWert bezeichnet. Je kleiner der a-Wert und die Fugenlänge sind, desto weniger Wärme geht verloren. • 4038363432302828 26-c _ 2422 i cs 20 — ^ 18— r N U 3 16— "E 14 _I r 12— 10— 8— 6— 4 2— ^ co ä ä .Y 7 a) N O) C Y a N7 N^ N: d C N :7 ggb Außenwand: Rahmen Flügel LL I- fVerglasung N-p CN NO ^ N .^^ acN ro N O)— . .N N C N Np ^ C .^L._^ N N LLY C w . .V).S, N O .yC^N. C^ N[0L .^. lL.Q7 N Cits ^^ u_ -To- CCN ^ _^ m ^ a) -O O — Na) • C 7 Ctl 1] N m2 C 0O1 4) Cd 0 N. 70, lL... Luftwechsel in Abhängigkeit von der Fensterstellung (nach Gertis) Dichtungsebene 1 2 3 Fuge zwischen Außenwand und Rahmen (undurchlässig) Fuge zwischen Rahmen und Fensterflügel (durchlässig, Begrenzung durch Fugendurchlaßkoeffizient a) Fuge zwischen Fensterflügel und Verglasung (undurchlässig) Die Dichtungsebenen am Fenster (nach Seifert) 13 Die Lüftungswärmeverluste werden in der Zukunft eine immer größere Bedeutung bei der Wärmebilanz eines Gebäudes haben, da sich die Lüftungswärmeverluste unter Beibehaltung der natürlichen Lüftung nicht in dem gleichen Maße verringern lassen wie die Transmissionswärmeverluste. Trotz Reduzierung der Lüftungswärmeverluste durch Abdichten der Fugen an Fenstern und Außentüren müssen Räume mit der aus hygienischen Gründen notwendigen Frischluftmenge versorgt werden. Vorsicht ist vor allem bei Räumen mit sogenannten „offenen" Feuerstellen (z. B. Heizkessel in der Küche, Kombitherme im Badezimmer) geboten, da ausreichende Sauerstoffzufuhr für die Bewohner und zusätzlich für die Verbrennung gesichert sein muß. Als Größe zur Beschreibung des Luftaustauschs wird u. a. die Luftwechselzahl mit der Einheit h -1 verwendet. Die Luftwechselzahl gibt an, wievielmal innerhalb einer Stunde eine dem Raumvolumen entsprechende Luftmenge mit der Außenluft ausgetauscht wird. Nach anerkannter Regel ist aus hygienischer Sicht ein 0,5- bis 0,7facher Luftwechsel pro Stunde erforderlich. 26 14 Wärmebedarf und Wärmeverbrauch Wärmebedarf und Wärmeverbrauch sind keineswegs identisch. Der Wärmebedarf ist das Ergebnis der Wärmeverlustberechnung nach DIN 4701 und setzt sich ähnlich wie der Wärmeverlust eines Gebäudes aus den Anteilen für Transmission und Lüftung zusammen. Er ist auf die Zeiteinheit „Stunde" bezogen und daher Grundlage für die Bemessung der Heizleistung. Sowohl Heizkessel als auch Heizflächen müssen so dimensioniert sein, daß sie den Wärmebedarf unter den in der Norm genannten Randbedingungen decken. Der Wärmeverbrauch ist die beim Betrieb der Heizung tatsächlich erforderliche Leistung und in der Regel kleiner als der Wärmebedarf. Der Grund ist u. a. bei den in den Rechenwerten der Wärmeleitfähigkeit AR enthaltenen Sicherheiten, in der Tatsache, daß der errechnete Lüftungswärmebedarf nur in einem Teil des Gebäudes gleichzeitig auftritt und bei der Nichtberücksichtigung der Wärmegewinne zu suchen. Das Ergebnis der Wärmebedarfsrechnung nach DIN 4701 führt daher stets zu ausreichend bemessenen, wenn nicht sogar zu überdimensionierten Heizungsanlagen. Jahreswärmebedarf Ein fundamentales Element der Energiebilanz ist wie bei der Bilanz des Kaufmanns der Bilanzierungszeitraum. Häufig wird ein Jahr als Bezugszeitraum gewählt. Um die stetige Veränderung der Energieströme und ihre gegenseitige Beeinflussung zu verdeutlichen, kann es aber vorteilhaft sein, mit kürzeren Zeiträumen zu arbeiten. Für die Berechnung des Jahreswärmebe- Der Heizwert beträgt z. B. für: daris gilt die Beziehung (siehe auch VDI 2067 E, Elatt 2) 2,3.... 4,3 kWh/kg Holz 7,2.... 8,0 kWh/kg Koks _ Qh Qa 1000 b Steinkohle 8,2.... 8,9 kWh/kg 5,5.... 5,8 kWh/kg ßraünkohle mit Qa - jährlicher Wärmebedarf in kWh/Jahr 10,0....10,8 kWh/I Heizöl Oh = stündlicher Wärmebedarf in W b - Faktor für die jährliche Benutzungs4,2.... 4,9 kWh/m3 Stadtgas dauer in Std./Jahr (Jahresvollbenutzungsstunden). 7,9 ....11,9 kWh/m3 Erdgas Die Benutzungsdauer gibt an, wieviel Stunden im Jahr die Heizanlage mit voller Leistung im Dauerbetrieb arbeiten müßte, um den jährlichen Wärmebedarf zu decken. Sie kann hinreichend genau mit der nachfolgenden Gleichung bestimmt werden: b=24• Gt iii — üa mit Gt Gradtagzahl mit der Einheit Kelvin • Tag (K • d1 Jahr ` a Innentemperatur nach DIN 4701 in °C 15'a Außentemperatur nach DIN 4701 in °C Die Gradtagzahlen werden ermittelt aus der täglichen Differenz der mi ttleren Innen- und Außentemperaturen sowie der Anzahl an Heiztagen - die genaue Definition enthält VDI 2067 E, Blatt 1, Ziffer 2.8 - und berücksichtigen den Einfluß der unterschiedlichen Klimate auf die Beheizung. Bei Vorausberechnungen werden die in VDI 2067 E, Blatt 1, Tafel 21 und 22 aufgeführten mittleren Gradtagzahlen verwendet. Sie beruhen auf Messungen von 134 meteorologischen Stationen in der Bundesrepublik Deutschland während des Beobachtungszeitraumes 1951 bis 1971. Für Nachberechnungen können die tatsächlichen Heizgradtage für die entsprechenden Zeiträume den einschlägigen Fachzeitschriften entnommen oder vom Zentralamt des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach gegen Kostenerstattung bezogen werden. Jahresenergiebedarf (Jahresbrennstoffbedarf) Mit dem Heizwert H u als Maß für die bei der Verbrennung freiwerdenden Wärmeenergie und dem Gesamtwirkungsgrad n der Anlage über das Jahr als Maß für die Ausnutzung der durch die Verbrennung gewonnenen Wärme ergibt sich der Jahresenergiebedarf Ba: Ba = 100 Qa Es bedeutet: Qa Jah reswärmebedarf in kWh/a Hp, Heizwert in kWh/kg, kWh/I, kWh/m 3 je nach Brennstoff Jah res-Anlagenwirkungsgrad in %. 2111 GRUNDLAGEN Bauphysik Weitere Einzelheiten sind VDI 2067 E, Blatt 1, Tafel 13 und 14 zu entnehmen. Wenn die Heizwärme mit elektrischer Energie erzeugt wird, kann der Heizwert bei der Berechnung des Jahresenergiebedarfs entfallen (H u =1). Auch für den Jahreswirkungsgrad von Heizungsanlagen werden Angaben gemacht, und zwar in Tafel 17 der genannten VDI-Richtlinien. Als Richtwerte für den Jahres-Anlagenwirkungsgrad können gelten bei Anlagen für feste Brennstoffe Öl, Gas 70% 75% Elektrozentralspeicher 93% 96% Elektrokessel jedoch nur, wenn diese nicht gleichzeitig der Warmwasserbereitung dienen. Abgasverluste 14% 7%, Stillstands- und Bereitschaftsverluste ro 4% Leitungsverluste Energie im Brennstof 100% Energiefluß einer ganzjährig betriebenen Warmwasser - Zentralheizung 15 Wärmedämmstoffe Nur genormte oder bauaufsichtlich zugelassene Dämmstoffe dürfen im Bauwesen Anwendung finden. Damit ist stets eine Güteüberwachung vorgeschrieben, die gewährleisten soll, daß die Produkte in gleichmäßiger Qualität hergestellt und geliefert werden. Die Eigenschaften der Wärmedämmstoffe werden in starkem Maße durch ihr Gefüge und durch die Eigenschaften der Ausgangsprodukte geprägt. Was sich in einem Fall als gut und richtig erwiesen hat, kann im anders gelagerten Fall zu unerwünschten Nebenwirkungen oder gar Bauschäden führen. Den für alle Einsatzbereiche optimalen Dämmstoff gibt es nicht. Vielmehr hat die Auswahl von Wärmedämmstoffen unter gesamtkonstruktiven Gesichtspunkten zu erfolgen. Unter anderem sollten Fragen des Brandschutzes, des Schallschutzes, des Tauwasserschutzes und des Regenschutzes eine Rolle spielen. 27 Auf die beiden erstgenannten Bereiche soll in diesem Zusammenhang kurz eingegangen werden, während hinsichtlich des Tauwasser- und des Regenschutzes auf DIN 4108, Teil 3, Ziffer 3 und 4 verwiesen wird. Dämmstoffe gelten gemäß DIN 4102 „Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen" als Baustoffe und werden daher in brennbare und nichtbrennbare Produkte unterschieden. Einen Überblick, welcher Baustoffklasse die einzelnen Produktgruppen zuzuordnen sind, vermittelt die folgende Tabelle. Kleber, Beschichtungen u. a. können das Brandverhalten eines Dämmstoffes verändern. Aus diesem Grunde wird bei Verbundbaustoffen die Prüfung des Verbundquerschnittes gefordert. Quellen Hebgen, H.: Neuer baulicher Wärmeschutz, Vieweg Verlagsgesellschaft, Braunschweig (Abb. 10). Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau: Energiesparbuch für das Eigenheim (Abb. 11). Obering. Irmhild Sauerbrunn, Mannheim DBZ 6/81 (Abb. 16). Prof. Dr.-Ing. habil. Karl Gösele, Stuttgart. Wärme, Kälte, Schall 2/78 (Abb. 17). Gesetze, Vorschriften, Literatur [1]Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz - ENEG) vom 22. Juli 1976 Bundesgesetzblatt 1976 Teil I S.1873 ff. [2]Verordnung über einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden (Wärmeschutzverordnung - WärmeschutzV) vom 11. August 1977 und 24. Februar 1982 Bundesgesetzblatt 1977 Teil I S.1554 ff. Dämmstoff Baustoffklasse B1 132 B3 Bundesgesetzblatt 1982 Teil I S. 209 ff. A1 A2 [3] Verordnung über energiesparende Anforderungen X Holzwolle-Leichtbauplatten heizungstechnischen Anlagen und BrauchwasseranMehrschicht-Leichtbauplatten X X E an Kork X ,F.s lagen (Heizungsanlagen-Verordnung - HeizAnlV-) vom Phenolharz-Hartschaum X ^ 24. Februar 1982 Bundesgesetzblatt 1982 Teil I S. 205 ff. Polystyrol-Partikelschaum X [4]Verordnung über energiesparende Anforderungen Polystyrol-Extruderschaum X an den Betrieb von heizungstechnischen Anlagen und Polyurethan-Hartschaum X X Harnstoff-Formaldehydschaum X X '3 Brauchwasseranlagen (Heizungsbetriebs-Verordnung Mineralfaserdämmstoffe X' m HeizBetrV-) vöm 22; September 1978 X X ; Schaumglas E Bundesgesetzblatt 1978 Teil I S.1584 ff. X Klassifizierung von Dämmstoffen nach DIN 4102, Teil 1 16 [5]Verordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung'der Heiz- und Warmwasserkosten (Verordnung über Heizkostenabrechnung - Heizkosten' vom Dämmschichten beeinflussen die Schalldäm- 23. Februar 1981 Bundesgesetzblatt 1981 Teil I S. 261 ff. mung des betreffenden Bauteils bzw. der ge[6] DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau" Ausgabe samten Konstruktion je nach Steifigkeit des August1981 verwendeten Dämmstoffes und Befestigungs- Beuth Verlag GmbH, Berlin* art. Während sich beispielsweise bei einer [7] DIN 4701 (Entwurf) „Regeln für die Berechnung des Innendämmung mit vollflächig aufgeklebten Wärmebedarfs von Gebäuden" Ausgabe März 1978 Beuth Verlag GmbH, Berlin* Polystyrol-Hartschaumplatten die Schall[8] VDI 2067 (Entwu rf) „Berechnung der Kosten von Längsdämmung im mittleren FrequenzbeWärmeversorgungsanlagen" Ausgabe Dezember 1979 reich sehr stark verschlechterte, wurde bei Beuth Verlag GmbH, Berlin* Verwendung von Mineralfaserplatten unter [9] Berber, J.: Bauphysik - Wärmetransport, Feuchtiggleichen Versuchsbedingungen eine Verbeskeit, Schall serung gegenüber dem unverkleideten ZuVerlag Handwerk und Technik, Hamburg stand erzielt. [10] Nikolic, V.: Handbuch des energiesparenden Bauens Deutscher Consulting Verlag, Wuppe rtal [11]Gösele/Schüle: Schall, Wärme, Feuchte 4RL Bauverlag, Wiesbaden [12]Der Bundesminister für Forschung u. Technologie (Hrsg.): Bauen und Energiesparen Ein Handbuch zur rationellen Energieverwendung im GipskartonHochbau platten auf Verlag TÜV Rheinland 30 mm Mineralfaser[13]Gösele/Kiesewetter: Schalldämmverschlechterung platten durch Plattenverkleidungen. Forschungsvorhaben im 500 1000 2000 Hz 100 200 Auftrag des BMBau, November 1978 *DIN-Normen und Vdl-Richtlinien können direkt beim Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstraße 4-10, 1000 Berlin 30, bezogen werden. 4R^ Gipskartonplatten auf Hartschaumplatten 500 1000 2000 Hz Frequenz Die „Verbesserung AR S " der Längsdämmung RL . einer Außenwand durch zwei 1erkfeidungen (jeweils vollflächig aufgeklebt). Die Verkleidung mit Mineralfaserplatten verbessert im ganzen Frequenzbereich die Längsdämmung; die Verkleidung auf Hartschaumplatten verschlechtert im mittleren Frequenzbereich sehr stark. 17 28 Kurzbiografie des Autors Dipl.-Ing. Wilfried Zapke Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung „Bauphysik und Baukonstruktion" im Institut für Bauforschung e. V., Hannover. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen auf den Gebieten Bauphysik, Bauschäden. Redaktionelle Bearbeitung und Layout Dipl.-Ing. Bernd Faskel, Koordination Vladimir Nikolic. gIILIND ' ENER GIEE1NSPARUNG LAG^ Ene^ riehilani ion 2.2 vereinfachte Berechnungsverfahren Ein Forschungsvorhaben der Bundesarchitektenkammer durchgeführt sm Auftrage des Bundesministeriums fur Städtebau. Raumordnung und Bauwesen GRUNDLAGEN Energiebilanz von Gebäuden, vereinfachte Berechnungsverfahren Verfasser; Prof. Dr -ing. habit Lothar Rouvel August 1981 Einflüsse auf den Heizenergieverbrauch Natürliche Einflüsse Der Heizenergieverbrauch eines Gebäudes hängt von einer Vielzahl von Einflußfaktoren ab, die zum Erreichen eines angenehmen Raumklimas erforderlich sind. Abhängig von der Klimazone und damit verknüpft von der Auslegungstemperatur für die Heizungsanlage, den jeweiligen Standortverhältnissen, der Lage des Hauses nach Windanfall sowie eine mehr oder weniger günstige Orientierung der Wohnräume nach der Besonnung können bereits merkliche Unterschiede im Heizenergieverbrauch von etwa±20% nur durch standortbedingte natürliche Einflüsse bringen. Es handelt sich dabei im wesentlichen um vier Einflußbereiche: O die außenklimatischen Verhältnisse, vor allem die Temperäfur dbr kilIefiluff im Verlauf eines Jahres und der Windanfall, aber auch die Sonneneinstrahlung während der Heizperiode; O das Gebäudekonzept mit der Art der Bauweise des Gebäudes, seinen energetischen Eigenschaften und bauspezifischen Kenndaten; hierzu rechnen z. B. die Verwendung wärmedämmender Bauteile für Außenwände, die thermische Fensterqualität, aber auch die Gebäudegröße, die Geschoßzahl, die Fassadengliederung, der Fensteranteil an der Fassadenfläche und die Lage einer Wohnung im Gebäude; O die heizungstechnische Konzeption, das bedeadti. B. bei be einten Ge-bäüden ohne raumlufttechnische Anlagen die Art der Heizungsanlage mit ihrem Wärmeverteilungssystem, der Energiewandler also z. B. Heizkessel oder Öfen oder Wärmepumpen - sowie die Regelung der Heizungsanlage und der Anlagenzustand; O der Mensch mit seinen Nutzungsansprüchen an die Heizung unid seinen Gewohnheiten; charakteristische Merkmale hierfür sind: Art der Nutzung der Räume, Höhe der Raumtemperaturen, Dauer der Heizperiode, tägliche Nutzungs- und Heizdauer, Umfang der Beheizung sowie Häufigkeit und Dauer des Lüftens. Außenklima 110% Ost/ —14°C RaumklimasEnergietechn. Konzeption Raumnutzung Haupteinflußgrößen auf eines Gebäudes den Energiehaushalt Um einen Anhalt über die Auswirkungen der wichtigsten Einzeleinflüsse auf den Heizenergieverbrauch eines Gebäudes zu erhalten, sind folgende charakteristische Werte zu berücksichtigen. West normal 90% Auslegungstemperatur Lage nach Windanfall Orientierung des Wohnraumes Heizungstechnisches Einflüsse auf den Heizenergieverbrauch 2 Konzept Benutzerbedingte Einflüsse Die Benutzer eines Gebäudes beeinflussen den Heizenergieverbrauch vor allem durch die Entscheidungen, welche Raumtemperaturen angestrebt und eingehalten werden, bei welchen Außentemperaturen die Heizungsanlage ein- bzw. abgeschaltet wird und welche Maßnahmen zum Lüften getroffen werden. Eine Verlängerung bzw. Verkürzung der Heizperiode führt zu einer Bedarfsänderung bis zu etwa ± 7%. Der Trend zu höheren Raumtemperaturen bedeutet ebenfalls eine Verbrauchszunahme von etwa 5 bis 8% je Grid KK611 in) Temperaturerhöhung. Werden dagegen nur noc die Räume beheizt, in denen sich Personen längere Zeit aufhalten, so kann der Energieverbrauch erheblich gesenkt werden. Unzweckmäßiges Lüften durch zu langes oder ständiges Offnen von Fenstern führt zu erheblichem Mehrverbrauch. 110% Gebäudekonzept Nord —16°C ENERGIEHAUSHALT Baukonzept NATÜRLICHE EINFLÜSSE ungeschützt Außenklimatist Verhältnisse BENUTZERBEDINGTE EINFLÜSSE 22°C viel 140 100% 90% • 80% Raumtemperatur Außentemperatur Lüften bei Heizbeginn Einflüsse auf den Heizenergieverbrauch 3 29 Nutzungsansprüche Verbrauchszunahme z ..i GRUNDLAGEN Energiebilanz von Gebäuden, vereinfachte Berechnungsverfahren WärmeschutZverordnung und zusätzliche Wärmeschutzmaßnahmen Ermittlung des mittleren Wärmedurchgangs koelfizlenten Thermostatisch gesteuerte Heizkörperventile Gebäude- und heizungsanlagenbedingte Einflüsse Eine noch größere Bedeutung haben die gebäude- und anlagebedingten Einflußfaktoren. Je nach Wärmeschutz eines Gebäudes, aber auch nach Gebäudeart und Fassadengliederung, Heizsystem und Regelungsart verändert sich der Heizenergiebedarf wesentlich. Die Wärmeschutzverordnung (WSchVQ) vom August 1977 hat bei Neubauten fast<.zu einer Halbierung des Heizenergiebe.arfs gegenüber der bis Ende der sechziger Jahre üblichen Bauweise geführt, und zusätzliche Wärmeschutzmaf3nahmen können den Heizenergieverbrauch auf fast ein Drittel gegenüber „herkömmlicher" Bauweise senken. Der Einbau einer witterungsabhängigen Regelung der Vorlauftemperatur in Verbindung mit thermostatisch gesteuerten Heizkörperventilen kann bei Zentralheizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern Energieeinsparungen bis zu 25% bringen. Eine Raumtemperaturregelung in Einfamilienhäusern führt zu etwa gleichen Einsparungseffekten. 100% GEBÄUDE- UND ANLAGENBEDINGTE EINFLÜSSE üblich früher üblich Bungalow Reihenhaus 75% 0) Wohnblock 50% sehr gut 0% Kompaktheit des Gebäudes mit: A Temperaturdifferenz zwischen Raumund Außenluft. Daraus ergibt sich, daß der km-Wert wesentlich die Transmissionswärmeverluste beeinflußt. Würde man fordern, daß alle Gebäude bezogen auf das umbaute Volumen dieselben Transmissionswärmeverluste (bei gleichen außenklimatischen Randbedingungen) haben sollten, müßte gelten: km v = tonst. (2) oder anders ausgedrückt km 1 /Ü (3) Hätten alle Gebäude gleiche Transmissionswärmeverluste pro m 3 umbauten Raums (QT), ergäbe sich ein hyperbolischer ZuV sammenhang zwischen k m und A/V. 25% Wärmeschutz Wärmeschutzverordnung Als Kriterium für die Güte des Wärmeschutzes eines Gebäudes wird in der Wärmeschutzverordnung der mittlere Wärmedurchgangskoeffizient km der wärmeübertragenden Umfassungsflächen A vorgegeben, wobei die Mindestanforderungen abhängig vom Verhältnis A/V sind (V = von der Umfassungsfläche eingeschlossenes Bauwerksvolumen). Die Brm,itti i tgdes_raittieren Wärmed_u.r..ch.erfolgt nach den Begangskoeffizient rechnungsvorschriften in DIN 4108 Teil 2. Will man ein von der Gebäudegröße und der Gebäudegeometrie unabhängiges Maß für die Transmissionswärmeverluste QT eines Gebäudes haben, bezieht man QT z. B. auf das umbaute Volumen. Es gilt dann: QT = km A A (1) Regelungsgüte Einflüsse auf den Heizenergieverbrauch Einfache Berechnungsregeln zur energetischen Bewertung eines Gebäudes Kompaktheit Energetische Bewe rtung von Gebäuden Im folgenden soll vor allem auf die baulichen Maßnahmen eingegangen werden, die zu einer Beeinflussung des Heizwärmebedarfs führen. „Einfache" Berech_oungsregeln sollen dazu beitra g en auch dem Architekten die Möglichkeit einer energetischen Bewertung des Gebäudes zugeben.. Füreinen Teil der genannten Einflüsse bestehen bereits seit längerem Berechnungsverfahren. Es sei hier an die DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau" von 1981 und die etwa gleichlautende Wärmeschutzverordnung von 1977, an die DIN 4701 „Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfs von Gebäuden" von 1978 sowie die VDI 2067 „Wirtschaftlichkeitsrechnung von Wärmeverbrauchsanlagen" von 1979 erinnert. Diese konventionellen Berechnungsverfahren haben den Vorteil, relativ einfach zu sein, jedoch betrachten sie nur Teilaspekte, nämlich hauptsächlich nur die Wärmeverluste und vernachlässigen die Wärmegewinne, z. B. durch Sonneneinstrahlung. Sie führen daher zum Teil zwangsläufig zu Fehlbeurteilungen. 30 de 60'‘^\oGKe 4 Pe\• ren^aUSe( tre s^e Na se ^N ‚11-Iholiere Wärmeverluste 'yi a ^F 1 ` ^a^, '^^^^^ -^^ ► ^^^;^^i^^ ^^//// ^^^. ^^ ^ -"^" ^^ ^^ geringere Wärmeverluste 0,8 0,4 0,6 0,2 0 A = Gebäudeumfassungsfläche umbauter Raum V T = tonst. n Q 1,0 m2 m3 1,4 - übliche Werte Qualitativer Zusammenhang zwischen mittlerem Wärmedurchgangskoeffizient k m und dem Verhältnis A/V Daraus leitet sich ab, daß an kompakte gro-, fie_Gebaude (ALVist klein) n r._seh-r geringe Anforderungen hinsichtlict d.es._Warrrsescbutzes _gestellt werden_mt!ßten, an kleine H.auser_(A/V ist gr ferdersang en.ear_de lch_sind.._In der Praxis hat sich - wie bereits erwähnt - herausgestellt, daß große Gebäude meist einen geringeren und kleine Gebäude einen höheren Transmissionswärmeverlust aufweisen. Darauf nimmt auch die Wärmeschutzverordnung Rücksicht, indem sie eine Grenzkurve der Form (4) k m, rhax = a + b • 1 /Ü angibt (a und b sind konstante Werte; z. B. nach WSchVO, August 1977: a = 0,61, b = 0,19). Einen Überblick über die Bereiche des mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten in Abhängigkeit von der Bauweise gibt nachstehende Abbildung. ,O\oGµ iii or`^ 1,8 W m2K 1,4 1,2 Lm 1,0 ^ E 0,8 E 0,6 0,4 0,2 0 e<'des Uec ^`(‘ clee \<e E^\(^ '^,a Der Schwankungsbereich kann hierdurch wesentlich verkleinert werden, jedoch sind immer noch Unterschiede bei gleichem am= . ^m - Wert von k m • V bis zu fast 2:1 zu erwarten. oh.^ - ^ " m ^^^^^^^^^ ^^^ m• - - 0 0,2 0,4 0,6 08 A __Gebäudeumfassungsfläche V umbauter Raum Bauweise: Da ein solch großer Toleranzbereich für eine energetische Bewertung unzureichend erscheint, müssen andere Wege gesucht werden, die eindeutiger sind und mit der Realität besser übereinstimmen. - m 21 4 1,0 m 350 : vor 1978 -WschVO vorn 11. August 1977 wirtschaftlich optimal (Stand 1980) vorauss. Novellierung der WSchVO 1982 \ Grenze bei konvent. Bautechniken kWh m2a Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient krr, in Abhängigkeit vom Verhältnis A/V 6 Ein Reihenhaus mit dem Kennwert A/V von z. B. 0,7 m 2 /m 3 hatte nach den Bauvorschriften der siebziger Jahre einen km-Wert von etwa 1,3 W/m 2 K, die Wärmeschutzverordnung vom August 1977 fordert einen Maximalwert von knapp 0,9 W/m 2 K, die voraussichtliche Novellierung der WSchVO verschärft die Anforderungen auf einen Wert unter 0,7 W/m 2 K. Mit konventionellen Bautechniken dürfte die untere erreichbare Grenze bei etwa 0,5 W/m 2 K liegen. Obwohl der k m -Wert als Kriterium für die Beurteilung des Wärmeschutzes festgelegt ist, besteht kein sehr enger Zusammenhang zum Jahresheizwärmebedarf pro m 2 Wohnfläche. 350 kWh m a 250 `m -0 a) .o E 200 Mehrfamilienhaus A/V = übliche Bauweise bis 1978 vom Bauweise nach Aug vom August 1977 Der zu erwartende Jahreswärmebedarf pro m 2 Wohnfläche schwankt bei gleichem k m Wert um den Faktor 3, obwohl nur der Bereich der Mehrfamilienhäuser betrachtet ist. Wesentlicher Parameter für den Schwankungsbereich ist das Verhältnis A/V. Daher scheint es günstiger, als Kenngröße für den Jahreswärmebedarf entsprechend Gleichung (1) den Parameter A km v zu wählen. Hier werden zusätzlich zum mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der Umfassungsfläche auch die Fassadengliederung und die Gebäudeart gewertet. " d V 250 200 150 100 50 0,6 .!$ ö 1E. A ^, > 0 0 0,2 04 0,6 km • vA km= mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient A = Hüllenfläche V = umbautes Volumen 4i , , 7 '‘‚‚: t4W IttiVi Jahreswärmebedarf je m 2 Wohnfläche 150 'ed ä^ t ü^ 100 50 ü^ E 0 möglicher Bereich bei konventionellen Bautechniken Energiebilanz von Gebäuden voraussichtliche Novellierung der Wärmeschutzverordnung 1982 0 0,5 1,0 W/m2K mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient km Mittlerer Jahreswärmebedarf je m 2 Wohnfläche in Abhängigkeit vom Wärmeschutz 2,0 7 Hierzu muß der Energiehaushalt eines Gebäudes mehr beachtet werden. Um mehr Verständnis für die Wirkungsmechanismen zu bekommen, wird für ein Gebäude mit statischer Heizung die qualitative Energiebilanz während eines Tages in der Heizperiode betrachtet. Transmission Dach nachts GRUNDLAGEN Energiebilanz von Gebäuden, vereinfachte Berechnungsverfahren Lüftung Transmission Fenster Transmission Außenwand Direkte und diffuse Strahlung Transmission Keller Qualitative Energiebilanz an einem Wintertag für ein Gebäude mit statischer Heizung Transmissions- und Luftungswärmeveriust Deckung der Wärmeverluste durch Sonneneinstrahlung 9 Nachts wird die Heizung in der Regel mit verminderter Leistung betrieben (Nachtabsenkung). Der Wärmeverlust des Gebäudes - bestehend aus Transmissionswärmeverlusten über die Gebäudeumfassungsflächen sowie den Lüftungswärmeveriusten - wird nur zum Teil durch die Heizungsanlage gedeckt. Die in den Wänden, in Fußboden und Decke sowie im Mobiliar gespeicherte Wärme wird zur Beheizung des Raumes mit herangezogen. Einen kleinen Beitrag liefern auch die Bewohner des Gebäudes. Die Raumtemperatur fällt dabei langsam ab. Transmission Dach Während des Tages tri fft Sonneneinstrahlung auf das Haus. Hierbei ist nicht nur an die direkte Sonnenstrahlung, sondern auch an die diffuse Strahlung zu denken. Wenn auch die maximalen Werte der direkten Strahlung bis zu sechsfach so hoch sind wie die di ff use Strahlun ,_sind sie im Mittel über die Heizperiode etwa gleich groß. as bedeutet, daß auf die Nordseite eines-Gebäudes immerhin noch nahezu halb soviel Sonnenwärme eingestrahlt wird, wie auf die Südseite fällt. Der größte Teil der Sonneneinstrahlung auf ein Gebäude trifft auf die Außenwände und wird an deren Oberfläche zum Teil reflektiert, zum Teil von den Wänden absorbiert und in Wärme umgewandelt. Der größte Anteil hiervon wird wieder über Wärmestrahlung und Konvektion an die Umgebung abgegeben; nur etwa 10% gelangen durch Transmission in den Raum. Wesentlich günstiger sehen die Relationen beim Fenster aus. Hier gelangen etwa 70% der auftreffenden Strahlung in de n Raum und trauen zur Deckung der Wärmeverluste bei. Das Fenster mit dem dahinterliegenden Raum stellt also einen einfachen Sonnenkollektor dar. Die Heizleistung kann dadurch gesenkt werden. Ein Teil der eingestrahlten Wärme wird in den Innenbauteilen des Gebäudes gespeichert und ein Überheizen des Gebäudes in der Mittagszeit kann vermieden werden. Transmission Dach morgens Lüftung Transmission Fenster Transmission Mods Außenwand Transmission Keller Qualitative Energiebilanz an einem Wintertag für ein Gebäude mit statischer Heizung • Nachtabsenkung Abgekühlte Speichermassen Innere Warmeguelien Lüftung Transmission Fenster Transmission 10 Morgens wird die Nachtabsenkung aufgehoben. Die Heizung deckt jetzt die Wärmeverluste nach außen vollständig. Zudem müssen von ihr noch die abgekühlten Speichermassen (Wände usw.) wieder erwärmt werden. In geringem Umfang helfen auch innere Wärmequellen, wie Beleuchtung und Personenbei. Die Heizung muß zu diesem Zeitpunkt in der Regel die höchste Wärmeleistung (im Tagesgang) abgeben. Außenwand Transmission Keller Qualitative Energiebilanz an einem Wintertag für ein Gebäude mit statischer Heizung 12 Gegen Abend wird diese Wärme wieder aus den Wänden entnommen und hil ft mit, das Defizit durch den Wegfall der Sonneneinstrahlung zu decken. Aus dem Tagesrhythmus läßt sich die Jahresbilanz herleiten. Entspeichern und Speichern von Wärme in Wänden, Decken u. ä.; Transmission Dach Transmission Dach Lüftung Transmission Fenster Transmission mittags Außenwand Lüftung Transmission Fenster Transmission Transmission Keller Qualitative Jahresbilanz für ein Gebäude mit 13 statischer Heizung Außenwand Transmission Keller Qualitative Energiebilanz an einem Wintertag für ein Gebäude mit statischer Heizung 32 11 Die Wärmeverluste, bestehend aus O Transmission über die Gebäudeumschließungsflächen sowie O Lüftung werden im Jahresmittel nur etwa zu 50 bis 70% durch Wärmelieferung der Heizungsanlage gedeckt. 30 bis 50% der Wärmeverlustestammen aus Wärmegewinnen durch O Sonneneinstrahlung und O innere Wärmequellen. Es ist daher offensichtlich, daß eine energetische Bewertung des Gebäudes nur nach den Wärmeverlusten zu keinen objektiven Ergebnissen führen kann. Daher sind erhebliche Fehlentwicklungen bei zukünftigen Maßnahmen zur Energieeinsparung sowoh I bei Neu- wie auch bei Altbauten vorausseh bar. Die Wärmespeicherung in den Bauteilen erscheint im Jahresmittel betragsgleich wieder als Entspeicherung, da die Temperaturen in den Bauteilen zu Beginn und zu Ende der Heizperiode praktisch gleich sind. Für den stündlichen und täglichen Energiehaushalt eines Gebäudes ist die Wärmespeicherung jedoch von erheblicher Bedeutung. Um die Mittagszeit würde ein Raum ohne Wärmespeicherung überheizt, die Überschußwärme müßte hinausgelüftet werden und stünde am Abend nicht mehr zur Beheizung des Raumes zur Verfügung. Von besonderer Bedeutung ist die Speicherwärme für die solaren Energiegewinne in der Übergangszeit. Der tages- und jahreszeitliche Verlauf der Energiebilanz eines Gebäudes und somit auch der ausnutzbaren Wärmegewinne lassen sich mittels dynamischer EDV-Sir► ula tion ermitteln [2]. Dieses Planungsinstrument wurde bereits an einer Reihe von Bauvorhaben mit Erfolg angewendet. Für viele Gebäude, insbesondere Einfamilienhäuser, ist eine vereinfachtere Betrachtungsweise, die die Wärmebilanz von transparenten und nichttransparenten Bauteilen ebenfalls berücksichtigen muß, sinnvoll. Um einen besseren Überblick über die Größe der einzelnen Bilanzposten bei der Jahreswärmebilanz unterschiedlicher Hauser rt bei verschiedenem Standard der Wärme -dam ungzuerhalten,sind ieVerhältnis e bei einem freistehenden Einfamilienhaus und einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus jeweils getrennt für O Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 vom August 1969, O Wärmeschutzverordnung vom August 1977, O voraussichtliche Novellierung der Wärmeschutzverordnung 1982 aufgezeigt. 0 M d d ro E Wärmegew. ca. 125 kWh/m2a Heizwärmebedarf ca. 195 kWh/m2a Em t^ Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 August 1969 Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 August 1969 m m E E E y o \ . Wärmegew: ca..^ ^ 140 kWh/m2a M 1 N Heizwärme- —' °' .3 Em d bedärf ca. . 210 kWh:m<a. / • . '. . ^ ... ä a^ ^ E c z Dach Außenwand d N a, Transmission Fenster — Lüftung E N Keller Erhöhter Wärmeschutz nach WSchVO 11. August 1977 Wärmegew. ca. 110 kWh/m2a E ^Heizwärme=• . bedarf ca.. 130 kWh,m°a • E L m ^ E 3 z Lüftung Keller E E ^ Heizwärmebedarf ca. 130 kWh/m2a Erhöhter Wärmeschutz nach WSchVO 11. August 1977 E 0 N m Dach Außenwand Transmission Fenster Wärmegew. ca. 110 kWh/m2a Em d CD c^ Dach Außenwand ^ Wärmegew. ca. E 75 kWh/m2a E m m E ,3 ^ ^ Transmission Fenster Lüftung \, Keller E c^ Heizwärme bedarf ca. 80 kWh/m2a Dach Außenwand Transmission enster Lüftung eller z UCi d c^ Voraussichtliche Novellierung der WSchVO 1982 JahreswärmebHanz eines freistehenden, 11/2stöckigen Einfamilienhauses 14 GRUNDLAGEN Energiebilanz von Gebäuden, vereinfachte Berechnungsverfahren Dynamische EDV-Simulation Jahreswärmebilanz von Häusern E Außenwand Transmission Fenster 2.z Voraussichtliche Novellierung der WSchVO 1982 n Jahreswärmebilanz eines 5stöckigen Mehrfamilienhauses n 33 Wärmespeicherung Jahreswärmebilanz unterschiedlicher Häuser bei verschiedenem Standard der Wärmedämmung are Energie Ubergangs, inne in 2.2 GRUNDLAGEN Energiebilanz von Gebäuden, vereinfachte Berechnungsverfahren Zur besseren Übersicht ist die Breite der Bilanzposten direkt proportional dem Bedarf in kWh pro m 2 beheizte Fläche. Es werden folgende Zusammenhänge deutlich: O Bezogen auf gleichen Baustandard benötigt das Mehrfamilienhaus zwischen 35 und 45% weniger Heizwärme als das freistehende Einfamilienhaus. O Bei besserer Wärmedämmung der Gebäude nehmen zwar die Wärmegewinne durch Sönne, Personen u. a. absolut ab, sie _m. decken aber einen immer großer werdenden Anteil der Wärmeverluste. O Die Wärmeverluste über Dach und Keller sind beim Einfamilienhaus von größerer Bedeutung als beim Mehrfamilienhaus. O Eine dominierende Rolle bei den Verlusten, insbesondere beim Mehrfamilienhaus, spielen die Fenster, und zwar hinsichtlich — Transmission und Lü ft ung Fenster 1 (kF = 3,3 W/m2K) kw=0,9W/m2K 2,5 r^ ohne Sonnen- \ ^ einstrahlung IY W/m 2K 'C'a1 '17i N0 Ai Nord Iplip. cm ccom -c .` Süd ^.. r Al ^ :ior ',5 0,5 Ca) >^ Zweifachverglastes Fenster (k = 3,0 W/m2K, Glasanteil 65%) ¢ 0 Heizperiode 0 25 Fensteranteil 50 75 % AF+AN, Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient der Außenfassade ohne Sonneneinstrahlung 0,5 100 AF ^ 1,0 110" 1 1,5 1,0 mit einem Anteil von rund 60%. 2,0 kWh mTTag 1,5 Um eine Größenordnung von der Bedeutung der Sonneneinstrahlung zu bekommen, ist die Abhängigkeit des äquivalenten Wärmedurchgangskoeffizienten einer Außenfassade von der Größe der Fenster dargestellt. 17 Fenster 2 (kF = 1,9 W/m2K) kw = 0,9 W/m2K 2,5 3+ 0,5 Y W/m2K Co :El C mC 3m m̀ °J E Nordfenster 1,0 West- u. Ostfenster —•—•—.— Südfenster Positive Wärmebilanz bei zweifachvergiastem Fenster in Südlage Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient kaa \ 1,5 /1 1,5 • ^C m ohne Sonnen- einstrahlung CO 5 0 —5 Monatsm itteltemperatu r 10 15 `C 20 Energiebilanz eines Fensters für den Energieaustausch durch Transmission und Strahlung 16 Energiebilanz eines Fensters Für ein zweifachverglastes Fenster ist bei Südlage bereits bei mittleren Außentemperaturen oberhalb etwa 7°C die Wärmebilanz positiv, d. h. im Monatsmittel entsteht ein Wärmeüberschuß. Bei Nordfenstern tritt dieser Zustand erst bei mittleren Außentemperaturen oberhalb etwa 13 °C auf. Durch Einsatz eines temporären Wärmeschutzes nachts, z. B. durch dichtschließende wärmedämmende Rolläden, lassen sich die Relationen noch verbessern. Lm U 1,0 Nord E ^, 0 ,5 ^^11111111111111111111111111111111 Süd m 1 a , ä 0 MI 0 50 25 Fensteranteil 75 % 100 AF AF +Aw Dabei wird unterschieden nach zwei Verglasungsarten: O Fenster 1: Zweischeiben-Isolierverglasung, O Fenster 2: Dreischeiben-lsolierverglasung bzw. Wärmeschutzverglasung. Bereits bei der heute üblichen lsolierverglaÄquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient sung ist der resultierende Wärmeverlust auch bei Nordfenstern erheblich niedriger Die Energiebilanz von Bauteilen während der Heizperiode läßt sich mit dem sogeals man es nach der Wärmeschutzverordnung und DIN 4108 ermittelt. Bei Südfassanannten „äquivalenten Wärmedurchgangskoeffizien- den ist danach bereits bei Zweifachverglaten k " sung der Heizwärmebedarf nur geringfügig abhängig von der Fenstergröße. Bis zu beschreiben. Er schließt neben den Transeinem Fensteranteil von 50% an der Fasmissionswärmeverlusten auch die nutzsade ist die Wärmebilanz der Fenster etwa baren Wärmegewinne durch transparente und nichttransparente Bauteile, wie Fengleich groß wie die Werte für Außenwände ster, Außenwände und Dächer, ein. mit einem k-Wert von rund 0,9 W/m2K. 34 Bei Dreifachverglasung sinkt der Heizwärmebedarf sogar mit zunehmender Fenstergröße. Das Fenster ist bei Südorientierung energetisch gleichwe rt ig einer Wand mit einem k-Wert von etwa 0,5 W/m 2 K, bei Nordfassaden immerhin noch einem k-Wert von ca. 0,8 W/m2K. Wie bereits erwähnt, lassen sich durch einen temporaren Wärmeschutz die Verhältnisse noch verbessern. Somit spielt die Größe des Fensteranteils an der Fassade keine entscheidende Rolle für den Jahresheizwärmebedarf eines Gebäudes. Fensterflächenanteil an der Fassade 2. GRUNDLAGE Energiebilanz vo Gebäuden, vereinfacht Berechnungsverfahre Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient von Fenstern Die Wärmebilanz von transparenten und nichttransparenten Flächen läßt sich mit einfachen Näherun sformein abschätzen, Für Fenster werden außer dem Wärmedurchgangskoeffizient k F als weitere Parameter nur die Gesamtstrahlungsdurchlässigkeit des Glases sowie die Himmelsrichtung benötigt. (5) käq,F = k F — g • S h mit käq,F: äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient des Fensters in W/m2K Wärmedurchgangskoeffizient des kF: Fensters in W/m2K Gesamtstrahlungsdurchlässigkeit des g: Glases Strahlungsgewinnkoeffizient in W/m2K S: h: Einfluß der Himmelsrichtung Nord und dauernd h =1 verschattete Fenster: Ost/West: h =1,5 h=2 Süd: 50 100 150 200 250 300 350 Jahresheizwärmebedarf pro m 2 beheizte Bruttogeschoßfläche Strahlungsgewinnkoeffizient in Abhängigkeit vom Jahreswärmebedarf Einfache Näherungsformel zur Ermittlung de Wärmebilanz von transparenten und nichttransparenten Flächen 18 Zahlenmäßig läßt sich der Strahlungsgewinnkoeffizient S auch aus einer Näherungsformel bestimmen: S=0,95 + 06e Strahlungsgewinnkoeffizient S (7) mit x= + Aw ) • AB 6 — (0,033 — 0,3 AF Aa AF: Fensterfläche in m 2 Aw: Außenwandfläche in m2 AB: Qa: beheizte Bruttogeschoßfläche in m 2 Jahresheizwärmebedarf in kWh/a Der Jahresheizwärmebedarf läßt sich durch einen temporären Wärmeschutz an den Nach [1] liegt der mittlere Tiefstwe rt für den transparenten Flächen erheblich senken, Strahlungsgewinnkoeffizienten bei S = 1,2 W/m 2K (6) da in den Dunkelstunden die Transmissionswärmeverluste verringert werden, in Verglasung Gesamtstrahlungs- den Hellstunden aber die Sonnenwärmegewinne unverändert bleiben. durchlässigkeit g Doppelverglasung aus Die Auswirkung des temporären WärmeKlarglas 0,8 schutzes läßt sich berücksichtigen, indem Dreifachverglasung aus man in Gleichung (5) für den WärmedurchKlarglas und gangskoeffizienten k F den zeitlich gewichWarmeschutzverglasung 0,7 teten Wert für die WärmedurchgangskoeffiGlasbausteine 0,6 zienten mit und ohne temporären WärmeSonnenschutzschutz einsetzt. verglasung 0,2-0,8 (8) kF — kF,Taq ' tTaq + kF,Nacht ' tNacht 24 Quelle: DIN 4108 (Teil 2) von 1981 Nach den Ergebnissen des Instituts für Bauphysik in Holzkirchen kann für dichtEine Doppelverglasung mit einem kF-Wert schließende Rolläden einschließlich der von 3,0 W/m 2 K hat danach in der NordfasLuftschicht zwischen Rolladen und Fenster sade einen käq,F-Wert von rd. 2,0 W/m 2 K und im Mittel mit einem Wärmedurchlaßwiderin der Südfassade einen Wert von ca. stand von 0,22 m 2 K/W gerechnet werden. 1,1 W/m2K. Der Wärmedurchgangskoeffizient eines Der in Gleichung (6) angegebene Wert des Fensters mit Doppelverglasung hat tags Strahlungsgewinnkoeffizienten von z. B. einen k F-Wert von 3,0 W/m 2 K, er ver1,2 W/m 2 K ist nur ein Näherungswert, da bessert sich dann durch den Rolladen die Ausnutzung des Strahlungsangebotes nachts auf einen kF-Wert von 1,8 W/m2K. von der Bauweise und somit auch vom Wärmeschutz abhängt. Bei zehn Dunkelstunden ergibt sich nach Gleichung (8) ein Tagesmittelwert von Bei gut wärmegedämmten Gebäuden ist die kF = 2,5 W/m2K. Strahlungsausnutzung geringer als bei Gebäuden mit hohem Wärmebedarf; mit gröDer Äquivalentwert sinkt dann entspreßerem Fensteranteil an der Fassade nimmt chend Gleichung (5) auf: der Strahlungsgewinnkoeffizient ebenfalls Nordfenster: 1,5 W/m2K ab. Südfenster: 0,6 W/m2K 35 Temporärer Wärmeschu 2.z GRUNDLAGEN Energiebilanz von Gebäuden, vereinfachte Berechnungsverfahren Proportionalitätsfaktor x, zur Bestimmung des äquivalenten Wärmedurchgangskoeffizienten Äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient von Außenwänden Bei nichttransparenten Außenflächen kommt man in der Regel mit einem einfachen Proportionalitätsfaktor x r zur Bestim-. muh des äquivalenten W armedurchgangskoeffizienten [3] aus: kaq,W = X r ' kW (9) mit xr: Reduktionsfaktor O Nord und dauernd xr — 0,94 verschattete Flächen: xr — 0,91 O Ost/West: xr — 0,88 O Süd: xr' 0,88 O Horizontal: O Mittelwert (meist xr — 0,90 ausreichend): Die Wärmeverluste von Außenwänden reduzieren sich danach aufgrund der Sonneneinstrahlung im Mittel um 10%. Bei gut wärmegedämmten Außenwänden ist zwar der Wärmegewinn geringer als bei schlecht gedämmten Wänden, der prozentuale Anteil an den Wärmeverlusten ist jedoch praktisch konstant. ^ Richtwe rte für den jährlichen Heizwärmebedarf Mi tt lerer äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient Mit Hilfe des äquivalenten Wärmedurchgangskoeffizienten der Einzelbauteile läßt sich auch - sinngemäß nach der WSchVO oder der DIN 4108 - der „mittlere äquivalente Wärmedurchgangskoeffizient käq,m" für die wärmeübertragende Gebäudeumfassungsfläche A eines Gebäudes ermitteln: k ä q ,m = Abweichung von Richtwerten durch extreme auße matische Verhältisse oder Nutzerverhalten Verkürzung der Heizperiode bei größeren Fenstern Setzt man für neuere Wohngebäude folgende mittlere Werte zugrunde LW -- 0,7 h-1 Vb/V -- 0,7 läßt sich die Formel (11) vereinfachen zu Qa V+0,16) Gt 1000 ininkWh/m 3 a (12) oder bezogen auf eine m 2 -beheizte Wohnfläche Ab (Wohnfläche, die beheizt werden kann): Gt in kWh/m2a (13) b=(84 • käq , m +14) 1000 A wobei vorausgesetzt wurde, daß Ab -^ 3,5 m ist. Mit den Näherungsformeln (11) bis (13) lassen sich sowohl die außenklimatischen als auch die gebäudebedingten Einflüsse, aber auch indirekt über die Gradtagszahl ein Teil der benutzerbedingten Einflüsse berücksichtigen. Als Richtwerte für den jährlichen Heizwärmebedarf lassen sich folgende Bereiche angeben_ (Werte bezogen auf eine m 2-beheizte Wohnfläche Ab): günstige Bauweise unter ungünstige Bauweise über 220 kWh/m 2 a + 0,5 • k G • AG + kpL Apo über unter über (10) mittlerer stündlicher Luftwechsel während der Heizperiode in h-t beheiztes Raumvolumen in m3 Gradtagszahl in K • d/a (siehe VDI 2067, Blatt 1, Entwu rf Dez. 1979) z. B.: Berlin: Bremen: Essen: Frankfurt: Hamburg: 36 Stuttgart: unter Qa = ( kaq,m • V + CL PL LW • Vb) • Gt 1000 (11) inkWh/m 3 •a mit CL ' PL : spezifischer Wärmeinhalt von Luft (0,33 mW3h K) Gt: München: Nürnberg: Saarbrücken: 160 kWh/m 2 a Jahresheizwärmebedarf Jahresheizwärm/e^- Der Jahresheizwärmebedarf Qa eines Gebedarf-Qa -- bäudes pro m 3 umbauten Raums V!äßt sich dann bestimmen nach: Vb: Gt = 3782 K d/a Gt = 3226 K • d/a Gt = 3409 K d/a Gt = 3692 K • d/a Gt = 3223 K • d/a Gt = 4046 K • d/a Gt= 391 6K•d/a Gt = 3471 K • d/a Gt = 3434 K • d/a freistehende • k äq,D • AD+ k ää, W • A W +kaq,F • AF+0,8 A A dabei bedeuten die Indizes: W: an Außenluft angrenzende Außenwände F: Fenster D: Dach G: Grundfläche des Gebäudes, soweit sie nicht an die Außenluft grenzt DL: Deckenfläche, die das Gebäude nach unten gegen die Außenluft abgrenzt LW: Hannover: Heidelberg: Karlsruhe: Kassel: Köln: Einfamilienhäuser Reihenhausanlage Stadthäuser u. ä. Mehrfamilienhäuser über 3 Geschosse 125 kWh/m 2 a 100 kWh/m 2 • a 180 kWh/m 2 a 130 kWh/m 2 • a Selbstverständlich können im Einzelfall Abweichungen von diesen Richtwerten. bedingt durch extreme außenklimatische Verhältnisse oder Nutzerverhalten auftreten. Jahreszeitlicher Verlauf des Heizwärmebedarfs Der Jahresheizwärmebedarf ändert sich nach Abb.17 bei unterschiedlicher Fenstergröße aber sonst gleicher Bauweise kaum. Der jahreszeitliche Gante di ff eriert jedoch nicht unbeträchtlich. Durch das geringe Strahlungsangebot in den Wintermonaten November bis Februar dominieren die Wärmeverluste. Bei größeren Fenstern steigt somit auch der Heizwärmebedarf in diesem Zeitbereich. In der Übergangszeit wird dies wieder durch die höheren Wärmegewinne aus der Sonneneinstrahlung kompensiert. Die Heizperiode wird daher bei größeren Fenstern und sonst gleicher Bauweise verkürzt und der Wärmebedarf auf die reinen Wintermonate konzentriert. Gt = 3809 K d/a Gt =3703 K • d/a Gt = 3470 K • d/a Dies ist insbesondere bei Heizungsanlagen Gt = 3387 K • d/a mit Wärmepumpen, die Umweltwärme nutGt = 3837 K • d/a zen, von Bedeutung; denn der Deckungs- der Wärmepumpe am Heizwärmebedarf wird bei den bivalenten Systemen zwangsläufig verringert. Das bedeutet tenvon Wärmepumpen daß bei nicht z u groß sein soll-^ die d Fensterflächen _ ist eine Verkürzung der ererseits ten. And Heizperiode für konventionelle Heizsysteme von Bedeutung, da hierdurch die nicht unbedeutenden Erzeugungs- und Verteilungsverluste im Sommerhalbjahr vermieden werden können. e) Der monatliche Heizwärmebedarf —Monat ermittelt sich dann zu (14) QMonat = (1 — D) • WV zu a): Die monatlichen Wärmeverluste errechnen sich zu Fensteranteil an der Außenfassade , ^ — zu b): Die monatlichen Wärmegewinne durch transparente Flächen, z. B. Fenster, lassen sich ermitteln aus: anteil 2, !o °r !F-. , 2,0 1,5 '^ I 7 M Wärmepumpen und konventionelle Heizung In der Regel sind jedoch die Einstrahlwerte auf vertikale Flächen nicht verfügbar. Hier kann man sich behelfen, indem man über die Globalstrahlung (Strahlung auf horizontale Fläche) nach Abb. 20 und dem mittleren Verhältnis der monatlichen Sonneneinstrahlung auf vertikale Flächen zur Globalstrahlung nach Abb. 21 die Sonneneinstrahlung auf die jeweilig betrachtete Fläche ermittelt. 0,5 ä I 4 Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Reihenmittelhaus A/V =0 ,58 m2/m2 k -2,8 W/m 2 K Zweifach- Isolierverglasung Fensteranteil an der Außenfassade ca. 20% ca. 50% km-Wert [W/m 2K] 0,96 0,71 1,77 Jahreswärmebedarf [kWh/m 2] 1,74 Luftwechsel [1/h] 0,7 0,7 Jahresgang des Heizwärmebedarfs in Abhängigkeit vom Fensteranteil Tage 1979) onat (siehe VDI 2067 Blatt 1 von 1979 K• Energiebilanz von Gebäuden, vereinfachte Berechnungsverfahren (16) WG = g • (1—f) AF • Is in kWh/Monat mit g: Gesamtstrahlungsdurchlässigkeit des Glases f: Rahmenanteil an der Fensterfläche Is: monatliche Sonneneinstrahlung auf die Fensterfläche in kWh/m 2 • Mt. 1,0 0 WV = (k m • A + C L • p L • LW • Vb) • GtMonat ' 24 1000 (15) in kWh/Monat mit GtMonat: monatliche Gradtagszahl in 2.2 GRUNDLAGEN 19 Monatliche Ergiebigkeitsbilanz von Gebäuden Zur rechnerischen Erfassung der jahreszeitlichen Veränderungen reicht die beschriebene Jahresbetrachtung nicht aus. In der Regel muß man dann zumindest auf Monatswerte übergehen. Eine monatliche Betrachtungsweise ist in der Regel nur bei folgenden Voraussetzungen erforderlich: O hoher Glasanteil an der Fassade (über ca. 30%), O Solararchitektur, z. B. Wintergarten, Trombe-Wände, „Haus im Haus"Systeme und O Ausnutzung von Umweltenergie mittels Wärmepumpen. Auch hierfür läßt sich ein vergleichsweise einfaches Berechnungsverfahren angeben. Die Vorgehensweise läßt sich wie folgt beschreiben [4] [5]: a) Ermittlung der monatlichen Wärmeverluste WV durch Transmission und Lüftung. b) Ermittlung der monatlichen Wärmegewinne WG durch Sonnenemstrahlung, abhängi9von der Himmelsrichtung und evtl. auch durch innere Wärmequellen. c) Ermittlung des Verhältnisses der monatlichen Wärmegewinne zu -den monatlichen Wärmeverlusten WG/WV. d) Abschätzung des Anteilstier monatlichen Wärmeverluste, die durch die Heizungsanlage gedeckt werden müssen. Dies erfolgt mit Hilfe der sogenannten solaren Deckungsrate D", die angibt, um welchen Anteil die Wärmeverluste durch Ausnutzung von Wärmegewinnen reduziert werden können. Für nichttransparente Flächen, also z. B. Außenwände und Dächer, läßt sich der Wärmegewinn mittels einer Näherungsformel für das Verhältnis Wärmegewinn zu Wärmeverlust WG/WV ebenfalls angeben: WG _ (1— p) • Is • 1000 (17) WV aa • GtMonat • 24 mit P° mittlerer Reflexionskoeffizient der nichttransparenten Fläche (meist p — 0,3) aa = mittlerer Wärmeübergangskoeffizient auf der Außenseite der Außenfläche in W/m 2K (meist aa 20 W/m2K). Jahresmittelwert: Mittel Sept. bis Mai: 55 - 65 kWh/m 2 Mt Mittel Okt. bis April: 40 - 50 kWh/m 2 Mt 200 kWh m2Mt 150 Monatliche Energiebilanz m = Wärmegewinne 100 m Wärmeverluste ^ ä0 Solare Deckungsrate C7 L• ' 50 Heizwärmebedarf m C E a) o Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep Okt. Nov. Dez. Mittlere monatliche Globalstrahlung (Werte nach DIN 4710 von 1979) 20 37 Z.2 1,75 q / /i m 0,75 ,1 - exp (— WG /WV) 1,50 Y 0,50 0 GRUNDLAGEN Energiebilanz von Gebäuden, vereinfachte Berechnungsverfahren 1,00 _^/ ^ q a,0,25 1,25 0) 0 0 0,5 1,0 1,5 '2,0 monatliche Wärmegewinne = WG WV monatliche Wärmeverluste 1,00 Solare Deckungsrate in Abhängigkeit vom Verhältnis Wärmegewinne zu. Wärmeverluste 23 Die hier quantifizie rt en Rechenverfahren erreichen ihre Grenze bei extremer passiver Solarnutzung wie z. B. Haus im Haus" oder andere Sonnenhäuser. Für diese Sonder- 0,50 0,25 bauformen muß man auf Tages- bzw. Stundenbetrachtungen zurückgreifen [2]. 0 Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt Nov Dez Mittlere monatliche Sonneneinstrahlung auf vertikale Flächen (bezogen auf die Globalstrahlung) 21 Mit Hilfe von Abb. 22 kann man für horizontale Außenflächen die monatlichen Verhältniswerte für WG/WV unmittelbar ablesen. Mittels Abb. 21 lassen sich dann auch die Verhältnisse für ve rt ikale Flächen angeben. as = 20 W/m2K 0 p = 0,3 Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep.Okt. Nov. Dez Klimadaten nach DIN 4710 von 1979 Wärmegewinn durch Sonneneinstrahlung bei horizontalen nichtt ransparenten Außenflächen 22 Mit Gleichung (17) kann man nicht nur übliche Außenwände berücksichtigen, sondern auch „Exoten", wie z. B. die Trombe -Wand. Vor der massiven Außenwand ist hierbei als Strahlenfalle eine Glasscheibe angeordnet und somit die Außenwand als Absorber ausgebildet. Entsprechend ist in Gleichung (17) im Zähler die absorbierte Sonneneinstrahlung und im Nenner anstelle des Wärmeübergangskoeffizienten aa der Wärmedurchgangskoeffizient k F der Glasscheibe einzusetzen. Entsprechendes gilt auch bei Verwendung von thermischen Pufferzonen wie Wintergärten u. ä. zu d): Der Zusammenhang zwischen der solaren Deckungsrate D und dem Verhältnis monatliche Wärmegewinne zu Wärmeverluste WG/WV läßt sich aus Abb. 23 entnehmen oder aus der Näherungsformel D = 1 — exp (— WG/WV) Literatur [1] Gertis, Hauser, Künzel, Nikolic, Rouvel, Werner: „Energetische Bewe rtung von Fenstern während der Heizperiode" Deutsches Architektenblatt, Heft 2/80, S. 201/202 [2] Rouvel, L.: „Raumkonditionierung - Wege zum energetisch optimie rten Gebäude" Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1978 [3] Rouvel, L.; Wenzl, B.: „Kenngrößen zur Beu rteilung der Energiebilanz von Fenstern während der Heizperiode" HLH 30 (1979), Nr. 8, S. 285/291 [4] First European Passive Solar Competition 1980 Calculation Booklet. Commission of the European Commites, Directorate General XII for Research, Science & Education [5] Rouvel, L.: „Energiekennzahlen von Gebäuden" in: Schriftenreihe der Forschungsstelle für Energiewi rtschaft, Band 14 Springer Verlag Berlin, Heidelberg, New York 1981, S.117/132 (18) Kurzbiografie des Autors Prof. Dr.-Ing. habil. Lothar Rouvel, Professor an der Technischen Universität München für das Fachgebiet Energietechnik und Energieversorgung. Forschungsarbeiten über' - Rationelle Energieverwendung und -versorgung für Großbauten, Energetische und wirtschaftliche Optimierung im Bereich der Haustechnik unter Einbezug der Gebäudegestaltung, - Energie- und Leistungsbedarfsanalysen für Einzelobjekte, Regionen und Volkswi rtschaften, - Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Entwicklung von Versorgungskonzeptionen sowie integrierter Systeme bei der Energieanwendung für Regionen und große Einzelobjekte im Bereich der Industrie, des Gewerbes, der öffentlichen Hand und des Haushaltssektors. Redaktionelle Bearbeitung und Layout Dipl.-Ing. Faskel, Koordination Vladimir Nikolic. PRAXISINIORMAflON GEBÄUDE INERCIEEINSPARIING nLA&III&IP VIZ° der Bundesarchitektenkammer durchgetuhrt im Auftrage des Bundesministersums fur Städtebau Raumordnung und Bauwesen 3111 Ein F örschungsvorhaben GEBÄUDEPLANUNG ser. Bernd G Faskel, Viadimiriyiknitc Der Stellenwert, den die Planungsdimension Energie bei der Gebäudeplanung haben kann und soll, ist von Fall zu Fall von der Bauaufgabe abhängig und auch von der Fähigkeit des Architekten oder Planers, sich mit dieser Planungsdimension auseinanderzusetzen. Eine Überbewertung mit der Tendenz zu einer „Energiearchitektur" ist momentan eher als Überreaktion auf eine unsichere Situation zu verstehen. Sicher ist jedoch, daß Energie als selbstverständliche und gleichberechtigte Planungsdimension für Architektur und Städtebau zumindest mittelfristig nicht mehr wegzudenken ist. Jedes Gebäude kann - ohne Mehrkosten - nach energetischen Gesichtspunkten geplant werden. Ohne Mehrkosten bedeutet, daß vor allem in der ersten Planungsphase eine Reihe von Entscheidungen getroffen werden müssen die später in der Detailplanung und bei der technischen Ausstattung den Energiebedarf erheblich beeinflussen_ und vermindern. Häufig werden noch heute Neuplanungen erst bei der Ausführungs- und Detailplanung auf ihre betrieblichen Aufwendungen, so auch auf ihren Energiebeda rf untersucht, was Umprojektierungen mit den dazugehörigen Kosten verursacht. Daher da rf Energieeinsparung in der frühen Planungsphase weder nur als ein technisch-apparatives noch als baukonstruktives Problem verstanden werden, sondern als ein rein planerisch-entwurflicher Aspekt behandelt werden. Dazu gehören Maßnahmen wie z. B. die Proportion, Orientierung und Zonung eines Gebäu des sowie die Möglichkeiten der Sonnenenergienutzung, die mit planerischen und entwurflichen Mi tt eln zu erreichen sind. Klimaeinflüsse Gebäudeform Geländeeinbindung,. Ausrichtung Orientierung Grund- und Aufriß Verschattung Gebäudehülle Freiraumplanung Lageplan Standortplanung Grundrißzonung Entwurf Gebäudeplanung Wärmeschutz Sonnennutzung Konstruktion Detailplanung Gesamtkonzeption Der Energiebeda rf eines Gebäudes richtet sich nach seiner Energiebilanz. Energieeinsparung bedeutet also, die Wärmeverluste des Gebäudes zu minimieren und die natürliche Wärmegewinnung zu optimieren. Die Wärmeverluste sind von dem Temperaturunterschied zwischen der gewünschten Rauminnentemperatur und der Außentemperatur sowie von der Wärmedämmqualität der Begrenzungsflächen abhängig. Der Wärmefluß findet vom höheren zum niedrigeren Energieniveau statt, in unserem Klima meist von innen nach außen. Die Außentemperaturen werden vom Lokalklima bestimmt. Die Innenraumtemperaturen richten sich nach nutzungsspezifischen Behaglichkeitskriterien, die das Wohlbefinden des Menschen im Gebäude garantieren sollen. Der Planung kommt somit die Aufgabe zu, das Gebäude dem vorgegebenen natürlichen Energiepotential anzupassen, also durch planerische Maßnahmen Entwurfskonzeptionen zu entwickeln, bei denen Energiegewinnung, Wärmespeicherung und -bewahrung ein Optimum darstellen. Neben den planerischen und baulichen Maßnahmen des Wärmeschutzes, die in den Praxisinformationen 1. Stadtplanung und 4. Baukonstruktion ausführlich behandelt sind, lassen sich die entwurflichen Maßnahmen, von denen die Energiebilanz eines Gebäudes abhängig ist, in folgende zwei Kategorien unterteilen: Wärmeverluste minimieren, Warmegewir:ne optimieren Planungsdimension Energie Berücksichtigung schon in der ersten Planungsphase 1. Verringerung der Wärmeverluste O Form und Orientierung des Baukörpers, Reduzierung der Hülifläche, O Grund- und Aufrißgestaltung, O Grundrißzonung nach thermischer Hierarchie, Verringerung der Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen. 2. Nutzung der Sonnenwärme O Energiegewinne durch aktive solare Systeme, O passive Sonnenenergienutzung, O Speicherung der eingestrahlten Sonnenenergiegewinne im Bauwerk. Form und Orientierung Energetisch günstige Gebäudeformen sind solche, die durch richtige Anordnung und Größe ihrer Obe rf lächen den Wärmetransmissionsverlust minimieren. Dabei ändert sich der Wärmeverlust proportional_zur Oberfläche, wobei-der Anteil der Grundfläche nocii eine Rolle spielt, da der Wärmeverlust an das Erdreich geringer ist. Die geometrische Form der Kugel hat dabei die geringsten Wärmetransmissionsverluste, da das rKugelvolumen mit der propo rt ional kleinsten Flä, che zu umhüllen ist. Nicht nur die Grundgebäudeformen bestimmen das Verhältnis ^, sondern jede Art plastischer Fassadenteile wie Loggien, Erker, Durchgänge usw. vergrößern die Gesamtoberflächen und führen zu einem ungünstigeren 0-Verhältnis. 39 Wärmeverlust propo rt ional zur Oberfläche 3. Halbkugel Zylinder Pyramide Grund- und Aufrißgestaltung, Grundrißzonierung Unter dem°Begriff „Zonung" wird ein Konzept verstanden, das von einer _ Grundriß- und Raumdisposition ausgeht, in der Räume nach Wärmezonen differenziert sind, mit dem Ziel, den Energieaufwand für die Raumbeheizung zu reduzieren. Räume, de re n spezielle Nutzung eine niedrigere Temperatur erlaubt, umschließen Räume, deren Nutzung eine höhere Raumtemperatur e rfordert, also eine Grundrißzonung nach differenzierten Temperaturbereichen; Die wärmsten Räume geben ihre Wärme an die nächstkühleren ab und so fort. Ganzer Würfel GEBAUDEPLANUNG Gesamtkonzeption Oberfläche bei gleichem Volumen in Differenzierung nach Wärrnezonen halber Würfel mit 4 Einheiten kompakt getrennt gereiht gestapelt Oberflächenoptimierung Der Wärmeverlust sinkt proportional zur Reduktion der Oberfläche 2 Grundrißzonung 4 -Verhältnis Bei dem Entwu rf gilt es also abzuwägen, ob die Vergrößerung des;,-Verhältnisses zugunsten gestalterischer, funktionaler oder sonstiger relevanten Entwurfskriterien verschoben wird, wobei jedoch extreme Formen mit besonders hohem Flächenanteil aus energetischen Gründen vermieden werden sollten. Die mögliche Wärmeaufnahme durch Sonneneinstrahlung da rf nicht unberücksichtigt bleiben, deswegen sollte in Verbindung mit der Maximierung eingestrahlter Sonnenenergie das Verhältnis von sonnenbestrahlter Gebäudeoberfläche zu den Schattenflächen tendenziell zugunsten der Sonnenflächen verschoben sein. Die Öffnung zur Sonne bedingt eine strikte Südorientierung des Gebäudes sowie eine Maximierung der sonnenzugewandten Flächen (SO - S - SW) und eine Minimierung der sonnenabgewandten Flächen. Die so entstehende „Süd-Form" stellt idealisiert einen Trichter dar, sowohl im Grund- als auch im Aufriß. Räume mit abwärmeerzeugenden Geräten oder Installationen, wie die Küche mit Herd, Kühlschrank usw. und das Bad mit Waschmaschine und Warmwassergeräten, und Räume mit hoher Raumtemperatur sollten möglichst im Innenbereich angeordnet werden. Die Wohnräume sollten sich um diese wärmsten Räume (schalenförmig) gruppieren und von weniger warmen Räumen oder Raumzonen nach außen abgeschirmt werden. Dieser Bereich wird als „thermische Pufferzone" bezeichnet. Der Wärmeverlust eines Raumes ist in erster Linie abhängig von dem Verhältnis seines Volumens zum Außenflächenanteil. Eckräume, und ganz besonders die im Obergeschoß, haben größere Wärmeverluste als Räume mit nur einer Außenwand. Schließlich spielt die Proportion des Raumes selbst auch eine erhebliche Rolle. 1 Außenwand 4 Außenwände 2 Außenwände 5 Außenwände 3 Außenwände 6 Außenwände Grund- und Aufrißgestaltung 5 Form und Orientierung Die Hauptwindr'chtung sollte Einfluß auf Form und Orientierung haben, da Wind und Regen erhebliche Energieverluste bewirken können. Siehe dazu auch Praxisinformation 1.1 Stadtplanung. 40 Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens des BMFT Bau und Energie (Nikolic, Rouvel) zeigen eindeutig, daß die Lage des Raumes am Gebäude - mittlerer Raum - Dacheckraum - den Energieverbrauch wesentlich stärker beeinflußt als die Orientierung des gleichen Raumes zu unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Ein mittlerer Raum —Basisraum - orientiert nach Norden, hat einen ca. 17% höheren spez. Wärmebedarf als der gleiche Raum mit Orientierung SCJden. Dagegen ist der spez. Wärmebedarf des mittleren Raumes um über 80% geringer als der Wärmebedarf des Dacheckraumes bei identischen Orientierungen. Als Pu fferzonen sind sowohl die Erschließungsflächen wie die Nebenräume als auch Wintergärten und zeitlich begrenzt genutzte Räume zu betrachten. Verglaste Bereiche außerhalb des beheizten Volumens können mit dem Zwischenraum von Dreifachverglasungen verglichen werden, der erweitert und benutzbar ist. In kalten Jahreszeiten kann man sich in den Kernbereich der Wohnung zurückziehen. Es brauchen nur Teilbereiche der Wohnung beheizt zu werden. So ist es möglich, den Nutzungsbereich der Wohnung individuell und saisonalbedingt zu vergrößern oder zu verkleinern. Direkte Strahlung Diffuse Strahlung ! 3.1 GEBAUDEPLANUNG Gesamtkonzeption / / / / 1 / r —10 Spezifischer Jahreswärmebedarf in % (100% = 83 kWH/QM A) +,22° Süden +20° +20° +10° Norden Sonniger Wintertag, Heizung des Gebäudes durch gezielte Lüft ung von Süden nach Norden Daraus folgt, daß die Gebäudegeometrie einen stärkeren Einfluß auf die Energiebilanz hat als die Orientierung zu Himmelsrichtungen. Bei der Gestaltung energiesparender Gebäude müssen diese Erkenntnisse berücksichtigt werden. Der Energiehaushalt von solchen peripheren Räumen kann entweder durch konstruktive Maßnahmen - bessere Wärmedämmung der Außenflächen, wärmetechnische Verbesserung der Fensterflächen usw. - oder noch wirkungsvoller durch Anordnung von thermischen Pu fferzonen u. ä. beeinflußt werden. Gebäudegeometrie hat stärkeren Einfluß auf Energiebilanz als die Orientierung ,,,,^ , ^,,,,, , , „ //I/ , y ^ n77„, , , , , ^ ., , /, ///1////1”, „,, , ; y y +20° Suden Norden Bedeckter Wintertag, Verringerung der Lüftungswärmeverluste durch Pufferzonen Durch verglaste thermische Pu fferzonen um die beheizte Fläche wird der spezifische Wärmebedarf wesentlich gesenkt. Die Di ff erenz des spezifischen Jahreswärmebedarfes zwischen Eckräumen mit und ohne Puff erzonen beträgt bei Nordorientierung 69% und 65% bei Südorientierung. Die Anordnung von thermischen Puffe rzonen bringt höhere Energieeinsparupg für das ganze Haus, als eine ausschließliche Orientierung aller Räume nach Süden. —10° —10° Suden Das Haus-im-HausPrinzip mindert den spezifischen Wärmebedarf stärker als die Südorientierung aller Räume Veränderung des spezifischen Jahreswärmebedarfes durch Anordnung einer thermischen Pufferzone 7 Thermische Pufferzonen Norden Winternacht, Verringerung der Transmissionswärmeverluste durch Temperaturstaffelung 10 Die Wohnungen und deren Grundrisse sind so zu organisieren, daß natürliche Durchlüftung vom Süden zum Norden erfolgt. Es wird dadurch erreicht, daß die im Süden erwärmte Luft die nordorientierten Räume heizt und durch Frischluft in den Wohnräumen ersetzt wird. Dabei sollte die Frischluft in Wintergärten vorgewärmt werden. Es wird dadurch möglich, durch ein Minimum an haustechnischen Anlagen Gebäude mit optimaler Energiebilanz zu planen und zu bauen. Durch die Anordnung von thermischen Pu fferzonen wird somit nicht nur eine Verringerung der Transmissionswärmeverluste, sondern auch die Minimierung der Lüftungswärmeverluste erreicht. Verringerung von Transmissionsund Luftungswärmeverlusten 41 Winter 3., Minderung der Transmissions-Wärmeverluste transparenter und nicht transparenter Bauteile. Wirkung als Sonnenkollektor. Die übermäßige Abkühlung in der Nacht wird durch die Anbringung des temporären Wärmeschutzes an der Innenseite der äußeren Verglasung gemindert. Sommer Der temporäre Wärmeschutz übernimmt beim Sonnenschein die Funktion des Sonnenschutzes, die eingestrahlte Wärme wird durch entsprechende Öffnungen in der Fassade mittels eigener Thermik abgeführt — Kaminwirkung. Die Bepflanzung an der äußeren Seite der Pufferzone im EG und im 1. OG, sowie an der Innenseite im oberen Geschoß, übernimmt auch teilweise die Funktion des saisonalen Sonnenschutzes. GEBÄUDEPLANUNG Gesamtkonzeption Funktionen der Pufferzone 11 durch Sonnenkollektoren nutzbar gemacht, Luft-, Boden- und Wasserwärme über Wärmepumpen. Da es sich bei den aktiven Solarsystemen um haustechnische Anlagen handelt, deren Verteilungssystem auch in einer späteren Realisierungsphase konkretisiert werden können, da sie im Zusammenhang mit dem Hauptheiz-und Warmwasserbereitungssystem gesehen werden müssen, werden sie hier nicht weiter behandelt. Lage, Anordnung, Dimensionierung usw. dieser solaren Subsysteme sind nicht entwurfsentscheidend und müssen im Rahmen der AusführungsSonnenenergienutzung planung der Fachingenieure berücksichtigt werden. Neben den entwurflichen Maßnahmen zur VerrinBei der entwurflichen Integration aktiver Solargerung von Wärmeverlusten sind bei energiebesysteme sind lediglich die nach außen tretenden wußten Gebäudekonzeptionen die Möglichkeiten Bauelemente wie Sonnenkollektoren für die Geder Wärmegewinne durch Sonnenenergie zu'berücksichtigen. Bei der Nutzung der Sonnenenergie bäudekonzeption von Interesse, da hierfür bereits unterscheidet man grundsätzlich zwei verschiede- in der Planung bestimmte Entscheidungen bezügne Möglichkeiten, die „aktiven" und die „passiven" lich Orientierung, Größenverhältnis"sen, Beschattung, Dachneigung usw. fallen müssen. Die nötige Systeme. Kollektorflächengröße ist davon abhängig, wieviel Wärme man braucht, wie die Kollektoren und das Aktive Sonnensysteme Haus konzipiert sind und wo die Anlage geograDie bei den aktiven Systemen üblich gewordenen Anlagen e rfordern dafür spezielle Sonnenkollekto- phisch und klimatisch liegt. Für 100% Warmwasserbereitung in Mitteleuropa sind 7 m 2 bis 10 m2 ren und Wärmespeicher, Pumpen oder VentilatoKollektoren pro Haus ausreichend. Für Raumheiren, die zusammen mit einer besonderen Regelung für die Wärmesammlung, den Wärmetransport zung braucht man eine Fläche zwischen 30 m2 und 150 m2 , je nach Dämmwert und klimatischer und die Wärmeverteilung sorgen. Unter SonnenLage. Die Kollektorenneigung wird im allgemeinen energie wird hier nicht nur die direkte Sonnenfür winterliche Verhältnisse berechnet. strahlung verstanden, sondern auch die in der Als Erfahrungswerte gelten: Neigung = geographiLuft, im Boden und Wasser enthaltene Wärme, die sche Breite + 10° bis 15°. Wenn man die Koliekdirekt oder indirekt ebenfalls von der Sonnentoren nur im Sommer braucht, so gilt: Neigung = strahlung herrührt. Die Sonnenstrahlung wird geographische Breite - 15°. Südorientierung sollte für Sonnenkollektoren obligatorisch sein. Im Gegensatz zu Balkonen bieten thermische Pufferzonen durch eine fast ganzjährige Nutzung eine Erhöhung des Wohnwertes und können eine Verkleinerung von beheizten Wohnflächen kompensieren. Eine noch stärkere Reduzierung von peripheren Räumen an einzelnen Gebäuden kann durch räumliche Verbindung freistehender Mehrfamilienhäuser mittels gemeinsamer thermischer Pufferzonen erreicht werden (Hofüberdachungen, Passagen usw.). Sonnenkoilektoren Kollektorflächengröße 40 Kollektorneigung Typisches aktives Solar-Heizsystem 42 12 Solarabsorber - Energiedach Eine Variante oder Weiterentwicklung der herkömmlichen Sonnenkollektoren stellt der Solarabsorber dar. Dieser ist letztlich nicht anderes als ein Kollektor, bei dem die Wärmedämmung und Isolierverglasung demontiert wurde. Der entscheidende Unterschied zum Kollektor besteht darin, daß die Absorberfläche kälter gehalten wird als die Temperatur der Umgebungsluft. Dadurch kann der Absorber sowohl Strahlungsenergie als auch den Energiegehalt der Umgebung, das heißt Umgebungswärme, nutzbar machen. Die niedrige Oberflächentemperatur des Absorbers wird dadurch erreicht, daß er von einer kalten Flüssigkeit (Wasser und Frostschutzmi tt el) durchströmt wird. Die Temperatur der Flüssigkeit bleibt deshalb so niedrig, weil sie von einer Wärmepumpe ständig abgekühlt wird. Abkühlung bedeutet Wärmeentzug. Die entzogene Wärme wird durch die Wärmepumpe von dem niedrigen, für Heizzwecke nicht geeigneten Temperaturniveau auf ein hohes, für Heizzwecke brauchbares Niveau angehoben. Die Dachneigung und die Dachausrichtung sind für den Energiegewinn weniger entscheidend. Die Beschattung durch Bäume oder umliegende Gebäude hat bei weitem nicht den Einfluß wie bei Häusern, die mit Kollektoren ausgestattet sind. Die Probleme einer ästhetisch befriedigenden Einbindung in das Gebäude können wesentlich besser als bei Kollektoren gelöst werden. Das Energiedach ist wegen seiner einfachen Konstruktion wesentlich kostengünstiger als entsprechende Kollektorsysteme und bringt außerdem im Jahresdurchschnitt einen zwei-bis zweieinhalbmal höheren Energiegewinn. Durch die zusätzliche Funktion als Wetterschutz wird die normale Dacheindeckung eingespart, so daß die Kosten für ein Energiedach - im Gegensatz zum Kollektordach nicht wesentlich über denen einer normalen Dacheindeckung liegen. Dazu kommt allerdings ein erheblicher apparativer Aufwand. Nähere Angaben hierzu in Praxisinformation 5. Tech Wischer Ausbau. Passive Solarsysteme Eine Alternative zur aktiven Sonnenenergienutzung stellt die passive Nutzung dar, wobei die solaren Energiegewinne durch transparente Fassadenteile„ Dächer undWande aufgenommen und innerhalb der Bauteile gespeichert und weitergeleitet werden. Man spricht von „passiven Solarsystemen", weil sich dabei der thermische Energiefluß auf natürliche Weise vollzieht. Das heißt die hauptsächlichen Mechanismen des Energieflusses sind Konduktion (Leitung), Konvektion (natürliche Übertragung) und Radiation (Abstrahlung). Diese Definition schließt nicht die Verwendung von mechanischen Vorrichtungen für Steuerung, wie z. B. eine bewegliche Wärmedämmung, die dem jeweiligen Sonnenstand angepaßt wird, aus. Viele Systeme fallen unter die Kategorie „Hybriden-Systeme";_das sind Mischsysteme insofern, als sie entweder durch Ventilatoren, Pumpen oder anderes Gerät, das mechanischen oder elektrischen Antrieb verwendet, den thermischen Energiefluß anregen oder verstärken. Wie effektiv solche Geräte und Kombinationen sind, läßt sich nicht verallgemeinern, sondern hängt von den jeweiligen individuellen Bedingungen ab. Erst richtig orientierte Fenster, Glasveranden oder Wintergärten, Solarwände, sinnvoll angeordnete Oberlichter oder problemgerecht entworfene Dachkonstruktionen sowie eine wirkungsvolle Speicherung der Wärme in Bauteilen führen zu einer drastischen Verminderung des Heizenergiebedarfs eines Gebäudes. Man unterscheidet folgende Kategorien von passiven Solarenergiesystemen: a) direkte Nutzung, b) indirekte Nutzung - thermische Speicherung, c) thermische Pufferzonen - Sonnengewächshaus. Direkte Sonnenenergienutzung: Über die Hauptfenster- Uber die Hauptfenster- flächenfront und Oberlichter Ausschließlich über die Oberlichter Indirekte Sonnenenergienutzung: Über vertikale Über massive Stein- oder Betonwände (Trombe-Wand), Wasserbehälter Über horizontale Wasserbehälter Das Sonnengewächshaus: Vor der verglasten Fassade Vor der geschlossenen Speicherwand Vor den Fenster- oder Türöffnungen als thermischer Puffer Die unterschiedlichen Kategorien passiver Sonnenenergienutzung 13' 43 Gesamtkonzeption Hybriden-Systeme Kategorien von passiven Solarsystemen Energiegewinne durch transparente Fassadenteile, Dächer und Wände 3.1 GEBÄUDEPLANUNG Gesamtkonzeption Große Temperaturunterschiede Speicherung und Vermeidung von Abstrahlung Nutzungserweiterung Direkte Nutzung Der direkte Weg zur Gewinnung passiver Solarwärme ist der einfachste und meist angewandte. Die durch ein Südfenster eindringende Wintersonne wird in den Wohnräumen des Gebäudes absorbiert und im Gebäude massie rt gespeichert. Ist die Energiegewinnung am Tage größer als verwendet werden kann, ist eine Wärmespeicherung unerläßlich, damit die Wärme vom Tage in der Nacht genutzt werden kann. Das tritt dann ein, wenn der Heizanteil durch Sonnenenergie größer als 40% ist. Je größer die gewünschten Heizanteile werden, desto bedeutsamer wird auch die Rolle der Wärmespeicherung. Die Charakteristika eines Hauses mit „Direkt-Ausnutzung" sollte man kennen, bevor man sich an den Entwu rf begibt. Der direkte Sonneneinfall in das Gebäude gibt ein kräftiges, direktes Licht, verursacht Blendung und hat einen zersetzenden Einfluß auf Gewebe. Naturstoffe müssen verwendet werden, die in der Sonne nicht bleichen und zerfallen. Gebäude für „Direkt-Ausnutzung" weisen ziemlich große Temperaturunterschiede auf. Diese einfachste Art, die Sonnenenergie direkt über die Fenster zu nutzen, sollte nicht unterschätzt werden. Große Fensterflächen in richtiger Orientierung und Ausbildung verwandeln das Fenster vom „Kälteloch" in eine Wärmefalle. Voraussetzung jedoch ist die Speicherung und die Vermeidung der Abstrahlung der tagsüber aufgenommenen Sonnenenergie. Dies stellt Anforderungen an die Speicherfähigkeit der Raumbegrenzungsflächen, also Fußböden und Wände und setzt einen temporären Wärmeschutz voraus, um die Wärme zu „halten". •'lrrO i'P rri b•rNrONi rlrrr^S`i rrPtiMPi•P.4`P4JOi'P • r' • ^ • • • • • "•"^ 'i Luftheizung durch natürliche Querlüftung s^^ tPi'►0't'P^'i4iAriYi'^'idi'Pd^'^'JA^I7NIPdlOSPiit$'a*PAt^`^'^^;* • Die durch die transparente Schale eingestrahlte Sonnenwärme wird in der Massivwand (Beton, Ziegel) gespeichert und/oder direkt bei Beda rf durch Konvektion in das Gebäudeinnere geleitet. Die Beheizung des Raumes e rfolgt dabei durch Auffüllung mit warmer Luft von oben. :rrriWrrdtt ^ rPairaYPP4i`AA•i•.'i'CCPi'i•'P.'OWWJNNlt^'dPA'C.'Mt.hS4'.O^fdr^'d ^ '" • ql J ^M' 11 0 J i`A `i• d r i i d i •' / ^` ^ A P r ^'e'^ riY.'! ^ t .' Q 0 d !•' P i d ^@ A1`ii • - % Indirekte Sonnenenergienutzung Thermische Speicherwand Das Sonnengewächshaus Eine Mischung aus „direkter Nutzung" und „thermischer Speicherung" stellt das Prinzip des Sonnengewächshauses dar. Es wird durch extensive Verglasung zur direkten Nutzung eingerichtet, während der anschließende Wohnbereich von dem Gewächshaus oder Wintergarten getrennt ist. Das Prinzip ist im Grunde das gleiche wie bei einem Gebäude mit Trombe-Wand-Effekt, mit dem zusätzlichen Vorteil, daß es nicht nur energetische Funktionen hat, sondern daß der Orientierung und den Jahreszeiten entsprechende funktionale Nutzungserweiterungen der Wohnfläche erreicht werden. Besonders während der Übergangszeit können vorgelagerte südorientierte Gewächshäuser oder Wintergärten als Wärmeerzeuger für eine wohnungsinterne Luftheizung dienen. Dabei ist anzustreben, daß die im Gewächshaus infolge Sonneneinstrahlung erwärmte Lu ft durch natürlich e Querlüftung die gesamte Wohnung erwärmt. Bei fehlender Sonneneinstrahlung während der Nachtstunden dient die verglaste Loggia oder das Anlehngewächshaus als Puffer zwischen Innenund Außenklima und sorgt für einen geringeren Wärmeverlust der Wohnung. Ein besonderes Problem bei der Wärmegewinnung durch große südorientierte Glasflächen liegt im Wärmeüberschuß während des Sommers. Indirekte Nutzung – Sonnenschutz Daher ist auf wirkungsvollen Sonnenschutz und Thermische Speicherung Vermeidung_ ausreichende Querlüftung zur Vermeidung unerDie nächste Klassifizierung von passiven Solarunerwünschter wünschten Wärmestaus zu achten. systemen ist die thermische Speicherwand. Eine Wärmestaus Speicherwand hat die Fähigkeit, Wärme aufzuneh- Ebenso wichtig zur Verbesserung der EnergieTemporärer men und diese zeitlich verschoben wieder abzuge- bilanz sind temporäre Wärmeschutzmaßnahmen Wärmeschutz um den nächtlichen Wärmeäbfluß zu verringern. ben. Diese Eigenschaft machte man sich in den Gegenden mit starken Temperaturdifferenzen zwi- Siehe hierzu Praxisinformation Baukonstruktionen Fenster 4.4. schen Tag und Nacht beim Häuserbau zu eigen. Dicke, massive Steinwände können zum Beispiel tagsüber die Sonnenwärme speichern und sorgen somit für eine relativ kühle Raumlufttemperatur. - , 0i C eaten: r 1 C 1 ^`^' r " • Nachts geben sie die gespeicherte Wärme an die ^ ii, ^ Dämpfung von Raumluft wieder ab und dämpfen somit die extreextre; en Temperaturmen Temperaturschwankungen. Durch die Kombischwankungen nation mit Glasflächen läßt sich die Wirkung der eingestrahlten Sonnenenergie noch verstärken. Eine dunkel gestrichene Wand, die gegen die ---^— Außenluft mit einer Verglasung oder transparenten rlilr NA'tllM aot r^I Kunststoffverkleidung abgedeckt ist, kann als wirksames Kollektor/Speicher-Element zur Nutzung der Sonnenenergie verwendet werden (TrombeWand). r%' 44 ►' ^i• ^d i^ ^'i ^^i ^ i` ^4'i'P ^ P i ^' ^^ @ C N^ Ji' Q t • ^ • ^ ^ ' • • Wärmespeicherung Eine wichtige Voraussetzung zur optimalen Ausnutzung der eingestrahlten Sonnenenergie ist die Wahl wärmespeichernder Konstruktionen. Dadurch wird außerdem eine den Komfort steigernde thermische Trägheit des Gebäudes erreicht. Im Sommer wird es selten zu einer hohen Übertemperatur kommen und im Winter können die Wände Wärme aufnehmen und bei fehlender Sonneneinstrahlung am Abend wieder an den Raum abgeben. Neben dem positiven Einfluß auf die Nutzbarmachung eingestrahlter Sonnenenergie muß das angenehme Raumklima wärmespeichernder Konstruktionen erwähnt werden. Bei Sonneneinstrahlung steigt die Raumlufttemperatur an. Ein großer Teil der Energie wird von den Baustoffen der Raumumschließungsflächen aufgenommen und gespeichert. Nacht Wärmespeicherung 17 Nach Beendigung der Sonneneinstrahlung und sinkender Raumlufttemperatur wird die Wärme von den Wänden wieder abgegeben. Zusätzliche Energieeinspeisung durch die Heizungsanlage wird erst mehrere Stunden später erforderlich. Die Speicherung der sommerlichen Strahlungswärme in den Bauteilen wirkt sich auf das Raumklima vor allem in zweierlei Hinsicht aus: 1. Amplitudendämpfung, das heißt die im Innenraum entstehenden Temperaturspitzen sind bei wärmespeichernden Bauweisen beträchtlich niedriger als bei Leichtbauweise; 2. Phasenverschiebung das heißt die Spitze der Innenraumtemperatur liegt erheblich später als die Zeit der größten Sonneneinstrahlung. Optimal: zwölf Stunden. Phasenverschiebung 01 n►.i^^^m^^m^^r wi! •^►^^^^^^^^V C111111111111111111111111111,C1 t•^l•^^^/^1^I•^l,r ^^ENI•\1CrAlri:.1 1 ^^^rl•^ \^^^%%,^ 16° 14° — ^ 11111 111 1111111 111 M111 111 111 111 30 28 26' — 24° — 22° — 20' — 8° Amplitudendämpfung t2° Q*. 24 Stunden T, = Schwankungsbereich der Außentemperatur T, = Schwankungsbereich der Innentemperatur Schema einer Amplitudendämpfung und Phasenverschiebung nach Haferland 18 Die Wärmespeicherfähig-keit der Materialien ist recht unterschiedlich, wie das der Tabelle zu entnehmen ist. Stoffe mit einem hohen spezifischen Gewicht und einem geringen Luftanteil besitzen eine hohe Wärmespeicherfähigkeit. Dagegen ist die Speicherfähigkeit leichter Stoffe mit hohem Anteil an umschlossenen Luftporen entsprechend gering. He rv orzuheben ist, daß Wasser, verglichen mit anderen Stoffen, ein verhältnismäßig geringes spezifisches Gewicht hat bei hoher Wärmespeicherfähigkeit. Mittelwe rte der Wärmespeicherfähigkeit einiger Stoffe: Stoff Rohdichte Volumenbezoin kg gene Wärmespeicherfähigkeit in kcal/m 3 • grd Luft Polystyrolschaum Glaswolle Schlackenwolle Holzfaserplatten Korkstein, expand. imprägniert Kork, Korkstein roh Torfplatten Fichtenholz Gasbeton, Bimsbeton Eichenholz Sand, trocken Polystyrol Blei Ziegelmauerwerk Kalkmö rtel Gummi Zinn Asbestzement Zementmörtel Bitumen Asphalt Steinzeug Hartbare Kunststoffpreßmassen mit anorganischen Füllstoffen Gips Tafelglas Aluminium Stahlbeton Natursteine Zink Stahl Kupfer Wasser Gußeisen 25 120 220 200 76 84 135 230- 1 000 800 1 500 1 060 11 300 1 800 1 800 250 300 300 340 353 360 378 400 409 414 420 450 460 470 1 720-1 970 2500 2500 2 700 2400 3100 7100 7850 8990 1 000 . 7250 GEBÄUDEPLANUNG Gesamtkonzeption Wärmespeicherfähigkeit aumklima 0,31 8 24 40 64 230 200 300 600 7300 1 800 2 000 1 050 2100 2300 3., 430-590 500 500 594 630 630 640 942 845 1000 1088 Amplitudendämpfung Phasenverschiebung 19 Wie stark sich diese einzelnen unterschiedlichen Maßnahmen auf die spätere Energiebilanz des Gebäudes auswirken, kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern hängt von vielen Faktoren wie Standort, klimatischen Verhältnissen, Nachbarbebauung, Dichte usw. ab. Teilweise widersprechen sich sogar einzelne Maßnahmen der Vermeidung von Wärmeverlusten und der Gewinnung von Sonnenwärme, wie etwa bei der Kompaktheit des Gebäudes zur optimalen Gestaltung des Gebäudes für passive Sonnenenergienutzung usw. Derartige Fragen können nicht als Einzelprobleme beantwortet werden, sondern sind ausschließlich in einer GesamtheitsbetrachtuncL bei der Gebäudekonzept ion zu berücksichtigen. 45 Gesamtheitsbetrachtung bei der Gebäudekonzeption 3., GEBÄUDEPLANUNG GesamtKonzeption Doch auch das perfekteste Energiekonzept muß nicht optimal sein, wenn es nicht mit dem Nutzerverhalten in Übereinstimmung gebracht wird. Hierzu ist nicht nur ein theoretisches Fachwissen des Architekten notwendig, sondern vor allem eine eingehende Beratung und Einstimmung der späteren Nutzer, die in und mit den Häusern leben und ihre Verhaltensweisen mit dem thermischen Verhalten des Gebäudes in Einklane Drin& en Psollen, wie etwa Lüftungsgewohnheiten, Betätigungen von temporärem Wärmeschutz und Sonnenschutzmaßnahmen, Anpassung der Nutzung an die thermische Hierarchie des Grundrisses usw. In den letzten Jahren wurden in der Bundesrepublik auch auf dem Sektor der passiven Sonnenenergienutzung Grundlagenforschung betrieben, Wettbewerbe durchgefüh rt und Planungen und Entwürfe vorgestellt und diskutie rt. Auch die Bundesarchitektenkammer hat mit der Wanderausstellung „Enerf iebewußte Architektur" Interesse und Bewußtsein für diese Problematik in der FachÖffentlichkeit geweckt. Doch die praktische Umsetzung und Realisierung dera rtiger Konzeptionen läßt immer noch auf sich wa rten. Um gebaute Beispiele für energiebewußte Gebäudekonzeptionen vorzustellen, muß man immer noch Bauten aus dem Ausland, besonders aus den USA, zitieren. Die hier und in der Praxisinformation 5.1 „Technische Gesamtkonzepte" vorgestellten Projekte stammen aus dem 1978 vom Bundesminister für Forschung und Technologie unterstützten Wettbewerb Landstuhl zur Entwicklung von Solartypologien für Einfamilienhäuser, sowie dem 1981 vom Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau unterstützten Wettbewerb EnergiesparhäuserBerlin. Haus K. Terry, Santa Fe, New Mexico Dieses Haus gehört zu den klassischen Prototypen der „direkten Sonnenenergienutzung". Durch die höhengestaffelte Bauweise und die Anordnung von Oberlichtern kann die Sonne tief in das Gebäude eindringen. Die sehr massiven, raumumschließenden, fast fensterlosen Außenwände bestehen aus Adobe-Lehm. Der Fußboden sowie die sich direkt unter den Oberlichtern befindlichen Brüstungen sind als Wärmespeichermasse ausgebildet. Außenliegende Sonnenschutzlamellen verhindern bei steil stehender Sonne die sommerliche Überhitzung des Gebäudes. Architekt: D. Wright Haus D. Kelbough, Princeton, New Jersey Eine indirekte Sonnenenergienutzung wurde bei dieser Gebäudekonzeption verwirklicht. Vor der massiven Südwand wurde eine zweite Glasfassade errichtet, um den Trombe-Wand-Effekt, das heißt die Aufheizung der Wand und nächtliche Wärmeabstrahlung sowie Warmluft-Konvektion zu erzeugen. Durch Öffnung von Abluftklappen an der Oberseite der Glasfassade kann im Sommer ein Unterdruck in der Trombe-Wand erzeugt werden und über Lüftungsklappen eine natürliche „Kühlung" der Räume durch das Ansaugen kalter Luft von der schattigen Nordseite erreicht werden. Architekt: D. Kelbough Beispiele für Gebäudekonzeptionen T" tuT ni Iluno Wohnhäuser in Santa Fe, New Mexico Architekt: D. Wright 46 Wohnhaus in Princeton, New Jersey Architekt: Dough Kelbough 3. GEBAUDEPLANUNG Gesamtkonzeption Haus Balcomb, Santa Fe, New Mexico Das Gebäude ist auf einem v-förmigen Grundriß entwickelt, der einzweigeschossiges, nach Süden orientiertes Glashaus einschließt. Die Trennung zwischen Glashaus und Wohnhaus wird durch eine massive Speicherwand aus Adobe-Ziegeln gebildet, die dafür sorgt, daß die Lufttemperaturen im Glashaus nicht zu stark ansteigen und nachts die eingestrahlte Wärme phasenverschoben an Wohnund Glashaus wieder abgegeben wird. Eine balkonartige Galerie aus einer leichten Holzkonstruktion im Glashaus sorgt dafür, daß die steilstehende Sonne die Speicherwand nicht bescheint und eine unerwünschte Überhitzung im Sommer vermieden wird. Eine wirkungsvolle Querlüftung und starke Bepflanzung sorgen im Glashaus selbst in den Sommermonaten für angenehme klimatische Bedingungen. Architekten: S. + W. Nichols Melkerei Landstuhl Freistehendes Einfamilienhaus, zweigeschossig Das zweigeschossige Einfamilienhaus basiert auf einer quadratischen Grundrißform. Es ist als „Haus im Haus" mit minimierter Außenfläche konzipiert und besteht aus dem inneren Steinhaus mit Warmzone als Winterhaus, dem umschließenden Glashaus, der Pufferzone, als Übergangshaus. Das Glashaus bildet die eigentliche Außenhaut des Gebäudes. Die Sommerbelaubung des Pflanzengerüstes dient als Sonnenschutz, Wind- und Wärmeschutz. Architekt: 0. M. Ungers Wohnhaus in Santa Fe, New Mexico Architekten: Wayne und Susan Nichols Wohnhausprojekt Architekt: 0. M. Ungers 3.^ GEBÄUDEPLANUNG Gesamtkonzeption Energiesparhaus Berlin Freistehendes Meh rfamilienhaus für den innerstädtischen Bereich Das Gebäude ist nach dem Prinzip „Haus im Haus" aufgebaut. Alle Wohnräume (laute Räume) sind nach Norden zur attraktiveren Aussicht orientie rt. Alle Schlafund Kinderräume (leise Räume) sind; nach Süden zum Hof orientie rt. Die Hauswirtschafts- und Sanitärräume befinden sich in der mittleren Zone des Grundrisses. Das Gebäude ist in einzelne thermische Zonen gegliedert. Im Inneren des Gebäudes sind „warme" Räume, in dem Randbereich „kältere" und „kalte" Räume angeordnet. An der Nord-Ost- und WestAußenwand des Gebäudes wird durch thermische Pufferzonen - Wintergärten - die beheizte Fläche von der Außenluft abgeschirmt. In der Übergangszeit und an den meisten Winte rtagen mit relativ hoher Sonneneinstrahlung und niedriger Außentemperatur kann der Winterga rten als erweiterte nichtbeheizte Wohnfläche genutzt werden. In der Sommerzeit verhindern an der Süd-Ost- und West-Seite außenliegende Bepflanzung, beweglicher Sonnenschutz und wirksame Lüftung des thermischen Puffers eine unerwünschte Aufheizung. Da die Wohnräume über den Wintergarten be- und entlüftet werden, kann der Lüftungs-Wärmeverlust durch eine A rt „Wärmerückgewinnung" im Wintergarten gemindert werden. Architekten: B. Faskel, V. Nikolic Variante 213. Obergeschoß 2 2-Zi.-Whg. Literaturhinweise: V.Nikolic: Bau + Energie, Forschungsprojekt des BMFT, 1982 (Abb. 5, 6, 7) [1] R. G. Stein, Architecture and Energy, Anchor-Press, B. Faskel, V. Nikolic: Architektur und Energie, Bärenreiter New York, 1978 Verlag, 1981 (Abb. 11, 26, 27, 28) [2] E. Mazria, The passive Solarenergy-Book, RodaleD. Oppenheimer: Small solar buildings. The architectural Press, 1979 [3] V. Nikolic, Handbuch des energiesparenden Bauens, press, London, 1981 (Abb. 12, 13, 14, 15, 16) W.Koblin: Wärmespeicherung und Kühlung in WohnDeutscher Consulting Verlag, Wuppertal gebäuden, Bauwelt, 1977 [4] Solar Dwelling Design Concepts, Drake publishers O. M. Ungers: Entwürfe für eine klimagerechte und enerInc., New York, London,1977 giesparende Architektur, Studio Verlag für Architektur, [5] B. Faskel, Die Alten bauten besser, Eichborn Verlag, Köln, 1980 (Abb. 24, 25) 1982 [6] Shurka + Naar, Design for a limited Planet, Ballantine Books, New York, 1977 Quellen, Abbildungsnachweise: B. Faskel: Energiebewußte Architektur. Wanderausstellung der Bundesarchitektenkammer, 1980 (Abb. 1, 20, 21, 22, 23) P. Steiger u. a.: Plenar, Niggli-Verlag, Schweiz, 1975 (Abb. 2, 4) J. Lambeth: Solar-Design, Selbstverlag USA, 1978 (Abb. 3) 48 Kurzbiographie der Autoren: Dipl.-Ing. Bernd G. Faskel, Architekt BDA Arbeitsschwerpunkt: energiebewußtes, ökologisch angepaßtes Bauen. Prof. Vladimir Nikolic, Architekt BDA, Gesamthochsohule Kassel. Arbeitsschwerpunkt: energiesparendes Bauen, Forschung Redaktionelle Bearbeitung und Layout: Dipl.-Ing. Bernd G. Faskel, Koordination: Vladimir Nikolic R INERGI[EINSPAHUNC^ Ein Forschungsvorhaben der Bundesarchitektenkammer durchgeführt im Auftrage des Bundesministerrums für Städtebau. Raumordnung und Bauwesen Einleitung - Grundlagen Energieeinsparende Maßnahmen an Altbauten beschränken sich für den Architekten auf den Bereich der raumabschließenden Bauteile, die je nach Gebäudetyp, Baualter, Material und Konstruktionsstärke unterschiedliche Wärmedämmung aufweisen und damit auch unterschiedlich verbesserungsbedürftig sind. Auslösender Faktor für Maßnahmen zur Energieeinsparung sind häufig Notwendigkeiten zur Instandsetzung vorhandener Bauteile. Die volkswi rtschaft lichen Aspekte der Energieeinsparung haben ihren Niederschlag in den Verordnungen zum Energieeinsparungsgesetz gefunden. Ihre Anwendung für energiesparende Maßnahmen an bestehenden Gebäuden wird zur Zeit noch nicht gefordert [1]. Die Verordnungen geben jedoch in den Anforderungen an die einzelnen raumabschließenden Bauteile Richtwerte für eine Bemessung der Dämmschichten vor. Häufig ist aber der Fall anzutreffen, daß volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen zur Verminderung des Energiebedarfs sich für den einzelnen Hausbesitzer nicht lohnen. Dies gilt zum Beispiel für den Einbau besser wärmedämmender Fenster ohne Notwendigkeit der Instandsetzung. Neben den bautechnischen tragen haustechnische Maßnahmen zur Energieeinsparung bei. Vorhandene Heizungs- oder Warmwasserbereitungsanlagen können je nach Zustand in ihrer Wirkung verbesse rt oder vollständig erneue rt werden. Im Zweifel wird es notwendig sein, dies durch einen Fachingenieur überprüfen zu lassen. Besonders zu beachten ist, daß sich durch bautechnische Maßnahmen zur Wärmedämmung der Energiebedarf von Gebäuden erheblich verringe rt und damit vorhandene Anlagen zu groß dimensionie rt sind. Dies gilt besonders für ältere Anlagen, die oftmals ohnehin zu groß ausgelegt wurden. Dämmwirkung vorhandener Konstruktionen - erforderliche Verbesserung GEBÄUDE- Hausmodernisierung PLANUNG losiandseaung Verfasser Heinz Sc hmi A7ovem In der Abb. 1 sind in Tabellenform übliche Altbaukonstruktionen aufgeführt und hinsichtlich ihrer Wärmedämmeigenschaft berechnet worden. Bei den in der Regel geringen Mehrkosten durch größere Dicke der Dämmschicht ist eine über die Mindestanforderungen hinausgehende Dimensionierung der Dämmungsinnvoll, solange dadurch keine konstruktiven oder bauphysikalischen Probleme verursacht werden. Zur Verdeutlichung werden die Anforderungen an die verschiedenen Bauteile im folgenden dargestellt: Mindestanforderungen nach DIN 4108 sind: Dimensionierung der Dämmung Verordnungen zum Energieeinsparung gesetz Außenwände im Mi ttel k = 1 39 W/m21 Außenfenster k = 3,50 W/m `K Decken gegen Außenluft k 0,79 W/m2K Decken unter nicht ausgebautem Dachraum k = 0,90 W/m2K Kellerdecken k = 0,81 W/m2K Erhöhte Anforderungen nach der WärmeschutzVO an einzelne Bauteile sind: Außenwände und Fenster k = 1,25 W/m2K (Mittelwert) Decken gegen Außenluft k = 0,30 W/m2K Decken unter nicht ausgebautem Dachraum k= 0,30 W/m2K Kellerdecken k = 0,55 W/m2K Erhöhte Anforderungen ab Januar 1984 Haustechnische Maßnahmen Für die Berechnung der Außenwanddämmung wurde davon ausgegangen, daß Kunststoffenster mit Isolierglas (4 X 12 X 4 mm) mit einem k-Wert von 3,0 W/m 2K eingebaut werden, und zwar mit einem Flächenanteil von 30% gegenüber 70% massiver Außenwand. Daraus ergibt sich ein Sollwert von 0,50 W/m2K für die Wand, um die Gesamtforderung von 1,25 W/m2K einzuhalten [3]. Die Weiterverwendung vorhandener Fenster sollte in jedem Fall überprüft werden [4]. Vorhandene Anlagen zu groß Einfachfenster mit Einfachverglasung genügen den Anforderungen nicht. Es können jedoch durch relativ kostengünstige Verbesserungsmaßnahmen (Aufdoppeln der Flügel, zweite Glasscheibe) bessere We rte erzielt werden als durch neue Einfachfenster mit Isolierverglasung. Die raumabschließenden Flächen, wie Außenwände, Fenster, Dächer, Decken gegen Außenluft und gegen unbeheizte Räume, haben Bei diesen Verbesserungen sind häufig denkje nach Ausführungsart unterschiedliche Wär- malpflegerische Anforderungen an Fensterteimedämmwirkung. Einige Konstruktionen erfül- lung, Sprossen, Profilstärken und Material len bereits ohne Verbesserung die Anfordeleichter zu erfüllen als bei neuen Fenstern. rungen des Mindestwärmeschutzes nach DIN 4108 oder sogar die erhöhten Anforderungen Doppel- und Verbundfenster verschiedener für einzelne Bauteile nach der WärmeschutzRah menmaterialgruppen mit zwei EinfachVO. Zu diesen Bauteilen zählen vorrangig glasscheiben und Luftzwischenraum 2 bis Außenwände entsprechender Dicke und Bau- 7 cm erreichen bessere We rte als Einfachart [2]. fenster mit Isolierverglasung. 49 Denkmalpflegerische Anforderungen DIN 4108 (neu) - w 3,2 N ll 7 L^. c c o 2 U YCOw.0 w C ^ o GEBÄUDEPLANUNG Y Hausmodernisierung und Instandsetzung ^ Ö) ^ L U C O N a) Y :ro 0) v) L ^ E a) ^Y a) a) ti o (E E w NII 7 .7 ELT ^ ^ m ^ 11II _. ^ O- I N Y ^ ' O) CZ a) ^ L d) ro O) 0 L ap c O p) N c c co Y ro o) ` N ^Q L ^Y c o °) ^ °' c N 0 ^i 7 C O d 'a Cc Q ä: c ^E ^E _'Yoin -o L-o o E E_ roL Y -p "O Ö E E L cro ^.ro ro^ ö r̀o ö C r ^Y^.a 0,25 1,603 0,38 1,190 0,51 0,946 Maue rziegel als Sichtmauerwerk, 1 400 kg/m3 0,25 1,640 0,38 1,210 0,51 0,959 Bimsmauerwerk, verputzt, 700 kg/m3 0,12 1,971 0,25 1,202 0,38 0,864 Lochsteine aus Leichtbeton, verputzt, 1 400 kg/m3 ^ (n w > Decken gegen nicht ausgebauten Dachraum Außenwand Mauerziegel, ver- putzt, 1400 kg/m3 DD ^Y^ 0,38 1,740 0,51 1,393 0,02 0,07 0,02 0,05 0,02 0,04 0,02 0,06 0,02 0,05 0,04 0,02 0,06 0,02 0,05 0,04 0,02 0,06 0,02 0,06 1,603 0,890 0,421 1,190 0,746 0,478 0,946 0,642 0,486 1,640 0,901 0,474 1,240 0,754 0,482 0,959 0,489 1,971 0,993 0,498 1,202 0,751 0,480 0,864 0,464 1,740 0,930 0,482 1,393 0,821 0,451 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Holzbalkendecke, 0,30 1,200 0,02 Schalung 2,5 cm, 0,10 E Schlackenf. 10 cm, verputzt, 1 500 kg/m3 Stahlbetondecke, 0,24 2,807 0,04 E Verbundestrich, 0,12 2400 kg/m3 Stahlbetondecke, 0,18 3,113 0,04 E verputzt, 2400 kg/m 30,13 Hohlkörperdecke, 0,25 0,938 - 0,02 verputzt, 0,10 500 kg/m3 1,200 0,750 0,300 E 2,807 0,737 0,298 3,113 0,757 0,280 0,938 0,638 0,280 E E E E E E 0,730 0,535 E E E 2,189 0,686 0,511 E E E 1,808 0,767 0,296 3,971 0,666 0,286 1,808 0,767 0,281 - E E - E E - E E E E E - 0,855 0,704-- E 0,461 E E E - E E - - - Kellerdecken - Ziegelkappendecke, oberseit. Holzdielung E auf Lagerhölzern 0,115 1,149 0,02 Ziegelwerk: 0,04 Schüttung: 0,08 Dielung: 0,025 - Stahlbetondecke, 0,18 2,189 0,04 Verbundestrich, 0,06 E 2400 kg/m3 -<.. E Decken/Flachdächer gegen Außenluft E Holzbalkendecke 0,18 1,808 (s. oben) 0,03 0,12 Stahlbetondecke, 0,12 3,971 Verbundestrich, 0,05 - 2400 kg/m 30,13 E Hohlkörperdecke, 0,18 1,808 verputzt, 0,03 - 500 kg/m 30,12 E Geneigte Dächer Fachwerk ausgemauert, 1 000 kg/m3 Fugenabdich 0,14 2,790 0,02 0,07 2,790 1,165 0,474 E E 0,04 - Sparren: Lattung: 0,05 E Dachpfannen: 0,08 Quelle: Berechnung Gruppe Haus- und Stadterneuerung Aachen O Zwang zur Bauzeitoptimierung, Q beengte Arbeitsverhältnisse durch vorhandene Konstruktionen, Q trockene Bauweisen sind zu berücksichtigen. Beispiel: Das Aufbringen eines schwimmenden Estrichs z.B. in Feuchtbauweise verzögert den Bautechnische Maßnahmen Bauablauf und bringt Feuchtigkeit ins Gebäuzur Energieeinsparung de, die einen weiteren Baufortschritt behindert. Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung raumabschließender Bauteile unDurch energiesparende Maßnahmen entsteterscheiden sich bei gleicher Dämmstärke hende Folgearbeiten müssen beachtet und in durch konstruktive, gestalterische und ökono- die Bewertung der einzelnen Maßnahmen einmische Gesichtspunkte sowie durch unterbezogen werden. schiedliches Verhalten bei FeuchteeinwirDie folgenden Darstellungen bewerten auskung. gewählte Einzelmaßnahmen hinsichtlich ihrer Zusätzliche Faktoren wie: Eignung für die Anwendung bei der ModerOwährend der Bauzeit bewohnte Räume, nisierung. Es muß allerdings bei vorhandenen Fenstern durch - in der Regel wenig aufwendige Maßnahmen zur Fugenabdichtung sichergestellt werden, dali durch verzogene Flügel und schadhaft e Anschlüsse an die Außenwand kein zu hoher Lüftungswärmeverlust entsteht. 50 Außenwand 3.2 durch vorgesetzte Metallständerwand, Mineraltasermatten d = 4 cm, Beplankung mit Gipskartonbauplatten. Bewertung der Maßnahme: Außenwand: Innendämmung Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Vorteile: Dämmung ohne Beeinträchtigung der Fassade, Räume schnell aufheizbar. Nachteile: Verkleinerung der Wohnfläche, Anschlußprobleme Fensterbänke und Fußleisten, Vo rziehen von Elektrodosen und Schaltern sowie Heizkörpern. Verschlechterung der Schalldämmung von Innenund Außenwand bei steifen Dämmplatten möglich. Wärmebrücken kaum zu vermeiden. Evtl. zusätzliche Maßnahmen an der Fassade nötig. Preiswe rte Maßnahme gegenüber Außendämmung: Bei normalem Raumklima unbedenklich. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (Bäder, Küchen, Kinderzimmer) Dampfsperre innen vor der Dämmschicht zu empfehlen bei Verwendung von Mineralfasermatten. Es wird kein zusätzlicher Schlagregenschutz außen erreicht. In unbewohnten Räumen unproblematisch. Einschränkungen durch enge Transportwege und zum Teil nicht möglichen Einsatz von Transportgeräten und Maschinen. In bewohnten Räumen problematisch durch Belästigung der Mieter und Behinderungen bei der Ausführung durch Möbel und Bewohner (Organisation, Schmutzbelästigung usw.). Kosten 100% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,04 m = 100% 0,06 m = 103% 0,08 m = 107% 0,10m=112% Bemerkung: Kosten für Maßnahmen an der Fassade können zusätzlich entstehen. 2 Bewe rt ung der Maßnahme: Außenwand: Außendämmung d = 4 cm (Thermohaut) Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Auch in Teilflächen anzuwenden, keine Auflager oder Abhängung erforderlich, auf vorhandenen Putz aufzubringen, gestalterisch variabel, verbesse rter Schlagregenschutz. Nachteile: Anschlußprobleme an Dach, Sockel und Nachbarbebauung, Probleme bei strukturie rten Fassaden. Preiswerteste Außendämmung: durch Kunstharzputz auf Polystyrol-Hartschaumplatten, Feuchtetechnisch Kondensatprobleme sind nicht zu erwa rten, solange die Außenhaut ausreichend Kosten 135% dampfdurchlässig ist. Der Kostenveränderung bei er- Schlagregenschutz wird höhter Dämmstärke: verbessert. 0,04 m = 100% 0,06 m = 103% 0,08 m = 109% 0,10m=113% Realisierbarkeit Ohne Beeinträchtigung der Bewohner von außen anzubringende Konstruktionen, Grenzabstände und Bauwiche können zu Problemen führen. Bewe rt ung der Maßnahme: Außenwand: Außendämmung durch hinterlüftete Vorhangfassade, Mineralfasermatten d = 4 cm, Asbestzementplattenverkleidung Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Auch in Teilflächen Relativ aufwendige Konanzuwenden, keine Auflager struktion: erforderlich, auf jeden trag- Kosten 188% fähigen Untergrund aufzuKostenveränderung bei erbringen, verbesse rter höhter Dämmstärke: Schlagregenschutz. Nachteile: Anschlußproble- 0,04 m = 100% me an Dach, Sockel, Nach- 0,06 m = 106% 0,08 m = 117% barbebauung. Nachweis 0,10m=133% Zugbeanspruchung vorh. Konstruktionen, dicke Konstruktion durch Hinterlüftung, gestalterisch häufig Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Problemlose Konstruktion mit Verbesserung des Schlagregenschutzes. Ohne Beeinträchtigung der Bewohner von außen aufzubringende Konstruktion, Grenzabstände und Bauwiche können zu Problemen führen, ebenso Gestaltungssatzungen. unbefriedigend, Probleme bei strukturie rten Fassaden. Bewe rt ung der Maßnahme: Außenwand: Außendämmung Konstruktiv/Gestalterisch Vorteile: Widerstandsfähige Außenhaut, Erhaltung einer Ziegelsichtfassade möglich, relativ wartungsfrei. Nachteile: Anschlußprobleme an Dach, Sockel, Nachbarbebauung und Wandöffnungen, dicke Konstruktion, häufig schwierige Auflagerung, Probleme bei strukturierten Fassaden. durch Vormauerung d =11,5 cm hinterlüftet, Mineralfasermatten d = 4 cm Kostenaspekte Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Aufwendige Konstruktion: Kosten 316% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,04 m = 100% 0,06 m = 102% 0,08 m = 107% 0,10m=116% Problemlose Konstruktion, die den Schlagregenschutz verbesse rt. Eine Luftschicht ist nicht unbedingt erforderlich. Mineralfasermatten sollten hydrophobiert sein. Ohne Beeinträchtigung der Bewohner von außen aufzubringende Konstruktion. Grenzabstände und Bauwiche können zu Problemen führen. DIN-Vorschriften über Abstand der Vormauerung beachten. 51 GEBAUDEPLANUNG Hausmodernisierung und Instandsetzung 3.2 GEBÄUDEPLANUNG Hausmodernisierung und Instandsetzung Fenster Fugendichte Fenster können bei Raumbeheizung mit Einzelöfen oder Etagenheizungen die Bewohner gefährden. Die für die Verbrennung benötigte Luft muß unbedingt durch gezielte Frischluftzufuhr garantiert werden. Dies ist bei völlig dichten Fenstern nur über zusätzliche Maßnahmen zu erreichen. Zu beachten ist auch, daß der Dampfdruck (Feuchtigkeitskonzentration) auf andere raumabschließende Bauteile durch dichte Fenster erhöht wird. Gegenüber üblicher Isolierverglasung erfordern meh rfach- und sonderverglaste Fenster (wie Dreifachverglasungen, Verglasungen mit Reflexionsschichten) erheblich höhere Investitionskosten. Bewertung der Maßnahme: Fenster: Stufenisolierverglasung (4 x 12 x 4 mm) in vorhandene Fensterflügel einbauen. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Beibehaltung des Preisgünstige Maßnahme: vorhandenen Fensters und Kosten 120% der Flügeligkeit, keine Folgearbeiten. Nachteile: Evtl. geringere Lebensdauer, je nach Zustand des Fensters, evtl. zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen e rforderlich, Sprossenteilung kann in der Regel nicht beibehalten werden, Haftungsausschlüsse der Glashersteller bei zu schwachen Rahmen beachten. Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Keine Nachteile gegenüber einem neuen Fenster, wenn die Fugen und Anschlüsse ausreichend abgedichtet sind. Abhängig vom Zustand und der Belastbarkeit der vorhandenen Fensterkon- struktion. Geeignet für die Durchführung in bewohnten Räumen, da geringe Belästigung der Bewohner. Rundbögen sind in der Regel nicht herstellbar. Bewert ung der Maßnahme: Fenster: Zweite Einfachglasscheibe in Kunststoffrahmen innen auf vorhandene Fensterflügel aufschrauben. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Vorteile: Beibehaltung des vorhandenen Fensters und der Flügeligkeit sowie evtl. Sprossenteilung, keine Folgearbeiten. Nachteile: Evtl. geringere Lebensdauer, je nach Zustand des Fensters, evtl. zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen e rforderlich, aufwendigere Reinigung (2 Scheiben), gestalterisch innen problematisch. Preisgünstige Maßnahme: Kosten 100% Kondensatbildung auf der Innenseite der äußeren Scheibe möglich, wenn der Kunststoffrahmen nicht dicht genug abschließt, evtl. bei unebenen Rahmenoberflächen. Abhängig vom Zustand des vorhandenen Fensters geeignet für die Durchführung in bewohnten Räumen, da geringe Belästigung der Bewohner. Rundbögen sind in der Regel nicht herzustellen. Bewertung der Maßnahme: Fenster: Zweites Kiefemholzfenster mit Einfachverglasung innen hinter vorhandenem Fenster einbauen. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Beibehaltung des Preisgünstige Maßnahme: vorhandenen Fensters mit Kosten 127% Flügeligkeit sowie evtl. Sprossenteilung, hohe Wärme- und Schalldämmwirkung. Nachteile: Evtl. geringere Lebensdauer, je nach Zustand des vorhandenen Fensters Kürzen der Innenfensterbank e rforderlich, evtl.Stemmarbeiten und Beiputz bei eingeputztem Blendrahmen, aufwendigere Reinigung durch zwei Scheiben. Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Kondensatbildung innen auf der äußeren Scheibe möglich, wenn das Innenfenster nicht dicht genug abschließt. Bei Aufputz-Konstruktion des Blendrahmens für bewohnte Räume geeignet, da die Belästigung gering bleibt. Bei Aufschneiden des Putzes mit Einstemmen des Blendrahmens hohe Belästigung und Folgekosten. Bewertung der Maßnahme: Fenster: Aufsatzrahmen mit Isolierglas (4 x 12 x 4 mm) über beizubehaltenden Blendrahmen einbauen. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Saubere Konstruk- Relativ aufwendige Kontion ohne Stemm- und Bei- struktion: putzarbeiten, schnell einzu- Kosten: 183% bauen. Nachteile: Bei Glasbruch muß der Flügelrahmen mit erneue rt werden, Erfüllung denkmalpflegerischer Anforderungen problematisch (Sprossenteilung, Profilstärken usw.). Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Bei wärmegedämmten Rahmen und richtiger Fugenabdichtung unproblematisch. Gut geeignet für den Einbau in bewohnten Räumen, da schnell und sauber ohne stärkere Belästigung der Bewohner einzubauen. 9 Bewe rt ung der Maßnahme: Fenster: Neue Edelholz- oder Kunststoffenster mit Isolierglas (4 x 12 x 4 mm) anstelle der vorhandenen Fenster einbauen. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Vo rteile: Längere Lebensdauer als bei zu verbessernden Fenstern, moderne Beschläge. Nachteile: Evtl. umfangreiche Folgearbeiten erforderlich (Stemm-, Beiputz, Anstrich-, Tapezierarbeiten, evtl. Innen- und Außenfensterbänke zu erneuern), konstruktive und gestalterische Probleme bei Denkmatsch utzanforderu ngen, besonders bei Kunststoffenstern. Aufwendige Maßnahme: Kosten: 180-207% Die Kosten sind allerdings im Zusammenhang mit der zu erwa rt enden Lebensdauer und der voraussichtlich geringeren Instandhaltung zu relativieren. Bei ausreichend wärmedämmenden Rahmen und Anschlüssen an die Fassade unproblematisch. Bei Bei bewohnten Räumen problematisch, wenn umfangreiche Folgearbeiten zu erwa rt en sind, die zu hohen Belästigungen der Bewohner führen. Dies ist im Einzelfall zu prüfen. Fugendichte Fenster können bei Etagenheizung und Einzelofenheizung durch fehlende Zuluft die Bewohner gefährden. dichten Fugen Erhöhung des Dampfdruckes auf die übrigen raumabschließenden Bauteile. 10 Decken gegen nicht ausgebauten Dachraum bauten Dachraum sind die Anforderungen des Brandschutzes nach DIN 4102 zu beachBei der Anordnung wärmedämmender Maß- #en, nahmen an Decken gegen den nicht ausge- Bewe rt ung der Maßnahme: Decken gegen Dachraum: Ausschäumen der Deckenhohlräume in einer Stärke von 4 cm. Konstruktiv/Gestalterisch Realisierbarkeit Kostenaspekte Feuchtetechnisch Vo rteile: Keine Veränderung der Deckenoberflächen, keine Folgearbeiten erforderlich. Nachteile: In der Regel nur bei Holzdecken anzuwenden. Voraussetzung ist ein Hohlraum der gewünschten Dicke. Preiswe rt este Maßnahme: Kosten: 100% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,04 m = 100% 0,06 m = 133% 0,08 m = 167% 0,10m=200% 0,12m=233% Bei völliger Ausschäumung der Hohlräume in Holzbalkendecken wird eine Belüftung des Holzes verhinde rt , was bei eindringender Feuchtigkeit zu Schadensbildung führen kann. Durch Bohrlöcher geringen Durchmessers auch in zum Teil vollgestellten Räumen zu realisieren. Belästigung für Bewohner gering. Bewe rt ung der Maßnahme: Decken gegen Dachraum: Ausrollen von Dämmatten in 4 cm Stärke auf der vorhandenen Decke. Realisierbarkeit Feuchtetechnisch Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vo rteile: Keine Folgearbeiten e rforderlich. Nachteile: Nur bei nicht begehbaren Kaltdächern anzuwenden. Preiswe rt e Maßnahmen. Kosten: 139% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,04 m = 100% 0,06 m = 112% 0,08 m = 120% 0,10m=130% 0,12 m = 144% Unproblematische Konstruktion. Aluminiumkaschierung ist nicht zu empfehlen, da dadurch nur eine Belüftung der Oberseite verhinde rt wird. Eingeschränkt, da nur bei nicht begehbaren Kaltdächern anzuwenden. Do rt allerdings problemlos. 12 53 3.2 GEBAUDEPiANUNG Hausmodernisierung und Instandsetzung Bewertung der Maßnahme: Decken gegen Dachraum: Trockenestrich mit begehbarer Oberfläche, Dämmschicht 4 cm aufbringen. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Trockene Bauweise, glatte Oberfläche, Ausgleich von Unebenheiten des Unterbodens möglich, keine Verringerung der Raumhöhe darunterliegender Räume. Nachteile: Relativ dicke Konstruktion, dadurch evtl. Folgearbeiten bei Anschlüssen, Verminderung der Höhe des Dachraums. Aufwendige Konstruktion: Unproblematische KonEingeschränkt bei vorhanstruktion. Günstig die trok- denen Lattenverschlägen Kosten: 306% kene Bauweise, ohne Bau- und vollgestellten Räumen. Kostenveränderung bei er- feuchtigkeit ins Gebäude In leeren Räumen unprohöhter Dämmstärke: zu bringen. blematisch. Kurze Einbau0,04 m = 100% zeit durch Elementbauwei0,06 m = 109% se. Vorteilhaft ist, daß 0,08 m = 118% darunterliegende Wohn0,10 m = 133% räume nicht betreten werden müssen. Hinweis: Die Dicke der Dämmschicht ist auf 0,10 m beschränkt. 13 Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Bewertung der Maßnahme: Decken gegen Dachraum: Abgehängte Decke mit 4 cm Mineralfasermatten, Beplankung mit Gipskarton-Bauplatten einbauen. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Vorteile: Der Oberbelag der Decke bleibt unangetastet, evtl. Schäden am vorhandenen Deckenputz brauchen nicht behoben zu werden. Nachteile: Raumhohe Fenster führen zu konstruktiven Problemen, Raumhöhen werden verringert, Stuckdecken verdeckt, z. T. sind Revisionsöffnungen für Leitungen im Luftzwischenraum vorzusehen. Aufwendige Konstruktion: Kosten: 367% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,04 m = 100% 0,06 m = 105% 0,08 m = 108% 0,10m=112% 0,12m=115% Bei Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit sollte eine Dampfsperre innen vor der Dämmschicht angeordnet werden. Günstige Konstruktion durch trockene Bauweise. In bewohnten Räumen problematisch, da ein Leerziehen der betroffenen Räume in der Regel e rforderlich ist. In unbewohnten Räumen einfach anzuwenden. 14 Bewertung der Maßnahme: Kellerdecken: Ausschäumen der Hohlräume zwischen Lagerhölzern in 4 cm Stärke. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Begehbare Oberfläche bleibt unverändert, keine zusätzliche Aufdikkung nötig. Nachteile: Belüftung der Holzteile wird verschlechtert, Dampf- und Feuchtesperre nur auf der vorhandenen Fußbodenoberfläche möglich; zusätzliche Schutzschicht gegen me- Preiswe rteste Maßnahme: Als Innendämmung in normalen Räumen unbedenkKosten: 100% lich bei Verwendung von Kostenveränderung bei er- Schäumen mit relativ hohöhter Dämmstärke hem Dampfdiffusionswider0,04 m = 100% stand. In Feuchträumen 0,06 m = 133% sollte eine Dampf- bzw. 0,08 m = 167% Feuchtesperre angeordnet 0,10m=200% werden. Feuchtetechnisch Realisierbarkeit In leeren und bewohnten Räumen anzuwenden, relativ geringe Belästigung von Bewohnern. chanische Beanspruchung, nur bei Dielen auf Lagerhölzern anwendbar. 15 Bewertung der Maßnahme: Kellerdecken: Anbringen von Polystyrol-Hartschaumplatten in 4 cm Stärke unter der Kellerdecke. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Vorteile: Lage der Dämmung an der kalten Außenseite. Nachteile: Anfälligkeit für mechanische Zerstörung ohne Schutzschicht - und Preiswerte Konstruktion: Kosten: 161% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,04 m = 100% 0,06 m = 110% 0,08m=121% 0,10m=131% In der Regel unbedenklich. Bei Feuchträumen innen muß die ausreichende Dampfdiffusion durch die Schaumstoffplatten gewährleistet sein. Wird häufig durch Kellertrennwände, Lattenverschläge, Rohrleitungen an der Decke sowie Kappenund Gewölbedecken erschwert. Vorteilhaft ist, daß Wohnräume von der Maßnahme nicht berührt werden. 16 Hitzeeinwirkung. Brand- schutz beachten. gen von Bre tt ern an die Sparren erforderlich. Dadurch kann auch Höhe für die Durchlüftung erzielt werden. Decken/Dächer gegen Außenluft Problematisch bei Dämmung von außen und von innen ist, daß häufig zwischen Dachhaut und Dämmung keine Belüftung mehr möglich ist, da die vorhandenen Sparren in der Regel nicht hoch genug sind. Bei Holzbekleidungen ist mangelhafte Winddichtigkeit eine häufige Ursache von Wärmeverlusten. Dies gilt auch nach der Reduzierung des notwendigen Belüftungszwischenraumes in DIN 4108 von 4 auf 2 cm, da Mineralfasermatten häufig durch Ausdehnung größere Dicken annehmen als rechnerisch angesetzt [5]. Wenn keine ausreichende Belüftung der Dämmschicht vorhanden ist, sollte zur Vermeidung von Kondensatschäden eine Dampfsperre innen vor der Dämmschicht angeordnet werden. Für eine Bekleidung mit Gipskarton-Bauplatten ist in der Regel ein Flächenausgleich der Sparrenunterseiten durch seitliches Anschla- Die Belüftungsschicht muß zwischen Oberseite der Dämmung und Unterspannbahn liegen. Bewe rt ung der Maßnahme: Flachdächer gegen Außenluft: Innendämmung zwischen Holzbalken, 5 cm Mineralfasermatten, GK-Verkleidung zwischen den Balken. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Die vorhandene Dachhaut bleibt unberüh rt , Holzbalken bleiben zum Teil sichtbar Nachteile: Balkenhöhe muß für die Anordnung einer Luftschicht oberhalb der Dämmung ausreichen, bei vorhandenem Deckenputz, Ve rteuerung durch Abschlagen und Abfuhr. Relativ preisgünstige Maßnahme gegenüber Erneuern der Dachhaut: Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Es sollte eine Dampfsperre innen vor der Dämmschicht angeordnet werden, um Kondensation an der kalten Kosten: 100% Dachhaut zu verhindern, Kostenveränderung bei er- wenn keine ausreichende höhter Dämmstärke: Entlüftung gewährleistet ist. 0,05 m = 100% 0,08 m = 103% 0,10 m = 106% 0,12 m = 110% Bewe rt ung der Maßnahme: Flachdächer gegen Außenluft: Außendämmung ten Polystyrol-Schaumplatten. In bewohnten Räumen in der Regel nicht durchzuführen. In unbewohnten Räumen problemlos. durch Aufbringen von 5 cm extrudier- Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Feuchtetechnisch Vorteile: Beibehaltung der vorhandenen Dachhaut möglich. Balkenprofile bei Holzbalkendecken können in voller Höhe sichtbar bleiben, ebenso Dachschalung. Relativ preiswe rt e Maßnahme: Bauphysikalisch sehr gün- Auch bei bewohnten Räustige Konstruktion ohne men unter dem Dach proProbleme. blemlos von außen zu realisieren, relativ wetterunabhängig. Kosten: 100% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,05 m = 100% 0,08 m = 103% 0,10 m = 109% 0,12 m = 122% Bewe rt ung der Maßnahme: Flachdächer gegen Außenluft: Außendämmung platten d = 5 cm. Realisierbarkeit 3lagiges Pappdach, Hartschaum- Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Vo rteile: Keine zusätzliche Belastung durch Bekiesung, Balkenprofile und Dachschalung innen können sichtbar bleiben. Nachteile: Häufige Erneuerung sämtlicher Dachanschlüsse wird e rforderlich, erhöhter Dachaufbau durch zusätzliche Dämmung, kein Schutz gegen UV-Bestrahlung vorhanden. Relativ aufwendige Maßnahme: Kosten: 113% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,05 m = 100% 0,08 m = 103% 0,10 m = 108% 0,12m=119% Unproblematische Konstruktion. Die alte Dachhaut sollte als Dampfsperre bestehen bleiben. Bedingt über bewohnten Räumen durchzuführen, im wesentlichen bei unterseitig verputzten Holzbalkendecken oder Massivdecken' möglich, wetterabhängig. 3.2 GEBAUDEPLANUNG Hausmodernisierung und Instandsetzung 3.z GEBÄUDEPQNUNG Hausmodernisierung und Instandsetzung Bewertung der Maßnahme: Geneigte Dächer: Befestigen Alu-kaschierter Mineralfaserpatten, 6 cm dick, zwischen den Sparren. Feuchtetechnisch Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vort eile: Einfache Konstruktion, Dachhaut bleibt unangetastet. Nachteile: Nur für nicht auszubauende Dächer, Oberfläche innen leicht zu beschädigen, Sparrenhöhe muß für die vorgesehene Dämmung und Luftschicht ausreichen, was bei stärkeren Dämmschichten meist nicht gegeben ist, eine Unterspannbahn sollte vorhanden sein. Eine Dampfsperre innen vor der Dämmschicht sollte unbedingt angeordnet werKosten: 100% den, um Kondensatbildung Kostenveränderung bei er- an der Unterseite der Dachhöhter Dämmstärke: haut zu verhindern, wenn keine ausreichende Entlüf0,06 m = 100% tung gewährleistet ist. 0,08 m = 125% 0,10 m = 135% 0,12 m = 150% Preisgünstigste Maßnahme: Realisierbarkeit Wird häufig durch Lattenverschläge und vollgestellte Dachräume beeinträchtigt, bei ausgebauten Dächern nicht anzuwenden. 20 Bewertung der Maßnahme: Geneigte Dächer: Einbringen Alu-kaschierter Mineralfasermatten, 6 cm dick, zwischen den Sparren, GK-Beplankung mit Ausgleichslattung. Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Feuchtetechnisch Realisierbarkeit Vo rteile: Dachhaut bleibt unangetastet, es entsteht eine tapezierfertige Oberfläche. Nachteile Ohne vorhandene Unterspannbahn nicht zu empfehlen, Ausgleichslattung für ebene Sparrenunterseiten erforderlichLuftschicht oberhalb derbämmung häufig ohne zusätzliche Maßnahmen nicht möglich. Relativ aufwendige Maßnahme: Kosten: 350% Kostenveränderung bei erhöhter Dämmstärke: 0,06 m = 100% 0,08 m = 104% 0,10m=115% 0,13 m = 118% Es sollte eine Dampfsperre innen vor der Dämmschicht angeordnet werden, um Kondensatbildung zu verhindern, wenn keine ausreichende Entlüftung gewährleistet ist. Bei ausgebauten Dächern nicht anzuwenden, Behinderung durch Lattenverschläge und vollgestellten Dachraum. 21 Bewertung der Maßnahme: Geneigte Dächer: Aufnehmen der Dachhaut, 6 cm Mineralfasermatten, Unterspannbahn, Lattung mit vorhandenen Pfannen wieder eindecken. Feuchtetechnisch Konstruktiv/Gestalterisch Kostenaspekte Vorteile: Vorhandener Innenputz bleibt unangetastet, Einbau einer Unterspannbahn ist möglich, altbaugerechte Pfannendeckung bleibt erhalten. Bei Einlegen der Dämmung zwischen die Sparren muß die Alu-Kaschierung innen Kosten: 350% dicht schließen, um KonKostenveränderung . bei er- densprobleme zu vermeihöhter Dämmstärke: den. Bei dicker Dämmschicht Erhöhung der 0,06 m = 100% Sparren zur Anordnung ei0,08 m = 103% ner Luftschicht, minde0,10 m = 107% stens 2 cm e rf orderlich. 0,12m=111% Relativ aufwendige Maßnahme: Haustechnische Maßnahmen zur Energieeinsparung Haustechnische Maßnahmen betreffen die Verbesserung von Heizungsanlagen und Warmwasserbereitur igsanlagen. Maßnahmen zur Verringerung des Wärmebedarfs sind im Normalfall: Realisierbarkeit Möglichkeit der Dämmung bei ausgebauten Dächern, relativ unabhängig von Bewohnern, wetterabhängig. 22 Schlitz- und Stemmarbeiten sollten auf ein Minimum reduziert, Leitungen vor der Wand verlegt, Leitungsführungen auf kürzestem Wege exakt geplant, aus dem Neubau übernommene Standardvorstellungen kritisch geprüft und davon abweichende Konstruktionen angewendet werden, die der Altbausubstanz entsprechen. Beispiel: Beim Einbau von Gas-Etagenheizthermen 0 Verbesserung der Regelung, müssen die zu benutzenden Kaminzüge O Anpassung von Anlagen an verringerten mit Edelstahlrohr ausgekleidet werden. Durch Wärmebedarf, Verwendung von Außenwandgeräten mit ge0 Verringerung von Abwärmeverlusten der schlossener Verbrennungskammer sind diese Wärmeerzeuger, erheblichen Kosten einzusparen und die Ka0 Umstellung des Wärmeerzeugers auf ande- minzüge zusätzlich als Feuchtraumentlüftung re Heizmedien, zu nutzen. 0 Nutzung von Umweltenergie. Der Aufstellort von Etagenheizgeräten ist von erheblicher Bedeutung für bautechnische Folgearbeiten. Hier können zusätzliche RaumVon ausschlaggebender Bedeutung für Kosten der Verbesserung haustechnischer Anla- belüftungseinrichtungen, Schaffung von Luftverbund in der Wohnung durch Lüftungsgitter gen ist die schonende Integration in das vorin Türen und Wänden e rforderlich werden. handene Baugefüge [6]. 56 Verbesserung der Wärmeerzeuger möglich und trägt durch hohe Meßgenauigkeit zu einem energiebewußten Heizverhalten Die Erneuerung von Gas- oder Ölbrennern unter Beibehaltung des vorhandenen Kessels der Nutzer bei. Bei besserer Wärmedämmung der raumabführt in der Regel nicht zu einer Energieeinschließenden Bauteile steigt die durchschnittsparung, sofern der alte Brenner keine Funkliche Temperatur der Raumumschließungsflätionsstörung aufweist. chen, was bei gleicher Behaglichkeit eine Ebenso wird durch Ersetzen eines Ölbrenners durch einen Gasbrenner kaum Energie einge- Senkung der Raumtemperatur ermöglicht. spart werden können, wenn der Heizkessel Wi rtschaftlichkeit einzelner Maßnahmen erhalten bleibt. Eine Einsparung wäre zu erzielen, wenn der Gaspreis deutlich unter dem Die Wirtschaftlichkeit einzelner Maßnahmen Ölpreis läge, war zur Zeit nicht der Fall ist. unterscheidet sich durch den Anteil der betreffenden Bauteile am jeweiligen Gebäude Eine ErneuerungvonHeizkessel und Brenner und den damit jeweils zu erzielenden Anteil bei Zentralheizungen im Zusammenhang mit der Energieeinsparung je Gebäudetyp. der Verminderung des Wärmebedarfs eines Altbaues durch bautechnische Maßnahmen, Für die folgenden Haustypen wird für ausgemit einer Verringerung der Auslegung des wählte energiesparende Maßnahmen die Kessels und Verbesserung seines Wirkungs- Energieeinsparung und die Rentabilität nach grades, kann zu Energieeinsparungen bis zu der Kapitalwertmethode errechnet [7]. 20%* führen. Der Kapitalwe rt stellt den umgerechneten GeDie Erneuerung von Gas-Etagenheizthermen genwartswert der über einen bestimmten Zeitzur Anpassung an verringe rten Wärmeenerraum - hier 15 Jahre - e rfolgten Ausgaben giebedarf ist kaum sinnvoll, da bei kleineren und Einnahmen für eine Maßnahme dar. Wohnungen die geringst mögliche Auslegung Als Aufzinsrate wurde 7%, als Energiepreisder Thermen in der Regel noch zu groß ist. steigerungsrate wurden 4,5% angenommen. Auch sind die Investitionskosten je Wohnung Maßnahmen mit positivem Kapitalwert sind im Verhältnis zu eventuell zu erzielenden Ein- wirtschaftlich, bringen höhere Einnahmen als sparungen hoch. Ausgaben. Der Einbau einer Abgassperrklappe zur Redu- Typ A: dreigeschossiges Reihenhaus, zierung der Abwärmeverluste ist wirtschaftlich einseitig angebaut, 400 m 2 Wohnfläche erst bei Anlagen ab ca. 30 kW zu ve rtreten, Typ B: dreigeschossiges Reihenhaus, Energieeinsparungen von 2 bis 4% sind vor zweiseitig angebaut, 400 m 2 Wohnfläche allem bei überdimensionierten Kesseln zu er- Typ C: fünfgeschossiges Wohnhaus in der reichen. Stadt, einseitig angebaut, 600 m 2 Wohnfläche Typ D: fünfgeschossiges Wohnhaus in der Verbesserung der Regeleinrichtungen Stadt, zweiseitig angebaut, 600 m 2 Wohnfläche Die Nachrüstung vorhandener Heizkörper mit thermostatischen Heizkörperventilen ist im all- Bei der Auswe rtung der graphischen Darstellungen sollte im Einzelfall der Zustand und die gemeinen problemlos auszuführen, zum Teil Erneuerungsbedürftigkeit eines betroffenen sogar ohne Entleerung der Heizanlage. Bauteils zusätzlich berücksichtigt werden [8]. Durch die Berücksichtigung von Wärmegewinnen durch Sonnenstrahlung, Körperwärme Dämmung der Außenwand durch Hartund anderen Wärmequellen bei der Raumschaumplatten mit Kunstharzputz bringt regelung sind ca 10% Energieeinsparung 20 bis 35%* Energieeinsparung und liegt im möglich. Die Investitionskosten sind verwirtschaftlichen Bereich. gleichsweise niedrig. Auslegen von Mineralfaser-Dämmatten in Eine optimale Regelung wird erreicht, wenn 8 cm Stärke auf der Decke gegen unbeheizeine witterungsgeführte Vorlauftemperaturten Dachraum sowie unterseitige Dämmung regel-Einrichtung eingebaut wird. der Kellerdecke durch 6 cm Hartschaumplatten sind wi rtschaftlich und bringen Regeleinrichtungen zur Begrenzung der Energieeinsparung von 5 bis 15%. Brauchwassertemperatur bringen zwar nur geringe Energieeinsparung, verhindern jeWitterungsgeführte Vorlauftemperaturregedoch Schäden an der Anlage durch geringere lung mit Nachtabsenkung, Einbau thermostaKorrosionsgefahr bei geringem Anfall von Här- tischer Heizkörperventile und Regelung zur tebildnern. Begrenzung der Brauchwassertemperatur sind wirtschaftlich und bringen EnergieeinSonstige betriebstechnische Maßnahmen sparung von 3 bis 14%. Ein bis zwei Wa rtungen vorhandener HeizanFallbeispiel lagen je Heizperiode zur Reinigung und Einstellung gewährleisten einen optimalen WirEin dreigeschossiger Wohnblock in 5 .1, 60 Dükungsgrad der Anlage und helfen so, Energie ren, Baujahr 1950, wurde 1981 modernisiert. einzusparen. Untersucht werden hier 6 WE mit ca. 270 m2 Der Einbau von Wärmezählern mit Messung Wohnfläche. Die Außenwände bestehen übernach dem Ultraschall-Prinzip in Zentralheiwiegend aus 24 cm Bimsmauerwerk, im EG zungsleitungen jeweils vor jeder Wohnung ist 30 cm stark, die Fenster aus Holzrahmen mit ohne größere Belästigung der Bewohner Einfachverglasung, die Kellerdecke aus Stahlbeton mit Verbundestrich. Die Decke zum * Die im folgenden Text angegebenen Prozentzahlen der nicht ausgebauten Dachraum ist als HolzbalEnergieeinsparung sind nicht als absolute Größen zu kenjconstruktion mit Schlackenfüllung ausge verstehen, sondern zeigen die Einsparungsmöglichkeiten im Verhältnis zueinander. bildet. 57 ;^41.+_s+ -r:rern,ver u og arid ;natandsect,ng rtewritee:- 3.2 GEBÄUDEPLANUNG Hausmodernisierung und Instandsetzung giekQstenersparr;ts Es wurden folgende energiesparende Maßnahmen, zum Teil in bewohnten Räumen, durchgeführt: A. Aufbringen von Hartschaumplatten, 5 cm dick, und Kunstharzputz auf die Außenwand. B. Einbau neuer Kunststoffenster mit Isolierverglasung (4 x 12 x 4 mm). C. Aufbringen von Schaumkunststoffplatten, 6 cm dick, unter die Kellerdecke. D. Ausschäumen der Deckenhohlräume der Decke zum Dachraum in 6 cm Stärke. Die Gesamtkosten der energiesparenden Maßnahmen beliefen sich für den untersuchten Gebäudeteil 1981 auf DM 54150,-. Durch Berechnung des Wärmebedarfs vor der Modernisierung und nach erfolgten energiesparenden Maßnahmen ergibt sich bei BeFassade und heizung mit Gas-Etagenheizungen eine Ener-giekostenersparnsvon ca. DM 2600,- pro Jahr- 4,8% der Investitionskosten. Zu berücksichtigen beim Kosten-NutzenVergleich ist allerdings, daß die Fenster sowieso erneuerungsbedürftig und der Außenputz schlecht waren. Hier dürften eigentlich beim Vergleich nur die Mehrkosten angesetzt werden, die sich durch bessere energieeinsparende Ausführung gegenüber einer reinen Instandsetzung ergeben würden. Anzusetzen wären dann etwa DM 27500,Investitionskosten für energiesparende Maßnahmen. Die Ersparnis von DM 2600,- pro Jahr entspricht dann 9,5% der Investitionskosten. Die Wirtschaft lichkeit ist an der Höhe der jeweils üblichen Kapitalverzinsung zu messen. Fenster 10 20 15 0 5 5 20 5 2 ö r 0 0 —5 —5 0 —10 —15 —15 —20 0 20 —25 ö —30 c —30 —25 —35 = —35 —40 = —40 -fio- 0 10 20 30 40 50 60 70 —80 Energieeinsparung in % Maßnahmen: 1. 6 cm Dämmplatten mit Kunstharzputz auf Außenwand anbringen. 2. Auf vorhandenem Fenster zweite Schraube in Kunststoffrahmen aufschrauben. 3. Neues Kunststoff-Fenster mit Isolierverglasung einbauen. Heizung und Brauchwassererwärmung 10 20 0 30 10 20 30 Energieeinsparung in % Maßnahmen: 1. Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit Nachtabsenkung einbauen. 2. Regelung zur Begrenzung der Brauchwassertemperaturen einbauen. 3. Einbau von thermostatischen Heizkörperventilen. 4. Umstellung auf Gasbrenner. Dach und Kellerdecke Nutzung von Umweltenergie 20 15 10 5 0 5 —10 0 o oo —15 —20 —25 iS —30 —35 = 0 ^ 10 20 30 Energieeinsparung in % Maßnahmen: 1. 8 cm Dämmatten auf Balkenlage des Dachbodens ausrollen. 2. Dachdeckung aufnehmen, 8 cm Dämmung einlegen, wieder eindecken. 3. Unter der Kellerdecke 6 cm Dämmplatten anbringen. 4. 8 cm Dämmung zwischen die Dachsparren bringen, Verkleidung mit Gipskartonplatten innen. Quellenangaben und ausgewählte Forschung [1]Wischerhoff, E., Düwel, G.: „Energieeinsparung, Wärmeschutz und Heizung", Wingen-Verlag, Essen 1978. [2] Bundesminister für Forschung und Technologie: „Bauen und Energiesparen" TÜV-Rheinland-Verlag, Köln, Bonn 1981. [3] RWE Bau-Handbuch: „Technischer Ausbau 1981/82" Energie-Verlag, Heidelberg 1981. [4] Batt elle-Institut e.V. Frankfu rt , Neuland Gem. Wohnungs-GmbH: „Rationelle Energieverwendung im Fernwärmeversorgungsgebiet der Stadtwerke Wolfsburg AG" Bericht 1981. [5] Schild, E., Oswald, R., u.a.: „Konstruktionsempfehlungen zur Altbaumodernisierung - Bauteile im Erdreich", Bauverlag 1980. [6] Schmitz, H., Meisel, U., Fleischmann, R.: „Althausmodernisierung - praxisbezogene Anleitung", Schriftenreihe Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes NW, Band 3.019 I und II, Do rt mund 1980. [7] Computer-Beratungsprogramm Energiesparen der Landesbausparkasse: Entwickelt von: Ingenieurgesell58 —40 -80 0 10 20 30 40 50 60 70 Energieeinsparung in % Maßnahmen: 1. Installation von Sonnenkollektoren für die Brauchwassererwärmung. 2. Einbau einer elektrischen Luft/Wasser-Wärmepumpe für bivalenten Heizbetrieb. schaft Schmidt-Reuter, Köln, und Gruppe Haus- und Stadterneuerung, Aachen. Aachen/Köln 1980. [8] Müller, H.: „Untersuchung des Energieverbrauchs in Wohngebäuden und der Wirtschaftlichkeit von Energiesparmaßnahmen" Fachaufsatz in: Klima-Kälte-Heizung 4/1981. Kurzbiographie des Autors: Dipl.-Ing. H. Schmitz ist Geschäftsführer der Gruppe Haus- und Stadterneuerung (Architekten und Ingenieure), seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen auf dem Bereich der praktischen Durchführung und Forschung zum Thema „Altbaumodernisierung". Dipl.-Ing. U. Meisel ist Mitarbeiter der Gruppe Haus- und Stadterneuerung. Sein Tätigkeitsbereich erstreckt sich ebenfalls auf Abwicklung von Modernisierungen und Forschungsarbeiten mit stark anwendungsbezogenem Charakter. Redaktionelle Bearbeitung und Layout: Dipl.-Ing. Bernd Faskel, Koordination: Vladimir Nikolic PRAXI SINIONMATION ixxs Ein Forschungsvorhaben der Bundesarchitektenkammer durchgeführt im Auftrage des Bundesministeriums für Städtebau, Raumordnung und Bauwesen BAUKONSTRUKTION winde BAUKONSTRUKTION Wände Verfasser: Dipl.-Ing. Wilfried Zapke Jul; 1981 Wände und ihre Funktionen Beim Konzipieren von Wandkonstruktionen sind aus bauphysikalischer Sicht eine Reihe von Ein fl üssen zu beachten, die jeweils im Zusammenhang gesehen werden müssen. Neben dem Q winterlichen Wärmeschutz, dem zweifelsohne aufgrund der einschneidenden Entwicklungen auf dem Energiesektor die größte Bedeutung beizumessen ist, sind Fragen des Q sommerlichen Wärmeschutzes, Q Schallschutzes, Q Brandschutzes, Q Witterungsschutzes (Regenschutzes), Q Feuchtigkeitsschutzes (Tauwasserschutzes) in die Überlegungen einzubeziehen, wobei die beiden letztgenannten Einflußgrößen nur bei Außenwänden relevant sind. Wärmeschutz Sparsamer Energieverbrauch bei der Beheizung und hygienisch einwandfreies Raumklima werden wesentlich von der Wärmedämmung der Außenwände beeinflußt. Grundlage für die Bemessung des winterlichen Wärmeschutzes bilden die Bestimmungen der DIN 4108— Wärmeschutz im Hochbau -Ausgabe August 1981 und die Wärmeschutzverordnung. Verbessert wird der Wärmeschutz durch Veränderung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/A, und zwar durch Q Vergrößerung der Wanddicke, Q Einsatz eines Wandbaustoffes mit geringerer Wärmeleitfähigkeit AR, Q Anordnen einer zusätzlichen Dämmschicht im Wandquerschnitt. Durch Mindestanforderungen an den bauli chen Wärmeschutz im Sommer soll eine zu hohe Erwärmung der Räume infolge Sonneneinstrahlung vermieden werden. Hierbei reicht es nicht aus, lediglich die Außenbauteile nach ihrer Wärmedämmung zu beurteilen. Vielmehr hängt der sommerliche Wärmeschutz ab von Außen 41 r' Innen Strahlung Zustrahlun (Sonne - diffus - Leitung, teils Speicherung Abstrahlung Konvektion Konvektion Reflektierte Strahlung S Wärmezufuhr durch Strahlung W Wärmeproduktion interner Wärmequellen (Beleuchtung, Bewohner) U Wärmeaufnahme der inneren Umfassungsteile L, K Wärmeabfuhr durch Lüftungs-oder Klimaanlage T Transmissionswärme von außen Die sich iminnenraum abspielenden Wärmeübertragungsvorgänge Zu beachten ist die enge Verknüpfung der Problematik des sommerlichen Wärmeschutzes mit den Möglichkeiten zur passiven Nutzung der Solarenergie. Hausnahe Bepflanzungen wie auch direkte Bepflanzung der Fassaden bilden bei richtiger Artenwahl durch Erzeugung windberuhigter Zonen in Außenwandnähe ein wärmedämmendes Polster, das wesentlich zur Reduzierung der Transmissionsverluste beiträgt. Physikalisch ist dieser Effekt durch die Vergrößerung des äußeren Wärmeübergangsvviderstandes t/a a zu erklären, und zwar weist geringer bewegte Luft eine höhere Wärmedämmfähigkeit auf als stärker bewegte Luft. inter Begrünte Fassaden Wärmeschutz im Sommer Q der Energiedurchlässigkeit der Fenster (Verglasung), Q dem Fensteranteil an der Außenfläche, Q der Orientierung der Fenster nach der Himmelsrichtung, Q der Lüftung in den Räumen, Q der Wärmespeicherfähigkeit insbesondere der innenliegenden Bauteile, Q den instationären Wärmeleiteigenschaften der nichttransparenten Bauteile, im wesentlichen der Außenwände. Einzelheiten regelt DIN 4108, Teil 2, Ziffer 7. ^escn utz 2 59 4.. BAUKONSTRUKTION Wände Instationäre Wärmeleiteigenschafters Wärmespeicherfähiykeit Auch zum sommerlichen Wärmeschutz kön- Das Wärmespeichervermögen wächst mit zunen Fassadenbepflanzungen und hinterlüfte- neh mender Bauteildicke. Von einer gewissen teAußenwandkonstruktionen einen positiven Dicke an nimmt es nur noch in geringem Umfange zu. Diese Dicke liegt, für SchwerbeBeitrag leisten, weil bei genügend großem Zwischenraum die angestaute Wärme durch ton bei etwa 8 cm, für Ziegel bei etwa 14 cm und für Gasbeton bei etwa 20 cm. Bei mehrLuftzirkulation entweichen kann (Kaminwir- schichtigen Innenbauteilen kommt es auf die kung). Dicke der einzelnen Schichten und vor allem Außenwände sind wechselnden klimatischen auf ihre Reihenfolge an. Leichte wärmedämBeanspruchungen — Sommer und Winter, mende Schichten auf der Innenseite des RauTag und Nacht— ausgesetzt. Daher ist streng- mes lassen dahinterliegende speicherfähige genommen ein zeitlich konstanter WärmeSchichten nicht oder nur unwesentlich wirkstrom nie vorhanden. Vor allem im Sommer sam werden. Innenliegende Bauteile mit nur verursacht die Sonneneinstrahlung starke, geringer Speicherfähigkeit können im Somsich in unregelmäßigen Abständen wiederho- mer leicht ein unbehagliches Innenraumklilende Temperaturschwankungen. Diese set- ma (Barackenklima) verursachen. zen sich in de r Wand fort, werden dabei gedämpft und machen sich in der Regel erst Schallschutz nach Stunden auf der Wandinnenseite bemerkbar. Bei Wänden mit speziellen Wärme- Bestimmte, relativ steife Dämmplatten köndämmschichten ist diese Erscheinung weni- nen auf Massivwände geklebt eine beträcht li che Verschlechterung der Schalldämmung ger ausgeprägt. bewirken. Der Wärmespeicherfähigkeit von Bauteilen dB kommt im Winter wie im Sommer große Be- deutung zu, da eine gute Speicherfähigkeit zu jeder Jahreszeit ausgleichend auf das In60 nenraumklima wirkt. Unter der Speicherfä.• .• ..... a _• , • higkeit von Bauteilen versteht man deren Eigenschaft, bei Zunahme der Lufttemperatur •• E 50 : Wärme aufzunehmen und diese bei Abnahme E ......•.,..;.• der Lufttemperatur wieder abzugeben. Diese 40 ""m1111111/ -1111111 Fähigkeit wird hauptsächlich durch die Baustoffrohdichte bestimmt und nimmt mit grö= 30 ßer werdender Masse zu. Da die Aufnahme! 100 200 400 800 1600 3200 Frequenz in Hz und Abgabe der Wärme durch die Innenbauteile in Wechselbeziehung zur Raumtempe125 mm Normalbeton, beidseitig Verbundplatten aus 10 mm Hartschaumplatten und 25 mm ratur erfolgt, wirken wärmespeichernde, das Holzwolle-Leichtbauplatten anbetoniert und heißt schwere Bauteile, ausgleichend auf. verputzt; Schwankungen der Raumtemperatur. Soa:ohne Dämmplatten R' = 53 dB b:mit Dämmplatten R' = 42 dB wohl im Sommer (Problematik des SonnenVerschlechterung der Luftschalldämmung schutzes) als auch im Winter (Nachtabseneiner Trennwand durch anbetonierte und kung der Heiztemperaturen) ist dieser Effekt verputzte Dämmplatten zu beachten. 4 . l^. Eine Reihe möglicher Wandkonstruktionen mit Angaben zum bewerteten SchalldämmMaß R' W enthält DIN 4109, ,,Schallschutz im Hochbau", Teil 3, Ziffer 4.3. a [°C] 20 20 16 16 12 12 8 8 4 4 0 16h 500 ® Zeitlicher Verlauf der Lufttemperaturzunahme in Räumen verschiedener Bauarten Leichte Baua rt (p s 500 kg/m3) mittelschwere Baua rt (p=1000 kg/m3) 3 schwere Bauart (=? 1500 kg/m3) Erhöhung der Raumlufttemperatur in Abhängigkeit von der Rohdichte p der raumumschließenden Bauteile Brandschutz Baustoffe—so auch die Dämmstoffe—werden grundsätzlich in brennbare und nichtbrennbare Baustoffe unterschieden. Das Angebot an Wärmedämmstoffen ist so umfangreich, daß für bestimmte Wärmedämm-Maßnahmen immer mehrere Produkte in Frage kommen. Dabei ist das Brandverhalten der Dämmstoffe zu beachten. Mehrschicht-Leichtbaupl. aus Schaumk. und Holzwolle Kork Schaumkunststoff-Ortschaum Schaumkunststoff Holzwolle-Leichtbauplatten Mineralfaserdämmstoff Schaumglas '.. Al, A2 nicht brennbar B1 B2 Einfluß der Rohdichte p der raumumschließenden Bauteile auf die Raumlufttemperaturzunahme brennbar schwerentflammbar brennbar normalentflammbar Brandverhalten Brandverhalten von Wärmedämmstoffen 60 Witterungsschutz Bekanntlich leiten feuchte Baustoffe die Wärme sehr viel besser als trockene. Auf ausreichenden Regenschutz ist daher großer Wert zu legen. NS BAUKONSTRUKTION Die Anforderungen an den Schlagregenschutz werden in DIN 4108, Teil 3, Ziff. 4. beschrieben. Im einzelnen werden die dem Regenschutz dienenden Schichten aufgrund des Wasseraufnahmekoeffizienten (Angabe für die Saugfähigkeit) und der diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (Angabe für die Wasserabgabe durch Verdunstung) bewertet. Man unterscheidet: Wände ^% Gru ppeI II u1 gering Beanspruchung mittel stark Jahresnieder<600 mm <800 mm >800 mm schlag Lage geschützt Hochhäuser und Häuser in exponierter Lage in Gebieten, die aufgrund der regionalen Regenund Windverhältnisse einer " geringen mittleren Schlagregenbeanspruchung zuzuordnen wären, Schlagregenbeanspruchungsgruppen Außenputze aus Mörteln der Gruppen II und III nach DIN 18550 gelten als wasserhemmend und genügen geringer sowie mittlerer Schlagregenbeanspruchung. Gleiches gilt für zweischaliges Verblendmauerwerk ohne Luftschicht nach DIN 1053, Teil 1. Zweischaliges Verblendmauerwerk mit Luftschicht und Wände mit hinterlüfteten Außenwandverkleidungen entsprechen der Beanspruchungsgruppe III. Hinsichtlich anderer Wandbauarten wird auf DIN 4108, Teil 3, Tab. 1, verwiesen. Feuchtigkeitsschutz Tauwasserausfall auf der dem Raum zugewandten Oberfläche sowie im Inneren von Außenwänden führt ebenso zu einer Verschlechterung des Wärmeschutzes wie Durchfeuchtungen aufgrund eines mangelhaften Witterungsschutzes. Als Faustregel für eine einwandfreie Ausbildung in wärmeschutz- wie diffusionstechnischer Hinsicht kann gelten: O Der Wärmedurchlaßwiderstand 1/A der einzelnen Bauteilschichten soll von innen nach außen ansteigen. O Die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke µ s soll von innen nach außen kleiner werden. Regenschutz ^ ^ ^ O wasserhemmende Schichten, O wasserabweisende Schichten, O wasserundurchlässige Schichten (vgl. DIN 18550 E, Teil 1, Putz. Begriffe und Anforderungen). Die Beanspruchung von Gebäuden durch Schlagregen wird durch Einordnen in bestimmte Beanspruchungsgruppen beschrieben. Je nach Windgegend, Höhe des Jahresniederschlages und Lage des Gebäudes werden drei Beanspruchungsgruppen unterschieden: D 1/A / Damit wird deutlich, daß bei lnnendämmungen- abgesehen von dem Problem der zwangsläufig auftretenden Wärmebrücken die Gefahr der Tauwasserbildung auf der raumseitigen Wandoberfläche je nach Wandaufbau gegeben ist. Hinweise auf Außenwände, für die kein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalles infolge Dampfdiffusion erforderlich ist, enthält DIN 4108, Teil 3, Ziffer: 3.2.3. Werden die dort genannten Bedingungen nicht erfüllt, ist eine Diffusionsberechnung nach DIN 4108, Teil 5, notwendig. Außenwände Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an den Mindestwärmeschutz gemäß DIN 4108 werden Außenwände in Konstruktionen 0 leichter ¢auart (flächenbezogene Masse <300 kg/m 2) und 0' schwerer Bauart (flächenbezogene Masse 300 kg/m2) leichte und schwere Bauart unterteilt. Die Mindestwerte der Wärmedurchlaßwiderstände 1/A sind für leichte Außenwände größer als für schwere (vgl. DIN 4108, Teil 2, Tab. 2). Leichte Wandkonstruktionen verhalten sich in thermischer Hinsicht grundsätzlich anders' als schwere. 70 Fenster 60 50 40 30 20 Wand (schwer) 10 Wand (leicht) Sonne (kurzwellig) 0 100 200 300 400 500 Dam pfdiffusion SEMI Mad 0 4 8 12 16 20 24 Tageszeit(h) Der Einfluß leichter und schwerer Baua rt 61 4. BAUKONSTRUKTION Wände Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des Wärmeschutzes einschaliger Außenwände liegt in der Verwendung sogenannter Wär-. medämmputze. Bei den Dämmputzen handelt es sich um mehrere Zentimeter dicke mineralische Putze mit wärmedämmenden Zusätzen. Die wärmedämmende Wirkung ist wesentlich größer als bei üblichen Außenputzen. Dämmputze, die nicht DIN 18550 entsprechen, bedürfen einer bauaufsichtlichen Zulassung. Während über die leichte Wandkonstruktion ebenso wie über das Fenster zu den Zeiten starker Sonneneinstrahlung weniger Wärme verlorengeht, vergrößern sich zu dieser Zeit bei der schweren Wand die Wärmeverluste. Die schwere Wandkonstruktion wirkt also ausgleichend. Die Unterschiede in der Höhe der Wärmeverluste resultieren daraus, daß die leichte Wandkonstruktion etwas besser wärmegedämmt ist als die schwere. einschalige Wände mehrschichtige Wände Bei mehrschichtigen Außenwänden wird ein Teil der Aufgaben der gesamten Wand übertragen (Schallschutz, Brandschutz), während andere bautechnische und bauphysikalische Aufgaben einzelnen Wandschichten zugeordnet werden. Eine zumeist schwere Wandschicht liegt in. der Regel auf der dem Raum zugekehrten Seite und übernimmt die Weiterleitung der Lasten in den Untergrund. Der Witterungsschutz wird durch eine besondere Schutzschicht auf der Wandaußenseite übernommen, während eine Wärmedämmschicht für ausreichenden Wärmeschutz sorgt. Nach der Konstruktion können Außenwände in einschalige (monolithische) und mehrschichtige Wände unterschieden werden. Einschalige Wände sind Wandaufbauten mit einer tragenden Mittelschicht, die üblicherweise beidseitig mit einer dünnen Putzschicht versehen werden und die sämtliche Funktionen als Ganzes erfüllen müssen. Es handelt sich hierbei um langbewährte unkomplizierte Konstruktionen, die bei fachgerechter Ausführung den heutigen Ansprüchen ohne weiteres genügen. Es fällt auf, daß im Bereich schlechter k-Werte bereits geringe Dämmschichtdicken ausreichen, um den Wärmeschutz wesentlich zu verbessern. Diese Erscheinung ist um so ausgeprägter, je schlechter der Wärmeschutz des Restquerschnittes ist. Dagegen sind im Bereich guter k-Werte (k0,5 W/m2 K) immer größere Dämmstoffdickenerforderlich, um noch effizient Energie zu sparen. Weiterentwicklungen während der letzten Jahre haben zu Stoffen geführt, mit deren Hilfe auch die heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz erfüllt werden können. Hier sind unter anderem spezielle Leichtziegel sowie Steine aus Gas- bzw. Leichtbeton zu nennen. Effizienz der Wärmedämmung Die Rechenwerte für die Wärmeleitfähigkeit sind DIN 4108, Teil 4, zu entnehmen. Davon abweichende Werte müssen im Bundesanzeiger veröffentlicht sein. 2,50 Kurve 1: Außenwand 24 cm HLz 1,2 beidseits verputzt + Dämmschicht Kurve 2: Dämmschicht in einer Außenwand 2,00 Weiterhin wird unterschieden zwischen Mauerwerk mit Normalmörtel gemäß DIN 1053, Teil 1, Ziffer 4, und Mauerwerk mit Leichtmauermörtel (Wärmedämm-Mörtel). Bei der Verwendung von Leichtmauermörtel sind hinsichtlich der zulässigen Druckspannungen des Mauerwerks die Ergänzungen zu Tab. 10 der DIN 1053, Teil 1, zu beachten (siehe Ministerialblatt für Nordrhein-Westfalen Nr. 28 vom 3. April 1978). 1,50 E 1,00 = 0,040 W/(mIC)' ?; 0,50 0,00 10 15 d [cm] Abhängigkeit des k-We rtes von der Dämmstoffdicke d 10', AUSSENWAND schwer leicht nicht hinterlüftet Innendämmung mehrschichtig einschalig hinterlüftet n Außendämmung Kerndämmung Wärmedämmputz Außendämmung Thermohaut Vorhangfassade t 9'. 62 Die Tatsache, daß mit der Vergrößerung der Dämmstoffdicke keine lineare Verbesserung des Wärmeschutzes einhergeht, bedeutet aber nicht, daß man nur relativ geringe Dämmstoffdicken wählen sollte, um im Bereich vermutlich effektiver Dämm-Maßnahmen zu bleiben. Wer sich mit einem Minimum an Wärmedämmung begnügt, läuft Gefahr, eines Tages mit wesentlich höheren Kosten eine Verbesserung des Wärmeschutzes vornehmen zu müssen. Wärmedurchgangskoeffizienten k = 0,4 W/m 2K sollten deshalb bereits heute für mehrschichtige Außenwände angestrebt werden. Mehrschichtige Außenwände werden je nach Lage der Wärmedämmschicht in Wände mit Q Außendämmung, Q Kerndämmung, Q Innendämmung unterteilt. Bei der Außendämmung unterscheidet man hinterlüftete und nicht hinterlüftete Konstruktionen. Außenwände aus zweischaligem Mauerwerk mit Luftschicht (vgl. DIN.1053, Teil 1) werden häufig in Norddeutschland eingesetzt. Sie sind bauphysikalisch unproblematisch, aber verhältnismäßig aufwendig. Außen 40°C 30° Sommer 20°C Frost ±0°C -15°C 4 5 Die Ausführung von außenseitigen Wärmedämmschichten mit Putzbeschichtungen (Thermohaut) sollte nur Firmen übertragen werden, welche die Konstruktion als geschlossenes System anbieten. Als Wärmedämmschicht dienen meistens Hartschaumplatten, die stumpf oder mit einer speziellen Randausbildung versehen gestoßen werden. Neuerdings werden auch Systeme mit Wärmedämmstoffen auf mineralischer Basis angeboten. Da Hartschaum nach der Herstellung einem Schwindprozeß unterliegt, sollten geschnittene Hartschaumplatten mindestens sechs Wochen, möglichst aber drei Monate, abgelagert sein. Die Wärmedämmschicht sollte mindestens 4 cm, möglichst jedoch dicker gewählt werden. Der Oberputz wird entweder als Kunststoffputz oder als mineralischer Edelputz ausgeführt. Außen 1 23 2 3 sen sorgfältig gegen Korrosion, Fäulnis und gegen Schädlinge geschützt sein. Der Abstand zwischen Innen- und Außenschale darf bei zweischaligem Mauerwerk 12 cm nicht überschreiten. Die Luftschicht muß in diesem Fa ll mindestens 4 cm dick sein. Damit beträgt die maximal mögliche Dicke für die Wärmedämmschicht 8 cm. Die gleichen Kriterienkönnen für hinterlüftete Außenwandbekleidungen zugrunde gelegt werden. Eine besondere Form des Luftschichtmauerwerks entsteht durch die Verwendung sogenannter Luftschicht-Dämmplatten. Das sind' plattenförmige Dämmelemente mit einer Wärmedämmschicht aus Mineralfasern oder Schaumkunststoff und aufkaschierten bzw. integrierten Lüftungszonen. Planung und Ausführung des Mauerwerks müssen unter Beachtung der Bestimmungen des jeweiligen Zulassungsbescheides erfolgen. 45 11,5 cm Verbiendmauerwerk AR = 1,10 W/(m•K; 4,5 cm Luftschicht 6,0 cm Mineralfaserdammplatten A R = 0,040 W/(m•iO 17,5 cm tragendes Mauerwerk AR = 0,99 W/ (m ia<) 1,5 cm Innenputz AR = 0,70 W/(m • K) k-Wed 0,47 W/(m 2 K). Sommer 1 4,0 cm hi;atursteinplatten 2 4,0 cm Luftschicht 3 ö,fl cm Mineralfaserdämmplatten hR = 0,040 W/(m•K) 4 18 cm Stahlbeton AR = 2,10 W/(m•K) 5 1,5 cm Innenputz aR = 0,70 W/(m K) k-Wed 0,57 W/(m2 K). 60°C 3 s°C Frost ±0°C -15°C 123 12 3 4 Beispiele für zweischaliges Mauerwerk und Vorhangfassade Ähnlich wie das zweischalige Mauerwerk ist die hinterlüftete Außenwandbekleidung (DIN 18516-Außenwandbekleidungen ) bauphysikalisch einwandfrei. Als äußere Bekleidung (Vorhangfassade) kommen Asbestzement platten, Leichtmetalltafeln, Kunststoffelemente, Holzverschalungen, Natur und Kunststeinplatten in Frage. Die Verbindung mit der tragenden Wand erfolgt beim zweischaligen Mauerwerk -über nichtrostende Stahlanker mit mindestens 4 mm Durchmesser und bei Vorhangfassaden je nach Art der Bekleidung über Lattenroste, eingelassene Anker oder spezielle Abstandhalter. DieUnterkonstruktion und Befestigungsmittel müs- 1 0,6 cm mehrlagige, armierte Putzbeschichtung AR = 0,70 W/(m • K) 2 6,0 cm PS-Hartschaumplatten A R = 0,040 W/(m• K) 3 0,4 cm Ansetzkleber A R = 0,35 W/(m•K) 4 24,0 cm Mauerwerk AR = 0,70 W/(m • K) k-Wert 0,50 W/(m2- K). '; 1 1,0 cm mehrlagige, armierte Putzbeschichtung A R = 0,70 W/(m-K) 2 6,0 cm mineralische Fassadendämmplatte AR = 0,040 W/(m • K) 3 24,0 cm Mauerwerk A R = 0,60 W/(m•K) 4 1,5 cm Innenputz AR = 0,70 W/(m • K) k-Wert 0,45 W/(m 2 • K). Beispiele für Außendämmung durch Thermohaut 12 63 4.1 BAUKONSTRUKTION Wände zweischaliges Mauerwerk Die Thermohaut hat sich seit langem bewährt, jedoch ist das diffusionstechnische Verhalten nicht eindeutig (vgl. hierzu DIN 4108, Teil 3, Ziffer 3.2.3.1.3). Von Kerndämmung spricht man, wenn die Wärmedämmung etwa in der Mitte von Außenwänden liegt. Der Zwischenraum bei zweischaligem Mauerwerk kann auf verschiedene Art und Weise ausgefüllt sein: • hydrophobierte Schütt-Dämmstoffe, O Schaumkunststoff-Ortschaum, • hydrophobierte Mineralfaserdämmplatten, O spezielle Hartschaumplatten. Dabei kann im Maximum der Zwischenraum zwischen Innen- und Außenschale von 12 cm voll ausgenutzt werden. Die Verblendung sollte aus Gründen des Feuchtigkeitsschutzes infolge Dampfdiffusion ein möglichst geringes sd aufweisen. (sd = diffusionsäquivalente Luftschichtdicke). Kerndämmungen sind nicht genormt und unterliegen daher der Zulassungspflicht. Bei Verwendung von Mauersteinen mit integrierter Wärmedämmschicht entsteht „einschaliges" Mauerwerk mit Kerndämmung. 1 2,0 cm Außenputz 1 2,0 cm Außenputz NR = 0,87 W/(m•K) NR = 0,87 W/(m- K) 2 9,5 cm Außenschale d. 2 5 ,0 cm Holzwolle- Leichtbauplatten NR =0,093 W /(m-K) Holzspanbetonsteines NR = 0,13 W/(m • K) 3 16,0 cm Kernbeton 2,10 W/(m-K) NR= 3 18,0 cm Kernbeton 2,10 W/(m•K) NR= 4 4,5 cm Innenschale des 4 2,5 cm Gipska rt .-Platten Holzspanbetonsteines NR = 0,21 W /(m•K) NR = 0,13 W /(m•K) 5 1,5 cm Innenputz 5 1,5 cm Innenputz NR = 0,70 W/(m • K) NR = 0,70 W/(m-K) k-We rt 1,05 W /(m 2 • K) k-We rt 0,73 W/m2-K) Beispiele für Manteldämmung 14' Innenliegende Wärmedämmschichten lassen sich preisgünstig anbringen. Es muß aber besonderes Augenmerk auf den Feuchtigkeitsschutz (rechnerischer Nachweis) und die unvermeidlichen Wärmebrücken (siehe Seite 1338) gelegt werden. Innendämmung sollte nur in Frage kommen, wenn • Räume:zeitweise beheizt werden, Q bei Altbauten aus denkmalpflegerischen Gründen die Außenfassade erhalten bleiben soll. 5 1 2,0 cm Außenputz ^R = 0,87 W/(m' K) 2 7,0 cm Außenschale des Hohlblocksteines 2 ' 6,O cm Wärmedämmung NR=0,49 W/(m•K) NR = 0,040 W/(m • K) 3 6,0 cm Wärmedämmung! 3 ' 14,0 cm Stahlbeton NR = 2,10 W/(m K) N R = 0,040 W/(m K) 4 17,0 cm Innenschale 4 ' 0,5 cm Spachtelputz des Hohlblocksteines NR = 0,27 W /(m K) = 0,49 W/(m • K) NR 5 ' 1,5 cm Innenputz NR =0,70 W/(m•K) 1 7,0 cm Stahlbeton als Sichtbeton XR 2,10W/(m.K) k-We rt 0,56 W/(m2 K) 24,0 cm Mauerwerk (frostbeständig) NR = 0,81 W/(m-K) 2 0,7 cm Ansetzkleber NR = 0,35 W/(m-K) 3 4,0 cm PS -Ha rt- k-We rt 0,52 W/(m 2 • K) + Beispiele für Kerndämmung 13 Außenwände mit beidseitiger Wärmedämmung werden entweder aus entsprechenden Schalungssteinen (Holzspanbeton, Schaumkunststoff) oder in Mantelbetonbauart hergestellt. 64 schaumplatten NR = 0,040 W/(m; K) 4 PE-Folie als Dampfbremse 5 1,3 cm Gipskartonpl. ^R =0,21 W/(m•K) k-We rt 0,65 W/(m 2 • K) Beispiele für Innendämmung 16,0 cm Stahlbeton (Sichtbeton) N R = 2,10 W/(m•K) 2 5,0 cm Mineralfaserdämmplatten N R = 0,040 W/(m- K) 3 Alu-Folie als Dampfbremse 4 1,3 cm Gipskartonpl. auf Lattenrost ^R = 0,21 W/(m• K) k-We rt 0,64 W /(m2 K) 15 Die Trombe-Wand besteht im Prinzip aus ei- Winterlicher Wärmeschutz ner schweren, massiven Speicherwand, vor der eine Verglasung angeordnet wird. Sie ist Der Einfluß von Innenwänden auf den winphysikalisch gesehen Kollektor und Speicher terlichen Wärmeschutz ist nur dort von Bedeutung, wo sie Räume mit unterschiediizugleich. chem Temperaturniveau voneinander trenDie kurzweiligen Sonnenstrahlen durchdrin- nen . Dies ist besonders bei Trennwänden zu gen die Glasfassade, werden von der dahinunbeheizten Treppenräumen der Fall. terliegenden Wand mit möglichst dunkler Innenliegende Treppenräume und eingebauOberfläche absorbiert und in langwellige te Treppenräume mit einer Außenwand weiWärmestrahlung verwandelt. Je nach Wandsen in der Regel auch ohne Beheizung Innendicke und Art des Materials wird die aufgetemperaturen von mehr als 10 °C auf und nommene Sonnenenergie unterschiedlich können daher als fremdbeheizt angesehen lange gespeichert, bis sie Stunden später werden. In diesen Fällen kann die Wärmeden dahinterliegenden Wohnräumen als dämmung sowohl an der Treppenraumwand Wärmegewinn zugute kommt. als auch an der Gebäudeaußenwand vorgeDurch bewegliche Sonnenschutzelemente nommen werden. In der Praxis wird man in und Querlüftung innerhalb der Wohnräume kann die Überhitzung während warmer Som- der Regel der zweiten Lösung den Vorzug geben. mertage vermieden werden. Liegt das Treppenhaus vor dem Gebäude und wird dieses nicht beheizt, so liegt die Innentemperatur wesentlich unter der von eingebauten Treppenräumen. Hier ist die Wärmedämmung der Wände zum Treppenraum sinnvoll. Wohnungstrennwände zwischen Wohnungen und zu Nachbargebäuden sind nach dem heutigen Stand der Technik wärmeschutztechnisch von untergeordneter Bedeutung, weil davon ausgegangen werden kann, daß auf beiden Seiten der Trennwände je nach Beheizung in etwa das gleiche Temperaturniveau herrscht. Je größer jedoch der Wärmeschutz der Gebäudehülle wird, desto mehr ist darauf zu achten, daß Wohnräume nicht durch benachbarte Räume indirekt beheizt werden. Bei mittleren k-Werten für das ganze Gebäude von k m - 0,4 W/(m 2K) sollte daher der k-Wert der Innenwände bei 0,7 W/(m2K) liegen. Bisher wurde die Wärmespeicherfähigkeit von Innenbauteilen und ihre Wirkung durch Trombe-Wand 16 das Raumklima von Planern und Konstrukteuren wenig beachtet. Wenn man zukünftig Innenwände vermehrt Niedertemperaturheizsysteme einUnter Innenwänden werden im folgenden al- setzen und die Sonnenenergie als über die Fenster eingestrahlte Wärme nutzen will, le Wände verstanden, die nicht an Außenluft grenzen (Ausnahme: Erdreich). Eine speziel- müssen zur Kompensation der geringeren le Art von Innenwänden sind WohnungsRegelfähigkeit von Heizungsanlagen und tren nwände. zum Ausgleich der Schwankungen der WOHNUNGTRENNWÄNDE ^'^ zwischen Wohnungen zum Treppenhaus leicht mehrschalig zum Nachbargebäude schwer einschalig mehrschalig 1234 'i 7:^It a1#'1n[iRE 2 3 Gipsputz 1 ! Gipsputz 2 ' Kalksandlochsteine KSL 1,4 in Kalkzementmörtel 3 '', Mineralfaser-Trittschalldämmplatte T20/15/1 1. ' fl Dicke Art. Nr.- Schicht cm A 1 Holzspanplatte, Flachpreßplatte : 1,3,1 2 Mineralfaser-Wärmedämmplatte 5,0i WD 050 2,5 3 Luftschicht 4 Holzspanplatte, Flachpreß', 1,3 platte 10,1 , B ;1 I Gipsputz '! 1,5 j 2 ; Kalksandlochsteine KSL 1,4 in ,'24,0 Kalkzementmörtel 3 4 3 4 15, 27,0 1,5 17,5 2,0 4 ! Kalksandlochsteine KSL 1,4 mit Kalkzementmörtel 17,5 5 ! Gipsputz 1,5 40,0 17 65 .1 BAUKONSTRUKTION Wände Trombe-Wand Treppenraumwände Speicherfähigkeit 4.1 BAUKONSTRUKTION Wände Einstrahlungsintensität ausreichend speicherfähige Massen im Innern vorhanden und nutzbar sein. Dies hat zudem den Vorteil, daß besondere Sonnenschutzmaßnahmen zur Verminderung der Wärmebelastung der Räume unter Umständen ganz und gar entfallen können. Um die Speicherfähigkeit so weit wie möglich auszunutzen, müssen möglichst 1. für die Innenbauteile schwere Baustoffe verwendet und 2. wärmedämmende Schichten auf den raumseitigen Oberflächen, wie z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Holzfußböden, dickere Teppichbeläge, vermieden werden, 3. die Wärmedämmschichten von Außenwänden außen liegen. sommerlicher Wärmeschutz Um diesen Zusammenhängen gerecht zu werden, ist in DIN 4108, Teil 2, für Gebäude ohne raumlufttechnische Anlagen ein Kapitel über den sommerlichen Wärmeschutz aufgenommen worden. Danach werden die raumumschließenden Innenbauteile nach leichter und schwerer Innenbauart unterschieden. Bei einer flächenbezogenen Masse, die größer als 600 kg/m2 ist, liegt eine schwere Innenbauart vor. Für die Bestimmung der flächenbezogenen Masse ist zu beachten, daß O bei Innenbauteilen ohne Wärmedämmschicht die Masse zur Hälfte angerechnet wird, O bei Innenbauteilen mit Wärmedämmschicht die Masse derjenigen Schichten angerechnet wird, die zwischen der raumseitigen Bauteiloberfläche und einer Dämmschicht mit ?, R 0,1 W/(m • K) und 1/A ? 0,25 m 2 • K/1N angeordnet wird, höchstens jedoch die Hälfte der Gesamtmasse, O bei Innenbauteilen mit Holz oder Holzwerkstoffen die Schichten aus Holz oder Holzwerkstoffen näherungsweise mit dem zweifachen Wert ihrer Masse angesetzt werden dürfen. Wärmebrücken Wärmebrücken in Außenwänden oder bei Außenwandverbindungen sind örtlich begrenzte Bereiche, die einen geringeren Wärmeschutz aufweisen als die umgebenden Flächen. Die Oberflächentemperaturen auf der Innenseite liegen hier daher meist deutlich niedriger als in den angrenzenden Bereichen. Tauwasserniederschlag, Durchfeuchtungserscheinungen und Pilzbefall sind die `Folge. Der Nachteil von Wärmebrücken ist weniger der durch sie entstehende Wärmeverlust, wenn auch ihr zunehmender Einfluß bei immer höher werdendem Dämmniveau nicht unterschätzt werden darf, als die Tauwasserbildung und daraus resultierende Bauschäden. Für Wärmebrücken sind mindestens die in DIN 4108, Teil 2, Tabelle 1, gestellten Anforderungen einzuhalten, sofern nicht für die ungünstigste Stelle besondere Werte angegeben sind. Vor Heizkörpern darf die Wärme-f, dämmung von Außenwänden nach §2 Abs. 3 der Wärmeschutzverordnung nicht geringer 66 sein als in den anderen Außenwandbereichen. Wärmebrücken werden auf sichere Art und Weise vermieden, indem man das ganze Gebäude konsequent auf seiner Außenseite gegen Wärmeverluste dämmt. Anderenfalls sind konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken zu ergreifen, indem man zusätzliche Wärmedämmschichten im Bereich der Wärmebrücken innen oder außen anordnet. Bei Innendämmung sind gegebenenfalls Dampfsperren vorzusehen. Querlenz Nikolic, V.: Handbuch des energiesparenden Bauens, Wuppertal 1978 (Abb. 1, 8). Wettbewerb Solartypologie Melkerei Landstuhl, Arch. 0. M. Ungers (Abb. 2). Schild u. a.: Bauphysik, Braunschweig 1977 (Abb. 3). Gösele, Schäle: Schall, Wärme, Feuchte, Wiesbaden 1980 (Abb. 4). Heben, H.: Neuer baulicher Wärmeschutz, Braunschweig 1978 (Abb. 11, 12, 13, 14, 15). Literaturhinweise: 1. Forschungs- und Materialprüfungsanstalt BadenWürttemberg, Otto-Graf-Institut: Witterungsverhalten von Wärmedämmputzsystemen. Forschungsarbeit im Auftrage des Bundesministers für Forschung und Technologie. 2. Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., Institut für Bauphysik, Stuttgart : Wärme- und Regenschutz bei zweischaligem Sichtmauerwerk mit Kerndämmung. Forschungsarbeit im Auftrage des Bundesministers für Forschung und Technologie. 3. Außenstelle Holzkirchen des Instituts für Bauphysik der Fraunhofer-Gesellschaft: Untersuchungen über das Verhalten von kunststoffbeschichteten Wärmedämmplatten auf Außenwänden in der Praxis. Forschungsarbeitim Auftrage des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 4. Gertis, K., und Hauser, G., Universität Essen: Sommerlicher Wärmeschutz von Gebäuden. Forschungsarbeit im Auftrage des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. 5. Schild, E., u. a.: Bauschäden im Wohnungsbau, Teil V, Außenwände und Öffnungsanschlüsse, Empfehlungen zur Schwachstellenvermeidung. Forschungsarbeit im Auftrage des Innenministers des Landes NordrheinWestfalen. 6. DIN 4108, Wärmeschutz im Hochbau, Ausgabe Augus1981.; 7. Verordnung über einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden (Wärmeschutzverordnung) vom 11.August 1977. B. Bauen und Energiesparen. Ein Handbuch zur rationellen Energieverwendung im Hochbau. Verlag TÜV Rheinland, Köln, 1979. 9. Hebgen, H.: Neuer baulicher Wärmeschutz. Verlag Vieweg u. Sohn, Braunschweig, 1978. 10. Zapke, W.: Wärmeschutztechnisch einwandfreie Ausbildung der gebäudeumschließenden Bauteile. bei Neubauten RKW-Merkblatt Nr. 55, Hrsg. RG-Bau, Eschborn 1982. Kurzbiografie des Autors: Dipl.-Ing. Wilfried Zapke Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung „Bauphysik und Baukonstruktion" im Institut für Bauforschung e. V., Hannover. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen auf den Gebieten Bauphysik, Energieeinsparung, Wirtschaftlichkeitsfragen, Bauschäden. Redaktionelle Bearbeitung und Layout Dipl.-Ing. Bernd Faskel, Koordination: Prof. Dipl.-Ing. Vladimir Nikolic PIIAXISINRIHMAIIIIN FNERGIE[INSPAHIINB Ein Forschungsvorhaben der Bundesarchitekteru durchgeführt im Auftrage des Bundesminis für Städtebau Raumordnung und Bau.: 3 WilfriedZauAe Dächer Die Funktion eines Gebäudes, seine flächenmäßige Ausdehnung, seine Gliederung und seine Einbettung in die Umgebung bestimmen letztendlich die Dachkonstruktion. Dabei hat der Planer die Aufgabe, unter Berücksichtigung der bauphysikalischen und bautechnischen Gegebenheiten ein Optimum an gestalterischer Qualität bei Respektierung wirtschaftlicher und baupraktischer Belange zu realisieren. Aus bauphysikalischer Sicht werden Dächer in nichtbelüftete und belüftete Konstruktionen („Warmdächer” und „Kaltdächer") unterschieden. Beim nichtbelüfteten Dach grenzen alle Schichten unmittelbar aneinander und bilden in ihrer Gesamtheit eine Schale. Oberflächenschutz +. .a^ • ^^ ^ • :rer^^w: Y• :•+^•: :•' Dachabdichtung _..r •^ rY V ^^ I' •• ^^• :i ^. is • ^^. iii : izinsui T 1^ Ausgleichs► ®i schicht T2 T? I iT i T2 T?'^ i t T 1 T ^T 1 b!: Wärmedämmung Dampfsperrschicht AusgleichsPAirrilia7 schicht Tragkonstruktion Putz Nichtbelüftetes einschaliges Dach ^ --^^,.. ME : .. !^! e Wird für die Tragkonstruktion Gasbeton verwendet, so können Wärmedämmschicht und somit unter Beachtung von DIN 4108, Teil 3, Ziffer 3.2.3.2, auch die Dampfsperre entfallen. Beim belüfteten Dach werden die Bauteilschichten durch eine Luftschicht, die mit der Außenluft verbunden ist und für die nach DIN 4108, Teil 3, Ziffer 3.2.3.3, bestimmte Konstruktionsregeln zu beachten sind, getrennt. Kennzeichen des belüfteten Daches sind also zwei durch eine Luftschicht getrennte Schalen. Außere Schale Oberflächen..^^ .: • Y._ schutz . . •. ; i.• ,.:^ ^. ...... ^_ ^. . = m^in^au^i,^^u t^ü Dachabdichtung Belüftete Luftschicht r111> TT?l?jTh 1 S? Z1 rapp7Ar jar Innere Schale Belüftetes zweischaliges Dach Ausgleichsschicht Dachschalung Wärmedämmung Tragkonstruktion Putz 2 Nichtbelüftete wie auch belüftete Dachkonstruktionen können bei allen üblichen Dachneigungen eingesetzt werden. KONSTRUKT1ON Dachgewicht Eine wesentliche Einflußgröße für dassommeriiche Raumklima ist das Dachqewicht. Leichte Dachkonstruktionen in Verbindung mit großen Fenstern ohne Sonnenschutzmaßnahmen und einem geringen Anteil wärmespeichernder Innenbauteile begünstigen eine hohe Erwärmung im Sommer. Die Temperaturen in Wohnräumen unter dem Dach steigen schnell über das als angenehm empfundene Maß. An leichte Dachkonstruktionen werden deshalb wärmeschutztechnisch höhere Anforderungen gestellt als an schwere. Damit wird die Problematik des sommerlichen Wärmeschutzes leichter Dächer jedoch nur zum Teil erfaßt. Ausreichendes Speichervermögen der Innenbauteile und adäquate Sonnenschutzmaßnahmen dürfen bei der Planung nicht außer acht gelassen werden. Unterscheidungsmerkmal ist das Dachgewicht, genauer die flächenbezogene Masse der raumseitigen Bauteilschichten, und zwar gilt: flächenbezogene Masse < 300 kg/m2— leichte Bauart, flächenbezogene Masse 300' kg/m 2 - schwere Bauart. Hinsichtlich der Bestimmung der flächenbezogenen Masse wird auf die Fußnoten der Tabelle 2 in Teil 2 der DIN 4108 verwiesen. Wärmedämmung Zur Wärmedämmung können alle Wärmedämmstoffe verwendet werden, sofern sie mindestens normalentflammbar sind (Bau, stoffklasse B 2). Wärmebrücken durch nachträgliches Schwinden der Dämmstoffe sind zu vermeiden. Beispielsweise gibt es Polystyrol-Hartschaumplatten, die unter Spannung zwischen den Sparren eingebaut werden und daher in gewissen Grenzen schwinden können. Wenn nicht genormte Baustoffe—wie zum Beispiel Schüttungen — zur Anwendung kommen, sind die entsprechenden Nachweise wie Prüfbescheide, Veröffentlichungen der Rechenwerte des Wärmeschutzes im Bundesanzeiger usw. zu prüfen auf O Geltungsdauer, O Übereinstimmung mit dem Anwendungsfall, O Einhaltung der tangierten Vorschriften. Feuchte Wärmedämmstoffe vermindern den Wärmeschutz erheblich. Durchfeuchtungen, ob sie nun durch mangelhaften Witterungsschutz oder durch Tauwasserbildung im Bautenquerschnitt entstehen, sind daher unbedingt zu vermeiden. Steildächer Bisher konnten Steildächer sowohl in konstruktiver als auch bauphysikalischer Hin67 Leichte und schwere Dachkonstrukticnen Nichtbelüftete und belüftete Ko, ,struktionen Wärmedämmstoffe 4E2 BAUKONSTRUKTION Dächer und Decken Dachgeschoßausbau 11, Wärmedämmung von Steildächern sicht als problemlos gelten. Große, nicht oder nur zu untergeordneten Zwecken genutzte Dachräume, ohne Unterspannbahnen, mit Dachziegeln oder Dachsteinen eingedeckt, wurden automatisch belüftet und sorgten durch ihr großes Volumen für ausreichenden Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich. Durch die Nutzung von Dachräumen für Wohnzwecke werden kompliziertere Dachkonstruktionen notwendig. Dicke Dämmstoffschichten, Dampfsperren und Unterspannbahnen ergänzen den Dachaufbau und verändern das bauphysikalische Verhalten. Lage der Wärmedämmung Soll ein Dachgeschoß in absehbarer Zeit ausgebaut werden, so ist es durchaus sinnvoll, die Wärmedämmung von Anfang an in der Dachebene einzubauen. Ist jedoch geplant, das Dachgeschoß zunächst nicht auszubauen, so ist die Wärmedämmung auf der obersten Geschoßdecke anzuordnen. Andernfalls wird der Dachboden ständig über die oberste Geschoßdecke indirekt beheizt. Die Wärmedämmung von Steildächern kann Q unter den Sparren, Q zwischen den Sparren, Q unter und zwischen den Sparren bei niedrigen Sparren, Q über den Sparren erfolgen. In jedem Fall sollte die Dicke der Wärmedämmschicht 10 bis 12 cm betragen (k = 0,3 W/[m 2K]). Eine Dampfsperre auf der dem Raum zugewandten Seite der Dämmschicht entlastet die außenliegenden Lüftungsquerschnitte. Wo die Dämmschicht liegen kann, hängt von einer Reihe von Faktoren ab, primär von den Sparrenabmessungen. Unter den Sparren wird man nur dämmen, wenn tatsächlich ausreichend Platz im Dachraum vorhanden ist, und über den Sparren, wenn man die Sparren in ihrer ganzen Höhe als gestalterisches Element für das Rauminnere sichtbar bleiben läßt. Um möglichst dicke Dämmschichten zwischen den Sparren einbauen zu können, sind schlanke, hohe Sparren solchen mit gedrungenem niedrigen Querschnitt vorzuziehen. Das bedeutet, daß man mehr Sparrenbzw. Kehlriegeldächer und weniger Pfettendächer konzipiert. Außerdem haben die beiden erstgenannten Dachformen den Vorteil, daß der Dachgeschoßausbau unabhängig von der Tragekonstruktion erfolgen kann. Die Wärmedämmung muß den genutzten Dachraum völlig umschließen. Man kann die Dämmung von der Traufe bis zum First führen: Die Dämmschicht läßt sich auch im Bereich der Dachschrägen und der Kehlbalkenlage anordnen: Wärmedämmung zwischen den Sparren _ Werden die senkrechten Abseitenwände gedämmt, so ist darauf zu achten, Cdaß auch die Decke im Abseitenbereich in die Dämmaßnahmen einbezogen wird: PYA #A -.•-.--41111 ^ ^^ ^ ► ^ ► *^ ^ # ^ # ^ i^ ^+ ^ # ^ ^. ►!^ r'^i^s^j ri ► Wärmedämmung unter und zwischen den Sparren Wärmedämmung Ober den Sparren 3 68 Dachlüftung Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Funktionsfähigkeit zu erhalten, sind beim wärmegedämmten Steildach ausreichend große Lüftungsräume und -öffnungen zwingend. DIN 4108, Teil 3, Ziffer 3.2.3.3, enthält Konstruktionsmerkmale in Form von Mindestwerten, deren Einhaltung eine hinreichende Be- und Entlüftung gewährleistet und einen rechnerischen Nachweis des Tauwasserausfalles infolge Dampfdiffusion erübrigt. Hiernach Kann der freie Strömungsraum über der Wärmedämmung auf 2 cm reduziert, darf aber nicht zusätzlich durch hochgezogene Dämmschichten oder Überlappungen eingeengt werden. Es ist daher— vor allem unter Berücksichtigung baupraktischer Toleranzen — ratsam, die Strömungsraumhöhe nicht zu knapp zu bemessen (Richtwert: 4 cm), damit die Lüftung von der Traufe bis zum First tatsächlich ungehindert erfolgen kann. Im übrigen ist dafür Sorge zu tragen, daß alle Bereiche zwischen Wärmedämmung und Unterspannbahn einerseits und UnterspannKahn und Dacheindeckung andererseits an ,ie Be und Entlüftungsöffnungen angeschlossen sind. schwerentflammbar nach DIN 4102 (Baustoffklasse B 1) und sollten dampfdurchlässig sein. Üblicherweise wird die Unterspannbahn über den Sparren unter einer Konterlattung parallel zur Traufe mit mindestens 10 cm loser Überlappung verlegt. Zur Entlüftung des unterhalb der Spannbahn liegenden Dachraumes muß die hetzte obere Bahn etwa 10 cm unterhalb des Firstes enden. BAUKONSTRUKTION Dächer und Decken Dampfdiffusion *I d Unterspannbahn unter der Konterlattung 8 Unterspannbahn Der nachträgliche Einbau einer Unterspannbahn zwischen den Sparren bildet im allgemeinen nur einen Staubschutz, da die Folie im Traufenbereich•meistens nicht in die Dachrinne eingeführt werden kann. Dachiattung Konterlattung Unterspannbahn / ^^^^^ ^ .. ) /^^// Hr/fl1^i) Unterspannbahn zwischen den Sparren Schornsteine und Dachflächenfenster unterbrechen den Strömungsraum. Es bilden sich stehende Luftpolster verbunden mit der Ge`g hrvon Tauwasserbildung, wenn nicht arch konstruktive Maßnahmen die Weiterführung der Luftschichten sichergestellt wird. Das Durchblasen und auch das Durchfeuchten der Wärmedämmung bei Wind und Re gen muß vermieden werden durch Einbau einer Unterspannbahn. Günstig ist auch eine zusätzliche außenseitige Abdeckung, vor allem bei Faserdämmstoffen. Diese Abdeckung muß dampfdurchlässig sein; die Wärmedämmschicht der Einfachheit halber so einzubauen, daß die Dampfsperre zur Außenseite zeigt, führt über kurz oder lang zu Feuchtigkeitsschäden infolge Dampfdiffusion. Richtig ist vielmehr, die Dampfsperre raumseitig anzuordnen, um die Lüftungsquerschnitte zu entlasten. Platten und Matten müssen dicht gestoßen, gegebenenfalls mit Überlappungen verlegt werden. Unterspannbahn Als Unterspannbahn werden heute in der Regel reißfeste Kunststoffolien (Gitterfolien) verwendet. Diese müssen wasserdicht und 9 Planungskriterien O Die Dicke der Wärmedämmschicht sollte 10 cm nicht unterschreiten (a..R = 0,040 W/[m- K]). O Die Wärmedämmstoffe sind fugendicht einzubauen. O Die innere Schale (unterhalb der Luftschicht angeordnete Bauteilschichten) sollte möglichst eine diffusionsäquivalente Luftschichtdicke µ s von 10 m oder mehr aufweisen. Auf ausreichende Be- und Entlüftung ist O zu achten. Die Luftschicht zwischen Wärmedämmung und Unterspannbahn sollte 4 cm an der ungünstigsten Stelle nicht unterschreiten. O Ein Durchblasen oder Durchfeuchten der Wärmedämmung ist unter allen Umständen zu vermeiden. Flachdächer im Grunde genommen sind Flachdächer den gleichen Beanspruchungen ausgesetzt wie auch die Außenwände, nur unmittelbar und wesentlich intensiver. Das erklärt auch, warum Flachdächer grundsätzlich aus mehreren Schichten bestehen. 69 Vermeidung von Durchfeuchten und Winddurchlässigkeit BAUKONSTRUKTION Dächer Und Decken Funktionsfähigkeit des belüfteten Flachdaches Tauwasserbildung Schichtenfolge im belufteten Flachdach • Be- und Entlüftungsöffnungen Bei schweren, belüfteten Flachdächern über Je komplizierter aber Bauteile aufgebaut sind, desto größer wird die Schadensanfällig- nimmt die untere Schale neben den Schutzkeit. Die Erfahrungen beim Bau von Flachdä- funktionen (Wärmeschutz, Schallschutz, Tauwasserschutz) auch die tragende Funkchern zeigen dies ganz deutlich. tion (Stahlbetondecke o. ä.), während bei Andererseits ist es mit den heute zur Verfüleichten belüfteten Flachdächern die tragengung stehenden hochwertigen Baustoffen Konstruktion zwischen oberer und unterer bei richtiger Planung sicherlich möglich, auf de Schale liegt, z. B. als Holzbalken oder FachDauer einwandfreie Flachdächer zu bauen. werkträger. Die Einhaltung der Flachdachrichtlinien [11 Die obere Schale wird in der Regel als leichte des Deutschen Dachdeckerhandwerks ist Konstruktion ausgeführt, weil ihre Funktion hierfür Voraussetzung. im Prinzip nur darin besteht, gegen Niederschläge zu schützen und das NiederschlagsDachneigung bei Flachdächern wasser sicher abzuleiten. Sie sollte möglichst § 40 der Musterbauordnung sieht vor, daß einen Oberflächenschutz, z. B. in Form einer Dächer die Niederschläge sicher ableiten 5 cm dicken Kiesschüttung, erhalten. müssen und die Dachhaut gegen Einflüsse der Witterung widerstandsfähig sein muß. Leichte belüftete Flachdachkonstruktionen Unter diesem Aspekt erhebt sich die Frage, sind häufig anzutreffende, preiswerte Däob die sogenannten Nullgraddächer, also Dä- cher. Auf die Problematik des sommerlichen cher, die ohne jedes Gefälle ausgeführt werWärmeschutzes infolge geringer Dachgeden, vertretbar sind, zumal sich Dachkonwichte wurde bereits hingewiesen. struktionen infolge ihres Eigengewichts und` Die Funktionsfähigkeit des belüfteten Flachder Nutzlasten stets durchbiegen . daches hängt ähnlich wie die des wärmegeDas führt unter anderem dazu, daß die in dämmten Steildaches vor allem von der StärAuflagennähe angeordneten Einläufe in den ke des Luftstromes zwischen den beiden Hochpunkten der Dachflächen liegen und Schalen ab. Dabei ist zu bedenken, daß der das Niederschlagswasser bereichsweise auf thermische Auftrieb beim Flachdach wegen der Dachhaut verbleibt. der fehlenden Höhenunterschiede wesentlieh geringer ist als beim Steildach. Auch Es scheint daher angebracht, Flachdächer wenn nach DIN 4108, Teil 3, Ziffer 3.2.3.3.1, grundsätzlich mit einer Dachneigung von 3° die Höhe der Luftschicht auf 5 cm reduziert auszuführen, wie dies bei der Verwendung werden kann, sollte sie wegen der baustelvon Holzwerkstoffen; z. B. Spanplatten, lenbedingten Ungenauigkeiten möglichst durch die „Richtlinien für die Bemessung 10 cm oder mehr betragen. und Ausführung von Dachschalungen aus Holzspanplatten oder Bau-Furnierplatten Stellt sich keine oder eine zu geringe Luftverbindlich vorgeschrieben ist. strömung ein, wirkt die Luftschicht wie eine zusätzliche Wärmedämmschicht. Die Folge Belüftete Flachdächer ist Tauwasserbildunq auf der Unterseite der oberen Schale. Das belüftete Flachdach (häufig als „Kalt dach" bezeichnet) ist ein zweischaliges Dach mit oberer und unterer Schale und einem dazwischenliegenden, von außen belüfteten Hohlraum. Die Schichtenfolge im belüfteten Flachdach 0 ist zwingend (von unten nach oben): ^ ^^.^- ^^^^ D Unterkonstruktion, Zr O Dampfbremse (zweckmäßig), ^ ^#^ l% ^i Q Wärmedämmung, Q Luftschicht, belüftet, Diffusionsstrom Q Dachschalung, Dachabdichtung, O Tauwasserbildung im belüfteten Flachdach O Oberflächenschutz. Abweichungen können zu Bauschäden fühSelbst bei ausreichender Durchlüftung wird ren. die einströmende trockene Luft durch von unten eindiffundierenden Wasserdampf mit Dachabdichtung zunehmender Luftschichtlänge immer feuchOberflächenschutz ter, bis sie ab einer bestimmten Länge keinen I^ ^^^^ Ausgleichsweiteren Wasserdampf mehr aufnehmen \ I/k. \`;;: :^,^^^i®•^^; schicht _..: Dachschalung kann. Es kommt zur Tauwasserbildung auf ^i ^^••--'s:.. <aT//%U^% Tragkonder Unterseite der oberen Schale. Yn, struktion Die unterhalb der Luftschicht angeordneten Luftschicht, belüftet Bauteilschichten müssen nach DIN 4108, Teil (s? 10 cm) 3, Ziffer 3.2.3.3.1, eine diffusionsäquivalente Wärmedämmung Luftschichtdicke µ s aufweisen, die minde(s.? 10 cm) stens 10 m beträgt.' Dampfbremse (µ s m) Die Be- und Entlüftungsöffnungen müssen Untermindestens 2Voo der Dachgrundrißfläche bekonstruktion tragen; dieser Mindestwert darf keinesfalls Belüftetes Flachdach unterschritten, wohl aber überschritten wer10 den. ^ ^1j^^112i^ 1 t̀'T^i ^^t ^ f 70 Das kombinierte Umkehrdach ist besonders geeignet für nachträgliche Wärmedämmaßnahmen bei noch intakter Dachabdichtung. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, ist ein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalles infolge Dampfdiffusion nach DIN 4108, Teil 5, zu führen. Bereiche, die ohne Luftaustausch bleiben, sind unter allen Umständen zu vermeiden. Bei gewinkelten, versetzten und gestaffelten Bauten ist bereits im Planungsstadium zu prüfen, ob alle Dachbereiche durchlüftet werden können. Weitergehende Konstruktionsempfehlungen sind in den im Anhang zu den „Flachdach richtlinien" abgedruckten „Hinweisen für die Planung zur Be- und Entlüftung bei belüfteten Dachkonstruktionen` enthalten. Konventionelles Flachdach Beim konventionellen Flachdach ist der Tauwasserbildung im Bauteilquerschnitt besondere Beachtung zu schenken. Mit der Abdichtung liegt eine extrem dampfdichte Schicht auf der Dachaußenseite, so daß unter der Dachhaut häufig gewisse Tauwassermengen ausfallen, die ihrerseits Ursache für zahlreiche Bauschäden sind. Mit Ausnahme einschaliger Dächer aus Gasbeton ist daher eine Dampfsperre unterhalb der Wärmedämmung zwingend. Planungskriterien O Die Dicke der Wärmedämmschicht sollte 10 cm nicht unterschreiten ( R = 0,040 W/[m • K]). O Die Wärmedämmstoffe sind fugendicht zu verlegen, möglichst zweilagig und mit versetzten Stößen zur Vermeidung von Wärmebrücken. O Die untere Schale sollte eine diffusionsäquivalente Luftschichtdicke µ •_,s von mindestens 10 m aufweisen, wenn die in DIN 4108, Teil 3, Ziffer 3.2.2.2, angegebenen Klimabedingungen eingehalten wer- 13 DIN 4108, Teil 3, Ziffer 3.2.3.2.1, schreibt in diesem Zusammenhang vor, daß bei Dächern mit einer Dampfsperre unter oder in der Wärmedämmschicht die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s d der Dampfsperre mindestens 100 m betragen muß, wobei der Wärmedurchlaßwiderstand der Bauteilschichten unterhalb der Dampfsperrschicht höchstens 20% des Gesamtwärmedurchlaßwiderstandes betragen darf. Im übrigen ist darauf zu achten, daß die Wärmedämmung trocken verlegt wird. Durch feuchte Dämmstoffe „eingebautes" Wasser verschlechtert den Wärmeschutz nachhaltig, da es durch die Dachhaut nach oben und die Dampfsperre nach unten nur sehr langsam austrocknen kann. Unter der Abdichtung Zit^ . y ^ii^ew ^^^^^i tr^^i 'rrro1^^y^i• ^^'Qy.!N. 1^j 2TSM t ASST2̀liTt:L ?T n^^n^n^n^^u^^^(^ ^i%^^ i^^ I^ Dampfsperre Nichtbelüftetes konventionelles Flachdach Nichtbelüftetes Flachdach Konventionelles Dach Weitergehende Konstruktionsempfehlungen Oberflächenschutz Dachabdichtung Dampfdruckausgleichsschicht Wärmedämmung (s >_ 10 cm) Dampfsperrschicht ( II •s?100m) Ausgleichsschicht Trag- und Unterkonstruktion Gleitlager den. O Die Luftschicht zwischen oberer und unterer Schale sollte 10 cm an der ungünstigsten Stelle nicht unterschreiten. O Ein Luftaustausch zwischen Wohnraum und Dachraum darf nicht stattfinden. O Die Dachneigung sollte wenigstens 3° betrageh. O Die Dachabdichtung sollte nur wenn notwendig durchstoßen werden. Jede Durchdringung der Dachhaut bildet eine potentielle Schwachstelle. O Bestehen Zweifel an der Wirksamkeit der belüfteten Luftschicht, bietet sich das nichtbelüftete Flachdach als Alternative an. Nichtbelüftete Flachdächer Das nichtbelüftete Flachdach (häufig als „Warmdach" bezeichnet) ist ein einschaliges Dach, bei dem der Dachaufbau unmittelbar an die Unterkonstruktion grenzt. Bezogen auf die Lage der Wärmedämmung im Verhältnis zur Dachabdichtung werden drei Arten des nichtbelüfteten Flachdaches unterschieden: 4.2 BAUKONSTRUKTION Dächer und Decken Über der Abdichtung Kombiniertes Umkehrdach • ^^rr ^^:^^^ l ^ s S^r •t / ♦^l ^17-Ais.:ii^i, ^.v i ^1 •^.• Y 1 tiT t?i ij ii?l?tt12171!lt ji12 j11 il!1!iti2i2it1TtöL11fät1t:!i!Ztätl21tit12sZltltitit q Ar 's 1 i^irn grer ^^ ^nr^^ ^i^l^ Umkehrdach 7 ^.. ^ s1r jr^o^ ^!^^ ^id r ° V^ V:i .^.::+^ d Pp!:. • lis.i : ,.^^. ±+^rtt i!l T I?11tTl tl®T ® .4W it a% n^^^i^^n ^i ^^n^^ 2 71 Nichtbelüftetes Flachdach BAUKONSTRUIMON Dächer Und Decken Oberflächenschutz Eine direkt der Sonneneinstrahlung ausgesetzte Dachhaut ist extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Im Sommer sind Temperaturstürze zwischen 50 °C und 60 °C nach plötzlichen Regenschauern keine Seltenheit. Aus solchen Temperaturschwankungen herrührende Spannungen sind häufig Ursache für Risse und Ablösungserscheinungen. Als wirksamer Oberflächenschutz hat sich eine mindestens 5 cm dicke Kiesschüttung aus hellem, rundem Material mit der Körnung 16/32 mm erwiesen. Bei der Bestimmung des Wärmeschutzes von Umkehrdächern gilt abweichend vom übhchen Rechnungsgang die folgende Regelung [2]: Q Als Rechenwert für die Wärmeleitfähigkeit der Dämmplatten ist der in DIN 4108 für Schaumkunststoffe nach DIN 18164 festgelegte 2LR-Wert einzusetzen. Q Der nach DIN 4108 in der jeweils geltenden Fassung erforderliche WärmedurchIaßwiderstand 1/A für Decken, die Aufenthaltsräume nach oben gegen die Außenluft abschließen, ist um 10% zu erhöhen. o Bei der Berechnung des vorhandenen Wärmedurchgangskoeffizienten k0 ist der errechnete k-Wert um einen Betrag 6. k nach folgender Tabelle zu erhöhen: Planungskriterien Q Die Dicke der Wärmedämmschicht sollte 10 cm nicht unterschreiten ?.R = 0,040 W/[m •K]). Q Die Wärmedämmstoffe sind fugendicht zu verlegen, möglichst zweilagig und mit verAnteil des Wärmedurchiaßwiderstandes Erhöhung unterhalb der Dachhaut in % des gesamten des k-Wertes setzten Stößen, um Wärmebrücken zu Wärmedurchiaßwiderstandes 4 k W/(m 2 K) vermeiden. Q Die Dampfsperre muß unter der Wärme-, 0,08 * 0-5 dämmung liegen. Q Die diffusionsäquivalente Luftschichtdik0,06 5;1 -20 ke 1.1 s der Dampfsperre sollte unter Beachtung der in DIN 4108, Teil 3, Ziffer 0,04 20,1 -40 3.2.2.2, angegebenen Klimabedingungen mi ndestens 100 m betragen. 40,1 -60? 0,02 Q Die Dachneigung sollte wenigstens 3° betragen. > 60 Die Dachdichtung sollte nur wenn notQ * Dieser Wert ist stets anzusetzen, wenn der Wärmewendig durchstoßen werden. Jede Durchdurchlaßwiderstand der Unterkonstruktion < 0,1 m 2 KAW beträgt, dringung der Dachhaut bildet eine poten15 tielle Schwachstelle. Q Ein wirksamer Oberflächenschutz dämpft Planungskriterien Temperajurschwankungen, bietet zusätz- Q Die Dicke der Wärmedämmschicht sollte lichen Schutz gegen mechanische Be12 cm nicht unterschreiten (A R = 0,040 schädigungen und erhöht die LebensW/[m . K]). dauer der Dachabdichtung. Q Dämmstoffplatten sind fugendicht zu verlegen und sollten an den Kanten gefalzt Umkehrdach sein, um ein Unterströmen bei Regen zu Umkehrdach Das Umkehrdach unterscheidet sich vom vermeiden. konventionellen Flachdach dadurch, daß die Q Die Dämmstoffplatten werden häufig lose Wärmedämmschicht über der Dachabdichverlegt. Ihr Aufschwimmen muß durch tung liegt. Damit ist die Schichtenfolge aus ausreichend hohe Auflast verhindert werdiffusionstechnischer Sicht richtig und bei den, z. B. Kiesschüttung oder Plattenbeeinwandfreier Ausführung ist kein Tauwaslag. Darüber hinaus sind die erhöhten serausfall im Bauteilquerschnitt zu erwarten. Windlasten in den Rand- und Eckbereichen der Flachdächer zu berücksichtigen. Q Zwischen der Dämmschicht und der Kiesschüttung sollte eine diffusionsoffene Kiesschüttung -^ ^^viIW .,:. .,.. termatte, z. B. aus Polyesterfaservlies s^ ^ ^.1^. e^ . Rieselschutz (mindestens 150 g/m2), verlegt werden, Wärmedämmung um das Unterschwemmen der Dämmplat(s ;? 12 cm) ten mit Feinkornanteilen zu verhindern. Dachabdichtung Q Ein Teil des Regenwassers läuft in der AusgleichsEbene zwischen Dämmstoffplatten und schicht Dachhaut ab. Auch diese Ebene ist an die Stahlbetondecke Dachentwässerung anzuschließen. Putz O Der umgekehrte Dachaufbau sollte nur auf Unterkonstruktionen mit möglichst Umkehrdach großem Wärmespeichervermögen eingesetzt werden, damit sich Temperatur14 absenkungen durch Unterströmen der Dämmplatten kaum auf der DeckenunterDämmstoffe für Umkehrdächer dürfen auf seite bemerkbar machen. Dauer keine Feuchtigkeit aufnehmen und müssen frostbeständig, trittfest, formbeständig und verrottungssicher sein. Es dürfen nur Dämmstoffe verwendet werden, deren Eignung durch eine bauaufsichtliche Zulassung nachgewiesen ist. Fortsetzung in DAB 6/82. `•^^ . 72 Genutzte Dachflächen gen im Verlauf eines Jahres von etwa 100 °C auf etwa 30 °C vermindern. Je nach Beanspruchungsart werden nichtgenUlzte und genutzte Dachflächen unterschieden. Beanspruchung der Dachoberfläche Nicht genutzte Dachflächen Genutzte Dachfläch irile Aufenthalt von Personen, Nutzung durch Verkehr, Bepflanz, Wartung und Instandhaltung 16 Ein wichtiger Aspekt ist beim heute häufig praktizierten verdichteten Flachbau die Begrünung von Dächern als Ersatzfür die bebauten Flächen. Zwar können Klimaverhältnisse erst dann entscheidend beeinflußt werden, wenn die Dachbegrünung zum festen Bestandteil modernen Bauens geworden ist, jedoch auch Einzelmaßnahmen können punktuell ökQjogische Verbesserungen bewirken. Der Beitrag von über der Dachabdichtung liegenden Schichten begrünter Dächer zum winterlichen Wärmeschutz ist relativ gering, da diese Schichten stets durchfeuchtet sind. Sie entsprechen in etwa einer Schichtdicke von 10 bis 15 mm eines Dämmstoffes mit der Wärmeleitfähigkeit ? R = 0,040 W/(m • K). Nur wenn es gelingt, durch entsprechende Artenwahl auf der Dachoberfläche ein relativ stabiles Luftpolster zu schaffen, können die Wärmeverluste infolge des größeren Wärmeübergangswiderstandes 1/äa auf der Außenseite verringert werden. Dagegen wird die Beanspruchung der Dachabdichtung infolge Sonneneinstrahlung durch Begrünung wesentlich geringer, da sich die möglichen Temperaturschwankun- Extensive Begrünungen *at tA Rasen Oberste Geschoßdecke Decken unter nicht ausgebauten Dachgeschossen grenzen Wohnräume gegen nicht beheizte Bereiche ab und sind damit Bestandteil der wärmeübertragenden Umfassungsfläche. In jedem Fall ist die Wärmedämmung auf und nicht unter der Decke anzuordnen, weil Q die Ausführung kostengünstig, Q die Verlegung der Wärmedämmung einfach, Q die bauphysikalisch richtige Anordnung gewährleistet ist. amozzaza Schutzschicht Gleitschicht Dachhaut - Vegetationsschicht Filterschicht' Dränschicht Die Begrünung von Dächern ist bei Beachtung der technischen Vorschriften und Regeln sowie beim Einsatz bewährter Baustoffe keine besondere Problemstellung. Q Die Trennfolie über der Dachabdichtung muß wurzelbeständig sein. Q Die Dachanschlüsse müssen so gestaltet sein, daß die Vegetation nicht in sie hineinwächst. Q Für die Vegetationsschicht sind spezielle Substrate entwickelt worden, die wesentlich leichter sind als normaler Mutterboden. Die Schichthöhe ist je nach der beabsichtigten Bepflanzung zu bemessen. Q Die Bepflanzung muß dem örtlichen Klima entsprechen und soll ein Maximum an Verdunstung, Luftfilterung und Sauerstoffabgabe besitzen. Q Die Begrünung darf keine brennbaren Beläge bilden. Q Begrünte Dächer sind in der Regel zweimal im Jahr zu warten, im Frühjahr zur Vorbereitung der Vegetationsperiode und im Herbst zur Vorbereitung der Ruhezeit. Q Die Erfahrungen von Herstellern, die Dachbegrünungen als System anbieten, sollten genutzt werden. cc—. Bodenbedeckende Stauden Einjährige, Pflanzen Stauden Bodenbedeckende Gehölze Bäume Großsträucher Kleine Bäume 0,1-5 5-25 i ir: o^iit üüir %%iiiI/i^iIiii/i üi ü 35-65 MIR -- 90-120 Schichtdicken der Dränschicht und der Vegetationsschicht bei begrünten Flachdächern (Fo rtsetzung aus DAB 5/82) 73 Begrünung von Dächern Wärmeschutz bei nicht ausgebautem Dachgeschoß Kellerdecke Sobald die Kellerräume eines Gebäudes nicht beheizt werden, ist die Kellerdecke Bestandteil der wärmeübertragenden Umfassungsfläche und gegen Wärmeverluste zu BAUKONSTRUKTION schützen. Aber auch wenn Kellerräume nur 2 Dächer und Decken zeitweilig beheizt werden. sollte eine Wärmedämmung der Kellerdecke erfolgen. Der Fußboden muß nämlich, damit Fußkälte vermieden wird, eine bestimmte Oberflächentemperatur aufweisen. Bei einer Lufttemperatur im Warme tz nicht be izt beheizten Raum von 20 °C sollte diese zwiICeI schen 16 und 19 °C liegen. 4 Kellerdecken können auf der Ober- und/oder 1 Spanplatten der Unterseite wärmegedämmt werden. Bei 2 Mineralfaserdämmplatten zwischen Lageroberseitiger Dämmung sollte ein schwimhölzern (s ? 10 cm) 3 Stahlbeton-Decke mender Estrich nach DIN 4109, Teil 4, einge4 Deckenputz baut werden, da dann gleichzeitig die Anforderungen sowohl an den Wärmeschutz als auch an den Schallschutz erfüllt werden. Als Dammstoffe für die Deckenunterseite sind unter anderem geeignet Platten aus Beispiel für die Wärmedämmung einer obersten Geschoßdecke Q Holzwolle, 18 Q Mineralfasern, Q Schaumkunststoffen. Q Schaumglas. ermeidung von Eine unterseitige Dämmung empfiehlt sich itiger Dämmung nicht, weil Es werden auch sogenannte Verbund Latten aus Gipskarton und Schaumkunststoff bzw. Q Wärmebrücken unvermeidlich sind, Mehrschicht-Leichtbauplatten aus Holzwolle Q die Geschoßhöhe vergrößert werden muß, und Schaumkunststoff angeboten, die einum das Mindestmaß für die lichte Raumfach anzubringen sind und bereits eine Behöhe einzuhalten, kleidung der Dammschicht aufweisen. Q eine raumseitige Dampfsperre erforderlich wird, 0 Mehrkosten gegenüber der auf der Oberseite angeordneten Wärmedämmung entstehen. 4.2 Auf der Decke können praktisch alle Dämmstoffe verlegt werden; auch Schüttungen sind möglich. Auf`sorgfältiges und fachgerechtes Einbringen der Wärmedämmung ist zu achten. Fugendichte Verlegung ist Voraussetzung für einwandfreie Funktionsfähigkeit. Die Dicke der Dämmschicht sollte 10 bis 12 cm betragen (A R = 0,040 W/[m K]). Eine obere Abdeckung der Dämmschicht ist immer dann angezeigt, wenn die Fläche nicht nur zu Reparaturzwecken betreten werden soll. Als Abdeckung sind plattenförmige Baustoffe, z. B. Spanplatten, geeignet. Werden die Dachgeschosse zu untergeordneten Zwecken genutzt, z. B. als Trockenboden, empfiehlt sich der Einbau eines schwimmenden Estrichs nach DIN 4109, Teil 4. Damit ist ein hinreichender Trittschallschutz sichergestellt. Wenn der Diffusionswiderstand der Abdekkung hoch ist — das gilt z. B. für Fußböden aus PVC o. ä. —, ist eine Dampfsperre vorzi sehen. Sie ist unterhalb der Wärmedämmung, also auf der Decke, anzubringen. lm Zweifelsfall ist ein rechnerischer Nachweis zu führen (DIN 4108, Teil 5). Brandverhalten Eine ausreichende Durchlüftung des ungenutzten Dachbodens muß stets gesichert sein, da sich sonst Tauwasser unter der Dachhaut oder Unterspannbahn, aber auch in anderen Bereichen, bilden kann. Das Tauwasser tropft auf die Wärmedämmung, durchnäßt sie und verhindert ihr Dämmvermögen. 74 ^ // ^/,‚ ^^ " Y+1^^ ll tlftrtslMirr rfrytrWrrt►Lr 7ttirtttilit+l . 2 ^^1j 2^?♦ t 1 2 3 4 3 4 Zementestrich Mineralfaser- Trittschalldämmplatte Stahlbeton -Decke Ps-i-lar,s-hai;mpi 4 te Beispiel für die Wärmedämmung einer Kellerdecke Dämmplatten unter der Decke werden entweder nachträglich durch Kleben, Dübeln oder Schießen befestigt oder vor dem Betonieren der Decke in die Schalung eingebracht. Dampfsperren sind im Regelfall nicht notwendig. Im Zweifelsfall sollte ein rechnerischer Nachweis nach DIN 4108, Teil 5, geführt werden. Das Brandverhalten der Wärmedämmstoffe sowie die bauaufsichtlichen Vorschriften hinsichtlich des Brandschutzes sind unbedingt zu beachten. Das gilt vor allem für Decken über Heizräumen und Brennstofflagerräumen. Nach unten gegen Außenluft abgrenzende Decken Zu den unten gegen Außeniu_ ft abgrenzenden Decken zählen Q Deckenbereiche auf der Unterseite aufgeständerter Gebäude, Q die Unterseite auskragender Gebäudeteile, O Decken über Durchfahrten, auch wenn sie durch Tore geschlossen sind, O Decken über in Gebäude integrierten Garagen, Q Decken über belüfteten Kriechkellern. Nach DIN 4108, Teil 2, Tabelle 1, muß der Wärrnedurchgangskoeffizient mindestens betragen: kmin = 0,50 W/(m 2K) bei Bauteilen mit hinterlüfteter Außenhaut, km,, = 0,51 W/(m 2K) in allen übrigen Fällen. Das bedeutet, daß die gesamte Dämmstoffdicke je nach Deckenkonstruktion in der Größenordnung von 6 bis 7 cm liegt ( = 0,040 W/[m • K]). Nach unten gegen Außenluft abgrenzende Decken sollten auf jeden Fall einen schwimmenden Estrich nach DIN 4109, Teil 4, erhalten. Nur dann wird ein ausreichender Schall schutz (Flankenübertragung) sichergestellt. Die Wärmedämmung ausschließlich auf derDeckenoberseite in Verbindung mit einem schwimmenden Estrich wird im allgemeinen zu in der Praxis kaum realisierbaren Lösungen führen. Ein Teil der Dämmung wird daher sinnvollerweise auf der Deckenunterseite angeordnet. Diese Wärmedämmschicht muß den mit der Außenluft in Verbindung stehenden Deckenbereich einschließlich aller Unterzüge, Vor- und Rücksprünge vollflächig umhüllen. Bereits im Planungszustand ist zu prüfen, ob durch die vorgesehene Wärmedämmaßnahme alle Flächen vollständig erfaßt werden und somit keine Wärmebrücken verbleiben. jNNj+Nrrtrtriri+Zrl►i•n^rtTt71r1r^iT7trnlririi^ti7FFlUier /^^ ^^ ^ ^ // 3 ^^/ r^_^- - ♦- 7 .0.r^.^►^,^^ 1 rT r^l^j"'^' ^t^i^^ 1 Zementestrich 2 PS-Hartschaumplatte 3 Stahlbeton-Decke 4 Meh rschicht-Leichtbauplatte 5 Außenputz Beispiel für die Wärmedämmung einer nach unten gegen Außenluft abgrenzenden Decke ohne Hinterlüftung 20 Als Wärmedämmstoff eignen sich vornehmlich plattenförmige Materialien, wie z. B. Q Schaumkunststoff, Q Mineralfaser, Q Kork, Q Schaumglas. Die Wärmedämmplatten können entweder nachträglich auf der Deckenunterseite durch Kleben, Dübeln, Nageln, Schießen u. ä. befestigt oder vor dem Betonieren in die Schalung eingelegt werden. Die Wärmedämmung auf der Deckenunterseite sollte möglichst vor Beschädigungen oder anderen schädlichen Einflüssen geschützt werden. Diese Schutzschicht kann direkt auf die Wärmedämmung aufgebracht werden (z. B. Kunststoffputz) oder aber in Form abgehängter Decken aus hinreichend formbeständigen Baustoffen (z. B. Blechen aus Stahl oder Aluminium, Kunststoff, Holz).: 1 7 ilrr.rnxlTji1rjTjTtrli2r2lj11dt7jTl`lTtr2o t171717lBdrNlli // // +^ rT ♦^1^^^l^^^^^^`^I^f^i^^^1^^^ti / 3 1 Zementestrich 2 Mineralfaser-Trittschalldämmplatte 3 Stahlbeton-Decke 4 Mineralfaserdämmplatte5 Luftschicht, belüftet' 6 Aluminium-Profilblech Beispiel für die Wärmedämmung einer nach unten gegen Außenluft abgrenzenden Decke mit Hinterlüftung 21 Auskragende Balkonplatten sind Wärmebrücken und führen häufig zu Bauschäden, z. B. Feuchtigkeitserscheinungen in den oberen Raumecken der darunterliegenden Räume. Zur Vermeidung dieser Nachteile sind grundsätzlich zwei Wege möglich: 0 Die Balkonplatte wird durch konstruktive Maßnahmen vom Baukörper weitgehend oder unter Umständen vollständig getrennt. Dies kann durch Auflager für die Balkonplatten in Form von Konsolen, Stützen oder Wandscheiben geschehen. 0 Können Balkonplatten jedoch nur als auskragendes Teil der Geschoßdecke konzipiert werden, ist diese Geschoßdecke unter- und oberseitig zu dämmen. Fensterstürze sind in die Wärmedämmaßnahme mit einzubeziehen. Die letztgenannte Lösung bringt zudem eine erhebliche Verbesserung des Wärmeschutzes der Decke mit sich. 75 4.2 BAUKONSTRUKTION Dächer und Decken Decken nach unten gegen Außenluft Verbesserte Lösungen Ungünstige Lösung :a>)tl:s rl.lf+rrnravrl.l.TJ^.1 TrSr3Utr! ^izUrlllt . ,.^'" BAUKONSTRUKTION /r Dächer Una Decken f!(!!If1llllttflt.rl.Ir^Iri ttrölI4i2, i,,3,:s..rrvtr..rrrr 22 Wärmedämmung der Wo ungstrenndecken Schallschutz Literaturhinweise [1] Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen— Flachdachricht!in!en —, Helmut Gros Fachverlag, Berlin, 1982. 1. Je besser die Gebäudehülle gedämmt [2]Bundesanzeiger Nr. 223 vom 29. November 1978, wird, desto größer können bei unterBundesanzeiger Verlagsgesellschaft, Köln. schiedlicher Beheizung der Wohnungen [3]DIN 4108 „Wärmeschutz im Hochbau", Ausgabe „Wärmeverluste" innerhalb des Gebäudes August 1981, Beuth Verlag GmbH, Berlin. werden. [4]Verordnung über einen energiesparenden Wärme2. Weniger beheizte Wohnungen (Räume) schutz bei Gebäuden (Wärmeschutzverordnung) vom 11. August 1977, Bundesgesetzblatt 1978, Teil I, S. 1581 ff. entziehen gut beheizten Wohnungen (Räumen) Heizwärme und verfälschen die [5]Institut für Bauphysik der Fraunhofer-Gesellschaft, Stuttgart, Wärmetechnische Untersuchungen an Wänverbrauchsabhängige Heizkostenabrechden und Flachdachkonstruktionen —Stufe 2: Flachdänung. cher; Forschungsarbeit im Auftrage des Bundesministeriums für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Daher sollen bei km-Werten von 0,4 W/(m2K) für die Gebäudehülle die k-Werte der Woh[6]Schild, E. u. a.: Schwachstellen. Bauschadensverhütung im Wohnungsbau. Band 1: Flachdächer, Dachnungstrenndecken in der Größenordnung terrassen, Balkone. Bauverlag, Wiesbaden, 1977. von 0,7 W/(m 2K) liegen. Speziell bei der Pla[7]abc der Bitumen-Bahnen —Technische Regeln—. nung von Fußbodenheizungen ist in Absprache mit dem Heizungsfachmann eine ausrei- VDD Industrieverband bituminöse Dach- und Dichtungsbahnen e. V., Frankfurt, 1980. chende Wärmedämmung der Decken vorzu[8]Bauen und Energiesparen. Ein Handbuch zur rationelsehen. len Energieverwendung im Hochbau. Verlag TÜV Rheinland, Köln, 1979. Auf der Unterseite von Decken angeordnete Wärmedämmschichten können in gewissen [9]Hebgen, H.: Neuer baulicher Wärmeschutz. Verlag Vieweg u. Sohn, Braunschweig, 1978. Fällen ebenso wie auf der I nnenseite von Außenwänden liegende Dämmschichten eine [10]Zapke, W.: Wärmeschutztechnisch einwandfreie AusVerschlechterung des Schallschutzes bewir- bildung der gebäudeumschließenden Bauteile bei Neubauten, RKW-Merkblatt Nr. 55, Hrsg. RG-Bau, Eschborn, ken. 1982. Einer erhöhten Wärmedämmung der Wohnungstrenndecken wird man zukünftig besonderes Augenmerk schenken müssen. a: 2 cm Ausgleichs- estrich dB 8 Jc 7 N b: 3 cm Estrich , = 2,5 cm Holzwolleichtbauplatten ä Kurzbiografie des Autors: 6 T, 100 200 400 800 1600 3200 Frequenz in Hz Falsche (a) und richtige (b) Anwendung von Dämmplatten bei Massivplattendecken 76 Dipl.-Ing. Wilfried Zapke Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung „Bauphysik und Baukonstruktion" im Institut für Bauforschung e. V., Hannover. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit Hegen auf den Gebieten Bauphysik, Energieeinsparung, Wirtschaftlichkeitsfragen, Bauschäden. Redaktionelle Bearbeitung und Layout Dipl.-Ing. Bernd Faskel, Koordination: Prof. Dipl.-Ing. Vladimir Nikolic 23 PRAXISINIOR EN[HI[EINSPAH Btn horsCr, nc ^IRfo mehrende 8 1111 If :KeMttlnr..,. . ... lesminiyp tSurcrge•_ y wr€asseR' _. Chdi.. Lnt}. v .nd 9ar Ausführungsmöglichkeiten Immer häufiger werden in Kellergeschossen Nutzräume, wie z. B. Hobbyräume, Spielzimmer, Gästezimmer, Partyräume u. a. untergebracht, oder Wohnhäuser werden aus Kostengründen überhaupt nicht unterkellert. In diesen Fällen müssen Bauwerksohle und Kel-4Z^^..11a^ Jun( 1981 i lerwände nicht nur gegen im Boden vorhandenes Wasser abgedichtet, sondern zur Gewährleistung eines hygienisch einwandfreien Raumklimas auch hinreichend wärmegedämmt sein. Die in der Praxis vorhandenen Möglichkeiten zeigt die nachfolgende Obersicht: Ausführungsmöglichkeiten 2. A ^V1 A.. r M .. ^ An Erdreich grenzende Bauteile .*--, Außenwände , ,. Jl :Vg<r, 4.7: Einschalig A .L^^ .., Mehrschichtig9 ^aM. ^ .v'`iC^^^Y,;.3^o,^^. It ---..... Bauwerkssohle ^.. i 44f v tt `V,ZIffiat,r,RK, ^^,:.. ^,"^•ir.^3^ ^{^yo-^ .e^.^ '^+yi^^:7.°fEi:;t4. Kerndämmung Ill it I I Art A B $^ ^ ^^ ^° ^.^ > ^.' Innendämmung Außendämmung E D 1 3' ^ ^^^-^ü.bs^.riFe^ _ gy ^f °^°. I . i, 12 ... :. Nicht unterkellert ^'}t,,y^^, ^ ^^.`SE ,SiY^.:^^^MP±^;:A,?^c!iyii3" :n C 'I • e ^ Jl^ Innendämmung B ^.^ ^'^' Unterkellert .. I `'^'$iVan^,^^, 4^ a. 3 Nr. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 4 li:11 :r^ h^o wl • 3 4567 12 Schicht 3lagiger Bitumenanstrich Zementputz Leichtziegel Kalk-Gipsputz 3lagiger Bitumenanstrich Zementputz Stahlbeton Luftschicht/Ansetzbinder MineralfaserWärmedämmplatte Aluminiumfolie Gipskartonplatte T•[ r_ _r'3: ':r.^ Dicke cm 0,1 2,0 36,5 1,5 0,1 2,0 20,0 1,5 5,0 Art C 1 2 3 4 Nr. 1 2 3 4 D 1 2 3 4 5 1,25 E 6 1 2 Leichtziegel: >,,R -. - 0,34 W/(mK) Wärmedämmschicht: ,1 R .' - 0,040 W/(mK) I -- i -3.i:' ^:'.'..'.'::':'.,^-1 2 3 4 1 3 4 5 6 Schicht Bituminöse Abspachtelung Stahlbeton Polystyrol-Extruderschaum- Wärmedämmplatten Hochbauklinker in Zementmörtel Wellasbestzementplatten Polystyrol-Extruderschaum- Wärmedämmplatten Bitumenspachtelung Zementputz Mauerziegel in Kalkzementmörtel Kalk-Gipsputz Zementestrich auf Polyäthylenfolie Hartschaumplatte auf Polyäthylenfolie Stahlbeton-Sohlplatte Sauberkeitsschicht Dicke cm 0,3 20,0 6,0 11,5 6,0 6,0 0,3 2,0 36,5 1,5 4,0 5,0 , 12,0 5,0 77 Wärmeschutz und Feuchtigkeit Den Abdichtungsmaßnahmen kommt besondere-Bedeutung zu, da feuchte Baustoffe bekanntlich Wärme wesentlich besser leiten als trockene. BAUKONSTRUKTION Erdberührerrde Bauteile Einfluß feuchter Wärmedämmstoffe Hinsichtlich der Ausführung und Bemessung von Abdichtungen wird verwiesen auf: O DIN 18195 „Bauwerksabdichtungen" im Zusammenhang mit O DIN 4031 „Wasserdruckhaltende bituminöse Abdichtungen für Bauwerke", O DIN 4117 „Abdichtung von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit", O DIN 4122 „Abdichtung von Bauwerken gegen nichtdrückendes Oberflächenwasser und Sickerwasser mit bituminösen Stoffen, Metallbändern und KunststoffFolien". 1 Dämmschicht 2 Betonfertigteil 3 Fundament und Bodenplatte 4 Mauerwerk 5 untere horizont. Wandund Bodenabdichtung 6 horizontale Abdichtung in Spritzwasserhöhe 7 vertik. Wandabdichtung 8 Bekleidung auf Unterkonstruktion 9 beheizter Raum \\\\\\\\\\\\\\\\^^ ^`L .^' ^^ I J 0 10 50 60 20 30 40 Volumenbezogener Feuchtegehalt, % 4 Polystyrol-Hartschaum 1 Gasbeton p = 19 kg/m3 p = 540 kg/m 3 5 Polyurethan-Hartschaum 2 Leichtbeton p = 1140 kg/m3 p = 35 kg/m3 3 Ziegel 6 Mineralfaserplatten p = 1556 kg/m 3 p = 61 kg/m3 Wärmeleitfähigkeit in Abhängigkeit vom volumenbezogenen Feuchtegehalt Wärmeleitfähigkeit steigt linear zum Feuchtigkeitsgehalt Isolierung im Baugrund • .: \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\`. ^\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\ 2 Bereits im Planungsstadium muß die zu erwartende Belastung des Gebäudes durch Wassereinwirkung ermittelt werden. Es ist zu unterscheiden: O Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser, O nichtdrückendes Wasser (stauendes Sickerwasser), O außendrückendes Wasser (Grundwasser). Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser sind im allgemeinen bei nichtbindigen, gut durchlässigen Böden wie Kies und Sand anzutreffen. Stauendes Sickerwasser tritt auf bei nichtwasserdurchlässigen Böden wie Lehm, Ton, Mergel, Klei und bei Hangbebauungen. Im Bereich der Baugrubenverfüllung versickert hier Oberflächen- und Schichtenwasser, wobei es sich vor den Kelleraußenwänden aufstauen kann. 78 ^j^r ^^^ i^^^r^^' y^^^%^ ^•;^•;•^,, ••a..^^ '^,•\\\\\\ 3 \\\\\ •e•;i^^.^ ^• e ^^ ^..r \\\\\\\\\\\\ . •S•.^iiJ•: • .••i+.•ä ., ., ^'^•^'e•^ ^!^ `3° Mit Ausnahme der überwiegend geschlossenporigen Schaumkunststoffe steigt die Wärmeleitfähigkeit praktisch linear zum Feuchtigkeitsgehalt an, wenn auch mit unterschiedlicher Neigung. Bei den Hartschäumen erstreckt sich der lineare Verlauf nur bis etwa 15 Vol.-%. Grundwasser übt von außen einen hydrostatischen Druck auf die Abdichtung aus. In Anbetracht der wechselnden Grundwasserstände ist die Kenntnis des höchsten Grundwasserstandes von großer Bedeutung. 5 •. : Q `o gc Beispiel für die Wärmedämmung und die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit nichtunterkellerter Gebäude 3 / / ^ ^ Bodenfeuchtigkeit • ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^\ ^\\\\\\\\\\\\\\\\\^\ ^ ^^ ar ^^; i i\\ —gir-ossfx ,1,^, •O\\^\\\\\\\\\\\^! o. ..,.^.\ ^ 7- r,^_ 1 i ^ /•`,: .;';;; ^^ii; O ^:•'•^• ^:•...:^^^, :;; 3 y/ ^^;^:!.^r•r;< ^^^ ^=,.^;^.; • / 1 Dämmschicht 2 Abdichtung 3 Putz 4 Mauerwerk 5 Innenputz 6 untere horizontale Wandabdichtung 7 Dränplatten (Kunstst.) 8 Filtermatte 9 Kiespackung mit Dränage 10 obere horizontale Wandabdichtung 11 Keller beheizt D '/// ^^^^^^ g^/^^^ i G^^ 6 // // // // / r•. // ///// 1 tIolfr rI'iLO!^:!:i^=^ i:^^: i:^'^^•a•:.'i•. ..::. ...: •.. .^.' Beispiel für die Wärmedämmung und die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit unterkellerter Gebäude Einschalige Kellerwände Bei Verwendung gut dämmender Wandbaustoffe ist es durchaus möglich, die Außenwände beheizter Kellerräume einschalig auszuführen. Auf eine sachgemäße Abdichtung gegen Feuchtigkeit von außen ist zu achten. 413 Kunststoff-Noppenbahn BAUKONSTRUKTION extrud. PS -Hartschaumplatten (s = 6 _ 7 cm) .o bituminöse Abdichtung Außenputz Mauerwerk aus wärmedämmenden Steinen (s = 36,5 - 49,0 cm) Erdberührende Bauteile bituminöse Abdichtung Mauerwerk (s = 24 ± 36,5 cm) Innenputz Außendämmung mit extrudierten Polystyrol-Hartschaumpiatten Die außenliegende Dämmschicht bildet selbst ke i ne ausreichend w ir ksame Sickerund Filterschicht. Diese ist vielmehr durch Verwendung sickerfähiger und filterstabiler Verfüllmaterialien im Arbeitsraum, z. B. Kiesschüttung oder durch spezielle Sickerschichten, z. B. Dränplatten, herzustellen. Einschalige Außenwand eines beheizten Kellerraumes 5 Mehrschichtige Kellerwände Grundsätzlich können Wärmedämmschichten bei Kellerwänden sowohl auf der Außen- Eine Außendämmung —wenn auch nicht im Sinne der o. g. Definiton, da die Wärmedämmschicht noch außenseitig durch Auftrag einer Spachtelmasse abgedichtet wird — kann mit Schaumglas nach DIN 18174 ausgeführt werden. als auch auf der Innenseite angeordnet werden. Welcher Ausführungsart im Einzelfall der Vorzug zu geben ist,-hängt neben anderen Kriterien, auf die noch einzugehen sein wird, von den angetroffenen Grundwasserverhältnissen und den daraus resultierenden Abdichtungsmaßnahmen ab. Dränplatte bituminöse Abdichtung Schaumglas (s = 6 ± 7 cm) Außendämmung von Kellerwänden bituminöser Kleber Von außenseitig angeordneten Dämmschichten bei an Erdreich grenzenden Außenwänden spricht man, wenn diese außerhalb der Dichtungsschichten liegen. Sie sind damit der Feuchtigkeit im Boden ausgesetzt. Für die außenseitige Dämmung spricht, daß O die Dämmschicht bauphysikalisch richtig angeordnet ist, O Wärmebrücken durch einbindende Decken und Wände vermieden werden, O die Dämmschicht die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und vor Beschädigungen schützen und damit Bauschäden verhindern helfen, O die Dämmschicht leicht angebracht werden kann. Nach den geltenden Bestimmungen, Wärmeschutzverordnung und DIN 4108, dürfen-ä6--ßenliegende Dämmstoffschichten von an Erdreich grenzenden Bauteilen bei der Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes nicht berücksichtigt werden. Eine Ausnahme bilden Wärmedämmstoffe, die sich durch eine besonders geringe Wasseraufnahme auszeichnen, wie z. B. extrudierte PolystyroiHartschaumplatten. Einzelheiten sind in der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt. Mauerwerk (s = 24 ± 36,5 cm) Innenputz a =l eau^3eTis tiger Dimmung „Außen"-Dämmung mit Schaumglas 7 Innendämmung von Kellerwänden Bei nur zeitweise beheizten Kellerräumen ist die Innendämmung wegen der geringen Anheizzeiten und dem damit verbundenen geringeren Wärmeverbrauch der Außendämmung vorzuziehen. Bei nachträglichen Wärmedämmaßnahmen an Kellerwänden stellt die Innendämmung die kostengünstigste Lösung dar, wenn nicht im Rahmen einer umfassenden Sanierung die Kellerwände ohnehin von außen freigelegt werden. Zu beachten ist in diesen Fällen jedoch die dampfdiffusionstechnisch ungünstige Lage der Wärmedämmschicht auf der Innenseite der Abdichtungsschicht, die in der Regel einen sehr hohen Dampfdiffusionswiderstand aufweist. Durch die Verwendung von Dämmschichten mit einem hohen Dampfdiffusions79 Ba+,aufsichtliche Z^,lassung Tauwasserschutz 4.3 BAUKONSTRUKTION Erdberühren de Bauteile widerstand (genauer: wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke p.. s) oder auf der Innenseite der Wärmedämmung aufgebrachter dampfsperrender Schichten (Aluminiumfolie) vermeidet man die Tauwasserbildung. Im Zweifelsfall ist ein rechnerischer Nachweis durchzuführen (siehe DIN 4108, Teil 5). /,i ^/, //,, l ^j /^^,.,^ Gleichmäßige Wärmeverluste bei unterkellerten Gebäuden l 1= Q 1 13 kcal 2i F. //^,^► = %^ Ij j^j ; bituminöse Abdichtung Mauerwerk (s = 24,0 - 36,5 cm) M ineralfaserdämmplatte (s = 5 ± 6 cm) Aluminiumfolie Gipskartonplatte 1-T0-48157;5 ., m 1,0 461 unterkellerten Gebäuden s:l Z:. 2,0 m...::..:...:.. Temperaturfeld unter der Sohle eines finnischen Versuchshauses mit Radiatorenheizung innenseitige Wärmedämmung einer Kelleraußenwand gegen Erdreich 8 Richtwerte Zur Erzielung behaglicher Oberflächentemperaturen wird empfohlen, Außenwände mit einem Wärmedurchlaßwiderstand 1/A von etwa 1,3 m2K/W zu konstruieren. Dies entspricht einer Dämmstoffdicke zwischen 5 und 6 cm (A R = 0,040 W/[m-K]). Die Dicke des tragenden Querschnitts gemauerter Kelleraußenwände richtet sich nach DIN 1053 Teil 1, Tabelle 1. Bauwerkssohle Unter Bauwerkssohlen ist je nach der Größe der Bodenpressungen eine Außendämmung nicht möglich oder aber nur mit hohen Kosten realisierbar. Wirtschaftlich sinnvoller ist es, auf der Oberseite der Sohlplatte einen schwimmenden Estrich auszuführen. Wegen möglicher Durchfeuchtungen der Wärmedämmschicht ist unter dieser eine Abdichtung, z. B. als Folienahrlichtiumg , notwendig. Die ohnehin bei schwimmenden Estrichen erforderliche Abdeckung der Dämmschicht ist als Dampfsperre auszubilden, insbesondere bei Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Zementestrich auf Kunststoff-Folie 4r4i^^+i^i+^i^^► ^^•^' \ X\ \\ \ \\ \ \ \ \ \ \\ \ \\\\\\\\\\ \\\\ \\\\%\\\\\\N\\ i: ° .:a.... Korkplatten auf Kunststoff-Dic htu ngsbahnen. (s=4-5 cm) Stahlbetonplatte .'° 9 Die. unter der Wärmedämmschicht liegende Abdichtung_gegenaufsteigende Bodenfeuchtigkeit ist an die untere waagerechte Ab-. dichtung in der Außenwand .._anzuschließen, am einfachsten gemäß Abb. 3 und Abb... , 4, 80 10 In der Randzone, die nach skandinavischen und französischen Untersuchungen etwa 1 m breit ist sollte dahe r ein erhöhter Wärmeschutz vorgesehen werden. Man kann in diesem Bereich in etwa die Verhältnisse für erdberührte Kelleraußenwände zugrundelegen. Quellen: Achtziger, J.: Bedeutung der Wärmeleitfähigkeit und der Wasserdampfdurchlässigkeit im Bauwesen, VDI-Seminar „Baulicher Wärmeschutz" 1977 (Abb. 2). Prof. Dr.-Ing. Erich Schild; Dipl.-Ing. Rainer Oswald, Lehrstuhl für Baukonstruktion Ill der RWTH Aachen: Wärmeschutz von erdberührten Gebäudeaußenflächen — Querschnittsbericht (Abb. 3, Abb. 4). Vuorelainen, 0.: The temperatures under houses erected immediately on the ground and the heat losses from their foundation slab, Dissertation, Helsinki 1960 (Abb. 10). Literaturhinweise: 1. Schild, E. und Oswald, R.: Wärmeschutz von erdberührten Gebäudeaußenflächen — Querschnittsbericht, Forschungsarbeit im Auftrage des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 1980. 2. Schild, E. u. a.: Bauschäden im Wohnungsbau, Teil VII, Schwachstellen an Kellern und Dränagen (Schäden, Ursachen, Konstruktions- und Ausführungsempfehlungen), Forschungsarbeit im Auftrage des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen, 1978.. 3. DIN 4108, Wärmeschutz im Hochbau, Ausgabe August 1981. 4. Verordnung über einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden (Wärmeschutzverordnung) vom 11. August 1977. 5. Bauen und Energiesparen, Ein Handbuch zur rationellen Energieverwendung im Hochbau, Verlag TÜV Rheinland, Köln, 1979. 6. Hebgen, H.: Neuer baulicher Wärmeschutz, Verlag Vieweg u. Sohn, Braunschweig, 1978. 7. Zapke, W.: Wärmeschutztechnisch einwandfreie Ausbildung der gebäudeumschließenden Bauteile bei Neubauten, RKW-Merkblatt Nr. 55, Hrsg. RG-Bau, Eschborn 1982. Sauberkeitsschicht Wärmedämmung eines Kellerfußbodens Abdich 12"C. 1,5 I Erhöhter Wärmeschutz in der R dzune bei nicht- Bei Kellerfußböden sind die Wärmeverluste gleichmäßig verteilt und relativ gering. Eine 4 cm dicke Wärmedämmschicht ( AR = 0,040 W/[m-K]) als Bestandteil des schwimmenden Estrichs reicht im allgemeinen aus. Abweichende Verhältnisse liegen dagegen bei Fußböden nicht unterkellerter Gebäude vor, da in den Randzonen der Sohlplatte höhere Wärmeverluste auftreten als in dem Mittelbereich. Kurzbiographie des Autors: Dipl.-Ing. Wilfried Zapke, Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung „Bauphysik und Baukonstruktion" im Institut für Bauforschung e. V., Hannover. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit liegen auf den Gebieten Bauphysik, Energieeinsparung, Wirtschaftlichkeitsfragen, Bauschäden. Redaktionelle Bearbeitung und Layout Dipl.-Ing. Bernd Faskel, Koordination Vladimir Nikolic. PRAXISINHIRMAUON EN(HGIEIINSPAHIIN6 KONSTRUKTION Fenster BAU- Forschungsvorhaben der Bundesarchitekten .:.^mr durchgef hrt lm Auftrage des Bundesminist,r,u: für Städtebau. Raumordnung und Bauwe Allgemeine energetische Kriterien Die Energiegewinnung durch das Fenster ist der wesentliche Teil der sogenannten passiven Solarenergienutzung. Im Gegensatz zur aktiven Ausnutzung der Sonnenenergie, z. B. Son nenkollektoren, wurden bei den passiven Maßnahmen keine haustechnischen Anlagen zur Verwertung der eingestrahlten Sonnenenergie angewandt. Die direkte und diffuse Son nenenergieeinstrahlung wird durch die transparenten Bauteile in das Innere des Gebäudes hereingelassen und mittels Speichermasse in den Räumen für die Schaffung eines beheizten Raumklimas genutzt. Fenster übernehmen in diesem Zusammenhang die Funktion des „Sonnenkollektors". Diese Betrachtung der Fenster, als Gewinn- und Verlustflächen, entwickelte sich erst in den letzten Jahren durch die Zunahme der Forschung über die Energiebilanzen von Gebäuden (siehe Lit.). Die Fenster gelten nach der bislang vorherrschenden Betrachtung als wärmetechnisch schwächste Glieder in der Gebäudehülle. Legt man den geltenden k-Wert W/m 2K Wärmedurchgangskoeffizient zugrunde, so ergibt sich bei durchschnittlicher Ausführung der Fenster (Zweifachverglasung) ein etwa dreimal so hoher Wärmeverlust wie an einer gleichgroßen Außenwandfläche üblicher Bauart. Bei dieser Betrachtungsweise bleibt jedoch unberücksichtigt, daß durch ein Fenster Wärme mittels direkter und indirekter Sonneneinstrahlung gewonnen wird. Das energetische Verhalten setzt sich zusammen aus den Energiegewinnen durch die Sonneneinstrahlung, Energieverlusten durch die Transmission der Wärme und aus den Lüftungswärmeverlusten durch Fugen-Fensterrahmen und -Flügel sowie zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Die Einstrahlungsgewinne werden von folgenden Kriterien bestimmt bzw. wesentlich beeinflußt: Meteorologische Kriterien In der Bundesrepublik Deutschland nimmt das Son nen-Strahlungsangebot von Süden nach Norden ab. Die mittlere winterliche Außenlufttemperatur steigt wiederum in dieser Richtung an. Im Norden herrschen höhere mittlere Außentemperaturen. Diese gegenläufige Tendenz bewirkt einen Ausgleich der Heizenergieverbräuche, da Orte im Norden und Westen gegenüber Orten im Süden neben geringen Strahlungswerten auch kleinere Heizgradtagzahlen aufgrund der höheren Außenlufttemperaturen aufweisen. Bauliche Kriterien Orientierung der Fenster Wegen des unterschiedlichen Strahlungsan- Verfasser: Prof. Vladimir Nikoüc März 1981 gebotes der vier Haupthimmelsrichtungen hängt der mögliche strahlungsbedingte Wärmegewinn stark von der Orientierung des Fensters ab. Leider kann das Strahlungsangebot in den Übergangsmonaten nicht in allen Fällen voll genutzt werden. Je nach zugrundeliegenden baulichen Randbedingungen kann bei den nach Süden orientierten Fenstern die eingestrahlte Energie zu 50% bis 90%, dagegen bei den nach Norden orientierten zu 90% bis 100% wärmetechnisch verwertet werden. Die geringere Verwertbarkeit der eingestrahlten Sonnenenergie im Süden ist auf die begrenzte Speicherfähigkeit von innenliegenden Bauteilen und durch bewirkte Überhitzung des Raumes zurückzuführen. Größe des Fensters Der Einfluß der Fenstergröße ist direkt abhängig von der Orientierung zur Himmelsrichtung und von der thermischen Qualität der Konstruktion. Bauart der Raumumschließungsflächen Die Speicherkapazität von innenliegenden Bauteilen (Wände, Decken und Böden) beeinflussen die Verwertbarkeit der durch Fenster gewonnenen Energie. Bei einer durchschnittlichen Fenstergröße von 20% bis 30% der Außenwandfläche wird bei einer leichten Bauweise (geringe Speicherkapazität) der Raumumschließungsflächen die Ausnutzung der Sonneneinstrahlung um etwa 15% niedriger als bei einer schweren Bauweise ausfalfen. Bei nordorientierten Fenstern beträgt die Differenz weniger als 7%. Dieses physikalische Phänomen wird häufig mit dem Begriff — leichte Bauweise erzeugt „Barackenklima" — bezeichnet. Veränderungen des Wärmebedarfs eines Raumes, bedin gt durch unterschiedliche Wärmedämmungen der Raumumschließungsflächen bzw. der internen Wärmequellen. wirken sich hinsichtlich der Ausnutzbarkeit der Sonneneinstrahlung in ähnlicher Weise aus wie entsprechende Variationen des Fensterflächenanteils. Die Veränderungstendenz ist jedoch umgekehrt: Mit Zunahme des Wärmebedarfs steigt die Ausnutzbarkeit der Sonneneinstrahlung an. Passive Solarenergienutzung durch Fenster Einfluß der Fenstergröße Direkte und indirekte Sonneneinstrahlung Energieverluste des Fensters Transmissionswärmeverluste Diese Verluste werden in Form von k-Werten Wärmedurchgangskoeffizient in W/m2K-in der DIN 4108 Tabelle 3 schon in der Wärmeschutzverordnung verbindlich festgeschrieben. Der mittlere k-Wert eines Fensters setzt sich zusammen aus dem k-Wert des Fensterrahmens und aus dem k-Wert der jeweiligen Verglasung. Der durchschnittliche Rahmenanteil wird mit 30% der gesamten Fensterfläche angenommen. 81 nsmissionsrvärmevertuste F ra k- Rechenwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten für Verglasungen (kv) und für Fenster und Fenstertüren einschließlich Rahmen (k F ) DIN 4108, Teil 4 .4 BAUKONSTRUKTION Fenster Zeile 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Beschreibung der Verglasung Unter Verwendung von Normalglas Einfachverglasung Isolierglas mit 6 bis 5 8 mm Luftzwischenraum Isolierglas mit > 8 bis < 10 mm Luftzwischenraum Isolierglas mit > 10 bis 5 16 mm Luftzwischenraum Isolierglas mit zweimal > 6 bis 5 8 mm Luftzwischenraum Isolierglas mit zweimal > 8 bis 5 10 mm Luftzwischenraum Isolierglas mit zweimal > 10 bis 5 16 mm Luftzwischenraum Doppelverglasung mit 20 bis 100 mm Scheibenabstand Doppelverglasung aus Einfachglas und Isolierglas (Luftzwischenraum 10 bis 16 mm) mit 20 bis 100 mm Scheibenabstand Doppelverglasung aus zwei Isolierglaseinheiten (Luftzwischenraum 10 bis 16 mm) mit 20 bis 100 mm Scheibenabstand 2 Sondergläser 3 Glasbausteinwand nach DIN4242 mit Hohlglasbausteinen nach DIN 18 175 1 Fenster und Fenstertüren einschließlich Rahmen kF für Rahmenmaterialgruppe' I W/m2K) 2.2 I 2.3 I 2.1 I 5,8 5,2 3,4 2,9 3,2 3,3 3,6 4,1 3,2 2,8 3,0 3,2 3,4 4,0 3,0 2,6 2,9 3,1 3,3 3,8 2,4 2,2 2,5 2,6 2,9 3,4 2,2 2,1 2,3 2,5 2,7 3,3 2,1 2,0 2,3 2,4 2,7 3,2 2,8 2,5 27 2,9 3,2 3,7 2,0 1,9 2,2 2,4 2,6 3,1 1,4 1,5 1,8 1,9 2,2 2,7 Verglasung kv W/(m 2 - K) 3 Sondergläser werden nicht berücksichtigt, da sie einen ungünstigen Einfluß auf die Wärmegewinne durch die Fenster haben. 3,5 la Die Einstufung von Fensterrahmen in die Rahmenmaterialgruppen 1 bis 3 ist wie folgt vorzunehmen: Gruppe 1: Fenster mit Rahmen aus Holz, Kunststoff und Holzkombinationen (z. B. Holzrahmen mit Aluminiumbekleidung) ohne besonderen Nachweis oder wenn der Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens mit kR < 2,0 W/(m 2 • K) Anmerkung: In die Gruppe 1 sind Profile für Kunststoff-Fenster nur dann einzuordnen, wenn die Profilausbildung vom Kunststoff bestimmt wird und eventuell vorhandene Metalleinlagen nur der Aussteifung dienen. Gruppe 2.1: Fenster mit Rahmen aus wärmegedämmten Metall- oder Betonprofilen wenn der Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens mit kR < 2,8 W/(m 2 • K) Gruppe 2.2: Fenster mit Rahmen aus wärmegedämmten Metall- oder Betonprofilen, wenn der Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens mit 3,5 > kR > 2,8 W/(m 2 K) Abstand gegenüberliegender Stege a mm Anteil der Kunststoffverbindung an der Dämmzone mit X'..?... 0,17 W/(m • K) Dicke der Dämmzone smm bei Verbindung der Innen- und Außenschale der Metallprofile mit Kunststoff Dämmstoff oder Luft b1+62 IS 0,4- b > 7 >12 > 12- >9 b i + 6 2 > 0,4 - b Gruppe 2.3: Fenster mit Rahmen aus wärmegedämmten Metall- oder Betonprofilen, wenn der Wärmedurchgangskoeffizient des Rahmens mit 4,5 > kR > 3,5 W/(m 2 • K) Abstand Dicke der gegenüber- Dammzone liegender Stege s mm a mm Ante il der Kunststoffverbindung an der Dämmzone mit a.>0,17 W/(m - K) Dicke der Stifte Abstand der Stifte mm mm <3 >200 bei Verbindung der Innen- und Außenschale der Metallprofile mit Kunststoff Dämmstoff oder Luft b1+6250,4• b b,+b 2 > 0,4 • b > 3 >10 > 5 >10 >5 > 10 bei Verbindung der Innen- und Außenschale der Metallprofile mit Stiften Dämmstoff oder Luft Gruppe 3: Fenster mit Rahmen aus Beton, Stahl und Aluminium sowie wärmegedämmten Metallprofilen, die nicht in die Rahmenmaterialgruppen 2.1 bis 2.3 eingestuft werden können, ohne besonderen Nachweis. Bei Verglasung mit einem Rahmenanteil < 15% dürfen in der Rahmenmaterialgruppe 3 (ausgenommen Zeile 1.1) die kF-Werte um 0,5 W/(m 2 • K) herabgesetzt werden. 1b 82 Thermischer Einfluß des Fensterrahmens Der Einfluß des Rahmenanteils auf den mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten von Fenstern bei Verglasung mit Isolierglas (12 mm LZR). Bei thermisch minderwertigen Fensterrahmenkonstruktionen (z. B. ungedämmte, Metall) und einer hochwertigen Verglasungsart (z. B. Drei- bis Vierfachverglasung) soll der Anteil des Rahmens reduziert werden. Hierzu sind neue Konstruktionen zu entwickeln. Eine eindeutige Verbesserung des thermischen Verhaltens von solchen Fenstern ist sinnvoller durch die Reduzierung des Rahmenanteils zu erreichen als durch die thermische Verbesserung der Rahmenkonstruktion. mittl. Wärmedurchgangskoeffizient km des Fensters in W/m 2 K 1 Aluminiumrahmen 2 Alu-wärmegedämmt 3 Holzrahmen Thermischer Einfluß der Verglasung — Energiegewinne durch die Glasflächen Der Baustoff Glas besitzt folgende physikalische Eigenschaften: Ein normales Glas läßt 78% bis 90% der kurzwelligen Sonnenstrahlung durch. Daraus leitet sich der sogenannte Treibhaus- oder Gewächshauseffekt von Glasflächen ab. ,7 0 20 10 30 40 Rahmenanteil in % 2 Aufgrund dieser Eigenschaften dienen Glasflächen, ähnlich wie bei den Gewächshäusern, nicht nur zur Belichtung der Räume oder zur Herstellung eines Kontaktes zwischen innen und außen, sondern sie werden auch zur Sonnenenergiegewinnung eingesetzt. Die rechnerische Ermittlung des Wärmedurchgangskoeffizienten von Fensterrahmen ist wegen unterschiedlicher Oberflächengeometrie auf der Innen- und Außenseite nicht ohne weiteres möglich. k Fahm„n k = 1 V:rglasung -9,0 JF° / ^ // 11 6,0' w^. Ym -_ r J " 50 1, !W11I 11 ^ 44^ /J .11 . ^ p di Ili 4A Durchlässigkeit von Glasscheiben für die Sonneneinstrahlung in Prozenten , ^ / 41111 Gesamtenergiedurchlaßgrade g von Verglasungen Zeile j ^^ ^ 10 20 30 I' 40 50 Anteil des Rahmens in % 1,0 wi ll MI 50 60 70 80 90 Anteil der Verglasung in % Graphische Besti mmung des K„ -We rt es für Fenster nach Prof. Seifert 3 Verglasung g 1.1 Doppelverglasung aus Klarglas 0,8 1.2 Dreifachverglasung aus Klarglas 0,7 2 Glasbausteine 0,6 3 Mehrfachverglasung mit Sondergläsern (Wärmeschutzglas, Son- 0,2 bis 0,8 nenschutzglas) ' 1 ' Die Gesamtenergiedurchlaßgrade g von Sondergläsern können aufgrund von Einfärbung bzw. Oberflächenbehandlung der Glasscheiben sehr unterschiedlich sein. Im Einzelfall ist der Nachweis gemäß DIN 67507 zu führen. Ohne Nachweis darf nur der ungünstigere Grenzwert angewendet werden. 5 83 BAUKONSTRUKTION Thermischer Einfluß des Fensterrahmens und der Verglasung Treibhau .4 BAUKONSTRUKTION Wärmeverlust und Wärmegewinn durch Fenster und Wände Bei Fenstern tritt infolge Besonnung ein Wär megewinn durch unmittelbare „Durchstrahlung" auf. Der Wärmeverlust durch Fenster und Wände erfolgt hingegen in gleicher Weise durch Wärmeleitung entsprechend dem k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Energiebilanz von Fensteraußenwänden Der Einfluß der Fenstergröße hängt von der Orientierung und der thermischen Qualität des Fensters ab. 100% Spezifischer Wärmebedarf in 100 75% W/ m2 2326 Wärmeverlust und Wärmegewinn durch Fenster und Wande 90 50% 80 25% 1744 581 0% 70 60 y a) E :m 1163 S I 1744 2326 Vergleich der unterschiedlichen Orientierungen sowie Fenstergrößen bei einem Mittelraum mit Außenwand kAw = 0,656 W/m2K 2907 W/m Einfach- Doppel, Dreifach 1/A),55 Fenster Fenster. Fenster Wände Quelle: Künzel. Gertis: Fenster und Sonnenschutz. 1979. zen a Holzfenste , 34% Rahmenanteil, 2fach-Verglasung kF=2,5=W/m2 K Um Fenster energetisch richtig beurteilen zu können, müssen Energiebilanzen des dahinterliegenden Raumes gerechnet werden. Mit Hilfe von solchen relativ aufwendigen und komplizierten EDV-Rechnungsprogrammen von Prof. Dr.-Ing. Lothar Rouvel wurden folgende energetische Beurteilungen von verschiedenen Fensterqualitäten vorgenommen. Ein vereinfachtes Rechenverfahren ist in der Praxisinformation Energieeinsparung 2.2 veröffentlicht worden. Der Wärmebedarf von Räumen unterschiedlicher Orientierung und gleicher Fensterqualität variiert um so mehr, je größer der flächenmäßige Anteil des Fensters an der Außenwand ist. Bei einer thermischen Qualität (Zweifachverglasung, 34% Rahmenanteil aus Holz) kFe = 2,5 W/m 2K bringt die Vergrößerung der Fensterfläche von 25% auf 50% bis 75% trotz Energiegewinnen durch Sonneneinstrahlungsgewinne bei allen Orientierungen außer nach Süden negative Tendenz für die Energiebilanz des Raumes. Diese verstärkt sich bei der Anwendung thermisch besserer Außenwandkonstruktionen um einen kAw von weniger als 0,5 W/m2K. Randbedingungen ;für energetische Optimierung Energetische Optimierung. durchgeführt im Rahmen des Forschungslioiektes Bau und ^Cnergie. geförde rt durch das BMFT Bei der energetischen Optimierung von Räumen mit Fenstern unterschiedlicher thermischer Qualität und Größe werden diese baulichen Randbedingungen angenommen. 8 Holzfenster 34% Rahmenanteil /• e 2faach -Ver Iasung kFe = 2,5 W1m_2K .. E .c C_ 6,0 m 100 90 80 70 ä.) L 60 U m Holzfenster 34% Rahmenanteil ^ a) a^ E m (4‘ 4” ,/ Mittelrauml^/ aget/ \I Grundfläche: AR ° 24,00 m2 Volumen: VR = 64,80 m2 Außenwand: AAw = 12,00 m2 Fenster: AFe = 0,00 m2 bis 12,00 m 2 entsprechen 0%-100% Fensterflächenanteil an L ca ca 50 m 11 5 cm Hlz 1,6 beidseitig verputzt 84 0 25 5 75 100 iv U 100 90 N ä 80 70 60 der Fassade Außenwand: 24 cm Hlz 1,6 mit 4 cm Wärmedämmung außen, beidseitig verputzt k 0,656" W/m2 K Innenwand: 24 cm Hlz 1,6 beidseitig verputzt Fußboden/ Nadelfilz, 4 cm Zementestrich, 2 cm TrittDecke:' schalldämmung,16 cm Stahlbetondecke, 1,5 cm Innenputz Klimadaten: Essen Bauliche Ausbildung des Raumes und Lage am Gebäude 3fach^Ver Ia^s^u^^n^_ W kFe = 1,90^%m?K Holzfenster 34% Rahmenanteil 4fach-Verglasung kFe 1,35 W/m2K 0 25 50 75 100 Fensteranteil an der Fassade in % Nordraum Ost- bzw. Westraum ....^Südraum Einfluß von unterschiedlicher Raumorientierung auf den spezifischen Jahreswärmebedarf in Abhängigkeit vom Fensterflächenanteil an der Fassade 9 Zusätzliche Wärmedämmaßnahmen am Fenster Verbesserung der Energiebilanz in der Nacht Temporärer Wärmeschutz Temporäre Wärmeschutzvorrichtungen können während der Nacht den Wärmeverlust durch das Fenster deutlich erniedrigen, ohne daß die Wärmegewinne durch die SonnenEine weitere Verbesserung der Energiebilanz einstrahlung tagsüber beeinträchtigt werden. Der temporäre Wärmeschutz verhält sich von Fenstern ist durch die Fensterkonstrukenergetisch fast analog wie eine zusätzliche tion wie Kastenfenster oder Wintergarten zu Fensterscheibe, d. h. ein dreifachverglastes erzielen. Wintergärten mit einer DoppelverFenster mit temporärem Wärmeschutz entglasung an der Außenseite und einer Einspricht energetisch einer Vierfachverglafachverglasung an der Innenseite sind wesung. sentlich günstiger als übliche FensterkonDurch die Anwendung des temporären Wärstruktionen mit einer Dreifachverglasung. meschutzes am Fenster von Altbauten kann Die Orientierung der Fenster nach Süden ist ohne einen großen finanziellen Aufwand die energetisch um ca. 20% günstiger als die thermische Qualität verbessert werden. AllerOrientierung nach Norden. Die Orientierung dings ist die Voraussetzung hierzu, daß die zu unterschiedlichen Himmelsrichtungen hat Fugendichtigkeit des Fensters gewährleistet einen geringeren Einfluß auf die Verbesseist. rung des spezifischen Wärmebedarfs als die Steigerung der wärmetechnischen Qualität— Folgerungen aus den dargestellten Zweifach- Dreifachverglasung Wintergärten. Diagrammen: 1. Ein temporärer Wärmeschutz vermindert Doppel- oder Isolierverglasung außen und eine übermäßige Abkühlung in der Nacht. Einfachverglasung innen ist für eine längere 2. Die günstige Lage des Wärmeschutzes ist Nutzbarkeit des Wintergartens eindeutig an der Innenseite der äußeren Verglasung günstiger. des Wintergartens. Grundsätzlich kann gesagt werden, daß bei einerthermischen Qualität der Außenwand kAw = 0,6 kWh/m2K nur Fenster mit geringeren Transmissionswärmeverlusten, wie dreibis vierfachverglaste Fenster und einer Fenstergröße von 25% auf 50% bis 75% der Außenwand, die Energiebilanz bei Süd-, Ostund Westorientierung des Raumes positiv beeinflussen. OHNE temporären Wärmeschutz 120 kWh/m 2 • a 140 1 1 10 ` % a., 100 120 E 90 m OO L co E 80 cLi'm w1v ^ 0 11 .E 0 :m 'z E (7, ^ 40L C m ^ Y ^ 7 m ^ ^ N L N.N \mw 50 H Ö 0 0 CN 120 kWh/m2 • a 140._110 0/0 100 90 80 80 70 70 60 60 50 50 40 Zweifach-Verglasung 50% A Dreifach-Verglasung 100% 30 Dreifach-Verglasung 50% A Wintergarten 100%AF 20 außen zweifach/innen einfac Wintergarten 150% AF 10 außen zweifach/innen einfac 0 Nord Ost Süd West Nord c:2_ 0 MIT temporärem Wärmeschutz A C D B Zweifach-Verg asung 50% A C 30 Dreifach-Verglasung 100% Dreifach-Verglasung 50% AF 20 Wintergarten 100% AF $ außen zweifach/innen einfac 10 Wintergarten 150% A F zweifach/innen einfac 0 Nord Ost Süd West Nord 40 OHNE temporären WintergartenMIT temporärem Wärmeschutz temperatur Wärmeschutz 35 Südorientierung Südorientierung 30 25 20 15 10 5 0 Nordorientierung Nordorientierung 5 —10 —5 0 +5 10 15 20 25 30 —10 —5 0 +5 10 15 20 25 30 Außentemperatur Außentemperatur Wintergarten- MIT temporärem OHNE temporären Wärmeschutz temperatur Wärmeschutz 35 Südorientierung Südorientierung 30 25 20 15 10 5 0 Nordorientierung Nordorientierung —5 —10 —5 0 +5 10 15 20 25 30 —10 —5 0 +5 10 15 20 25 30 Außentemperatur Außentemperatur Vergleich unterschiedlicher Verglasungsarten ohne temporären Wärmeschutz Fensterflächenanteil variiert Vergleich des spezifischen Jahreswärmebedarfs von Mittelräumen mit variierender Verglasungsart ohne temporären WärmeSchutz. Ergebnisse aus dem Forschungsvorhaben Bau und Energie, gefördert durch das BMFT Vergleich unterschiedlicher Verglasungsarten mit temporärem Wärmeschutz Fensterflächenanteil variiert Vergleich des spezifischen Jahreswärmebedarfs von Mittelräumen mit variierender Verglasungsart mit temporärem Wärmeschutz. Ergebnisse aus dem Forschungsvorhaben Bau und Energie, gefördert durch das BMFT • MIME NNE MEE 85 414 BAUKONSTRUKTION reri gier Wintergär Südorientierung 4.4 BAUKONSTRUKTION Die Maßnahmen, der derzeit noch nicht allgemein üblich sind, könnten, innen oder außenseitig angebracht, als spezielle Vorhänge, Schiebevorrichtungen, Rolläden, Klappladen und dergleichen ausgeführt werden. In experimentellen Untersuchungen ist die wärmedämmende Wirkung von Vorhängen bzw. Li blichen Rolläden bereits bestätigt worden. Nachtwand geschäumte Paneele mit Magneten am Fensterrahmen befestigt Sonnenschutzrollo als Matte oder Jalousie (Schema) el i 1 Schiebewand verschiebbare starre Paneele in horizontaler Türführung Fenster mit Wärmedämm Klappflügel, (oder (Schiebeflügel-Jalousette) Faltwand Paneele werden gefaltet; und in horizontaler Führung zur Seite geschoben In der Winternacht als Wärmedämmung Am Sommertag als Sonnenschutz Beispiele möglicher Vorrichtungen des temporäre Wärmeschutzes - Paneelkonstruktionen Am besonnten Wintertag ist Sonneneinstrahlung durch das Fenster erwünscht 14 Flexible Wärmedämmelemente für den winterlichen (nächtlichen) Wärmeschutz - wie sie von einigen Autoren vorgeschlagen wurden - machen auch weiterhin größere Fensterflächen energiewirtschaftlich möglich Fester Sonnenschutz 12 Sonnenschutzvorrichtungen am Fenster Sonnenschutzanlagen sind ebenso wie die Wärmeschutzvorrichtungen Präventivmaßnahmen. Damit soll während der Sommermonate mit starker Sonneneinstrahlung auch ohne Anwendung raumlufttechnischerAnlagen ein erträgliches Raumklima erzeugt werden. Fester Sonnenschutz Bei richtiger Konstruktion und Anordnung stellt dieser Sonnenschutz die effizienteste Maßnahme dar. Er benötigt keine oder nur geringe Wartungs- und Reparaturkosten, kann jedoch nicht überall angewandt werden. Man unterscheidet zwei grundsätzliche Konstruktionsprinzipien: 1. feste, auskragende, horizontale und vertikale Platten an den Fensteröffnungen, 2. feste, vertikale oder horizontale Lamellen an den Fensteröffnungen. Süd Stepp-Rollo Vertikalschnitt Es muß näherunasweise sichergestellt sein, daß keine direkte Besonnung des Fensters erfolgt. Dies ist der Fall, wenn bei Südorientierung der AbdeckwinrCel ß ? 50° ist und bei Ost- und Westorientierung entweder. der Abdeckwinkel ß ? 85° oder y > 115° ist. Zu den jeweiligen Orientierungen gehören Winkelbereiche von ± 22,5°. Bei Zwischenorientierungen ist der Abdeckwinkel ß _> 80° erforderlich. Ost Beispiele möglicher Vor ri chtungen des temporären Wärmeschutzes - Rollokonstruktionen 86 13 Fester Sonnenschutz DIN 4102 Tell 2 Tabelle 5 15 Beweglicher Sonnenschutz Unterdiesem Begriff werden derzeit Metalljalousien, Markisen, Vorhänge sowie horizontal und vertikal verschiebbare Sonnenschutzplatten verstanden. Die Wirkung solcher Anlagen wird im wesentlichen von ihrer Anordnung bestimmt. 23% 100% i 19% 14% 17% 40% e /44% Normale Verglasung k= 4,2 l' 3% 40% Normale Verglasung k= 5.0 19% • Wärmeabsorbtion am Fenster bei verschiedenen Anordnungen von Sonnenschutzvorrichtungen 16 Abminderungsfaktoren z von Sonnenschutzvorrichtungen' in Verbindung mit Verglasungen 1 2 2.1 2.2 Sonnenschutzvorrichtung fehlende Sonnenschutzvorrichtung 1,0 innenliegend und zwischen den Scheiben liegend Gewebe bzw. Folien 2 0,4 bis 0,7 z 0,5 3 Jalousien außenliegend 31 Jalousien, drehbare Lamellen, hinterlüftet 0,25 3.2 3.3 3.4 3.5 Jalousien, Rolläden, Fensterläden, feststehende oder drehbare Lamellen Vordächer, Loggien Markisen, oben und seitlich ventiliert Markisen, allgemein i NORMALGLAS Doppelverglasung 27 73 Dreifachverglasung 37 63 0,2-0,7 ABSORPTIONSGLAS Einfachscheibe 40 Grauglas Einfachscheibe 44 Grünglas Zweifachscheibe 45 Grauglas mit Spiegelglas 0,2-0,7 REFLEXIONSGLAS Einfachscheibe 55 mattbedampft Zweifachscheibe 60 mattbed. mit Spiegelglas Einfachscheibe 71 Goldbelag Zweifachscheibe 72 Goldbelag mit Spiegelglas Verhalten versch. Giasarten bei Wärmeeinstrahiung BAUKONSTRUN110R 60 56 Beweglicher Sonnenschutz 55 45 40 29 28 18 Lüftungswärmeverluste des Fensters 46% 15% 20% 25% 45/ ♦ 4% Wärmereflektierendes Glas k= 4,2 Normale Doppelverglasung k= 2,0 Zeile 100% durch SonnenGV Strahlung zugeführte Wärme Eindringende 0,8-0,7 Zurückgewie. Wärme in % Wärme in % Gesamtenergiedurch aßgrad Die Lüftungswärmeverluste der Fensterkonstruktion im geschlossenen Zustand sind in der DIN 4108 Teil 4 Tabelle 4 festgelegt: die Fugendurchiaßkoeffizienten an der Fenster und Fenstertüren dürfen die Werte nicht überschreiten. Fenster ohne Öffnungsmöglichkeiten und Verglasungen sind dauerhaft und praktisch luftundurchlässig einzudichten. Auf einen Nachweis des Fugendurchlaßkoeffizienten für Holzfenster kann verzichtet werden, wenn die Profile der DIN 68121 — Holzfenster — Ausgabe März 1973 entsprechen. 0,3 0,4 0,5 Die Sonnenschutzvorrichtung muß fest installiert sein (z. B. Lamellenstores). Übliche dekorative Vorhänge gelten nicht als Sonnenschutzvorrichtung. 2 Die Abminderungsfaktoren z können aufgrund der Gewebestruktur, der Farbe und der Reflexionseigenschaften sehr unterschiedlich sein. Im Einzelfall ist der Nachweis in Anlehnung an DIN 67507 zu führen. Ohne Nachweis darf nur der ungünstigere Grenzwert angewendet werden. 17 Sonnenschutzgläser Für den Sommer konzipierte Sonnenschutzverglasungen können im Winter im Sinne der Energieeinsparung ungünstiger sein als nicht beschichtete Verglasungen, da Sonnenschutzverglasungen im Vergleich zu Wärmeschutzverglasungen bei annähernd gleichen k F-Werten wesentlich geringere Gesamtenergiedurchlaßgrade aufweisen. Dadurch wird der mögliche, durch die Sonne bedingte Wärmegewinn bei annähernd gleichem Wärmeverlust verringert. Fugeridurchlaßkoeffizient Konstruktionsmerkmale von Fenstern und Fenstertüren in Abhängigkeit vom Fugendurchlaßkoettizienten a nach DIN 18 055 Konstruktionsmerkmale 0,3 Lüftungswärmeverluste Holzfenster (auch Doppelfenster) mit Profilen nach DIN 68121 ohne Dichtung alle Fensterkonstruktionen (bei Holzfenstern mit Profilen nach DIN 68121) mit alterungsbeständiger, leicht auswechselbarer,weichfedernderDichtung Fugendurchlaßkoeffizient a m3/(h • m daPa2'3) 2,0 > a >1,0 < 1,0 19 Über die Möglichkeiten, den Lüftun g swärmeverlust zu reduzieren (bei einer Reduzierung des Transmissionswärmeverlustes von Fenstern nimmt der Lüftungsverlust eine wesentlich höhere, wenn nicht mengenmäßig ausschlaggebende Stellung ein), werden zur Zeit mehrere Forschungsprojekte durchgeführt. Tendenziell kann man schon im voraus feststellen, daß eine kontrollierte Be- und Entlüftung von Räumen mit Wärmerückgewinnung am effizientesten die Höhe des Lüftungswärmebedarfs reduzieren kann. Sonnenschutzgläser Mindestluftwechsel Ein Mi_ndestluftwechsel sollte ständig zwischen O 5- bis0,7fach sein. Bei einer drastischen Reduktion des Luftwechsels bei Nichtbenutzung der Räume und einer entsprechenden Absenkung der Heizungsleistung entstehen infolge der Kondenswasserbildung Schäden an dem Gebäude. Hierzu werden in der nächsten Zeit neue Ergebnisse aus der Forschung und Entwicklung vorliegen. 87 4.4 BAUKONSnmUKoIOmn Fenster Darstellung der AnschluBausbildung zwischen Fenster und Boukörper Ein wesentlicher Punkt ist die Verbindung undAbdiohtungzum8auhÜrper. Die riohtige VVah|deeAneoh|u8eyetemeundderVVerhetoffeietfÜreinedauerhafteAbdichtungbeedmmend.OieTabe|le..Aneoh|u8derFenater zunn8auhörper''gibthiereineEntaohei' dungehi|fe.wenndieUmgebungabedingungenbehanntaind.UntereohiedeinderAneoh|u8auebi|dungzeigtdiefo|gendeTabe||e. 9. L. Rouve und B. Wenzel: Kenn moonzu,sourto+ |unuvonFenmomun*o,Bo,uoxowhtigungdo,Gonnonoinstmmvngwäx,onuuo,Hoizpo,|oue.in:aavphvoix1 (1e79).mr.1.G. 1e-18. 10. DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau, Teil 1-5, Manuskript Dezember 1980. 11. DIN 18055 Fenster, Fvuonuu,nNmooigxoaunu Gomagmgonsioxo,xoit. 12. DIN Orsoruoxttmnom|oo|onug,uuo.Stmmvnue~ t,anomimsionegmuovnuoovamtene,gieuu,oNaoumuo vonvorg|auunuon. 13. DIN sa1e1Too1 Holzfenster-Profile; Dreh-, Drehkipp- und Klappfenster. Anschlußausbildung zwischen Fenster und Baukörper - ^ / ‘ ,, 0111)** ,1 ^`. ^ '~` |'^ | | Anschluß- ausbildung Ble*drahme" eingeputzt A Putzfassade mit "^*^^=^^ ^ ^^ Abdichtg. mit ^^~^^^e roo .4,, ^^^^ ^^^^^ ^ *mmo ^^^^^ ^^^^^ ^^^m^ B ^"^'c^ mnoa,//e Anschluß Zarge Abdichtung _ ^m ^. mit o°°°"»omm"n/^"h/« der ««"^mmm" tt :14: ^^^ .6 ^^^ ^ . • B Putzfassade alit it its _ - -- -. Id x^m^` m^m^/| m^u ^ it'l ^ / C at^ stefn, metal l !sc e ^ Ba- ^^8^^ »SE |.. wxmo A k: m^vx» - i D at • eau *°t fen Beanspruchungsgruppen &IV` f^'` ' 1 , 2 LiteraturhinwniAR h ix Wär1 Prof.h für Fvnute medurchgangskoeffizient 2. Wärmeschutztechnische Messungen von Fenstern 0:ssw 1 I , eo 3.1 ' 3.2 uo 14. Wärmeschutzverordnung bei Gebäuden, BMW Au gust 1977. QuelenaUUldungon: DIN 4108 (Abb. 1,5, 15, 17, 19). Seifert: Wärmed x . fizienten k für die Technischen Baubestimmungen, in: Institut für Fenstertechnik, Rosenheim (Abb. 2, 3). _n " . .-4, F-_r __.`'. Künzel, Gertis: Fenster und Sonnenschutz, Holzkirchen 1975 (Abb. 6). Nikolic: Bau un'd Energie, Gom obonohtForsohungr g ° projekt des BMFT (Abb. 7, 8, 9, 10, 11). '^^^blatt" Heft 2/198Ö. Nikolic: Handbuch des energiesparenden Bauens (Abb. 12, 16). 4. Prof. V. o | nuon Wright: Natural solar Architecture (Abb. 13. 14). aavono, Deutscher Consulting Verlag, Wuppertal. SchriftenSeiffert: Fensteranschluß zumBuvxo 5. Prof. v.wixnUo(pmjekt|oitor):Fors reiheuoo oMBav, Bau- und Wohnforschung 1e77 Bau und Ene i gom,uortuumxuuuaunuoommmte' (Abb. 20). rium für Forschung und Technologie (BMFT). 6. Rationelle Ener i onwonuung,|n: Statusbericht Kurzbiographie des Autors: 1e80Tox1.G.24-33.ounuooministormrForsoxvngvnu Prof. oip|,Inu. Vladimir mix000. Technologie. Architekt BDA - Gesamthochschule Kassel- Konstrukti7. Pm,.or'mg. L. Rou yel: Raumkonditionierung, Wege -freischaffender Architekt-Schwerves Entwerfen Entw zum energetisch optimiertenoouguuo.m:Gohnoonm/' punktwoxnungouuu-onorg|oopumnu000uvon- For xouorFvmoxunuoote||omrEnong|ewirtooxmtounu12, schung - rationelle Energieverwendung. Springer-Verlag. Redaktionelle Bearbeitu u Layout oipl.-Ing.00mu 8. D. WriNatural S lar Architecture a passive primer, Van Nostrand Reinhold Company, New York. 88 ^ INEHGIEINS Ein Forschungsvorhaben der Bundesarcnetekter <4n w.' durchgefuhrt im Auftrage des Bu ' desminister,' ms für Städtebau. Raumordnun:F uno Bauweser In diesem Teil der Praxisinformation sollen haustechnische Konzepte im Zusammenhang mit dem Verbrauch dargestellt werden. Bei der Auswahl von Beispielen wurde versucht, eine möglichst große Aktualität zu gewährleisten. Es ist beabsichtigt, die Veröffentlichung von interessanten und wegweisenden Lösungen in regelmäßigen zeitlichen Abständen zu wiederholen. Die erste Veröffentlichung beschränkte sich auf die Darstellung der prämierten Gebäude und haustechnischen Konzepte aus dem zweistufigen Wettbewerb für Energiesparhäuser Berlin, der 1981 durchgeführt wurde. Die ausgewählten Gebäude-Beispiele werden im Rahmen der Internationalen Bauausstellung in Berlin 1984 - fünf Mehrfamilienhäuser mit je zwölf Wohnungen - präsentiert. Dieses Programm wird vom Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau unterstützt. Um utopische Lösungen von vornherein auszuschließen, mußten Planer, Arbeitsgemeinschaften mit Generalunternehmern eingehen und im Rahmen der vorgegebenen maximalen Kosten ein schlüsselfertiges Angebot mit Festpreis abgeben. Gefordert war eine detaillierte Beschreibung von Bauteilen und der Mittel des technischen Ausbaus, d. h. Heizung, Lüftung und Warmwasseraufbereitung. TECHNISCHER AuSBAU Gesamtkonzepte Verfasser, Prof. Dipl -ing. Viadimir Nikolic Die eingesetzte Studiengruppe wählte 24 besonders erfolgversprechende Ideen für die Teilnahme an der zweiten Ausschreibungsstufe aus. In dieser zweiten Stufe in Form einer beschränkten Ausschreibung waren von den ausgewählten Teams unter anderem vorzulegen: O ein detaillierter Gebäudeentwurf, O die genaue Beschreibung aller technischen Systeme für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung sowie für die passive Nutzung der Sonnenenergie, O die Berechnung des Energiebedarfs, O ein verbindliches Preisangebot für die schlüsselfertige Erstellung eines Gebäudes. Die Kosten für Bauwerk und Außenanlagen waren limitiert: O DM 3500000,- für ein sechsgeschossiges Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen in Berlin. Die prämierten Arbeiten der zweiten Wettbewerbsstufe wurden durch die Darlegung des energiesparenden Gebäudekonzeptes - passive Sonnenenergienutzung - der adäquaten haustechnischen Anlage zur rationellen Energieverwertung sowie des rechnerisch ermittelten Energiebedarfs vorgestellt. Für alle angebotenen Lösungen haben Prof. Esdorn und Dr. Jahn einen detaillierten Energiebedarf berechnet, so daß bei der Beurteilung auch der rechnerisch ermittelte Energieverbrauch berücksichtigt werden konnte. Eine Verifikation von prognostischen Energieeinsparquoten soll nach Feststellung der Objekte durch Beobachtungen und Messungen vorgenommen werden. Die Auswahl geeigneter Lösungen wurde durch eine interdisziplinär zusammengesetzte Studiengruppe in einem zweistufigen Verfahren vorgenommen. Bei der Auswahl standen folgende Entscheidungskritierien im Vordergrund: O architektonische Qualität, O Grad der Integration von baulichen und haustechnischen Maßnahmen, O Energieeinsparquote, O Ökonomie bei den Investitions- und Betriebskosten, O Innovationsgrad O sowie Vielfältigkeit einzelner Lösungen. Die Ideenvorschläge der ersten Wettbewerbsstufe enthielten: O eine kurze entwurfsorientierte Baubeschreibung, häufig mit einer skizzenhaften Darstellung der gestalterischen Konzeption, O eine Beschreibung der energetischen Konzeption, manchmal schon mit - allerdings noch nicht prüffähigen - Angaben zur Wirtschaftlichkeit. 89 ttbewerE ergiespai I i ün __ Schlüsselfertiges Angebot mit Festpreisen 5. Zusammenstellung der Bauteile Kennziffer 1005 (Auszug aus den Angebotsunterlagen) WÄRMERUCKGEWINNUNG AUS DEN PUFFERZONEN UND DER ABLUFT INNENLIEGENDER RAUME TECNN.AUSBRU FPENZfk'E Gesamtkonzepte oH^u ^ r^ -- ^ > I0 ^.! n IQy_ ^ I kt^l :^ ^^ . ^ _ -' ^ ,- .. . . _ . ;•Z ti^l l ; ^ \ . . ,{ a ^u. ^ I^^, . 1 Außenwand Leichtziegel k = 0,49 W/m 2 • k 2 Wohnungstrennwand k = 0,61 W/m 2 • k Leichtziegel 5 Innenwand Kalksandstein k = 2,31 W/m 2 • k k = 0,45 W/m 2 • k 21 Kellerdecke Stahlbeton 10 Geschoßdecke Stahlbeton k = 0,79 W/m 2 • k k = 2,6 W/m 2 • k 7.1 Fenster Holz 6.3 Fenster Stahl k = 3,0 W/m 2 k ;^ ,- ;^ C. 4g,^,^ ; ' ^fL'^'^^i ^^^ ^^ ^^6 :^ -^^ \ ford ; • • ^ GASKESSEL ' ® f ^ ^^cä^ ^ ^. ^ -- ,. Architekten: Dipl.-Ing. Bernd Faskel, Berlin Prof. Dipl.-Ing. Vladimir Nikolic, Koordination Energieplanung: Prof. Dr.-Ing. Lothar Rouvel, München Haustechnik: H + Plan GmbH, Köln Ausführende: SF-Bau GmbH, Köln ^ ^\ \ .. '^C ^^ ' I " .^. a, ^ ^ ^,N91 ^1 ^ ÜF7\^ FER --_ . .- ELEKTRO- ^/^^ WÄRMEPU1; NIEERTEMPERAT ^ --^ ^ y SPEICHER . ^ ZENTRALER NWRMWASSERAUFBEREITER GRUNDRISS 2 Herstellungskosten (volle DM-Beträge) Kost.- Kosten Kosten mit besonderen gruppe ohne bes. Energiesparmaßnahmen nach EnergieDIN sparmaßDM/m2 DM/m3 276 nahmen DM DM Wfl. u. R. 1 Bauwerk 1866700 3012600 3194 617 3.1 1.1 Baukonstruktionen 404120 498460 529 102 1.2 Installationen 3.2 1.3 Zentrale Betriebstechnik 3.3 3.4 1.4 Betriebliche Einbauten 3.5 1.5 Bes. Bauausführungen 2270820 3511 060 3723 719 Kosten des Bauwerks Proz.Anteil % 86,1 14,2 100,3 Tab. 1 Energetische Kriterien vorhanden Ausschreibung Energiesparhäuser Berlin/Kassel ja nein Projekt: 1005 943 m 2winterlicher Wärmeschutz in erforderlichem Maße Bezugsfläche 0 Schutz gegen Transmissionswärmeverluste x 0.038 Pers./m2 Personen 36 Pers. Außenwand Leichtziegel K = 0,49 W/m 2 • K 52,7 W/m2 Norm-Wärmebedarf 49,7 kW Wohnungstrennwand Leichtziegel K = 0,61 W/m2 • K Energiebedarf f. Heizung Innenwand Kalksandstein K = 2,31 W/m 2 • K 16,41 kWh/m 2 a und Lüftung 15 474 kWh/a Keüerdecke Stahlbeton K = 0,45 W/m2 K Energieverbrauch Geschoßdecken Stahlbeton K = 0;79 W/m2 K kWh/m2 a O Schutz gegen Lüftungswärmeverluste Ol kWh/a x 18,20 kWh/m 2 a sommerlicher Wärmeschutz in erforderlichem Maße Gas 17 158 kWh/a a 58,41 kWh/m2 Strom 55 081 kWh/a x o gute Speicherfähigkeit der Innenbauteile Strom: Heizung, Lüftung x o Sonnenschutzvorrichtungen 21,04 kWh/m 2 a und Brauchwasser 19 838 kWh/a in Form Strom: sonst. Verbraucher x co technischer Vorrichtungen 37,37 kWh /m 2 a 35 243 kWh/a (Beleuchtung, Haushalt) (Jalousien, Markisen, Rollos u.ä.) x co baulicher Maßnahmen 1110,8 DM/m2 Energiekosten f. 25 Jahre 1 047,5 TDM (Vordächer, vorgelagerte Balkone u.ä.) 368,3 DM/m2 Kapitalwert 347,5 TDM co äußerer Vegetationshülle Energiekosten f. 25 Jahre 485,9 DM/m2 (o. Haushalt, Beleuchtung) 458,2 TDM x temporärer Wärmeschutz O A rt 182 401 kWh/a 193,43 kWh/m2a Primärenergie O Aufbau 19,34 1/m2 a Äquivalente Ölmenge 18,24 m3/a O Praktikabilität Primärenergie passive Nutzung der Solarenergie 81,31 kWh/m 2 a (o. Haushalt, Beleuchtung) 76 672 kWh/a Fenster Holz K= 2,6W/m2•K 7,67 m3/a 8,13 I/m 2 a Aquivalente Ölmenge Fenster Stahl K= 3,0W/m2•K x O durch Verdrehen des Baukörpers o durch Glasvorbauten x O durch große Südfenster Zonierung des Gebäudes O Pufferzonen vor den Aufenthaltsräumen' x O „warme" Räume im Gebäudekern Orientierung der Räumlichkeiten o Südseite: Kinderzimmer"* O zentral: Bad, WC, x o Nordseite: Küche, Schlafzimmer x Treppenhaus, Aufzug Bemerkungen: " mit Ausnahme der Südseite, " Wohnzimmer nordorientiert 90 WÄRMERÜCKGEWINNUNG USER WÄRMEROHR UND RESTWÄRME ,AUSSENLUFT AUS ABWASSER zuu T ^ ABLUFT 1' 1 ^.` ; ELEKTROMPE JflWARME__ ROHR PECHER ^^r^►^/ti^^yv^ • ^^ . I I P^["il'^ FdEERZ' NU v I IIJIIFUIL I . ^ ^' ' / IPPn [:+1 P%Z^t 1111111041 ^6^.[^+IP•• n^E^D^ ' ^I 1^[Jl'%^ ^ .. .^ SPEICHER . ZENTRALER WARMNmSSERANFDEREfTER Kennziffer 1007 Zusammenstellung der Bauteile (Auszug aus den Angebotsunterlagen) 3 Wohnungstrennwand Hochlochziegel 4 Kellerdecke Stahlbeton, Dämmung 6 Oberste Geschoßdecke Stahlbeton, Dämmung 1 Einfachfenster 2 Verbundfenster k = 0,69 k = 0,45 TECHN. AUSBAU k = 0,36 k = 2,7 k= 1,7 Architekten: von Gerkan, Marg + Partner, Hamburg/Berlin Energieplanung: Dr. Herbst Ingenieurgesellschaft, Berlin Ausführende:. Dr. Herbst Ingenieurgesellschaft, Berlin 'n ^WO dN^ , I I ^l ^I.. _ PLATTENTAUSCHER • LEKTROQ /^^ ^:•^ WÄRMEPUMPE AI i \\.;^x \\ ._ h. GRUNDRISS 5., Herstellungskosten (volle DM-Beträge) Proz.Kost.- Kosten Kosten mit besonderen gruppe ohne bes. Energiesparmaßnahmen Anteil nach EnergieDIN sparmaßDM/m2 DM/m3 276 nahmen Wfl. u. R. _% DM DM 1 Bauwerk 76,4 1.1 Baukonstruktionen 2515775 2672555 2430 547 3.1 19,3 1.2 Installationen 3.2 628945 677095 618 139 1.3 Zentrale Betriebstechnik 3.3 1.4 Betriebliche Einbauten 3.4 : 1.5 Bes. Bauausführungen 3.5 3 Kosten des Bauwerks 95,7 3144720 3349650 3057 686 Tab. 2 vorhanden Energetische Kriterien Ausschreibung Energiesparhäuser Berlin/Kassel ja nein Projekt: 1007 Bezugsfläche 1096 m2winterlicher Wärmeschutz in erforderlichem Maße x Personen 0:034 Pers./m 20 Schutz gegen Transmissionswärmeverluste 37 Pers. x 0 Schutz gegen Lüftungswärmeverluste Norm-Wärmebedarf 34,4 W/m2 37,7 kW sommerlicher Wärmeschutz in erforderlichem Maße Energiebedarf f. Heizung x und Lüftung 62 898 kWh/a 57,39 kWh/m2 a O gute Speicherfähigkeit der Innenbauteile x O Sonnenschutzvorrichtungen Energieverbrauch x Öl kWh/a kWh/m 2 a temporärer Wärmeschutz o Art Gas kWh/a kWh/m 2 a Strom 72 696 kWh/a 66,33 kWh/m2 a o Aufbau o Praktikabilität Strom: Heizung, Lüftung passive Nutzung der Solarenergie und Brauchwasser 34 250 kWh/a 31,25 kWh/m 2 a o durch Verdrehen des Baukörpers Strom: sonst. Verbraucher x O durch Wintergärten (Beleuchtung, Haushalt) 38 446 kWh/a 35,08 kWh/m 2 a O durch große Südfenster Energiekosten f. 25 Jahre 1 215,5 TDM 1108,9 DM/m2 Zonierung des Gebäudes Kapitalwert 403,0 TDM 367,7 DM/m2 x C Pufferzonen vor den Aufenthaltsräumen' Energiekosten f. 25 Jahre x O „warme" Räume im Gebäudekern (o. Haushalt, Beleuchtung) 572,6 TDM 522,5 DM/m2 Orientierung der Räumlichkeiten Primärenergie 218 088 kWh/a 198,99 kWh/m 2 a O Südseite: Kinderzimmer" Äquivalente Ölmenge 19,90 1/m2 a 21,81 m3/a O zentral: Bad, WC, Eßplatz Primärenergie O Nordseite: Küche, Schlafzimmer (o. Haushalt, Beleuchtung) 102 750 kWh/a 93,75 kWh/m2 a x Treppenhaus, Aufzug Äquivalente Ölmenge 10,27 m3/a 9,37 1/m 2 a Bemerkungen: ` auf der Südseite — Wohnzimmer nordorientiert 91 Gesamtkonzepte 5.1 WARMWASSERBEREITUNG ÜBER SONNENKOLLEKTOREN, NACHWARMUNG ÜBER HOCHTEMPERATURSPEICHER DER HEIZUNG Zusammenstellung der Bauteile Kennziffer 1009 (Auszug aus den Angebotsunterlagen) , ^ l• ^\ ^ ^1is^^ TECH$. AUSBAU : I 1 Außenwand Kalksandlochsteine mit Dämmplatte 3 Wohnungstrennwand Kalksandvollsteine mit Dämm-Matte 5 Innenwand-Hochlochziegel 13 Kellerdecke-Stahlbeton, Dämmplatte 18 Dachdecker-Stahlbeton, Dämmung 1 Verbundfenster 6 Einfach Türelement + + ^^ Gesamtkonzepte , a.„1.:4j Alb via N1111111 taq AL ' ; 111111111 ^ lE ^. , • ^ ^ l N@ illlll ^BNONG' Ill)fl^ ^ ...... ^ u— .. ` ^ ^ Iillliill ( < %^ ^l . ' I IIIIIIII ^..... . . 4- k = 0,37 k = 0,56 k = 1,23 k= 0,41 k=0,3 k = 1,6 k = 2,2 i. M. ^ al Nlitil4! ,: . N 111111111 I` 111111i11 I \ s nC =1111111 21 111 . 1161- ::. WARME ' ^'•I ^I 'h .._ ^N /i , ^- «. IIIIÜPI . • MIN al . * ~ • ;.` Y.....:.: : kn../ HOGHTEMP- WARMESPEICHER Architekten: Dipl.-Ing. Pysall - Jensen - Stahrenberg + Partner, Berlin Energieplanung: Haustechnik-Planungs GmbH, Berlin Ausführende: Boswau + Knauer, Berlin Ili ii 'EICHER :' 72 ,^ F - p Tt • ^ , r../1 ow m GRUNDWASSER GRUNDRISS 4 Herstellungskosten (volle DM-Beträge) Kost.- Kosten Kosten mit besondefen gruppe ohne bes. Energiesparmaßnahmen nach EnergieDIN sparmaß276 nahmen DM /m2DM/m3 DM Wfl. ' u. R. DM 1 Bauwerk 2007959 2429509 2501 506 1.1 Baukonstruktionen 3.1 401331 722929 744 151 1.2 Installationen 3.2 1.3 Zentrale Betriebstechnik 3,3 3.4 1.4 Betriebliche Einbauten 1.5 Bes. Bauausführungen 3.5 2409290 3152438 3245 657 Kosten des Bauwerks Proz: Anteil % 69,4 20,7 90,1 Tab. 3 Ausschreibung Energiesparhäuser Berlin/Kassel Energetische Kriterien vorhanden Projekt: 1009 ja nein Bezugsfläche 972 m2winterlicher Wärmeschutz in erforderlichem Maße 'Personen 0,040 Pers./m 20 Schutz gegen Transmissionswärmeverluste x 39 Pers. 0 Schutz gegen Lüftungswärmeverluste x Norm-Wärmebedarf 40,1 kW 41,3 W/m2 Energiebedarf f. Heizung sommerlicher Wärmeschutz in erforderlichem Maße und Lüftung 39 484 kvvh/a 40,62 kWh/m 2 a O gute Speicherfähigkeit der I nnenbauteiie-" x O Sonnenschutzvorrichtungen Energieverbrauch in Form ÖI kWh/m 2 a kWh/a x 00 technischer Vorrichtungen Gas kWh/m 2 a kWh/a (Jalousien, Markisen, Rollos ä.) Strom 92 745 kWh/a 95,42 kWh/m2 a co baulicher Maßnahmen Strom: Heizung, Lüftung (Vordächer, vorgelagerte Balkone u.ä.) und Brauchwasser 27,74 kWh/m 2 a 26 963 kWh/a CO äußerer Vegetationshülle x Strom: sonst. Verbraucher temporärer Wärmeschutz (Beleuchtung, Haushalt) 67,68 kWh/m 2 a 65 782 kWh/a O Art: Klappläden Rolläden Energiekosten f. 25 Jahre 1 550,6 TDM 1595,3 DM/m2 o Aufbau: Kunststoff, Holz, Kapitalwert 514,1 TDM 528,9 DM/m2 Wärmedämmung wärmegedämmt Energiekosten f. 25 Jahre o Praktikabilität x (o. Haushalt, Beleuchtung) 450,8 TDM 463,8 DM/m2 Kombination von Maßnahmen x Primärenergie 278 235 kWh/a 286,25 kWh/m 2 a O des sommerlichen Wärmeschutzes und Äquivalente Oimenge 27,82 m3/a 28,62 I/m2 a O des temporären Wärmeschutzes Primärenergie passive Nutzung der Solarenergie (o. Haushalt Beleuchtung) 80 889 kWh/a 83,22 kWh/m 2 a O durch Verdrehen des Baukörpers x Äquivalente Ölmenge 8,09 m3/a 8,32 I/m2 a O durch Glasvorbauten x o durch große Südfenster x Zonierung des Gebäudes x o Pufferzonen vor den Aufenthaltsräumen x o „warme" Räume im Gebäudekern Orientierung der Räumlichkeiten` O Südseite: Wohnzimmer, Kinderzimmer* x x o zentral: Bad, WC, Eßpiatz x o Nordseite: Schlafzimmer x Treppenhaus, Aufzug Bemerkungen: * Kinderzimmer teils süd-, teils nordorientiert, Die Innenwände innerhalb der Wohnungen sind aas Leichtwände (Metallständerkonstruktionen mit Wärmedämmung) konzipiert. 92 5., 5,1 ;r Kennziffer 1010 Zusammenstellung der Bauteile (Auszug aus den Angebotsunterlagen) WARMEGEWINNUNG AUS DEM LANDWEHRKANAL DURCH EINE ELEKTRO-WARMEPUMPE • ti, . Außenwand-Poroton Außenwand-Poroton Innenwand-Poroton Kellerdecke-Stahlbeton, Dämmung Oberste Geschoßdecke-Stahlbeton, Dämmung 21a Fenstertür 23a Fenster 1 2 3 9 10 I: '"") ^^ 1 . >...,...,. ^'. lOn. 4> f^^^jj `^ •. ^ . ^ L.. \ • `i i ► ;^"'' ^i .1111 ^^, i ELEKTRO- C S E. PUMPE ^i. ^'N' I ^ . • °., Gesamtkonzepte k = 0,48 k = 2,01 k = 2,46 ^ ^^^^.^ ', NIEOERTEMP- • • K ES E L MIT ^ BRENNER I ® 1 ^I OBERFLÄCHEN ;WASSER ^I _. . . . ..,. TECHN. AUSBAU Architekten: Dipl.-Ing. M. Schiedheim und A. Axelrad, Berlin Energieplanung: Dipl.-Ing. Müller, Berlin Ausführende: Eberth Bau GmbH, Berlin .^^^ ^ k=0,6 k=1,07 k = 0,98 k = 0,27 ZENTRALER ^ .SPEI- CHER WARMWAS$ RAUFBERERER / >>.^ ^ , i1 / , A /_ GRUNORISS 5 Herstellungskosten (volle DM-Beträge) Kosten mit besonderen Kost: Kosten gruppe ohne bes. Energiesparmaßnahmen nach EnergieDIN sparmaßDM!m2 DM/m3 nahmen 276 Wfl. u. R. DM DM 1 Bauwerk 2204565 2642065 2583 495 3.1 1.1 Baukonstruktionen 90, 3.2 480435 480435 470 1.2 Installationen 3.3 1.3 Zentrale Betriebstechnil 3.4 1.4 Betriebliche Einbauten 3.5 1.5 Bes. Bauausführungen 2685000 3122500 3053 585 Kosten des Bauwerks Proz: Anteil 75,5 13,7 89,2 Tab. 4 vorhanden Energetische Kriterien Ausschreibung Energiesparhäuser Berlin/Kassel ja nein Projekt: 1010 w interlicher Wärmeschutz in erforderlichem Mäße Bezugsfläche 1023 m 2 Personen 0.037 Pers./m 20 Schutz gegen Transmissionswärmeverluste 38 Pers. 0 Schutz gegen Lüftungswärmeverluste 44,0 W/m2 Norm-Wärmebedarf 45,0 kW sommerlicher Wärmeschutz in erforderiichem Maise Energiebeda rf f. Heizung 51,67 kWh /m2 a 0 gute Speicherfähigkeit der Innenbauteile und Lüftung 52 860 kWh/a 0 Sonnenschutzvorrichtungen Energieverbrauch in Form kWh/m 2 a 0I kWh/a CO technischer Vorrichtungen 12,48 kWh/m2 a Gas 12 768 kWh/a (Jalousien, Markisen, Rollos u.ä.) 67,57 kWh/m 2 a Strom 69 124 kWh/a x CO baulicher Maßnahmen Strom: Heizung, Lüftung (Vordächer, vorgelage rte Balkone u.ä.) x 28,72 kWh/m 2 a und Brauchwasser 29 382 kWh/a CO äußerer Vegetationshülle Strom: sonst. Verbraucher x temporärer Wärmeschutz 38,85 kWh/m 2 a (Beleuchtung, Haushalt) 39 742 kWh/a o Art: Rolläden bzw. Klappläden 1221,8 DM/m2 Energiekosten f. 25 Jahre 1 249,9 TDM o Aufbau: Mu wärmegedämmt x 405,1 DM/m2 414,4 TDM Kapitalwe rt o Praktikabilität Energiekosten f. 25 Jahre x Kombination von Maßnahmen 572,3 DM/m2 (o. Haushalt, Beleuchtung) 585,4 TDM o des sommerlichen Wärmeschutzes und 220 140 kWh/a 215,19 kWh/m 2 a Primärenergie o des temporären Wärmeschutzes 22,01 m 3/a 21,52 1/m 2 a Äquivalente Ölmenge passive Nutzung der Solarenergie x Primärenergie o durch Verdrehen des Baukörpers x 98,65 kWh/m2 a (o. Haushalt, Beleuchtung) 100 914 kWh/a o durch Glasvorbauten x Aquivalente Ölmenge 10,09 m3/a 9,86 1/m 2 a o durch große Südfenster Zonierung des Gebäudes x o Pufferzonen vor den Aufenthaltsräumen x o „warme" Räume im Gebäudekern Orientierung der Räumlichkeiten x o Südseite: Wohnzimmer* x o zentral: Bad, WC, Eßplatz x o Nordseite: Küche* x Treppenhaus" Bemerkungen: * Kinderzimmer nordorientiert, Schlafzimmer südorientiert, ** Aufzug im Gebäudekern. 93 5., WÄRMERÜCKGEWINNUNG AUS BÄDERABWASSER ÜBER PLATTENTAUSEHER Zusammenstellung der Bauteile Kennziffer 1015 (Auszug aus den Angebotsunterlagen) 5-01 Flachdach-Stahlbeton, Dämmung k = 0,31 5-02 Dach-Holzkonstruktion, Dämmung k = 0,24 5-03 Kellerdecke-Stahlbeton, Dämmung k = 0,64 5-06 Wohnungstrennwand-Schalungsk = 1,55 steine „Gisoton" 5-07 Innenwand-Holblockstein HBL 4 k = 0,95 5-08 Außenwand-Mauerstein „Gisoton" k = 0,33 5-09 Innenwand-Bimsplatten k = 1,11 6-01 Holzfenster 2-Scheibenverglasung k = 3,0 6-09 Holzfenster 3-Scheibenverglasung k = 1,86 6-29 Hauseingangstür-Stahl/Alu mit 1-Scheibenverglasung k = 5,8 TEMPI. AUSBAU Gesamtkonzepte PLATTENTAIßCHER PEILHER ER ASSERAUFBEREITER OIESELrVÄRMEPUMPE bBERF1ÄCHENWASSER ^---_ GRUNDRISS Architekten: Klipper + Partner, Stuttgart Energieplanung: Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfah rt Ingenieurbüro Scheer, Stuttga rt Ausführende: Züblin AG, Stuttgart Herstellungskosten (volle DM-Beträge) Kost.- Kosten Kosten mit besonderen gruppe ohne bes. Energiesparmaßnahmen nach EnergieDIN sparmaßDM/m2 DM/m3 276 nahmen DM Wfl. u. R. DM 1 Bauwerk 2212065 2440913 2459 489 1.1 Baukonstruktionen 3.1 380132 447480 451 90 1.2 Installationen 3.2 3.3 1.3 Zentrale Betriebstechnik 16046 31188 32 1.4 Betriebliche Einbauten 3.4 1.5 Bes. Bauausführungen 3.5 2608243 2919581 2942 585 Kosten des Bauwerks Proz: Anteil 69,7 12,8 0,9 83,4 Tab. 5 Ausschreibung Energiesparhäuser Berlin/Kassel Projekt: 1015 993 m2 Bezugsfläche 0.044 Pers./m2 Personen 44 Pers. 30,0 W/m2 29,8 kW Norm-Wärmebedarf Energiebeda rf f. Heizung 34,60 kWh/m 2 a und Lüftung 34 355 kWh/a Energieverbrauch ÖI Gas Strom 48 698 kWh/a kWh/a 69 558 kWh/a Strom: Heizung, Lüftung und Brauchwasser 2 503 kWh/a Strom: sonst. Verbraucher (Beleuchtung, Haushalt) 67 055 kWh/a Energiekosten f. 25 Jahre 1 522,1 TDM Kapitalwert 504,7 TDM Energiekosten f. 25 Jahre (o. Haushalt, Beleuchtung) 401,0 TDM Primärenergie 257 372 kWh/a Äquivalente Olmenge 25,74 m3/a Primärenergie (o. Haushalt, Beleuchtung) 56 207 kWh/a Äquivalente Ölmenge 5,62 m3/a 94 49,04 kWh/m 2 a kWh/m 2 a 70,05 kWh/m 2 a 2,52 kWh/m2 a 67,53 kWh/m 2 a 1532,9 DM/m2 508,2 DM/m2 403,9 DM/m2 259,19 kWh/m 2 a 25,92 1/m2 a 56,60 kWh/m2 a 5,66 1/m 2 a Energetische Kriterien winterlicher Wärmeschutz in erforderlichem Maße O Schutz gegen Transmissionswärmeverluste o Schutz gegen Lüftungswärmeverluste sommerlicher Wärmeschutz in erforderlichem Maße O gute Speicherfähigkeit der Innenbauteile O Sonnenschutzvorrichtungen in Form 00 technischer Vorrichtungen (Jalousien, Markisen, Rollos u.ä.) 0o baulicher Maßnahmen (Vordächer, vorgelagerte Balkone u.ä.) CO äußerer Vegetationshülle temporärer Wärmeschutz O Art: Wärmedämmrollos, innen O Aufbau: Zusammenrichten mit Markisen O Praktikabilität Kombination von Maßnahmen O des sommerlichen Wärmeschutzes und O des temporären Wärmeschutzes passive Nutzung der Solarenergie o durch Verdrehen des Baukörpers o durch Glasvorbauten O durch große Südfenster Zonierung des Gebäudes o Pufferzonen vor den Aufenthaltsräumen o „warme" Räume im Gebäudekern Orientierung der Räumlichkeiten o Südseite: Wohnzimmer, Kinderzimmer O zentral: Bad, WC, Eßplatz o Nordseite: Küche, Schlafzimmer Treppenhaus, Aufzug vorhanden ja nein x x x x x x x x x x x x x x Verglastes Dach am Beispiel des Internationalen Begegnungszentrums Berlin (IBZ) Dachraum - Treibhauseffekt Wirkung als Luft-Sonnenkollektor Die vorgegebene Dachneigung füh rt e zur Überlegung, den gesamten Bachraum als eine ganzjährlich nutzbare Gartenfläche zum Aufenthalt und zur Kommunikation auszubilden. Energetisch ist der Dachraum dem Prinzip nach ein Treibhaus: Die einstrahlende Wärmemenge wird im Dachraum gesammelt und mittels einer gasbetriebenen Wärmepumpe mit ausgedehnter Absorberfläche zur Heizung bzw. zur Warmwassererzeugung verwertet, die eingestrahlte überflüssige Wärme wird zur Temperaturstabilisierung während der Nachtzeit (Zeit ohne direkte bzw. di ff use Einstrahlung) gespeiche rt . Eine übermäßige Abkühlung des Dachraumes in der Nacht wird durch temporären Wärmeschutz geminde rt . Die Lufttemperatur im Dachraum da rf allerdings ein Minimum nicht unterschreiten, damit die Pflanzen nicht geschädigt werden. Die Wärmegewinnung im Dachraum ermöglicht nach den durchgefüh rt en EDV-Energiesimulationsberechnungen eine weitere 20%ige Einsparung des Wärmebedarfs. Begründung: Bei einem Energiedach mit Metalloberfläche (Kupfer oder Zinkblech) ist die Reflektionskoeffizienz sehr hoch, weiterhin wird die absorbierte Wärme durch den Wind zum großen Teil wieder abgeführt (Starke Abkühlung der Dachoberfläche beim Wind). Der flächige Außenluft-Kollektor des Metall-Energiedaches ist auch deswegen energetisch ungünstiger als ein Energiedach unter der Dachdeckung aus Ziegel. Im Vergleich eines Energiedaches unterhalb des Ziegeldaches mit einem Glasdach Luft-Sonnen-Kollektor - schneidet der zweite deswegen besser ab, weil beim Energiedach unter dem Ziegeldach trotz höherer Absorbtionswerte der größere Wärmewiderstand (Dachziegel) bis zur Absorberfläche die Energiegewinne minde rt . Bei Glasdach - (Luft-Sonnen-Kollektor) - kann die Sonneneinstrahlung nur wenig gedämpft durch das Glas (Einfachverglasung) in den Dachraum eindringen, die Flächen des luftgekühlten Absorbers im Dachraum erwärmen. Die langwellige Rückstrahlung der absorbie rt en Wärme wird durch das Glas weitgehendst vermieden. Damit sind die Wärmeverluste der Absorberfläche minimie rt . 5., iECNN.AUSBAU Gesamtko nzepte .äfasdal Sonner ft :tor Sammelrohr WarmeSpeicher und Sonnen,% Schutz Naturliche Lü ftung Fortluft Haustechnische Anlagen Bei der Konzeption der haustechnischen Anlagen gingen wir davon aus, daß diese, um Energie einzusparen, in einer direkten Wechselbeziehung zwischen baulicher Maßnahme und-Nutzerverhalten entwickelt werden müssen. Um die Wärme von den erwärmten Wintergärten an der Südseite zu den Räumen im Norden zu bringen, wird eine kor hinierte Flächenheizung (zur Decku n"-. des stationären Bedarfs) und eine Luftheizung (zur Wärmeverschiebung) angeboten. Gleichzeitig wird versucht, die großen Wärmeverluste bei der Entiüftung innenliegender Bäder und Küchen durch Zwischenschaltung von Wärmerückgewinnungsanlagen zu mindern. In der Planung der Haustechnik soli grundsätzlich versucht werden, die Anlagen soweit wie möglich zu minimieren, so daß deren Energiebeda rf im primären und sekundären Sektor merklich reduzie rt werden kann. Der Schwerpunkt bei der Entwicklung alternativer Systeme liegt in einer differenzierten und dem tatsächlichen Beda rf angepaßten Steuerung und Regelung der zugefüh rt en Wärmemenge bzw. der e rforderlichen Frischluftraten. Bei der Auswahl der haustechnischen Anlagen werden vor allem Kriterien wie gesamte Energieeinsparung, Investitionen, Wartungs-und Instandhaltungskosten im Vordergrund stehen. Architekten: Prof. Otto Steidle - Entwurf Prof. Vladimir Nikolic - Energiekonzept Schmidt-Reuter - Haustechnik Nord Zentrale Wärmegewinnung aus der Luft mit Wasser(Kühlmittel)neta 8 Dach b/c1 Nutzung: Schrebergarten erte :izu g Iheizung Wärmerückgewinnung OFirstbereich zu öffnen (Lüftung — Sommer) ® Dachfläche, wärmegedämmt, Blechdeckung ® Ventilator O Dachfläche, verglast ® Schwarzes Metallrohr mit Luftansaugöffnung ä` Aufblasbare Folie, transparent, oder alternativ Doppelverglasung 0 Wärmetauscher zu zentraler Wärmepumpe ® Falls f. Schreberg. erfordert., zusätzl. Belichtungsfläche Folienschlauch, perf. oder altern. Blechkanal, quasi geschlossener Kreislauf 9 95 . Temperatur im Dachraum ( ° C). 15 5., 10 5 TECHN. AUSBAU .....®i Haus b/c1 Nord-Süd Schrebergarten NEI ill gig iiiumnisii !xi iiiilligilannui Hau''s c2'.... Gesamtkonzepte -5 - 10 - 15 -20 Haus at II '.111WA Außentemperatur ®' uuiip ipui Die Berechnungen zeigten, daß im Normaljahr das potentielle Wärmeangebot höher liegt, als bei einseitig verglasten Nord-Süd-Dächern im Haus b/C1, da bei extrem niedrigen Außentemperaturen diesem Dach weniger Wärme infolge sehr starker Abkühlung entzogen werden kann. Dieses ist jedoch nicht ausschlaggebend, da bei solchen extremen klimatischen Verhältnissen sowieso eine Zusatzheizung eingeschaltet wird. Dach a1/a2 Nutzung: Schrebergarten „r0 Tagesverlauf der Temperatur im Dach aum an klaren Tagen, verglichen mit der Augentemperatur im Extrem ahr - Winter - 10 Dach im Haus B-C 1 - Schrebergarten Orientierung Nord-Süd Einfachverglasung an der Südseite. Nordseite ist geschlossen und hat einen k-Wert von 0,382 W/m 2 K. Entlang der Verglasung an der Südseite ist eine Doppelfolie oder adäquate Konstruktion angeordnet. Haus b/c1, Variante 1, Schrebergarten, 1-fach Verglasung, Teilbetrieb 1 1 (00 Tägliches Wärmeangebot rill n All n (kW e, i00 7s! A West Abstellraum Firstbereich zu öffnen (Lüftung - Sommer) ® Dachflächen, verglast Ventilator. Ci Schwarzes Metallrohr mit Luftansaugöffnung ü Wärmetauscher zu zentraler Wärmepumpe ® Schrebergarten, im Winter keine Bepflanzung ^^iA.r ^.►qr 00Irr em 'fribiLli00 ^.^.®^ Täglich erf. Wärmenut zung für die G rf, War epum pe aus dem Dachraum 0 -1h 5 Gegenübergestellt wurde das tägliche Wärmeangebot bezogen auf eine Hauslänge von ca. 25 m dem erforderlichen Wärmeentzug für die Gas Wärmepumpe. Daraus ist ersichtlich, daß im normalen Jahr die zur Betreibung der Heizungsanlage inklusive Warmwasserversorgung notwendige Energie dem Dach entzogen werden kann. Nur für extreme Temperaturen muß eine Zusatzheizung die Heizung mit der Gas-Wärmepumpe ergänzen (bivalente Heizung ist nur zur Deckung vom Spitzenbedarf bei extrem niedrigen Temperaturen notwendig). Die Heizung mit Gas-Wärmepumpe muß über einen ausreichenden Wärmespeicher verfügen. Haus A1/A2 Ost-West, Variante 1, Schreberga en, 1-fach Verglasung Teilbetrieb (kWh/el) . AM m „ol . L. ,%^I ^ ^^ m,ahr .n. n Nor ...... kla T äg liches Wärmeangebot 500 400 300 200 I !III ür Täglicdihere fGaswär . Wärmmenutepumpe zung de 100 / ^.. .r . a *I 0 5 -10 -5 10 25 ('C) 5 20 15 Gegenüberstellung von Wärmeangebot und ertorder icher Wärmenutzung hi die Gaswärmepumpe in Abhängigkeit von. der Tagesmitteltemperatur 12 96 13 Das Dach im Haus A 1/A 2 - Schrebergarten Orientierung West-Ost Beide Seiten sind einfach verglast. An beiden Seiten ist entlang der Verglasung eine Doppelfolie oder eine adäquate Konstruktion angebracht. Dach c3 -t II- 1 '0 2 (°C) 10 Gegenüberstellung von Wärmeangebot und ertorder icher Wärmenutzung für die Gaswärmepumpe in Abhängigkeit von der Tagesmitteltemperatur 11 700 ®Aufblasbare Folie,transparent, mit Gewebeeinlage, ca. 30 cm von der Außenverglasung entfernt, bildet Luftkanal oder alternativ Doppelverglasung Folienschlauch, perforiert Oa oderalternativ Blechkanal, quasi geschlossener Kreislauf Nutzung: Keine — Energiedach Süd Nord Q Firstbereich zu öffnen (7 Dachfläche, verglast (Lüftung - Sommer) QQ Aufblasbare Folie, mit ) Dachfläche, wärmeGewebeeinlage, ca. 30 cm gedämmt, Blechdeckung von der Außenverglasung entfernt, bildet Luftkanal oder sQ Ventilator alternativ Doppelverglasung 0 Schwarzes Metallrohr O Folienschlauch, perforiert mit Luftansaugöffnung oder alternativ Blechkanal, Wärmetauscher quasi geschlossener ® Abschottung des First- Kreislauf bereichs, wärmegedämmt, Alternative: Absorberdach 14 begehbar Dieses Dach wurde einmal gerechnet als LuftSonnen-Kollektor mit innenliegendem Absorber, s. Zeichnung - zum anderen als Energiedach aus Metall. Bei der Berechnung wurde davon ausgegangen, daß eine Abkühlung im Dachraum (Luft-SonnenKollektor) sowie beim Metall-Energiedach auf 10 K unter der Außentemperatur möglich ist. Diese Absenkung ist begrenzt durch die technischen Möglichkeiten einer Gas-Wärmepumpe auf mind. -10 °C. 5.1 5.1 Haus c3, (nur Energienutzung) Vergleich: 1-fach Verglasung Süd: Energiedach Süd 700 (kWh/d) 500 Täglich ed. Wärmenut für die Gaswärmepumpe aus .e achraum Tä.liches Wärmean.ebo aus dem Dachraum 400 300 200 100 5 -10 0 -5 5 10 15 20 25(°C) Gegenübe Stellung von Wärmeangebot und erforder icher Wärmenutzung.. fü die Gaswärmepumpe in Abhängigkeit von der Tagesmitteltemperatur 15: Der Vergleich von alternativer Konstruktion Glasdach als Luft-Sonnen-Kollektor mit einem MetallEnergiedach ergab günstigere We rt e für das Glasdach. An den drei Haustypen N, S und E sollen die Kostenerspamisse durch aktive und passive Maßnahmen verdeutlicht werden. Typ N: „Normalhaus" Wärmeschutz nach DIN 4108, vor dem Erlaß der Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz in Gebäuden vom August 1977. Typ S:„Schwedenhaus” Wärmeschutz nach den Vorschriften der Schwedischen Baustandards SBN 1975, die seit dem 1. Juli 1977 gültig sind. Er entspricht dem zukünftig in Schweden verbreiteten Typ, der nach den bis heute in Europa progressivsten staatlichen Richtlinien erbaut sein wird. Typ E: „Philips-Experimentierhaus" Das Experimentierhaus ist ein Fe rt ighaus, dessen Außenhülle einer Reihe zusätzlicher Maßnahmen zur Wärmedämmung unterzogen wurde. k = 0,17 W/m2K Außenwände: Decke, Fußboden: k = 0,23 W/m 2K; 0,3 W/m2K k = 1,9 W/m2K Fenster: Darüber hinaus wurden verschiedene Einrichtungen zur Wärmerückgewinnung und Nutzung der Sonnenenergie installie rt (Solarkollektoren, Erdwärmespeicher, Wärmerückgewinnung aus Abwasser und Abluft). Sonnenenergienutzung durch Sonnenkollektoren — aktive Systeme Der He-izu öc° .0rgicbcdarf [Mt sich tauri, i den Einsatz von aktiven Maßnahmen zur Einsparung und Nutzung alternativer Energiequellen erheblich reduzieren. Zu diesen aktiven Maßnahmen gehö rt der Sonnenkollektor. Sein Deckungsanteil ist von der KollekN-Version S-Version E-Version torfläche abhängig. Jedoch steigt dieser für große Flächen bei weiterer Vergrößerung nur noch geKollektorfläche ringfügig an. Auch bei zunehmendem Tankvolu40 16 8 (m2) men steigt bei festgehaltener Kollektorfläche der Gesamtkosten Anteil der solaren Energie nur noch wenig. (DM/Jahr) 1750 650 5900 So stellt, bei einem Tagesverbrauch von 280 I Ersparnis Warmwasser, ein 400 I-Tank die obere wirtschaft350 960 590 (DM) liche Grenze dar. Solarbeitrag Doch auch die Wahl der Kollektorart spielt eine 12000 5800 3200 (kWh/Jahr) große Rolle. So benötigt man beispielsweise bei Fossiler Beitrag einem höher effizienten Kollektor, im Gegensatz zu (kWh/Jahr) 22250 5800 1700 einem Stando rt -Kollektor, bei gleichem DeckungsEntspr. Liter grad und gleichem Tankvolumen, weniger als die 220 2900 750 Heizöl ca. Hälfte an m 2 Kollektorfläche. Ein Stando rt -Kollektor mit einem Deckungsgrad Zur Entscheidung zwischen passiven oder aktiven von 50% und einem Tankvolumen von 200 I benöMaßnahmen zur Nutzung der Sonnenenergie im tigt 7,5 m 2 Kollektorfläche. Ein höher effizienter Gebäude, kann eine Kostenanalyse angenommen Kollektor mit dem gleichen Deckungsgrad von werden. Die errechneten Kosteneinsparungen soll50% und dem gleichen Tankvolumen von 200 I aber nicht über den tatsächlichen Preis für den ten benötigt nur 3,3 m 2 Kollektorfläche. Energieverbrauch des Gesamtsystems hinwegtäuDas System mit dem höher effizienten Kollektor schen. deckt im Zeitraum von Mai bis August 95% des -.; So bleibt die Frage nach der wi rt schaftlichen OpEnergiebedarfs und liefert im Januar einen Anteil timierung der Solaranlage. von 20%. Der Standort-Kollektor dagegen nur 80% Vereinfacht kann man sagen: Je höher der Preis in den Sommer- und 10% in den Wintermonaten. für den konventionellen fossilen Energieträger ist, um so größer ist der mit einer Solaranlage zu erzielende Gewinn. Bei einem Preis der fossilen ^ Brennstoffe von DM 0,05 pro kWh steigen daher J 100 die Gesamtkosten mit der Kollektorfläche an. i 00 +Ö00 200 E ö >^ 400 m 100 H 80 ^ ^ ^ c U 60 40 Preis der t ossilen Energieträger DM -,05/kWh 0 m ö 2000 Hoher. effiz. Kollektor: `m 20 `m Standard-Kollektor 2 4 10 12 14 16 8 N 1000 m d 20 m2 Kollektor-Fläche CD Solarer Anteil am jährlichen Energiebedarf eines Warmwassersystems als Funktion der Kollektorfläche (Hamburg 1973, System A, 4-Personen-Haushalt) L 3000 m2 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Kollektorfläche Jährliche Gesamtkosten als Funktion der Kollektorfläche 17 97 -5. TECHN. AUSBAU Gesamtkonzepte Schritt 1 Halbierung der Lüftungsverluste Schritt 2 Doppelglasscheiben Schritt 3 Rolläden Schritt 4 Wärmeisolation des Dachbodens Die Schritte 1 bis 3 können durch Einbau einer modernen, dichtschließenden Fensteranlage (Doppelscheiben und Rolläden) erreicht werden. Preis de ossilen Energieträger. DM.—,10/kWh 4000 n1 3000 TECHN. AUSBAU Gesamtkonzepte 0 Sie führen zu jährlichen Einsparungen von insgesamt 12100 kWh =1700 I 01. Schritt 4 bedeutet eine jährliche Einsparung von 6800 kWh = 970 I 01. Diese vier Schritte lassen sich in jedem Altbau realisieren. ö 2000 N ^ <7) E 1000 ^ ^ L m? ` ` 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Kollektorfläche Jährliche Gesamtkosten als. Funktion der Kollektorfläche 18 Preis der fossilen Energieträger: DM —,20/kWh 7000 6000 5000 4000 9.- 3000 d 0 Haustyp F Flächen: Freistehendes Einfamilienhaus Wohnen 115 m2 Fußboden 140 m2 Außenwand 122 m2. Dachboden 140 m2 Fenster 8 m2 5, 4 m2 W, 4m2N,4m20 Jährlicher Heizbedarf Hamburg 39200 kWh = 5 600 I Öl Freiburg 31 700 kWh = 4500 I bi Wärmetechnische Ausführung Grundausführung (Altbau) i-We rt (W/m2 K) Einfachscheiben (75%) 6,8 Fensterrahmen Holz (25%) 2,5 Rolladen nicht vorhanden ,10 Dachboden siehe -x°1,2 Außenwände Aufbau Erläuterung *1,0 Fußboden Lüftungsverluste (Undichtigkeit und 1,8 Luftwechsel Fensteröffnen) pro Stunde Auswirkungen wärmetechnischer Verbesserungen m 01 2000 N d Jährlicher Heizbedarf (kWh) Hamburg Freiburg 39 200 31 700 E ^ 1000 Grundausführung U ^ 0{ m2 0 5 10 15 20. 25 30 35 40 45 50.Kollektorfläche Jährliche Gesamtkosten als Funktion der Kollektorfläche ^ 19 Schrittweise Verbesserung Halbe Lüftungsverluste 0 Luftwechsel pro Stunde 0,9 Hamburg Freiburg 32400 26100 k-Wert Aber nicht nur der Preis der fossilen Energie, son28'700 23200 31rt dern auch der Standard der Wärmedämmung können die Ersparnisse optimieren. Das ist eigentlich Rolladen+Doppelscheibe 1,9 27100 21900 auch Grundvoraussetzung, um Einsparungen im gewünschten Umfang realisieren zu können. Erst Dachboden+ 20300 0,3 16300 nach diesen Maßnahmen ist der Einsatz weiterfüh- ® 12 cm Mineralwolle render Techniken angebracht und sinnvoll. qußenwände+ So sollte man bei einem Neubau eine optimale 0,4 12 300 9 700 © 8 cm Polystyrol Abstimmung verschiedener Maßnahmen unter Kellerdecke+ akzeptablen ökonomischen Bedingungen zur 0,5 11 500 9100 6 cm Polystyrol Reduzierung des Heizbedarfs auf ein Minimum anstreben. Quellen: Bei bestehenden Gebäuden hat jedoch die VerV. Nikolic: IBZ - Minimierung des Energieverbrauchs. besserung der Wärmedämmung höhere Priorität. Schriftenreihe des BMFT-S, 1982 Erst dann sind weitere aktive Maßnahmen zur V. Nikolic: Gesundes Bauen, rororo aktuell. Energieeinsparung vo rz uschlagen. Das internationale Begegnungszentrum, 1982 Beispiel: Die wärmetechnische Verbesserung Institut für Bauforschung e. V., Hannover eines freistehenden Einfamilienhauses und die Energiesparhäuser Berlin/Kassel Auswirkung auf den Heizbedarf. Ergebnisse der Vorprüfung 1981 Bei der Ermittlung der Energiegewinne durch die H. Hörster, Hrsg.: Fenster, wurden sowohl die direkte als auch die Wege zum energiesparenden Wohnbau. Philips Fachdiffuse Komponente der Solarstrahlung berückbücher, 1980 sichtigt. Gesamte Fensterfläche 20 m 2, 8 m 2 Süd, 4 m 2 West, 4m 2 Nord, 4 m 2 Ost. Ku rzbiografie des Autors: Durch Undichtigkeit von Fenstern und Türen sowie Prof. Dipl.-Ing. Vladimir Nikolic, Architekt BDA, DWB durch das Öffnen der Fenster wurde ein 1,8facher Kassel. Arbeitsschwerpunkt: Gesamthochschule Luftwechsel pro Stunde berechnet. energiesparendes Bauen, Forschung Durch verschiedene Schritte sollen die Wärmever- Redaktionelle Bearbeitung und Layout: Dipi.-ing. Bernd G. Faskel, Koordination: Vladimir Nikolic luste eingeschränkt werden. 98 5.1 ENIRGIflINSPARII NG NI forfcnunQ:SVf:t; .<v Gurcr+geru^°' ft;r St.. ms ^ Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung Ein wichtiges Ziel bei der Planung und Ausführung einer Heizanlage ist ein möglichst kostengünstiger Betrieb. Dabei sind sowohl die erforderlichen Investitionen als auch die im Betrieb zu erwartenden Energiekosten zu berücksichtigen. Beides wird ganz wesentlich von der Wahl der Energieträger beeinflußt. Daher sollte in einem frühestmöglichen Stadium der Planung eine Übersicht über die jeweils zur Verfügung stehenden Energieträger einschließlich der daraus folgenden Konsequenzen für die konkrete Anlagenplanung zusammengestellt werden. Die Entscheidung für eine geeignete Anlagenkonzeption kann nur unter Berücksichtigung dieser Randbedingungen zu jenem Zeitpunkt getroffen werden, zu dem die Bauplanung überhaupt noch eine Entscheidung zwischen Alternativen zuläßt. Die Eignung der verschiedenen Energieträger solite zunächst nach folgenden Kriterien beurteilt werden: 1. Importunabhängigkeit und Versorgungssicherheit 2. Aufwand für Anschluß bzw. Lagerung 3. Aufwand für die Wärmeerzeugung 4. Betriebsbedingungen bzw. Betriebssicherheit 5. Umweltbelastung 6. Kosten und Zahlungsbedingungen Welchen Kriterien das stärkste Gewicht zugemessen wird, muß jeder Anlagenbetreiber nach seinen Erwa rt ungen festlegen. Grundsätzlich kann zwischen zwei Kategorien von Energieträgern unterschieden werden: Leitungsgebundene Energie - Strom, Gas, Fernwärme; nichtleitungsgebundene, lage rf ähige Energie - Heizöl, Flüssiggas, Festbrennstoff - Kohle, Koks, Holz usw. 1. Importunabhänaiakeit und Versnr g un gs_sicherheit Sie ist bei Energieträgern aus heimischen Quellen am höchsten (Fernwärme, Festbrennstoffe und bedingt Strom); bei jenen natürlich am geringsten, die im Inland nicht oder nur unwesentlich vorhanden sind (Heizöl) und zudem noch hauptsächlich aus politisch labilen Gebieten stammen. Eine mögliche Unsicherheit kann aber auch bei solchen Energieträgern bestehen, die nur zum Teil auf Importbasis beruhen (Atomstrom, Erd- bzw. Flüssiggas, Fernwärme), oder bei denen die Förderkapazität nicht ohne weiteres einem stark steigenden Absatz nachkommen könnte (Kohle). 2. Aufwand für Anschluß und Lagerung Bei den leitungsgebundenen Energieträgern muß immer mit mehr oder weniger hohen Anschlußkosten gerechnet werden; bei Strom ist in vielen Fällen (z. B. Wärmepumpen) der übliche Hausanschluß ausreichend, so daß do rt lediglich im Gebäude zusätzliche Installationen e rf orderlich sind. Von den lagerfähigen Brennstoffen haben die Festbrennstoffe wohl den größten Platzbedarf, sind TECHNISCHER AIJSBALJ wimwoen.. Prof. Or O ng. Heinz Bach aber ansonsten am einfachsten auf Vorrat zu halten. Bei größeren Anlagen werden jedoch Fördereinrichtungen benötigt, die einen automatischen Betrieb ermöglichen. Heizöl kann man bekanntlich sowohl im Gebäude als auch außerhalb (vorzugsweise unterirdisch) lagern, wobei auf die einschlägigen Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften sowie die regelmäßig erforderliche Wartung zu achten ist. Bei der Lagerung von Flüssiggas kommen für kleine Mengen (z. B. für die Zusatzheizung einer Wärmepumpenanlage) Flaschen in Frage, für größere Mengen ortsfeste Behälter, die sowohl im Gebäude (bis 1200 I) als auch im Freien oder unterirdisch aufgestellt werden können. Für die Lagerung von Flüssiggas gibt es strenge Vorschriften bezüglich Aufstellungsort, Ausstattung, Schutzzonen usw. Die Bestimmungen sind in den Technischen Regeln Flüssiggas (TRF) sowie in der Musterverordnung für Feuerungsanlagen (MFeuVo) zusammengefaßt. 3. Aufwand für die Wärmeerzeugung Die e rf orderlichen Investitionen sind bei Fernwärme sowie bei flüssigen und gasförmigen Brennstoffen am niedrigsten und liegen bei Wärmepumpen - unabhängig von der Antriebsenergie - am höchsten. Bei Wärmepumpenanlagen gehören auch die Erschließungskosten der Wärmequelle zur Wärmeerzeugung. Erheblichen Einfluß auf Investitionen und späteren Verbrauch hat die Abstimmung der Leistung des Wärmeerzeugers auf den Leistungsbedarf des Verbrauchers. 4. Betriebsbedingungen bzw. Betriebssicherheit Unter diesem Punkt ist abzuklären, ob das Versorgungsunternehmen aus Gründen der Netzbelastung bzw. der Tarifgestaltung bei den leistungsgebundenen Energieträgern Abschaltzeiten oder ändere Eirifiußmaßnanmen auf den Betrieb vorschreibt. Gegebenenfalls müssen Speicher oder Zusatzwärmeerzeuger vorgesehen werden. Bei bivalenten Anlagen ergibt sich g_eg_enüber monovalenten eine wesentlich höhere Betriebssicherheit. 5. Umweltbelastung Diese ist sicherlich am geringsten do rt , wo die Heizenergie aus Kopplungsprozessen großer Anlagen stammt, da dann einerseits der bezogene Primärenergieverbrauch am niedrigsten ist und andererseits technisch aufwendige Ve rf ahren wie die Abgasreinigung wi rt scha ft lich anwendbar sind. Bei Wärmeerzeugung am O rt des Verbrauchs sind 01und vor allem Gasfeuerungen noch als wenig umweltbelastend anzusehen, wogegen die Verwendung von Festbrennstoffen in kleinen Anlagen die bei weitem stärkste Umweltbelastung aller Wärmeerzeuger bewirkt. Aus diesem Grunde sollte von ihrer Verwendung als hauptsächlichem Energieträger in dicht bebauten Gebieten unter allen Umständen abgesehen werden. Eine ebenfalls beachtliche Umweltbelastung hat die Verwendung 99 Investitionen Energiekosten Energieträger Anlagenplanung Beurteilungskriterien Abstimmung von Leistung auf Leistungsbedarf Betriebssicherheit Abgasreinigung Anschlußkosten Platzbedarf BereitstellungsLeistungspreis Abdeckung von Spitzenbedart Preisentwicklung monovalent bivalent multivalentes System Kaminfeuer von Heizöl in Wärmepumpen mit Verbrennungsmotorantrieb zur Folge (NOX , Ruß-Emission), obwohl auch hier wie bei Fernwärme der bezogene Primärenergieverbrauch sehr niedrig ist. 6. Kosten und Zahlungsbedingungen Bei leistungsgebundenen Energieträgern ist hier besonders zu prüfen, ob Bereitstellungs-oder Leistungspreise erhoben werden, oder wie die Anlage auszulegen ist, um sie zu vermeiden. Im Gegensatz zu den lage rfähigen Brennstoffen, die beim Kauf vor dem Verbrauch - bezahlt werden müssen, erfolgt die Bezahlung bei leitungsgebundener Energie in regelmäßigen zeitlichen Abständen nach dem Verbrauch, so daß sich die finanzielle Belastung gleichmäßig verteilt. Die Preisentwicklung in der Zukunft ist wohl bei sämtlichen Energieträgern kaum vorhersehbar, im übrigen bestehen zwischen den Preisen nahezu sämtlicher Energieträger mehr oder weniger starke Zusammenhänge, die auseinanderlaufende Entwicklungen kaum zulassen. Aus verschiedenen, zuvor teilweise genannten Gründen, wird heute zunehmend versucht, die Energieversorgung einer Heizung nicht mehr nur von einem einzigen Energieträger bzw. Brennstoff abhängig zu machen. Daher bietet es sich an, eine bisher nur bei Wärmepumpen übliche Systematik auf die Wärmeerzeuger insgesamt zu übertragen: ein System, das nur einen einzigen Energieträger nutzen kann, wird als monovalent bezeichnet; können zwei verschiedene Energieträger genutzt werden, so handelt es sich um ein bivalentes System_, bei drei oder mehr Energieträgern wird es als multivalent bezeichnet. Die Betriebsweise der Wär-w meerzeugeranlage wird je nachdem, ob verschiedene Energieträger nur getrennt oder gleichzeitig genutzt werden können, als alternativ oder parallel bezeichnet. In der folgenden Tabelle sind einige Systemkombinationen beispielhaft aufgeführt: SystemKombinationen Kachelöfen monovalent monovalent - parallel monovalent - alternativ bivalent - parallel bivalent - alternativ multivalent - parallel multivalent - alternativ Beispiel Gasheizung mit atmosphärischem Kessel Dieselwärmepumpe mit Ölzusatzheizung Elektrowärmepumpe mit Nachtspeicherzusatzheizung Elektrowärmepumpe mit Flüssiggaszusatzheizung Zweikammerkessel für Öl und Koks Elektrowärmepumpe, Ölzusatzheizung, Festbrennstoffkessel, atmosphärischer Gaskessel und Universal-Festbrennstoffkessel Eiserne Öfen Bei der Planung von Anlagen mit parallel oder alternativ zu betreibenden Wärmeerzeugern ist auf eventuelle Einschränkungen zu achten, die auf behördlichen Vorschriften beruhen können (z. B. nicht gleichzeitiges Verbrennen von Öl oder Gas und festen Brennstoffen) oder von der Energieversorgung her bedingt sind (z. B. kann eine elektrische Zusatzheizung nicht während der Ab100 schaltzeiten einer Wärmepumpe in Betrieb genommen werden). Mit der Entscheidung für einen (oder mehrere) Energieträger ist in gewissen Grenzen auch die Entscheidung für die Art der Warmwasserbereitung festgelegt. Einzelheizungen (Kamine, Kachelöfen usw.) können aus ästhetischen oder nostalgischen Gründen zum Heizen in der Übergangszeit oder als Teil einer bivalenten Wärmeerzeugung zur Abdeckung des Spitzenbedarfs an kalten Tagen oder auch nur zur Befriedigung eines Sicherheitsbedürfnisses neuerdings wieder in Frage kommen. Einzelheizung, Sammelheizung, Warmwasserbereitung Bei den Einzelheizungen (Kamine, Kachelöfen, eiserne Öfen, Warmluft-Kachelöfen, elektrische Direktheizung, elektrische Speicherheizung) befindet sich der Wärmeerzeuger in dem zu beheizenden Raum selbst. Die älteste Heizart MMt das Kaminfeuer. Es kommt vor allem Holz als Brennstoff in Frage, die Wärme wird hauptsächlich durch Strahlung an den Raum übertragen, der feuerungstechnische Wirkungsgrad ist sehr gering, der Bedienungsaufwand ist der höchste von allen Wärmeerzeugern. Es kann mit einer Heizleistung bezogen auf die Kaminöffnung von etwa 3,5 bis 4,5 kW/m 2 gerechnet werden. Kachelöfen sind als Wärmes_peicheröfen ausgeführt. Die Feuerung ist ein- bis zweimal täglich in Betrieb, die dabei abgegebene Wärme wird in der großen Masse der Öfen gespeichert und langsam im Laufe des Tages an die Umgebung abgegeben. Außer den Festbre instoi el kommt auch Ol in Frage. Von der großen Oberfläche der mit Kacheln ummantelten Ofen wird die Wärme etwa zu gleichen Teilen durch Strahlung und Konvektion an den Raum abgegeben. Dabei ist die Wärmestromdichte stark mit der Zeit veränderlich und auch schlecht zu regulieren. Nach der Feuerung können maximale Oberflächentemperaturen von über 120 °C auftreten; im Mittel liegen die Oberflächentemperaturen über 80 °C. Die Temperaturunterschiede im Raum sind wie beim Kaminfeuer sehr hoch. Der Feuerungswirkungsgrad liegt maximal bei etwa 85%, meist jedoch unter 75%. Eiserne Öfen sind dadurch gekennzeichnet, daß man den Brennstoff im Ofen je nach der verlangten Heizleistung durch Einstellen der Verbrennungsluftmenge mehr oder weniger langsam abbrennen lassen kann. Sie sind daher auch für Dauerbrand geeignet. Wegen der im Gegensatz zu den Kachelöfen kleinen Speichermasse und dünneren Wände ist ihre Oberflächentemperatur deutlich höher (mithin auch der Strahlungsanteil). Nach t eilig ist auch hier die ungleichmäßige Raumerwärmung. durch Konvektion und Strahlung - vom BelaAnwendung finden fast alle Brennstoffe. Bei mostungsgrad unabhängig hoch bleibt und daß. die dernen Öfen ist der Bedienungsaufwand niedrig und auch eine Regelung der Heizleistung nach der feuerraumseitigen Auskühlverluste während der Raumtemperatur möglich. Brennerstillstandszeiten mit abnehmender Belastung größer werden. Damit ergibt sich das in Bei Warm _ Iuft-Kachelelfen wird in eine Kachel-UmAbb. 1 dargestellte prinzipielle Betriebsverhalten, mantelung ein meist gußeiiserner Heizeinsatz für das sich im praktischen Betrieb um so ungünstiDauerbrand hineingestellt; es handelt sich hier ger bemerkbar macht, je mehr der Wärmeerzeuger also nicht um eine Speicherheizung. Die Raumluft tritt unten in die Ummantelung ein, erwärmt sich an im Vergleich zu tatsächlich auftretenden Höchstlast überdimensioniert ist. dem Heizeinsatz und tritt oben durch ein Gitter in einen oder mehrere Räume aus Wie beim eisernen Ofen kann auch hier die Heizleistung abhängig vom Bedarf in Grenzen reguliert werden. Die Wärmeabgabe ist überwiegend konvektiv; eine gleichmäßige Raumerwärmung ist schwer zu er0,9 reichen. Elektrische Direktheizgeräte kommen wegen der hohen Kosten ähnlich wie die Gasheizung nur als Zusatz- und Übergangsheizung in Frage. Ihre Hauptvorteile sind kurze Anheizzeit, sauberer Betrieb, vorzügliche Regelbarkeit, keine Brennstofflagerung, stete Betriebsbereitschaft, geringer Anschaffungspreis. Elektrische Speicherheizung kann durch Nutzung der niedrigen. Nachtstrom-Tarife als Dauerheizung wi rtschaftlich sein. Sie gewinnt daher an Bedeutung, insbesondere unter der Zielsetzung, 01 als Brennstoff zu substituieren. Von den in ihrer Regelfähigkeit stark unterschiedlichen drei Bauarten ist nur die energetisch vertretbar, bei der die Wärmeabgabe im wesentlichen über die von einem Ventilator durch die Speichermasse geförderte Luft an den Raum abgegeben wird (Baua rt Ill). Moderne Geräte werden automatisch in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Restwärme im Speicher aufgeladen und besitzen auch eine Regelung für die Luftaustrittstemperatur. Sammelheizung - Heizkessel Mehr und mehr werden konstruktiv und steuerungstechnisch hochentwickelte Kessel angeboten, die zusammen mit auf sie in den Auslegungstemperaturen abgestimmte Raumheizflächen Nutzungsgrade bieten, wie sie von elektrisch angetriebenen Wärmepumpen primärenergetisch gesehen, kaum erreicht werden. Zum Beispiel können die Abgase bei genügend kaltem Kesselrücklauf so weit abgekühlt werden, daß mehr Energie, als dem (unteren) Heizwert o nts i ichtgenutzt wird. Oder weiter: Die Betriebsweise mit gleitender Kesseltemperatur führt nur dann zu hohen Nutzungsgraden, wenn die für die Raumheizflächen erforderlichen niedrigen Temperaturen auf die Auslastung des Kessels abgestimmt sind. Bei konventionellen Heizkesseln war es vor allem aus Gründen der rauchgasseitigen Korrosionsgefahr notwendig, sie ständig auf einer Mindest-Betriebstemperatur zu halten, unabhängig davon, ob das anschließende Wärmeverteilungssystem Heizmitteltemperaturen in Höhe der Kesseltemperatur oder - wie in der weitaus überwiegenden Zeit der Heizperiode weit darunter anforderte. Die jeweils notwendigen Heizmitteltemperaturen wurden durch Mischung erreicht, was für die Regeltechnik ohne Probleme zu realisieren war. Zusätzlich waren Mindesttemperaturen der Heizflächen im Feuerraum erforderlich, um einen vollständigen Ausbrand zu erreichen und damit die Schadstoffemission so gering wie möglich zu halten. Dieser ständige „Hochtemperatur"-Betrieb hat zur Folge, daß ein wesentlicher Teil der Wärmeverluste eines Heizkessels - die Oberflächenverluste 5.2 tECNN.AUSBAU vJarmequellen Warmluft-Kachelöfen Elektrische Direktheizgeräte 0,8 0 ,05 .0,2 0,3040.5 0,1 Belastungsgrad YK Abgasverluste µLA. Auskühlverluste 1-t o Oberflächenverluste Elektrische Speicherheizung Kesseinutzungsgrad V K und Feuerungsnutzungsgrad -F F in Abhängigkeit des Kesselbelastungsgrads YK für einen konventionellen Heizkessel Aus der Abhängigkeit der einzelnen Verlustanteile lassen sich.die Anforderungen für die Gestaltung eines für Niedertemperatur-Heizanlagen geeigneten Kessels ableiten: Die temperaturabhängigen Wärmeverluste müssen sowohl durch ausreichende Wärmedämmung als auch durch die Betriebsweise des Kessels mit abnehmender Belastung kleiner werden, Dies läßt sich z. B. durch den sogenannten „gleitenden Betrieb" erreichen, bei dem die Kesseltemperatur abhängig von der jeweiligen Außentemperatur - und somit von der Belastung - variie rt wird. Trotzdem muß dafür gesorgt sein, daß der Ausbrand in der Flamme nicht durch zu kalte Heizflächen beeinträchtigt wird. Der Anteil der Abgasverluste hat dä'S größte Gewicht vor allem, wenn der Heizkessel riehtia dimensioniert ist. Damit wird seine Reduzierung lohnend. Dem steht allerdings das Problem der Taupunktunterschreituna (wie bereits erwähnt) nicFit nür im Kessel, sondern besonders in der Abgasanlage (Schornstein) - entgegen. Im Kessel selbst tritt nur dann Kondensation auf, wenn die Oberflächentemperatur der rauchgasberührten Flächen unter dem (Wasser-)Taupunkt der Abgase liegt. Dabei können die den Kessel verlassenden Abgase so heiß sein, daß im Schornstein keine Kondensation zu befürchten ist (Versottung). Hingegen können niedrige Abgastemperaturen, wenn der Abgasstrom im Verhältnis zu den Kesselhe)zflächen zu klein ist, zu Kondensation im Schorn-: stein führen, obwohl derKessel wegen genügend höher Heizmitteltemperaturen trocken bleibt. Die Abgasverluste lassen sich nur dadurch reduzieren, daß die nicht zu vermeidende Kondensation nur an dafür vorgesehenen Bauteilen erfolgen kann. Das erfordert, diese Bauteile aus korrosionsbeständigen Materialien herzustellen und das anfallende Kondensat (verdünnte Kohlenspure und bei Heizöl verdünnte schweflige Säure) gezielt abzuführen und zu neutralisieren. Weiterhin sind dazu korro101 NiedertemperaturHeizanlagen Nutzungsgrad hgasverluste 1aupunktUnterschreitung ndensation Schornstein sionsbeständige Abgasführungen (Edelstahl, Asbestzement) notwendig. Unter Umständen bedarf es eines Abgasgebläses, wenn die Auftriebskräfte der Abgase nicht mehr ausreichen. Die Anwendung der Niedertemperaturtechnik zur Abgaskühlung kann darin bestehen, die AuslegungsTemperaturen des Wärmeverteilungssystems so auszuwählen, daß die Rücklauftemperaturen auf jeden Fall den Kondensationsbetrieb ermöglichen, oder spezielle Einrichtungen zur Abgaskühlung einzusetzen, wie z. B. Kleinwärmepumpen. Lastabsenkung Raumtemperaturabsenkung Leistungske; :; Kesselnutzungsgr-d im Teillastbereich Lastabsenkunfen oder Abschaltungen sind typische Betriebsabläufe für Wärmeerzeuger in modernen Heizanlagen. Dies kann durch gewollte Raumtemperaturabsenkung_ während der Nachtstunden oder in anderen Zeiten verursacht sein. Bei der heutigen Bauweise entfällt dabei meist die° Wärmezufuhr. Kessel hierfür und für bivalente Anlagen, die die meiste Zeit über keine Wärme zu liefern brauchen - abgesehen von den täglichen Stromabschattzeiten für die Wärmepumpe - sollten nach ihrem Betrieb möglichst schnell und ohne merkliche Verluste auf Umgebungstemperatur auskühlen und von der Heizanlage abgekoppelt bleiben. Dies setzt niedrige Wasserinhalte voraus. Werden die zuvor . genannten Maßnahmen Abgaskühlung, gleitender Betrieb, Abschaltung angewandt, so ändert sich das Betriebsverhalten eines modernen Kessels im Vergleich zu einem alten ganz erheblich: Die einzelnen Verluste nehmen mit sinkender Belastung ab - teilweise überproportional -, so daß der Kesselnutzungsgrad im Teillastbereich höher liegen kann als bei Vollast. In Abb. 2 sind typische Verläufe für vier unterschiedliche Kesselkonzeptionen qualitativ dargestellt. beliebig exakt nach der tatsächlich auftretenden Höchstlast auszulegen. Wesentlich anders ist die Situation für Heizöl als Brennstoff. Aufgrund verschiedener Ursachen (vor allem Schadstoffbildung) erlaubt es die Brennertechnik nicht, Feuerungsleistungen bei ausreichender Zuverlässigkeit unterhalb von 15 bis 20 kW zu realisieren. Dies führt dazu, daß zumindest im Bereich der Einfamilienhäuser - deren Auslegeleistung unter 10 kW liegen kann - eine Überdimensionierung des Wärmeerzeugers bei Verwendung von Heizöl als Brennstoff nicht zu vermeiden ist. Ganz besonders gilt dies, wenn der Kessel mit Ölfeuerung als Zusatzheizung zu einer Wärmepumpe im Parallelbetrieb vorgesehen ist. Ein überdimensionierter Kessel hat Verluste (diese wachsen ja mit der Größe, wenn sie auch anteilig etwas niedriger werden können). Dieser Nachteil ist unvermeidbar, kann aber zu einem wesentlichen Teil dadurch wieder wettgemacht werden, daß die Anlage für den Temperaturbereich ausgelegt wird, in dem der Kessel sein Leistungsoptimum hat. Das heißt, daß für diese Anwendung im Normalfall nur Kessel in Frage kommen, die für den Betrieb mit gleitender Kesseltemperatur geeignet sind. Abb. 3 zeigt, in welchen Bereich der Leistun_skennlinie eines Kessels der reale Betrieb fällt, wenn er richtig dimensionie rt ist. 100 1 1` ' +' -^-•—^ 80 0,8 0,6 ^ ^. i ^ 60 ^^ 0,4 40 rr 20 d m m 11111 0,8 oi c Belastungsgrad 0,6 a = gleitend betriebener Kessel b konventioneller Kessel t r;-dem Belastungsgrad entsprechende mittlere Heizmitteltemperatur bei konventioneller Auslegung ^ c 0,4 0.2 Leistungsbeurteiliing von Heizkesseln DIN 4702 Heizungsanlagenverordnung Heizungsbett : isverorct ^^ Bundesimmiss schutzg. Kesselnutzungsgrad v5 in Abhängigkeit des Kesselbelastungsgrades Y,r An dieser Stelle müssen noch einige grundsätzliche Bemerkungen zur Anwendung der verschiedenen Brennstoffe in Heizkesseln gemacht werden. Der augenblickliche Stand der Brennertechnik erlaubt es, bei Gas als Brennstoff nahezu eine beliebig kleine Feuerungsleistung zu realisieren vor allem durch die Anwendung von sogenannten atmosphärischen Brennern ohne Gebläse, die dazu noch in einem größeren Leistungsbereich regelbar sein können (allerdings muß teilweise ein etwas geringerer Feuerungswirkungsgrad in Kauf genommen werden). Damit ist es möglich. Wärmeerzeuger mit Gasfeuerung nahezu in jedem Fall 102 YK Betriebsbereich betrichtiger Dimensionierung Betriebsbereich bei 100% Überdimensionierung Kesselnutzungsgrad K in Abhängigkeit K2as-iii2iäitur,ySiyrGde7f Y K - 0 ' 0 1 0,05 0,2 0,3 0,4 0,5 1 Belastungsgrad YK a konventioneller Kessel, Kesseltemperatur konstant>70 °C b wie a, jedoch gleitende Kesseltemperatürt K =f (tAu) c Kessel mit extrem verringe rten Verlusten, Kesseltemperatur gleitend>50 °C d Kessel mit Abgaskühlung unter die Kondensationstemperatur, Kesseltemperatur gleitend 0 ®®®1 Das gegenüber konventionellen Heizkesseln wesentlich veränderte Betriebsverhalten von Niedertemperatur-Kesseln (Abb. 2) wird in Zukun ft auch Ergänzungen bei der vergleichenden Beu rteilung erfordern. Die zur Zeit noch gültigen Normen für die Leistungsbeurteilung von Heizkesseln (-DIN 4702) sind dazu nur eingeschränkt geeignet, da sie nur auf dem Vergleich des Wirkungsgrades im Vollastbetrieb sowie des BetriebsbereitschaftsWärmeaufwands (Stillstandsverlust) aufbauen. Die maßgeblichen Unterschiede im Teillastverhalten können damit kaum berücksichtigt werden. B_.^E^g. :, ::::..........1 F.Ntfir. inkriaith Wert r Fe—,';=°Er's .r=- 1 .-•r*e-51...uirg n trk s :: .i^ , von Fete.- _r r `-lreti- _ ^rd-.. ._.. . . ^äF des fossil befeuerten Wärmeerzeugers auch für längere Zeit erhalten bleibt. Direkt befeuerte Wärmeerzeuger: Eine bewährte Technik bei der Verwendung von Gas als Brennstoff stellen Wärmeerzeuger mit, Brennern ohne Gebläse Latmosphärische Brenner") dar, die entweder als Kessel - meist in Gliederbauweise - oder als Durchlauferhitzer Gasthermen - ausgeführt sind. Bei Aurcillauferb tzern ist hervorzuheben, daß sie den Vo rt eil besitzen, praktisch speicherlos zu sein. Bei Beachtung der jüngsten Entwicklungen mit automatischer Zündung ohne ständig brennende Zündflamme und stufenloser Leistungsregelung im Bereich ab 25% der Nennleistung weisen diese Gerate nahezu keine Stillstandsverluste auf und sind damit gut als Zusatzwärmeerzeuger mit Flüssiggas in bivalenten Wärmepumpenanlagen geeignet. Bei paralleler Betriebsweise ist der Energieverbrauch des Zusatzwärmeerzeugers so niedrig, daß sich die Verwendung von Flüssiggas nahezu in jedem Fall anbietet, auch der deutlich höhere Preis bei Einkauf von kleinen Mengen (z. B. Raschen) macht sich bei den gesamten Energiekosten nur wenig bemerkbar. Falls für die Warmwasserbereitung ein Speicher vorgesehen werden kann, ist es mit einem Ladekreislauf in Vorrangschaltung möglich, das Wasser mit der Gastherme zu erwärmen. Eher für monovalente, der Gasversorgung angeschlossene Anlagen eignen sich Gaskessel (Gliederbauweise) mit Brennern ohne Gebläse. Wegen der üblicherweise verwendeten Werkstoffe Guß oder Edelstahl sind sie gegen Korrosion widerstandsfähig und damit für den Betrieb mit gleitender Kesseltemperatur geeignet. Der durch Feuerraum und Strömungssicherung gewährleistete ständige Luftzutritt sorgt zudem für schnelles Verdunsten des Kondensats. Durch Ausrüstung mit automatischer Zündung und Abgassperrklappe können Stillstandsverluste nahezu vollständig vermieden werden. Allerdings ist bei gleitendem Betrieb - vor allem bei regelbarer Leistung - eine korrosionsbeständige Abgasanlage e rforderlich. Sehr verbreitet sind auch,Speziatkesse(,für_c oder Gasbetrieb mit Gebläsebrenner und gleitender Kesseltemperatur. Sowohl bei Guß als auch hei Stahl werden rlie Rrennraiumnherflächen durch eine besondere Beschichtung gegen Ko rrosion unempfindlich gemacht. Trotzdem sollte ein ständiger Betrieb im Kondensationsbereich vermieden werden, da für eine Ableitung des Kondensats üblicherweise nicht gesorgt ist. Meist ist zur Brauchwasserversorgung ein Speicher aufgesetzt, der über eine Vorrangschaltung temperaturgesteuert aufgeladen wird. Bei reinem Sommerbetrieb (nur Warmwasserbereitung) oder als Zusatzwärmeerzeuger darf der Kessel in der Betriebspause vollständig abkühlen, was durch den geringen Wasserinhalt der Kesselglieder nur wenig Wärmeverluste mit sich bringt. Eine weitere Möglichkeit, die Kesseltemperaturen bis zur Umgebungstemperatur gleiten zu lassen, besteht bei Stahlkesseln in Verbund-Konstruktionen: Der Brennraum besteht aus einem liegenden Rohr mit inneren Längsrippen, in das ein ungekühltes Stahlrohr als eigentliche Brennkammer eingeschoben ist. Diese „heiße" Brennkammer bewirkt einen guten Ausbrand auch bei niedrigen Wassertemperaturen, Kondensation wird durch die Innenberippung weitgehend vermieden. Ein weiterer Weg der Leistungsoptimierung kann dadurch beschritten werden, daß wesentliche Bauelemente in ein Gehäuse mit gemeinsamer Wärmedämmung einbezogen werden und so die Stillstandsverluste erheblich reduzie rt werden können, obwohl derartige Kessel nur über 5000 mit gleitender Kesseltemperatur betrieben werden. Hier ist der Brenner Bestandteil der Konstruktion, was eine optimale Abstimmung erlaubt. Zusätzlich verfügen diese Wärmeerzeuger über Ansaugluftund Ölvorwärmung sowie einen Zugunterbrecher, um Auskühlung zu vermeiden. Schließlich besteht auch eine Möglichkeit, die Kesselnutzüngsgrade anzuheben darin, zusätzlich Aggregate zur Nutzung der Abgasenthalpie einzubauen. Vor allem bei Verbrennung von Gas kann man hier die Abgase mit Hilfe eines Gebläses über den Verdampfer einer Kleinwärmepumpe iu einer korrosionsbeständigen Abgasanlage führen. Die bei den meisten der vorgestel lt en Kesselkonzepte mögliche Temperaturabsenkung in Betriebspausen läßt die zentrale Brauchwasserbereitung in Verbindung mit der Heizung de rzeit wieder vorteilhaft erscheinen. Während der Heizperiode erfolgt die Wassererwärmung ohnehin mit dem günstigen Kesselnutzungsgrad des Heizbetriebes und im Sommerbetrieb (etwa 120 Tage) ist der Energieverbrauch infolge des an sich geringen Energiebedarfs zur Warmwasserbereitung auch bei nur mäßigen Nutzungsgraden so niedrig, daß kein heute bekanntes System damit wi rt scha ft lich konku rrieren kann. Atmosphärische nner ::hlauferhitzer kessel Sammelheizung - Wärmepumpe Durch die erheblichen Energiepreissteigerungen der letzten Jahre haben die Wärmepumpen als Wärmeerzeuger für Heizanlagen eine Bedeutung erlangt, die zuvor kaum vorstellbar war. Dabei ist ihr physikalisches Prinzip aus der Kältetechnik schon seit über 100 Jahren bekannt und do rt auch längst zur technischen Reife gelangt, da es zur stetigen Kälteerzeugung keine konkurrierenden Verfahren gibt. Zur Wärmeerzeugung blieb diese Technik solange unbedeutend, solange es wesentlich billiger und d az u noch einfacher war, Wärme durch Verbrennung fossiler Energieträger zu e rzeugen. Da es mit Hilfe der Wärmep umpe möglich ist, Heizenergie dadurch bereitzustellen, daß ein Bruchteil davon in Form von hochwertigerAntriebsenergie aufgewendet wird, ist ihre Bedeutung als Wärmeerzeuger im wesentlichen nur vom Verhältnis der Energiepreise abhängig. Beim de rz eitigen Stand der technischen Entwicklung ist von mehreren physikalisch möglichen Arbeitsverfahren nur das der Kaltdampf-Kompressionswärm_ epumpe technisch ausgereift, wobei für kleine bis mittlere Anlagen (Antriebsleistung < 20 kW) nur der elektromotorische Antrieb in Frage kommt. Bei höheren Leistungen kann der Antrieb auch mit Verbrennungsmotoren (Diesel oder Gas) erfolgen. Eine vielversprechende Entwicklung für die Zukunft stellen Absorpttonswärmepumgen_dar, bei denen die Antriebsenergie nicht in Form von mechanischer Arbeit, sondern als Wärme zugeführt wird. Obwohl erste Geräte nach diesem P ri nzip bereits angeboten werden, wird es bis zur breiten Markteinführung noch einige Jahre dauern. Die Funktion der Wärmepumpe beruht darauf, daß die Temperatur von Dampf bei einer Druck103 eZialkessel mit blasebrenner Kai . .:mpf-Kompr: •:onswärmepumpe Absc,rptionswärmepumpe -. .hlkessel "t: rhund•uktionen Wärmequellen erhöhung erheblich ansteigt und zudem auch sei- Die Heizleistung der Wärmepumpe steigt mit kleine Kondensationstemperatur. Das heißt man kann ner werdendem Temperaturabstand zwischen Verdampfung und Kondensation, das heißt zwischen mit Hilfe von mechanischer Energie die TemperaWärmequelle und Heizmittel; dabei steigt sowohl tur eines Stoffes so weit erhöhen, daß es möglich die Leistungszahl als auch die Antriebsleistung; ist, bei niedrigen Temperaturen aufgenommene Wärme bei wesentlich höheren Temperaturen wie- bei gleichbleibendem Temperaturabstand zwider abzugeben. Um dies zu verwirklichen, läßt man schen Heizmedium und Wärmequelle steigt sowohl die Heizleistung als auch die Antriebsleistung einen Stoff (Arbeitsmittel oder Kältemittel) einen mit steigendem Temperaturniveau, die Leistungssogenannten Kreisprozeß durchlaufen, der es ermöglicht, die Wärme bei niedriger Temperatur auf- zahl bleibt praktisch konstant. zunehmen und bei höherer Temperatur kontinuierDaraus ergeben sich für die Gestaltung der lich abzugeben (Abb. 4). Systeme auf der „kalten" und der „warmen" Seite I der Wärmepumpe folgende Forderungen: t„ QWP Heizmedium Ö Das Medium der Wärmequelle sollte vor allem dann mit möglichst hohen Temperaturen zur tq Verfügung stehen, wenn hoher HeizleistungsKondensator bedarf vorliegt; „warme Seite" (hoher Druck) O das System der Wärmeverteilung sollte so ausDrosselventil s gelegt sein, daß die erforderlichen HeizmittelP ,kalte Seite" Verdichter temperaturen einen günstigen Wärmepumpen(niedriger Druck) betrieb ermöglichen. lb Beide Forderungen lassen sich in Wirklichkeit leider kaum erfüllen, da das durch das Klima gegea0=Qwal bene Verhalten von Wärmequelle und Heizlast dem Wärmequelle + thermodynamisch gegebenen der Wärmepumpe Schema einer Kompressionswärmepumpe entgegenläuft: 4 Wenn die Heizung (bzw. das Gebäude) hohe Leistung verlangt, sind zum einen die erforderlichen Nicht zur Wärmepumpe mit Verdampfer und KonHeizmitteltemperaturen hoch und zum anderen densator gehören zwei Elemente, die für die Konzeption der Gesamtanlage jedoch maßgeblich sind die Temperaturen der Wärmequelle, wenn sind: Eine Wärmequelle, der die im Verdampfer zu- nicht gar extrem niedrig (wie beispielsweise bei zuführende Wärme entnommen werden kann (z. B. Außenluft), so doch nicht höher als zu Zeiten mit niedrigem Leistungsbedarf. Außenluft, Grundwasser, Erdreich) und das Heizsystem, an das die Wärmepumpe die Heizwärme Diese Eigenschaften von Wärmequelle und Heizabgibt. system stellen bei der Auslegung der Wärmepumpe ganz besondere Anforderungen an die LeiVerschiedene im Handbuch Niedertemperaturstungsregelung. Da bei kleinen Wärmepumpen heizung [4] näher erläuterte Einflüsse auf das (Heizleistung ca. 20 kW) beim heutigen Stand der Leistungsverhältnis der Wärmepumpe ergeben Entwicklung weder eine kontinuierliche (z. B. Drehzusammengefaßt folgendes grundsätzliches zahlregelung) noch eine stufenweise Regelung Betriebsverhalten (Abb. 5): (z. B. Zylinderabschaltung) wirtschaftlich realisieri—, bar scheint, gibt es nur die Möglichkeit des Ein-/ Aus-Betriebes. Dies hat zur Folge, daß bei zu ku rzen Taktzeiten mit einer Beeinträchtigung der Lebensdauer gerechnet werden muß. two —► Verdampfer Schon aus diesem Grund ist die Anordnung eines Pufferspeichers im Heizsystem angebracht [4]. Pufferspeicher Der elektrische Antrieb der Wärmepumpe hat derzeit den größten Anteil am Markt. Bei Heizleistungen bis 20 kW sind keine Alternativen vorhanden. Wird eine elektrisch angetriebene Wärmepumpe als Wärmeerzeuger einer Heizanlage vorgesehen, so ist bei der Planung darauf zu achten, daß aus Gründen der Belastung der Stromversorgung mit gewissen Betriebseinschränkungen gerechnet werden muß. Elektrische Wärmepumpe -10 0 -5 5 10 15' Temperatur der Wärmequelle in °C —► tc = 35° C tc=45°C tc=55°C — — — Typisches Betriebsverhalten einer Luft Wasser-Wärmepumpe. Leistungszahl C, Heizleistung dlwe und Leistungsaufnahme Pwp in Abhängigkeit der Lufttemperatur (Wärmequelle) far unterschiedliche Kondensationstemperatur 104 5 So legt die Bundestarifordnung Elektrizität vom Januar 1980 fest, daß nur solche Wärmepumpen ohne Bereitstellungskosten angeschlossen werden können, die entweder alternativ mit einer Zusatzheizung betrieben oder bis zu dreimal täglich jeweils für zwei Stunden (über Fernsteuerung) abgeschaltet werden können. Der Stromverbrauch für diese Wärmepumpen wird dann zu allgemeinen Tarifpreisen (einschließlich Schwachlasttarif) berechnet. Die Abschaltzeiten der Wärmepumpe können entweder durch Wärmespeicher oder eine Zusatzheizung überbrückt werden. Werden infolge einer ungünstigen Auslegung der Wärmepumpen anlage vom EVU Bereitstellungskosten berechnet, so ist von vornherein ein wi rtschaftlicher Betrieb der Wärmepumpe nicht mehr möglich. Mit Verbrennungsmotoren angetnebeneWärme pumpen sind derzeit nur bei größeren Leistungen einsetzbar. Da die erforderlichen Leistungen der Motoren so niedrig sind, daß keine in genügender Stückzahl hergestellten Motoren für andere Verwendungsbereiche zur Ve rfügung stehen, von denen eine ausreichende Lebensdauer erwa rtet werden könnte. Folgende Wärmequellen sind für Wärmepumpen denkbar: Luft Grundwasser Strahlung Oberflächenwasser Erdspeicher Abwärme Erdreich TECHN. AUSBAU w^; Bezüglich des Temperaturverhaltens ist zwischen solchen Wärmequellen zu unterscheiden, deren Temperatur vom täglichen oder jährlichen Gang der Außentemperatur abhängig ist, und solchen, deren Temperatur davon ganz oder weitgehend Der besondere Vo rteil des Antriebs mit Verbrennungsmotoren besteht darin, daß zusätzlich zu der unabhängig ist. von der Wärmepumpe gelieferten Wärme die vom Bei einer größeren Verbreitung von Wärmepumpen Kühlwasser und Schmieröl dea Motors abzufühals Wärmeerzeuger vor allem für kleinere Heizanrende Wärme sowie ein wesentlicher Teil der Abgas-Enthalpie genutzt werden kann. Dadurch kann lagen wird Luft die wichtigste Wärmequelle sein. Da die Heizlast mit fallender Außentemperatur zuauch die von der Wärmepumpe her beschränkte Heizmittelvorlauftemperatur in den nachgeschalte- nimmt, ergibt sich für die Abhängigkeit von der Außentemperatur das gegenläufige Verhalten für ten Wärmetauschern noch erhöht werden, so daß Heizmitteltemperaturen von über 70 °C erreichbar Heizlast und Wärmepumpen-Heizleistung. Dies muß bei der Auslegung berücksichtigt werden, sind. Ein weiterer Vo rteil des Verbrennungsmotorwas üblicherweise zu einer bivalenten Anlage mit antriebs besteht darin, daß sich eine Leistungsregelung durch Drehzahlveränderung relativ leicht Zusatzheizung füh rt , bei der die Wärmepumpe nur' einen Teil der Maximallast (z. B. 50%) abdecken durchführen läßt. kann. Bei der Absorptionswärmepumpe durchläuft zwar ein Arbeitsmittel einen ähnlichen Kreisprozeß wie bei der Kompressionswärmepumpe, die Verdichtung mit der Temperaturerhöhung wird aber nicht von einem mechanischen Kompressor bewirkt, sondern durch einen Lösungsmittelkreislauf, der auch als ,,thermischer Kompressor" bezeichnet wird. Dabei wird von einer Lösungspumpe die Druckerhöhung des in Lösung befindlichen Arbeitsmittels bewirkt, die Temperaturerhöhung erfolgt durch zusätzliche Wärmezufuhr im Austreiber, wo das Arbeitsmittel dampfförmig vom Lösungsmittel getrennt wird. Der vom Verdampfer kommende Kaltdampf wird im Absorber wieder vom Lösungsmittel aufgenommen und gibt dabei zusätzlich Wärme ab. 5.z Wärmepumpen für die Wärmequelle Luft werden in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten: als Kompaktgeräte, bei denen das vollständige Gerät mit Verdampfer und Ventilator in einem Gehäuse untergebracht ist, und als geteilte Geräte Splitausführung -, bei denen Verdampfer mit Ventilator in ein von der übrigen Wärmepumpe getrenntes Gehäuse eingebaut sind. Kompaktgeräte sind üblicherweise für die Aufstellung im Gebäude vorgesehen, es werden jedoch auch solche für Aufstellung im Freien angeboten. Der Verdampfer teil der Splitgeräte ist regelmäßig für die Aufstellung im Freien ausgerüstet, er kann aber auch im Gebäude untergebracht werden, z. B. auf dem Dachboden. Befindet sich der Verdampfer im Gebäude, so sind Luftkanäle und Wanddurchbrüche zur Minderung des Ventilatorgeräusches meist Schalldämpfer erforderlich. Ein Vorzug der Absorptionswärmepumpe besteht darin, daß die zum Antrieb e rforderliche Energie bis auf den kleinen Anteil mechanischer Energie Bei Aufstellung im Freien kann ein Wetterschutz für die Lösungsmittelpumpe - in Form von Wärme nötig sein, bei größeren Entfernungen zu Gebäuauf einem mäßig hohen Temperaturniveau zugeArten den kann eventuell auf Schalldäm pfer verzichtet fi_ihrt werden kann Damit können werden. Der Einbau von Schalldämpfern hat einen von Brennstoffen als auch Abwärme aus anderen erheblich zusätzlichen Druckabfall zur Folge, was Prozessen (z. B. Abgasenthalpie) zum Antrieb bebei der Auslegung des Ventilators berücksichtigt nützt werden. Allerdings wird bei kleinen Anlagen werden muß. (Einfamilienhaus) das Problem bestehen, daß nicht für jeden Brennstoff entsprechend kleine WärDa die Oberflächentemperaturen des Verdampfers meerzeuger realisierbar sind. immer deutlich unter der Lufttemperatur liegen müssen, ist abhängig vom Feuchtegehalt der Luft Eine Absorptionswärmepumpe hat außer der mit Kondensatanfall zu rechnen. Bei VerdampLösungsmittelpumpe keine bewegten, dem Verfungstemperaturen über 0 °C bleibt dieses Konschleiß unterliegenden Teile, so daß mit ausreidensat flüssig und kann abtropfen; liegen die Verchender Lebensdauer dieser Aggregate gerechnet dampfungstemperaturen unter 0 °C, wird sich auf werden kann. den Verdam_pferflächen Reif bilden, was den Wärmeübergang erheblich verschlechtert und zu erhöhtem Druckabfall füh rt. Daher sind Einrichtungen zum Abtauen des Reifniederschlags notwendig. Üblicherweise wird eine sogenannte HeißWärmequellen gasabtauung eingesetzt, bei der kurzfristig die Das Temperaturverhalten sowie die zeitliche VerFunktion von Verdampfer und Kondensator verfügbarkeit der Wärmequelle bestimmen die Betauscht wird. Die zum Abtauen e rforderliche Enertriebsweise und damit die Auslegung der Wärmegie verschlechte rt in jedem Fall die Energiebilanz pumpe, die Kosten für die Erschließung hängen der Wärmepumpe. Nach bisherigen E rfahrungen hauptsächlich von der Art der Wärmequelle und liegt der Aufwand hierfür aber deutlich unter 5% weniger von der Auslegung der Wärmepumpe ab. der Heizwärme. 105 equellen Wärmepumpen mit Verbrennungsmotor Wärmequelle Luft Kompaktgeräte Thermischer Kompressor Splitausführung geteilte Geräte ldämpfer ^ng Wärmequelle Wärmequelle n Solarabsorber Grundwas ser Oberflächenw, Erdspeicher Abwärmenutzung Erdreich als direkter Solarspeicher •imensionierung Rohrverlegung Erdreichfläche Zur Nutzung der Strahlungsenergie werden in jüngster Zeit eine Vielzahl von unterschiedlichsten Bauelementen angeboten (meist unter dem Begriff Solarabsorber, Ausführung z. B. als Dach- oder Fassadenelemente, Rohrbündel-, Plattenwärmetauscher usw.), deren Wirkung darauf beruht, daß sie bei direkter Sonneneinstrahlung diese als Wärmequelle nutzen und bei fehlender Einstrahlung durch freie Konvektion der Luft Wärme entzogen wird. Für die Abhängigkeit der Heizleistung von der Außentemperatur gilt das bereits für Lu ft Gesagte. Die bei direkter Bestrahlung auftretenden hohen Wärmequellen-Temperaturen erfordern allerdings noch technische Entwicklungen bei der Wärmepumpe selbst. Erste Betriebserfahrungen mit Energieabsorbern lassen erkennen, daß die erreichbaren Arbeitszahlen der Wärmepumpen-Anlagen kaum höher liegen, als bei Luft als Wärmequelle. Auch bei der Auslegung ist wie bei Lu ft vorzugehen, allerdings ist zu berücksichtigen, daß zum Wärmetransport zwischen Absorber und Wärmepumpe üblicherweise ein Solekreislauf zwischengeschaltet wird, Absorber mit Direktverdampfung sind bisher nicht bekannt geworden. Als Wärmequelle hat G undwassernur dort eine Bedeutung, wo es reichlich vorkommt und nicht oder nur kaum als Trinkwasser verwendet wird. Es ist aber eine sehr günstige Wärmequelle, da die Grundwassertemperatur das ganze Jahr über nahezu gleich bleibt und durch ihre Höhe von ca. 8 bis 10 °C beste Voraussetzungen für die Wärmepumpe ergibt. Zur Gewinnung sind in der Regel zwei Brunnen zu bohren, da das abgekühlte Grundwasser wieder ins Erdreich zurückgeführt werden muß. Die Errichtung einer Brunnenanlage erfordert erhebliche Sorgfalt und sollte nur von erfahrenen Fachfirmen durchgeführt werden. Nahezu immer ist eine behördliche Genehmigung erforderlich. Mit Grundwasser als Wärmequelle läßt sich bei ausreichender Schüttung des Brunnens am ehesten eine monovalente WärmepumpenAnlage ausführen. In seltenen Fällen steht Qberflächenwasser als Wärmequelle zur Verfügung. Zum Wärmeentzug können Verdampferflächen direkt in das Gewässer gehängt werden, oder das Wasser wird über ein Einlaufbauwerk der Wärmepumpe zugeleitet und dem Gewässer nach der Abkühlung wieder zugeIm Zusammenhang mit Energieabsorbern steht der führt. Da bei den meisten Oberflächengewässern Erdspeicher als Wärmequelle. Durch seine Einfüin längeren Kälteperioden eine Abkühlung bis gung in die Wärmequellen-Anlage kann die Außen- nahe 0 °C möglich ist, können solche Anlagen nur temperaturabhängigkeit der Heizleistung verringert bivalent ausgeführt werden. werden, da die in Zeiten mit wenig HeizleistungsAbwärmenutzung als Wärmequelle für Wärmepumbedarf anfallende Strahlungsenergie für längere pen ist normalerweise nur dort anwendbar, wo Zeit gespeichert werden kann. Während strahlungsarmen Zeiten mit niedrigen Lufttemperaturen zwischen Abwärmeanfall und Heizleistungsbedarf ein fester proportionaler Zusammenhang besteht wird dann nur der Speicher als Wärmequelle her(z. B. innerhalb eines Betriebes). Ist dies der Fall, angezogen. Die Speicherkapazität des Erdreichs kann erheblich erhöht werden, wenn der als Spei- so kann unter Berücksichtigung des Temperaturganges der Abwärme unter Umständen auch eine cher vorgesehene Bodenbereich, z. B. durch monovalente Anlage in einem besonders günstiFolien abgedichtet und vollständig mit Wasser gen Betriebsbereich realisiert werden. getränkt wird. Die zum Wärmeentzug bzw. zur Aufwärmung notwendigen Rohrschlangen werden In der nebenstehenden Tabelle A sind für sämtin mehreren Lagen übereinander in das Erdreich liche Wärmequellen die Beurteilungen nach den eingebettet. Über die günstigste Speichergröße wesentlichen Kriterien zusammengefaßt. lassen sich noch keine Angaben machen, da zu dieser Technik noch zu wenig Erfahrungen vorliegen. Eine seit längerem bewährte Wärmequelle stellt das Erdreich als direkter Solarspeicher dar, dem im Erdreich verlegte Röhre Wärme entzieht. Durch die Sonneneinstrahlung kann sich der abgekühlte Bereich in der heizfreien Zeit wieder mehr oder dauernde v^^... ,^..^ ^^.., ^..^Ob ^. vu eine dauernde 1 CITemperaI Il.JC1C1wenigr ..we .regenerieren. turabsenkung erhalten bleibt - was die Eignung als Wärmequelle im Laufe der Zeit einschränken kann - hängt von der Bodenstruktur und dem flächenbezogenen Wärmestrom ab. Je feuchter das Erdreich ist und je mehr Fläche zur Verfügung steht, desto sicherer ist eine dauernde Nutzung möglich. Bewährt hat sich die Verlegung der Rohre in einer Tiefe von 1,4 bis 1,8 m mit einem Abstand von 0,3 bis 0,6 m. Bei einer durchaus möglichen monovalenten Auslegung ist je nach Bodenart eine Erdreichfläche erforderlich, die das 1,5- bis 2,5fache der zu beheizenden Wohnfläche beträgt. Die Rohrverlegung sollte möglichst in mehreren parallelen Kreisen erfolgen, was bei Beschädigung durch Abklemmen des defekten Kreises einen weiteren Betrieb zuläßt. Auch hier wird üblicherweise Sole als Transportmedium zur Wärmepumpe benützt, gelegentlich werden die Rohre auch als Direktverdampfer betrieben. Aufgrund der benötigten großen Bodenflächen wird die Wärmequelle Erdreich nur selten angewendet. 106 Auslegung der Wärmepumpe Da die Investitionskosten für eine Wärmepumpe und die dazugehörige Wärmequellen-Erschließung erheblich über denen eines konventionellen Wärmeerzeugers liegen, ist die richtige Festlegung Heizleistu _ _ im der benötigten benötigten ur^ilc^ülilpeil-1 ti ICIi1CIJLUIII^j Auslegungsfall besonders wichtig. Jede Überdimensionierung müß vermieden werden. Die Anwendung von Monogrammen zur Auslegung wird im Handbuch Niedertemperaturheizung [4] ausführlich erläutert. Voraussetzung für eine richtige Abstimmung der Wärmepumpe und der Raumheizflächen aufeinander und auf das Gebäude, ist das Vorliegen von Leistungskennlinien der Wärmepumpe in Abhängigkeit der Heizmittel- und Wärmequellentemperatur. Zu beachten ist, daß die Heizleistung von Wärmepumpen nur in Stufen vorliegt. Im Zweifelsfall sollte man eher eine zu kleine Wärmepumpe auswählen. Maßgeblich ist dabei nicht die Summe der nach DIN 4701 berechneten Wärmebedarfswerte der Räume eines Gebäudes, sondern die als wahrscheinlich zu erwartende Maximallast Qmax (s. [4]). Bei Wohngebäuden liegt diese Maximallast bei etwa 60% des Summen-Wärmebedarfs. Die Heizmitteltemperaturen sind bei alleinigem Wärmepumpenbetrieb nach oben durch den von der Wärmepumpe vorgegebenen Höchstwert begrenzt; je niedriger sie gewählt werden, um so höher ist die 5.1 Leistungszahl der Wärmepumpe. Allgemein gilt, daß eine im Vergleich zur Maximallast hoch gewählte Heizleistung der Wärmepumpe eine niedrige Auslegetemperatur für die Raumheizflächen zur Folge hat. Im Gegensatz zu einer monovalenten Wärmeerzeugung mit Wärmepumpe ist bei einer bivalenten ein größerer Gestaltungsfreiraum für eine energeti- sche und wirtscha ft liche Optimierung vorhanden. Ziel der Auslegung ist hier, mit einer möglichst kleinen Wärmepumpe (niedrige Investitionskosten) einen möglichst hohen Anteil am Gesamtenergieverbrauch der Anlage zu decken. Als Faustwert gilt, daß die Auslege-Heizleistung der Wärmepumpe unter 50% der Maximallast des Gebäudes liegen sollte (5.141). c m co -a ro ^^ cu a) i5 a) E ro : . Y Y CD ro Q) L Q) L 9_ 7U ro ro a) a) a 7U t— '7 .V t ö >N H E.roö C a aro -o , cp C7 3 -p E m^ CO 0)-a a) .a) n QO^p m Ö) - a) E To Q2 m a) CL roLro L V) o .29 ä)< W CO a) 41 Ü C a) in Y C a) ) Y - a a) U :ro '29 mü Luft gut gut +15 > -12 bivalent <50< 2,2 mäßig hoch teilweise notwendig Strahlung gut (Platzbedarf!) mäßig > 15 > -12 bivalent G 50 G 2,2 hoch hoch teilweise notwendig Erdspeicher mäßig gut +10 > -5 monooder bivalent < 50 G 50 G 2,7 mäßig mäßig nur Grundstücksfläche Erdreich s. selten (große Fläche) gut +10 > -5 monooder bivalent 50 G 50 G 2,7 hoch mäßig nur Grundstücksfläche Grundwasser s. selten sehr gut +12 >+8 monovalent 50 2,9 hoch gering nur Grundstücksfläche Obe rf lächenwasser s. selten gut +15 > 0 bivalent G 50 G 2,7 mäßig mäßig nur Grundstücksfläche Abwärme s. selten gut < 50 >3 mäßig gering teilweise notwendig > 15 > monovalent Wärmequellen AuslegeHeizleistung P0 E 5.z TECHN. AUSBAU Tabelle A: Beurteilungskriterien für Wärmequellen Literaturhinweise: [1] Verordnung über energiesparende Anforderungen an heizungstechnische Anlagen und Brauchwasseranlagen (Heizungsanlagen-Verordnung - HeizAnlV-) vom 22. 9.1978, Bundesgesetzblatt S.1581, Bonn 1978. [2] Verordnung über energiesparende Anforderungen an den Betrieb von heizungstechnischen Anlagen und Brauchwasseranlagen, Heizungsbetriebs-Verordnung. Bundesgesetzblatt Teil 1, 9.1978. [3] Verordnung über Feuerungsanlagen -1. BundesImmissionsschutzverordnung, 2.1979. [4] Bach, H. (Hrsg.) u.e.a.: Niedertemperaturheizung, Handbuch für Planer, Hersteller u. Betreiher. Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1981. 107 TECHNISCHER (NERGIRINSPARUNC AUSBAU Em Forsc 4 4,ngsvnrhat7era or Hundesarchitektenkamme^rt un Aattrage des Bundesmintster,ums Raurttordnunq ,nd F3a;twes?n Sonnenkollektoren Fernwärme DampfturbinenHeizkraftwerke Bloeizkraftwerke Wärmepumpenheizkraftwerke Übergabestation und Hauszentrale Temperaturregelung Sammelheizung — Direktnutzung der Solarenergie Aus klimatischen und aus wirtschaftlichen Gründen hat sich die Direktnutzung der Solarenergie (mit Sonnenkollektoren) in Deutschland nicht durchgesetzt. Sammelheizung — Fernwärme Als besonders vorteilhaft für eine rationelle Energieverwendung auf dem Gebiet der Hausheizung hat sich die Nutzung von Abwärme aus Kopplungsprozessen über Fernleitungen (Fernwärme) .......................... _.... erwiesen. Am weitesten verbreitet ist die Wärmeauskopplung aus Dampfturbinen-Heizkraftwerken. In steigendem Maße kommen aber auch kleinere Blockheizkraftwerke (BHKW mit Diesel- oder Gasmotoren) und Abwärme abgebende Industriebetriebe (z. B. Erdölraffinerien, Eisenhütten, Papierfabriken) als Fernwärmelieferanten in Frage. Außerdem werden neuerdings Wärmepumpenheizkraftwerke gebaut, als deren Wärmequelle das Rücklaufwasser eines Fernwärmenetzes dient. Auch gibt es bereits sehr weit gediehene Konzepte, bei denen Fortwärme aus wassergekühlten Kondensatoren von Dampfkraftwerken geordnet in fernwärmewürdige Verbrauchergebiete geleitet wird, um do rt Wärmepumpenheizwerke zu versorgen (kalte Fernwärme). Aus mehreren Gründen wird angestrebt, die Rücklauftemperatur im Fernwärmenetz möglichst tief abzusenken. Vor allen lassen sich bei großen Temperaturdifferenzen zwischen Vor- und Rücklauf (Spreizung) die Transpo rt -und Verteilungskosten mindern. Um einen möglichst sparsamen Heizbetrieb zu erreichen, wird die Wärmeabgabe an den Raumheizflächen durch Regelung ihrer mittleren ÜbertemVV.ra#dir dem Heiz=L astveriüüf( s. Kap. 5. v) angepaßt. Je größer in den verschiedenen Gebäuden das Verhältnis von Normwärmeleistung der installie rt en Heizflächen zum Wärmebedarf der jeweiligen Räume gewählt wird, desto niedriger kann die Übertemperatur liegen. Die Vorlauftemperatur im Netz muß mindestens so hoch sein, daß bei Mindestauslegung der Raumheizflächen im Einklang mit den jeweiligen Vorschriften der Wärmebedarf gerade gedeckt werden kann. Das heißt bei größer ausgelegten Heizflächen oder einem durch Innenlasten und vergleichbarem reduzie rt em Wärmebedarf muß die Übertemperatur an der Heizfläche abgesenkt werden; entweder so, daß die Rücklauftemperaturdurch Drosseln des Heizmittelstromes oder ,die Vorlauftemperatur durch Beimischen von Rücklaufwasser abgesenkt wird. Die Drosselregelung z. B. mit thermostatischen Feinregulierventilen hat den Vo rt eil, daß bei gegebenen Heizflächen die niedrigste Rücklauftemperatur, also die größtmögliche Spreizung, erreicht werden kann; zudem wird bei Fernwärmeanschluß in der Hauszentrale weder ein Mischer noch eine Umwälzpumpe benötigt. Die Drosselregelung 108 Prof. Dr.-Ing. Heinz Bach eignet sich demnach für den Anschluß von Altanlagen an die Fernheizung, wenn an den Raumheizflächen keine Änderungen vorgenommen werden sollen. Sie hat aber den Nachteil, daß der „Heizmittelwechsel" (Verhältnis von Heizmittelstrom zu Wasserinhalt des betreffenden Heizkörpers) und damit die Regelfähigkeit der Heizfläche sehr ungünstig wird. Durch schlechte Anpassung der Wärmeabgabe des Heizkörpers an den Heiz-Lastverlauf entstehen so zusätzliche Verluste oder auch erhebliche Einbußen an Behaglichkeit. Diese Nachteile lassen sich durch die zweite Möglichkeit, die Mischregelung, beheben. Sie erforde rt allerdings den Einbau von Mischer, Umwälzpumpe und, wenn die gleiche Rücklauftemperatur wie bei der Drosselregelung erreicht werden soll, eine Vergrößerung der Raumheizflächen. Die in der Fachliteratur und auch in vielen Vorschriften von Wärmelieferern anzutreffende Behauptung, daß die angestrebten niedrigen Rücklauftemperaturen nur mit einer Drosselregelung zu erreichen sind, ist unzutreffend und läuft auf eine vermeidbare Einschränkung des Heizkomforts hinaus. Der unmittelbare Anschluß von Heizflächen an die Fernwärmeleitungen ist nicht möglich, da der Druck und meist auch die Vorlauftemperatur im Netz immer höher sind, als für die Wärmeverteilung in einem Gebäude erforderlich wäre. Zwischen dem Netz und der Wärmeverteilung im Gebäude sind daher die Übergabestation und die Hauszentrale angeordnet. Bei Kostenbetrachtungen wären diese Zwischenstationen einem Wärmeerzeuger (z. B. Kessel) vergleichbar. Während die Übergabestation meist Eigentum des Fernwärmeversorgungsunternehmens ist oder wird, gehö rt die Hauszentrale (auch Hausstation oder Abnehmerstation) immer dem Eigentümer des Gebäudes. Zur Übergabestation zählen Einrichtungen für Druckbegrenzung, Absicherung gegen Überdruck, Differenzdruckregeiung, Heizmitteistrombegrenzung (Mengenbegrenzung) und Wärmemengenzählung. Die Hauszentrale umfaßt Einrichtungen zur Warmwasserbereitung, zur Regelung der Vorlauftemperatur im Hausnetz und zur Begrenzung der Rücklauftemperatur; bei indirektem Anschluß zusätzlich auch die Wärmeaustauscher. Hausstationen mit direktem Anschluß sind einfacher und billiger als die mit indirektem Wärmeaustauscher. Allerdings müssen dann die Heizflächen im Gebäude in aller Regel für die höheren Drücke, wie sie im Fernheiznetz herrschen (Ruhedruck), ausgelegt werden. Zudem können Einschränkungen bei der Auswahl der Heizflächenwerkstoffe wegen der Zusätze des aufbereiteten Fernheizwassers bestehen. Bei Hausstationen mit indirektem Anschluß wird das Heizwasser über Wärmeaustauscher erwärmt. Die Regelung kann sowohl im Primär- als auch im Sekundär-Kreislauf erfolgen. Die Gestaltung der Übergabestation und der Hauszentrale ist häufig dem Hausbesitzer nicht überlas- Nach der Wärmeschutzverordnung muß heute der Wärmedurchgangswiderstand von Heizkörpernischen so groß sein wie der der übrigen Außenwende. Der zusätzliche Transmissionswärmeverlust beträgt dann nur noch 1%. Die meisten Heizkörper geben jedoch die Wärme zu etwa 75% konvektiv ab; bei ihnen reduzieren sich die Verlustsätze deutlich. Die Wärmeschutzverordnung schreibt im übrigen weiterhin vor: „Werden Heizkörper vor außenliegenden Fensterflächen angeordnet, sind zur Verringerung der Wärmeverluste geeignete Abdekkungen an der Heizkörperrückseite vorzusehen" [1]. Die Abstrahlung könnte z. B. durch einen Strahlungsschirm aus Glas zwischen Fensterfläche und Heizkörper in wirksamer und wenig störender Weise verhindert werden. Raumheizflächen, thermische Behaglichkeit Wesentlich höhere anordnungsbedingte WärmeAls Raumheizkörper werden die Raumheizflächen bezeichnet, die frei im Raum, dessen Wärmebedarf verluste treten auf, wenn Heizkörper - wie heute in Bürogebäuden häufig Glblich - nicht in einer Heiz.. zu decken ist, angeordnet sind. Sie sind zu unterkörpernische, sondern direkt vor der Außenwand scheiden von jenen Raumheizflächen, die in eine der Umfassungsflächen des zu beheizenden Rau- angeordnet sind. mes integrie rt sind, meist z. B. in den Fußboden. In diesen Fällen gibt es üblicherweise auch keine Fensterbänke. Hier legt sich der aufsteigende Zunächst werden Raumheizkörper nach ihren Warmluftstrom über dem Heizkörper sofo rt an die Eigenschaften für die Wärmeübertragung beu rt eilt. kalte Fensterfläche an und erwärmt sie. Dadurch Es ist daher naheliegend, hieraus die wesentlichen erhöht sich die innere Oberflächentemperatur der Unterscheidungsmerkmale für die Einteilung der Scheibe, und somit vergrößern sich die TransmisRaumheizkörper abzuleiten. Der Wärmeübergang slonawärmeve rluste n ach außen. Dies läßt sich auf der Luftseite durch Konvektion und Strahlung durch Anbringen von Fensterbänken nahezu vollist maßgebend (der Wärmeübergang auf der Was- ständig vermeiden. serseite ist so hoch, daß Unterschiede nicht ins Die Wärmeabgabe von Raumheizkörpern wird in Gewicht fallen), Während die durch Strahlung einem genormten Versuch nach DIN 4704 ermitübertragene Wärmeleistung einheitlich für alle telt. Die Anwendung der hierbei festgestellten WerBauformen von der Größe (und der Temperatur) der Hüllfläche abhängt - der Strahlungsanteil sich te für eine Auslegung wird ausführlich beschrieben im Handbuch „Niedertemperaturheizung" [1]. also nicht zu einer Unterscheidung eignet -, hat die Bauform auf die Konvektion einen starken Bei Fußboden-, Wand- und DeckenstrahlungsEinfluß. heizungen sind die Heizflächen in ein Bauteil Bei der Auswahl der Raumheizkörper aus der vom Boden, Wand oder Decke - integriert' „Integrierte Markt angebotenen Typenvielfalt sind folgende Heizflächen". Die übliche Bezeichnung „FlächenKriterien zu beachten: heizung" erscheint als nicht geeignet, da heute Raumheizkörper vor allem für NTH ebenfalls Aussehen, flächig gestaltet sein können (sie sind hingegen keine scharfen Kanten (Verletzungsgefahr für frei vor Wänden aufgestellt: „Freie Heizflächen"). Kinder), Reinigungsmöglichkeiten, Die verschiedenen WarmwasserfußbodenheizunKorrosionsbeständig keit, gen sind ausführlich in [3] und auch im Handbuch große Wärmeleistung (bezogen auf die Ansichts„Niedertemperaturheizung" [1] dargestellt. fläche oder das Bauvolumen), geringes Gewicht und kleiner Wasserinhalt, Die wärmeübertragende Fläche bei Fußbodenheileichte Montagemöglichkeit, zungen ist allein die einheitiich ebene Fußbodenhohe Druckfestigkeit (für Sonderanlagen), fläche. Daher sind für die Wärmeabgabe der Fußgeringe Investitionskosten. bodenheizung in dem darüberliegenden Raum nur die Oberflächentemperatur des Bodens und die Zum Ausgleich des Strahlungsüberschusses vor dem Fenster und der Außenwand und zum Abfan- der übrigen Umfassungsflächen maßgeblich: gen des Kaltluftabfalls sollten Raumheizkörper in Bei gegebener mittlerer Oberflächentemperatur diesem Bereich angeordnet werden. Ihre Länge des Fußbodens hat ein spezieller Fußbodenaufbau sollte mindestens der Breite des Fensters, keinen Einfluß auf die Wärmeleistung, wohl aber möglichst aber der der Außenwand entsprechen. darauf, mit welcher Heizmitteltemperatur die zur gewünschten Wärmeabgabe notwendige mi tt lere Auch bei erhöhter Wärmedämmung ist es günstiOberflächentemperatur erreicht werden kann. ger, den Heizkörper vor den Außenflächen als an den Innenwänden aufzustellen. Im letztgenannten Die vom Fußboden abgegebene flächenbezogene Fall erhielte man zwar ein kleineres Rohrnetz, Warmestromdichte q setzt sich aus einem Strahmüßte jedoch - abgesehen von der geringen Einlu. r -und I<rrvektionsanteil zusammen. Aus umbuße an Behaglichkeit - einen geringeren Nutzfangreichen, vom BMFT geförde rt en Untersuchunwert des Raumes in Kauf nehmen: Verlust an Steilgen wurde unter anderem folgendes gefunden: flächen im Raum usw. sen. Wer z. B. die Vorlauftemperatur in seinem Haos unabhängig vom Netz regeln möchte, weil er RaWrnheizflächen einbauen oder weiterbetreiben möchte, die mit niedrigen Vorlauftemperaturen au5kommen oder sie benötigen (Fußbodenheizung), kann wegen der örtlich stark unterschiedlichen Vorschriften der Wärmelieferer gezwungen sein, vom preisgünstigen direkten auf den teureren indirekten Anschluß auszuweichen. So sind häufig die Beimischung von Rücklaufwasser in der Hauszentrale oder auch Druckminderer nicht gestattet (letzteres e rforde rt genügend druckfeste Heizkörper). Als weiteres Argument für die Innenaufstellung wird die Energieeinsparung herangezogen. So betrug in älteren Gebäuden mit schlecht gedämmten Heizkörpernischen der zusätzliche Transmissionswärmeverlust bei Heizkörpern mit hohem Strahlungsanteil (40%) etwa 5% der Heizkörperleistung. In einem Raum mit einer Außenwand (k, =1,32 W/1 m`K) und einem Luftwechsel vo 0,5 h ' < ß < 1,5 h ' (aufgrund Fugendurchlässigkeiten an Fenster und Türen) ist die in Abb. 1 dargestellte Wärmestromdichte zu beobachten. Hat der Raum mehrere Außenwände, so erhöht sich 5.z TECHN. AUSBAU Wärmequellen Raumheizkörper Wärmeverluste Auswahlkriterien Fußboden -, Wand-, Deckenstrahlungsheizungen Oberflächentemperatur Wärmestromdichte 100 W/m2 80 60 40 20 Konvektion 8 (t F — t L)/K 12 Wärmeabgabe der Fußbodenheizung durch Strahlung und Konvektion in einem Raum mit einer Außenwand (Voraussetzung t L tW) aufgrund größerer Wärmeabstrahlung vom Fußboden zu den Raumbegrenzungsflächen die Wärmeabgabe. Die Auslegung einer Fußbodenheizung Ist in Einklang mit_ den zur Zeit beratenen Normen DIN 4725 und DIN 4726 im Handbuch „Niedertemperaturheizung" angegeben. Aus der wärmetechnischen Prüfung von Fußbodenheizsystemen ist der Zusammenhang zwischen erreichbarer Wärmestromdichte und Heizmittelübertemperatur bekannt. Die Prüfung wird ohne Bodenbelag durchgeführt; zur Überwindung des zusätzlichen Wärmeleitwiderstands des Bodenbelags muß die Heizmitteltemperatur erhöht werden. Es muß deshalb bei der Auslegung bereits daran gedacht werden, welcher Fußbodenoberbelag zu berücksichtigen ist. Weiterhin ist zu beachten, daß von der Fußbodenheizung nicht nur Wärme an den zu beheizenden Raum, sondern auch zusätzlich Wärme O durch die Decke in den Unterraum, O über Wärmebrücken an die Außenwand des Gebäudes und O durch Zusatzstrahlung zur Außenwand übertragen wird. Reicht die Wärmeleistung der Fußbodenheizung alleine nicht aus, den Norm-Wärmebedarf des Raumes zu decken, so sind Zusatzheizflächen zur Fußbodenheizung einzuplanen. Neben stärker temperierten Randzonen bieten sich in erster Linie Estrich-Konvektoren an. Konvektoren haben den Vorteil, daß sie sehr gut regelbar sind. Bei Luftheizungen wird die Wärme an das Heizmittel Luft übertragen und dann den zu versorgenden Räumen zugeführt. Diese Art der Wärmeverteilung eignet sich auch für Niedertemperatursysteme, da zur thermischen Behaglichkeit Zulufttemperaturen von höchstens 40 °C e rforderlich sind. Gegenüber „konventionellen" Luftheizungen müssen lediglich die Wärmeaustauscherflächen des Lufterhitzers größer bemessen werden; Ventilator und Kanalnetz bleiben gleich. Moderne Luftheizungen sind meist nur als Ventilator-Warmluftheizungen mit indirekter Lufterwärmung (Wasser, Luft) ausgeführt. Warmluftheizungen lassen sich in vielen Fällen einsetzen, ihre Vorteile sind: 0 Einfache Umstellung bei bestehenden Luftheizungen auf einen Niedertemperatur-Wärmeerzeuger, da nur der Lufterhitzer durch einen größeren ersetzt werden muß, das Kanalnetz bleibt gleich. 0 Rasche Lufttemperaturänderungen durch die geringe Speicherfähigkeit des Wärmeträgermediums (z. B. für den unterbrochenen Heizbetrieb). 0 Beheizbarkeit besonders gestalteter Räume, bei denen sich Heizflächen nicht anordnen lassen (wie Fabrikationshallen u. ä.). 0 Einfache Beheizbarkeit von Räumen, die ohnehin mechanisch belüftet werden müssen (hierbei Wärmerückgewinnung möglich). 0 Schnellregelbare Zusatzheizung zu Raumheizflächen. Gegenüber der Warmwasserheizung bestehen bei der Luftheizung folgende Nachteile: 0 Die Wandtemperaturen reagieren auf Leistungsänderungen (z. B. beim Hochheizen) träge, da keine strahlenden Heizflächen vorhanden sind. Als anordnungsbedingte Verluste sind in jedem Es erfolgt kein Strahlungsausgleich zu kalten Fall die Zusatzstrahlung an die Außenwand und Außenflächen. Vom Nutzer werden deshalb oft Zusatzwärmestrom über eine Wärmehri;cke anzuhöhere Raumlufttemperaturen verlangt. sehen. Der Zusatzwärmestrom in einem Unterraum 0 Durch den Wärmeübergang vom Primärwärmegilt nur dann als Verlust, wenn es sich dabei um träger (Wasser) auf den Sekundärwärmeträger einen unbeheizten Nebenraum, z. B. Keller, han(Luft) werden vom Wärmeerzeuger höhere Temdelt. Ist der Unterraum ebenfalls über den Fußboperaturen verlangt, als dies die Wärmeverteiden beheizt, so kommt die Wärme der darüberlielung e rf ordert. genden Fußbodenheizung dem Unterraum zugute. 0 Beim Wärmetransport mit Lu ft sind gegenüber Hierbei sei erwähnt, daß der Wärmestrom der dem mit Wasser höhere Förderleistungen notoberen Fußbodenheizung durch die Decke in den wendig. Die Unterschiede soll das Beispiel aus unteren beheizten Raum aufgrund der GegenTabelle A verdeutlichen. strahlung der Fußbodenheizung darunter vernach0 Der Raumbeda rf für Luftverteilungssysteme ist lässigbar gering ist [3]. erheblich. In manchen Gebäuden kann das Kanalnetz nicht untergebracht werden. Zur Begrenzung des Wärmestroms nach unten, z. B. an unbeheizte Räume oder ins Erdreich, müs- O Durch die Luftkanäle können sich Brände im sen bei Fußbodenheizung unter der Heizebene Gebäude ausbreiten. Um dies zu verhindern, Wärmedämmschichten eingebaut werden. In den müssen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen meisten Fällen wird eine Polystyrolschicht mit (z. B. Brandschutzklappen) eingebaut werden. einem Wärmeleitkoeffizienten von A = 0,04 W/(mK) 0 Kanalnetz, Ventilator und Sicherheitsmaßnaheingesetzt. Die Dicke der Wärmedämmschicht men bewirken für Warmluftheizungen hohe Inbzw. der Wärmeleitwiderstand ist nach der Wärmevestitionen. Vor der Wahl des Wärmeverteischutzverordnung zu wählen. Die Wärmedämmung lungssystems sollte die Wirtschaftlichkeit beist, soweit möglich, unmittelbar unter der Heiztrachtet werden. ebene, darüber hinaus unterhalb der Decke an0 Luftkanäle übertragen Geräusche des Venzuordnen (weitere Einzelheiten s. [3] und [2]). tilators bzw. die aus den einzelnen Räumen. 110 20 kW Heiz 1 eistung 0 Wärmeverteilung Ober Temperaturen bei Auslegungsbedingung en Heizrnittelstrom Gesarntdruckerhöhung der Pumpe oder des Ventilators theore tische Antriebsleistung Wirkungsgrad (gesamt) Antriebsleistung des Motors Wasser Luft (Umluft) tv=65°C 13=50°C tZU=40°C tqg=tqq=20°C 0,318 kg/s 0,00032 m 3/s 0,990 kg/s 0,861 m3/s 15 kPa 0,2 kPa 5W 172 W 1:Pumpe 0,3 17 W mungsbild nur die Hauptluftbewegung dar; seitlich neben dem Heizkörper kann abgekühlte Luft in entgegengesetzer Richtung in den Bodenbereich einfließen. 5.z TECHN. AUSBAU Wärmequellen .. n,Ventilator = 0,8 216 W Tabelle A: Vergleich der Förderleistungen bei Wärmeverteilungssystemen mit Wasser und Luft O In der Nähe von Luftdurchlässen beobachtet man bei Luftheizungen eine starke Verschmutzung der Wände; diese läßt sich auch durch Filterung der Zuluft nur unvollständig vermeiden. O Die Heizkostenabrechnung ist bei Luftheizungen - vor allem in Gebäuden mit unterschiedlichen Wärmeverteilungssystemen (Warmwasserheizung, Luftheizung) - schwierig und aufwendig. ^ — Raumluftströmung bei Beheizung mit Raumheizkürperrc Wird die Heizfläche dagegen in eine der inneren Umfassungsflächen integriert, z. B. als Bodenheizung, dann entsteht eine entgegengesetzte Umwälzströmung, wie sie Abb. 3 zeigt. Die jeweils kälteste vertikale Umfassungsfläche ist, wie umThermische Behaglichkeit Die Aufgabe einer Heizung besteht ganz allgemein fangreiche Versuche von Schfapmann beweisen, unabhängig von der Temperaturverteilung auf dem' darin, einen Raum in kalten Jahreszeiten so zu Boden und den übrigen Flächen, bestimmend für erwärmen, daß sich die darin aufhaltenden MenRichtung und Intensität einer die ganze Raumluft schen behaglich fühlen. bewegenden turbulenten Umwälzströmung: Die Notwendige Voraussetzung für die Behaglichkeit kalte Luft an dieser Außenwand fällt nach unten, ist zunächst die Ausgeglichenheit des Wärmeüberschwemmt den Boden mit Geschwindigkeiten haushalts der Aufenthaltspersonen. Diese Bedinüber 0,5 m/s bis tief in den Raum und treibt die gung ist jedoch nicht hinreichend: Zusätzlich ist erwärmte Luft an den Wänden hoch und an der auch noch zu beachten, daß die Ausgeglichenheit Decke waagerecht zurück zur Außenwand. Höher der örtlichen Wärmeabgabe auf der Oberfläche temperierte Boden-Randstreifen vor der Außeneiner Aufenthaltsperson sich in der Richtung nicht wand und auch sogenannte Estrich-Konvektoren zu stark unterscheidet. Hierfür ist der örtliche Wärmeübergang durch Strahlung, Konvektion und auch Diffusion durch die Haut maßgeblich. Betrachtet man lediglich die hier behandelten Raumheizflächen und nicht raumlufttechnische Anlagen mit Einflußmöglichkeiten auf die Luftzusammensetzung, insbesondere den Feuchtegehalt, so genügt die Betrachtung der Temperaturen der Lu ft, der Umfassungsflächen des Raumes und der Heizflächen. Ein zu beheizender Raum besitzt immer mindestens eine Umfassungsfläche, deren Temperatur deutlich unterhalb aller anderen Flächen liegt (Außenwand mit Fenster). Die Temperatur der übrigen Flächen und der Luft sind abhängig von der Art der Heizwärmezufuhr: O Bei überwiegend konvektiver Heizwärmezufuhr Raumluftströmung bei Fußbodenheizung sind diese Flächen wegen der Abstrahlung an die Außenwand kälter als die Lu ft. O Bei überwiegender Heizwärmezufuhr durch Strahlung sind die Flächen wärmer als die Luft. (ohne Gebläse) vermögen diese kräftige Umwälzströmung nicht umzukehren. Auch eine AufwärtsDie Richtung der Luftbewegung im Raum ist abströmung vom erwärmten Boden (Benard-Konvek hängig von der Anordnung der Raumheizflächen. Wird ein Heizkörper frei vor der Außenwand aufge- tion) kann sich nicht ausbilden. Ferner bewirkt die der Außenwand über die ganze Raumhöhe zuströstellt (Anteil der konvektiv abgegebenen Wärme mende Luft eine langsame Bewegung von innen mindestens 60%), dann ist der im Bereich des Heizkörpers entstehende Auftrieb stark genug, die nach außen und somit auch einen geringfügigen an der kalten Außenwandfläche abfallende Luft am Temperaturabfall (s. Abb. 4). Bei der Luftheizung sind die Luftstrahlen aus den Eindringen in den Raum zu hindern und eine UmZuluftdurchlässen bestimmend für Richtung und wälzströmung zu erzeugen, wie sie in Abb. 2 prinIntensität der Strömung im Raum. In aller Regel zipiell dargestellt ist. Da Heizkörper in aller Regel sind die Raumluftgeschwindiakeiten höher als bei nicht die gleiche Länge wie die Außenwand besitder Radiatoren- oder Fußbodenheizung. zen, stellt das gezeigte zweidimensionale Strö111 usgeglichenheit Värmehaushaits Richtung der Luftbewegung Raumluft,_ geschwindigkeit • Die Temperaturprofile, die als Folge der unterschiedlichen Strömungen bei den einzelnen Beheizungsarten auftreten, sind in Abb. 4 in ihrer prinzipiellen Form einander gegenübergestellt. Die Oberflächentemperaturen sind bei den Heizflächen so eingestellt, wie es die Wärmezufuhr erfordert, und bei den übrigen Flächen das Ergebnis aus der Wechselwirkung von Zu- und Abstrahlung sowie konvektivem Wärmeübergang (ihre Berechnung ist ausführlich in [3] angegeben). Im folgenden soll geklä rt werden, in welchem Umfang die verschiedenen Heizsysteme dazu beitragen, die baulich bedingten Störungen im thermischen Umfeld des Menschen mit dem Ziel der Behaglichkeit auszugleichen. Wirkungsvergleich Fußbodenheizung/ Radiatorenhe=jung Der Wärmeabgabevergleich wird beispielha ft berechnet (ausführliche Formeln s. [1]) für einen Raum, der 4 m breit, 5 m tief und 2,5 m hoch ist. Verglichen werden die Wirlshng_der Fußbodenheizungmit der einer Radiatorenheizun_g, Eine Luftheizung ist in diesem Zusammenhang nicht vergleichbar, da mit ihr die Abstrahlung der Außenwand in keiner Stelle des Raumes zu kompensieren ist. ▪ Für den Raum mit Fußbodenheizung ist eine mittlere Außenwandtemperatur (Fenster und Wände) von 13 °C, eine Innenwandtemperatur (Decke und Seitenwände) von 21 °C und eine Lufttemperatur von 19 °C angenommen; der Boden soll 27 °C warm sein. Bei Radiatorenheizung ist eine einfache Heizpla tt e von 0,4 m Höhe und 4 m Breite vorausgesetzt; die mittlere Oberflächentemperatur soll 55 °C betragen. Die mittlere Temperatur der restlichen Außenwandfläche (ebenfalls Fenster und Wand) sei hier nur 12 °C, die Temperatur der Innenwände 19,5 °C und die Temperatur der Lu ft 20,5 °C. Im wesentlichen stellt sich der Wärmeabgabevergleich als Zustrahlungs- und Abstrahlungsüberschuß dar. Abb. 5 zeigt für den Mittelschnitt des Raumes die Feldverteilung. Die Betrachtung ließe sich in der gleichen Weise für ein in das Innere des Raumes gerichtetes Körperflächenelement anstellen (s. [1]). Die angegebenen Wärmestromdichten können veranschaulicht werden, wenn man berücksichtigt, daß z. B. ein Abstrahlungsüberschuß von etwa 8 W/m 2 einer um 1 K gegenüber dem definie rt en Behaglichkeitszustand kälter empfundenen Temperatur entspricht (s. [1]). Heizkörper E AW 1,5 c ta)0 t _....L..`..._.. _^_^,_._ 2 19 20 21 i f 1 i n i^_ti 19 20 21 19 20 21 ' 3 4 5 0,75 ^ ro ¢ 0 Raumtiefe in m —^ 19 20 21 Fußbodenheizung 72'5 1,5 Fußbodenheizung Raumtiefe Radiatorenheizung Lufttemperatur-Verläufe im Raum bei unterschiedlichen Beheizungsarten Quellen: [1] Bach, H. (Hrsg.), u.e.a.: Niedertemperaturheizung, Handbuch für Planer, Hersteller u. Betreiber. Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1981. [2] Verordnung über einen energiesparenden Wärmeschutz bei Gebäuden (Wärmeschutzverordnung) vom 11. August 1977 (BGB 1 S. 1554). Hierzu insbesondere: Baumann, H., E. Kapmeyer und B. Muser: Die neuen Anforderungen des Energie-Einspargesetzes bei Planung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden. WEKA-Verlag, Kissingen 1981. [3] Bach, H. und S. Hesslinger: Warmwasserfußbodenheizung. 3. Auflage, Verlag C. F. Müller, Karlsruhe 1981. 112 3 Raumtiefe in m < -25 W/m2- 5 / + 5 W/m2 L71,73 -25 / -15 W/m2 r __•+ 5 / +10 W/m2 i1 ^-15 / -10 W/m2 L.:^_^ + 10 y +20 W/m2 5 W/m2> L ^' -10 +20 W/m2 /- Zu- und Abstrahlungsüberschuß bei freien bzw. integrie rten Raumheizflächen PRAXISINfORMAIION TECHNISCHER EM[RGIE[INSPAH1JNG Al SBAU b w'^.n, Ein Forschungsvorhaben der Bundesarchitektenkarnmer durchgeführt im Auftrage des Bundesminrsteriums für Städtebau. Raumordnuno und Bauwesen Anforderungen an die Regelung Die primäre Aufgabe der Heizungsregelung besteht darin, die Raumtemperatur auf einem vom Nutzer gewünschten Niveau möglichst konstant zu haften. Eine bestimmte Maximaltemperatur sollte dabei auf keinen Fall durch Heizung überschritten werden. Die Regelung muß also die Wärmeabgabe der für einen Extremfall (Normwärmebedarf des Raumes) bemessenen Heizflächen der meist wesentlich niedrigeren und ständig wechselnden sog. Heizlast des Raumes anpassen. Dabei sollte der Cesamtenergieeinsatz so niedrig wie möglich gehalten werden. Voraussetzung dafür ist sowohl eine unter den Gesichtspunkten der rationellen Energieverwendung und der Regelbarkeit konzipierte und dimensionierte Heizanlage als auch eine Regelung, die möglichst individuell auf diese Heizanlage abgestimmt ist und die außerdem bestimmten Anforderungen hinsichtlich der Regelgüte und der Wi rt -schaftlikegnü. Um die Wärmeabgabe der Heizflächen genau der jeweils erforderlichen Heizlast anpassen zu können, müssen alle Parameter erfaßt werden, die die Heizlast beeinflussen. Abb. 1 zeigt einen zu beheizenden Raum, in dem die Temperatur t, möglichst konstant gehalten werden soll. Der Raum gibt Wärme QWR nach außen bzw. an kühlere Räume ab.. Die Wärmezufuhr erfolgt über einen Heizkörper OH und evtl. zeitweise durch andere Wärmequellen wie z.B. elektrische Geräte, Personen oder Sonneneinstrahlung Q;. Bei Änderung der Raumtemperatur wird außerdem in die Umgebungswände und in die Einrichtungsgegenstände des Raumes Wärme Qsp ein- bzw. ausgespeichert. ti = tonst. wenn Qli-.QH=QWR Regelung der Raumtemperatur Aufgabe der Regelung ist es nun, die Wärmeabgabe des Heizkörpers so einzustellen, daß die Summe der Wärmezufuhr durch Heizkörper und andere Wärmequellen gleich ist der Wärmeabgabe des Raumes nach außen. Die Wärmeabgabe des Heizkörpers entspricht dann der Heizlast des Raumes. Die Heizlast wird wesentlich beeinflußt durch: O Klima bzw. Witterung O Nutzerverhalten O Baukörper mit Bauausführung. Bei Klima und Witterung sind am wichtigsten: O Lufttemperatur O Sonnenstrahlung O Windgeschwindigkeit und -richtung. Verfasser Prot. Dr.-Ing. Hein z B Das Nutzerverhalten äußert sich im: O vorgegebenen lnnentemperaturverlauf O Luftwechsel O Aufenthaltszeiten der Personen O Aktivitätsgrad der Personen O Einschaltzeiten wärmeabgebender Geräte. Während Klima oder Witterung und Nutzerverhalten für die zeitlich veränderlichen und sogar unstetig auftretenden Energiestrome in den Raum direkt ursächlich sind, wirkt sich der Baukörper durch sein Speichervermögen dämpfend und verzögernd auf diese Energieströme und damit auf die Heizlast aus. Folgende Eigenschaften des Baukörpers beeinflussen die Dämpfung und Zeitverzögerunc: O Absorptions-, Emissionsgrad O Wärmeleitwiderstand O Temperaturleitfähigkeit O Orientierung O Fläche und Dicke der Außenwände, Dächer und inneren Raumumschließungsflächen sowie O Wärmeleitwiderstand O Durchlaßfaktor O Fugendurchlaßkoeffizient O Orientierung O Fläche der Fenster. Der Wärmebedarf eines Raumes nach DIN 4701 ist eine genormte fiktive Heizlast für quasistationäre Bedingungen ohne Berücksichtigung innerer und äußerer Wärmequellen und des Nutzerverhaltens.. Er kann als extremer Sonderfall der Heizlast angesehen werden. Die Abb. 2 und 3 zeigen beispielhaft die berechneten Verläufe der auf den Wärmebedarf des Raumes bezogenen Heizlast und der Innentemperatur für verschiedene Tagestypen und verschiedene Räume. Die Nutzungszeit beginnt morgens um 6.00 Uhr und endet um 22.00 Uhr. Die Sollinnentemperatur beträgt in dieser Zeit 20 °C, in der übrigen Zeit dürfen 16 °C nicht unterschritten werden. Alle betrachteten Räume sind nach Süden orientie rt und unterscheiden sich durch Wärmedämmung und Speicherfähigkeit. Raum 1: Hohe Wärmedämmung, hohe Speicherfähigkeit. Raum 2: Hohe Wärmedämmung, niedrige Speicherfähigkeit. Raum 3: Niedrige Wärmedämmung, hohe Speicherfähigkeit. Kurve a in Abb. 2 zeigt für den Raum 1 die Verläufe von bezogener Heizlast und Innentemperatur an einem klaren Januartag (Außenlufttemperatur und Sonnenstrahlung sind in das Bild mit eingetragen). Während der Zeit der Nachtabsenkung (die Heizlast hat den Wert 0) sinkt die Innentemperatur aufgrund der stark speichernden Umschließungsflächen um weniger als 2 K ab. Die bezogene Heizlast nimmt ihren Maximalwert an, bis um 915 Uhr 113 Naze -halten Einflußgrößen auf Dämpfung und Zeitverzögerung Wärmebedarf nach DIN 4701 Beeinflussung der Heizlasten .3 TECH AUSBAU einstrahlung als Führungsgröße für eine Regelung der Vorlauftemperatur gewählt werden. Man unterscheidet daher im wesentlichen nach A rt der Regelgröße zwischen: O Raumtemperatur-Regelung O Vorlauftemperatur-Regelung. In beiden Fällen wird, um den Einfluß von Störgrößen auf die Raumtemperatur auszugleichen, die Wärmeabgabe der Heizflächen verände rt . Als Stellgrößen hierzu können O Massenstrom O Vorlauftemperatur O Drehzahl (bei Gebläsekonvektoren oder Ventilatoren in Luftheizungen) verwendet werden. die Sollinnentemperatur erreicht ist. Bereits um 1t00 Uhr tri tt keine Heizlast mehr auf, da Außenlufttemperatur und Sonnenstrahlung so stark angestiegen sind, daß die Innentemperatur über ihren Sollwert hinausgeht. Erst kurz vor 19.00 Uhr ist der Raum soweit ausgekühlt, daß wieder Heizlast auftritt. Steuerung und Regelung 2 _ R:aum — • ". Raum 2 Rnuii 3 1220 — 6•o — 600 00 200 8 1 7 4 80 1 des 6e-or. G 16 +8 Tageszeit in Stunden Berechnete Verläufe der auf den Wärmebedarf bezogenen Heizlast unterschiedlicher Räume an einem heiteren Januartag 2 0 a)freie Heizfläche 0,5 b)integrierte Heizfläche 0 1 0 0 5 2,0 m/mqusl. Abhängigkeit der Wärmeabgabe vom Heizmittelstrom Heizkörperventil Die einfachste und billigste A rt der Regelung geschieht durch ein Heizkörperventil, das entweder von einer im Raum befindlichen Person bei Beda rf geöffnet oder geschlossen bzw. thermostatisch betätigt wird. Diese sog. Drosselregelung bei konstant hoher Vorlauftemperatur hat vor allem Tageszeit in Stunden --während der Übergangszeit, wenn nur sehr wenig Verlauf der den WBnnebedaf Bezogenen Herbst eines Südraumes mil hoher Wärmedämmung und hoher SgeicheAägiekeit an einem NW Januadag 3 Wärme angeforde rt wird, den Nachteil, daß dann sehr kleine Massenströme einzustellen sind. Den typischen Verlauf für den gleichen Südraum Abb. 4 ist zu entnehmen, daß z. B. Wärmeleistunan trüben Januartagen zeigt Abb. 3. Obwöhl die gen von weniger als 40% des Auslegewertes bei Außenlufttemperatur während der Nacht knapp konstanter Vorlauftemperatur nur mit einem auf unter 0 liegt und damit insbesondere in den frühen unter 10% des Normmassenstroms gedrosselten Morgenstunden deutlich höher als an heiteren We rt zu erreichen sind. Diese Massenströme lasTagen ist, sinkt die Innentemperatur aufgrund der sen sich mit Handventilen meist nicht mehr einrehohen Speicherfähigkeit des Raumes in dieser gulieren. Auch die Regelgüte und die Wirkung von Zeit fast genau so weit ab wie an klaren Tagen, Thermostatventilen wird beeinträchtigt, wenn sie d. h. bei Räumen mit hoher Speicherfähigkeit hängt ständig in der Nähe des Schließpunktes arbeiten. die Absenkung der Innentemperatur kaum von der Die Drosselregelung bei konstant hoher VorlaufAußentemperatur ab. Tagsüber tritt wegen der temperatur erfüllt nicht die oben genannten Anforfehlenden Sonnenstrahlung immer Heizlast auf. derungen bezüglich Konstanthaltung bzw. MaxiMnid rvnininlieRaumtemperaur Bei diesen Berechnungen sind keine inneren Wär- malhegren7tu ..^H er ...Raumtemperatur ..F,.,,caw^ und _ mequeiien berücksichtigt. Die Heizlast der Räume rung des Energieeinsatzes. Sie ist daher zur Regewird also noch um den Betrag der jeweils auftrelung einer modernen Heizanlage nicht geeignet. tenden Wärmequellen reduzie rt . Eine wesentliche Verbesserung gegenüber der Eine ideale Regelungsanlage muß in der Lage sein, Drosselregelung wird erreicht, wenn die Vorlaufdie Wärmeabgabe der Heizkörper entsprechend temperatur des Heizmittels jeweils so eingestellt den hier gezeigten Lastverläufen einschließlich zu- wird, daß auch bei niedriger Heizlast die Heizfläche sätzlicher Wärmequellen einstellen zu können. mit dem Auslegemassenstrom betrieben werden kann. Regelung der Wärmeabgabe von Heizflächen Die Anpassung der Heizflächenwärmeabgabe Ein einfacher Regelkreis besteht aus Regler, e rf olgt also nicht durch Drosseln des MassenStellglied und Regelstrecke. Die Regelgröße wird stromes, sondern durch Verändern der Heizmittelmit Hilfe eines Meßfühlers e rfaßt und im Regler mit temperatur (Abb. 5). einem eingestellten Sollwert verglichen. Tritt eine Störgröße auf, so weichen Soll- und Istwert von1,5 einander ab. Über das Stellglied wird entspreQ chend dem Regelalgorithmus die Stellgröße verän1,0 dert, um den Einfluß der Störgröße auszugleichen. a)freie Heizfläche Bei der Regelung von Heizanlagen gibt es ver0,5 schiedene Möglichkeiten, die Regel-, Stell- und b)integrierte Heizfläche Führungsgrößen zu wählen. Hauptregelgröße ist 0 die Raumtemperatur. Da die Heizlast eines Rau30 0 20 tv-t[/K 50 10 mes wesentlich von der Witterung abhängt, kann Abhängigkeit der Wärmeabgabe yen der Heizmitteltemperatur 5 also z. B. die Außentemperatur oder die Sonnen16 18 20 22 2 awl • Drosselregelung emperaturregelung 4 QAusl 111PE EMI 114 Ein Regler e rfaßt über einen Temperaturfühler Abv eiGhungen der Raumtemperatur von einem eingestellten Sollwert und steue rt ein Stellglied an, mit dem die Vorlauftemperatur verändert wird. Als Stellglied dient, abhängig vom eingesetzten Wärmeerzeugersystem, entweder ein motorgesteuertes Mischventil (bei konventionellen ölbefeuerten Heizkesseln) oder ein Thermostat, der einen Brenner (bei sog. NT-Kesseln) oder den Verdichter einerWärmepumpe ein- und ausschaltet. Damit kann jedoch nur die Temperatur eines einzigen Raumes geregelt werden. Dies hat den Vorteil, daß die Vorlauftemperatur für diesen Raum immer auf ihrem niedrigst möglichen Wert ist und sämtliche in diesem Raum auftretenden zusätzlichen Wärmequellen ausgenutzt werden. Die Wärmeabgabe der Heizflächen in den anderen Räumen stellt sich jedoch entsprechend der jeweiligen Heizlast in diesem temperaturgeregelten Raum, dem sog. Testraum, ein. Ist z. B. die Heizlast dieses Testraumes aufgrund der Sonneneinstrahlung oder erhöhten inneren Lasten niedri g , so kann dies in einem Raum auf der Nordseite (ohne innere Last) zu einer Temperaturabsenkung unter den gewünschten Sollwert führen. Die Regelung nach der Testraummethode eignet sich daher nur für Einfamilienhäuser oder Etagenheizungen mit offener Bauweise. In den anderen Räumen ist bei Beda rf eine zusätzliche Einzelraumregelung vorzusehen. 1 Wittergngsgetührth VorlauftemperaturRegelung mit 4-Wege-Mischer _j. bzw. mit NI-Kessel 6 Bei größeren Gebäuden mit mehreren unterschiedlich genutzten Räumen bzw. bei Mehrfamilienhäusern wird die Vorlauftem peratur zentral außentemperaturabhängig nach einer am Regler einzustellenden Heizkurve geregelt (Abb. 6). In Abb. 7 sind solche Heizkurven für verschiedene Auslegetemperaturen eines Heizkörpers darae stellt. 90 ® ' tu/°C 70® 60^® 50 Heizkurven zur Regelung der r, 40 ^^ <<^ ^ ! ^ ;." • r' "" in Abhängigkeit yell r 30 20..._. +20 Vorlauftemperatur Außentemperatur 15 +10 +5 0 —5 t A u/°C —15 ^ Die am Regler eingestellte Heizkurve muß nicht unbedingt mit derjenigen Kurve übereinstimmen, die der Auslegungstemperatur der Heizanlage zugeordnet ist. So kann es z. B. in einem Neubau während der Bauaustrocknungsphase aufgrund einer durch die Verdampfungswärme erhöhten Heizlast e rforderlich sein, eine etwas höherliegende Heizkurve einzustellen. Umgekeh rt ist bei evtl. überdimensionierten Heizflächen bzw. bei ständigem Auftreten von zusätzlichen Wärmequellen eine niedrigere Vorlauftemperatur bzw. Heizkurveneinstellung ausreichend. In jedem Fall sollte die Einstellung der Heizkurve von „unten her" e rfolgen; d. h. beginnend mit einer niedrigeren Einstellung wird die Heizkurve schrittweise höhergestellt, bis schließlich die gewünschte Raumtemperatur gerade erreicht wird. Bei Neubauten sollte spätestens zwei Heizperioden nach der ersten Inbetriebnahme überprüft werden, ob evtl. eine niedrigere Einstellung der Heizkurve ausreichend ist. Neben der Außentemperatur können auch andere meteorologischen Größen als Führungsgrößen verwendet werden. Bei größeren Gebäuden mit Nord-/Süd- bzw. Ost-/West-Orientierung ist es sinnvoll, die Heizanlage in zwei oder mehrere Zonen einzuteilen und die Vorlauftemperatur zonenweise zu regeln (Zonenregelung). Als Führungsgrößen müssendann die für die jeweilige Zone maßgebende Außentemperatur und Sonneneinstrahlung verwendet werden. Bei Zonen, die einer extremen Windbelastung ausgesetzt sind und dadurch einen erhöhten Lüftungswärmebedarf aufweisen, kann zusätzlich der Wind als Führungsgröße aufgeschaltet werden. 5.3 TECHN. AUSBAU Steuerung und Rege' Regelung über Raumtemperatur- tühler Zonenregelung Testraummethode Der Kostenaufwand für eine solche Zonenregelung ist wesentlich höher als für eine einzige zentrale Regelung. Mit steigender Anlagengröße werden jedoch die Mehrkosten, bezogen auf die Anlagenkosten, relativ gering. Demgegenüber stehen dann erhebliche Einsparungen dadurch, daß in ganzen Gebäudeteilen bei Sonneneinstrahlung die Vorlauftemperatur erheblich abgesenkt wird bzw. meist sogar die Heizung abgestellt werden kann. Der Gesetzgeber sieht in der HeizungsanlagenVerordnung [1] vor, Zentralheizungen mit „zentralen selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur Beeinflussung der Wärmezufuhr in Abhängigkeit von einem Zeitprogramm und der Witterung auszustatten". Diese Forderung kann sinnvoll nur mit einem witterungsgeführten Vorlauftemperaturregler e rfüllt werden. Bei Anlagen für bis zu zwei Wohnungen sind auch Handsteuerungen zugelassen, d. h. in diesem Fall braucht z. B. der Mischer nicht von einem elektronischen Regler angesteue rt zu werden, sondern kann von Hand eingestellt werden. Um jedoch auch mit diesem Handmischer gute Regelergebnisse erzielen zu können, ist möglichst häufig, nämlich bei jeder spürbaren Witterungsänderung, eine neue Einstellung vorzunehmen bzw. bei Nacht oder bei längerer Abwesenheit die Vorlauftemperatur abzusenken. Bei diesen Anlagen ist z. B. auch eine Vorlauftemperaturregelung nach der Testraum-Methode zulässig. Dabei muß jedoch eingeschränkt werden, daß diese Regelung - aufgrund ihrer Funktionsweise - bei Anlagen für mehr als eine Wohnung nicht sinnvoll eingesetzt werden kann. In jedem Falle ist es bei einer modernen Heizantage e rforderlich, immer die niedrigst mögliche Vorlauftemperatur einzustellen. Nur so läßt sich z. B. bei NT-Kesseln oder Wärmepumpen der Energieeinsatz minimieren. Um bei einer zentralen Vorlauftemperaturregelung (witterungsgeführt, handgesteue rt, TestraumMethode) den Einfluß zusätzlicher innerer Wärmequellen in den einzelnen Räumen (außer dem Testraum) berücksichtigen zu können, muß in diesen Räumen laut Heizungsanlagen-Verordnung eine 115 Regelung über Außentemperatur- fühier Handsteuerung an.msc er TECHN. AUSBAU Steuerung und Regelung Mischventile Umschaltventile The rmostatvent Reaktionszeit der Heizanlage zusätzliche thermostatische Einzelraumregelung vorgesehen werden. Dies ist bei Heizkörpern im einfachsten Fall mit Thermostatventilen durchzuführen. Dabei müssen jedoch die Nachteile der Drosselregelung bezüglich der Regelgüte in Kauf genommen werden. Eine thermostatisch gesteuerte Mischregelung in jedem Raum wäre zwar regelungstechnisch besser, erfordert jedoch anlagenseitig und bei der konstruktiven Gestaltung des Mischventils einen erheblichen Mehraufwand, so daß diese Lösung aus wirtscha ft lichen Gründen bisher nicht realisiert wird. Eine Einzelraumsteuerung ist dann sinnvoll, wenn die verschiedenen Räume eines Gebäudes regelmäßig nach einem bestimmten Zeitplan genutzt werden, wie dies z. B. in Schulen der Fall ist. Von einer zentralen Leitwarte aus kann dann für jeden Unterrichtsraum entsprechend dem Stundenplan ein Zeitprogramm eingestellt werden, nach dem dieser Raum dann beheizt bzw. die Temperatur abgesenkt wird. Drei- und Vier-Wege-Ventile werden entweder zum Umschalten eines Heizmittelstroms oder zum Mischen von zwei Heizmittelströmen unterschiedlicher Temperatur eingesetzt. Mischventile sind zur Vorlauftemperaturregelung bei ölbeheizten Heizkesseln mit konstanter Kesseltemperatur unbedingt erforderlich. Bei Heizkesseln, die mit gleitender Kesseltemperatur betrieben werden, gleicht ein nachgeschaltetes Mischventil die Temperaturschwankungen im Vorlauf (aufgrund von Schaltdifferenzen des Kesselthermostaten) aus. Bei bivalenten Wärmeerzeugungssystemen werden Umschaltventile benötigt. Der Antrieb von Misch- und Umschaltventilen kann elektromotorisch oder elektromagnetisch erfolgen. Thermostatventile (bzw. thermostatisch gesteuerte Heizkörperventile) sind sog. Proportionalregler, die ohne Hilfsenergie arbeiten. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Temperaturfühler, der zusammen mit dem Sollwerteinsteller und einem Federmechanismus den eigentlichen Regler bildet, und dem Ventilkörper. Die Wärmeabgabe des Heizkörpers wird dadurch an die jeweilige Heizlast des Raumes angepaßt, in dem bei Abweichungen Anforderungen an Heizflächen und Heizanlage der Raumtemperatur vom eingestellten Sollwert Voraussetzung für eine gute Regelbarkeit der Andie Stellung des Ventilstößels und damit der Heizlage ist, daß das Rohrnetz korrekt ausgelegt und mittelstrom geändert wird. auch entsprechend eingebaut ist. Wenn z. B. aufEine Übereinstimmung von Soll- und Istwerttempegrund eines Auslegungsfehlers der eine Heizkörratur tritt bei Proportionalreglern nur für einen beper zuviel und der andere zuwenig vom Heizmittel durchströmt wird, so kann die beste Regelung die- stimmten Lastfall auf. Ändert sich die Heizlast z. B. durch Au ft reten von inneren Wärmequellen, so sen Fehler nicht vollständig beheben. kann eine Drosselung des Heizmittelstroms nur Ein weiteres wichtiges Kriterium stellt das Speidadurch erreicht werden, daß sich eine höhere chervermögen der Heizflächen und der Anlage Raumtemperatur einstellt. Diese Raumtemperaturdar. Gerade bei der Einzelraumregelung in Verbin- änderung wird als Proportionalabweichung bzw. dung mit einer Niedertemperaturheizung spielt bleibende Sollwertabwertung bezeichnet und dieser Punkt eine wichtige Rolle. Für eine gute beträgt bei korrekter Auslegung der ThermostatRegelbarkeit der Anlage ist unbedingt eine schnell ventile ca. 1 bis 2 K. reagierende Heizfläche erforderlich. Nur so kann Die Regelgüte der Thermostatventile wird im gewährleistet werden, daß mit dem Drosseln des wesentlichen beeinflußt von seinen konstruktiv Heizmittelstroms auch entsprechend die Wärmeft en, der Art des Einbaues bedingten Eigenscha leistung der Heizfläche zurückgeht. Dies ist besonders dann sehr schwierig, wenn z. B. mit integrier- und dem stationären und dynamischen Verhalten ten Heizflächen zwangsläufig eine große Speicher- der Heizanlage [2]. Die wichtigsten Eigenscha ft en des Thermostatventils sowie die Anforderungen masse verbunden ist. Eine Einzelraumregelung ist und die dazugehörigen Prüfverfahren sind in hier wohl am besten dadurch möglich, daß über die integrierte Heizfläche nur eine gewisse Grund- DIN 3841, Teil 2, festgelegt. last abgedeckt wird und die restliche Heizlast durch schnell regelbare Zusatzheizflächen in den Raum gebracht wird. Auf keinen Faii ist es sinnvoii, die Einzelraumregelung bei integrierten HeizQuellen: flächen mit Thermostatventilen durchzuführen. [1] Verordnung über energiesparende Anforderungen an heizungstechnische Anlagen und Brauchwasseranlagen (Heizungsanlagen-Verordnung - HeizAnIV -) vom 22. 9. 1978, Bundesgesetzblatt S. 1581, Bonn 1978. Regler, Stellorgane [2] Ast, H. und Striebel D.: Energieeinsparung und Zentralgeräte, die einen Mischer ansteuern, besitRaumtemperaturregelung mit thermostatischen Heizkörzen P- oder PI-Verhalten; letzteres ist vorzuziehen, perventilen. Feuerungstechnik 19,1/81, S.18-25. da keine bleibende Regelabweichung au ft ritt. Wird der Brenner eines Kessels oder der Verdichter einer Wärmepumpe geschaltet, so besitzt der Reg- Kurzbiografie des Autors: Prof. Dr.-Ing. Heinz Bach ist Leiter der Abteilung Heizungler ein unstetiges Zwei-Punktverhalten (Ein-Aus). Lüftung-Klimatechnik im Institut für Kernenergetik und Dient das Zentralgerät der witterungsgeführten Energiesysteme der Universität Stuttga rt. Er leitet damit Vorlauftemperaturregelung, so ist der Zusammenzugleich die Prüfstelle Heizung-Lüftung-Klimatechnik, hang zwischen Führungsgröße und Regelgröße die im großen Umfang, z. B. Heizkörper, Wärmeaustaueinstellbar (Heizkurve). Außerdem sind die Geräte scher, Thermostatventile, Heizkostenverteiler oder Heiznoch mit einer Zeitschaltuhr mit Einstellmöglichkessel untersucht. Er hat promovie rt über Wärmeaustaukeiten für Tages- oder Wochenprogramme ausge- scher und sich habilitiert mit einer Arbeit zum Wärmestattet. Hierbei wird entweder die Vorlauftemperaübergang bei freier Konvektion. Hervorgetreten ist er tur abgesenkt oder die Pumpe oder der Wärmedurch Veröffentlichungen über die an der Prüfstelle unerzeuger abgeschaltet. Meist können die Regler tersuchten Anlagenelemente, aber auch über Probleme noch um Zusatzfunktionen, wie z. B. Steuerungsder Abwärmeentstehung, der Wärmerückgewinnung, einrichtung für bivalente Systeme, erweitert die Niedertemperaturheizung, den Nutzungsgrad von Heizanlagen und über Raumluftströmung. werden. 116 PIIAXISINIIJHMATION [NERGIEEINSPAHIING E3n Forschungsvorhaben der Bundesarchltektenkammcv rttrmhnet:,hrt :.,, a,.tt.,.l. B::ndesm.inisteriums . r,:,iq und Bauwesen Verbrauchsabhängige Wärmekostenabrechnung Die Wärmekosten müssen nach dem Verbrauch abgerechnet werden. Dies ist in der Neubaumieten-Verordnung für den öffentlich geförderten Wohnungsbau und in der Heizkostenverordnunq für den privaten Wohnungsbau vorgeschrieben. Drei Geräte zur Erfassung des Wärmeverbrauchs sind zugelassen: 1. Wärmezähler 2. Heizkostenverteiler mit elektronischer Meßgrößenerfassung 3. Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip. Für diese Geräte sind in DIN 4713 und 4714 die Mindestanforderungen festgelegt. Die technischen Anforderungen an die Wärmezähler sind durch die nationalen und internationalen Vorschriften vorgegeben. Elektronische Heizkostenverteiler und Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip, die nach dem 1. Juli 1981 eingebaut werden, müssen den Mindestanforderungen der DIN 4713 und DIN 4714 genügen. Der Nachweis dafür muß durch eine Prüfung an einer neutralen Heizkostenverteiler-Prüfstelle erbracht werden. Die Geräte werden dann mit dem DIN-Prüfzeichen gekennzeichnet. Die Anwendung der erwähnten Erfassungsgeräte ist jedoch systembedingt eingeschränkt. Wärmemengen-Messung Der Einsatz von Wärmezählern ist daran gebunden, daß pro Wohnung eine Ringleitung vorhanden ist, an die alle Heizkörper angeschlossen sind. Nur in diesem Fall kann man den gesamten Heizmittelstrom der jeweiligen Wohnung mittels eines Volumenmeßteiles erlassen. Zusätzlich wird mittels Zweirohr-Heizsystem mit waagerechter Ve rteilung TECHNISCHER AUSBAU .....,.. Bach Heizkostenmessung, -verteilung u. -abrechnung zweier Tauchfühler die Temperatur des Heizmediums beim Eintritt in die Wohnung und beim Austritt aus der Wohnung erfaßt (Abb. 1). Aus diesen Meßwerten wird mit einem Rechenwerk die abgenommene Wärmemenge bestimmt. Die Wärmezähler oder die Anzeigeeinheit des Wärmezählers lassen sich außerhalb der Wohnung montieren, so daß die Wohnungen nicht vom Ablesepersonal betreten werden müssen. Wärmezähler sind die einzigen Erfassungsgeräte,'' die für die verbrauchsorientierte Wärmekostenabrechnung zugelassen sind, die in physikalischen Einheiten anzeigen. Sie können im Gegensatz zu Heizkostenverteilern bei allen Heizungsarten eingesetzt werden, sofern die Verteilleitungen als Ringleitungen ausgeführt sind. Nur bei den heute fast nicht mehr anzutreffenden Dampfheizungen dürfen Wärmezähler nicht eingesetzt werden. Heizkost enverordnung Wärmeverbrauchsertassung nach DIN 4713 und 4714 Die Gültigkeit der Eichung bzw. Beglaubigung beträgt 5 Jahre. Nach dieser Zeit muß eine Oberprüfung des Wärmezählers bei einer von der PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt) zugelassenen Prüfstelle e rfolgen. Heizkostenverteilung Heizkostenverteiler mit elektronischer Meßgrößenerfassung (HKVE) können prinzipiell bei senkrechter (Abb. 2) und bei waagrechter Verteilung (Abb. 1) eingesetzt werden. Nicht eingesetzt werden dü rfen HKVE bei Fußbodenheizungen, Deckenstrahlungsheizungen, Warmlufterzeugern und klappengesteuerten Heizkörpern. Außerdem dürfen die elektronischen Heizkostenverteiler, die die Raumlufttemperatur nicht mit e rfassen, nicht bei Niedertemperaturheizungen mit Auslegungsvorlauftemperaturen niedriger als 60 °C eingesetzt werden. Vorlauf Rücklauf Wärmezähler Zweirohr-Heizsystem mit senkrechter Verteilung 117 Heizkostenverteiler mit elektronischer Meßgrößenerfassung Wärmezähler TECHN. AUSBAU Heizkostenmessuna -verteiiung u. -abrechnun^s Direkte und indirekte Meßwerterfassung HKVE lassen sich unter verschiedenen Gesichtspunkten unte rt eilen [11: 1. Nach der A rt der Anzeige gibt es HKVE mit zentraler Anzeige und solche mit dezentraler Anzeige. Bei der zentralen Anzeige werden die erfaßten Verbrauchswerte, die heizkörperweise vorliegen, wohnungsweise mittels einer Verkabelung zusammengefaßt und einem zentralen Zähler zugefüh rt . (Abb. 3). Bei der dezentralen Anzeige (Abb. 4) werden die Verbrauchswe rt e direkt am Heizkörper angezeigt. Hierbei spa rt man sich die Verkabelung, muß jedoch zum Ablesen der Verbrauchswerte die einzelnen Wohnungen betreten (Abb. 5). 2. Weiterhin kann man die HKVE unterscheiden nach der A rt der Meßwerterfassung in solche mit direkter und solche mit indirekter Meß werterfassung. man einen Fühler an geeigneter Stelle direkt auf der Heizkörperoberfläche montie rt . Der O rt auf der Heizkörperoberfläche, an dem die mittlere Oberflächentemperatur herrscht, wechselt jedoch je nach Betriebsweise des Heizkörpers. Bei Normheizmittelstrom mißt man die mittlere Oberflächentemperatur in der geometrischen Mitte des Heizkörpers. Drosselt man den Heizmittelstrom, wandert diese Stelle jedoch nach oben. Bei extremer Drosselung (2-5% des Normheizmittelstroms) wäre der richtige Meßort bei etwa 65% der Heizkörperbauhöhe und in halber Heizkörperbaulänge. Da der Temperaturfühler jedoch an einer festen Stelle des Heizkörpers montier t werden muß, legt die DIN 4714, Teil 3, eine Fühlermontagehöhe in 50-60% der Bauhöhe des Heizkörpers fest. Man kann davon ausgehen, daß unter normalen Betriebsbedingungen in diesem Bereich der Verteilfehler minimie rt wird. Transmissionsfühler • °ll r Bewertung Wand Nachbarwohnung Bewertung Heizkörper n 1° f°ll° f°10 1° -- Wohnung 1 Ringleitung O AEG co Warmwasser-Impulsgeber Meßfühler (Heizkörper) ^ Bewertung Wand Nachbarwohnung I °lfo Bewertung Heizkörper 1 Bewertung Heizkörper ® Meßelektronik (Wohnung) Wohnung 2 • Vergleichsfühler (Wand) 1 Bewertung Wand Nachbarwohnung Bewertung Heizkörper n - Bewertung Heizkörper 1 Meßelektronik (Wohnung) Wohnung n _a 1) Innenwand ^ Meßelektronik Vergleichsfühler Die zweite Methode, die mittlere Heizkörpertemperatur zu bestimmen, besteht darin, die Vorlauftemperatur und die Rücklauftemperatur des Heizkörpers zu messen (System Exatron). Hier stellt eich nicht das Problem der Montagehöhe. Bei Heizkostenverteilern mit indirekter Meßwerterfassung sind im Augenblick zwei unterschiedliche Systeme bekannt. 1. Systeme, die nur die Raumlufttemperatur in der Wohnung messen und als Abrechnungsgrundlage heranziehen. Diese Systeme erfüllen nicht olo I^I die Forderung der DIN 4713, wonach ein einolole I—I —Zentrale deutiger Zusammenhang zwischen der Anzeige Heikozent 3a eines Heizkostenverteilers und dem Wärmeverbrauch vorhanden sein muß. Dies wird offenDie meisten elektronischen Systeme arbeiten sichtlich, wenn man zwei Wohnungen innerhalb nach dem Prinzip der direkten Meßwerterfassung eines Gebäudes betrachtet, die aufgrund ihrer (Heikozent, Exatron, Techem, ISTA). Dabei wird Lage einen stark unterschiedlichen Wärmevon der Beziehung Gebrauch gemacht, daß die bedarf haben. Bei gleicher Raumtemperatur Wärmeleistung eines Heizkörpers in erster Linie würde die Anzeige mit HKVE-Systemen, die nur von der Temperaturdifferenz zwischen mittlerer die Raumlufttemperatur berücksichtigen, gleich Heizkörpertemperatur und der Raumlufttemperatur sein. abhängt. Der Wärmeverbrauch der beiden Wohnungen Die mittlere Heizkörpertemperatur kann man auf ist jedoch bei gleicher Raumtemperatur aufzwei verschiedene A rt en e rfassen. Einmal, indem grund des unterschiedlichen Wärmebedarfs 00 Mittlere Heizkörper temperaturerfässung Heizkörperfühler Transmissionsfühler Heikozent 118 181 Timi 1 r Stromversorg 43att.) t^ TECHN. AUSBAU ^ Heizkostenr . - .._...: -verteilung c - - ung 1^: ^ IR Zeittakt -o^ Quarz tu 5.4 Fühler (tv) LCD-Anzeige blinkt bei tL722°C Steuerung Fühler (tu) EXATRON Fühler im Gerät (tL) Exatron Heizkostenverteiler Exatron Heizkostenverteiler 4a Zentralgerät N Thermostatventil IHeizkörper OEM '4 Kabel' Netzanschluß - Verteilerdose Fernfühler 1 MIME " Kabel außerhalb- 1 innerhalb der Wohnung ISTA-HKVE zur Montage an Gliederheizkörpern Blockschaltbild des RCC-Systems (Werkbild Comap) nicht gleich. Ebenso würde bei geö ff netem Fenster eine niedrigere Raumtemperatur und damit eine geringere Anzeige registriert, während der Wärmeverbrauch stark in die Höhe geht. Deshalb dürfen diese Systeme nach dem 1. Juli 1981 nicht mehr eingebaut werden. und jedem einzelnen Thermostatventil hergestellt. Für die verschiedenen Wohnungen einer Liegenscha ft ist in dem an geeigneter Stelle aufgestellten Zähler jeweils eine Anzeige. Es ist deshalb nicht notwendig, zum Ablesen die Wohnung zu betreten. 2. Systeme, die mit Sollwerten der Regelung arbeiten (Abb. 6). Hier ist im Augenblick nur das RHV der Firma COMAP bekannt. Bei diesem System wird jeder Heizkörper mit einem Thermostatventil mit Flüssigkeitsfernfühler ausgerüstet. Im Thermostatventilkopf ist ein Potentiometer integriert, über welches der eingestellte Raumtemperatur-Sollwert elektronisch abgefragt wird. Dieser Sollwert muß natürlich von dem Thermostatventil möglichst genau eingeregelt werden können. Für die Heizkostenverteilung wird die am Potentiometer abgefragte Sollwerteinstellung mit der Normwärmeleistung des Heizkörpers sowie der Außentemperatur bewertet. Über eine zweiadrige Sternverkabelung wird die Verbindung zwischen dem zentralen Zähler Von den elektronischen Heizkostenverteilern verspricht man sich eine deutliche Verbesserung gegenüber den Heizkostenverteilern nach dem Verdunstungsprinzip (HKVV). Es läßt sich beispielsweise die .unvermeidbare Anzeige der HKVV, die während der Sommermonate au ft ritt, die sog. Kaltverdunstung, bei den elektronischen Heizkostenverteiler-Systemen unterdrücken. Außerdem ist es möglich, einen linearen Zusammenhang zwischen der Heizkostenverteiler-Anzeige und der Heizkörperleistung zu erreichen. Dies ist bei den Verdunstern aufgrund der Verdunstungscharakteristik der Meßflüssigkeit nicht möglich. 6 Weitere Vorteile der elektronischen Systeme sind in dem erhöhten Auflösungsvermögen der Anzeige 119 handelsüblicher Silikonkleber wieder angeklebt werden. Man muß also darauf achten, daß die Heizkostenverteiler mit Schweißbolzen an Plattenheizkörpern befestigt werden, nur dann ist eine ausreichende Manipulationssicherheit gegeben. zu sehen, so daß der Wohnungsnutzer sich in kurzen Zeitabständen einen Überblick über sein Verbrauchsverhalten verschaffen kann. nI TECHN. AUSBAU Heizkostenmessung. -verteilung a. -abrechnung Heizkostenverteiler nach dem Ver dunsturlgsprinzep Die Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungs prinzip (HKVV) sind die am häufigsten eingesetzten Geräte zur Wärmekostenverteilung. Etwa 30 Mio. Geräte sind in der Bundesrepublik Deutschland im Einsatz. Eing re nzen der Genauigkeit Unterschiedliche Fehlerdefinitionen, wie sie in der Praxis angewandt werden, tragen stark zur Verwirrung der Öffentlichkeit bei. Aus diesem Grund soll hier nur auf die einzelnen Definitionen eingegangen werden. Frontteil Ampulle Ein Meßfehler kann nur bei Meßgeräten auftreten, die in physikalischen Einheiten messen. Also in unserem Fall nur bei dem Wärmezähler. Spann, stück für Yvtel3fehler / -Skala Rückenteil transparente Abdeckplatte. Montage an Glieder', heizkörper Strahlungsschutz ---Plombe Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip 7 Der HKVV wird direkt auf den Heizkörper montie rt. Über ein metallisches Rückenteil wird Wärme auf eine Ampulle, die Kontakt mit dem Rückenteil hat, geleitet. Aus dieser Ampulle verdunstet entsprechend der Wärmeeinwirkung vom Heizkörper eine Meßflüssigkeit. Die Abnahme dieser Meßflüssigkeit durch Verdunstung ist ein Maßstab, wieviel Wärme der Heizkörper, auf dem der HKVV montie rt ist, im Vergleich zu anderen Heizkörpern im Haus abgegeben hat. Ein in letzter Zeit hochgespieltes Thema bei den HKVV ist die Montagehöhe am Heizkörper. Es wird teilweise behauptet, beim Einsatz von Thermostatventilen seien HKVV entweder zur Heizkostenverteilung nicht geeignet oder aber sie müssen sehr hoch am Heizkörper montie rt werden. Dieser Ansicht ist zu widersprechen. HKVV, die in dem von der Norm DIN 4713 angegebenen Montagebereich von 60-80% der Heizkörperbauhöhe montiert Sind, haken etwa gleich gute Verteil_ genauigkeiten. Nicht einsetzbar sind HKVV bei Fußbodenheizungen, Deckenstrahlungsheizungen, klappengesteuerten Heizkörpern, Warmlufterzeugern, bei Heizsystemen, die mit niedrigeren Auslegungsvorlauftemperaturen als 50 °C arbeiten, bei Dampfheizungen und bei Einrohrheizungen, sofern sie über den Bereich einer Nutzereinheit (Wohnung) hinaus verwendet werden. Montagesicherheit Eine wichtige Voraussetzung für die Vermeidung von Fehlern ist die Montagesicherheit. In DIN 4713 lautet die Forderung „die Befestigung des Gehäuses am Heizkörper muß dauerhaft und manipulationssicher sein". Diese Forderung wird von geklebten HKVV, wie dies bei vielen Firmen bei Plattenheizkörpern aus Kostengründen üblich ist, nicht erfüllt. Geklebte Heizkostenverteiler können abgelöst werden und bevor der Meßdienst zum Ablesen kommt, mittels 120 Ein Meßfehler ist die prozentuale Abweichung des Istwertes vom Sollwert. Ganz anders dagegen verhält es sich beim sog. Verteilfehler. Hier ist im Endeffekt nur entscheidend, ob sich irgend welche Fehler wieder aufheben. Wird beispielsweise bei einem bestimmten Betriebsfall 30% zu wenig angezeigt und bei einem anderen Betriebsfall 30% zu viel, so kann der Verteilfehler 0 sein. Wie man sieht, hängt bei dieser Definition alles von dem angenommenen statistischen Verbraucherverhalten ab, ob sich die Abweichungen aufheben oder aufsummieren. Daher sind die Angaben, wie sie von Stiftung Warentest über die Verteilfehler der einzelnen HKV-Fabrikate gemacht wurden, unter diesem Aspekt zu betrachten. Zusätzlich ist im Verteilfehler meist noch der Festkostenanteil enthalten, d. h. ein Verteilfehler von 20% bei 100%iger verbrauchsbezogener Abrechnung halbiert sich auf 10%, sobald 50% Festkostenanteil erhoben werden. Nach den Anforderungen der PTB sind nach [2] folgende Gesamtfehler für Wärmezähler zulässig. Temperaturdifferenz At<10°C 10 °C At < 20 °C 20°C At Gesamtfehler ± 8% ±7% ±5% Nach vorliegenden Erfahrungen bei der Beglaubigung von Wärmezählern ergibt sich, daß der Gesamtfehler der Geräte enger liegt als die zulässige Eichfehlergrenze und für 95% der Anwendungsfälle zu ± 3% vom Meßwert der Wärmemenge abgeschätzt werden kann. Der Systemfehler der HKVV, der sich aus statistischen Annahmen ermittelt, dür fte realistisch bei ± 15% liegen, wobei sich unter Berücksichtigung des Festkostenanteils (50%) ein Verteilfehler von etwa ± 7,5% ergibt. Für HINE liegen noch zuwenig Erfahrungen vor, außerdem sind die physikalischen Erfassungsprinzipien zu unterschiedlich, um schon jetzt Aussagen über eine Systemgenauigkeit machen zu können. Gerätekosten Die Kosten für die meßtechnische Ausstattung zur Erfassung der Heizwärme, jedoch ohne Warmwassererfassung, für eine Dreizimmer-Wohnung mit fünf Heizkörpern betragen etwa DM 75,- für Verdunstungsgeräte, DM 750,- bis DM 1000,- für elektronische Heizkostenverteiler mit zentraler Anzeige. Dieser Preis liegt so hoch, da hier eine Verkabelung mit Mauerdurchbrüchen notwendig ist. Für elektronische Heizkostenverteiler mit dezentraler Anzeige muß man mit etwa DM 350,-rechnen. Beim Einsatz von Wärmezählern muß man inkl. Montagekosten mit DM 500,-bis DM 600,- rechnen. Wenn man diese Kosten betrachtet, so kommt man zu dem Schluß, daß der Einsatz von Wärmezählern, dem einzigen physikalisch exakten Verfahren, empfehlenswe rt ist. Beim Neubau ist dies leicht möglich, wenn sich der Planer von vornherein über die Wärmeverbrauchserfassung Gedanken macht und eine waagrechte Rohrver ,leuvorsteht. die Verbrauchswe rte (Nutzverbrauch) von der Anzahl der zu versorgenden Wohnungen, der Zahl der Personen, ihren Lebensgewohnheiten und Komfortansprüchen und der A rt der sanitären Einrichtungen abhängen, ist der zur Deckung dieses Warmwasserbedarfs e rforderliche Wärmebedarf zusätzlich auch abhängig von der Anlagengestaltung. Dominierend für den Warmwasserbedarf ist die Anzahl der Personen und ihre Lebensgewohnheiten. Im Entwurf der VDI 2067 [8] werden die in folgender Tabelle zusammengestellten Durchschnittswerte angegeben: Systeme zur Erfassung des Warmwasserverbrauchs Bei der Warmwasser-Erfassung sind im Augenblick zwei verschiedene Geräte zugelassen: Warmwasserkostenverteiler und Warmwasserzähler. Die weit verbreiteten Warmwasserkostenverteiler sind ebenso wie die Heizkostenverteiler unter die Meßhilfsverfahren einzuordnen. Im Gegensatz zu den Heizkostenverteilern gibt es jedoch in der DIN 4713 und der DIN 4714 keine Anforderungen an die Warmwasserkostenverteiier. Die Mehrheit der Mitglieder dieser Normenausschüsse hat sich geweige rt , für dera rtige Geräte Anforderungen aufzustellen. Man ist der Ansicht, daß diese Geräte ungeeignet sind für die Warmwasserkostenverteilung. Aus diesem Grund ist es nicht empfehlenswert, Warmwasser-Versorgungsanlagen mit diesen Geräten auszurüsten, da Warmwasserkosten-Ver teller nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen [2] und daher in Zukunft mit juristischen Schwierigkeiten zu rechnen ist. niedrig mittel hoch Die andere Methode, den Warmwasserverbrauch zu erfassen, ist die physikalisch exakte Messung mittels Warmwasserzählern. Hier entstehen häufig wieder Probleme mit der Leitungsführung, so daß nicht mit nur einem Warmwasserzähler der gesamte Wohnungsverbrauch an Warmwasser ermittelt werden kann. In diesem Fall müssen mehrere Warmwasserzähler pro Wohnung eingebaut werden oder man muß versuchen, von der Ausnahmegenehmigung der Heizkostenverordnung Gebrauch zu machen. Eine wi rtschaftliche Warmwassererfassung dürfte nämlich beim Einsatz von mehreren Warmwasserzählern nicht mehr möglich sein. Auch bei der Warmwasserversorgung empfiehlt sich daher, bei Neubauten oder Sanierungsmaßnahmen auf eine Ringleitung pro Wohnung überzugehen. Warmwasserbereitung Erwärmtes Trinkwasser wird nach DIN 4708 [3] als Warmwasser bezeichnet. Wegen der stark unterschiedlichen Bedarfswerte ist zwischen Wohnbauten und wohnungsähnlichen Bauten einerseits und Gewerbe- und Industrieanlagen, Krankenhäusern, Badeanstalten usw. andererseits zu unterscheiden. Angaben über die Bedarfswerte bei Zweckbauten findet man bei Sander [4], im Buderus-Handbuch [5] und im RecknagelSprenger [6]. Im folgenden wird nur auf die Versorgung von Wohnbauten eingegangen. Zur Berechnung der Bedarfswerte bei Wohnbauten geben die DIN 4708 [3] und der Entwu rf der VDI 2067 Blatt 4 [7] ausführlich Auskunft. Während BedarfWarmwasserbedarf lid Pers. 10 bis 20 20 bis 40 40 bis 86 N utzwärmebedarf kWhid Pers. 514 TECHN. AUSBAU Heizkostenmessung, -verteilung u. -abrechnung Waagerechte Rohrverlegung zur Wärmeverbrauchserfassung bei der Planung berücksichtigen 0,6 bis 1,2 1,2 bis 2,4 2,4 bis 5,0 Daraus läßt sich die Größenordnung der Kosten, die pro Person und Jahr auftreten, abschätzen; sie betragen etwa DM 120,- im Jahr bei zentraler Brauchwasserbereitung z. B. mit einem Ölkessel (Stand 1981). Bei der Beschreibung von Warmwasserbereitungs anlagen wird im allgemeinen unterschieden zwischen zentraler und dezentraler Warmwasserberejtung, obwohl die Warmwasserbereiter in beiden Fällen grundsätzlich gleich und nur in der Größe unterschiedlich sind. Ein Unterschied besteht lediglich darin, daß bei zentraler Versorgung ein Verteilungssystem mit seinen Verlusten zu berücksichtigen ist und unter Umständen ein zentraler Wärmeerzeuger einschließlich dem zugehörigen Speicher kleiner sein kann als die Summe der dezentralen Warmwasserbereiter. Die im Gebäude vorkommenden WarmwasserBereitungsanlagen können gegliede rt werden in: O Durchlauf-Wassererwärmer und O Speicher-Wassererwärmer, die O direkt oder O indirekt beheizt sind und O Kombinationen von Durchlauf- und Speichererwärmern. fl ^urrhln, E7ö^1GI •Y(Arl _lI JI IIlI YYa1 ! 1 IGQUAIaUscher, in denen das Wasser beim Durchströmen direkt durch heiße Rauchgase oder einen Elektroheizkörper [5] oder indirekt durch ein Heizmittel erwärmt wird. Durchlauferhitzer, wie diese Geräte auch genannt werden, besitzen im Vergleich zu Speicher-Wassererwärmern eine größere Leistung des Wärmeerzeugers und werden daher mit Vorliebe do rt eingesetzt, wo ein unregelmäßiger Verbrauch vorliegt, Vo rteilhaft sind die niedrigen Anschaffungskosten, der geringe Platzbedarf und ihre Eigenschaft, schnell frisches, nicht abgestandenes Warmwasser zu liefern. Sie werden aus all diesen Gründen überwiegend zur dezentralen Versorgung einzelner Entnahmestellen eingesetzt. Allgemein haben Speicher-Wassererwärmer im Vergleich zu Durchlauf-Wassererwärmern den Vorteil, daß sie mit einer kleineren Leistung auskommen und kurzfristig große Warmwassermengen liefern können. Sie sind daher für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen (Gruppen-Versorgung oder Zentralversorgung) besonders geeignet. 121 Warmwasserkostenverteiler Zentrale und dezentrale Warmwasserbe re itu ng Warmwasserzähler rmer Speicher-Wasser -erwäm n4 TECHN. AUSBAU Heizkostanmessung. -verteiiung u. -abrechnung Direkt beheizte Speicher -Wasser erwärmer Indirekt beheizte-. Speich er-Wassererwärmer Wärmeaustauscher Bei direkt beheizten Speicher-Wassererwärmern gilt im Hinblick auf die Wärmeerzeugung das gleiche wie bei Durchlauf-Wassererwärmern. Wird elektrischer Strom zur Beheizung verwendet, besteht die Möglichkeit, die von den Energieversorgungsunternehmen (EVU) für bestimmte Stunden angebotenen Sondertarife zu nutzen. Weiterhin können durch den Einsatz kleiner Geräte auch einzelne Entnahmestellen (dezentral) versorgt werden. Auf diese Weise lassen sich die Leitungsverluste (zum Aufheizen, für die Ve rt eilung und Zirkulation) vermeiden. Bei indirekt beheizten Speicher-Wassererwärmer wird das Wasser über einen Wärmeaustauscher durch ein Heizmittel erwärmt. Im einfachsten Fall wird der das zu erwärmende Trinkwasser enthaltende Speicher in einem vom Heizmittel durchflossenen Behälter angeordnet und von außen beheizt. Die Wärme kann aber auch durch Rohrbündel oder Rohrschlangen, die entweder innerhalb oder außerhalb des Speichers angeordnet sind, zugefüh rt werden. Gegenüber der Doppelmantelausführung besteht hier der Vo rt eil, die Heizfläche genügend groß zu gestalten. Weiterhin bietet die externe Anordnung des Wärmeaustauschers den Vo rt eil, das Warmwasser geschichtet zu speichern (längere Laufzeiten bei der Wassererwärmung, kleinere Stillstandsverluste). Abgesehen von der Gestaltungsvielfalt bei den Wärmeaustauschern besteht bei den indirekt beheizten Speicher-Wassererwärmern auch der Vorteil, daß zur Erwärmung des Heizmittels alle für die Raumheizung gebräuchlichen Wärmeerzeuger in Frage kommen: Alle Kessel (Kohle, Holz, 01, Gas, Strom), Wärmepumpen, Fernwärme, Solarkollektoren und Kombinationen der genannten Wärmeerzeuger. Als Vo rt eil gegenüber Durchlauf-Wassererwärmern und direkt beheizten Speicher-Wassererwärmern ist auch anzuführen, daß die Temperatur der Wärmeaustauschflächen unter 60 °C gehalten werden können, so daß eine Kesseisteinablagerung weitgehend vermieden wird. Indirekt beheizte Speicher-Wassererwärmer werden ausschließlich für eine Zentralversorgung eingesetzt. Die Größe des Speichervolumens ist abhängig von der Anzahl der zugeordneten Entnahmestellen und den Nutzeransprüchen, bei Blockausführung (Warmwasser-Speicher und Wärmeerzeuger als Einheit) zusätzlich auch von der Nennleistung des Wärmeerzeugers. Der Speicher kann kleiner ausgefüh rt werden, wenn der Wärmeaustauscher außerhalb angeordnet und eine Schichtung des Warmwassers gewährleistet ist. Auch die Größe des Wärmeaustauschers richtet sich im wesentlichen nach der Anzahl der Entnahmestellen und den Komfortansprüchen der Nutzer. Eine zusätzliche Vergrößerung des Wärmeaustauschers bietet die Möglichkeit, dem SpeicherWassererwärmer in einem gewissen Umfang Eigenscha ft en des Durchlauf-Wassererwärmers zu verleihen. Bei den heutigen Dämmvorschriften kann bei zentraler Warmwasserversorgung in Ein- oder Zweifamilienhäusern auf die früher übliche Zirkulationsleitung verzichtet werden. Ist nicht zu vermeiden, Entnahmestellen weiter als etwa 10 m von der Wärmeerzeugung anzuordnen, sollten hie rf ür kleine (dezentrale) Wassererwärmer vorgesehen werden. In Mehrfamilienhäusern läßt sich die Zirkulationsleitung nicht vermeiden; hier ist auf 122 eine besonders gute Wärmedämmung zu achten und eine nutzzeitabhängig geschaltete Umwälzung vorzusehen. Unter diesen Voraussetzungen ist es, wie bereits erwähnt, derzeit am günstigsten, das Brauchwasser zentral in Verbindung mit einem Heizkessel zu erwärmen. Das gilt besonders dann, wenn die zuvor beschriebenen modernen Kessel verwendet werden. Eine einfache Rechnung verdeutlicht dies: Geht man, wie vorn dargelegt, bei einem mittleren Beda rf einer Person pro Tag von 2,4 kWh Nutzwärme aus, also 72 kWh im Monat, so ist der monatliche Energieverbrauch bei einem modernen Kessel mit einem Nutzungsgrad von etwa 90% während der Heizzeit ca. 80 kWh und in der Sommerzeit (Nutzungsgrad ca. 50%) 144 kWh (j eweils pro Person). Rechnet man die Kilowattstunde ÖI mit DM -,70, so kostet die Warmwasserbereitung pro Person und Monat im Sommer etwa DM 10,- und im Winter DM 5,60 (Gesamtkosten im Jahr ca. DM 80,-). Zu beachten ist, daß Einsparungen nur während der etwa drei Sommermonate denkbar sind und lediglich Bruchteile der genannten Kosten während dieser Zeit betragen können. Wird z. B. mit einer monatlichen Einsparung in dieser Zeit von etwa DM 5,- gerechnet, so dürfen die Investitionen hierzu (ebenfalls personenbezogen) nicht mehr als DM 150,- betragen [10]. Quellen: [1] Geottling, D. und Kuppler F.: Heizkostenverteilung Technische Grundlagen und praktische Anwendung. C. F. Müller Verlag, Karlsruhe, 1981. [2] Verbrauchsabhängige Wärmekostenabrechnung. Kommentar zur Heizkostenverordnung und DIN-Normen Teil 4, Beuth-Verlag 1981. [3] Schulz, H.: Was sind Warmwasserkostenverteiler? Wärmetechnik 5,1981, S. 274/276. [4] DIN 4708: Teil 1 bis 3: Zentrale Wassererwärmungsanlagen, Ausgabe Oktober 1979. [5] Sander, H.: Warmwasserbereitungsanlagen für Wohn- und Zweckbauten, 2. Auflage 1963, Verlag Hänchen und Jäh, Berlin. [6] Buderus-Handbuch, 32. Ausgabe 1975, VDI-Verlag Düsseldorf. [7] Sprenger, E. (Hrsg.): Recknagel-Sprenger, Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, 61. Ausgabe 1981, Verlag R. Oldenbourg, München/Wien. [8] VDI 2067, Blatt 4: Warmwasserversorgung, Ausgabe September1979. [9] RWE Bau-Handbuch, Technischer Ausbau, 1981/82, Energie-Verlag Heidelberg. [10] Dittrich, A.: Wi rtschaftlichkeit von Sommerbrauchwasser-Anlagen mit Sonnenenergie. HLH 23 (1977) Nr. 4. Kurzbiografie des Autors: Prof. Dr.-Ing. Heinz Bach ist Leiter der Abteilung Heizung - Lüftung - Klimatechnik im Institut für Kernenergetik und Energiesysteme der Universität Stuttga rt. Er leitet damit zugleich die Prüfstelle Heizung - Lüftung - Klimatechnik, die im großen Umfang z. B. Heizkörper, Wärmeaustauscher, Thermostatventile, Heizkostenverteiler oder Heizkessel untersucht. Er hat promovie rt über Wärmeaustauscher und sich habilitie rt mit einer Arbeit zum Wärmeübergang bei freier Konvektion. Hervorgetreten ist er durch Veröffentlichungen über die an der Prüfstelle untersuchten Anlagenelemente, aber auch über Probleme der Abwärmeentstehung, der Wärmerückgewinnung, die Niedertemperaturheizung, den Nutzungsgrad von Heizanlagen und über Raumluftströmung.