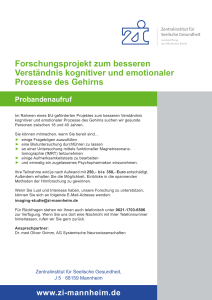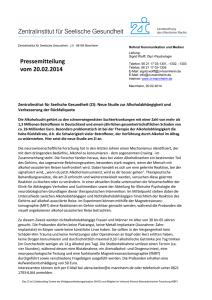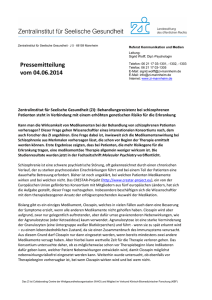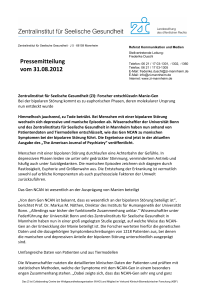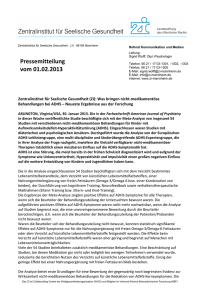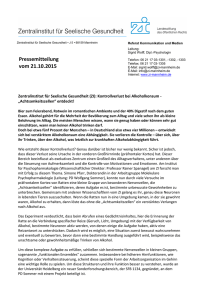in format io n
Werbung

INFORMATION Nummer 1 • April 2006 29. Jahrgang Inhalt „Ich werde die große ZI-Familie vermissen!“ Prof. Henn wechselt in den (Un-)Ruhestand nach USA Seite 3 Ein Rückblick 30 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie am ZI Seite 6 Kongressbericht Tagung der Biologischen Kinder- und Jugendpsychiatrie Seite 8 Präventionsprojekt „Zappelphilipp“ Frühintervention bei durch Delinquenz auffällig gewordenen Kindern Seite 10 Nichtrauchen in 6 Wochen Qualifizierte Tabakentwöhnung am ZI Seite 11 Nimmt der Alkoholkonsum im Alter ab?? Eine Verlaufsstudie zu Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit bei Bewohnern in Mannheimer Altenpflegeheimen (1995-2003) Seite 12 Neuer Bezeichnung für alte Inhalte? Gesundheits– und Krankenpflege im Kontext suchtmedizinischer Behandlung Seite 14 Deeskalationsmanagement Umgang mit Aggression und Gewalt Seite 16 Wenn wir hören, was wir fühlen Emotionale Verarbeitung bei Tinnitus Seite 17 Strahlenschutz Zertifizierung und Perspektiven der Neuroradiologie am ZI Seite 19 Gene halten sich nicht an die ICD! Auf dem Weg zur molekulargenetischen Klassifikation von psychiatrischen Erkrankungen am Beispiel des Gens G72 Seite 20 Stress und Immunität Ein Modellprojekt zur Stressreduktion bei Patienten unter Knochenmark- und Stammzelltransplantation Seite 24 Zum Schluss... Seite 27 Autorenliste und Impressum Seite 28 „Ich werde die große ZI-Familie vermissen!“ Prof. Henn wechselt in den (Un-)Ruhestand nach USA Sie waren seit 1994 Direktor des ZI. Welches sind die wesentliche Wegmarken in der Entwicklung des ZI in dieser Zeit?? Meines Erachtens ist die bedeutendste Entwicklung am ZI der Wandel in der psychologischen Struktur des Institutes. Als ich 1994 nach Mannheim kam, traf ich am Zentralinstitut Prof. Dr. Dr. Fritz A. Henn (Quelle:DGPPN) auf feste, hierarchisch geprägte Strukturen. Heute, so hoffe ich zumindest, sind die Strukturen flacher und durchlässiger, und ermöglichen den wissenschaftlichen Austausch zwischen Studenten, jungen Wissenschaftlern und erfahrenen Forschern in einem Umfeld, das es auch ermöglicht, die theoretischen Ansätze von Vorgesetzten auf die Probe zu stellen. Natürlich gab es auch signifikante Veränderungen in der Forschungsausrichtung. So konnten wir nach meinem Wechsel ans ZI das erste neurobiologische Labor eröffnen und 1995 mit dem Aufbau der NMR-Forschergruppe beginnen. Beide Projekte sind inzwischen sehr ausgereift und wir blicken heute auf ein Institut, das durch die Breite seiner biologischen und bildgebenden Forschungsansätze geprägt ist. Diese Entwicklungen gingen zu Lasten des bis 1994 maßgeblichen epidemiologischen ForschungsZI Aktuell 1/06 schwerpunktes am ZI, wobei ich darauf hinweisen möchte, dass sowohl die epidemiologische Forschung als auch die Versorgungsforschung nach wie vor am ZI sehr aktiv vertreten sind, auch wenn sie die psychiatrische Forschung des Institutes nicht mehr maßgeblich prägen. Sowohl im Bereich der Krankenversorgung als auch bezüglich des Forschungsschwerpunkts wurden Ansätze und Ressourcen, so wie bereits vor meinem Wechsel ans Zentralinstitut festgelegt, um den Bereich der Gerontopsychiatrie erweitert. Außerdem konnte neben einer Reihe neuer klinischer Angebote auch der in Deutschland bislang erste und einzige Forschungsschwerpunkt „Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin“ am ZI etabliert werden, was meines Erachtens die Dringlichkeit und das Ausmaß der Suchtproblematik als wichtiges Gesundheitsproblem darstellt. Auch der Bereich der Psychosomatischen Medizin hat hier am Zentralinstitut in den letzten Jahren durch die Einbindung experimentell validierter Behandlungsansätze und Therapien einen Wandel vollzogen und dabei eine für das gesamte Gebiet richtungsweisende Rolle angenommen. Schließlich konnte auch die neue Forschungsabteilung im Bereich Neuropsychologie etabliert werden, die innerhalb Deutschlands auf diesem Gebiet inzwischen eine führende Rolle einnehmen konnte. All dies illustriert meines Erachtens die wichtigsten Veränderungen, die sich in den vergangenen elf Jahren am ZI vollzogen haben. Sie hatten 1994 in einem Interview geäußert, Ihre wesentlichen Ziele für die Zukunft des ZI seien der Ausbau der modernen biologischen Forschung auf molekularer Ebene und die Stärkung der Bildgebung. Diese Ziele scheinen Sie erreicht zu haben? Editorial Liebe Leserin, Lieber Leser, das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit durchläuft zur Zeit eine Phase der personellen Veränderungen, wie selten in seiner mehr als 30jährigen Geschichte zuvor. Ende März feierte Prof. Dr. Dr. Fritz Henn, seit 1994 Direktor des Instituts, seinen 65. Geburtstag und trat in den USA eine neue berufliche Herausforderung an. Zeitgleich wurde Prof. Dr. Dr. Martin H. Schmidt nach 31 Jahren als Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindesund Jugendalters emeritiert. Bei seiner Berufung 1975 war er mit Abstand der jüngste Lehrstuhlinhaber der Fakultät, nun verließ er als letzter Vertreter der ersten ZI-Generation seinen Chefsessel. Bereits Ende Dezember verabschiedete sich der kaufmännische Direktor Winfried Busche nach acht Jahren am Institut zu neuen beruflichen Ufern. Da sie alle in dieser Ausgabe nochmals zu Wort kommen sollten, liegt Ihnen „ZI Information aktuell“ nun etwas später vor als gewohnt – dafür in neuem, farbigen Layout. Bis zum Herbst werden alle Berufungsverfahren wohl abgeschlossen sein, so dass wir Ihnen in der nächsten Ausgabe viele neue Gesichter vorstellen können. Nun aber wünsche ich Ihnen für die Lektüre dieser Ausgabe viel Vergnügen. Ihre Ja, ich glaube, es ist uns gelungen, 3 www.zi-mannheim.de diese Ziele durch die Rekrutierung exzellenter Wissenschaftler und der Etablierung kooperativer Forschungsprojekte zu erreichen. Was ist die herausragendste neue Erkenntnis in der Psychiatrie der vergangenen 10 Jahre? Zwei Gebiete sind meines Erachtens maßgeblich zu nennen: Die Möglichkeit, anhand bildgebender Verfahren die Pathologie zahlreicher psychiatrischer Erkrankungen visuell darzustellen und zweitens die Bestimmung der ersten Gene, die in der Entstehung der wichtigsten psychiatrischen Störungsbilder eine Rolle spielen, wobei meines Erachtens nicht ein einziges Moment, sondern die Gesamtheit des erzielten Fortschrittes hervorzuheben ist. künftig auch zu Kooperationen mit anderen Zentren im Rhein-Neckar-Dreieck und innerhalb Europas führen wird. Als weiteren Schritt sehe ich die Möglichkeit einer formellen Kooperation zwischen dem Zentralinstitut und dem Institut für Psychiatrie am Kings College in London. Beide zählen zu den führenden Forschungseinrichtungen in Europa und eine offizielle Zusammenarbeit könnte die Position beider Institute mit Blick auf zukünftige Unterstützung durch EU Forschungsgelder stärken. Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger? Haben Sie Tipps für ihn? Meinem Nachfolger wünsche ich, zu delegieren, offen für Vorschläge zu sein und gut zuzuhören. Sie gehen zurück in die USA? Was werden Sie dort tun? In den USA werde ich als Co-Direktor am Brookhaven National Laboratory für den Bereich Lebenswissenschaften verantwortlich sein. Brookhaven ist ein großes physikalisches Labor, das in den letzten 25 Jahren Arbeiten zu sechs Nobelpreisen in Physik hervorgebracht hat und zwei im Fach Biologie. Ein Preis wurde für die Entwicklung der strukturellen Magnetresonanz verliehen, ein zweiter für Arbeiten, die wesentlich zu unserem Verständnis der Struk- Wie sehen Sie die weiteren Entwicklungen der Psychiatrie in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Welches sind die zu erwartenden herausragenden Erkenntnisse? Ich sehe die Zukunft der psychiatrischen Forschung und Behandlung von Krankheitsbildern in der Verknüpfung von Geneffekten zu strukturellen und funktionellen Veränderungen im Gehirn, womit wir uns hier am ZI und auch zahlreiche andere Wissenschaftler sich inzwischen beschäftigen. Ich vermute stark, dass, wie von unserer Arbeitsgruppe in jüngster Zeit publiziert, die Identifikation bestimmter Geneffekte auf spezifische Emotionen, Verhaltensmustern und kognitive Funktionen sowie die Analyse funktioneller Veränderungen, die zu diesen Veränderungen führen, gänzlich neue diagnostische Gesichtspunkte innerhalb der Psychiatrie sowie neue Ansatzpunkte der Therapie aufzeigen werden. Und wie sehen Sie die weitere Entwicklung des ZI in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Wichtig ist meines Erachtens die Konsolidierung und dabei die komplette Nutzung der vorhandenen Ressourcen des neuen Laborgebäudes, was sicherlich zuZI Aktuell 1/06 Therapiegebäude • Laborgebäude • Forschungsgebäude dass er, wie ich, auf gute Zusammenarbeit mit den anderen Lehrstuhlinhabern und den Assistenten bauen kann. Ich hoffe, dass es ihm und dem Zentralinstitut gelingt, kluge und herausragende Mitarbeiter für vorhandene Ausbildungsprogramme und bei der Wiederbesetzung frei werdender Lehrstühle zu rekrutieren. Schließlich wünsche ich ihm die beständige Unterstützung der psychiatrischen Forschung durch das Land sowie die vermehrte Förderung durch die DFG und das BMBF. Als Tipp würde ich meinem Nachfolger raten, nicht alles im Alleingang bewerkstelligen zu wollen, sondern 4 turen und Funktionen des ersten Ionenkanals, einem Kalium-Kanal beigetragen haben. Brookhaven war auch federführend in der Initiierung des „Human Genome Projects“ und verfügt über eines der bestausgestatteten PET-Zentren der Welt. Für mich bietet Brookhaven die Chance, administrativen Aufgaben und der Krankenversorgung den Rücken zu kehren, und mich wieder voll und ganz der Forschungsarbeit zu widmen. Erste Ansätze zur Etablierung einer kooperativen klinischen Forschergruppe mit den Medizinischen Fakultäten in New York sind gemacht, die uns, sozusagen im Auswww.zi-mannheim.de tausch für hochspezialisierte Forschungsmöglichkeiten, die an den einzelnen Fakultäten selbst nicht vorhanden sind, die notwendigen Fragestellungen zu Patienten und Krankheitsbildern liefern werden. Gibt es weitere Kooperationen mit dem ZI? Ich hoffe doch sehr, denn ich kann mir gut vorstellen, dass einige der jungen Wissenschaftler am ZI von Postdoc-Arbeiten in Brookhaven profitieren würden und es ist durchaus denkbar, dass Brook- Stärken in Deutschland? Meines Erachtens sind heute die Unterschiede im Bereich der psychiatrischen Forschung zwischen den USA und Deutschland deutlich geringer als noch vor elf Jahren. Deutsche Einrichtungen bringen herausragende Arbeiten hervor, die sich auf fast allen Gebieten mit den besten messen können. Es ist vor allem auch die Dimension der großangelegten kooperativen klinischen Studien in den USA, die diese nach wie vor eine beherrschende Rolle spielen lassen. Die Einrichtung unterschiedlicher Kompetenznetz- Erachtens im Allgemeinen deutlich besser. Der Grund hierfür ist im amerikanischen System zu suchen, das mit seinem Schwerpunkt auf „managed care“ und Kostendämmung bei psychiatrischen Patienten eine Verweildauer von durchschnittlich weniger als einer Woche vorsieht. Außerdem haben mehr als 50 Millionen Amerikaner für den Bereich der psychiatrischen Erkrankungen keinerlei Krankenversicherung. Schließlich ist die Versorgung chronisch psychisch Kranker in Deutschland durch gut strukturierte, gemeindepsychiatrische Programme deutlich weiter verbreitet und besser zugänglich als in den USA. Sie haben mehr als 11 Jahre in Deutschland gelebt. Werden Sie in den USA etwas von hier vermissen? Therapiegebäude haven seine Ressourcen, ähnlich den Vereinbarungen mit Schulen in New York, für Projekte des Zentralinstituts zur Verfügung stellt. Außerdem möchte ich gerne weiterhin einen kleinen Beitrag zu den laufenden Forschungsarbeiten im Biochemischen Labor leisten, wenn dies von meinem Nachfolger gewünscht wird. Da ich auch im Jahr 2007 noch für die DFG als Gutachter tätig sein und bis Ende 2008 in die fortlaufende Evaluierung Medizinischer Fakultäten in England eingebunden sein werde, werde ich sicherlich auch zukünftig ab und an das ZI besuchen. Was sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen Unterschiede zwischen Deutschland und USA bezüglich der psychiatrischen Krankenversorgung und Forschung? Wo liegen ihrer Meinung nach die ZI Aktuell 1/06 werke in Deutschland hat jedoch stark dazu beigetragen, dass die psychiatrische Forschung auf einigen Gebieten modellhaft wurde. In den USA lassen sich Ideen auch etwas schneller umsetzen, was hauptsächlich auf Gegebenheiten des deutschen Systems zurückzuführen ist. Oftmals werden wirklich neue Ideen von jungen Forschern eingebracht, die in den USA zügig vorankommen, unabhängig werden und ihre Ideen vorantreiben. Junge Forscher in Deutschland werden oft durch das System gebremst, das Lehrstuhlinhabern beträchtliche Macht zuspricht und den jungen Wissenschaftlern wenig Raum lässt, die notwendige Zeit und Ressourcen zur Durchführung eigener Ideen ohne die Kooperation des Lehrstuhlinhabers aufzubringen. Auf dem Gebiet der Krankenversorgung ist Deutschland meines 5 Sicherlich werden meine Frau und ich Deutschland sehr vermissen. Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt, haben es genossen in Heidelberg zu wohnen und beim Spaziergang durch die Gassen der Altstadt auf die Spuren vorheriger Generationen zu stoßen. Die kulturellen Vorteile dieser Region mit ihrem vielseitigen Angebot haben wir in all den Jahren sehr genossen. Vor allem Suella wird ihr Engagement und aktives Singen in der Capella Palatina sehr vermissen und ich die dazugehörigen Konzerte. Auch unsere ausgedehnten Spaziergänge durch den Odenwald in Begleitung unseres Hundes bleiben uns in bester Erinnerung, denn in den USA kennen wir derart gut gepflegte und zugängliche Waldstücke leider überhaupt nicht. Auch die Pfalz und ihre exzellenten Weine werden uns fehlen. Vor allen Dingen werden wir aber unsere Freunde vermissen, die wir in den letzten 11 Jahren gewonnen haben. Für mich persönlich gehört dazu auch die große „ZI-Familie“, und in besonderem Maße auch meine Mitarbeiter im Forschungsund Kliniksekretariat, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass fast jeder Arbeitstag am ZI Spaß gemacht hat. red www.zi-mannheim.de Ein Rückblick 30 Jahre Kinder- und Jugendpsychiatrie am ZI In unserer kurzlebigen Zeit feiert man Jubiläen schon nach zehn oder fünfzehn Jahren. Da erscheint es gerechtfertigt, nach 30-jähriger Leitung der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am Zentralinstitut Rückschau zu halten, erst recht, da diese dreißig Jahre für das Fach eine Zeit intensiver Veränderungen waren. Sie spiegeln sich vor allem in den Möglichkeiten der Patientenversorgung, in der Weiterbildung und in Themen der Forschung. Prof. Dr. Dr. Martin H. Schmidt Modifizierte Behandlungsmöglichkeiten sind heute selbstverständlich, es gibt längst nicht mehr nur die stationäre Behandlung als Alternative zur ambulanten. Tages- und nachtklinische Behandlungen wurden in das Therapiekonzept integriert, ohne, wie an manchen Orten, eine eigene Institution dafür zu schaffen. Das erlaubt eine hohe Flexibilität und entlastet Belegungsengpässe angesichts der ständigen Vollauslastung der Klinik. Diese ist nicht nur bedingt durch den Patientenzustrom aus dem Raum Ludwigshafen, sondern durch Aufnahmen, die wegen des bekannten Behandlungsstandards der Klinik weit über das Versorgungsgebiet hinausgehen. Mit dem Umbau in den Jahren 2004/2005 hat die Klinik für den stationären Anteil exzellente räumliche Verhältnisse gewonnen, so dass die Arbeit mit unseren Patienten in Gruppen zu je sechs organisiert werden konnte. Auch der Neubau der Klinikschule geht seiner Verwirklichung entgegen. Modellversuche zur Behandlung im natürlichen MiZI Aktuell 1/06 lieu - also in Familie, Kindergarten und Schule - wurden erfolgreich durchgeführt. Es ist zu hoffen, dass sie im Rahmen der jetzt konzipierten integrierten Versorgung Eingang in die Routine finden, so dass die starre Grenze zwischen ambulanten und stationären Behandlungsmöglichkeiten im Interesse der Patienten durchbrochen wird. Im Umfeld der Klinik hat sich ein Netz niedergelassener Fachärzte gebildet, die große Teile der ambulanten Versorgung übernehmen. Das Psychotherapeutengesetz hat die Engpässe vor allem mit ambulanter Verhaltenstherapie nachhaltig verbessert. Der Enquete zur Lage der Psychiatrie folgte in den Anfangsjahren des Mannheimer Lehrstuhls das Modellprogramm, das die extramurale psychiatrische Versorgung verbessern sollte. Davon sind im sozialpsychiatrischen Netzwerk für Kinder und Jugendliche noch heute Bestände erhalten. Die Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe zeigt sich nicht nur in Kontakten zu den zuständigen Jugendämtern, sondern auch in der Betreuung der therapeutischen Intensivgruppen im Wespinstift, den Nachsorgegruppen für psychisch kranke Jugendliche im Johann-Peter-Hebel-Heim, der Beratung von Heimen und der Einrichtung des Internationalen Bundes für Sozialarbeit zur beruflichen Eingliederung. Für viele Jahre konnten auch psychisch kranke Vorschulkinder der in Regelkindergärten integrierten Sondergruppen unter Anleitung der Klinik behandelt werden; finanzielle Engpässe haben das nicht länger möglich gemacht, aber die Klinik verfügt heute über gute Möglichkeiten zur Mitaufnahme von Müttern. Die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen betreffen vor allem die Psychiatrie-Personalverordnung, an deren Gestaltung von Mannheim aus mitgearbeitet wurde, und die einen, im Vergleich zu anderen Fächern, sicheren Schlüssel für ärztliches, therapeutisches und Pflegepersonal darstellt. Das Kinder- und Jugendhilferecht wurde neu gefasst und 6 kam unseren Patienten durch die Einbeziehung seelisch Behinderter in die Jugendhilfe zugute. Das Kindschaftsrecht wurde modernisiert. Die Abschaffung körperlicher Strafen wurde durch die von der CDU-/FDPRegierung eingesetzte „Gewaltkommission“, in der von Mannheim aus mitgearbeitet wurde, eingeleitet. Die gesetzlichen Änderungen schlugen sich teilweise in den Gutachten nieder, die Mitarbeiter der Klinik für Jugendstrafkammern, Familiengerichte und Verwaltungsgerichte erstellten. Vielfach neue Vorstellungen zur Pathogenese psychischer Störungen im Entwicklungsalter, die vorzugsweise auf Verlaufsbeobachtungen beruhen, haben die Therapiekon- Außenansicht der neuen Stationen 2005 zepte beeinflusst und zur deutlichen Verkürzung der Dauer stationärer Behandlungen geführt. Die Ablösung der in den siebziger Jahren noch vorherrschenden tiefenpsychologisch orientierten Kinderpsychotherapie durch eine Kombination von Verhaltenstherapie und Pharmakotherapie hat dazu wesentlich beigetragen. Aus der Familientherapie, in die seinerzeit überhöhte Erwartungen gesetzt wurden, sind wichtige Elemente in die Betreuung der Bezugspersonen unserer Patienten übernommen worden. Die Entwicklung neuer Psychopharmaka und deren spezifische Zulassung für Kinder und Jugendliche erlaubt eine zielgerechtere Behandlung und hat die Akzeptanz von Pharmakotherapie auch im Entwicklungsalter www.zi-mannheim.de deutlich verbessert. Die Leitlinien für Diagnose und Therapie der Erkrankungen, für die das Fachgebiet zuständig ist, geben einen sicheren Handlungskorridor vor. Sie gehören zum Rüstzeug des angehenden Facharztes, der nicht mehr – wie der frühere Name der Klinik – nur Kinder- und Jugendpsychiatrie, sondern ausdrücklich auch Psychotherapie umfasst. Damit hat sich der Weg zum Facharzt wesentlich erweitert. Es gelang, zusammen mit anderen Fächern am Zentralinstitut, eine Psychotherapie-Weiterbildung zu etablieren, die dem angehenden Facharzt die Inanspruchnahme auswärtiger und teils teurer Weiterbildungsmöglichkeiten erspart. Das Multiaxiale Klassifikationssystem, das in Mannheim seit Eröffnung der Klinik benutzt und inzwischen bundesweit eingeführt wurde, erlaubt eine diagnostische Verständigung mit in- und ausländischen Kollegen. Die heute gängigen Klassifikationssysteme der WHO und der Amerikanischen Gesellschaft für Psychiatrie erlauben eine differenzierte Betrachtungsweise, deren Fortschritt man nur ermessen kann, wenn man sie mit der vergleichsweise groben Kategorisierung der Achten Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten vergleicht. Lehrbücher unserer Tage sind mit denen der siebziger Jahre nicht vergleichbar. Sie zeigen überwiegend deutlich abweichende Vorstellungen über Ätiologie, Einteilung, Verlauf und Behandlung psychischer Störungen. Kurz vor Eröffnung der Mannheimer Klinik war die Zeitschrift für Kinderund Jugendpsychiatrie gegründet worden, die von Mannheim aus über dreißig Jahre mitbetreut wurde. Später kam die europäische Zeitschrift für unser Fachgebiet hinzu. Alle Mannheimer Studenten der Medizin hören während eines Semesters die klinische Übersichtsvorlesung über psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen und lernen diese im Praktikum kennen. Mehr als vierhundert Weiterbildungsnachmittage für niedergelassene Kollegen auch benachbarter Disziplinen hat die Klinik gestaltet. Wissenschaftliche Abkömmlinge der Kinder- und Enkelgeneration der Mannheimer Klinik vertreten kinderund jugendpsychiatrisches FachwisZI Aktuell 1/06 sen im deutschsprachigen Raum an zehn Fakultäten. Interessante Wandlungen haben sich in den Forschungsgegenständen auch der Kinder- und Jugendpsychiatrie vollzogen. Wissenschaftler des Lehrstuhls für Kinder- und Jugendpsychiatrie haben nicht nur in zwei Sonderforschungsbereichen mitgearbeitet, sondern die Klinik hat auch den Sprecher für beide gestellt, d.h. an Konzeption und Entwicklung mitgearbeitet. Während im Sonderforschungsbereich 116 epidemiologische Fragen im Mittelpunkt standen, deren Ergebnisse u.a. für Klassifikation und Versorgungsforschung bedeutsam wurden, zentrierte sich der Sonderforschungsbereich 258 auf modellgestützte Mehrebenenforschung im Aquarium auf der umgebauten Station Längsschnitt. Dieser Mehrebenenforschungsansatz hat in der Kinderund Jugendpsychiatrie vielfältiges Echo gefunden und fruchtbare Resultate gezeitigt. Die Längsschnittprojekte an Kohorten von Kindern bzw. Neugeborenen haben diverse Fragestellungen lösen helfen und die Mehrebenenforschung hat den Übergang zur Beantwortung neurobiologischer Fragestellungen mühelos vonstatten gehen lassen. Wissenschaftliche Mitarbeiter des Lehrstuhls haben die Möglichkeiten von Elektrophysiologie und Molekularbiologie genutzt und an multizentrischen Studien mitgearbeitet, auch als erste in Deutschland tierexperimentelle Arbeiten in unserem Fach durchgeführt. Die Klinik hat so Anschluss an das internationale Forschungsniveau gefunden. Das fand durch die Präsidentschaft der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Mitarbeit in WHO-Arbeitsgruppen sowie im Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Kinder- und 7 Jugendpsychiatrie Anerkennung. Allen Mitarbeitern, die zum Ruf der Klinik und dem wissenschaftlichen Renommee des Mannheimer Lehrstuhls beigetragen haben, gelten Dank und Anerkennung, auch für ihren Einsatz in schwierigen Zeiten und unter widrigen Umständen. Die Direktoren des Instituts, Herr Professor Heinz Häfner und Herr Professor Fritz Henn, haben die Forschung in unserem Fachgebiet gefördert. Der Ende 2005 ausgeschiedene Verwaltungsdirektor Winfried Busche, hat durch seine Bautätigkeit bleibende Möglichkeiten für eine optimale Versorgung geschaffen. Der Aufsichtsrat der Stiftung hat das unterstützt. Herr Dr. Hans Martini hat sich während seiner Zeit als Sozialbürgermeister für den Ausbau der extramuralen Versorgung gemäß seinen Zusagen aus den Berufungsverhandlungen des Jahres 1975 und während seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat für die Klinik eingesetzt, zuletzt durch sein intensives und erfolgreiches Bemühen um den Schulbau. Ihnen allen ist zu danken. Dem Nachfolger auf den Lehrstuhl sind ebensoviel Unterstützung, tüchtige Mitarbeiter und eine glückliche Hand in der Auswahl seiner Forschungsthemen zu wünschen, damit Mannheim seinen Platz in der kinderund jugendpsychiatrischen Landschaft der Bundesrepublik Deutschland behaupten kann. Vor ihm liegen die Anwendungen der Resultate von Genetik und Bildgebung auf die Störungsbilder von Kindern und Jugendlichen, die Kooperation mit vielen Abteilungen inner- und außerhalb von Mannheim, die Erhaltung des Standards von Lehre und Krankenversorgung und eine wissenschaftlich spannende Zeit. Er dürfte als Ergebnis der aktuellen Forschungstrends die Weiterentwicklung des Achsensystems der heutigen Klassifikation ebenso erleben wie die Aufhellung der gemeinsamen Elemente verschiedener Entwicklungsstörungen und die Renaissance der epidemiologischen Forschung, wenn es an die Klärung der entwicklungspsychopathologisch relevanten Gen-Umwelt-Interaktionen geht. Martin H. Schmidt www.zi-mannheim.de Kongressbericht Tagung der Biologischen Kinder- und Jugendpsychiatrie Die 13. Tagung der Biologischen Kinderund Jugendpsychiatrie fand am 1. und 2. Dezember 2005 in Mannheim statt. Diese jährlich, immer in der ersten Dezemberwoche stattfindende Veranstaltung hat zum Ziel, biologischen Themen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie einen entsprechenden Rahmen zu geben. Da die Teilnehmerzahl üblicherweise auf je drei Teilnehmer pro Tag je Universitätsklinik beschränkt ist, entsteht immer eine freundliche und intensive Atmosphäre, in der neue Projekte vorgestellt und diskutiert werden. Aufgrund einer finanziellen Unterstützung durch den Verein zur Förderung der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit e.V. konnten die großzügigen Räume der Jüdischen Gemeinde angemietet werden und der Tagung mit Vorträgen und Posterpräsentationen einen schönen Rahmen bieten. Der Einladung nach Mannheim waren 102 Teilnehmer gefolgt, die eine vielseitige und interessante Veranstaltung erleben durften. Wie schon 2003 in Aachen fanden auch dieses Jahr im Vorfeld zum Kongress zwei Vorseminare statt. Am 30. November konnten Nachwuchswissenschaftler der kinder- und jugendpsychiatrischen Universitätskliniken viel über neuropsychologische Diagnostik und Genetik lernen. Die Neuropsychologin PD Dr. Kerstin Konrad von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Aachen hielt das Seminar zum Thema Neuropsychologie. Die Seminarteilnehmer erhielten auf der Basis kognitiver Modelle eine Übersicht über neuropsychologische Testverfahren bei Kindern und Jugendlichen für Diagnostik und Differentialdiagnostik sowie deren Verwendung für wissenschaftliche Studien. Das zweite Vorseminar wurde von Prof. Dr. Johannes Hebebrand (Universität Essen) zum Thema Genetik gestaltet. Es wurde die Genetik bei den kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnosen Enuresis noc-turna und Autismus dargestellt. Außerdem lernten die Teilnehmer Strategien zur Entdeckung von ZI Aktuell 1/06 Prädispositionsgenen und erfuhren Neues über Familienstudien zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) und Störungen des Sozialverhaltens. Die Tagung startete am 1. Dezember mit den Themenblöcken Pharmakotherapie, Biofeedback in der Kinderund Jugendpsychiatrie sowie Lernen und exekutive Funktionen. Den diesjährigen, viel gelobten Gastvortrag hielt Prof. Marcella Rietschel von der Abteilung Genetische Epidemiologie am ZI mit dem Titel: „Gene halten sich nicht an das DSM!“. Die Kongressteilnehmer konnten in diesem spannenden und didaktisch sehr gut aufbereiteten Vortrag erfahren, dass bestimmte Varianten des Gens G72/G30 sowohl bei Patienten mit Schizophrenie als auch bei Patienten mit bipolaren Störungen vermehrt auftreten. Bei genaueren Analysen zeigte sich, dass das gemeinsame Symptom, das mit den Genvarianten assoziiert war, Verfolgungswahn bzw. Angst war. Diese neuen molekulargenetischen Erkenntnisse stellen ein weiteres, wichtiges Mosaik in der Identifizierung von Genen und deren Assoziation mit Syndromen bzw. Symptomen dar, regen dazu an, bisherige Diagnosekategorien zu überdenken und sind ein wichtiger Schritt in Richtung individueller Therapieansätze. Die Schwerpunktthemen des zweiten Tages waren Neuroanatomie, funktionelle Bildgebung, Neuropsychologie sowie Neurophysiologie bei Autismus, Hyperkinetischen Störungen und Schizophrenie. Posterpreise Neben den wissenschaftlichen Vorträgen gab es auch genügend Raum für die Besichtigung und Diskussion der Poster. Vor der Mittagspause wurden die Poster kurz präsentiert („one slide, one sentence“) und die Zuhörer auf den Inhalt neugierig gemacht, nach dem gemeinsamen Mittagessen gab es eine Posterbegehung mit Gelegenheit zur Diskussion und fachlichen Austausch. Die drei besten wissenschaftlichen Poster wurden von der Fachjury, 8 bestehend aus Prof. Dr. Andreas Warnke (Würzburg), Prof. Dr. Franz Resch (Heidelberg) und Prof. Dr. Alexander von Gontard (Homburg), prämiert. Den ersten Preis erhielt Dr. Lars Wöckel (Universität Frankfurt), der mit seiner Arbeitsgruppe die Geschmackswahrnehmung und die Geschmackspapillendichte auf der Zunge jugendlicher Patientinnen mit Essstörungen im Vergleich zu einer Kontrollgruppe untersucht hatte. Der zweite Posterpreis ging an eine Arbeitsgruppe vom ZI, und zwar an Dr. Yvonne Grimmer zusammen mit Dr. Dr. Pascal Frankhauser, PD Dr. Peter Bugert, PD Dr. Patrick Schloss und Prof. Dr. Dr. Martin H. Schmidt. Das Poster trug den Titel „Charakterisierung des neuronalen Dopamintransporters auf Thrombozyten“. Nach Meinung der Jury stellt die dargestellte Technik eine zukunftsträchtige Methode zur Untersuchung der Wirkungsweise des Dopamintransporters dar, der bei verschiedenen psychiatrischen Störungen eine wichtige Rolle spielt. Der dritte Preis ging nach Berlin an Dr. Stefan Ehrlich, der eine eindrückliche Kasuistik mit Komplikationen bei einer Patientin mit Anorexie darstellte. Er erhielt den Preis in Anerkennung für sein Poster „Refeeding Oedema - eine somatische Komplikation bei der Behandlung der Anorexia nervosa“. Positive Rückmeldungen gab es für die innovative Kennzeichnung der in die engere Auswahl für einen Posterpreis gekommenen Poster. So wurden die nach Meinung der Jury preisverdächtigen Poster, die in die engere Auswahl gekommen waren, schon am ersten Tag für alle ersichtlich gekennzeichnet, um insbesondere jungen Nachwuchswissenschaftlern Anreiz und Vorbilder zu geben, wie wissenschaftliche Sachverhalte anschaulich auf einem Poster präsentiert werden können. Bei der Preisverleihung betonte die Jury aber auch, dass alle der insgesamt 21 ausgestellten Poster sehr gut waren und lobte das hohe Niveau. Wissenschaftspreise Während der Tagung wurden außerdem zwei bedeutende Wissenwww.zi-mannheim.de schaftspreise in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verliehen: der Hermann-Emminghaus-Preis sowie der Kramer-Pollnow-Preis. Der erstgenannte, nach dem Pionier der deutschsprachigen Kinder- und Jugendpsychiatrie Hermann Emminghaus (1845 - 1904) benannte Preis, wird alle zwei Jahre an Forscher aus dem In- und Ausland verliehen für herausragende grundlegende Arbeiten auf dem Gebiet der Ätiopathogenese, der Diagnostik, der Therapie und/oder Prognose psychischer Störungen. Der von der Fa. Lilly gesponserte Preis, der aus der Hermann-Emminghaus-Medaille und einem Betrag von 5500 Euro besteht, wurde Prof. Dr. Christoph Wewetzer (Köln, früher Universität Würzburg) und Dr. Susanne Walitza (Universität Würzburg) für ihre herausragenden Forschungsarbeiten zur Zwangsstörung verliehen. Die Jury würdigte die wissenschaftlichen Arbeiten von Prof. Wewetzer zur familiären Komorbidität, zu formal-genetischen Zusammenhängen sowie zum Verlauf der Zwangsstörungen und Dr. Walitzas ergänzenden Studien zu molekulargenetischen Zusammenhängen. Den Preisträgern sind Erkenntnisse über eine hohe Stabilität der Zwangsstörung und die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen bei zwei Drittel der Betroffenen anzurechnen, was die Bedeutung einer frühen und möglichst nachhaltigen Therapie unterstreicht. Lobend erwähnt wurde auch die Netzwerkarbeit unter Einbeziehung der Kliniken in Aachen und Marburg und die damit verbundene große Stichprobenanzahl sowie die Verknüpfung von Längsschnitt- und Mehrebenenansatz. Im Rahmen eines feierlichen Abendessens wurde der Kramer-PollnowPreis an PD Dr. Kerstin Konrad (Universität Aachen) und ihre Arbeitsgruppe (Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Universität Aachen) in Würdigung ihrer wissenschaftlichen Leistung zur neurobiologischen Grundlage unterschiedlicher Aufmerksamkeitssysteme und um unterschiedliche Aufmerksamkeitslenkungen wie fokussierte und gedankliche Aufmerksamkeit verliehen. So sucht die Arbeitsgruppe z.B. auch nach psychophysiologiZI Aktuell 1/06 schen Korrelaten (wie autonomes Ruhearousal, Orientierungsreaktion oder Habituation auf aversive Reize) bei Kindern mit ADHS, um die Subgruppe der Kinder mit ungünstiger Prognose zu identifizieren. Die theoretische Konzeption der Gruppe um Dr. Konrad wird durch verschiedene anspruchsvolle Methoden (Augenbewegungen, fMRI, elektrodermale Antworten, neuro-psychologische Verfahren) überprüft. Dieser von der Fa. MEDICE gestiftete KramerPollnow-Preis, der in diesem Jahr zum zweiten Mal verliehen wurde, ist ein deutscher Forschungspreis für biologische Arbeiten auf dem Gebiet Preisverleihung Kramer-Pollnow Preis 2005 der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er ist mit 6000 Euro dotiert. Der Kramer-Pollnow-Sonderpreis ging an Dr. H. Heinrich (Erlangen/ München) und Dr. Ulrike Strehl (Tübingen) für ihre gut kontrollierten Studien zu Neurofeedback bei ADHS, die zeigen, dass dieses neurobiologisch basierte verhaltenstherapeutische Verfahren zu einer deutlichen Reduktion der ADHS-Kernsymptome und Verbesserung kognitiver Leistungen führt. Insgesamt können wir auf eine erfolgreiche Tagung mit spannenden, z.T. richtungsweisenden Impulsvorträgen, einer ansprechenden wissenschaftlichen Posterausstellung und lebhaften Diskussionen zurückblicken. „Young Investigators in Biological Child and Adolescent Psychiatry“ Während der Tagung, auf der viele junge Nachwuchswissenschaftler vertreten waren, wurde von Stefan Ehrlich (Charitè Berlin), Thomas Stegemann (UKE Hamburg) und Yvonne Grimmer (ZI Mannheim) die 9 Idee geboren, junge Wissenschaftler der verschiedenen Fakultäten, die im Gebiet der biologischen Kinder- und Jugendpsychiatrie forschen, mit dem Ziel intensiver(er) Zusammenarbeit und Steigerung von Qualität und Effizienz zu vernetzen. Diese innovative Idee wurde mit der Gründung von YIBcap („Young Investigators in Biological Child and Adolescent Psychiatry“, siehe im Internet unter www.yibcap.de) auch sofort in die Tat umgesetzt. Als Ziele von YIBcap benennen die Initiatoren u.a. die Weitergabe und das Teilen von Know how und Methoden, die Durchführung von Methodenseminaren, das Ermöglichen von Hospitationen, gemeinsame Projekte/multizentrische Studien, gemeinsame Kontrollgruppen und Mentoring. Eine Mailingliste und ein Diskussionsforum wurden bereits eingerichtet. Prof. Remschmidt (Universität Marburg) und Prof. Schmidt (ZI Mannheim) konnten schon gewonnen werden, als Senior Advisors zur Verfügung zu stehen. Wir danken allen Teilnehmern, Vortragenden, Poster-Präsentierenden, den Vorsitzenden der Symposien, der Posterjury, der Gastreferentin Prof. Rietschel sowie PD. Dr. Konrad und Prof. Hebebrand für die Durchführung der Vorseminare. Natürlich danken wir auch allen Mitarbeitern und kompetenten Helfern, die während der Tagung und im Vorfeld bei der Planung, Organisation, Koordination, Programm- und Plakaterstellung mitgearbeitet haben und maßgeblich am Erfolg der Veranstaltung beteiligt waren. Unser ganz besonderer Dank gilt Dr. Hans Martini und dem Verein zur Förderung der Stiftung Zentralinstitut für Seelische Gesundheit e.V. sowie den Firmen Janssen-Cilag, Lilly, Medice und Novartis für die finanzielle Unterstützung der Tagung, die ohne das Sponsoring in diesem ansprechenden Rahmen nicht möglich gewesen wäre. Eine kleine Kongressnachlese mit Fotos der Veranstaltung ist ab sofort auf der ZI-Homepage (http:// zi-mannheim.de) zu finden. Die nächste, dann 14. Tagung der Biologischen Kinder- und Jugendpsychiatrie wird im Dezember 2006 in Hamburg stattfinden. Katja Becker www.zi-mannheim.de Präventionsprojekt „Zappelphilipp“ Frühintervention bei durch Delinquenz auffällig gewordenen Kindern In den letzten Jahren sind Gewalt und Delinquenz unter Kindern und Jugendlichen verstärkt in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Berichte über vermehrte Aggressivität in Kindergärten und Schulen, steigende Kinder- und Jugendkriminalitätsraten und sexuelle Übergriffe beunruhigen Laien wie Experten gleichermaßen. 2005 sind laut Kriminalstatistik über 650 Kinder in Mannheim tatverdächtig geworden - und das ist nur die Zahl der Straftaten, die der Polizei bekannt geworden sind. Ca. 200 Neutäter im Alter von 8 bis 13 Jahren wurden von der Polizei erfasst. Was sind das nun für Kinder und Jugendliche, die diese Straftaten begehen? Frühes Auftreten von aggressiven und antisozialen Verhaltenweisen können Kennzeichen einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens sein. Ca 5% aller Kinder weisen die Symptome einer hyperkinetischen Störung auf. Die Symptome sind Aufmerksamkeitsdefizit (z.B. Ablenkbarkeit, Konzentrationsstörung), Impulsivität (plötzliches, unüberlegtes Handeln) und motorische Unruhe (Zappeln). Bei ca. 25-40% bestehen zusätzlich antisoziale Verhaltensmuster, d.h. oppositionelles Verhalten, lügen, stehlen, zeigen von Wutausbrüchen und körperlicher Aggressivität, Zerstörung von Gegenständen, zündeln, Tiere quälen usw. Dann spricht man von einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens. Die Kinder weisen schon früh (also vor dem 10. Lebensjahr) diese Symptomkombination aus. Des Weiteren zeigen Längsschnittuntersuchungen, dass dieses Störungsbild sehr stabil ist und bei 50% der 8-jährigen auch noch im Erwachsenenalter besteht. Die Behandlung dieser Kinder sollte möglichst frühzeitig erfolgen, um eine Verfestigung der Verhaltensmuster zu verhindern. Im Jahr 2003 untersuchte das Polizeipräsidium Mannheim die Gruppe der Intensivtäter genauer. Dabei stellte sich heraus, dass bei über 60% Symptome eines ADHS bestanden oder sogar die Diagnose gestellt war. Nur einer dieser IntenZI Aktuell 1/06 sivtäter nahm ein Medikament in diesem Zusammenhang, die anderen Intensivtäter befanden sich nicht in Behandlung. Eine Therapie wurde Projekt in Form einer Therapiestudie entwickelt, in dem neben bewährten Therapiebausteinen, wie Beratung und Medikamenten, die Eltern im Zappelphillip (Quelle: Heinrich Hoffmann „Der Struwwelpeter“ 1858) oft mit der Begründung abgelehnt, dass es zu aufwendig oder zu umständlich sei. Genauso oft wurde die Begründung angegeben, dass das Kind sich einer Behandlung verweigere. Durch Kinder- und Jugendkriminalität entstehen der Volkswirtschaft in mehreren Ebenen Schäden in Millionenhöhe, angefangen von der Zerstörung öffentlichen Eigentums bis zur Krankenversorgung von Geschädigten, von Jugendhilfe bis zu Justizvollzugsanstalten. Deshalb ist es naheliegend, eine Intervention auf die Zielgruppe der hyperaktiv-antisozialen Kinder abzustimmen. Dabei sind folgende Prinzipien zu berücksichtigen: Frühe Intervention ist Prävention, die Behandlung sollte im Gemeinwesen etabliert sein, damit sie allen Familien zur Verfügung stehen kann und sie sollte sich auf den Kreis der gefährdeten Kinder konzentrieren um möglichst effektiv zu sein. Ausgehend von dieser Sachlage wurde auf Anregung des Polizeipräsidiums Mannheim mit finanzieller Unterstützung des Vereins für Sicherheit in Mannheim und der Robert Bosch Stiftung eine Kooperation zwischen dem Polizeipräsidium und dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit aufgebaut. Es wurde ein 10 häuslichen Umfeld im Umgang mit ihren aggressiven und antisozialen Kindern gestärkt und unterstützt werden sollen. Das Projekt startete am 1. September 2005 und wird noch bis August 2007 fortgeführt Eltern, deren Kinder erstmalig straffällig geworden sind, kommen immer in den Kontakt mit den Jugendsachbearbeitern der Polizei. Diese überprüfen jetzt anhand eines einfachen Rasters, ob die Kinder für das Projekt in Frage kommen. Bei Einwilligung werden die Daten der Kinder in einer speziellen Datei erfasst und an das Zentralinstitut übermittelt. Von dort aus wird Kontakt mit den Familien aufgenommen und nach deren Einverständnis eine kinderpsychiatrische Diagnostik durchgeführt. In Abhängigkeit der Symptomatik erfolgt eine Intervention, die aus einer Kombination von Beratung, ggf. Medikation und Behandlung zu Hause (Hometreatment) besteht. Das Hometreatment erfolgt zweimal die Woche über einen Zeitraum von 16 Wochen. Danach findet eine erste Auswertung der Maßnahme statt. Um die langfristige Wirksamkeit dieser Maßnahme zu erfassen, soll der Verlauf der Kinder für über zehn Jahre verfolgt werden. Gerhard Ristow www.zi-mannheim.de Nichtrauchen in 6 Wochen Qualifizierte Tabakentwöhnung am ZI Die Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim startet ein neues ambulantes Gruppentherapie-Angebot zur Tabakentwöhnung. Durch Tabakrauchen sterben in den westlichen Industrieländern mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, AIDS, Morde, Selbstmorde, illegale Drogen und Alkohol zusammengenommen. Weltweit sterben jährlich etwa 4 Millionen Menschen, in Deutschland jährlich über 100.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Das aktuelle Jahrbuch 2006 der DHS bestätigt, dass ca. ein Drittel der Deutschen Bevölkerung ab einem Alter von 15 Jahren raucht, mit steigenden Zahlen insbesondere für Frauen und Jugendliche. Der Anteil der abhängigen Raucher liegt dabei vorsichtig geschätzt bei über 50%. Viele entwöhnungswillige Raucher sind trotz hoher Motivation zur Abstinenz und trotz bereits eingetretener gesundheitlicher Folgen nicht in der Lage, das Tabakrauchen ohne professionelle Hilfe zu beenden. Dabei bestehen inzwischen mit der Kombination aus psychotherapeutischen Techniken und einer medikamentösen Unterstützung wirkungsvolle und praktikable Therapiemöglichkeiten. Verhaltenstherapeutisch werden das Konsumverhalten und der Umgang mit Versuchungssituationen verändert, medikamentös werden durch eine vorübergehende Nikotinersatztherapie körperliche Entzugssymptome reduziert. Die ambulante „Qualifizierte Tabakentwöhnung“ am ZI orientiert sich an dem etablierten Entwöhnungsprogramm des Arbeitskreises Raucherentwöhnung der Universität Tübingen. Das ambulante Behandlungsprogramm am ZI richtet sich schwerpunktmäßig an Raucher ohne weitere Substanzabhängigkeiten. Nach einer ersten Einzelinformation werden sechs Gruppenbehandlungen mit einem Behandlungstermin pro Woche à 90 Minuten durchgeführt. Jeder Kurs besteht aus 8-10 Teilnehmern. Zu Beginn der Gruppentherapie erZI Aktuell 1/06 halten die Teilnehmer ausführliche Informationen über die Entstehung und die Risiken der Tabakabhängigkeit. Vor- und Nachteile einer Tabak-Abstinenz werden erarbeitet und mit dem Betroffen zusammen gewichtet. Ziel ist eine Verstärkung der Abstinenzmotivation. Die Selbstbeobachtung soll den Stellenwert des Rauchens sowie die Funktion des Rauchens im Alltag sichtbar machen und dient der Vorbereitung auf den Rauchstopp mittels der „Punkt-Schluss-Methode“. In der zweiten Kurswoche legen die Teilnehmer einen Rauchstopptermin fest, welcher zwischen der 2. und 3. Therapiesitzung liegen soll. In den folgenden Sitzungen werden Strategien zur Reiz- und Verhaltenskontrolle vermittelt und alternative Verhaltensweisen zum Rauchen erarbeitet. Die Steigerung der Kompetenz im Umgang mit riskanten Versuchungssituationen und typischen Rückfallsituationen ist ein weiteres Hauptziel. Zur Rückfallprophylaxe werden gefährliche Situationen über Gedankenspiele und Rollenspiele „durchgespielt“ und Bewältigungsstrategien eingeübt. Zusätzlich werden alternative Methoden zum Umgang mit Stress, Konflikten, Langeweile und ähnliche Situationen mit dem Risiko zum Rückfall besprochen. Ergänzt wird das Programm durch Informationen zur Ernährungsumstellung, Gewichtskontrolle und körperlichen Bewegung. Das verhaltenstherapeutische Programm erlaubt eine Anpassung an die Situation und die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe. Jedem Raucher wird eine individuelle Empfehlung zur medikamentösen Unterstützung der Tabakentwöhnung gegeben. Alexander Diehl Christine Rockenbach Weiterführende Ziele des Projekts „Qualifizierte Tabakentwöhnung“ am ZI sind: ► ► ► ► Etablierung und Ausbau des klinischen Angebotes Sicherstellung der Finanzierung über Absprachen mit Krankenkassen und Betrieben Wissenschaftliche Evaluation der Therapieergebnisse und Grundlagenforschung zur Grundlagen der Tabakabhängigkeit Mitarbeiterschulung und Behandlung als Angebot im Rahmen einer Aufnahme des ZI in das Netz „Rauchfreier Krankenhäuser“ Die Gebühr für den gesamten 6-wöchigen Kurs zur Tabakentwöhnung beträgt 95 Euro pro Person. Zahlreiche Krankenkassen übernehmen zumindest einen Teil der Kosten dieses zertifizierten Kurses. Die Anmeldung zum Kurs erfolgt telefonisch ab sofort unter der Nummer: 0621 - 1703 3503. 11 www.zi-mannheim.de Nimmt der Alkoholkonsum im Alter ab?? Eine Verlaufsstudie zu Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit bei Bewohnern in Mannheimer Altenpflegeheimen (1995-2003) Aus Bevölkerungsstudien geht hervor, dass Konsum, Missbrauch und Abhängigkeit von Alkohol im höheren Alter rückläufig sind. Beispielsweise ergab die Oberbayern-Studie (Dilling und Weyerer 1984), dass die Prävalenz von 3,1% behandlungsdürftigem Alkoholismus in der Gruppe der sum von Alkohol vor (Bühringer et al., 2000). Dabei zeigte sich, dass der riskante Alkoholkonsum bei den Frauen ab dem 50. Lebensjahr abnimmt, bei den Männern erst ab 60 Jahren. Für den insgesamt geringeren Anteil älterer Alkoholabhängiger Alkohol ist das Suchtmittel Nr. 1 in Deutschland 45-64-Jährigen auf 0,7% bei Personen ab dem 65. Lebensjahr zurückging. Bei den 70-Jährigen und Älteren, die Anfang der neunziger Jahre im Rahmen der Berliner Altersstudie untersucht wurden, lag die Prävalenz einer Alkoholkrankheit oder eines Alkoholmissbrauchs (DSM-III-R-Nr. 303.90, 305.00) bei 1,1% (Helmchen et al. 1996). Bundesweite Studien, die auch ältere Menschen einschließen, liegen für den riskanten KonZI Aktuell 1/06 sind unterschiedliche Gründe verantwortlich: Wegen der um ein Vielfaches höheren Mortalitätsrate von Alkoholikern erreichen nur relativ wenige ein höheres Lebensalter. Altersbedingte Veränderungen des Stoffwechsels führen zu einer Abnahme der Alkoholtoleranz. Im höheren Alter häufiger auftretende gesundheitliche Beschwerden und chronische Erkrankungen führen zu einer Reduktion des Alkoholkonsums. Im 12 Vergleich zu älteren Menschen in Privathaushalten ist der Anteil Alkoholkranker in Einrichtungen der stationären Altenhilfe überdurchschnittlich hoch. Amerikanischen Studien zufolge (Joseph et al., 1995, Brennan, 2005) sind bis zu 26% der Bewohner in Pflegeheimen für Kriegsveteranen aktuell alkoholkrank und bis zu 49% erfüllen die Kriterien für eine frühere (lifetime) Alkoholdiagnose. Im deutschsprachigen Raum liegt bislang lediglich eine von uns in den neunziger Jahren durchgeführte Studie vor. Eine Untersuchung von nahezu 2000 Heimbewohnern in 20 Mannheimer Alten- und Pflegeheimen ergab, dass bei Heimeintritt 7,5 % der Bewohner (19,3 % der Männer und 3,8 % der Frauen) alkoholkrank waren (Schäufele et al., 1998; Weyerer et al., 1999). In Einrichtungen der stationären Altenhilfe leben keineswegs nur ältere Menschen. Verschiedene Studien in Alten- und Pflegeheimen in Deutschland haben ergeben, dass etwa 8 bis 9% der Bewohner unter 65 Jahre alt sind (Hönig et al., 1999). In der Gruppe der jüngeren Bewohner finden sich neben schizophrenen Patienten und Patienten mit geistiger Behinderung vor allem alkoholkranke Bewohner. Ziele der Untersuchung Nach einer Querschnittserhebung (1995/1996) vor Einführung der stationären Pflegeversicherung (1. Juli 1996) haben wir in Altenpflegeheimen der Stadt Mannheim zwei weitere Querschnittsuntersuchungen 1997/1998 und 2002/2003 durchgeführt. Zu allen drei Zeitpunkten konnten jeweils über 1.200 Bewohner in den gleichen 13 Mannheimer Einrichtungen einbezogen werden. Es wurden folgende Fragen untersucht: www.zi-mannheim.de ► Wie häufig wird von Ärzten eine Alkoholdiagnose bei Heimeintritt gestellt und wie hoch ist nach Einschätzung des Pflegepersonals der aktuelle Alkoholmissbrauch? ► Welche soziodemographischen und klinischen Merkmale (Einschränkungen der Alltagsaktivitäten, Verhaltensauffälligkeiten) haben Heimbewohner mit Alkoholproblemen? Angesichts des sehr hohen Anteils von Heimbewohnern, die vor allem wegen einer demenziellen Erkrankung nicht befragt werden konnten, verwendeten wir bei der Datenerhebung zwei Quellen: ► die Pflegedokumentation: zur Erfassung von soziodemographischen Merkmalen, Aufenthaltsdauer, gesetzlicher Betreuung, Pflegestufen nach SGB XI, ärztlichen Diagnosen einschließlich Alkoholdiagnosen bei Heimeintritt und medizinischer Behandlung ► die Fremdbeurteilung durch qualifizierte Pflegepersonen, die die wichtigsten Interaktionspartner für die Heimbewohner sind: Mit Hilfe eines standardisierten Beurteilungsbogens wurden - bezogen auf die letzten vier Wochen ► Pflegebedürftigkeit, kognitive Beeinträchtigung, Verhaltensauffälligkeiten, Teilnahme an Aktivitäten, freiheitseinschränkende Maßnahmen (Fixierung), und Alkoholkonsum (differenziert in keinen, unauffälligen und missbräuchlichen Konsum) erfasst Ein solches Vorgehen mit Hilfe eines standardisierten und zeitökonomischen Untersuchungsinstruments liefert quantifizierbare Daten für alle, auch für körperlich, kognitiv und sensorisch schwer beeinträchtigte Heimbewohner. Ergebnisse und Folgerungen für die Praxis Ausgehend von den ärztlichen Diagnosen bei Heimeintritt wiesen zu allen drei Querschnitten ZI Aktuell 1/06 etwa 10% der Bewohner eine Alkoholdiagnose nach ICD 10 auf, wobei -ebenfalls stabil über die Zeit- ein Viertel der Männer und 5% der Frauen betroffen waren. Dabei dürfte die Dunkelziffer relativ hoch sein: Beispielsweise ist aus der oberbayerischen Feldstudie bekannt, dass nahezu die Hälfte der von psychiatrisch geschulten Interviewern identifizierten Alkoholkranken vom Hausarzt nicht erkannt wurde (Weyerer et al., 1981). Man muss deshalb davon ausgehen, dass von den Hausärzten nur schwerere Erkrankungen diagnostiziert wurden und der tatsächliche Anteil alkoholkranker Bewohner zum Zeitpunkt des Heimeintritts höher sein dürfte. Zu allen drei Querschnitten zeigten die Bewohner, die bei Heimeintritt eine Alkoholdiagnose hatten, im Vergleich zu den Bewohnern ohne Alkoholdiagnose signifikante Unterschiede bei einer Reihe von Merkmalen: ► das Alter zum Zeitpunkt des Heimeintritts war bei Alkoholkranken mit 62 Jahren wesentlich niedriger im Vergleich zu Nichtalkoholkranken (78 Jahre) ► über die Hälfte der Alkoholkranken, aber nur jeder vierte Nichtalkoholkranke war ledig oder geschieden ► vermutlich auch aufgrund des geringeren sozialen Netzes erhielten Alkoholkranke signifikant seltener Besuch von Verwandten und Angehörigen ► innerhalb von sieben Jahren nahm der Anteil der Heimbewohner mit einer gesetzlichen Betreuung zu, zu allen drei Zeitpunkten war der Anteil gesetzlich Betreuter bei den Alkoholkranken höher im Vergleich zu den Nichtalkoholkranken. Verglichen mit den ärztlichen Alkoholdiagnosen bei Heimeintritt ist die Prävalenz des aktuell von den Pflegekräften eingeschätz- 13 ten Alkoholmissbrauchs 1995/96 mit 4,2% (Männer: 7,5%; Frauen: 3,1%), 1997/98 mit 5,2% (Männer: 11,8%; Frauen: 2,9%), und 2002/2003 mit 2,2% (Männer: 7,8%; Frauen: 1,0%) wesentlich niedriger. Über die Hälfte der Bewohner, die zum Zeitpunkt der Heimaufnahme eine Alkoholdiagnose hatten, waren nach durchschnittlich etwa vier Jahren alkoholabstinent. In Anbetracht der geringeren Verfügbarkeit von Alkohol in den Einrichtungen und der erheblichen kognitiven und physischen Beeinträchtigungen der Betroffenen ist dieses Ergebnis jedoch nicht überraschend. Auch in den Fällen, in denen das missbräuchliche Trinken im Heim fortgesetzt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass es im Vergleich zu der Zeit vor der Heimaufnahme reduziert wurde. Von den Bewohnern, die zum Zeitpunkt des Heimeintritts keine Alkoholdiagnose hatten, stellte das Pflegepersonal bei 1,9% (1995/96), 2,8% (1997/98) und 1,2% (2002/03) einen Alkoholmissbrauch fest. Bewohner mit Alkoholproblemen stellen eine besondere Herausforderung für die Pflegekräfte dar: Die Hälfte der Bewohner mit aktuellem Alkoholmissbrauch zeigte ein aggressives und unkooperatives Verhalten gegenüber dem Pflegepersonal; bei der Gruppe ohne Alkoholmissbrauch traten diese Probleme dagegen nur bei etwa 25% auf. Auf die Anforderungen von Bewohnern mit Alkoholproblemen sind die Pflegekräfte nur unzureichend vorbereitet. Eine Schulung des Pflegepersonals im Umgang mit Alkoholkranken, eine adäquate personelle Ausstattung sowie eine konsiliarische Beratung durch qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Suchtberatungsstellen sind dringend erforderlich. In den Suchteinrichtungen wird nach wie vor nur ein sehr geringer Anteil älterer Menschen versorgt. Obwohl nahezu jeder vierte Deutsche 60 Jahre und älter ist, liegt der Anwww.zi-mannheim.de teil der 60-jährigen und älteren Alkoholabhängigen sowohl in den ambulanten als auch in den stationären Suchteinrichtungen nur bei etwa 5% (Welsch und Sonntag 2003). Viele Altenpflegeheime scheinen Versorgungsfunktionen für alt gewordene Alkoholkranke zu erfüllen. Bühringer et al. (1998) kritisieren zu Recht, dass die meisten Suchteinrichtungen bereits ein Alter ab 60 Jahren als Kontraindikation betrachten. Hier wird es notwendig sein, auch in den Spezialeinrichtungen für Suchtkranke geeignete Angebote für ältere Menschen zu schaffen. Aufgrund der demographischen Veränderungen mit der stetigen Zunahme des Anteils älterer Menschen nimmt auch die Behandlung von Alkoholkrankheiten in dieser Altersgruppe zu. Die bisherigen Erfahrungen mit der Therapie älterer Alkoholkranker zeigen generell (Oslin 2004), dass motivierte ältere Patienten eine günstige Prognose haben können, wenn ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt und geeignete Behandlungsmöglichkeiten angeboten werden. Das Thema des Schwerpunktes für 2006 der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) widmet sich dem Thema Sucht und Alter unter dem Motto: „Unabhängig – Tabak, Alkohol und Medikamente, es ist nie zu spät für Veränderung“. Es ist zu hoffen, dass diese Initiative nicht nur zu einer besseren Behandlung suchtkranker älterer Menschen beitragen wird, sondern auch wichtige Impulse für die bislang sehr defizitäre Forschung auf dem Gebiet „Sucht und Alter“ geben wird. (Literatur bei den Verfassern) Siegfried Weyerer Martina Schäufele Ingrid Hendlmeier ZI Aktuell 1/06 Neue Bezeichnung für alte Inhalte? Gesundheits– und Krankenpflege im Kontext suchtmedizinischer Behandlung Seit 2004 ist die Berufsbezeichnung Krankenschwester und Krankenpfleger ersetzt durch die Bezeichnungen Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Krankenpfleger. Analog sind die Bezeichnungen in der Kinderkrankenpflege ebenfalls geändert. Krankenpflege mit neuer Bezeichnung für alte Inhalte? Neues Etikett für Altbekanntes? Diese Fragen stellen sich, wenn man sich mit dem aktuellen Paradigmenwechsel in der Pflege auseinandersetzt. Medizin und Pflege befinden sich, bedingt durch ökonomische Anforderungen in Verbindung mit steigenden Qualitätserwartungen, in einem stetigen Wandel. Die Pflege ist dabei, sich von der Krankenpflege zur Gesundheits- und Krankenpflege zu entwickeln. Innerhalb der Gesundheitsversorgung ist eine bedeutende Aufgabenstellung damit verbunden. Diese Aussage werden durch folgende Fakten gestützt: ► Das Aufgabenspektrum ist breit gefächert. Aufgaben strukturell-organisatorischer Art werden ebenso übernommen wie medizinisch/therapeutische und pflegefachliche Aufgaben. ► Das Basiswissen setzt sich aus den Erkenntnissen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen (Medizin, Psychologie, Sozialwissenschaften) zusammen und wird durch pflegewissenschaftliche Erkenntnisse erweitert. Da sich die Pflegewissenschaft erst relativ kurze Zeit als wissenschaftliche Disziplin etabliert hat, ist der Zuwachs an wissenschaftlich belegten Erkenntnissen im Bereich der direkten Pflege unschwer zu erklären. ► In Ergänzung zur Medizin, die sich auf Krankheiten, deren Heilung oder Linderung konzentriert, steht im Mittelpunkt des Interesses der Pflege die erfolgreiche Bewälti- 14 gung des Alltages eines Patienten / Klienten im Rahmen des Krankheits- und Gesundungsprozesses. ► Durch die Ausrichtung des Pflegehandelns nach den Prämissen des Pflegeprozesses, die Verwendung spezifischer Instrumente zur Durchführung von Assessments und nicht zuletzt durch den Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung, kommen die Kernkompetenzen gezielt zum Tragen. Die Pflegetätigkeit im jeweiligen Behandlungsumfeld wird begründeterweise unverzichtbaren Bestandteil der Behandlungsplanung. Externe und interne Evidenz sind dabei von besonderer Bedeutung. ► Auf die Berücksichtigung von professionellem Erfahrungswissen kann nicht völlig verzichtet werden. Es ist vielmehr erforderlich, neue Erkenntnisse bewusst zu integrieren und damit die Handlungskompetenz zu aktualisieren. Aufgaben der Pflege Suchtmedizinische Behandlung bedingt konzeptionell klare und eindeutige Strukturen, die abgestimmt sein müssen im regionalen Behandlungsnetz und mit den Suchthilfeeinrichtungen. Beispielhaft und für die konkrete Akutbehandlungssituation der Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten und der Suchttagesklinik möchte ich hier die Qualifizierte Entzugsbehandlung in Erinnerung bringen. Dieses Therapiekonzept stellt für die Pflege ausgezeichnete Rahmenbedingungen dar. Für die Aufgabenstellung in diesem speziellen Kontext sind fundierte Kenntnisse aus dem Bereich somatische Medizin und Pflege ebenso unerlässlich wie die speziellen Fachkenntnisse der Suchtmedizin und ihre spezifischen Pflegeanforderungen. Die traditionellen Aufgaben von Pflegefachkräften sind auch im Bereich der Suchtmedizin vorzufinden. www.zi-mannheim.de Im Einzelnen heißt das: ► teilnehmende Beobachtung der Patienten ► Organisation einer Behandungseinheit ► Management der therapeutischen und diagnostischen Angebote ► Eingehen auf die Grundbedürfnisse der Patienten ► Mitverantwortung für das therapeutische Milieu einer Station ► Freizeitgestaltung Mit der Differenzierung im Bereich der medizinischen Gesundheitsversorgung, u.a. bedingt durch den beträchtlichen Erkenntnisgewinn, entwickelt sich die Krankenpflege zu einem Aufgabenbereich im Spektrum der Gesundheitsberufe. Gesundheits- und Krankenpflege wird von professionell Tätigen ausgeübt, die aus den Bereichen Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege kommen, optimalerweise ergänzt um die Kompetenzen, die durch die entsprechenden Fachweiterbildungen komplettiert werden. Bezieht man dies wiederum im engeren Sinne auf den Fachbereich der Suchtmedizin kann festgestellt werden, dass für die konkreten Aufgaben ein breit gefächertes Angebot von Pflegekompetenzen und Qualifikationen zur Verfügung steht. Qualifikationen Geht man aus Transparenzgründen zunächst von den Personen aus, die die Pflege ausführen, so kann man unterschiedliche Qualifikationsniveaus beschreiben. Basisqualifikation ist die Ausbildung in Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Aktuelle Tendenzen lassen eine Entwicklung zu einer integrierten Pflegeausbildung erkennen, die die aktuelle Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie die Altenpflege in einer gemeinsamen Basisqualifikation zusammenführt. Die ersten Auszubildenden eines Modellprojekts in Speyer werden voraussichtlich in 2006 ihre praktische psychiatrische PflegeausZI Aktuell 1/06 bildung im Zentralinstitut absolvieren. Darüber hinaus gibt es andere Ausbildungsmodelle, die die berufliche Ausbildung mit dem Erwerb eines akademischen Grades verbinden. Damit wird eine Basisqualifikation für wissenschaftliches Arbeiten begründet. Ein breit gefächertes Studienangebot im Fachhochschulbereich steht darüber hinaus zur Kompetenzerweiterung zu Verfügung. Die Basis für evidenzbasierte Pflege wird hier fundiert gesichert. Die speziellen Qualifikationen für die Anforderungen der Pflege im Bereich der Suchtmedizin werden nicht zuletzt durch die berufliche Weiterbildung ermöglicht. An Einrichtungen, wie die der Weiterbildungsstätte am Zentralinstitut (www.zi-mannheim.de /ausbild_ pfl ege.html), werden die notwendigen Kompetenzen vermittelt. Die Stationen der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin stehen als Ausbildungsort für die praktische Weiterbildung zu Verfügung. Absolventen der Weiterbil- Suchttagesklinik in J4 dung geben dabei ihr Wissen als Mentoren bzw. künftig als Praxisanleiter weiter. Ab 2006 wird auch die Suchtmedizinische Tagesklinik in diese Aufgabenstellung mit einbezogen. Mit der Übernahme spezifischer therapeutischer Aufgaben können die Weitergebildeten beauftragt werden. Die Vermittlung von Entspannungsverfahren (Progressive Muskelrelaxation und Phantasieund Märchenreise), die Übernahme von soziotherapeutischen Aufgaben (Alltagsbewältigung) 15 und psychotherapeutischen Aufgaben (Psychoedukation, Motivationsstärkung) ist fachkompetent möglich. Kompetenzen für eine suchtspezifische Krisenbewältigung werden ebenfalls erworben. Hierfür sind u.a. spezielle Gesprächsführungstechniken besonders hilfreich und nicht zuletzt das Wissen und die Handlungskompetenz in Bezug auf medizinisch/ pflegerischen Behandlungskonzepte z.B. bei Vorliegen einer Intoxikation, eines Entzugssyndroms mit Delirium, einem Entzugsanfall und in somatischen Krisen kardialer, neurologischer oder internistischer Art. Weitere Schwerpunkte erweitern den Aufgabenbereich der Pflege. Dies sind Beratung und Gesundheitsförderung. Bezugspflege Über die spezifisch therapeutisch definierten Aufgaben hinaus, ist der Beziehungsarbeit zwischen Patient und Pflegendem Beachtung zu schenken. Pflege defi niert ihre Funktion nicht nur über den Krankheits- und Genesungsprozess, sondern auch über eine positiv verstärkende, gesundheitsfördernde Unterstützung des Patienten. Der Veränderungsprozesses, den der Patient durchlebt, wird hier zielgerichtet begleitet. In der Pflegefachterminologie bedeutet dies: Praktizieren einer geeigneten Form von Bezugspflege. Hierin wird dem Patienten und seinen Bezugspersonen vermittelt, dass ihre aktuellen Bedürfnisse und Anliegen beachtet und respektiert werden. Diese Vermittlung ist eine aktiver Handlungsprozess der durch bewusstes Einbeziehen der Patienten und ihrer Bezugspersonen in die pflegerische Aufgabenstellung, die Beseitigung von Wissensdefiziten und die Beratung im Hinblick auf eine gesundheitsfördernde Lebensweise beinhaltet. Hieraus ergeben sich deutliche Hinweise, inwieweit Pflegefachkräfte über Potentiale verfügen, die im Rahmen neuer Behandlungskonzeptionen im Hinblick auf die Entwicklungen von Disease-Managementprogrammen und anderen integrierten Versorgungsformen abgerufen werden können. Bezugswww.zi-mannheim.de pflege kann als eine Basisqualifikation für Case Management verstanden werden und bei einer bewussten Ausrichtung auf die entsprechenden Kontextbedingungen die verantwortliche Wahrnehmung von Koordinations- und Beratungsfunktionen begründen. Die Grenzen der klassischen Behandlungsformen (stationär, teilstationär, ambulant) werden dabei überschritten. Das bedeutet, dass hier-mit weitere Möglichkeiten eröffnet werden - gerade im Bereich künftiger suchtmedizinischer Behandlungskonzepte. Ein Teil des Personenkreises, der zum einen Behandlungsrelevanz aufweist, zum anderen aber bisher nicht in das Behandlungsnetz eingebunden werden konnte, kann so erreicht werden. Die Chance, damit einen möglichen ständigen sozialen Abstieg zu verhindern und eine Lebensqualität zu erreichen, die Zukunftsperspektiven wieder eröffnet, werden für die Betroffenen erfahrbar. Damit wird eine wichtige Ressource geschaffen, die für die Bewältigung der Suchtproblematik von Bedeutung ist.Dies alles gelingt um so besser, wenn diese Zielrichtung von Pflege in Verbindung mit den Kompetenzen der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pflegern mit den anderen medizinisch/therapeutischen Gesundheitsberufen und ihren Aufgabenstellungen integrativ verbunden ist. Die Eröffnung des Suchtzentrums mit Suchtmedizinischer Tagesklinik ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Realisierung einer adäquaten Suchtmedizinischen Versorgung der Stadt Mannheim und der Region Rhein-Neckar. Pflege ist daran beteiligt. Das stelle ich als Leiter des Pflegedienstes am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit und Pflegedienstleiter der Klinik für Suchtmedizin und Abhängiges Verhalten mit Genugtuung und erfreut fest. Die pflegerischen Mitarbeiter in der suchtmedizinischen Versorgung wirken erfolgreich im multiprofessionellen Team und ich bin mir sicher, dass sie sich einer interessanten attraktiven Aufgabe mit viel innovativen Anteilen stellen. Hans-Werner Schiel ZI Aktuell 1/06 Deeskalationsmanagement Umgang mit Aggression und Gewalt Ende der 90er Jahre kam es zu einem „gefühlten“ Anstieg von körperlichen Übergriffen und Verletzungen, an die Berufsgenossenschaft gemeldete Unfälle aufgrund Patienteneinwirkung sowie Bitten an die Pflegedienstleitung für mehr Wissen und Handlungskompetenz im Bereich Aggression und Gewalt Sorge zu tragen. Damals wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, den Bereich „Aggres- Befreiender Haltegriff sion und Gewalt“ am Zentralinstitut zu beleuchten, Optimierungsvorschläge zu erarbeiten und den Prozess zu begleiten. Diese Arbeitsgruppe existiert nach wie vor und ist im Wesentlichen auch für die „Umbauarbeiten“ im Aggressionsmanagement verantwortlich. Vorgehensweise Eine extern durchgeführte Befragung der Mitarbeiter und die dadurch vorhandenen valide evaluierten Daten gaben den Anstoß, den gesamten Bereich Krisenmanagement neu zu überdenken. So waren beispielsweise 55,3% der Befragten der Meinung, dass ein Konzept zum sicheren Umgang mit Patienten nicht vorliege (n=150) und 72,3% fanden sich im Hinblick auf körperliche Übergriffe nicht ausreichend ausgebildet. (n=148) Daraus entstand das Konzept eines Kriseninterventionsteams, 16 das sowohl durch Schulungen im verbal-deeskalierenden Bereich als auch im taktilen Umgang bei bereits eskalierten Situationen K r is e nm ana g e m e nt f unk t i o n e n übernehmen kann. Neben dem Deeskalationsmanagement als Tagesfortbildung und dem kontrollierten Üben von Fixierungssituationen stellt das monatliche Üben der erlernten Techniken einen wichtigen Teil dar. Aktueller Stand Bereits jetzt lässt sich anhand der aktuellen Rückmeldungen und Einschätzungen feststellen, dass durch die installierten Maßnahmen ein deutliches Plus im Bereich Sicherheit und Handlungskompetenz erreicht wurde. Die Akzeptanz der angebotenen Fortbildungen ist hoch und die Nachfrage wächst im gesamten multiprofessionellen Bereich. Einen weiteren wesentlichen Punkt stellt die zunehmende Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen dar. Die Nachbesprechung eskalierter Situationen zeigt, dass regelmäßiges Üben und das Absprechen des Vorgehens unangenehme Folgen reduzieren. Besonders für die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege gilt daher, dass die in Fortbildungen verbrachte Zeit eine sinnvolle Investition darstellt. Derzeit wird die Tagesfortbildung von zwei Fachpflegern aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters angeboten, die das Konzept dazu selbst entwickelt und auch in anderen Zusammenhängen erfolgreich eingeführt haben. Erfahrungen und Schlussfolgerungen In einem Feld vielfältiger Angebote, die sich im Bereich Umgang mit Aggression und Gewalt gebildet haben, haben wir ein eigenes Konzept gefunden, welches durchaus Modellcharakter haben könnte und in unserem Haus zu einer anhaltenden Verbesserung geführt hat. Patienten und Mitarbei- www.zi-mannheim.de ter profitieren gleichermaßen, die Evaluation sowie die Modifizierung der Maßnahmen erfolgt unter Einbeziehung sämtlicher beteiligter Gruppen. Fortbildungen werden kontinuierlich angeboten. Im September 2005 fand im Zentralinstitut eine Veranstaltung zum Thema „Umgang mit Aggression und Gewalt“ statt, an der 100 Kollegen aus Kinder- und Jugendpsychiatrischen Kliniken und Abteilungen teilnahmen. Organisiert und eingebettet in unseren Arbeitskreis Südwest gab es sehr positive Rückmeldungen, speziell auch über das „Deeskalationsmanagement“, wie es in unserem Haus entwickelt wurde und umgesetzt wird.Anfang Dezember 2005 haben wir unser Konzept im Rahmen eines pflegewissenschaftlichen Kongresses, dem „2. Dreiländerkongress - Pflege in der Psychiatrie“ in Bern vorgestellt und mit der Fachöffentlichkeit diskutiert. Poster, Workshop und Vortrag haben den derzeitigen Stand in unserem Haus vermittelt und Kontakte und Austauschsmöglichkeiten ermöglicht, die für das Weiterentwickeln unseres Konzeptes enorm wichtig sind. Insgesamt lässt sich feststellen, dass wir auf einem sehr guten Weg mit einem erfolgreichen Konzept sind, welches wir in den nächsten Jahren evaluieren und weiterentwickeln wollen. Rückmeldungen über Erfahrungen mit Gewalt im Haus oder über die Teilnahme an der Tagesfortbildung „Deeskalationsmanagement“ sind erwünscht und gewollt. Unser Arbeitskreis hat sich in der Zusammensetzung verändert, aktuell sind folgende Kolleginnen und Kollegen an der konzeptionellen Weiterentwicklung beteiligt: Dr. Almut Betzen (Betriebsärztin), Prof. Dr. Harald Dreßing (Leiter Bereich Forensische Psychiatrie), Birgit Reichert (Fachkrankenpflegerin), Hans-Werner Schiel (Leiter Pflegedienst), Claus Staudter (Leitender Krankenpfleger der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters). Claus Staudter ZI Aktuell 1/06 Wenn wir hören, was wir fühlen Emotionale Verarbeitung bei Tinnitus Tinnitus Der Begriff Tinnitus (aus dem lateinischen, tinnire = klingeln) steht allgemein für die Wahrnehmung von Tönen oder Geräuschen, denen keine äußere Schallquelle zugeordnet werden kann. Häufigkeit Tinnitus stellt ein in der Bevölkerung weit verbreitetes Phänomen dar. Eine repräsentative Umfrage in Deutschland aus dem Jahre 1999 von Pilgramm und Kollegen zeigte, dass etwa ein Viertel der Deutschen im Laufe ihres Lebens zumindest kurzzeitig von Ohrgeräuschen betroffen ist. Viele Menschen haben schon einmal ein Ohrensausen nach einem Konzert oder Discothekenbesuch erlebt, das aber oft nach wenigen Minuten oder Stunden wieder abgeklungen ist. Etwa 4% aller Bundesbürger geben allerdings ein Ohrgeräusch an, das länger als ein Jahr andauert. Bedenklich ist, dass sich von den Tinnitusbetroffenen etwa 15% aufgrund des Ohrgeräusches und seiner Begleiterscheinungen wie Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafproblemen in ihrer Lebensqualität stark beeinträchtigt fühlen. Tinnitus kann dabei nicht nur mit körperlichen sondern oftmals auch mit deutlichen psychischen Beschwerden einhergehen, die sich in entsprechenden Emotionen wie Hilflosigkeit oder Angst widerspiegeln. Diese Emotionen können sich im Laufe der Chronifizierung massiv auf die Lebensqualität und die psychische Gesundheit der Betroffenen auswirken und sogar in Selbstmordversuchen gipfeln. Entstehung Bisherige diagnostische und therapeutische Ansätze grün- 17 den auf komplexen Modellen zur Entstehung des Ohrgeräusches, die sowohl Organschädigungen im Innenohr wie auch neuronale plastische Veränderungen auf verschiedenen Stufen der Hörbahn annehmen. Insbesondere das Modell von Jastreboff und Kollegen aus den 90er Jahren bietet interessante Erklärungsansätze zur Entstehung und Chronifizierung des Tinnitus. Es stellt Annahmen darüber an, wie die Wahrnehmung des Tinnitus im Zusammenhang mit psychischen Prozessen auf der Basis plastischer neuropsychologischer Mechanismen entsteht und aufrechterhalten wird. Fehlende oder defizitäre Gewöhnungsprozesse an das Geräusch bei den Betroffenen werden demnach über Hirnstrukturen vermittelt, die vor allem emotionale Informationen verarbeiten. Diese zentralnervösen Veränderungen gehen auch einher mit einer veränderten emotionalen Verarbeitung, die sich möglicherweise auch in Maßen wie der Herzaktivität widerspiegelt. Die Vorstellung geht dahin, dass durch wiederholte parallele Aktivierung die Hirnareale, die für das Hören zuständig sind, mit den Hirnarealen, die für die emotionale Verarbeitung zuständig sind, über neuroplastische Prozesse stärker miteinander verbunden werden. Schließlich bilden sich dem Modell nach zwischen dem Hörzentrum und den Strukturen der www.zi-mannheim.de emotionalen Verarbeitung, dem sogenannten limbischen System, neuronale Rückkopplungsschleifen aus. Damit könnte nicht nur die Wahrnehmung des Ohrgeräusches Emotionen wie Angst und Hilflosigkeit auslösen oder verstärken. Es könnten auch umgekehrt bestimmte mit dem Ohrgeräusch verknüpfte Emotionen die Wahrnehmung des Ohrgeräusches auslösen und verstärken. Diese Rückkopplungsschleifen könnten so zu einer Chronifizierung der Ohrgeräusche beitragen. Studie am ZI Bisher sind nur Teilaspekte dieser Modellannahmen ansatzweise überprüft, obwohl populäre Behandlungsansätze wie die Tinnitus Retraining Therapie auf den Annahmen des Jastreboffschen Modells gründen. Am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am ZI wurde unter Leitung von Prof. Herta Flor daher eine Studie zur Emotionalen Verarbeitung bei Tinnitus durchgeführt. Ziel war es, die Modellannahmen Jastreboffs zur Entstehung und Chronifizierung des Tinnitus zu überprüfen. Dazu wurden während der Betrachtung emotional gefärbter Bilder bei Tinnitusbetroffenen zentralnervöse Maße sowie autonome Maße als Indikatoren emotionaler Verarbeitung erhoben. Als zentrale Maße wurden ereigniskorrelierte Potentiale im Elektroencephalogramm (EEG) sowie BOLD-Kontraste in der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) gemessen. Als autonomes Maß diente u.a. die Veränderung der Herzfrequenz. Aufgrund des Modells sind mit zunehmender Tinnitusdauer stärkere neuroplastische Veränderungen erwartet und damit einhergehend veränderte zentrale und autonome Indikatoren emotionaler Verarbeitung zu erwarten. Insgesamt wurden die Daten von 15 akuten Tinnitusbetroffenen erhoben, die nicht länger als drei Mo-nate ein Ohrgeräusch berichteten, dazu die Daten von 15 ZI Aktuell 1/06 chronischen Tinnitusbetroffenen, die bereits über zwei Jahren ein Ohrgeräusch berichteten, sowie die Daten von 15 parallelisierten Kontrollprobanden ohne Ohrgeräusche. Die Durchführung der Studie wurde von der American Tinnitus Association finanziell gefördert. Chronische Tinnitusbetroffene zeigten tendenziell gegenüber akut Betroffenen und Kontrollprobanden eine stärkere Herzfrequenzveränderung bei Betrachtung der emotionalen Bilder. Weiter wurde als Ereigniskorreliertes Potential im EEG die späte Positivierung (P300 sowie Late Positive Complex) bei der Bildbetrachtung analysiert. Hier wurde zwar wie erwartet eine stärkere Positivierung auf emotionale Bilder im Vergleich zu neutralen Bildern gefunden. Allerdings unterschieden sich die drei Untersuchungsgruppen nicht bedeutsam in der Ausprägung dieser Reaktion. Sowohl die Herzrate als auch die mittels EEG gemessenen kortikalen Reaktionen stützen folglich Jastreboffs Annahme nicht, dass Tinnitusbetroffene mit zunehmender Tinnitusdauer eine verstärkte emotionale Reaktion zeigen. Zusätzlich wurde als zentralnervöses Maß die funktionelle Magnetresonanztomographie eingesetzt. Diese Methode ermöglicht es, auch die Aktivität des limbischen Systems zu untersuchen. Die chronischen Betroffenen zeigten entgegen den Annahmen erstaunlicherweise kaum bedeutsame Unterschiede zu den Kontrollprobanden. Die akuten Betroffenen dagegen zeigten bei positiven Bildern ein stärkeres Signal in der Amygdala, dem Anterioren Cingulum und in der Insula, also in Strukturen des limbischen Systems. Darüber hinaus zeigten die akuten Tinnitusbetroffenen aber auch gegenüber den chronisch Betroffenen eine stärkere Aktivierung in Regionen, die der Verarbeitung akustischer Reize zugeordnet werden können wie beispielsweise dem Heschl-Gyrus. Es scheint also gerade im Akut- 18 stadium des Tinnitus Anhalte für entsprechende Rückkopplungsschleifen zwischen emotionalen und auditorischen Hirnregionen zu geben. Bei chronischen Tinnitusbetroffenen mag eine dauerhafte plastische Veränderung möglicherweise nur bei solchen Personen zu finden sein, die sich nicht mit dem Ohrgeräusch abgefunden haben, sehr darunter leiden und eine psychische Störung wie z.B. eine Depression entwickelt haben. Solche Betroffene wurden aber nicht in der vorliegenden Studie untersucht, um Einflüsse psychischer Störungen auf die emotionale Verarbeitung auszuschließen. Jastreboffs Annahmen müssten nach der Formulierung seines Modells jedoch für alle chronischen Tinnitusbetroffene gelten, egal, wie stark sie durch ihr Ohrgeräusch belastet sind. Demnach konnten die durchgeführten Untersuchungen das Modell von Jastreboff nicht bestätigen. Ausblick Für die weitere Forschung wäre eine Längsschnittstudie wünschenswert, die akut Tinnitusbetroffene mit breit gestreuten Belastungsgraden prospektiv untersucht und Zusammenhänge mit der Aktivierung der limbischen und auditorischen Hirnareale im Laufe der Chronifizierung bzw. der Erholung näher beleuchtet. Eine solche Studie befindet sich derzeit am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie am ZI in Planung. Außerdem werden im Rahmen des Süddeutschen Brain-Imaging-Centers in Kooperation mit dem DKFZ Heidelberg geräuscharme Sequenzen für die fMRT-Messungen entwickelt. Diese neue Meßmethode wird es ermöglichen, emotionale Verarbeitungsprozesse mit akustischen Reizen, also in der tinnitusspezifischen Modalität, bei Tinnitusbetroffenen zu untersuchen. Maren Struve www.zi-mannheim.de Strahlenschutz Zertifizierung und Perspektiven der Neuroradiologie am ZI Im Abstand von zwei Jahren werden alle radiologischen Arbeitsplätze des Landes durch die „Ärztliche Stelle der Landesärztekammer Baden-Württemberg“ überprüft. Gegenstand der Prüfung ist die technische Optimierung der Röntgenuntersuchungen. Dazu werden die technischen Parameter des Arbeitsplatzes anhand der z.T. täglich, z.T. auch wöchentlich vorgenommenen Testaufnahmen und der Testung des Entwicklungsvorganges mit Standards verglichen. Außerdem werden die Röntgenbilder, die für verschiedene Organsysteme an unterschiedlichen Röntgenarbeitsplätzen für einzelne Patienten gefertigt wurden, auf standardgemäße Einstellungen und Durchführung beurteilt. Ziel ist es, durch optimierte Röntgentechnik mit möglichst geringer Strahlendosis störungsfreie, diagnostische Bilder zu gewinnen, die den nationalen Standards entsprechen und somit eine optimale Auswertung ermöglichen. In 2005 wurde auch die Abteilung für Neuroradiologie geprüft. Im Ergebnis wurde das erstmalig angebotene Zertifikat für alle drei radiologischen Arbeitsplätze (Somatom AR.T, Multix/Vertix und Siregraph) erteilt. Das ist unter dem Gesichtspunkt, dass in der Abteilung sehr viele ältere und schwerkranke Patienten untersucht werden, besonders erfreulich und dokumentiert auch den Erfolg eines verständnisvollen Umgangs der Röntgenassistenten mit psychisch Kranken. Die Urkunden wurden im Warteraum der Abteilung ausgehängt und werden in die Aufklärung der Patienten bei „Strahlenangst“ mit einbezogen. Mit der Zertifizierung der radiologischen Arbeitsplätze können alle Patienten sicher sein, dass die von ihren behandelnden Ärzten für notwendig erachteten Röntgenuntersuchungen unter optimalen technischen Bedingungen mit einem Minimum an Röntgenstrahlendosis in der Abteilung für Neuroradiologie durchgeführt werden. Die Bemühungen um die Reduzierung von Untersuchungen mit ionisierender (Röntgen-)Strahlung gehen jedoch weiter. Nach mehrjährigen Vorarbeiten wird bis zum Jahreswechsel die Ausstattung der Abteilung mit einem neuen ZI Aktuell 1/06 Universal Röntgengerät AXOIOM ICONOS MD, Fa. Siemens, vertraglich fixiert sein. Danach wird die Abteilung durch digitale Bildgebung und Verwendung von Speicherfolien statt Röntgenfilmen in der Lage sein, die Röntgenstrahlen-Exposition der Patienten weiter zu reduzieren. Dies ergibt sich daraus, dass einerseits die Folien empfindlicher als Filme sind und daher eine geringere Strahlenexposition des Patienten nötig ist. Andererseits lassen die digitalen Bilder eine Nachbearbeitung zu, sodass Fehler in der Belichtung auch dann noch ausgeglichen werden können, wenn bei Verwendung von Röntgenfilmen eine neue Aufnahme mit korrigierten Belichtungswerten notwendig ist. Außerdem hat die fortlaufende Analyse ergeben, dass für die diagnostischen Fragestellungen, die mit bildgebenden Verfahren am ZI zu klären sind, die Untersuchungen im Regelfall nicht mit Röntgen-Computer-Tomographie (CT), sondern mit der Magnetresonanz-Tomographie (MRT) ohne Röntgenstrahlen-Exposition durchzuführen sind. Damit wird nicht nur die Vorhaltung eines zweiten, in (Neu-)Anschaffung und Wartung teuren Gerätes überflüssig, sondern es wird die gesetzliche Vorgabe der Röntgenverordnung konsequent erfüllt. Diese fordert die Aufklärung der Patienten darüber, ob es Methoden gibt, die ohne Exposition mit ionisierender Strahlung zum gleichen diagnostischen Ergebnis führen. Sinnvollerweise sind dann diese, nicht an die Exposition mit ionisierender Strahlung gebundenen Unter-suchungen auch einzusetzen! Nicht verschwiegen werden soll, dass mit einer konsequenten Ausrichtung auf die MRT einzelne Untersuchungen nicht mehr in der Abteilunge durchgeführt werden können. Dies ergibt sich aus Kontraindikationen für die MRT, d.h. aktive Implantate wie Herzschrittmacher und Medikamentenports, oder auch Angst des Patienten vor der Untersuchung. Leider sind aber auch einige wenige, hier im Vorfeld der Entscheidung analysierte und quantifizierte Untersuchungen betroffen, die im Vergleich besser mit CT durchgeführt werden sollten. Dies kann im Einzelfall aber in einer 19 der umliegenden Praxen oder Krankenhäuser geschehen, die aufgrund ihres anderen Aufgaben- und Untersuchungsspektrums einen Computertomographen vorhalten. In der Gesamtschau dominieren die Vorteile der konsequenten Digitalisierung der Bildgebung in der Abteilung für Neuroradiologie. Neben dem Aspekt des Strahlenschutzes ist die Digitalisierung auch Voraussetzung für ein filmloses Arbeiten in der Abteilung. Verbunden damit ist die Möglichkeit, die digitalisierten Bilder in das Intranet resp. in das in Entwicklung begriffene KIS/PACS des Instituts einzustellen und dem autorisierten Arzt auf Station unverzüglich zugängig zu machen. Dies wird nach Installation des Gerätes in der Abteilung und geeigneten Bildschirmen auf Station im ersten Quartal 2006 technisch möglich sein. Für die (autorisierte) Weitergabe von Bildmaterial, z.B. zur Einholung einer zweiten Meinung oder Behandlung eines hier gefundenen Prozesses mit z.B. chirurgischer Konsequenz, werden die Bilder auf eine CD gebrannt und dem Patienten mitgereicht. Für die Verwaltung von Terminen und Material wird ein aus dem Zentral-Computer übernommener Patientendatensatz von der Anmeldung bis zur Dokumentation und Abrechnung der Leistung verwendet werden. Damit verringern sich der Personalaufwand und letztlich auch die Fehlermöglichkeiten. Selbstverständlich hat die digitale, filmlose Bildgebung auch finanzielle Konsequenzen. Eingespart werden die Kosten, einschließlich der Wartungskosten für einen Laserprinter, die Entwicklungsmaschine und die Chemikalien. Mit dem Verzicht auf die Filmdokumentation ist eine Rationalisierung der Archivierung verbunden, indem nicht mehr Filme mit entsprechendem Raumbedarf, sondern CD archiviert werden müssen. Somit entfällt die aufwendige handschriftliche und damit mit Fehlern behafteten Beschriftung von Archivtüten und letztlich auch die Suche nach Voraufnahmen, wobei wir mit entsprechenden gemeinsamen Anstrengungen bereits jetzt erfreulicherweise nur sehr geringe Verluste verzeichnen mussten. Frank Hentschel www.zi-mannheim.de Gene halten sich nicht an die ICD! Auf dem Weg zur molekulargenetischen Klassifikation von psychiatrischen Erkrankungen am Beispiel des Gens G72 Dass an der Entstehung psychiatrischer Erkrankungen in sehr großem Maße genetische Faktoren beteiligt sind, ist seit längerem aus Familien-, Zwillings- und Adoptionsstudien bekannt. Erkrankungen wie Schizophrenie, bipolare Erkrankung, Depression oder Angststörungen gehören, wie auch Krebserkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen oder Asthma, zu den genetisch komplexen Erkrankungen. Dies bedeutet zum einen, dass die Erkrankung polygener Natur ist, d.h. mehrere Gene sind an ihrer Entstehung beteiligt, ganz im Gegensatz zu monogenen Erkrankungen, ZI Aktuell 1/06 bei denen Veränderungen (Mutationen) in nur einem Gen krankheitsauslösend sind (z.B. Mukoviszidose, Chorea Huntington, Sichelzellanämie). Zum anderen spielen bei genetisch komplexen Erkrankungen neben den genetischen Faktoren auch Umgebungseinflüsse (exogene Faktoren) eine wichtige Rolle bei der Krankheitsentstehung. Daher spricht man im Bereich der komplexen Genetik auch vom Suszeptibilitätskonzept. Ein Suszeptibilitäts- oder Vulnerabilitätsgen ist weder hinreichend noch notwendig für die Ausbildung der Erkrankung. Man geht vielmehr von einem Wechselspiel der exogenen Faktoren mit den genetischen Anlagen aus, welches ent-scheidend zum Krankheitsausbruch, zum Erkrankungsalter, zur Schwere und zum Verlauf beiträgt. Ebenso ist anzunehmen, dass die Gene untereinander interagieren und in verschiedenen Populationen auch spezifische genetische Interaktionen zum Tragen kommen können. Im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen werden auf der Grundlage mehrerer epidemiologischer Studien verschiedene exogene Faktoren als bedeutsam diskutiert, z.B. Geburtskomplikationen, Geburt im Winter, Aufwachsen im städtischen Umfeld, Traumatisierung während Kindheit und Adoleszenz und Drogen. Obwohl eine familiäre Belastung durch einen Verwandten ersten Grades mit einer psychischen Störung wie Schizophrenie oder bipolarer Störung den größten aller bisher bekannten individuellen Risikofaktoren darstellt, ebenfalls an einer solchen Störung zu erkranken, tappte man bezüglich einer genaueren Eingrenzung der genetischen Faktoren auf molekulargenetischer Ebene längere Zeit im Dunkeln. Seit Beginn der modernen psychiatrischen Genetik, also seit ca. vier Jahrzehnten, 20 haben sich Forscher weltweit bemüht, den verantwortlichen Gene mittels so genannter Kopplungsund Assoziationsstudien auf die Spur zu kommen, anfänglich mit geringem Erfolg. Erst in den letzten drei Jahren konnten erhebliche Fortschritte gemacht werden. Genetische Kopplungs- und Assoziationsstudien Kopplungsstudien haben entscheidend zur Identifikation der verantwortlichen Gene bei monogenen Erkrankungen beigetragen. Kopplungsstudien untersuchen, ob in Kollektiven von Familien mit mehreren Erkrankten die Erkrankung überzufällig häufig gemeinsam mit bestimmten genetischen Markern (d.h. bekannte genetische Variationen in regelmäßigen Abständen über das menschliche Genom verteilt) gekoppelt, auftritt. Zeigt eine chromosomale Region Hinweis auf Kopplung mit einer Erkrankung, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass in dieser Region (Lokus), das krankheitsauslösende Gen zu finden ist. Frühe Kopplungsstudien für die Schizophrenie oder die bipolare Erkrankung, die sich solcher Kopplungsanalysen in großen Familien mit mehreren Erkrankten, bedienten, zeigten allerdings keine robusten Befunde. Die Ursache hierfür liegt darin, dass sich anders als bei monogenen Erkrankungen bei psychischen Störungen keine klaren Aussagen zum Erbgang (d.h. rezessiv oder dominant) oder zum Erkrankungsstatus machen lassen; so kann z.B. ein gesunder Bruder eines schizophren Erkrankten Genträger sein, ohne jemals selber zu erkranken. Die Verlässlichkeit dieser Parameter ist aber von entscheidender Bedeutung für die klassische Kopplungsanalyse, die deshalb auch parametrische Kopplungsanalyse genannt wird. Ist sie nicht gegeben, sind robuste Befunde nicht zu erwarten. Daher mussten viele www.zi-mannheim.de frühere Kopplungsbefunde für die Schizophrenie oder die bipolare Erkrankung, die zunächst Hoffung auf raschen Erfolg geweckt hatten, wieder verworfen werden. Die Einführung der sogenannten nicht-parametrischen Kopplungsanalyse, die nicht auf diese Parameter angewiesen ist und sich auf die Analyse von Kernfamilien (d.h. Eltern und erkrankte Geschwisterpaare) konzentriert (sog. „affected sibling pair“-Methode), hat allerdings in den letzten Jahren dazu beigetragen, dass für beide Erkrankungen mit großem Erfolg chromosomale Regionen identifiziert werden konnten, die von verschiedenen Forschergruppen weltweit in verschiedenen Kollektiven unterschiedlichster ethnischer Zusammensetzung bestätigt (repliziert) werden konnten. Zu diesem Erfolg haben maßgeblich auch die Kooperationen der Arbeitsgruppen auf nationaler aber auch internationaler Ebene beigetragen, da nur mittels gemeinsamer Kooperationen große, statistisch aussagekräftige Familienkollektive etabliert werden konnten. Mittels solcher Strategien sind für Schizophrenie (SZ) und bipolare Störung (BP) für eine Reihe chromsomaler Regionen positive Kopplungsbefunde berichtet worden, v.a.: 1q (SZ) , 3p (SZ), 5q (SZ), 6p (SZ), 6q (SZ und BP), 8p (SZ), 8q (BP), 10q (BP), 11q (SZ), 13q (SZ und BP) 14p (SZ), 18q (BP), 22q (SZ und BP). Wenn sich ein Kopplungsbefund als robust erwiesen hat, sind Feinkartierungsmaßnahmen, d.h. die Einengung des Lokus mittels Analyse weiterer genetischer Marker, der nächste Schritt. Gene, die in den so eingegrenzten chromosomalen Bereichen liegen, werden als positionale Kandidatengene bezeichnet. Ihr möglicher Beitrag zur Erkrankung wird mittels genetischer Assoziations-studien überprüft. Eine genetische Assoziationsstudie (Fall-Kontroll-Studie) untersucht, ob sich eine Population von Erkrankten von einer Kontrollstichprobe bzgl. der Häufigkeit der Ausprägung bekannter genetischer Variationen (MarkerZI Aktuell 1/06 Allelfrequenzen) signifikant unterscheidet. Typische genetische Marker für eine Assoziationsstudie sind sog. single nucleotide polymorphisms (SNPs). Diese genetischen Variationen bestehen in einem einfachen Basenaustausch, also z.B. A(lanin) statt G(uanin) oder T(hymidin) statt C(ytosin). Für Assoziationsstudien aussagekräftige SNPs (d.h. SNPs mit einer ausreichend hohen Allelfrequenz) treten im menschlichen Genom ca. alle 1000 Basen auf. Wenn z.B. bei Patienten mit bipolarer Störung an einem bestimmten SNP signifikant mehr A-Allele auftreten als bei Kontrollen, so ist das A-Allel mit der bipolaren Störung assoziiert. Moderne Assoziationsstudien untersuchen nicht nur Assoziationen mit einzelnen Allelen, sondern auch mit so genannten Haplotypen, Kombinationen von Allelen auf einem Chromosom (z.B. A-T-A-C-G). Voraussetzung für die Robustheit genetischer Assoziationsstudien sind hinreichend große Kollektive von Fällen und Kontrollen, die sich bzgl. möglichst vieler Parameter (Geschlecht, Alter und v.a. ethnischer Zusammensetzung) entsprechen sollen. Da ein singulärer positiver Assoziationsbefund in einer Population natürlich immer auch ein falsch positiver Befund sein kann, sind Replikationsstudien zur Überprüfung berichteter Assoziationen unabdingbar. Erst wenn eine genetische Assoziation in mehreren unabhängigen Studien in unterschiedlichen ethnischen Gruppen nachgewiesen werden kann, kann man von einem robusten Befund sprechen. Je mehr Studien nicht nur dasselbe Gen, sondern auch exakt dieselben Allele oder Haplotypen innnerhalb eines Genes assoziiert finden, desto eher kann man davon ausgehen, dass man kausale Genvarianten für eine Erkrankung gefunden hat. Durch systematische Assoziationsstudien in Kopplungsregionen konnten innerhalb der letzten drei Jahre mehrere Suszeptibilitätsgene für die Schizophrenie (z.B. 21 Neuregulin-1 auf 8p, Dysbin-din auf 6p, COMT auf 22q, DISC-1 auf 1q) identifiziert werden, die in mehreren Replikationsstu-dienn bestätigt werden konnten und nun das Ziel weitergehender Studien (funktionelle in vitro-Studien, knock-out-Tiermodelle) zur Klärung der Pathophysiologie der Erkrankung geworden sind. Der Genlokus G72 auf Chromosom 13q Im Jahre 2002 führten Chumakov und Kollegen eine groß angelegte, systematische Assoziationsstudie zur Schizophrenie in der Kopplungsregion 13q durch. Sie untersuchten ein frankokanadisches sowie ein russisches FallKontroll-Kollektiv. Sie typisierten 191 SNP-Marker. Mehre-re SNPs in der Subregion 13q34 zeigten sowohl Einzelmarker- als auch Haplotypen-Assoziation mit Schizophrenie. In der assoziiert gefundenen Region konnte mittels der verfügbaren Informationen aus dem Humanen Genomprojekt ein Gen identifiziert werden, welches seither unter dem Namen G72 bekannt geworden ist. Chumakov und Mitarbeiter konnten durch in vitro-Analysen des Weiteren herausfinden, dass das Gen-Produkt von G72, also das von ihm codierte Protein, mit dem Enzym D-Aminosäure-Oxidase (DAAO) interagiert und es aktiviert. Das für DAAO kodierende Gen liegt auf Chromosom 13. Bemerkenswerter Weise konnte auch eine genetische Asso-ziationsstudie mit SNPs im DAAO-Gen zeigen, dass dieses Gen mit Schizophrenie assoziiert ist. Da das Enyzm DAAO die Oxidation von D-Serin, einem wichtigen Aktivator von NMDA-Rezeptoren, katalysiert, wird postuliert, dass eine Mutation im Gen G72 zu einer vermehrten Aktivierung von DAAO und damit zu einer verminderten NMDA-Rezeptor-Aktivität führen, welche wiederum mit der Generierung psychotischer Symptomatik in Verbindung gebracht wird (siehe auch Blockade der NMDA-Rezeptoren durch PCP). In einer Studie der University of Chicago wurde nach diesen iniwww.zi-mannheim.de tialen Befunden eine mögliche Assoziation von G72-Markern mit der bipolaren Störung untersucht, da die Region 13q bereits zuvor als Kopplungsregion für die bipolare Störung beschrieben worden war. Die Forscher fanden tatsächlich eine Assoziation mit Markern des G72-Gen und der bipolaren Störung. Das Ende der kraepelinschen Dichotomie? Verfolgungswahn als Kern der genetischen Assoziation zwischen G72/G30 und der bipolaren Störung Die nähere Beschäftigung mit für diese Befundlage sein? In Anbetracht der oben skizzierten möglichen Beteiligung von G72 an der Regulierung von NMDARezeptor-Aktivität sowie der Tatsache, dass die Kopplungsbefunde zwischen der Region 13q und Auf der Grundlage dieser Befunde untersuchte unsere Arbeitsgr uppe, in Kooperation mit Kollegen der Universität Bonn (Institut für Humangenetik, Life & Brain Center, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie) eine mögliche Assoziation von G72-Markern mit Schizophrenie und bipolarer Störung. Wir untersuchten Kollektive von 300 Patienten mit Schizophrenie, 300 bipolaren Patienten sowie 300 Kontroll-Individuen aus Deutschland. Als erste Gruppe weltweit konnten wir für beide Erkrankungen eine Assoziation mit einem identischen 4Marker-Haplotyp, bestehend aus den Markern M12, M15, M23, M24 (entsprechend der Nomenklatur von Chumakov et al.) finden. Wir konnten für die Schizophrenie (und schwächer für die bipolare Störung) ebenfalls eine Assoziation mit dem DAAO-Gen finden. In der Folge dieser Befunde berichteten mehrere Gruppen weltweit Assoziationen zwischen G72 und Schizophrenie aber auch bipolarer Störung in unabhängigen europäischen, amerikanischen und asiatischen Populationen. Damit gehört das Gen G72 zu den am bestreplizierten Suszeptibilitätsgenen für psychische Erkrankungen. Obwohl dieses Gen für sich allein genommen nur einen kleinen Teil der ätiologischen Varianz der Schizophrenie oder der bipolaren Störung erklärt, stellt seine Identifikation doch einen ersten wichtigen Meilenstein in der psychiatrischgenetischen Forschung dar. ZI Aktuell 1/06 Abb.1: OPCRIT-Variablen für psychotische Lebenszeitsymptomatik und ihre Assoziation mit dem G72-Marker M23 diesen Befunden, die man in dieser Robustheit noch vor wenigen Jahren für nahezu undenkbar gehalten hätte, wirft natürlich einige Fragen auf. Zum einen wissen wir noch sehr wenig über die genaue Funktionsweise dieses Gens, welches nur bei höheren Lebewesen (Primaten) vorkommt. Zum anderen überrascht die Deutlichkeit der Assoziation dieses Genes mit zwei bisher als klar von einander getrennt angesehenen Krankheitsentitäten, nämlich der Schizophrenie und der bipolaren Störung. Was könnte der Grund 22 der bipolaren Störung ausgeprägter sind, wenn man sich auf bipolare Patienten mit psychotischer Lebenszeitsymptomatik konzentriert, liegt die Vermutung nahe, dass die Assoziation zwischen der bipolaren Störung und G72 auf Fälle mit psychotischer Symptomatik zurückzuführen sind. Wir überprüften dies: Von den 300 Patienten unseres Kollektivs hatten 173 eine positive Anamnese für psychotisches Erleben. Die Stärke der Assoziation wurde aber nicht wesentlich besser, wenn wir nur diese 173 Pawww.zi-mannheim.de tienten gegen Kontrollen testeten. Daher entschlossen wir uns zu einer systematischen Genotyp-Phänotyp-Korrelationsanalyse, um dem Kern der Assoziation näher zu kommen. Da wir pro Patient über 2000 Variablen mittels eines von uns entwickelten computergestützten Phänotypisierungsinventars (Interviews für Psychiatrisch-Genetische Studien; IPGS;) erheben, können wir psychotische Symptomatik detailliert beschreiben. So lässt sich psychotische Symptomatik mittels des OPCRIT-Systems z.B. anhand von 21 Variablen abbilden (siehe Abb.1). In dieser Genotyp-PhänotypKorrelationsanalyse (logistische Regression mit dem bestassoziierten Einzelmarker M23 als abhängige Variable) zeigte sich, dass nur ein spezifisches psychotisches Symptom, nämlich Verfolgungswahn, die abhängige Variable, den Marker M23, signifikant erklärte (p=0,005; siehe Abb.1). Auf Grund dieses Befundes testeten wir nun nur noch diejenigen Patienten mit einer psychotischen Lebenszeitsymptomatik (n=83) gegen unser Kontrollkollektiv: dies führte zu einer deutlichen Zunahme der Stärke der Assoziation. Die Odds Ratio für den 4-Marker-Haplotyp, als Zusammenhangsmaß für das relative Risiko, verbesserte sich von 1,29 im Gesamtkollektiv auf 1,54 in diesem Subkollektiv, obwohl das Fallkollektiv nun weniger als ein Drittel des Ursprungskollektiv umfasste (83 von 300 Patienten). Da diese Analyse natürlich eine explorative posthoc-Studie darstellte, war es wichtig, diesen Befund, in einem unabhängigen Kollektiv zu bestätigen. Dazu untersuchten wir ein ähnlich großes Fall-Kontroll-Kollektiv, welches durch unsere Kooperationspartner aus dem polnischen Posen erhoben worden war. Das Gesamtkollektiv zeigte keine Assoziation mit den von uns beschriebenen Risikohaploytpen. ZI Aktuell 1/06 Wenn wir allerdings nur die Fälle analysierten, die eine positive Lebenszeitanamnese für Verfolgungswahn aufwiesen, zeigte sich eine signifikante Assoziation. Aus unserer Studie lässt sich folgern, dass die von uns beschriebene Assoziation zwischen bipolarer Störung und dem Gen G72 hauptsächlich auf Fälle zurückzuführen ist, die eine positive Anamnese für Verfolgungswahn aufweisen. Damit wurde zum ersten Mal ein molekulargenetisches Korrelat der in der klinischen Praxis schon lange beobachteten Überlappung zwischen bipolarer und schizophrener Störung beschrieben. Dieser Befund rüttelt also an einer Grundfeste moderner psychiatrischer Klassifikationssysteme: der Dichotomie Kraeplins. Interessanterweise fanden wir dieselben Risikohaplotypen auch in einem Kollektiv von Patienten mit Panikstörung assoziiert, was darauf hindeuten könnte, dass „Verfolgungswahn“ per se nicht den eigentlichen Kern der Assoziation repräsentiert, sondern dieser möglicherweise die „Angst“ sein könnte. In Anbetracht der Tatsache, dass „Verfolgungswahn“ durch massives Angsterleben des Patienten gekennzeichnet ist, erscheint uns diese Überlegung als eine viel versprechende Arbeitshypothese. Da Angst ein elementarer Bestandteil vieler psychischer Erkrankungen ist, wirft dies dann natürlich weitere Fragen auf. In diesem Zusammenhang ist es daher nicht erstaunlich, dass vorläufige Resultate aus unseren Analysen auch eine Assoziation der beschriebenen Haplotypen mit der unipolar depressiven Störung nahe legen. Da unsere Befunde zur Panikstörung und zur unipolaren Depression allerdings noch nicht in unabhängigen Studien repliziert worden sind, lassen sich hierzu noch keine definitiven Aussagen machen. Daher streben wir, zusammen mit unse- 23 ren nationalen und internationalen Kooperationspartnern in den USA, Spanien, Russland, Bosnien-Herzegovina sowie Serbien & Montenegro, Replikationsstudien in unabhängigen Fall-Kontroll-Kollektiven an. Um dem Ziel der Gen-Identifikation näher zu kommen, bedienen wir uns auch moderner bildgebender Verfahren. In einer der bisher größten Studie untersuchten wir 42 bipolare Patienten und 42 Kontrollen mit strukturellem MRT. Hierbei zeigten die bipolaren Patienten gegenüber Kontrollen eine signifikante Verminderung der grauen Substanz im frontotemporalen Kortex. Dieser Kontrast war bei denjenigen Patienten deutlicher, die im Laufe ihrer Erkrankung jemals an Verfolgungswahn litten. Damit imponiert „Verfolgunswahn“ als phänotypischer Marker von entscheidender Bedeutung für die bipolare Störung. Auch wenn unsere molekulargenetischen und Bildgebungsuntersuchungen letztlich noch nicht den Schlüssel zum Verständnis der bipolaren Störung oder der Schizophrenie geliefert haben, so haben wir innerhalb der letzten Jahre doch eine entscheidende Wegstrecke zurückgelegt. Schon jetzt ist allerdings sicher, dass traditionelle, kategoriale Diagnosesysteme der Komplexität psychischer Erkrankungen nicht gerecht werden, sondern dass unser Augenmerk wieder vielmehr auf individuellen Symptomen und Symptomkomplexen liegen muss. Die molekulargenetische Forschung wird unseres Erachtens nach in Zukunft entscheidende Hilfestellungen hierbei leisten. Thomas G. Schulze Heike Tost Marcella Rietschel www.zi-mannheim.de Stress und Immunität Ein Modellprojekt zur Stressreduktion bei Patienten unter Knochenmark- und Stammzelltransplantation Die Behandlung von Patienten mit Leukämien und Krebserkrankungen stellt eine besondere Herausforderung für die hämatoonkologische und psychoonkologische Forschung dar. Die neu begründete Arbeitsgruppe „Psychoonkologie und Psychoneuroimmunologie“ der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin am ZI beschreitet jetzt in Kooperation mit mehreren deutschen und internationalen Transplantationszentren mit einem von der „Deutschen José Carreras Leukämiestiftung (DJCLS)“ mit knapp 300.000 Euro geförderten Modellprojekt innovative Wege zur Entwicklung und Erforschung psychoonkologischer Interventionen bei diesen hoch belasteten Patienten. Hintergrund Die Kombination von modifizierten Hochdosis-Chemotherapien gen auseinander setzen. Dazu gehören die Erkrankung selbst, die Isolation in einer keimarmen Umgebung, rasche und unsichere Veränderungen des klinischen Status, mögliche lange stationäre Aufenthaltsdauern, invasive medizinische Eingriffe, therapiebedingte körperliche Nebenwirkungen, Transplantatreaktionen bei Fremdspendertransplantationen, starkes Angewiesensein auf das Betreuungspersonal, familiäre Belastungen, berufliche Veränderungen, und u.U. eine reale Lebensbedrohung. Stressinduzierte psychische Symptome können Angst, Depression, Lethargie, Apathie, „Fatigue“, Ärger und Feindseligkeit, fehlende Compliance, Schlafstörungen, Alpträume, Grübeln, Intrusionen, verstärkte Schmerzwahrnehmung, u.a. sein. Nur wenige Studien haben bisher psychosoziale oder verhaltens- Abb.1: Grafische Darstellung der Stress Entwicklung..... mit Immuntherapien bei Leukämie-Patienten hat bei gleicher oder erhöhter Wirksamkeit deren Verträglichkeit erheblich verbessert. Dennoch müssen sich Patienten unter hämato-onkologischen Intensivtherapien nach wie vor mit starken körperlichen und psychosozialen BelastunZI Aktuell 1/06 bezogene Aspekte als Prädiktoroder Moderatorvariablen für die Symptomentwicklung und den Krankheitsverlauf von LeukämiePatienten untersucht. Eine Arbeitsgruppe konnte zeigen, dass das Ausmaß von initial erlebtem Stress, familiärer Unterstützung 24 und schmerzbezogenen Bewältigungsfähigkeiten der Patienten die stärksten Prädiktoren für die erlebte Schmerzintensität unter Knochenmarktransplantation waren. Eine andere Gruppe wies bei knochenmarktransplantierten Patienten eine Akutprävalenz psychischer Störungen (gem. DSM-IV) von über 40% nach. Dabei zeigten sich in einer multivariaten Regressionsanalyse - neben CML, initialem Karnofsky-Index <90 und intensivem Konditionierungsschema - affektive Störungen sowie Angst- und Anpassungsstörungen als unabhängige Prädiktoren für die Hospitalisierungsdauer der untersuchten Patientengruppe. Bereits von Mason (1968) wurde darauf hingewiesen, dass subjektiv als neuartig, unvorhersagbar und unkontrollierbar erlebte Situationen als besonders intensive Stressoren erlebt werden, die neben der psychischen Belastungserfahrung mit einer deutlichen Aktivierung endokriner Systeme assoziiert sind. Die besondere Behandlungssituation von Leukämie-Patienten unter Stammzelltransplantation mit vielen Unwägbarkeiten stellt einen solchen intensiven Stressor dar. Klinische Untersuchungen belegen, dass die Fähigkeit von Patienten unter Knochenmark- und Stammzelltransplantation zur „Bedrohungsminimierung“ und Stressreduktion sowie gegenregulatorische Maßnahmen (körperliche Aktivität, geleitete Entspannung, soziale Unterstützung) positive Auswirkungen auf ihr subjektives Befinden, den Krankheitsverlauf und die stationäre Aufenthaltsdauer haben. Experimentelle Untersuchungen zeigen, dass sich daraus auch günstige Effekte auf eine beschleunigte Immunrekonstitution, eine geringere Schmerzbelastung und einen geringeren Medikamentenverbrauch ergeben können. Interventionen www.zi-mannheim.de zur Stressreduktion bei Patienten unter HSCT/KMT Weltweit liegen bisher nur fünfprospektive, randomisierte und kontrollierte psychosoziale Interventionsstudien (RCT) bei Patienten unter hämatopoietischer Stammzelltransplantation vor. Diese untersuchten: ► informationelle und psychoedukative Einzel- und Gruppeninterventionen vor Beginn der Transplantation ► supportive Psychotherapien mit symptomorientierten und kognitiv-behavioralen Interventionen ► entspannungstherapeutische Verfahren ge einzelner Behandlungsmaßnahmen (z.B. kortikoidbedingte Myopathie). Die verminderte Leistungsfähigkeit hat wiederum bedeutsame psychische Folgen und Auswirkungen: Langzeitstudien konnten zeigen, dass aufgrund des reduzierten Allgemeinzustandes etwa ein Drittel der Patienten ein Jahr nach Abschluss der Knochenmarktransplantation nicht imstande ist, Erwerbstätigkeiten nachzugehen. Um das Ausmaß an „Fatigue“ zu verringern, wird den Patienten oft empfohlen, die körperliche Aktivität weitgehend zu reduzieren, was den Bewegungsmangel aber eher verstärkt. Daraus resultiert ein weiterer Muskelabbau und somit ein Circulus vitiosus. Mehrere Untersuchungen der Leistungsfähigkeit zu, gegenüber der Kontrollgruppe kam es zu einer signifikanten Reduktion psychischer Symptombelastung (Ärger/Feindseligkeit, zwanghaften Zügen, Angst, globaler psychischer Belastung). Weitere Studien haben die positiven Effekte eines Ausdauer- und Krafttrainings bei Patienten während und nach konventioneller Chemotherapie bzw. Bestrahlung belegt. Sie konnten auch zeigen, dass richtig dosierte körperliche Belastungen keine Zunahme der behandlungsbedingten Beschwerden verursachen. Einige Arbeiten zur Wirkung von Ausdauertraining untersuchten auch Effekte auf den immunologischen und hormonellen Status von Patienten, mit z.T. jedoch noch heterogenen Ergebnissen ► musiktherapeutische Verfahren ► Sport- und bewegungstherapeutische Verfahren (Ausdauertraining) Diese Studien hatten aber z.T. erhebliche methodische Schwächen, kleine Stichprobengrößen und heterogene Ergebnisse. Ausdauertraining Die Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit und die ausgeprägte Ermüdung („Fatigue“) sind gravierende stressinduzierende Probleme hämatoonkologischer Patienten. Dieses Phänomen wird bei über 70% der hämatologischen Patienten zeitnah nach konventioneller Chemotherapie und bei fast 100% der Patienten nach Stammzelltransplantation beobachtet. Häufig schränken diese Symptome Arbeits- und Freizeitaktivitäten auch längerfristig so stark ein, dass eine Wiederaufnahme des normalen Alltagslebens verzögert und erschwert wird. Zum Teil sind diese Probleme durch die meist mit einer Hospitalisierung verbundene Inaktivitätsatrophie bedingt. Zum Teil sind sie auch direkte Fol- ZI Aktuell 1/06 Patientengemälde letzten Jahre konnten nun die positiven Effekte eines Ausdauertrainings bei chemotherapie- und krankheitsbedingter „Fatigue“ belegen. Gleichzeitig bewirkt die körperliche Aktivität eine deutliche Besserung des psychischen Zustandes: Selbstwertgefühl und Selbständigkeit der Teilnehmer an einem Trainingsprogramm nahmen mit der Verbesserung der 25 Hypno- und entspannungstherapeutische Verfahren bei onkologischen Patienten. Ein anderer therapeutischer Ansatzpunkt zur Stress-Reduktion sind hypno- und entspannungs-therapeutische Verfahren. Rationale dieser Verfahren ist, zu einer Reduktion von physiologischem Arousal und Angst beizutragen, wodurch Patienten die www.zi-mannheim.de Umgebung als weniger feindselig und bedrohlich wahrnehmen und damit einen verbesserten Zugang zu Coping-Fähigkeiten erhalten. In einer Pilotstudie mit 30 krebserkrankten Patienten unterschiedlicher Diagnosegruppen in einem Behandlungszentrum in Dublin erreichten Patienten nach einem 10-wöchigen Kurs in Autogenem Training eine signifikante Reduktion von Angst, einen Anstieg des Coping-Stils „Fighting Spirit“ (Kampfgeist) und einen verbesserten Schlaf. Andere Studien untersuchten den Effekt von hypnotherapeutisch geleiteter Imagination auf das Wohlbefinden und die Immunität von Patientinnen nach Mamma-Ca. In einer ebenfalls nicht-kontrollierten und nicht-randomisierten Studie konnten Bakke et al. (2002) nach einem 8-wöchigen Trainingsprogramm in Hypnoticguided Imagery vorübergehend eine signifikante Verbesserung von Depressivität und einen absoluten Anstieg von NK-Zellen zeigen, die aber in einem 3-MonatsFollow-up nicht persistierten. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) bei onkologischen Patienten Ein besonders vielversprechender Ansatz zur Stressreduktion sind achtsamkeitsbasierte Verfahren in der Medizin und Psychotherapie. Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) ist ein von Jon Kabat-Zinn und Mitarbeitern an der University of Massachusetts Medical School in Worcester entwickeltes Programm, mit dem basale Fähigkeiten zur Stress-Modifikation vermittelt werden. Schwerpunkte und Ziele des Verfahrens sind eine: ► Wahrnehmungsfokussierung (Focussing) ► Förderung von Konzentration und Achtsamkeit (Enhancement of Concentration) givibblogo ► nicht-bewertende Akzeptanz von Wahrnehmungen, KognitioZI Aktuell 1/06 nen und Emotionen (Non-judgemental Attitude) Sie bedient sich durch regelmäßiges Üben mittels meditativer Techniken der Wahrnehmungslenkung auf Atmen, Hören, Sehen und andere Sinnesreize Dieses Verfahren ist ein Programm, das im Verlauf mehrerer weisen. Diese Patientengruppen erhielten jedoch keine intensive Chemotherapie. Bauer-Wu et al. (2004) legten eine Explorative Feasibility Study vor, in der sie am Dana-Farber Cancer Institute und dem Brigham and Women’s Hospital der Harvard University, Boston, Mass., bei insgesamt 19 Patienten unter KMT die Anwendbarkeit von MBSR in diesem Behandlungssetting überprüften und Stimmung und physiologische Stress sowie ausgewählte Immunparameter unmittelbar vor und nach den MBSR-Sitzungen erfassten. Zugleich erhoben Wochen (i.d.R. wöchentliche Gruppenübungen á 90 Min. für 7-9 Wochen) durch Trainings und CD-geleitete Hausaufgaben selbständig erlernt werden kann, wenig Anstrengungen erfordert und daher für hämatoonkologische Patienten besonders geeignet ist. Bislang liegen acht veröffentlichte Studien zur Anwendung von MBSR bei depressiven und onkologischen Patienten vor. Speca, Carlson et al. (2000) konnten nach 7 Wochen, Carlson, Ursuliak et al. (2001) nach 7 Wochen und in einem 6 Monats-Follow-up in jeweils unkontrollierten Studien deutliche Effekte auf Stimmung (Mood), Stress-Symptome, Schlafverhalten, Stresshormone und Immunfunktion bei jeweils 90 ambulanten Krebspatienten nach- sie direkte Rückmeldungen von den Patienten zu den 1:1-Sitzungen und der Anwendung von Guided Mindfulness Mediatation CDs. Über den Gesamtverlauf der Studie wurden unabhängig von den Trainern mit den Patienten Interviews zur Einschätzung ihrer Befindlichkeit und des Verfahrens durchgeführt, die audiographiert und transkribiert wurden; ferner erfolgte eine Einschätzung der Symptomatik. An unmittelbaren Effekten zeigten sich über alle Sitzungen hochsignifikante Ergebnisse in der Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens, des Ausmaßes an Entspannung, der Schmerzreduktion und der Zufriedenheit. Ebenso waren von der ersten bis zum Abschluss der vierten Sit- ► intentionslose Präsenz (Nonstriving Attitude) ► ein auf sich selbst und andere gerichtetes Wohlwollen und Wertschätzung (Loving Kindness) 26 www.zi-mannheim.de zung signifikante Änderungen der Herz- und Atemfrequenz feststellbar; auf die Erfassung des Blutdrucks während bzw. nach den Sitzungen wurde im Verlauf aus Praktikabilitätsgründen verzichtet. Die berichteten PatientenFeedbacks ergaben eine hohe Zufriedenheit der Patienten mit dem Training. Das Modellprojekt In einer weltweit ersten psychoonkologischen Interventionsstudie dieser Art werden nun unter Federführung des ZI die Auswirkungen gezielter und von Patienten vor der Behandlung eingeübter Meditations- und Entspannungsverfahren und eines an die Bedingungen einer hämatologischen Intensivstation angepassten Kraft-Ausdauertrainings bei Patienten unter hämatopoietischer Stammzelltransplantation systematisch untersucht. Es werden bis zu 160 Patienten verschiedener hämatologischer und onkologischer Systemerkrankungen in die Therapiestudie einbezogen. Die Untersuchung wird als Multicenter-Studie an den Transplantationszentren der Universitäten München, Heidelberg und Mannheim, sowie an der Deutschen Klinik für Diagnostik Wiesbaden, unter Federführung der Projektgruppe des ZI Mannheim durch geführt. International erfolgt eine enge Kooperation mit der Harvard-University. Vor Beginn der Interventionen werden psychobiologische, psychische und familiäre Belastungsund Schutzfaktoren der Patienten über Interviews, Fragebögen, funktionelle Bildgebung und Laboruntersuchungen erfasst. Nach einer achtwöchigen Trainingsphase in den spezifischen Verfahren (Mindfulness, Ausdauertraining) vor Beginn der Hochdosisthera- pie und Transplantation praktizieren die Patienten diese Verfahren täglich unter Anleitung und Supervision, zusätzlich zu den stations- und therapieüblichen Maßnahmen. Untersucht werden das Ausmaß von erlebtem Stress, psychischen Belastungen, Schmerzintensität, Schmerz- und Beruhigungsmittelverbrauch, Herz-Kreislauf-Funktionen, körperlicher Belastbarkeit, Infektionen, Erholung des Immunsystems, allgemeiner und spezifischer Lebensqualität, Behandlungsdauer und weiterer Merkmale im Therapieverlauf, zum Abschluss der stationären Behandlung, sowie 3, 6, 9 und 12 Monate nach Therapie. Über erste Ergebnisse wird in einer der nächsten Ausgabe von ZI-Information aktuell berichtet. Andreas Remmel Zum Schluss.... Mein Name ist Winfried Busche. Erinnern Sie sich? Vom 1. August 1998 bis zum 31. Dezember 2005 war ich Verwaltungsdirektor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim - Ihrem ZI - unserem ZI - meinem ZI. Der Anfang war schwer. Vieles war aufzubereiten, zu verändern, zu entwickeln – Vertrautes war veraltet, Neues erschien risikoreich und bedrohlich.Es war ein großes, ein gutes Stück Arbeit, die nötigen Dinge auf den Weg zu bringen. Wir haben ununterbrochen gebaut und renoviert, wir haben geplant und reorganisiert, wir haben mehr informiert und anders kommuniziert, wir haben delegiert und entbürokratisiert, wir haben kontrovers diskutiert und – miteinander gelacht. Das Ergebnis unserer Arbeit kann sich sehen und fühlen lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Flexibilität und Entwicklungsbereitschaft, Sie sind die Garanten für eine erfolgreiche, sichere und unabhängige Zukunft des Zentralinstituts. Bleiben Sie dran an der Gestaltung Ihres Arbeitgebers, Ihres Arbeitsplatzes, Ihres ZI. Ich will mein ZI gerne weiter beobachten, begleiten und unterstützen, denn es ist zweifellos etwas Besonderes. Mein besonderer Dank gilt allen Menschen am Zentralinstitut für diese arbeitsreiche, wie im Flug vergangene gemeinsame Zeit. Winfried Busche Sie haben mich qualifiziert für neue berufliche Aufgaben und mir Erfahrungen gegeben für das Leben. Zum Schluss ein herzliches „Ahoi“ an Monnem, das meiner Familie und mir eine Heimat bleiben wird, auch wenn wir – typisch Saarländer - nie hier gewohnt haben. Ihr Winfried Busche ZI Aktuell 1/06 27 www.zi-mannheim.de Autorinnen und Autoren Becker, Katja, Dr. med., komm. Ärztliche Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, E-Mail: [email protected] Busche, Winfried, bis 31.12.2005 kaufmännischer Direktor ZI, nun Vorsitzender des Vorstandes, Saarländischer Schwesternverband, E-Mail: [email protected] Diehl, Alexander, Dr. med., Oberarzt der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, E-Mail: [email protected] Hendlmeier, Ingrid, Dipl.-Geront., Wissenschaftl. Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Psychogeriatrie, E-Mail: [email protected] Henn, Fritz A., Prof. Dr. med Dr. phil. bis 31. März 2006 Institutsdirektor Hentschel, Frank, Prof. Dr. med., Leiter der Abteilung Neuroradiologie, E-Mail: [email protected] Remmel. Andreas, Dr. med. Dr. phil. Dipl.-Psych., Ltd. Oberarzt der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapeutische Medizin, E-Mail: [email protected] Rietschel, Marcella, Prof. Dr. med., Leiterin der Abteilung Genetische Epidemiologie, E-Mail: [email protected] Ristow, Gerhard, Dr. med., Assistenzarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters, E-Mail: [email protected] Rockenbach, Christine, Dipl.-Psych., Wissenschaftl. Mitarbeiterin der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin, E-Mail: [email protected] Schäufele, Martina, Dr. sc. hum., Stv. Leiterin der Arbeitsgruppe Psychogeriatrie, E-Mail: [email protected] Schiel, Hans-Werner, Dipl.-Pflegew., Leiter Pflegedienst, E-Mail: [email protected] Schmidt, Martin, Prof. Dr. med. Dr. rer. nat., Bis 31. März 2006 Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am ZI, E-Mail: [email protected] Schulze, Thomas G., Dr. med., Wissenschaftl. Mitarbeiter der Abteilung Genetische Epidemiologie, E-Mail: [email protected] Staudter, Claus, Leitender Krankenpfleger der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters am ZI, E-Mail: [email protected] Struve, Maren, Dipl.-Psych., Wissenschaftl. Mitarbeiterin am Institut für Neuropsychologie und Klinische Psychologie, E-Mail: [email protected] Tost, Heike, Dr. phil., Dipl.-Psych., Wissenschaftl. Mitarbeiterin der Abteilung Genetische Epidemiologie, E-Mail: [email protected] Weyerer, Siegfried, Prof. Dr. phil., Leiter der Arbeitsgruppe Psychogeriatrie, E-Mail: [email protected] Impressum Herausgeber: Zentralinstitut für Seelische Gesundheit 68159 Mannheim, J 5 Redaktion: Dr. Marina Martini Referat Öffentlichkeitsarbeit Telefon: 0621/17 03-1301, -1302 Telefax: 06 21/17 03-1305 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.zi-mannheim.de Nachdruck nur mit Genehmigung. Hinweis: Auch wenn in den folgenden Texten auf die weibliche Form bei der Benennung von Personen verzichtet wird, sind selbstverständlich immer Frauen und Männer gemeint. INFORMATION Martini, Marina, Dr. med., Leiterin des Referats Öffentlichkeitsarbeit, E-Mail: [email protected]