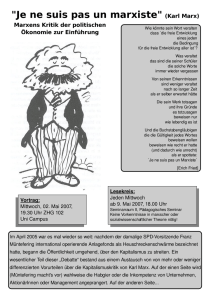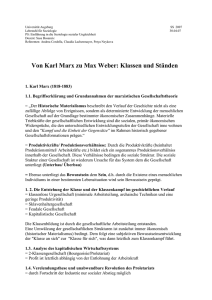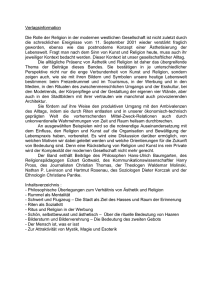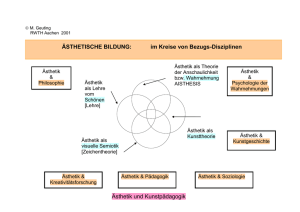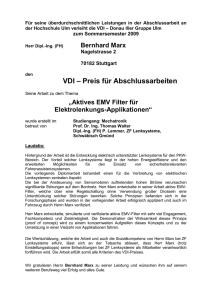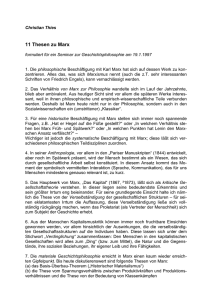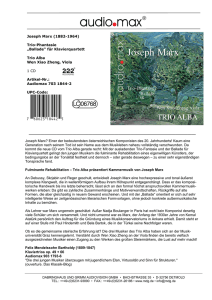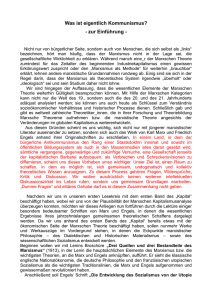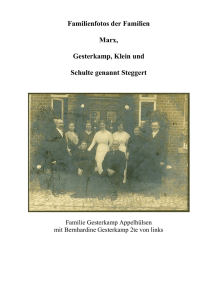In: Widerspruch Nr. 22 Wozu noch Intellektuelle? (1992), S. 70
Werbung

In: Widerspruch Nr. 22 Wozu noch Intellektuelle? (1992), S. 70104 Bücher zum Thema Rezensionen Besprechungen Bücher zum Thema Pierre Bourdieu Homo Academicus Frankfurt/Main 1988 (Suhrkamp), 455 S., brosch., 48.- DM. In seinem bereits 1988 auf deutsch erschienenen Buch unternimmt der französische Soziologe und Ethnologe Pierre Bourdieu den fast schon frivol zu nennenden, aber gleichwohl als gelungen zu bezeichnenden Versuch, den akademischen Betrieb Frankreichs einer wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen. Wir haben hier, ähnlich wie schon in „Die feinen Unterschiede“ den Entwurf einer gegenläufigen Ethographie vor uns, in der nicht das Exotische heimisch, sondern das heimisch Vertraute exotisiert wird. So sollen durch bewußt erzeugte Frappierungen neue Erkenntnispotenzen im allzubekannten Alltäglichen erschlossen werden. Diesmal steht also die besondere Spezies des „Homo Academicus“ der Wissenschaftler mit seiner Pra- xis - im Focus der komplexen Zergliederung. Für die solchermaßen Dekonstruierten eine sicherlich ungewohnte Rolle. Bourdieu nimmt eine Objektivierung der objektivierenden Subjekte (Wissenschaftler), eine Strukturierung der professionellen Strukturierer vor. Die Wissenschaft wird dabei folglich nicht nur als fortschreitender Erkenntnisprozeß begriffen, der von um die reine Wahrheit sich mühenden Individuen betrieben wird, sondern als eine Positionsfeld sozial handelnder Akteure und als deren Auseinandersetzungen und Produktionen in ihrem jeweiligen historischen Umfeld erkannt und als solches untersucht. Bourdieu beschreibt dabei minuziös die immer schon prädeterminierten Machtkämpfe und die dabei verwendeten Strategien in den Akademien und ihren Randbereichen, symbolisches Kapital zu erlangen und zu erhalten. Letzteres wird in eben jene Kämpfe reinvestiert und in die sich so entwickelnden, die Auseinandersetzungen und Standpunkte aber wiederum präformierenden Habitusformen, welche sich als scheinbare Kontingenz der persönlichen Beziehungen und Erfahrungen enfralten uns so verkannt und unbewußt als strukturelle Zwänge ihre Wirkung ausüben. Als eine der bedeutendsten Kapitalformen in diesen Kämpfen macht Bourdieu die Legitimität bzw. Infragestellung der jeweiligen Bildung fest. Ist sie formal, etwa durch Abschlüsse und Titel, anerkannt? Gibt sie sich als quasi 'naturhafte' Intelligenz, die sich über jeden sturen Formalismus erhaben dünkt, oder frönt man gar der Häresie? Der Habitus, der gleichsam ein Produkt dieser Kämpfe wie der individuellen und der Klassengeschichte ist, bildet neben der meist nur halbbewußten Verortung im sozialen Raum den Kristallisationspunkt im Individuum, von dem aus es die Ereignisse wahrnimmt und strukturiert, von dem aus es fast schon instinktiv und reflexhaft weiß, bei welchen Personen und Themen es zu beißen, zu bellen oder freudig zu hecheln hat. Der Habitus fungiert dabei als die Vermittlungsinstanz zwischen der Struktur, in der der Einzelne steht, und der sich daraus für ihn ergebenden Praxis. Wissenschaftliche Werke, aber auch ganze Fachdisziplinen, ebenso wie die beteiligten Menschen, stehen in der vorliegenden Untersuchung nicht mehr einfach für sich - oder werden in einer Scheinanalyse lediglich verschiedenen Seilschaften zugeordnet - sondern werden als Teile eines Gesamtfeldes gesehen, in dem sich gleich Positionspfählen Räume abstecken. Räume freilich, die keineswegs fixiert sind, die vielmehr von jeder Bewegung im Gesamtfeld berührt und dementsprechend in einem vorstrukturierten Rahmen an dessen Struktur sie allerdings ihrerseits konstitutiv teilhaben - sich verschieben. So werden Hierarchien und Rangfolgen aufgebaut und angegriffen, Kriterien ihrer Ordnung verteidigt oder verändert, während sich zugleich Teile der Kampfarena immer neu bilden. Indem Bourdieu dieses Universum der Forschung haarfein seziert, zeigt er die sozialen Bedingungen und Grenzen der wissenschaftlichen Arbeit auf, und, was vielleicht das wesentlichste Ergebnis dieser Arbeit ist, es gelingt ihm der Nachweis des direkten und zwangsläufigen, aber stets verschleierten und verkannten Niederschlages dieser Strukturen auf die wissenschaftliche, theoretische und politische Produktion der Akteure. In diesem Zusammenhang ist es für den deutschen Leser vielleicht am verblüffendsten, obgleich aus der Analyse logisch zwingend, daß die meisten der hier zu Lande rezipierten und ob ihrer Originalität bewunderten französischen Geistesheroen - wie Althusser, Barthes, Deleuze und Foucault - im akade- Bücher zum Thema mischen Betrieb Frankreichs nur eine marginale Außenseiterposition innehatten - eine Tatsache, die sich in ihrem Werk spiegelt. Wenn hier auch die Wissenschaft gleichsam gegen den Strich gebürstet wird, enträt diese Arbeit keineswegs des wissenschaftlichen Anspruchs. Bourdieu hält die soziologische Erkenntnis nicht nur nach wie vor für möglich, sondern für unbedingt notwendig. Denn nur so können sich, so sein Credo, die Verantwortlichkeiten dort ansiedeln, wo ihre Freiheit zur Veränderung auch tatsächlich besteht. Jeder postmodernen Verleugnung von derart gewonnenen wissenschaftlichen Einsichtsmöglichkeiten wird eine scharfe Absage erteilt. D.h. die Fähigkeit zur Objektivierung soll durch das Wissen um ihre Bedingtheit nicht vernichtet, sondern im Gegenteil noch gesteigert - epistemologisch geschärft und gleichzeitig ihrer Illusionen entkleidet werden. Überhaupt die Epistemologie: ihr sind - wie bei diesem Autor nicht anders zu erwarten - lange und äußerst subtile Betrachtungen gewidmet, die an dieser Stelle in ihrer Komplexität nicht einmal angerissen werden können; zumal das Thema der Untersuchung die wissenschaftsmethodische Problemlage nicht gerade entschärft, existiert hier doch eine große Nähe zwischen der Analyse und ihrem Gegenstand, die erst künstlich aufgelöst werden muß, um neue Erkenntnis gewinnen zu können. Dementsprechend ausführlich fällt auch die Dokumentation des wissenschaftlichen Apparates im Anhang aus. Dieses Buch ist sicherlich allen zu empfehlen, die sich über ihre vielleicht auch marginale Rolle im akademischen Betrieb aufklären lassen möchten, wenn sich auch nicht alle Ergebnisse umstandslos auf die hiesigen Verhältnisse übertragen lassen. Allerdings: leicht ist die Lektüre dieses Buches nicht. Holger Jendral Hauke Brunkhorst Der entzauberte Intellektuelle. Über die neue Beliebigkeit des Denkens Hamburg 1990 (Junius-Verlag), geb., 365 S., 29.80 DM. Es ist schon ein Elend mit den Intellektuellen. Egal was sie machen, sie machen es falsch. Mischen sie sich ein in die Geschäfte der Politik und in andere Kleinigkeiten des öffentlichen Lebens, bekommen sie es mit den Sachwaltern der jeweiligen Hoheitsbereiche zu tun. Das bringt den Intellektuellen in der Regel den strengen Verweis ein, sie mögen sich doch bitte nicht in fremde Angelegenheiten mischen und sich um ihren eigenen Mist kümmern. Schriftsteller und andere Nestbeschmutzer können ein Lied davon singen. Wenn sie dann aber mal schweigen, ist es auch wieder nicht recht. Dieselben Leitartikler, die den Intellektuellen gerade vorgeworfen haben, überall ungefragt mitzuschwätzen, stutzen sie im nächsten Moment zurecht, weil sie auf Tauchstation gegangen sind. Was Politiker und ihre Verbündeten von den Intellektuellen erwarten, ließen sie im Golfkrieg mit der notwendigen Deutlichkeit wissen: Gefragt war, Raketen auf Israel abscheulich zu finden; Raketen auf Bagdad sollten hingegen als Beitrag zur Befriedung der Region gelten. Wer das anders sah, sollte sich raushalten. Das läßt sich verallgemeinern: Politiker sind gar nicht so; gelegentlich haben sie durchaus ein Herz für Intellektuelle, wenn die nur auf der richtigen Seiten stehen. Andernfalls... Schnauze! Daß die Herrschenden kritische Beiträge gebildeter Besserwisser nicht sonderlich schätzen, ist freilich ein alter Hut. Erstaunlicher - wenn auch keineswegs neu - ist die Tatsache, daß immer mehr Intellektuelle selbst ihre Rolle als Anwälte des Allgemeinen, der Vernunft, der Menschlichkeit, der Freiheit und desgleichen in Zweifel ziehen. Im Vorwort seines Buchs über die neue Beliebigkeit des Denkens führt Hauke Brunkhorst die gegenwärtige Tendenz zur „Selbstverachtung der Intellektuellen“ an der Person Hans Magnus Enzensbergers vor. Enzensberger, „immer noch die markanteste Gestalt der westdeutschen Szene“ , war in den frühen sechziger Jahren „ein genialer Popularisator Adornos“, der „kompromißlos revolutionäre Konsequenzen aus dem negativen Denken zog“. Und heute? „Heute denkt Enzensberger anders. Er verabscheut den revolutionären Utopismus und den besserwisserischen Anspruch intellektueller und politischer Eliten. Er feiert die 'unerschütterliche Skepsis' des antiintellektuellen Massenbewußtseins.“ Eine Sympathie für das „unkomplizierte praktische Denken“ der einfachen Leute hat Brunkhorst unter den Intellektuellen ausgemacht. Verdächtig ist ihnen die abstrakte Moral, unter deren Banner sie einst für Gerechtigkeit, Humanität, Freiheit gekämpft haben. Das Allgemeine? Ist das nicht immer der Tod des Besonderen? Unter diesem Aspekt trennen Kant und Stalin nur noch Nuancen. Dem postmodern gestimmten Zeitgeist stellt sich Brunkhorst zufolge nur noch die Alternative: „Entweder ein hoffnungsloser und gar nicht harmloser Utopist an Stalins Seite oder der beste Freund des Dorfbürgermeisters.“ Tertium non dabitur. Hauke Brunkhorst, Privatdozent an der Uni Frankfurt, ist den Spuren des Zeitgeists in seinen Essays, die zumeist in der „Neuen Rundschau“ erschienen sind, mit großer Beharrlichkeit gefolgt. Die vorliegende Aufsatzsammlung enthält mit einer Ausnahme Beiträge aus den Jahren 1988 bis 1990 sowie einige unveröf- Bücher zum Thema fentlichte Texte. Er kennt seinen Luhmann und Foucault, seinen Rorty, Heidegger und Adorno und weiß an ihren Fragen die Fragen der Gegenwart zu bestimmen. Es geht um Vernunft, Freiheit und Universalität. Brunkhorst untersucht, was von ihnen zu retten ist, nachdem der postmoderne Zeitgeist im Sturm über sie hinweggefegt ist. Das macht das Buch interessant. Dem Zeitgeist hinterherzuhecheln und zum tausendsten Mal den Schwanengesang auf die Aufklärung anzustimmen, kann heutzutage jeder. Mit einer Hand voller Trümpfe ist leicht zu gewinnen. Aber was ist, wenn man schlechte Karten hat? Das immerhin darf man zugeben: Der klassische Intellektuelle mit seinen universellen Ansprüchen hat kein gutes Blatt. Und doch möchte Brunkhorst zeigen, „daß sich die utopischen Impulse eines selbstkritischen Rationalismus ohne Rückgriffe auf irgendeine Geschichtsphilosophie verteidigen lassen“. Gegen Luhmann, Foucault und Rorty beharrt Brunkhorst darauf, daß sich Freiheit nicht in pure Kontingenz verwandelt. Spannend ist vor allem seine Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Neopragmatiker Richard Rorty, dem es ja ebenfalls um die Freiheit zu tun ist. Für Rorty ist die Frage nach den transzendentalen Bedingungen ihrer Möglichkeit erledigt: Es gibt sie nicht. Wir müssen uns entscheiden, ob wir Freiheit oder Wahrheit, Solidarität oder Ob- jektivität wollen. Wohin die Reise geht, unterliegt mehr oder weniger dem Zufall. Das ist ein beunruhigender Gedanke. Was Brunkhorst dagegensetzt, ist kaum ein Trumpf, der die Partie entscheidet: Es ist die volonté génèrale, „dasjenige was nach der radikalen Säkularisierung in der 'civil society' diskutierender Öffentlichkeiten von der zertrümmerten Metaphysik des okzidentalen Rationalismus, von den platonischen Ideen und vom Monotheismus erhalten bleibt“. Dieser laut Hegel „objektive“ und „vernünftige“ Wille ist „das Zentrum des gänzlich säkularisierten Dispositivs der Demokratie“. „Wo immer sich Minoritäten und Einzelne das Recht nehmen, Beschlüssen und Gewohnheiten der Mehrheit zu widersprechen,... beziehen sie sich auf ein absolutes, nicht relativierbares Moment.“ Die Tiefe der Fragestellung Rortys erreicht Brunkhorst damit nicht. Er setzt in seinem Argument voraus, daß es so etwas wie eine demokratische Öffentlichkeit bereits gibt; genau das steht bei Rorty aber noch zur Disposition. Demokratie oder Objektivität lautet die Frage; objektiv aber läßt sich Demokratie ebensowenig ableiten wie Freiheit oder Gerechtigkeit. Zudem ist fraglich, ob sich die zitierten Minoritäten in jedem Fall auf ein absolutes Moment beziehen, wenn sie sich der Mehrheit widersetzen. Könnte der Widerstand nicht auch vom schieren Leiden ausgehen, das einfach bloß aufhören soll? Kann es sein, daß da nichts anderes ist als dieser Wunsch, kein Appell im Namen der Menschenrechte, kein Rekurs auf die allgemeine Vernunft? Gegenwärtig bleibt nicht viel mehr, als Inventur zu betreiben. Was besteht von den Ideen der Aufklärung, von der universellen Vernunft fort? Brunkhorst beginnt bei Hegels Rezeption der französischen Revolution und endet bei den Umwälzungen in Europa zweihundert Jahre später. Seine kenntnisreichen Essays machen die Verästelungen zwischen amerikanischem Neopragmatismus und neuer Pariser Philosophie ebenso deutlich wie den Ursprung der okzidentalen Freiheitsidee im moralischen Egalitarismus des Alten Testaments. Mag der Intellektuelle alter Prägung seine universelle Basis auch verloren haben - notwendig ist er doch. Wo Menschen leiden, ist Einspruch auch ohne letztbegründete Legitimation nötig. Von den großen Entwürfen, in deren Dienst man sich stellt, heißt es Abschied nehmen. Aber ein wenig Sand ins Getriebe des Bestehenden streuen, ist auch nicht schlecht - sich, wie Sartre sagt, in Dinge einmischen, die einen nichts angehen. Wolfgang Görl Wolfram Burisch Der uneingelöste Bildungsanspruch. Notwendige Erin- nerungen an die Zukunft von Hochschule und Studenten Mit einem Vorwort von Arno Klönne. Mössingen-Talheim 1990 (Talheimer-Verlag), brosch., 176 S., 24.80 DM Vergleicht man das öffentliche Bild der „68er-Revolution“ in zeitgenössischen und heutigen Darstellungen, kristallisiert sich folgender ideologische Kern heraus: Die Studentenbewegung erscheint als ein „plötzliches Ereignis“, dessen komplexe gesellschaftliche, geschichtliche und gedankliche Voraussetzungen im Dunkeln bleiben. Die dieser Verdrängung inhärente Irrationalität schrieb man damals, in einem von autoritären Fixierungen geleiteten Akt der Verkehrung, den Akteuren der Bewegung zu: die irritierende, reflexive kritische Intellektualität evozierte das Zerrbild des sich in unverständlichen Dekreten artikulierenden Intellektuellen; das Bedürfnis nach praktischer Veränderung erzeugte als militante Abwehrreaktion das Bild des virtuell gewalttätigen Chaoten, der es wagte, die als natürlich angeschaute staatliche Ordnung anzutasten. In der Perspektive distanzierter Gelassenheit heutiger „Nachbetrachtungen“ scheint mit der Unwiederbringlichkeit der „Ereignisse“ und der für gescheitert erklärten Revolution der Stachel der Beunruhigung verschwunden zu sein, der jedoch andererseits in den Tiefenschichten Bücher zum Thema des 68er-Mythos wiederzukehren scheint. Die Gründe für die heutige „restaurative Verhinderung“ einer entmystifizierenden Aufarbeitung der unabgegoltenen geschichtlichen Inhalte der Studentenbewegung sind - so die These des Kasseler Sozialwissenschaftlers Wolfram Burisch in den gesellschaftlichen Zwängen, wie sie sich in der Gegenwart formieren, auszumachen. Deren Spezificum erblickt Burisch im vorliegenden Buch in der Subordination der Hochschule und des ihr zugrunde liegenden Bildungsverständnisses unter das Diktat der „Marktgesetze“, wie sie sich aktuell im „gebannten Starren auf die technisch-ökonomische Entwicklung“ vermittelt. Als signifikante Folgeerscheinung dieser „ausschließlich technologischen Orientierung“ kann Burisch auch in der Hochschule das Vordringen jener „realistischen“ Haltung diagnostizieren, die als technokratisch-pragmatische Ideologie heute das gesellschaftliche Bewußtsein als ganzes charakterisiert. Diesen „Realismus“ beschreibt Burisch unter zwei wesentlichen Gesichtspunkten: zum einen äußert er sich darin, „daß die Vorstellung von mündiger Selbstbestimmung bereits als irreale Erfahrung vorweggenommen ist“, zum anderen in einer auf das „bloße Gelingen fixierten Haltung“, die sich der Auseinandersetzung mit allem Widersprüchli- chen, Unabgeschlossenen, Unfertigen, der Gefahr der Enttäuschung entzieht. Wenn Burisch hier treffend eine heute vorherrschende, auf bloße Fungibilität und Markttauglichkeit ausgerichtete konsumistische Einstellung kennzeichnet, die Bildung als Prozeß produktiver Aneignung von Kultur und Gesellschaft zu eliminieren droht, weist das ins Zentrum seiner Argumentation, seinem Bildungsbegriff als Form „gesellschaftlicher Arbeit“, als „emanzipatorische Produktivkraft“. Von dieser Voraussetzung ausgehend, rollt Burisch die Geschichtlichkeit von Bildung im doppelten Sinn auf - in der dialektischen Spannung von Affirmation und Negation der sich verändernden gesellschaftlichen Bedingungen, die sich durch die ganze Geistesgeschichte hindurchzieht und als Erinnerung an ihren unvollendeten „geschichtlichen Auftrag“, nämlich von ihrem Selbstverständnis her als kritische Rationalität, Emanzipation als Verwirklichung der Humanität voranzutreiben. Es kann so einsichtig werden, warum Burisch an den Ausgangspunkt der Studentenbewegung erinnert knüpft diese doch in ihrem wissenschaftlichen Grundverständnis und ihrer Kritik an der Institution Universität kritisch an den tradierten emanzipatorischen Bildungsbegriff an. Burisch weist dies in ausführlichen Analysen 'zum historischen Kontext der unabgegoltenen Studentenbewegung' nach. Ein entscheidendes Kriterium erblickt Burisch in der Belesenheit dieser Generation (zumindest ihrer theoretischen Köpfe), im Sinne einer „historischen Belesenheit“, die „die praktischen Erfahrungen der Enttäuschung festhalten sollte“. Diese Belesenheit bildete die Grundlage eines Theorie-PraxisVerhältnisses, dessen Aktualisierung Burisch als Korrektiv der unmittelbar auf Nutzanwendung gerichteten Strategien, die einen Autoritarismus neuen Typs etablieren, einklagt. Das symptomatische Unbehagen, resultierend aus der Spannung zwischen dem Verzicht auf Bildungswünsche und dem Zwang zum Erwerb funktionaler Befähigungen, in dem Burisch die Aporie studentischen Selbstverständnisses heute manifestiert sieht, könnte auf diese Weise auf den Begriff gebracht werden. Gerade deshalb erweist sich die Forderung Burischs als wichtig, den in ihrem Bildungsbegriff vermittelten, situationsüberschreitenden Anspruch der Hochschule, „ihre Legitimation als autonomes Gebilde sich nicht in Abrede stellen zu lassen“. So eröffnet die Hochschule in ihrem spezifischen Doppelcharakter zwischen „Übergang“ und „Situationsüberschreitung“ in der Möglichkeit der „Ahnung neuer Subkulturen, die in ihrem Charakter bewußt Widerständliches aufnehmen, das ökonomischen Zwängen und strukturierenden Denkhaltungen enteignet ist“ eine Perspektive auf Veränderung. Dem Autor ist es als Verdienst anzurechnen, daß er als ehemaliger „68-er“ weder in Selbstmitleid verfällt, noch in seinem Buch mit der Vergangenheit abrechnen will. Das Anliegen Burischs, die unabgegoltenen Inhalte der Studentenbewegung in forschender Erinnerung zu aktualisieren, mag manchem Leser so anachronistisch und akademisch erscheinen wie die Sprache des Autors. Andererseits könnte ein Abtun der Überlegungen Burischs bereits ein Produkt jenes „ideologischen Nebels“ (Bloch) sein, den der Autor zu erhellen trachtet. Die Möglichkeit einer weiteren Auseinandersetzung mit den Konzepten Burischs und dessen theoretischem Umfeld, in dem sie zu verorten sind, bietet die zu seinem 50. Geburtstag von Francesca Vidal herausgegebene Festschrift „Wider die Regel“. Hier werden hauptsächlich von Autoren aus dem Kreis der Ernst Bloch-Schüler philosophische Perspektiven aus den Bereichen Ästhetik, Naturphilosophie, Bildung und Gesellschaftstheorie erörtert. Georg Koch Joachim Fest Der zerstörte Traum. Vom Ende des utopischen Zeitalters Berlin 1991 (Siedler Verlag), 193 S., Leinen, 20.- DM. Bücher zum Thema Joachim Fest hat in seinem Band“ Der zerstörte Traum“ ein kritische Geschichte utopischer Modelle verfaßt. Seine Reflexionen finden ihren Anlaß und Ausgangspunkt in den Veränderungen und Auflösungserscheinungen der sozialistischen Systeme. Gemessen an den blutigen Revolutionen, in denen sich die sozialistischen Utopien, aber auch das Wahnsystem des Nationalsozialismus den Weg gebahnt hatten, bezeichnet Fest die nun eingetretene Wende als geradezu undramatisch und eben daran glaubt er seine These „Vom Ende des utopischen Zeitalters“ fest machen zu können. Aber noch etwas unterscheidet die momentanen Umsturzbewegungen von den bisherigen: Nach Fest hatte der Umsturz „keine Vordenker, die mit suggestiven Gesellschaftsentwürfen die Massen zum Bewußtsein ihrer Not gebracht und ihre Sehnsucht auf 'die neue und gerechte Ordnung' gelenkt hätten ... Keiner der Wortführer des Aufruhrs trat noch mit dem Anspruch vor die Massen, den Weg zum Heil zu kennen“. Kurzum: Die neuen Bewegungen sind gegenüber einer langen Tradition dadurch gekennzeichnet, daß ihnen keine Utopie zugrunde liegt. Trotz dieses scheinbaren Entschwindens der Attraktion utopischer Modelle stellt sich Fest die Frage, woher „die utopischen Systeme ihre immer neue Anziehungs- kraft beziehen?“ Obwohl Fest ebenso eindrucksvoll wie souverän die Entwicklungen und Wirkungen von Utopien schildert, berücksichtigt er in dieser entscheidenden Frage nicht angemessen, daß der Verelendung der Massen im Zuge der industriellen Revolution kein real existierendes System gegenüberstand, das den Eindruck hätte erwecken können, man könne es sinnvoll zur Nachahmung empfehlen. Auch sieht er nicht, daß es früher nicht im dem Maße wie heute (Westdeutschland/Ostdeutschland) die Möglichkeit des Anschlusses an ein bereits existierendes System gab, das - verglichen mit dem eigenen - recht verheißungsvoll erscheinen konnte. Fest sieht diese „gefährliche“ Attraktion utopischer Systeme im Aufkommen des aufklärerischen Denkens begründet: Die „Utopie, so lange ein Märchen oder eine normsetzende Legende und jedenfalls ein Literaturvergnügen, gab sich seither als politisches Handlungsmodell... Damit zugleich verlor sie ihre Unschuld.“ Und so lautet der Schluß, den Fest aus all dem zieht, „daß ein Leben ohne Utopien zum Preis der Modernität gehört“, da „alle System-Utopien ... in ihrer Verwirklichung zu totalitären oder jedenfalls inhumanen Zuständen führe“. Im Philosophen Jürgen Habermas sieht Fest eine Personifikation jener Utopisten, die die „Idee gegen die Realität“ verteidigen und unbelehrbar der Neigung frönen, „sich gegen das Leben ins Unrecht zu setzen, solange nur der Gedanke recht behält.“ So kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, daß Fest, wenn auch unausdrücklich, eine gedankliche Reihe suggeriert, die eine gewisse Gefährlichkeit der Habermasschen Theorie impliziert: Wenn das Festhalten an Utopien eine entscheidende Ursache des Terrors der Systeme ist - dann ist Habermas nolens volens einer ihrer Vordenker. Auf die Fragwürdigkeit einer solchen Position kann hier nicht ausführlich eingegangen werden. Aber soviel sollte doch gesagt sein: Wenn Fest mit der Einsicht schließt, daß sich die Menschen mit einer Praxis abfinden, „die nicht mehr Sinnfragen zu beantworten sucht, sondern vor allem Praxis ist, mehr Handwerk und Ingenieurswissen als metapolitische Fürsorge“, und wenn er daraufhin urteilt, dies sei „das Beste, was sich erwarten ließe“, so wird seine Ablehnung der Habermasschen Theorie nur fragwürdiger. Denn wer wie Fest die aus Frankfurt stammende Leitdifferenz vom 'instrumentellen' und 'kommunikativen Handeln' als zu idealistisch ablehnt, der sollte sich nicht zugleich in eine ihrer Seiten verlieben: Indem man aber der einen Seite, nämlich dem 'instrumentellen Handeln' des 'politischen Ingenieurs' den Vorzug gibt, kann man die Berechtigung der Leitdifferenz nicht wirklich in Frage stellen. Harald Wasser Iring Fetscher Utopien. Illusionen. Hoffnungen. - Plädoyer für eine politische Kultur in Deutschland Stuttgart 1990 (Radius), Pb., 312 S., 49.- DM. Im WIDERSPRUCH Nr. 19/20 formulierte der Frankfurter Politikwissenschaftler Iring Fetscher im Kontext seiner Überlegungen „zum Ende der bürokratischen Planwirtschaft“ folgende These: „Was an Marx bleibt ist gerade das, was er gern gar nicht wahr haben wollte, sein humanistisch-ethisches Anliegen: die Verwirklichung der von der Französischen Revolution eingeleiteten und unvollendeten Versprechungen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Nur vor dem Hintergrund dieser Intentionen sind auch die kritischen Analysen der 'entfremdeten Arbeit' und der Abhängigkeit aller Individuen von objektivierten Zusammenhängen der Wirtschaft ... in ihrer Relevanz zu erkennen“. Man kann in dieser These unschwer ein Leitmotiv erkennen das auch die im Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entstandenen, im vorliegenden Band versammelten Aufsätze Fetschers verbindet. Das Dilemma, mit dem sich eine fortschrittliche Gesellschaftstheorie heute konfrontiert sieht, erblickt Fetscher darin, daß einerseits die katastrophischen Folgen eines verselb- Bücher zum Thema ständigten ökonomischtechnologischen Wachstums - als eine der gravierendsten, Fetscher die Nivellierung und Vernichtung differenter Kulturen betont - die demokratische Kontrolle der Produktionsmittel und eine weitreichende gesellschaftliche Umgestaltung erfordern, andererseits die herkömmliche marxistische Konzeption unzureichende Antworten bietet. Denn gleichwohl die marxistische Konzeption einer „Dialektik des Fortschritts“ problembewußte Aspekte enthält, was Fetscher, intimer Marxkenner, durch verblüffend aktuelle, wenig bekannt Zitate belegt, so bleibt sie doch generell einem optimistischen Fortschrittsparadigma verhaftet, das seine theoretische Grundlage in einem dynamischen, universalistischobjektiven Vernunftbegriff hat und in praktischer Hinsicht auf dem Primat der Entfesselung der Produktivkräfte als Voraussetzung einer sozialistischen Weltgesellschaft basiert. Die als Folge dieses Konzepts als unbedingt notwendig begriffene Überwindung aller traditionalen Bindungen und kulturellen Unterschiede läßt aus heutiger Sicht auch den „Eurozentrismus“ dieses Modells hervortreten. Angesichts der Dynamik destruktiver Potenzen eines reduktionistisch an das ökonomisch-technologische Wachstum gekoppelten Fortschrittsbegriffs, hat die linke Gesellschaftstheorie mehr denn je die Aufgabe eines komplexen Entwurfs, der einerseits die humanen und aufklärerischen Potenzen des herkömmlichen Begriffs gesellschaftlicher Vernunft auslotet und aufhebt, wie diese durch eine Perspektive des Bewahrens erweitert. Der Weg, den Fetscher hierbei - in der Nachfolge der Kritischen Theorie - einschlägt, ist der einer Doppelstrategie. So macht Fetscher den Grundwiderspruch neokonservativer Ideologien transparent, einer Idiosynkrasie gegenüber den Folgen einer Entwicklung, „die sie gleichwohl für das Non-Plus-Ultra der Geschichte hielten“. Letzteres trifft ebenso auf die „postmodernistische“ Variante des Neokonservativismus, die Kompensationstheorie des Ritter-Schülers Odo Marquard zu, dessen Postulat einer Kultur der Vieldeutigkeit einem Verzicht auf jegliche Wahrheits- und Geltungsansprüche geschuldet ist, was letztendlich auf die Affirmation der kruden Faktizität hinausläuft. Demgegenüber hält Fetscher daran fest, daß nur unter veränderten strukturellen Bedingungen das Ziel einer Wiederherstellung der Vielfalt gesellschaftlicher und kultureller humaner Umgangs- und Lebensformen realisierbar sei. Dies impliziert jedoch die Überwindung einer optimistischen Fortschrittsdynamik, die sich der Einsicht verdankt, daß gerade im allgemeinen Überlebensinteresse der Menschheit die Bewahrung des Differenten und Vielfältigen gefordert ist. Die postulierte Toleranz schließt jedoch für Fetscher den Anspruch auf Wahrheit und Verbindlichkeit von Normen, wie den Menschenrechten, nicht aus, sofern sie sich im „freien Diskurs“ beweisen und nicht gewaltsam durchgesetzt sind. Daß Fetscher dieses Ziel als ethisches bestimmt, versteht sich als Korrektiv eines bloß interessegeleiteten Standpunktes, der in dieser Verkürzung selbst noch durch die instrumentelle Vernunft stigmatisiert ist. Fetschers ethisches Modell eines freien Diskurses über die Verbindlichkeit allgemeiner Normen, die zugleich „das Recht man selbst zu sein“ einschließt, hat seinen theoretischen Bezugspunkt in der „Diskursethik von Habermas und Apel. Die Crux dieser Argumentation scheint mir darin zu liegen, daß ein solches ethisches Konzept, will es nicht bloß „regulative Idee“ sein, auch zu eingreifender Stellungnahme verpflichtet ist. Diese könnte jedoch die Kritik der realen Machtkonstellationen nicht ausschließen, d. h. hätte also auch „Kritik der Politischen Ökonomie“ zu sein. Hier wird, nach meinem Dafürhalten der Mangel einer Diskursethik evident, die glaubt, das „Produktionsparadigma“ verabschieden zu können. Auf einen Dissens zu Habermas weist Fetscher explizit im Kontext seiner Überlegungen zur politischen Kultur in Deutschland hin, wenn er im Unterschied zum Habermas- schen „Verfassungspatriotismus“ für einen „Patriotismus“, der auf realer gesellschaftlicher Veränderung beruht, plädiert. Fetscher zeigt sich darin nicht zuletzt der Ethik des „aufrechten Gangs“ Ernst Blochs verpflichtet. Im Zusammenhang der heute virulent geforderten Infragestellung überkommener linker Konzepte und dem Bedarf an neuen Überlegungen bietet das Buch Iring Fetschers einen lesenswerten Diskussionsbeitrag. Georg Koch Robert Kurz Der Kollaps der Modernisierung. Vom Zusammenbruch des Kasernensozialismus zur Krise der Weltökonomie Reihe DIE ANDERE BIBLIOTHEK, Bd.82, hg. von Hans Magnus Enzensberger, Frankfurt/Main 1991 (Eichborn-Verlag), 291 S., geb., 44.- DM. Es ist schon beeindruckend, wenn ein Untergangsprophet marxistischer Herkunft, wie Robert Kurz, unmittelbar nach dem Sieg des Realen Kapitalismus in großen Zeitungen, mitunter auf einer ganzen Seite, rezensiert wird. Er ist auf Platz eins der Bücherliste der Süddeutschen Zeitung vorgedrungen und die erste Auflage seines Buches soll schon verkauft sein. Bücher zum Thema Diese Zeichen deuten darauf hin, daß hier der Zeitgeist an einer empfindlichen Stelle getroffen wurde. Das Bedürfnis, sich das überraschende historische Ende des Realen Sozialismus zu erklären, trifft sich mit dem allgemeinen Unbehagen, die Zukunft des siegreichen Gesellschaftsmodells könnte nicht nur große Gefahren und Ungewißheiten, sondern möglicherweise sogar auch seinen Untergang mit einschließen. Diese Konstellation ist der Ausgangspunkt der Kurz'schen Analyse. Von der Konstitution der realsozialistischen Kommandoökonomie über ihren Zusammenbruch spannt Robert Kurz den Bogen bis zur „Krise des warenproduzierenden Weltsystems“. Die Idee, das dem westlichen scheinbar entgegengesetzte System des Realen Sozialismus als Fleisch vom eigenen Fleische zu betrachten und die Zusammenbruchskrise des Ostens als Teil einer Weltkrise des gesamten Systems von Geld und abstrakter Arbeit zu denken, ist für große Teile der Intelligenz offenbar so frappierend, daß sich daraus auch das große Interesse an dem Buch erklären läßt. Theoretische Grundlage des Ansatzes von Kurz, der von einem hegelianisierenden Marxismus herkommt, ist die Kritik der abstrakten Arbeit. Die Kritik und Krise der „Arbeitsgesellschaft“ betrifft den Marxismus der Arbeiterbewegung ebenso wie die sie reichen Marktwirtschaften. Die abstrakte Arbeit wird mit dem Wert als gesellschaftliche Basiskategorie gesetzt, woraus sich die Selbstbewegung des Geldes in der modernen Warenproduktion ergibt, für die eine Bedürfnisbefriedigung in Form von Gebrauchswerten nur noch als sekundärer Aspekt erscheint. Mit der Kritik des (ökonomischen) Wertes als der verdinglichten abstrakten und toten Arbeit, in dem die sinnlichen Qualitäten der Produkte ausgelöscht sind und die gesellschaftlichen Verhältnisse die Form der Herrschaft toter Dinge annehmen (S.280f), erschließt Kurz dem Leser die tiefere Dimension Marxscher Gesellschaftskritik, die unter einem vordergründigen Klassenkampfkonzept verschüttet worden war. Mit der Mystifizierung der Klasse und dem Fehlen einer Kritik der Warenform konnte „die vermeintliche Befreiung vom Kapitalverhältnis als Entmachtung der 'Kapitalisten' erscheinen, oder schlimmstenfalls als deren jakobinische Liquidierung“ (S.46). Der „epigonale“ Marxismus, der seine Kritik nur auf den Mehrwert als unbezahlte Arbeit richtete und sein Ziel also letztlich in der gerechten Verteilung von Werten sehen mußte, gehört mit dem Realen Sozialismus „selbst dem bürgerlichen warenproduzierenden System an“ (S.21) und ist mit ihm zum Untergang verurteilt. Wichtig für einen weiteren produktiven Umgang mit der Marx'schen Theorie ist die Unterscheidung von zwei historischen Logiken, dem Kampf der Arbeiterklasse und der Selbstbewegung des Geldes, die bei Marx zusammengespannt werden. Kurz ist einer der wenigen, der erkannt hat, daß der „Klassenstandpunkt“ auch bei Marx in Wahrheit unvereinbar ist mit seiner eigenen Kritik der Politischen Ökonomie, weil in dieser die Arbeiterklasse als eine vom Kapital konstituierte Klasse erscheint (S.74f). Auf dieser Grundlage entwickelt Kurz seine Theorie des notwendigen Zusammenbruchs der östlichen Ökonomien. Er erinnert daran, daß auch im Westen der Staat, insbesondere seit dem Merkantilismus, dem warenproduzierenden System zum gesellschaftlichen Durchbruch verholfen hat. Der bürgerliche Vernunftstaat Fichtes einer geplanten Warenproduktion sollte nach der jakobinischen Oktoberrevolution in die Tat umgesetzt werden. Der besondere Charakter einer 'nachholenden' ursprünglichen Akkumulation bedingt die stalinistische Brutalität und die größere Bedeutung des Staates, gemessen an der Frühzeit des westlichen Kapitalismus. Auf diese Weise entstand ein warenproduzierendes System ohne die Dynamik der Konkurrenz als Motor der Produktivität. Dessen Letalität als Dauereinrichtung wurde nach der Phase extensiver Mehrwertpro- duktion erst in den siebziger und achtziger Jahren sichtbar, als die (mikroelektronische) Produktivitätsrevolution im Westen die Gültigkeit des Wertgesetzes über den Weltmarkt auch für die östlichen Binnenökonomien zunehmend krisenhaft praktisch werden ließ (S.146ff). Mit vielen Beispielen veranschaulicht Kurz ein Strukturdilemma des „geplanten Marktes“, mangels Konkurrenz die Gebrauchswertbedürfnisse der Konsumenten nicht befriedigen zu können. Er befaßt sich allerdings nicht mit der Frage, wie ein nicht warenproduzierendes System ohne diese Dynamik eine angemessene Versorgung sicherstellen könnte. Die Zukunft des Ostens und der Dritten Welt malt er in düsteren Farben. Der Grund ist im Produktivitätsniveau auf Weltmarktebene zu suchen. Eine in höchstem Grade kapitalintensive Produktion mit einem enormen Aufwand an Wissenschaft und Infrastruktur läßt in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt nicht nur den Osten und den Süden, sondern auch schon die westliche Peripherie, schlechten Zeiten entgegengehen. Aber auch das Zentrum wird von dieser Entwicklung eingeholt: Die Zerstörung von produktiver Kaufkraft korrespondiert mit der Ausweitung von Verschuldung und Kredit, der globale Verteilungskampf wird begleitet von der großen Verschuldungskrise. Damit Bücher zum Thema steht für Kurz die kapitalistische Weltökonomie noch vor der Jahrtausendwende am Abgrund: „Das absolut und relativ beispiellose Schuldengebirge ist ein klares Indiz dafür, daß die erreichte Produktivität auf Weltebene den Formzusammenhang der abstrakten Arbeit und des gesamten Fetischsystems der Moderne zu sprengen beginnt“ (S.247). Die zunehmend destruktiven Folgen der abstrakten Logik des Geldes für Mensch und Umwelt lassen für Kurz nur noch die Perspektive der „radikalen Abschaffung der modernen Ware und ihres Weltsystems“ (S.270) akzeptabel erscheinen. Dazu müßte eine gesellschaftliche Bewegung den Gesamtzusammenhang des Gesellschaftsprozesses erkennen können. Damit ist Kurz mit dem Ideologiedilemma einer modernen Revolutionstheorie konfrontiert. Die „Abschaffung“ ist nicht im Sinne des traditionellen linken Voluntarismus gedacht, sondern die kommunistische Vergesellschaftung der Menschheit liegt in inhaltlichstofflicher Form bereits vor, allerdings in verkehrter negativer Form eines Kommunismus der Sachen (S.265). Damit wäre, nach dem berühmten Wort von Marx, nur noch die Hülle zu sprengen... Natürlich gibt es an den Vorstellungen von Kurz einiges zu kritisieren; etwa die Tendenz zur Kritik der Abstraktion als solcher, die noch den Einfluß Alfred Sohn-Rethels erkennen läßt. Die weitgehende Gleichsetzung von abstrakter Arbeit und Wert findet sich auch so nicht bei Marx, der zwar ihre Verselbständigung in einer eigenen gesellschaftlichen reproduktiven Form kritisiert, aber sehr wohl einsieht, daß auch eine nicht warenproduzierende arbeitsteilige Gesellschaft mit abstrakter Arbeit rechnen muß. Die Kritik der Aufklärung, die den abstrakten (männlichen) Universalismus durch einen Begriff „sinnlicher Vernunft“ (S.279) ersetzen will, weist ebenfalls in die Richtung einer etwas überzogenen universalen Abstraktionskritik. Man könnte auch über gegenläufige, retardierende und anachronistische Elemente nachdenken, die sich der von Kurz erwarteten Krisendynamik entgegenstellen, aber das kann getrost die durch das Buch hoffentlich ausgelöste Diskussion einlösen. Insgesamt ist „Der Kollaps der Modernisierung“ für den philosophisch Gebildeten ein gefällig zu lesendes Buch, reich an Anregungen und eine Pflichtlektüre für Linke, die bereit sind, gründliche Gesellschaftsanalyse und -kritik mit der Selbstaufklärung über die eigene historische Beschränktheit zu verbinden. Gerhard Nagl Georg Lohmann Indifferenz und Gesellschaft. Eine kritische Auseinandersetzung mit Marx Frankfurt/Main 1991 (Suhrkamp), S., DM. Wie soll man auf den Vorwurf reagieren, die Marxsche Theorie verfahre reduktionistisch, wenn sie ihren Gegenstand - die moderne Gesellschaft - als entfremdete, abstrakte oder scheinbeladene soziale Formation beschreibt? In den Diskussionen um die Marxsche Theorie stößt man in der Regel auf drei Reaktionstypen: 1. Der Vorwurf wird postwendend an den Gegenstand zurückgeleitet: Die Beschreibung sei nichts anderes als die notwendige mimetische Angleichung an den reduktionistischen Gegenstand. 2) Man verabschiedet die inkriminierte Beschreibung und ersetzt sie durch andere, z.B. empiristische, strukturalistische oder systemtheoretische Beschreibungsmodelle. 3) Man konstruiert eine Mischform aus 1) und 2): Die Art und Weise der Beschreibung wird grundsätzlich als ihrem Gegenstand adäquat eingestuft, man hält sie aber insofern für korrekturbedürftig, als ihr Geltungsbereich näher zu bestimmen ist und allfällige ideelle Überzeichnungen des reellen Reduktionismus zu vermeiden sind. Die Studie „Indifferenz und Gesellschaft“ von Georg Lohmann gehört diesem letzten Reaktionstypus an. Sie präsentiert eine gleichsam korri- gierte Marxsche Beschreibung der abstrakten bürgerlichen Produktionsform, wobei sie sich nicht so sehr die Auseinandersetzung mit alternativen Beschreibungsmodellen, als vielmehr die Restrukturierung mit eigenen Mitteln den Leitfaden bildet. Lohmann macht den von Marx eher selten verwandten Begriff der Indifferenz zum operativen Begriff. Indifferenzphänomene der Marxschen Theorie wie Entfremdung, Versachlichung, Fetischcharakter, Realabstraktion sollen dabei auf einen differenzierten Begriff Indifferenz gebracht werden. Indifferenz wird am besten mit Gleichgültigkeit übersetzt. Gleichgültig ist uns etwas dann, wenn es keine Rolle spielt, ob wir etwas als a oder b bestimmen, ob wir in einer Situation a oder b tun. Mit gleichgültig meinen wir häufig aber auch, daß in einer dyadischen Relation beide Relata einander fremd sind oder auch sich zueinander als beliebig bzw. austauschbar verhalten. Gleichgültigkeitsverhältnisse können eine Sache betreffen, so wenn zwei Gebrauchswerte unter dem Tauschwert äquivalent, d.h. an einem äußeren Maßstab gemessen werden. Sie können aber auch Personen in ihrem Verhalten zu Sachen oder anderen Personen betreffen. Sofern Personen indifferent unter dem Diktat des Tauschwertes handeln, kann man von einer Form von Herrschaft bzw. Unterwerfung sprechen. Auf Bücher zum Thema dem Hintergrund dieser und ähnlicher Unterscheidungen, die zu einem großen Teil der Hegelschen Seins und Wesenslogik entlehnt sind, interpretiert der Autor Teile der Marxschen Frühschriften und die einschlägigen Kapitel des 1. Bandes des „Kapital“. In minutiöser Form wird aufgezeigt, welche Indifferenzverhältnisse jeweils im Spiel sind und wie sie von Marx bewertet werden (bzw. aufgrund seiner Vorgaben bewertet werden müßten). Spannend wird die Untersuchung dort, wo der Autor von der Ebene der Interpretation auf die Ebene der Kritik an Marx mit Marx überwechselt. Lohmann versucht jeweils jene Orte aufzuspüren, wo die Marxsche Beschreibung von Indifferenz die Sache der Indifferenz aus den Augen verliert. Der Hauptort liegt seiner Meinung nach in der Marxschen Behandlung der rechtlichen Verkehrsverhältnisse, die mehr oder weniger explizit in der Zirkulationssphäre des Warentausches angesiedelt sind. Dies gilt jedenfalls für die „Grundrisse“, wo Marx darstellt, wie die bürgerlichen Rechtsideale der Freiheit und Gleichheit in Form des abstrakten Rechtes zwar die Unfreiheit bzw. Ungleichheit in der Produktionssphäre verdecken, aber in der Zirkulationssphäre immerhin realisiert sind. Auf den Punkt gebracht lautet Lohmanns Kritik, Marx habe diese Rechtsideale im Übergang zum „Kapital“ teils ausgeblendet, teils rechtsfunktionalis- tisch verkürzt. Lohmann folgt darin weitgehend der Marx-Kritik von Habermas: Marx gleiche das abstrakte Recht funktional der ökonomischen Zweckrationalität an, müsse deshalb dessen sittliche und moralische Momente (Anerkennung, Gerechtigkeit) verkennen und beraube sich damit eines wertvollen Werkzeugs der Kritik der politischen Ökonomie. Die Tatsache, daß Marx rechtliche Indifferenzverhältnisse nicht hinreichend von ökonomischen abhebe, führe gar dazu, daß sein Konzept der „kritischen Darstellung“ der bürgerlichen Gesellschaft in einem „Kollaps“ ende. Sie setze nämlich kritisch mit einer diesen Rechtsidealen entsprechenden Gerechtigkeitsvorstellung an, welche mittels der Darstellung sodann negiert werde. Die Folge sei ein Ausweichen auf eine „transzendierende Kritik“. Zu den Elementen dieser „transzendierenden Kritik“ zählt Lohmann u.a. den „historischen Materialismus“ in seiner Auffassung der Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen und Produktionsverhältnissen sowie die „produktivistische“ Perspektive, d.h. Marx' Favorisieren einer Idee der selbstverwirklichenden Arbeit. Lohmanns Kritik an Marx' Beschreibung und Bewertung indifferenter Rechtsverhältnisse ist überzeugend. Bedenkt man, welche Auswirkungen das Fehlen eines die Individualsphäre garantierenden Rechtssystems im realen Sozialis- mus gehabt hat, wird man ihr auch nicht absprechen können, daß sie auf einen historisch folgenreichen Mangel der Marxschen Indifferenzdiagnose hinweist. Weniger überzeugend sind dagegen seine Ausführungen zum Verhältnis von „immanentem“ Konzept der „kritischen Darstellung“ und „transzendierender Kritik“ bei Marx. Hier ist man mit gutem Grund versucht, Marx auch gegen Lohmann zu lesen. Der Autor bezieht das Konzept der „kritischen Darstellung“ zur Hauptsache auf ein Verhältnis von gerechter Zirkulationssphäre und ungerechter Produktionssphäre der bürgerlichen Produktionsund Kooperationsform. Undurchsichtig bleibt, wo und wie Lohmann die formations- und systemtheoretischen Ansätze des Marxschen Konzepts und deren spezifische Widerspruchsformen und Kritikpotentiale unterbringt. Rechnet er sie einer 'transzendierenden kritischen Darstellung' zu? So wird beispielsweise kaum einsichtig, weshalb das Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen in toto einer „transzendierenden Kritik“ zugeschlagen wird. Denn dieses Verhältnis fungiert ja nicht nur als ein äußerliches geschichtsphilosophisches Konstrukt, ist es doch vielmehr auch kardinaler Teil der krisentheoretischen Darstellung. Wie heutige Regulationstheorien zeigen, ist die Dynamik der modernen bürgerlichen Gesellschaft kaum verständlich ohne die Reflexion über das Verhältnis von technologischen Schüben und Umwälzungen von Akkumulationsweisen. Lohmann verkürzt den Begriff der Darstellung in einer Weise, der sich mit den Marxschen Texten schwer rechtfertigen läßt. Bekanntlich verwendet Marx den Terminus „Darstellung“ sowohl in Beziehung zu dem der „Forschung“ als auch zu dem der „Kritik“. Im ersten Falle wird damit die Methode der Erkenntnisproduktion bezeichnet, im zweiten das konkret darzustellende System der politischen Ökonomie. Folgt man dem für das Programm der Kritik der politischen Ökonomie wichtigen Methodenkapitel in der „Einleitung“ von 1857, auf das auch Lohmann kursorisch eingeht, so wird deutlich, daß der Sache nach beide Bedeutungen auf einen Gegenstand der politischen Ökonomie bezogen sind, der neben zentralen Kategorien wie Wert, Geld, Arbeit auch formationstheoretische und entwicklungsgeschichtliche Zusammenhänge umfaßt. Eine solche Klärung des Marxschen Begriffs der Darstellung ist von mehr als nur textexegetischer Bedeutung. Mit Marx einen weiten, komplexen Begriff der Darstellung vorauszusetzen, ist vermutlich nicht weniger folgenreich als das Aufzeigen der Marxschen Mängel in Sachen normativer Kritik. Denn die Forderung einer am Maßstab von Gerechtigkeit und Moralität gemessenen Lebensform Bücher zum Thema ist nicht ablösbar von der Forderung einer möglichst vollständigen Darstellung desjenigen, welches gerechter und moralischer werden soll. Martin Bondeli Niklas Luhmann / Karl Eberhard Schorr (Hg) Zwischen Anfang und Ende. Fragen an die Pädagogik Frankfurt/Main 1990 (Suhrkamp), 227 S., 16.- DM. Mit dem hier vorgestellten Buch liegt die dritte von N. Luhmann und K.E. Schorr herausgegebene Aufsatzsammlung mit systemtheoretischen Beiträgen zur Pädagogik und zu Erziehungstheorien vor. Wieder geht es um ein „Reizthema“ für Pädagogen, ohne daß aber „zur Selbsthermeneutisierung des Berufsstandes“ eingeladen werden soll. Die „üblichen 'einheimischen' Begriffe werden nicht verwendet, denn die Anregungen sollen Brüche zwischen den Bildungsvorstellungen und der Sprache der Pädagogen einerseits und den Strukturen des Erziehungssystems in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften andererseits deutlich machen. Die Leitfrage nach den Funktionen und Hintergründen einer genauen Periodisierung von Erziehungs- und Bildungsprozessen wird mit den Beiträgen des Bandes thematisch vielfältig behandelt. Unter anderem geht es um die Schulerziehung, eine methodische Organisation des Unterrichts, um schulische Reformprojekte und die Konzepte der Berufsausbildung. Im folgenden wird nur auf diejenigen Beiträge näher eingegangen, in denen es um die systemtheoretischen Hintergründe der Fragestellung geht. Luhmanns Beitrag „Anfang und Ende. Probleme einer Unterscheidung“ behandelt die Schwierigkeit überhaupt, genau bestimmen zu können, wann wer was anfängt und beendet, und wie ein Anfang und ein Ende beobachtet werden können. Aus Luhmanns Sicht gilt eine Beobachtung von Anfang und Ende als deren Unterscheidung und als deren Festlegung. Eine solche Festlegung trägt paradoxe Züge, da stets bereits etwas angefangen hat oder zu einem Ende gekommen ist, wenn Anfang und Ende unterschieden werden. Die Unterscheidung trifft eine Auswahl unter Momenten einer Vorher/Nachher-Unterscheidung die jeweils auch Anfang und Ende betrifft. Wird in einem System, z.B. im Erziehungswesen, der Anfang eines Prozesses festgelegt, ist schon etwas im Gange, was gerade zum Feld des jeweiligen Prozesses gehört. Soziale Systeme - von Luhmann aus der Perspektive einer „allgemeinen Theorie sozialer Systeme“ betrachtet - gehen zu ihrer eigenen Unterscheidungsleistung und zu de- ren Ergebnissen ein paradoxes Verhältnis ein, denn die eigene Urheberschaft wird sowohl zu- als auch abgesprochen. Einerseits führen die Unterscheidungen über Selektionen Willkürmomente mit sich und das Unterschiedene fiel ehedem als „Umwelt“ nicht oder zumindest in anderer Prägung unter die Differenzierungsleistung des Systems. Das System kann sich seiner Einflußnahme vergewissern. Andererseits werden die selbst erzeugten Differenzen objektiviert und für notwendig gegeben gehalten, obwohl sie auch anders hätten ausfallen können, für kontingent also. Die Willkürmomente gehen in die Kontingenzerfahrungen über, wobei sich ein System sowohl das Willkürliche als auch das Notwendige selbst zuschreiben muß. Luhmann betrachtet die Paradoxie der Selbstreferenz in der Zuweisung von Unterscheidungen, die sich auch am besagten Problem des Anfangs zeigt, von einer Reflexionsebene aus, die diese Paradoxie ausdrücklich zum Gegenstand macht. Ziel ist eine Distanzierung von dieser Paradoxie. Die Systemtheorie versucht hierbei, die paradoxe Differenz des Eigenen und des Äußeren in sozialen Systemen als durch sie selbst, die Systemtheorie, erzeugt zu konstruieren. Unter dem „Postulat eines rekursiven Beobachtens von Beobachtern“ soll selbst noch eine Selbstreferentialität der paradoxen Selbstreferenz als durch die Theorie produziert verstanden werden können. Die Position einer Beobachtung von Beobachtern ermöglicht der Systemtheorie in Anwendung auf die Pädagogik, auf einen Bruch zwischen Funktion und Selbstzuweisung hinzuweisen, wenn es um die Festlegungen von Anfang und Ende in Erziehungsprozessen geht. Die Distanzierung von der „Paradoxie des Anfangs“ ist der Pädagogik gerade nicht oder nur begrenzt möglich. Im funktional orientierten Erziehungssystem moderner Gesellschaften können Operationen und Beobachtungen nicht derart unterschieden werden, daß eine Korrektur paradoxer Unterscheidungen durch deren Beobachtung möglich wäre. Das unterschätzte Problem des Anfangs radikalisiert sich zum Beispiel dadurch, daß auf Lebensläufe Bezug genommen wird, als begänne man jeweils mit einer tabula rasa. Erziehungsprozesse werden periodisiert durch bestimmte Organisationsformen, etwa durch eine Alters- und Terminfestlegung in der schulischen und beruflichen Ausbildung. Damit werden die Faktoren, die bei Lernvorgängen eine Rolle spielen, zum Gegenstand einer zugleich gezielten und willkürlichen Auswahl, und es werden unterschiedliche Voraussetzungen homogenisiert. Eine Homogenisierung ist Voraussetzung für eine angestrebte Heterogenisierung, denn die Unterscheidung guter und schlech- Bücher zum Thema ter Leistungen setzt auf eine Abweichungsverstärkung (N. Luhmann: Die Homogenisierung des Anfangs. Zur Ausdifferenzierung der Schulerziehung; K.E. Schorr: Erziehung als Periode. Über die Organisation von Anfang und Ende). Die pädagogische Ausfüllung der Festlegungen macht die Urheberschaft der Pädagogik undurchsichtig. Zielvorstellungen, Sinnzuweisungen und eine technologische Gestaltung von Lernprozessen - „Fallen“ - bewegen sich in zum Teil traditionell besetzten festen Schemata, die einen Einblick in die allererst erzeugte Periodisierung von Erziehung verdecken. Die segmentierten Kontexte werden so mit integrierten Kontexten verwechselt (vgl. auch J. Oelkers: Vollendung. Theologische Spuren im pädagogischen Denken). Auch wird leicht durch eine traditionsbezogene Kennzeichnung von Ausbildungsprozessen deren funktionale Einbindung undeutlich (K. Harney: Zum Beginn von Anfang und Ende. Tradition und Kontingenz der Berufsausbildung am Beispiel schwerindustrieller Betriebsformen). Aus Luhmanns und Schorrs Sicht ist die Pädagogik dem Problem einer paradoxen Festlegung von Anfängen nicht gewachsen. Sie überschätzt die Reichweite einer Periodisierung des sozialen Geschehens, aber „eine Funktionsorientierung ist mit der Willkür des Anfangs der Prozesse kompatibel. Sie nimmt etwas zur Kenntnis, 'sofern' es für sie relevant ist“. Neigen nun die Pädagogen und die Erziehungstheoretiker dazu, das nicht zu sehen, und gehört dies gerade zu ihrer Funktion, bleibt der Frage nachzugehen mit welchen Absichten und Erwartungen die systemtheoretischen Fragen an die Pädagogik gerichtet sind. Luhmann vermutet, daß die undurchsichtige „Einschnitthaftigkeit“ bislang undurchschaute Folgen hat, „über die die Pädagogenschaft Rechnung ablegen kann - oder jedenfalls Rechenschaft ablegen sollte“. Kann sie das, wenn die Paradoxie der Festlegungen mit zur Funktion der Pädagogenschaft im Erziehungssystem gehört? Luhmann und Schorr schreiben, daß bisher im „Schulleben“ keine „nennenswerten Rückwärtskorrekturen“ auszumachen seien, „so daß die Geschichte anders erzählt wird, als sie stattgefunden hat“. Selbst eine Vorwegnahme von Zynismusvorwürfen müßte mit der Möglichkeit einer Verunsicherung von Selbstzuweisungen der Pädagogenschaft rechnen. Bei der offengelassenen Frage nach einer folgenreichen Resonanz der Überlegungen kann es aber nicht nur um eine Bereitschaft der Pädagogen zur Reflexion oder um die Barrieren ihrer Einbindung in das Erziehungssystem gehen. Der Hinweis auf eine Paradoxie der Festlegungen von Anfang und Ende geht auf die systemtheoretische Operation mit einer Unterscheidung zurück und damit auf die Grundla- gen der allgemeinen Theorie sozialer Systeme. Eine das eigene Tun auf dieser Ebene reflektierende Pädagogenschaft müßte immerhin solche Grundlagen teilen und von ihnen ausgehen. Eine weiterführende Erörterung hätte sich zunächst mit den system- und damit auch theoriebezogenen Immanenzansprüchen der Systemtheorie zu beschäftigen. Ignaz Knips Jean-Francois Lyotard Die Mauer, der Golf und die Sonne. Eine Fabel Wien 1991 (Passagen-Verlag), br., 38 S., 12,80 DM. Auf das Scheitern der großen Erzählungen des Christentums oder der Aufklärung folgen die kleinen Erzählungen, die Fabeln. Die Fabel, die Lyotard erzählt, will informell und unaufdringlich sein: ein Traum, den die postmoderne Welt über sich selbst träumt. Und vor allem: ihr Held ist nicht mehr der Mensch. Ein Teil der Fabel trägt die Überschrift „Sonne“ und beginnt mit der Entstehung der Galaxien, der Milchstraße und unseres Sonnensystems. Sie fährt fort mit der Urgeschichte der Erde, mit der Entstehung der Zellen, ihrer Differenzierung, ihrer Fähigkeit zur Selbstreproduktion und der Entstehung von Pflanze, Tier und Mensch. Sprache, Reflexion und die Entwicklung materieller Techniken ermöglichen den Fortschritt der menschlichen Gesellschaft über die neolithische und die industrielle Revolution zum Sieg der liberalen Demokratie. Mit ihr ist die soziale Evolution abgeschlossen. Nichts kann ihr Ende herbeiführen als das Verglühen der Sonne, das eines Tages die Existenz des Menschen überhaupt auszulöschen droht. Auf der Grundlage der liberalen Demokratie wird daher die wissenschaftliche Forschung vorzüglich dem Problem gewidmet, den Menschen so anzupassen, daß sein Gehirn auch nach dem Ende unseres Sonnensystems fähig bleibt, mit den im Kosmos verbleibenden Energieformen zu arbeiten. Hier endet die Fabel. „Wie der Mensch und 'sein' Gehirn, oder besser das Gehirn und sein Mensch am Tage dieser letzten irdischen Herausforderung aussehen werden, erzählt die Geschichte nicht.“ (S.38). Der Fall der Berliner Mauer und der Golfkrieg rangieren in dieser Fabel selbstredend nur als Marginalien oder „Zwischenfälle“. Sie tragen durch das Zurückdrängen bürokratischer Staatsformen bzw. durch eine verbesserte Kontrolle über fremde Energiequellen dazu bei, den Sieg der liberalen Demokratie zu befestigen. „Mauer“ steht nicht nur für den Untergang des realen Sozialismus, sondern auch für den Fall der marxistischen Theorie mit ihrem Mythos des Proletariats als eines autonomen, kollektiven Sub- Bücher zum Thema jekts. „Golf“ dagegen repräsentiert das Ende der religiösen, fundamentalistischen Begründung staatliche Autorität. In modernen oder postmodernen Systemen ist Autorität eine Sache des Arguments, das bestimmten Individuen oder Gruppen auf Zeit delegiert wird, also weder der staatlichen Bürokratie noch der Religion. In ihnen herrscht Offenheit und diese Offenheit steigert ihre Leistungsfähigkeit. Geschlossenheit und Isolation dagegen lassen ein System im Wettkampf unterliegen oder der Entropie verfallen. „Mauer“ und „Golf“ symbolisieren so das Scheitern falscher Alternativen zur liberalen Demokratie. Lyotard entwickelt seine Analyse in Frontstellung zur liberalen und der marxistischen Analyse; beide scheinen ihm der gegenwärtigen Situation nicht gerecht zu werden (S.25). Das mag allerdings auch daran liegen, daß sich bei einer Perspektive, die vom Urknall bis zum Verglimmen unseres Sonnensystems reicht, die Konturen für geschichtliche Ereignisse oder Theorien etwas verwischen. Liberale Theorie erscheint von dieser erhabenen Warte aus als gleichbedeutend mit amerikanischer Propaganda (Saddam Hussein = Tyrann, Araber = hysterische Fanatiker), marxistische Theorie als gleichbedeutend mit der Ideologie Breschnews (Dritte Welt im Kampf gegen den Imperialismus = Proletariat). Eine differenziertere ZurKenntnisnahme geschweige denn Auseinandersetzung mit beiden Theorien und ihren Analysen der Gegenwart findet nicht statt. Mit seiner Fabel kehrt Lyotard nach eigener Aussage zur politischen Kritik der 50er und 60er Jahre zurück, zur sog. „Situationsanalyse“, wie er sie gemeinsam mit Cornelius Castoriades und Claude Lefort innerhalb des Projekts „Socialisme ou Barbarie“ betrieben hat. Situationsanalyse hieß damals: aus der Analyse einzelner, bedeutender Ereignisse ein zutreffendes Bild der Welt zu formulieren, das auch eine Perspektive politischen Handelns ermöglichen sollte. Zugleich macht Lyotard deutlich, was sich seit damals geändert hat, nämlich die Zielrichtung. Die Praxis des Intellektuellen ist heute wesentlich die Theorie. Noch immer geht es um die Rechte von Minderheiten, von Frauen, Homosexuellen, um die Interessen der Armen oder der Dritten Welt. Die Mittel aber, die dafür eingesetzt werden, sind nurmehr das geschriebene Wort, die Unterschrift unter Petitionen, die Organisation von Konferenzen, der Beitritt zu Kommitees etc. Das Ziel, das die Intellektuellen verfolgen, bezeichnet Lyotard nach wie vor mit dem Begriff der Emanzipation. Doch auch hier ist die Zielrichtung eine andere geworden. Einerseits ist Emanzipation nicht mehr das eine Ziel, sondern ein Ziel unter vielen. Es kann, wenn überhaupt, nur noch in den vielen Un- terbereichen der Arbeit, Sexualität, Rasse, Kultur etc. verwirklicht werden. Darin liegt gegenüber dem früheren Utopismus sicher eine bedeutende Wende zur Realität. Andererseits erschöpft sich die Emanzipation für Lyotard aber auch in den Grenzen der bestehenden Verhältnisse. Die Gesellschaft muß nicht mehr verändert, sie muß nur ihren eigenen Möglichkeiten entsprechend entwickelt werden. Damit vollzieht sich bei den Intellektuellen ein Wechsel von einer offensiven zu einer defensiven Strategie. Die Energie, die für eine defensive Strategie benötigt wird, beträgt nach Clausewitz nur ein Siebentel der offensiven. Ob dabei aber, wie Lyotard behauptet, der Effekt der gleiche bleibt, möchte ich bezweifeln. Konrad Lotter Roberto Ohrt Phantom Avantgarde. Eine Geschichte der Situationistischen Internationale und der modernen Kunst Hamburg 1990 (Edition Nautilus) geb., 336 S. (200 S/W-Abbildungen und 16 Farbtafeln), 88.- DM. Der Versuch einer Bestimmung des gesellschaftlichen Orts des Intellektuellen ist unabdingbar mit den Antinomien der modernen Kunst verknüpft. Kritische Theorie der Gesellschaft und Selbstverständnis der modernen Kunst vermitteln sich in der Konzeption der Kunst als Antithese zum ökonomisch-technischen Verdinglichungszusammenhang in dessen Destruktion die Utopie eines dysfunktionalen, repressionsfreien Lebens aufscheint. Aus heutiger Sicht scheint dieses Postulat zwar nicht eingelöst, aber gesellschaftlich eingeholt worden zu sein: Kunst als Korrektiv gesellschaftlicher Entfremdung ist inzwischen zum allgemein akzeptierten und praktizierten sozialtherapeutischen Programm erhoben und in das Selbstverständnis einer universellen Angestelltenmentalität eingegangen. Die offizielle Kunst wiederum scheint gegenwärtig - polemisch zugespitzt - zwischen den Polen ihrer Selbstauflösung durch Selbstverramschung und einer spektakulär inszenierten Re-auratisierung zu changieren. Gegen falsche Aufhebungen und Verlebendigungszwänge wie gleichermaßen gegen „Strategien des Vergessens“ und voreilige Verabschiedungen kann eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der modernen Kunst in mehrfacher Hinsicht erhellend sein: Sowohl um die historische Vermitteltheit der Gegenwart aufzuweisen, als auch, um in einem Prozeß forschender Erinnerung unabgegoltene subversive Potentiale freizulegen. Die von dem Hamburger Kunsthistoriker Roberto Ohrt vorgelegte „Geschichte der Situationistischen Internationale“ bietet hierfür wich- Bücher zum Thema tige Anregungungen. In dem sorgfältig recherchierten, auf umfangreichen Quellenstudien - die auch Resultate von Gesprächen mit noch lebenden Akteuren einbeziehen beruhenden Werk, das sich als „kritische Chronologie“ versteht, rekonstruiert der Autor die Genesis der SI im historischen Kontext der modernen Kunst. Die kritische Wiederanknüpfung der Nachkriegskunst an den Formationen der klassischen Avantgarde, des Dadaismus und Surrealismus fand ihren Ausdruck im Lettrismus, dem Guy Debord, der wichtigste Protagonist der SI entstammt. Den Lettrismus charakterisieren typische Momente der künstlerischen Avantgarde: das seismographische Reagieren auf die gesellschaftliche und technologische Entwicklung und als dessen Folge die theoretisch reflektierte, radikale Destruktion des tradierten Kunstbegriffs; die Erweiterung des künstlerischen Aktionsfeldes unter Einbeziehung der technischen Medien, insbesondere des Films; die Motive des Chocs, der Verfremdung und Dekonstruktion, der gezielten Provokation, des Urbanismus etc. Die zweite wichtige künstlerische Bewegung, aus der sich die SI konstituierte, war die Malergruppe COBRA, deren Protagonisten Asger Jorn und Constant in der SI den Gegenpol zu Debord bildeten. Die Grundintention der SI bestimmt sich als die Transponierung des experimentellen Charakters der Kunst auf das Alltagsleben, um dessen Veränderung und Revolutionierung durch Verflüssigung und Aufsprengen festgefügter Strukturen zu bewirken. „Das Ziel der Situationisten ist die unmittelbare Beteiligung an einem Überfluß der Leidenschaften im Leben durch die Umwandlung vergänglicher, mit voller Absicht gestalteter Momente. Das Gelingen dieser Momente kann nur in ihrer vorübergehenden Wirkung bestehen. Die Situationisten stellen sich die kulturelle Aktivität aus dem Blickpunkt der Totalität als eine Methode der experimentellen Konstruktion des alltäglichen Lebens vor, die mit der Ausdehnung der Freizeit und der Abschaffung der Arbeitsteilung (angefangen bei der Teilung der künstlerischen Arbeit) permanent entwickelt werden kann“ (176). Die SI verstand sich so als Erweiterung der kommunistischen Revolutionierung der Produktionsverhältnisse. Der zentrale Gedanke der permanenten Veränderung des Alltagslebens manifestiert sich im Programm des Drive, des Umherschweifens und sich von selbst erzeugten Situationen überraschen zu lassen. Die SI, die von 1958 bis 1972 existierte, scheiterte schließlich an der für die künstlerische Avantgarde charakteristischen Antinomie zwischen intendierter Selbstaufhebung in politischer Praxis und dem Anspruch, durch Überhöhung der Kunst, die Gesellschaft revolutio- nieren zu können. Die auf hohem reflexiven Niveau ausgetragene Auseinandersetzung zwischen politischem Aktionismus und experimenteller Kunst führte in letzter Konsequenz zum Ausschluß von Kunst und Künstlern. Die unterirdische Wirkungsgeschichte der SI in den sozialen und kulturellen Revolten reicht jedoch von der 68-er Revolution bis hin zur Punkbewegung und den urbanen Subkulturen der Gegenwart. Eine ausführliche Berücksichtigung erfährt in dem vorliegenden Buch auch die Münchner Sektion der SI, die Gruppe SPUR, deren Einfluß über die SUBVERSIVE AKTION bis hin zur KOMMUNE I sich erstreckt. Das gut geschriebene und spannend zu lesende Buch vermittelt so ein komplexes Bild der modernen Nachkriegskunst. Der philosophisch interessierte Leser hätte sich an manchen Stellen eine intensivere Diskussion der Konzeptionen der SI im Kontext des gegenwärtigen ästhetischen Diskurses gewünscht, zumal die Verbindungslinien bis hin zur französischen Philosophie der Gegenwart reichen. Immerhin werden die Berührungspunkte und Auseinandersetzungen mit H. Lefébvre oder Socialisme ou Barbarie angedeutet. Als Ergänzung zum Buch Ohrts sei auf die ebenfalls von der Edition Nautilus verlegten diversen Text- sammlungen der SI und die Schriften ihrer Protagonisten hingewiesen. Georg Koch Heinz Paetzold Profile der Ästhetik. Der Status von Kunst und Architektur in der Postmoderne Wien 1990 (Passagen Verlag), 263 S., 64.- DM. Heinz Paetzold, Ästhetik der neueren Moderne. Sinnlichkeit und Reflexion in der konzeptionellen Kunst der Gegenwart, Stuttgart 1990 (Franz Steiner Verlag), 170 S., 29.- DM. Die Ästhetik hat als philosophische Disziplin seit ihrer systematischen Formulierung durch Baumgarten eine maßgebliche Funktion in der Philosophie der Moderne eingenommen. Kant sprach ihr in der Kritik der Urteilskraft ein bindendes Moment zwischen der reinen und praktischen Vernunft zu; bei Hegel nimmt die ästhetische Reflexion zuerst Bezug auf einen ausgewiesenen Werkbegriff: der Kunst der Poesie folgt in seinem System des Weltgeistes nur noch die Philosophie selbst. Im 20.Jh. entwickelte Adorno mit seiner Ästhetischen Theorie als letzter eine umfassende systematische Ästhetik, wenngleich sich bei ihm auch schon abzeichnet, daß sich Ästhetik antisystematisch zur Philosophie verhalten muß, damit eine ästhetische Rationalität die wesentli- Bücher zum Thema che vermittelnde Rolle einer kritischen Reflexion auf das gesellschaftliche Ganze übernehmen kann; gleichzeitig nennt eine ästhetische Rationalität die Ausdrucksmöglichkeit des Leidens. Hier zielt Ästhetik noch auf einen höheren Sinn, auf Wahrheit im Kunstwerk, und ist Statthalterin eines kritischen Philosophierens. Adornos Spätwerk repräsentierte bislang den Schluß moderner Ästhetik. Die Dekonstruktion dieses Theorems durch die Postmoderne, die sich weder um den Sinn eines Kunstwerkes, noch um einen kritischen Gehalt schert, setzt mit der Reformulierung der Ästhetik des Erhabenen der Moderne eine affirmative Ästhetik (Lyotard) entgegen. Gegen diese eher verfahrene ÄsthetikDebatte stehen die beiden neuen Bücher Paetzolds, die ineinander verzahnt sind und deswegen hier nicht nur zusammen rezensiert werden, sondern auch zusammen gelesen werden sollten. Er unternimmt es, die Ästhetik auf der Folie der Postmoderne neu zu begründen, ohne auf ein modernes Kritikpotential zu verzichten. Focus der Paetzoldschen Ästhetik bleibt im Kern eine kritische Theorie, die ihre Aktualität aus der immer noch vom Kapitalgesetz durchdrungenen Welt zieht. Hier greift eine Ästhetik ein, die Paetzold sogar als Geschichtsphilosophie in praktischer Absicht formulieren will. „Indem die Philosophie auf die Ästhetik achtet, er- hält ihr Vermögen zur immanenten Kritik, welche bei den bestehenden Institutionen ansetzt, zugleich auch die Kraft des verfremdenden Blickes 'von außen'.“ (PdÄ, S.230) Im Sinne einer Reflexion auf den Zusammenhang von Kunst, Ästhetik und Philosophie rekonstruiert Paetzold die philosophische Ästhetik historisch: eine Bewußtseinsphilosophie, die seit der kommunikationstheoretischen Wende keine umfassende kritische Theorie mehr begründen kann, wird durch das in ihr vernachlässigte Element einer ästhetischen Rationalität erweitert: das Kantische Paradigma des Bewußtseins, durch Apel im Rückgriff auf Pierce durch eine konsistente Zeicheninterpretation ersetzt, wird von Paetzold „im Zeichen der Ästhetik noch einmal transformiert“ (ÄdnM, S.16). Das transformatorische Hinzufügen einer Ästhetik führt Paetzold auf einen sowohl bei Kant wie auch bei Apel fehlenden Bereich der sinnlich-leiblichen Reflexion, der nun im Zuge einer Merleau-Pontyschen Phänomenologie der Wahrnehmung und einer weitgehend an Plessner anknüpfenden Anthropologie als Ästheseologie zum Tragen kommt. Die Leiblichkeit des Menschen analysiert Paetzold aber nicht nur bezüglich der sinnlichen Wahrnehmung philosophisch, wo der Leib „Gesichtspunkt der Welt“ ist (Merleau-Ponty), sondern kunsttheoretisch aus der zeitgenössischen Kunst selbst: mit Künstlern wie Rainer Joachims, Joseph Beuys oder Willem de Kooning, denen Paetzold sich in Ästhetik der neueren Moderne werkanalytisch zuwendet, ist ein Bruch der Moderne vollzogen, wo Kunst wieder einen gesellschaftlichen Stellenwert bekommt, indem im Werk der leibliche Standpunkt des Rezipienten, also seine Wahrnehmungsstruktur, aufgegriffen wird. Eine derart über die Phänomenologie angereicherte ästhetische Reflexion stellt schließlich auch nicht mehr die Frage, was Kunst ist, sondern wann Kunst ist (vgl. PdÄ, S.230): In dem Maß, wie Kunst in die ästhetische Reflexion eingreift, sie auffordert, wird diese Frage beantwortet. Zusammengefaßt wird diese Antwort durch den Begriff der Konzeption. Der Konzeptionsbegriff leitet sich in seiner Affinität zum Heideggerschen Begriff des Entwurfs, der neuerdings auch in der Moraltheorie mit ähnlich ästhetischen Konnotationen neu diskutiert wird, aus den Künstlerästhetiken ab und nicht nur aus der Philosophie: Am Beispiel von van Gogh macht Paetzold deutlich, daß eine Reaktualisierung moderner Ästhetik auch mit einem Abschied vom emphatischen Werkbegriff verbunden sein muß und gleichsam die Künstlerbiographie in ihrer Begründung zu berücksichtigen hat. „Die Konzeption ist das, was den produktiven bildnerischen Gestaltungsvorgang intuitiv lenkt“ (PdÄ, S.15). Eine über den Konzeptionsbegriff entfal- tete Kunst „muß einerseits die Selbstbegründung der Kunst übernehmen, andererseits muß sie zu einer erwogenen Festlegung von Formen und bildnerischen Mitteln gelangen“ (ÄdnM, S.69). Die auf diese Werke reflektierende Wahrnehmung ist von ihrem Charakter her eine „durch die Sinne angereizte Dauerreflexion“ (ÄdnM, S.71), unbegrenzt und enthält ein Steigerungsmoment, das sich in der Kunstform begründet. Statt einer Hierarchisierung der Künste, wie etwa bei Hegel oder Schopenhauer, bestimmt sich der reflexive Gehalt von konzeptioneller Kunst über ihren sozialen Wirkungsgrad. Für Paetzold rücken damit nicht nur die zum Beispiel an die Ökologiebewegungen anknüpfenden Künste in den Vordergrund, sondern auch die Architektur, die innerhalb des Urbanen Lebenszusammenhänge der Menschen nachhaltig bestimmt. Gerade bezüglich der Architektur wendet sich Paetzold vehement gegen eine postmoderne Beliebigkeit, hält der Postmoderne aber ihre Heterogenität zugute, die sich in der Städteplanung als ein kritischer Regionalismus bemerkbar macht. Das Wohnen der Menschen, was noch einmal ihre Leibgebundenheit unterstreicht, in das Blickfeld einer ästhetischen Theorie zu rücken, verschärft eine Ästhetik, die mit dem Konzeptbegriff arbeitet, zum politischen Programm. So bleibt Ästhetik nicht länger nur die theoretische Re- Bücher zum Thema flexion, sondern fordert ihr kritische Potential gerade auch über Praxiszusammenhänge ein: diesmal ist es nämlich die Lebenspraxis, und nicht wie bei Adorno die Theorie, über die eine sich gegenseitig bedingende philosophische Ästhetik und Kunstproduktion sich geltend machen. Gerade mit dem Blick auf die Praxis gelangen schließlich auch Theoretiker der Moderne zu ihrem Recht, die in kritischer Absicht schon längst diagnostizierten, was die Postmoderne erst Jahre später als vermeintliches Novum explizierte: daß durch die ästhetischen Sensibilisierungen politischer Bewegungen nicht nur Folgen für die Kunst zu erwarten sind, sondern auch für das gesellschaftliche Leben - Marcuse etwa steht Lyotard hier in Nichts nach; schließlich haben wir es in der zeitgenössischen Kunst mit Konzeptionen zu tun, die in ihrer avantgardistischen Praxis den Rezipienten zum Entwurf einer „individuell und kollektiv gleichermaßen sinnvollen Lebenspraxis“ (ÄdnM, S.158) befähigen, um es mit Paetzolds Beuys-Interpretation zu sagen. Roger Behrens Wolfgang Pohrt Der Weg zur inneren Einheit. Elemente des Massenbewußtseins BRD 1990 Hamburg 1991 (Konkret Literatur Verlag), 317 S., 36.- DM. Mit der Vereinigung von BRD und DDR im Jahre 1990 zu einem gemeinsamen Staat ist in Europa unwiderruflich eine neue Zeit angebrochen, die nach modifizierten Analysen verlangt. Aus der großen Anzahl von mehr oder weniger wissenschaftlich angehauchten Veröffentlichungen über diese Umbruchszeit sticht die Studie von Wolfgang Pohrt über den Weg der Deutschen zur inneren Einheit besonders hervor. Seine auferlegte Enthaltsamkeit, sich dem häufig allzuschnell abgegebenen Einschätzungs- und Schlußfolgerungskanon der meisten wissenschaftlichen Publikationen zum Zeitgeschehen anzuschließen, läßt ihn, der bisher vorwiegend durch polemische und demagogische Pamphlete und Essays hervorgetreten ist, im Vergleich zur professionellen Zunft der Sozialund GeisteswissenschaftlerInnen geradezu seriös wirken. Angeregt von Adornos Studie zum autoritären Charakter, legt Pohrt die Untersuchungsergebnisse seiner im Auftrag der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur durchgeführten Ein-MannStudie über den Bewußtseinszustand der Deutschen nach der Einigung einem größeren Publikum vor. Der gewöhnlich nicht gerade von Selbstzweifeln geplagte Pohrt, der der bundesrepublikanischen Linken seit der Zeit der Friedensbewegung einen Hang zum Nationalistischen und Totalitären bescheinigte, fällt in seinem neuen Buch geradezu durch seine nüchterne, ja ernüchternde Art zu schreiben auf. Waren seine früheren Verlautbarungen von seiner Haßliebe zu dem, was in linken Kreisen allgemein als Bewegung begriffen wurde, gekennzeichnet, so scheint es, als sei diesem Verhältnis jetzt die sezierende Kühle des distanzierten Beobachters gewichen. Von dieser neuen Position aus greift Pohrt auch sofort diejenige Berufssparte an, die sich sonst in dieser Rolle gefällt, die Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen. Die Fragen der Zeit aufgrund umfangreichen Datenmaterials zu beantworten, dies wäre eigentlich ihre Aufgabe. Aber sie können es nicht, „weil die Wissenschaft das geduldige Opfer mag, am liebsten ein gut abgekühlte Leiche.“ (S.16) Pohrt will keinen Obduktionsbericht abliefern, sondern die Lebendigkeit eines Möglichkeiten schaffenden Prozesses dokumentieren, indem er wissenschaftliche Arbeit und Essay miteinander verbindet. Zwar steht der empirische Teil (Tabellen und Interpretationen) seiner Studie auf etwas dünnem Boden, aber es gelingt ihm, hierfür einen adäquaten Ausgleich zu schaffen. In seinen vorweg gegebenen Erläuterungen zum Untersuchungskonzept, zur politischen Lage Anfang 1990, zur endgültigen Testversion und zu den Gesprächsprotokollen wie auch in den essayistisch vorgetragenen Schlußfolgerungen im Anhang sorgt die Eindringlichkeit, mit der Pohrt seine Beobachtungen über die Bewußtseinslage der Deutschen darlegt, für die nötige Absicherung seiner empirischen Befunde. All dies läßt die Studie aus den üblichen, nach funktionalen Kriterien und in einer techno-rationalen Sprache abgefaßten sozial- und geisteswissenschaftlichen Arbeiten hervortreten und macht ihre Lektüre spannend. Die Art der Fragestellung und die Verwendung der schon bei Adorno wichtigen Likert-Skala für die Beantwortung der Fragen lassen den Leser selbst in Versuchung geraten, Antworten zu geben. Pohrts Absicht herauszufinden, ob der spezifische Nationalcharakter der Deutschen eine Disposition für faschistisches Denken als Gemütsbewegung aufweist, erfährt der Leser so beispielhaft am eigenen Denken. Dies sollte zum Schaudern zwingen, denn, wie Pohrt eindringlich nachweisen kann, diese Disposition existiert nicht nur bei anderen, sondern auch bei einem selbst. Einzig der Feind und der Führer würden noch fehlen, meint Pohrt, um sie in entsprechende zielgerichtete Handlungsperspektiven einmünden zu lassen. Aus dieser pessimistischen Einschätzung heraus verfolgt der Autor mit seiner Studie auch nicht den Zweck, „die Wiederkehr des Faschismus als Gemütsbewegung zu verhindern“, sondern „im Falle eines Falles vielleicht wenigstens die Wiederholung Bücher zum Thema Wiederholung jenes Antifaschismus aus der Weimarer Zeit, welcher die Ressentiments seines Gegners in die eigene Propaganda übernahm, sich selber als den besseren Vaterlandsretter empfahl und damit auch noch den letzten Zauderer den Nazis in die Arme treiben mußte.“ (S.20) Die von politischer Seite zu hörenden Verlautbarungen zu den jüngsten Ausschreitungen und Pogromen gegen alle, die als Nicht-Deutsche bestimmt werden, läßt da allerdings Schlimmes ahnen. Die Lektüre von Pohrts Studie wird angesichts dieser Verhältnisse zu einem regelrechten Muß, da sie Warnung und Hinweis für das ist, was die Vereinigung möglicherweise bei den Deutschen schon entfesselt hat. Roland Drubig W. Prinz und P. Weingart (Hg.) Die sogenannten Geisteswissenschaften: Innenansichten Frankfurt 1990 (stw), 487 S., 28.DM. Die im Band veröffentlichten Beiträge sind überarbeitete Vorträge, die im Rahmen einer Tagungsreihe 1987/88 am Zentrum für interdisziplinäre Forschung in Bielefeld gehalten wurden. Diese „Innenansichten“ sind Teil einer umfangreichen Erhebung zum „Status der Geisteswissenschaften“, die vom Bundesministerium für Forschung und Technologie gefördert wird. Betrachtungen der „Außenansichten“ sollen noch erscheinen. Aufgeteilt ist der Band in vier Bereiche mit jeweils mehreren Aufsätzen von (west-) deutschen Wissenschaftlern zu den Themen Geschichte (1), Sprache, Literatur und Kunst (2), Ferne Kulturen (3) und Philosophie (4), dem einleitende Bemerkungen der Herausgeber vorangestellt sind. Ziel der Tagung war es, mittels einer Bestandsaufnahme „nicht nur eine Diagnose der aktuellen Lage der Fächer“ abzugeben, sondern „ebenso eine Analyse wesentlicher Trends ihrer jüngeren und jüngsten Entwicklung. Als Zeithorizont wurde dabei der Zeitraum nach 1945 vorgegeben. Unter Situation der Forschung wurde ebenso ausdrücklich zweierlei verstanden: zum einen die Entwicklung der Forschung selbst, d.h. ihres Gegenstandes und ihrer theoretischen und und methodischen Bestände und zum anderen die Entwicklung der Forschung selbst, d.h. insbesondere des politischen und institutionellen Kontextes, in dem Forschung stattfindet, aber auch der Bildungs- und Ausbildungsfunktion der Fächer und der damit zusamenhängenden Erwartung der Öffentlichkeit.“ (Aus dem Vorwort der Herausgeber) Die insgesamt 31 Artikel von Wissenschaftlern/Innen unterschiedlicher Generationen - die ältesten unter ihnen sind in den zwanziger Jahren, die jüngsten in den fünfziger Jahren geboren - erfüllen das erklärte erste Ziel (Entwicklung der Forschung) mit mehr (Kocka, Schnädelbach) oder weniger (z.b. Möhlig) Bravour. Warum man nach dem politischen Kontext explizit fragt und dann doch so gut wie kein Wort darüber verliert oder höchstens zwischen den Zeilen etwas andeutet, bleibt schleierhaft. Freilich ist man als Leser dankbar, mittels der so offenkundigen Diskrepanz von Vorgabe und Beitrag eine eben doch politische Aussage zu erhalten: man bescheidet sich im Glück, noch arbeiten zu dürfen (schließlich sind die Geisteswissenschaften ja ins Gerede gekommen, wie die Herausgeber anmerken) und gibt sich naiv bis feige. Von Offensive einer gesellschaftlichen Entwicklung gegenüber, die den Geisteswissenschaftlern langsam aber sicher das Wasser abgräbt, ist keine Rede, wo man doch grad so schön internationalen Standard wieder erreicht hat, wie einige Autoren nicht müde werden zu behaupten. Dabei wäre die Jahreszahl 1945 doch Menetekel genug, um einige Gedanken auf den Zusammenhang von Politik und eigenem Wissenschaftsverständnis zu verschwenden und wo doch auch einige Autoren auf die fatale Kontinuität der wissenschaftlichen Arbeit von vor 1945 und danach hinweisen. Man gesteht für „damals“ durchaus Defizite und beklagt den Niveauverlust der deutschen Geisteswissenschaften durch Mord und Exil. Auch die Reaktionsweise auf die Katastrophe, das Schwören auf Objektivität, wird kritisch gesehen, und doch gewinnt man den Eindruck, die Katastrophe geschah nur außerhalb der Universitäten, und die Geisteswissenschaften hätten damals so recht eigentlich nichts damit zu tun gehabt. Mir steht es fern, ein unzulässiges Gleichheitszeichen zwischen der politischen Situation damals und heute zu setzen, festgehalten werden muß aber, daß auch heute (so wie damals) auf eine politische und gesellschaftliche Entwicklung nicht reagiert wird, weil es einen scheinbar nichts angeht. Der Elfenbeinturm scheint luxussaniert worden zu sein, zwischen Gesellschaft und Politik einerseits und den Geisteswissenschaften andererseits gibt es kaum einen Zusammenhang, außer der mit Stolz und auch Unbehagen festgestellten Tatsache, daß man sich denn doch manchmal fragt, was aus denen wohl werden soll. Die Herren und die Dame (Geschlechterverhältnis 30 zu 1) geben unterschwellig die Antwort, so schlimm kann es ja gar nicht sein, es hat sich noch niemand so richtig beschwert, und aus ihnen selbst ist ja schließlich auch etwas geworden, im günstigeren Fall benannt durch die Kürzel C3 oder noch besser C4. Man könnte gegen diese harsche Kritik einwenden, daß die geforderten Stellungnahmen wohl eher in den Band „Außenansichten“ gehö- Bücher zum Thema ren. Die Forderung nach politischen Rahmenbedingungen wurde aber selbst gestellt und zielt m.E. sehr wohl mitten hinein in die Lehr- und Forschungspraxis. Ein Beispiel: Wenn der Ägyptologe J. Assmann am Ende seines Artikels erklärt, daß der alte humanistische Standpunkt, in den Geisteswissenschaften das kulturelle Gedächtnis des Abendlandes aufzubewahren, einem anthropologischen Standpunkt Platz gemacht hat, dann ist es auch nicht abwegig, „anstelle der klassischen Philologie ein Fach wie die Ethnologie zu den Leitwissenschaften der heutigen Geisteswissenschaften zu rechnen. Entsprechend größere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Früh- und Fremdformen der Kultur. Das Verstehen fremden Denkens gehört zu den zentralen philosophischen und kulturanthropologischen Fragen ...“ Dies trifft sich vorzüglich mit den Erläuterungen, die H. Schnädelbach und R. Bubner über den Niedergang der philosophischen Schulbildungen und die neugewonnene Offenheit in der analytischen Philosophie geben. Aber diese neuen Chancen interdisziplinärer Zusammenarbeit gehen nicht und dürfen nicht im akademischen Raum aufgehen. Die Geisteswissenschaftler in der sogenannten dritten Welt verwahren sich entschieden dagegen, mit irgendwelchen Frühformen von Kultur zusammengedacht zu werden. Der Dialog der europäischen Geisteswissenschaft mit den anderen Kulturen der Welt ist nicht mehr von oben herab zu führen. Die immense Schwierigkeit, das Erbe der Aufklärung - z.B. die Menschenrechte - fortzuführen und doch für neue Denkwelten offen zu sein, löst sich nicht in der Akademie. Dies ist ein politischpraktisches Problem - diese Menschheitstragödie ist via Medien täglich konsumierbar -, zu dem wir Stellung beziehen müssen und das uns bis in die Methodologie und die Stellenbesetzung hinein beeinflussen wird. Daß darüber von den Wissenschaftlern nichts zu lesen ist, stimmt pessimistisch. Wolfgang Habermeyer Hans Jörg Sandkühler Demokratie des Wissens. Aufklärung, Rationalität, Menschenrechte und die Notwendigkeit des Möglichen Hamburg 1991, (VSA-Verlag), 179 S., Der Philosoph H.J. Sandkühler demonstriert unzeitgemäß Unverbesserlichkeit. Während allenthalben Fäden geknüpft werden, um Marx der Dekonstruktion preiszugeben, hält Sandkühler stur dagegen. Er übergibt Marx nicht den Schrottverwertern, sondern sucht eine „Erneuerung des Marxismus“. Eine solche könne nicht mehr an zurecht desavouierten Dogmen über den „Gang der Weltgeschichte“ festhalten, sondern geschehe in der Wiedererinnerung und Vergegenwärtigung des Theorietyps, dem Marx sich selbst verpflichtet wußte, und der in der Tradition der Aufklärung stand. Auch hier bürstet Sandkühler gegen den Strich, wenn er entgegen den allfälligen Antiaufklärungskampagnen an einem Aufklärungskonzept festhält, das die antispekulative Hinwendung zum empirischen Wissen mit dem praktischen Interesse an vernünftigen Verhältnissen mündiger und verantwortlich handelnder Individuen verbunden hat. Diesem Konzept einer rationalen Konstruktion empirischer Daten zum Zweck der Gestaltung menschengemäßer Verhältnisse war wie Sandkühler an einer Vielzahl von Beispielen demonstriert - der späte, naturund sozialwissenschaftliche Fakten studierende Marx verpflichtet. Doch diese Revitalisierung des Marxschen Denkens macht nur einen Aspekt aus. Mit dem Band, der überarbeitete Aufsätze des letzten Jahrzehnts enthält, geht es Sandkühler allgemeiner um die Verteidigung und die Begründung eines spezifischen Typus von Wissen, dessen beide „Eckpunkte“ Individuum und Vernunft sind. Individualität ohne Vernunft wird zum Spielball undurchschauter Verhältnisse; Vernunft, ohne daß sie ihren Ort im wissenden und sich wissenden Indi- viduum hat, verkommt zur Rechtfertigungsinstanz politischer Herrschaft. „Demokratie des Wissens“ bedeute daher die Partizipation des Individuums an einem Wissen, daß sein Maß am Menschen nimmt. Im Zentrum seines Einsatzes für Aufklärung und Rationalität steht die Begründung des Wissens als Menschenrecht. Wir befinden uns heute, so Sandkühler, in einer „globalen Krise des Wissens“. Die wissenschaftlich-technische Revolution erweitert objektiv das Wissen der Gattung in ungekanntem Ausmaß; für die Subjekte aber bringt sie Mangel an Wissen. Sie erstickt nicht die Masse der Informationen, sondern die „rationalen Weltbilder, in denen sich Wissen zur Einheit totalisiert, in einem chaotischen Prozeß der zunehmenden Fragmentierung im kognitiven System... Arbeitsteilung und Spezialisierung, Desintegration der Wissenschaften und ihre Trennung von der Alltagskultur, Segmentierung gesellschaftlicher Erfahrung und Resignation vor einer in sich bedeutungslosen Masse an Daten vertiefen die Entfremdung vom Wissen, das in bisher nicht gekanntem Maße für die Individuen fiktiv wird. In der Dekonstruktion des epistemisch-semantischen Ganzen und getrennt von der selbstreflexiven Erfahrung der Individuen, wird Wissen zur abstrakten Möglichkeit ohne Subjekt, Sinn und Ziel. Wissen ist so nicht mehr die subjektive Fähigkeit der Vernunft zur Bücher zum Thema Konstruktion der Wirklichkeit“ (S.147f). Sandkühlers Forderung nach dem Menschenrecht auf Wissen gründet auf der Selbstbeschreibung des Menschen als dem Konstrukteur einer möglichen vernunftgemäßen Welt, der dazu einer rationalen Weltbildsemantik bedarf. Sie klagt Wissen als Oppositionswissen freier Individuen zur rationalen Lebensgestaltung ein. Fehlt es, läßt sich ergänzen, werden die Menschen beherrscht von Angst und handlungslähmender Unsicherheit, von individuellen wie kollektiven Irrationalismen und unverstandenen Feindbildern. Wissen als Menschenrecht begegnet diesem Mangel. Über das streckenweise fesselnde Plädoyer Sandkühlers für eine zukunftsorientierte Rationalität, die die „epistemische Frage“ in die „humane Rekonstruktion des Sozialismus“ einbezieht, möchte ich mein Bedenken nicht hintanstellen, das sich bei der Begründung des Rechts auf Wissen einstellt. Ist es wirklich so, daß Wissen sich allein als Konstrukt „nach Gesetzen unseres Geistes“ (S.149) beschreiben läßt? Es hätte so zwar tatsächlich das Maß im Menschen, der darin die Weltentwürfe auf ihre Kohärenz und ihre Akzeptanz rückbezieht, und nur darin seinen Mangel an Wissen überwindet. Aber das, was wir als „Wissen“ bezeichnen, muß uns doch auch eine hinreichend adäquate Kenntnis von der „Welt da drau- ßen“ verschaffen, um unser Verhältnis in und zu ihr bestimmen zu können. Sandkühler wendet sich zurecht gegen einen Begriff, der Wissen als „Abbildung (Widerspiegelung) einer dem Bewußtsein äußeren Wirklichkeit“ (S.149) definiert, und insistiert zurecht auf dem Konstruktionscharakter unseres Wissens. Aber aus dieser Tatsache folgt m.E. nicht, daß auch das Maß des Wissens allein unser gesetzgebender Geist ist. Doch dieser wissenstheoretische Vorbehalt nimmt nichts vom Respekt vor Sandkühlers Einsatz 'wider den Zeitgeist' und für die Begründung eines Typus von Rationalität, der die Gegenwart mit der Perspektive auf Zukunft verbindet. Das Buch eines Linken für Linke, geschrieben gegen die Resignation. Alexander von Pechmann Oliver R. Scholz Bild, Darstellung, Zeichen. Philosophische Theorien bildhafter Darstellung Freiburg-München 1991 (Verlag Karl Alber, Reihe Kolleg Philosophie), kart., 198 S., 34.- DM. Die neuen Informationstechnologien lassen die Bilder wuchern, und die dazugehörigen Theorien scheinen ihnen auf dem Fuße zu folgen. Digitale Bilder, Simulakren und Cyberspace bringen die letzten Vertreter einer wie auch immer gelifteten Abbild-Theorie zum Verzweifeln und verhelfen den Propagandisten der Simulation zu unverdientem Ansehen. In dem Gefecht, das nicht zuletzt eines zwischen Sprache und Bild, Logos und Mythos, vor allem aber zwischen den Bildern in der Sprache und den Mythen im Logos ist, verdient das klärende Wort des analytischen Philosophen einige Aufmerksamkeit, besonders wenn es in einer für philosophische Dissertationen selten unprätentiösen, bisweilen gar humorvollen Sprache daherkommt. Scholz versucht, in Anknüpfung an Nelson Goodmans Symboltheorie, die dieser v.a. in „Languages of Art“ (1968) entwickelt hat, eine philosophische Bildtheorie zu erarbeiten, die sprachphilosophischen und logischen Maßstäben von Genauigkeit und innerer Kohärenz standhält. Mit diesem lobenswerten Vorhaben geht jedoch eine Verengung des semiotischen Horizonts einher, die dem Buch nicht gut bekommt. Vor allem der erste Teil der Arbeit, der eine ausführliche Kritik der Ähnlichkeitstheorie und der kausalen Theorie der Bilder unternimmt, gerät mitunter zur Spiegelfechterei. Scholz verwirft die Ähnlichkeitstheorie, indem er nachweist, daß sie keine hinreichenden Kriterien anzugeben vermag, die die Selektion relevanter Eigenschaften für die Ähnlichkeit von Bild und Objekt erlauben würden; alles ist allem „irgendwie“ ähnlich (eine Tatsache, aus der mittelalterliche Semiotiker ihr Kapital zu schlagen wußten). Auf diese Art kann die Ähnlichkeitsrelation als eine „natürliche“ Abbildbeziehung destruiert werden, nicht aber notwendigerweise auch als eine regelhafte Zeichenbeziehung. Scholz betrachtet Ähnlichkeit und Kausalität als zweistellige Relationen zwischen Bild und Gegenstand und fällt so einem naturalistischen Fehlschluß anheim. Denn Zeichen beziehen sich prinzipiell nie direkt auf ein reales Objekt, sondern immer nur mittels ihrer Bedeutung bzw. ihres Interpretanten, wie es die semiotische Tradition seit Peirce formuliert. Diese Feststellung hat etwa Umberto Eco dazu geführt, in seiner Zeichentheorie vom Referenten völlig abzusehen, da dieser nie direkt gegeben sein kann und somit ohne Wert für die Semiotik ist. Doch man muß diese radikale Folgerung nicht teilen, um dennoch anzunehmen, daß es eine Ähnlichkeits- bzw. Kausalrelation zwischen Bild, Interpretant und Objekt gibt, die Bild und Gegenstand nicht einfach kurzschließt, sondern das Objekt nach einer Regel über den Interpretanten konstruiert. Wenn Bilder, wie Scholz überzeugend klarmacht, wesentlich Zeichen sind, so müssen sie stets auch bezeichnen, daß sie bezeichnen, sie müssen eine reflexive Struktur aufweisen. Gerhard Schönrich hat dies jüngst in seinem Buch „Zeichenhandeln“ (Frankfurt/Main 1990) Bücher zum Thema eindrucksvoll gezeigt. Betrachtet man Bilder als Dinge und sucht ihre Ähnlichkeit mit andern Dingen herauszufinden, so ist es nicht verwunderlich, daß man in dieser Welt von „res significantes“ weder auf akzeptable Ähnlichkeitskriterien stößt noch überhaupt auf eine Zeichenbeziehung. Damit sind die beiden grundlegenden Schwächen von Scholz' Arbeit benannt: eine naturalistische epistemologische Haltung und ein intuitiver, nicht-reflexiver Zeichenbegriff. Seine konzeptionellen Ausführungen zu bildhaften Zeichensystemen und zur Pragmatik der Bildverwendung haben darunter zu leiden. So bemüht sich der Autor vergeblich, die fiktionalen und sonstige „ungegenständliche“ Bilder in seine Theorie zu integrieren, was für eine dreistellige Zeichenrelation ohne Probleme möglich ist. Und auch seine Erklärung der Beziehung von „type“ und „token“, d.h. von allgemeinem Zeichen und konkretem Zeichenvorkommnis, bleibt zirkulär, weil er sie nicht als eine regelhafte Relation erkennt, sondern das allgemeine Zeichen aus der empirischen Ähnlichkeit (sic!) von einzelnen konkreten Zeichen herleiten will und so die Existenz eines allgemeinen Zeichens immer schon voraussetzen muß. Abgesehen von diesen Mängeln in der semiotischen Fundierung liefert die Arbeit brauchbare Kriterien für die Erfassung bildhafter Zeichen- systeme. In Kontrastierung mit den Systemen natürlicher Sprachen beschreibt Scholz sie als syntaktisch und semantisch „dichte“ Systeme, bei denen sowohl Signifikanten als auch Signifikate „fließend“ ineinander übergehen; daher ist auch die Korrelation zwischen einem Bildsystem und seinem Denotatfeld eine kontinuierliche. Hinzu kommt eine relative „Fülle“ und „Gedrängtheit“ des Bildsystems, d.h. in einem Bild können prinzipiell alle Merkmale signifikant sein und sie können jedes für sich Bedeutung tragen, im Unterschied etwa zu den Verkehrszeichen, wo das Material und die Größe bspw. keine signifikante Rolle spielen, und zu den natürlichen Sprachen, wo einzelne Phoneme zwar bedeutungsdifferenzierend, aber nicht bedeutungstragend sind. Auch die Überlegungen zu einer „Gebrauchtstheorie“ von Bildern sind nicht ohne Wert. Scholz schlägt vor, eine Taxonomie von „Bildspielen“ - der Ausdruck wird in Anlehnung an Wittgensteins Begriff des Sprachspiels gebildet - zu erstellen, die sich die Klassifikation der Sprechakte bei Austin und Searle zum Vorbild nimmt. Dabei hebt er besonders die Rolle des Kontextes und der Performanz für „Bildspiele“ hervor. Zwar bleiben die Versuche zu einer Unterteilung von „Bildspielen“ ebenso in den Anfängen stecken wie der allzusehr am Alltagsverstand orientierte Entwurf einer Stufenfolge des Bild- verstehens, dennoch können sie nützliche Anregungen für die weitere Forschung geben. Es ist dies also durchaus kein unerfreuliches Buch: es faßt wichtige Ergebnisse der Analyse von Bildern auf anschauliche Weise zusammen und zeigt Möglichkeiten der Spezifizierung von Bildtheorien auf. Eine Integration der Bildtheorie in eine allgemeine Semiotik jedoch, die vom Autor intendiert ist, erfordert eine vertiefte semiotische Grundlegung, die jenseits des Horizonts dieses Buches schon zu ansehnlichen Ergebnissen geführt hat. Darüberhinaus wäre eine Theorie zu entwickeln, die die gesellschaftliche Produktion und Konsumtion von Bildern analysiert als eine Produktion von virtuellen „Wirklichkeiten“, in denen Zeichen und Objekt zusammenfallen (Peirce hat dies in seinem ikonischen Zeichenbegriff schon mitgedacht). Ein solches Vorhaben wird allerdings der Zusammenarbeit von Semiotik und Medientheorie bedürfen. Günter Butzer Michael Walzer Kritik und Gemeinsinn - Drei Wege der Gesellschaftskritik Berlin 1990 (Rotbuch), 26.- DM. Michael Walzer Zweifel und Einmischung - Gesellschaftskritik im 20. Jahrhundert Frankfurt/Main 1991 (Fischer), 48.DM. Der Zerfall des in der Tradition der Aufklärung stehenden gesellschaftskritischen Denkens oder auch nur des Willens dazu ist ein grundsätzliches, über mehr oder weniger akademische Diskussionen hinausreichendes Phänomen. Spätestens seit den frühen 80er Jahren hat sich auch im linken, wie im grünalternativen Lager TheorieMüdigkeit breitgemacht. Die beklagte Kopflastigkeit einstiger, immerhin noch um den Gesamtzusammenhang gesellschaftlicher Verhältnisse bemühter Debatten ist, wenn inzwischen überhaupt noch die Rede davon sein kann, einem auf „persönliche Betroffenheit“ beruhenden Engagement im meist unmittelbaren sozialen Umfeld der jeweiligen Akteure gewichen. Will man den Prognosen politischer, publizistischer und sozialwissenschaftlicher Sympathisanten Glauben schenken, wird diese Art Engagement jedoch die Politikform der Zukunft sein. So die Intelligenz dabei noch eine Rolle spielen will, bleibt ihr nichts anderes, als sich einzureihen. Wie das geht, und was davon zu erwarten ist, zeigen die inzwischen schon fast vergessenen Stellungnahmen während des Golfkrieges und das Niveau der gegenwärtigen Debatte um die Staatssicherheit der DDR. Bücher zum Thema Um so erstaunlicher ist deshalb die Tatsache, daß die Rezeption des US-amerikanischen Sozialphilosophen Michael Walzer, der sich dieses Politik- und Kritikverständnis exakt zu eigen gemacht hat und davon ausgehend die Arbeit der Intellektuellen zu umreißen und zu beurteilen versucht, hierzulande so lange auf sich warten hat lassen. Obwohl er seit 1983 mit „Gibt es einen gerechten Krieg?“ auf dem deutschen Buchmarkt vertreten und sein Essay „Exodus und Revolution“ bereits 1988 erschienen ist, findet er erst dieses Jahr mit „Kritik und Gemeinsinn - drei Wege der Gesellschaftskritik“ (KuG) und „Zweifel und Einmischung - Gesellschaftskritik im 20. Jahrhundert“ (ZuE) die Beachtung in den Feuilletons der meinungsmachenden deutschen Zeitungen, die er angesichts des Zeitgeistes auch verdient. Walzers Ideal der „national-volksnahen Kritik“ (ZuE 318ff), die sich aus der auf dem „Wege der Interpretation“ (KuG 29ff) aufgefundenen Moralphilosophie ableitet, ist die dem derzeitigen common sense verpflichtete Absage an jede grundsätzliche Infragestellung gesellschaftlicher Verhältnisse und in ihrer Konsequenz Apologie. Dies deshalb, weil sie aus der Tatsache, daß es in jedem gesellschaftlichen Alltag interne moralische Diskurse gibt, auf eine nicht mehr zu hinterfragende Verpflichtung der am Diskurs beteiligten Individuen auf diese Alltags-Moral schließt. Moral und gesellschaftliche Wirklichkeit unterscheiden sich nach Walzer nur insofern, als diese jener grundsätzlich hinterherhinkt (KuG 29). Kritik darf sich ausschließlich an den deshalb zwangsläufigen Defiziten der gesellschaftlichen Wirklichkeit festmachen, keinesfalls aber gesellschaftliche Grundlagen angreifen. Darüber hinaus beschränkt sie sich auf den spezifischen nationalen Kontext dieses Diskurses, in dessen Reflexion ausschließlich die jeweilige Nationalgeschichte einfließen soll (ZuE 320f). Walzers Vorstellung von Gesellschaftskritik und Moralphilosophie ist außerdem in strengem Sinne ideologisch. Wenn Otto Kallscheuer in seinem instruktiven Nachwort zu „Kritik und Gemeinsinn“ den USamerikanischen „communitarism“ als die intellektuelle Tradition beschreibt, in der Michael Walzer steht und dessen Ansatz als Votum für demokratische Opposition im sozialen Liberalismus eines Norbert Bobbio beurteilt (KuG 129), so wird klar, wie eingeschränkt Walzers Ansatz allenfalls auf im Habermas'schen Sinne moderne, also bürgerlich demokratische, sozialstaatlich abgefederte und relativ krisenfrei funktionierende Gesellschaftsformationen angewandt werden kann. Dennoch sollen die abstrakten Prinzipien jedes moralischen Diskurses die universellen Mindeststandards „jeder Menschengemeinde“ (KuG 34) sein und „praktisch in jeder Menschengesellschaft Anwendung gefunden“ (ebd.) haben. Die absurden Konsequenzen dieser Position zeigen Walzers Essays über elf Schriftsteller, Theoretiker und Intellektuelle (von Julien Benda über Martin Buber, Antonio Gramsci, Ignazio Silone und George Orwell bis zu Herbert Marcuse und Breyten Breytenbach) in „Zweifel und Einmischung“. Exemplarisch sollen sie an seiner Interpretation von Albert Camus' Stellungnahmen während des algerischen Befreiungskrieges skizziert werden. Walzer deutet dessen Verstummen angesichts der Greuel als ehrliche Konsequenz kritischer Verbundenheit mit sowohl der französischstämmigen Bevölkerung, der er selbst angehörte, als auch den arabischen und schwarzen Einheimischen, die mit den pieds-noirs auf das Blutigste verfeindet waren. „Was er (Albert Camus C.S.) nicht akzeptieren wollte und konnte, war die Ansicht, daß die pieds noirs schon durch ihre Kolonialgeschichte abgewertet waren, verdammt, ohne Hoffnung auf Erlösung“ (ZuE 207). Albert Camus' Kritik am französischen Kolonialismus geht also nie so weit, daß er kein Verständnis für die Forderungen der französischen Kolonialisten mehr hat. Dies zeichnet ihn nach Walzer als einen kritischen Intellektuellen aus, der sich umfassend und konkret der Wirklichkeit stellt und vor dieser lieber kapituliert, bevor er sich und seine vermittelnde Funktion aufgeben müßte. Im Gegensatz dazu zeugt nach Walzer Jean Paul Sartres und Simone de Beauvoirs entschiedenes Engagement für die algerische Befreiungsbewegung FLN und ihre Forderung, daß sich Frankreich sofort und bedingungslos aus Algerien zurückzuziehen habe und die Kolonie in die Unabhängigkeit entlassen müsse, von einer „ideologisch eingeebneten Realität: Die FLN repräsentiert die Befreiung, die Franzosen sind Faschisten“ (ZuE 196). Walzers weitere Kritik an Simone de Beauvoirs autobiographischen Diktum: „Das Leben der Moslems war in meinen Augen genausoviel wert, wie das meiner Landsleute“ (ZuE 196) demonstriert darüberhinaus an Denunziation grenzende Implikationen seines Ansatzes. Walzer wirft ihr vor, zugunsten eines abstrakten Humanismus das Interesse an Individuen verloren zu haben. „In der Tat gibt es wenig Indizien dafür, daß sie irgend ein bestimmtes Leben besonders wichtig findet“ (ZuE 196). Die theoretische Ursache liegt für Walzer darin, daß Jean Paul Sartre und Simone de Beauvoir, statt über den ihnen als Intellektuellen eigentlich zukommenden „Weg der Interpretation“, über den „Weg der Erfindung“ (KuG 17) zur Moralphilosophie gelangt sind. Sie konstruieren sich nach von ihnen selbst aufge- Bücher zum Thema stellter Regeln ihre eigene Moralphilosophie und benützen sie als bewußt gewählten Maßstab außerhalb der Gesellschaft, um die von ihnen als schlecht erkannte Wirklichkeit zu kritisieren. Laut Walzer ist Descartes' methodischer Zweifel Paradigma dieser theoretischen Einstellung und das cogito - und damit jede Philosophie, deren Kriterium die Vernunft ist - das realitätsferne Resultat seiner philosophischen Erfindung (KuG 17f). Analog dazu verläuft der „Weg der Entdeckung“ (KuG 11ff), die dritte Variante und religiöse Konstruktion eines moralischen Prinzips. Wie der Philosoph, der sich sein Prinzip außerhalb seines konkreten Lebenszusammenhanges erfindet, entdeckt der Religionsstifter ein solches in einem religiösen Schlüsselerlebnis und leitet davon eine religiöse Moral und so den Maßstab seiner Gesellschaftskritik ab. An den oben erwähnten Besprechungen von vor allem Michael Walzers „Zweifel und Einmischung“ überrascht die Selbstverständlichkeit, mit der die Rezensenten auf die Auseinandersetzung mit den aufgezeigten Konsequenzen seines Ansatzes verzichten. Stattdessen verlieren sie - exemplarisch seien hier Axel Honneths „Universalismus und kulturelle Differenz“ (Merkur 11/91) und Klaus Naumanns „Nähe und Distanz“ (Freitag, 26.April 1991) genannt - sich nach gut deutscher Mandarine- Gewohnheit in der Erörterung, ob, und wenn ja, wie Walzer trotz seines provokativen Verzichtes auf eine Ableitung seiner Moralphilosophie aus einer universal verbindlichen Metaethik auf eine solche verpflichtet werden kann, oder gar voraussetzt. Nur Stefan Breuer vermutet in „Blinder Spiegel“ (FAZ, 24. April 1991), daß es Walzer nicht daran gelegen ist, Begriffe und Theorien auszuloten, sondern sie ohne Analyse einfach loszuwerden. Und dann muß natürlich noch Thomas Neumanns Rezension in Konkret 10/91 erwähnt werden. Sein Urteil, Michael Walzer spiele den Gesellschaftskritiker, um den Zensor zu verbergen, trifft den Nagel auf den Kopf, aber das ist ja eigentlich von „traditioneller“ Ideologiekritik zu erwarten. Christian Sebald