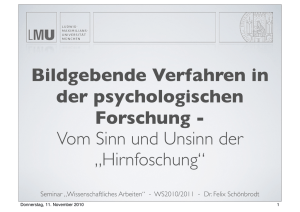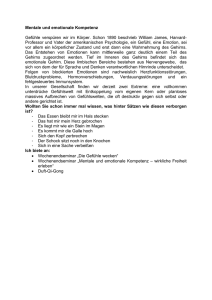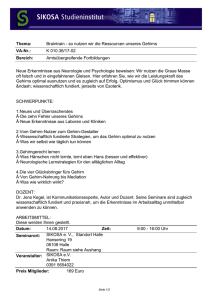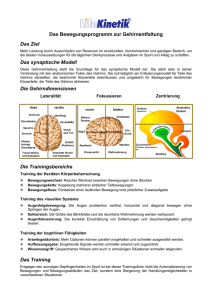11 Seh ich da was, was du nicht siehst?
Werbung

11 Seh ich da was, was du nicht siehst? Methoden, Möglichkeiten und Mängel des Neuroimagings Henrik Walter und Susanne Erk In seiner Anthropologie, der Wissenschaft vom Menschen, formulierte Kant drei Hauptfragen der Philosophie: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was kann ich hoffen? Sie zu beantworten ist Aufgabe der Erkenntnistheorie, der Ethik und der Religionsphilosophie. Heutzutage prägt die Wissenschaft unser Selbstverständnis, insbesondere die Hirnforschung, die gelegentlich auch als neue Leitwissenschaft bezeichnet wird. Einen Teil ihrer Popularität hat sie sicher dem Neuroimaging, der Bildgebung des Gehirns, zu verdanken. Durch dieses Verfahren können Struktur und Funktion anschaulich in ästhetischen Bildern dargestellt werden (Walter 2005). Dabei handelt es sich um einen jungen aufstrebenden Zweig der Neurowissenschaft, welcher einer inzwischen fast schon klassisch zu nennenden Wendung zufolge, erlaubt, dem „Gehirn bei der Arbeit zuzusehen“. Doch was genau zeigen solche Hirnbilder eigentlich? Können wir inzwischen tatsächlich „Gedanken lesen“ (Schleim 2008; Schleim u. Walter 2008)? Oder handelt es sich nur um die übliche Übertreibung von Journalisten bzw. die werbewirksame Selbstdarstellung von Wissenschaftlern? Hier besteht Aufklärungsbedarf – nicht allein aus praktischen Gründen, sondern auch, weil neurowissenschaftliche Befunde im Moment die Diskussion um das Leib-Seele-Problem, das Bewusstsein, das Selbst sowie die Fragen nach Willensfreiheit und Verantwortlichkeit stark beeinflussen. Als vierte Hauptfrage für die Philosophie (des Geistes) lässt sich also formulie308 ren: Was können wir messen? Darüber soll dieser Beitrag aufklären. Die öffentliche Debatte um das Neuroimaging zeichnet sich durch starke Behauptungen einerseits und durch geringes Wissen andererseits aus. Methoden und Begriffe werden munter durcheinander geworfen, es wird bedenkenlos zwischen neurowissenschaftlicher und psychologischer Beschreibungsebene hin- und hergewechselt, und dabei ersetzt fachliche Autorität qua Amt häufig das sachliche Argument. Das ist nicht unbedingt als außergewöhnlich anzusehen, je jünger eine Wissenschaft, desto geringer das Allgemeinwissen darüber. Dieser Beitrag möchte daher zweierlei leisten: ● Zum einen sollen allgemein verständlich, d. h. ohne naturwissenschaftliche Vorkenntnisse nachvollziehbar, grundlegende methodische und technische Grundlagen der Messung von Gehirnsignalen erklärt werden. ● Zum anderen sollen die typischen Fehlschlüsse und Missverständnisse dargestellt werden, die sich immer wieder bei der Argumentation mit Neuroimaging-Studien finden lassen. Abschließend wird auf eine aktuelle und viel Aufsehen erregende Kritik des Neuroimagings eingegangen. Was ist Neuroimaging und welche Gehirnsignale misst es? Neuroimaging ist die bildliche Darstellung der Struktur (strukturelles Neuroimaging), der molekularen Ausstattung (molekulares Neuroimaging) oder der Funktion (funktionelles Neuroimaging) des Gehirns (vgl. Abb. 1). Dafür werden mithilfe technischer Vorrichtungen Signale des Gehirns ge309 funktionell a Neuroimaging (Bildgebung des Gehirns) b c strukturell d molekular e Abb. 1 Neuroimaging ist die bildliche Darstellung der Struktur, der Funktion oder der molekularen Ausstattung des Gehirns. Die nichtinvasive MRT (Magnetresonanztomographie) kann für alle drei Arten des Neuroimagings benutzt werden. Obere Bilder (funktionelle MRT): Die Abbildungen zeigen, welche Regionen des Gehirns bei einer Arbeitsgedächtnisaufgabe im Vergleich zu einer einfachen Reaktionsaufgabe stärker durchblutet und damit aktiver sind. Mittlere Bilder (strukturelle MRT), links: Hochauflösendes strukturelles MRT-Bild, das einen deutlichen Unterschied zwischen weißer Substanz, grauer Substanz und „Hirnwasser“ (CSF) zeigt; rechts: Eine neuere strukturelle Darstel- 310 lung mithilfe des Diffusion-Tensor-Imagings (DTI): Hier werden die Nervenbündel sichtbar gemacht, die verschiedene Hirnregionen miteinander verbinden. Untere Bilder (molekulare MRT): Beispiel für die Darstellung der Konzentration verschiedener Moleküle in einem bestimmten Hirngebiet, dem anterioren zingulären Kortex (innerhalb des Kastens) mithilfe der Magnetresonanzspektroskopie (MRS). Die Höhe der Zacken entspricht der Konzentration des jeweiligen Moleküls, am deutlichsten ist die Zacke für NAA (N-Acetyl-Aspartat) ausgebildet, einem Molekül, anhand dessen sich die Integrität des Hirngewebes abschätzen lässt. messen und aus ihnen die genannten Aspekte rekonstruiert (zur Übersicht: Walter 2005). Die Geschichte des Neuroimagings ist noch jung. Sie beginnt im eigentlichen Sinne erst mit der Entdeckung des EEGs (Elektroenzephalogramm) durch Hans Berger Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts in Jena. Berger hoffte, mit dieser Methode die geistige Energie physikalisch fassen zu können. Das EEG entwickelte sich zu einer Standardmethode und war bis zur Entwicklung neuer Techniken eine sehr wichtige diagnostische Methode in der Neurologie und der Psychiatrie. Heute wird es klinisch vor allem in der Epilepsie-Diagnostik eingesetzt, spielt in der Hirntod-Diagnostik eine wichtige Rolle und ist als Forschungsinstrument weiterhin wichtig. Innerhalb eines Zeitraums von nur 20 Jahren erfolgte dann die Einführung fast aller heute gängiger Neuroimaging-Methoden: ● 1968: die Magnetenzephalographie (MEG) ● 1971: die Computertomographie (CT) ● 1973: die Magnetresonanztomographie (MRT) ● 1975: die Positronenemissionstomographie (PET) ● 1985: die transkranielle Magnetstimulation (TMS) In der neurowissenschaftlichen Erforschung geistiger Zustände, heute als kognitive Neurowissenschaft (cognitive neurosci311