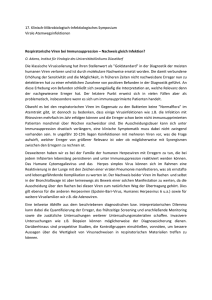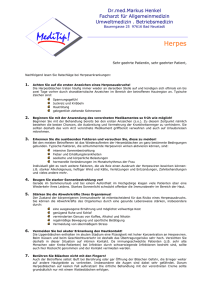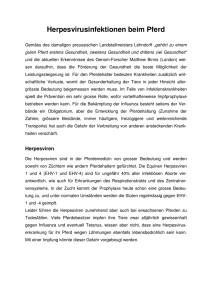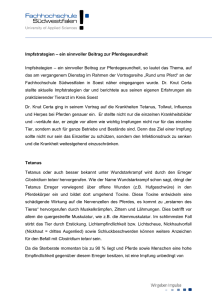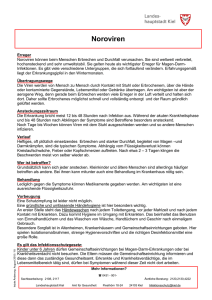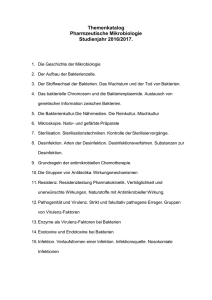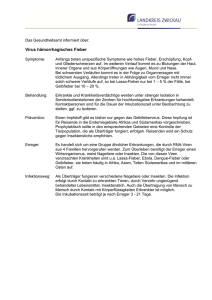Sind Herpesinfektionen auch nützlich - Klinik
Werbung

Sind Herpesinfektionen auch nützlich? Im Tierversuch Schutz vor anderen Infektionen Herpesviren geniessen keinen guten Ruf, verursachen sie doch eine Vielzahl von teilweise schweren Krankheiten. Fast revolutionär klingt es vor diesem Hintergrund, wenn den Erregern nun auch positive Eigenschaften bescheinigt werden. So haben amerikanische Forscher in Untersuchungen bei Mäusen entdeckt, dass die Viren den Wirtsorganismus indirekt vor Angriffen bakterieller Erreger schützen.[1] Inwieweit diese bei Tieren beobachteten Zusammenhänge auch für den Menschen Gültigkeit besitzen, lässt sich zwar noch nicht beantworten. Unabhängig davon werfen sie aber ein neues Licht auf die Beziehung zwischen Herpesviren und ihren Wirten. Denn anders als bisher vermutet scheint diese nicht rein parasitischer Natur zu sein, sondern eben auch symbiotische Züge zu tragen. Abwehrzellen in Alarmbereitschaft Ursprünglich wollten der Immunbiologe Erik Barton und seine Kollegen von der Washington University Medical School in St. Louis, Missouri, herausfinden, welche Rolle der Botenstoff InterferonGamma, ein bedeutsamer Vermittler der Immunantwort, beim Wiederaufflammen von Herpesinfektionen spielt. Zu den Eigenheiten dieser Viren zählt nämlich, dass sie sich nach der Erstinfektion in gewissen Körperzellen verschanzen. Bei ihren Studien nutzten die Forscher eine mit dem menschlichen Epstein-Barr-Virus eng verwandte Herpesviren-Art der Maus, das Gamma-HV68. Wie sie dann eher zufällig entdeckten, waren wichtige Immunwächter - die auch Fresszellen genannten Makrophagen - selbst Monate nach Abklingen der Symptome der akuten Infektion noch in erhöhter Alarmbereitschaft. Zurückführen liess sich die ungewöhnliche Kampfeslust der Makrophagen offenbar auf die Tatsache, dass das Immunsystem die Herpesviren nicht vollständig beseitigen kann und sich daher gegen einen erneuten Grossangriff der Erreger wappnet. Die Aufrüstung des Immunsystems, die unter anderem mit einer vermehrten Produktion der immunologischen Botenstoffe Interferon- Gamma und TNFalpha einherging, schien zugleich aber auch andere Aggressoren abzuwehren. Denn Mäuse mit latenter Gamma-HV68- Infektion waren sehr viel resistenter gegen die Attacken bestimmter Bakterienarten darunter Listerien und die Erreger der Pest - als Nager, die keine solchen Viren in sich trugen. Vergleichbar abwehrstärkend waren chronische Infektionen mit einer weiteren Herpesviren-Art, dem Zytomegalie-Virus. Allerdings vermittelten die Herpesviren keinen allumfassenden Schutz - im Kampf gegen den West-Nil-Virus hatten derart vorbelastete Tiere keinen Vorteil. In Jahrmillionen an den Wirt angepasst Wie Reinhard Kurth, der Präsident des Robert- Koch-Instituts in Berlin, anmerkt, sind Symbiosen zwischen Viren und Wirt im Tierreich extrem ungewöhnlich. Dass ausgerechnet Herpesviren eine Infektionsstrategie entwickelt haben, die nicht nur ihnen selbst, sondern auch ihrem Wirt zugute kommt, hält Walter Bossart vom Institut für Medizinische Virologie am Universitätsspital in Zürich andererseits für wenig überraschend. Die menschlichen Herpesviren hätten sich im Verlauf von Jahrmillionen an ihren Wirt angepasst und somit genügend Zeit gehabt, einen Infektionsmodus zu etablieren, der ein langfristiges Überleben im menschlichen Körper garantiere. Denn auch dem Virus bringe es keinen Nutzen, wenn der von ihm infizierte Mensch schwer erkranke oder vorzeitig sterbe. Denkbar sei daher, dass der Erreger die Immunabwehr seines Wirts durch seine andauernde Präsenz stärke, um diesen vor den Attacken bakterieller Erreger zu schützen. Laut Bossart sprechen etliche Beobachtungen für einen solchen «Masterplan». So gebe es etwa Hinweise darauf, dass das zur Gruppe der Herpesviren zählende menschliche Zytomegalie- Virus die Infektanfälligkeit verringere. Dennoch wiesen die Betroffenen häufiger eine verminderte Lebenserwartung auf - möglicherweise, weil sich ihr Immunsystem aufgrund der dauerhaft erhöhten Alarmbereitschaft schneller erschöpfe. Inwieweit es sich bei diesen Beobachtungen um ursächliche oder eher zufällige Zusammenhänge handle, werde derzeit in einer grösseren Studie am Universitätsspital Zürich untersucht. Nicola von Lutterotti 27. Juni 2007, Neue Zürcher Zeitung [1] Nature 447, 326-329 (2007).Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter: http://www.nzz.ch/2007/06/27/ft/articleF9LTO.html