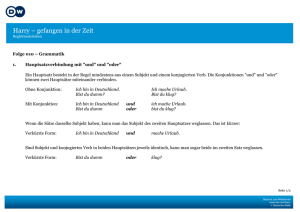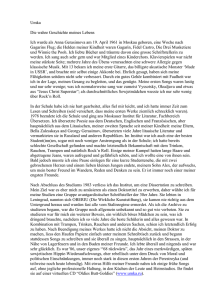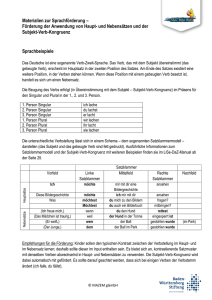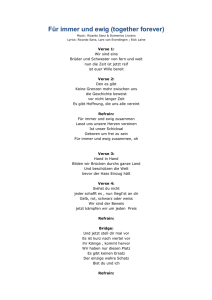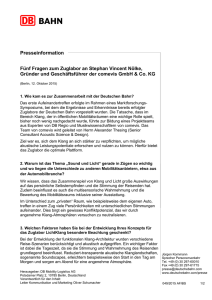Feministische Popmusikanalyse - Hu
Werbung

Feministische Popmusikanalyse
–
Auf der Suche nach Worten
Magisterarbeit von Lena Müller im Fach Musikwissenschaft
–
Humboldt-Universität zu Berlin
Abgabedatum: 21.11.2013
Erster Gutachter:
Prof. Dr. Peter Wicke
Zweite Gutachterin: PD Dr. Dorothea Dornhof
Inhalt
1. Klang, Körper, Stimme und Sprache – Eine Einleitung...................................................1
2. Rahmen................................................................................................................................11
2.1 Feministische Grundlagen........................................................................................11
2.1.1 Simone de Beauvoir –
Die Positionierung von Frauen als unwesentliche Subjekte........................11
2.1.2 Judith Butler – Die Einverleibung des heterosexuellen Körpers.................15
2.2 Popmusik als Dispositiv und Mimesis als Weltzugang............................................19
3. Werkzeuge...........................................................................................................................26
3.1 Möglichkeiten sich dem Klang zu nähern................................................................26
3.1.1 Assoziation...................................................................................................26
3.1.2 Homologie....................................................................................................30
3.1.3 Intertextualität..............................................................................................32
3.1.4 Materialität...................................................................................................36
3.1.5 Psychoanalyse..............................................................................................40
3.2 Körperliche Klangproduktion: Die Stimme .............................................................45
4. Analysen..............................................................................................................................54
4.1 Die „echte“ Stimme..................................................................................................55
4.1.1 Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“..............................................................57
4.1.2 Robbie Williams: „Feel“..............................................................................63
4.1.3 Michael Jackson: „Billie Jean“....................................................................65
4.1.4 Zusammenfassung: Die „echte“ Stimme als männliche Performanz ..........66
4.2 Andere Stimmen ......................................................................................................69
4.2.1 Kate Bush: „Feel It“.....................................................................................70
4.2.2 Kylie Minogue: „Can't Get You Out of My Head“......................................78
4.2.3 Björk: „All Is Full Of Love“........................................................................86
4.2.4 Birdy: „People Help The People“................................................................91
4.2.5 Zusammenfassung:
Die Fragmentierung der Anderen und der semiotische Stimmklang .......100
5. Klangliche Körperproduktionen – Ein Fazit ................................................................106
5.1 Worte.......................................................................................................................106
5.2 Verschiedene Modi auditiver Lust..........................................................................107
5.3 Eigenes und Anderes...............................................................................................109
5.4 Intelligibilität und Reproduktion............................................................................109
5.5 Feministische Konsequenzen..................................................................................110
ANHANG..............................................................................................................................114
Quellenverzeichnis ...............................................................................................................115
Literatur [Internetquellen zuletzt abgerufen am 7.11.2013].........................................115
Musik............................................................................................................................119
Internetseiten [Zuletzt aufgerufen am 16.11.2013].......................................................119
Songtexte...............................................................................................................................121
Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“..............................................................................122
Robbie Williams: „Feel“...............................................................................................124
Michael Jackson: „Billie Jean“.....................................................................................126
Kate Bush: „Feel It“......................................................................................................128
Kylie Minogue: „Can't Get You Out of My Head“.......................................................130
Björk: „All Is Full Of Love“.........................................................................................132
Birdy: „People Help The People“.................................................................................134
Trackliste der beigefügten CD............................................................................................136
Selbstständigkeitserklärung................................................................................................137
1. Klang, Körper, Stimme und Sprache – Eine Einleitung
„The thing with women, they're not real. They're not real at all.
And that's really hard to accept, and I don't think that I should have
to accept it.“1
„Consider, for example, the discursive and stylistic segregation of
«rock» and «pop». In this schema, rock is metonymic with
«authenticity» while «pop» is metonymic with «artifice». Sliding
even further down the metonymic slope «authentic» becomes
«masculine» while «artificial» becomes «feminine».[...] Real men
aren't pop and women, real or otherwise, don't rock.“2
In dieser Arbeit möchte ich mich aus einer feministischen Perspektive mit dem Klang von
Popmusik auseinandersetzen. Die mich antreibenden Fragen sind dabei, wie Sexismus
klingt, wie Geschlecht klingt, aber auch wie Feminismus klingt oder klingen könnte.
Meine Motivation für diese Arbeit ist dabei nicht nur ein Interesse, diese Zusammenhänge
zu verstehen, sondern vor allem auch eine ziemliche Unzufriedenheit mit etwas, was ich in
meinem Studium als eine Art Sprachlosigkeit gegenüber diesem Themengebiet
wahrgenommen habe.
Im Gegensatz zur Betrachtung anderer Medien, beispielsweise Literatur, Film oder
Photographie, für die es je eigene Werkzeuge zur Analyse sexistischer Strukturen gibt,
scheint ein entsprechendes Werkzeug in der Musikanalyse zu fehlen. Während ich so z.B.
in meinem zweiten Studienfach, Kulturwissenschaft, fast selbstverständlich nebenbei
einen „männlichen Blick“3 in bildlichen und filmischen Darstellungen zu erkennen lernte
oder eine sich als objektiv gebärdende Zentralperspektive in der westlichen Wissenschaft
als Ausdruck einer privilegierten gesellschaftlichen Position interpretieren konnte, 4 waren
entsprechende Analysen des Klangs von Popmusik in meinem Studium selten und oft
enttäuschend, obwohl die Relevanz von Sexualität, Geschlecht, Sexismus oder Begehren
in diesem Medium andererseits offensichtlich erscheint:
1
2
3
4
Shepherd (1991), S.183: Zitat einer jungen Frau (Diana) in einem qualitativen Interview.
Coates (1997), S.52.
Mulvey (1994), S.55.
Vgl. beispielsweise Haraway (1995b), S.79.
1
So lässt sich beim Hören von zahlreichen Popsongs, beispielsweise „Naughty Girl“ von
Beyoncé, kaum von der Hand weisen, dass auch im Klang sexualisierte Darstellungen von
Sängerinnen stattfinden. Und dass Geschlecht auch in der dominanten musikalischen
Ausdrucksform der gegenwärtigen westlichen Kultur eine relevante Rolle einnimmt, ist
grundsätzlich eine durchaus naheliegende These.
Ich denke, es lohnt sich, angesichts dessen, was ich hier als Sprachlosigkeit bezeichnet
habe, kurz zu überlegen, weshalb die Analyse von Sexismus in Musik und vor allem im
Klang so viel schwerer zu sein scheint als in Bildern oder Texten. Ein Grund hierfür liegt
wahrscheinlich bereits darin, dass ein Popsong nur schwer für den untersuchenden Blick,
als primäres westliches Erkenntnisorgan, zugänglich ist: Die dabei im Blick implizit
enthaltene Distanz vom betrachteten Gegenstand lässt sich auf das Hören nicht einfach
übertragen; vielmehr scheint Distanzlosigkeit gerade eine zentrale Eigenschaft des
Mediums Musik zu sein.5
Dabei lässt sich aber bereits diese unterschiedliche Bewertung der verschiedenen Sinne
aus einer feministischen Perspektive kritisch hinterfragen, denn der erkennende
wissenschaftliche Blick kann als eine Spielart einer männlich konnotierten sich selbst
immer im Zentrum einer objektiven Weltbetrachtung imaginierenden Perspektive gedeutet
werden.6 Der Musikwissenschaftler John Shepherd kritisiert die Abwertung des Hörens
gegenüber dem Sehen sogar ganz explizit als Ausdruck einer patriarchalen Weltordnung:
Die Nutzung der anscheinend neutralen Kategorien harmonischer und tonaler
Beziehungen und das Ausklammern emotionaler und körpernäherer Aspekte von Musik
interpretiert er, als eine Reduktion von Musik auf Notentext und damit eine Distanzierung
vom Körper, die er wiederum als musikalische Bestätigung patriarchaler die Welt und den
Körper objektivierender Herrschaftsansprüche ansieht.7
5 Vgl. Shepherd/Wicke (1997), S.164: „The presentation of sonic matter recognized as musically
significant cannot help but evoke states of awareness whose degree and manner of affectivity are related
to the characteristics of the sound presented. The sounds of music cannot help, in other words, but
reaffirm the present existence of the individual, and reaffirm it with a concreteness and directness not
required for reaffirmation through the sounds of language. The material character of sound in music
speaks directly and concretely through its technology of articulation to the individual's awareness and
sense of self, an awareness and sense, it should be remembered, that is pervasively social and discursive
in its mediation and constitution.“ [meine Hervorhebung].
6 Haraway beschreibt ihrem Aufsatz Situiertes Wissen „den erobernden Blick von nirgendwo“ [Haraway
(1995b), S. 80] , der für sie klar mit patriarchalen Machtstrukturen verbunden ist. „Dieser Blick schreibt
sich auf mythische Weise in alle markierten Körper ein und verleiht der unmarkierten Kategorie die
Macht zu sehen, ohne gesehen zu werden sowie zu repräsentieren und zugleich der Repräsentation zu
entgehen.“
7 Vgl. Shepherd (1991), S.154-164: Die Privilegierung des Sehens gegenüber dem Hören geht für ihn
einher mit der Vorstellung der Welt als objekthaft und vom eigenen Körper getrennt, während bei der
2
Schon die Frage, wie und was in Musik analysiert und beschrieben wird, kann auf dieser
Basis aus feministischer Perspektive nicht als neutral angesehen werden, sondern sollte
kritisch reflektiert werden.
Bei näherer Betrachtung erscheinen Musik und Klang dabei insgesamt an vielen Stellen
von einer Geschlechtersymbolik durchzogen. Die feministische Musikwissenschaftlerin
Susan McClary beschreibt dies folgendermaßen:
„The charge that musicians or devotees of music are «effeminate» goes back as far as recorded
documentation about music, and music's association with the body (in dance or for sensuous
pleasure) and with subjectivity has led to its being relegated as a «feminine» realm. Male
musicians have retaliated in a number of ways: by defining music as the most ideal (that is, the
least physical) of the arts; by insisting emphatically on its «rational» dimension; by laying
claim to such presumably masculine virtues as objectivity, universality and transcendence, by
prohibiting actual female participation altogether.“8
Die hier angedeutete starke Verbindung von Musik mit Körper und Subjektivität ist dabei
sicher ein weiteres Hindernis für die wissenschaftliche sprachliche Auseinandersetzung
darüber, da sie einer bewussten Reflexion nur schwer zugänglich ist. Wenn außerdem, wie
McClary implizit nahe legt, gerade hier nach den Momenten einer musikalischen
Geschlechterproduktion gesucht werden müsste, so ist ersichtlich, weshalb diese Thematik
in einer Disziplin, die ihren Gegenstand als „tönend bewegte Formen“9 versteht, nur
schwer eine Sprache findet.
Gerade Popmusik ist allerdings im musikanalytischen Denken dieser akademischen
Disziplin immer noch mit besonderen Problemen konfrontiert: Susan McClary und Robert
Walser beschreiben dies in einem Aufsatz von 1988 recht ausführlich und listen einige
grundlegende Probleme für die wissenschaftliche Popmusikbetrachtung auf. Diese
beginnen bei der „feindseligen“ Ablehnung von Popmusik durch die traditionelle
Musikwissenschaft und enden mit der Entwicklung einer stichhaltigen Argumentation zur
Beziehungen zwischen Musik und Gesellschaft.10 Popmusik bezeichnen sie dabei als
Erfahrung von Klang die Beziehung des hörenden Individuums zur Welt, seine Einbindung in die soziale
und physische Wirklichkeit, nicht verleugnet werden kann. Diese distanzierende Sicht der Welt versteht
Shepherd dabei als männlich („They [=Männer] quickly thought themselves into the entirely mythical
position of being separate from the world“[ders. S.158]), während er eine Gleichsetzung zwischen
Frauen, sozialen Beziehungen und Musik vornimmt: „Women, as emotional nurturers, […] come to
stand for the very process – social relatedness“ [ders. S.155] und „The existence of music, like the
existence of women, is potentially threatening for men to the extent that it sonically insists on the social
relatedness of human worlds“ [ders. S. 159]. Schließlich idealisiert er ein Bild des Ausgleichs oder der
Vervollständigung zwischen den in dieser Form postulierten männlichen und weiblichen Subjektivitäten
in einem sich ergänzenden vollen Obertonspektrum [ders. S.168].
8 McClary (1991), S.17.
9 Hanslick (1982), S.74.
10 Vgl. McClary/Walser (1996): S.281-293.
3
„uncharted areas for which there is no shared critical apparatus of language“ 11 und
verorten ihre Analyse „in a methodological vacuum“12 und auch wenn an dieser Stelle in
den letzten 25 Jahren Entwicklungen stattfanden, so beinhaltet jede Analyse von
Popmusik immer noch zugleich die Aufgabe Fragestellungen, Methoden und Werkzeuge
mitzuentwickeln.
Glücklicher Weise entwickeln sich jedoch dadurch nach und nach auch theoretische
Modelle und analytische Werkzeuge, mit denen sich gerade den körperlichen und
subjektiven Aspekten von Klang genähert werden kann, ohne die ein Verständnis
wesentlicher Prozesse der Popmusik nicht möglich wäre. Freya Jarman-Ivens Arbeit zu
„Queer Voices“ erscheint mir diesbezüglich bemerkenswert.
Jarman-Ivens beschäftigt sich, wie ihr Titel schon sagt, mit der Stimme und versucht unter
anderem die Beziehungen zwischen Körper und Stimme zu entschlüsseln, wobei sie eine
gegenseitige Abhängigkeit feststellt:
„[I]t is possible to think of the voice not only in terms of its production by the body, but its
implications for the body – its production of bodies.“13
Sie meint damit, dass wir einer gehörten Stimme auch eine körperliche Quelle
zuschreiben, wobei diese jedoch durchaus auch „an imagined body for a disembodied
voice“14 sein kann.
Auf der anderen Seite kann diese Produktion von Körpern durch Stimmen aber auch noch
anders verstanden werden. In einer der ersten Auseinandersetzungen zu der Beziehung
von Geschlecht und Popmusik, formulierten Simon Frith und Angela McRobbie bereits
1978 in ihrem Aufsatz „Rock and Sexuality“ die These, dass Rockmusik wesentlich an der
Konstruktion
von
Sexualität
beteiligt
ist15.
Dabei
werden
vor
allem
auch
Geschlechterunterschiede beständig reproduziert:
„The recurrent theme of this essay has been that music is a means of sexual expression and as
such important as a mode of sexual control. Both in its presentations and in its use, rock has
confirmed traditional definitions of what constitutes masculinity and femininity, and reinforces
their expression in leisure pursuit.“16
Insofern lässt sich argumentieren, dass das Erleben des eigenen Körpers durch Musik
beeinflusst, wenn nicht regelrecht konstruiert wird. Musik ließe sich somit als ein Medium
11
12
13
14
15
16
McClary/Walser (1996), S.282.
Dies., S.280.
Jarman-Ivens (2011), S.7.
Dies., S.8.
Vgl. Frith/McRobbie (1996), S.373.
Dies., S.387.
4
verstehen,
das
vielleicht
weniger
die
äußere
Wahrnehmung,
als
die
innere
Selbstwahrnehmung von Körpern beeinflusst.
Was mich nun vor allem interessiert, ist, wie eine solche Konstruktion von Körpern in
Musik stattfindet und wie sie insbesondere in der Musik analysiert werden kann. Dabei
denke ich, dass die Stimme einen besonders guten Ansatzpunkt bietet, diesen Prozess zu
verstehen, da sie bereits selbst körperlich ist.
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Shepherd, der vorschlägt, sich in der Musikanalyse
von den tradierten Kategorien der musikalischen Notation abzuwenden und andere
Ebenen, insbesondere das von ihm als körpernah eingestufte Timbre der Stimmen, in die
Analyse miteinzubeziehen. Auch ich halte die Analyse von spezifischer Klanglichkeit und
vor allem dem Einsatz der Stimme für viel versprechend für eine feministische
Popmusikkritik, doch für eine solche Betrachtung von Musik fehlen schnell die Worte:
Während sich eine Quarte oder eine Dominante begrifflich sehr klar fassen lassen, ist die
Unterscheidung von Klangeigenschaften durchaus komplizierter. Der Grund hierfür ist
allerdings nicht, dass die hörende Unterscheidung hier schwer fallen würde, sondern viel
mehr, dass es schnell an Vokabeln fehlt, um diese zu beschreiben.
Das Fehlen von Worten bedeutet jedoch nicht, dass solche klanglichen Unterschiede
kulturell bedeutungslos wären, im Gegenteil: Jarman-Ivens beschreibt diese Eigenschaft
von Stimmklang als „under-assimilated“17. Sie meint damit:
„[A]n audible inhalation, or diction […] do signify something, but that «something» is not
often explicitly identified, nor is there an established culture in the analysis of music of
wanting to identify them.“18
Es besteht daher für eine klangzentrierte Musikanalyse die Notwendigkeit, Begriffe zur
Beschreibung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen
Stimmklängen zu entwickeln. Diese Begriffe sind dabei zugleich Werkzeuge, die es
ermöglichen,
nicht
nur
Unterschiede
zu
beschreiben,
sondern
auch
diese
Unterscheidungen überhaupt erst vorzunehmen, d.h. sie für andere wahrnehmbar, sie
übertragbar
und
diskutierbar
zu
machen.
Schließlich
bilden
nachvollziehbare
Unterscheidungen auch die Voraussetzung für sinnvolle Interpretationen und damit für die
Thematisierung der kulturellen Bedeutung dieser Unterschiede. In dieser Arbeit werde ich
einige solcher Unterscheidungen vornehmen, um auf dieser Basis Thesen zur Darstellung
von Geschlecht in Popmusik zu erarbeiten.
17 Jarman-Ivens (2011), S.7.
18 Ebd.
5
Mein Ziel ist es dabei jedoch nicht, schlicht akustische Attribute von Männlich- oder
Weiblichkeit zu finden, sondern vor allem zu einer Betrachtung von Popmusik insgesamt
als ein von sexistischen Dynamiken strukturiertes Feld zu kommen. Ähnlich wie die These
der feministischen Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey, dass im Kino eine Identifizierung
des Publikums mit dem männlichen Helden unterstützt wird, während Frauen als
betrachtbares Spektakel von außen angesehen und objektiviert werden, 19 denke ich, dass
die Geschlechter auch musikalisch in ein asymmetrisches Verhältnis zueinander gesetzt
werden, bestimmte Perspektiven privilegiert und andere abgewertet werden.
Zwar halte ich grundlegende Analogien zwischen den Geschlechterdarstellungen im Film
und in Popmusik für wahrscheinlich, eine einfache Übertragung dieses als „male gaze“
[=männlicher Blick] bekannten Modells erscheint mir aber nicht zielführend, denn dies
würde die Unterschiede zwischen den Sinnen, Hören und Sehen, negieren. Außerdem ist
die mit der Stimme verbundene sprachliche Interaktion, in der Sprechen und Hören
aufeinander treffen und sich gegenseitig als sprachfähige Subjekte anerkennen müssen,
ambivalenter, als die einseitige Betrachtung des „male gaze“, durch den der, die oder das
Betrachtete mehr oder minder in die Position eines Objekts gebracht wird. Wer oder was
schließlich im Klang einzelner Popsongs aktiv oder passiv, Subjekt oder Objekt ist, ist
eine noch kompliziertere Frage und ließe sich nicht einfach mit einer übertragenen Idee
eines „männlichen Gehörs“ erklären.
Ich möchte in dieser Arbeit jedoch genau dieser Frage in der analytischen Betrachtung
einzelner Musikbeispiele nachgehen. Dabei werde ich außerdem die einzelnen Songs
miteinander in Beziehung setzen bzw. sie in Popmusik als einem gemeinsamen kulturellen
Raum verorten, über den ich hoffe, mithilfe der in den Beispielen gewonnenen
Erkenntnisse allgemeinere Aussagen machen zu können. Mein Ziel ist es so weniger zu
einer Kritik einzelner Songs zu kommen, als zu einer Kritik der Machtstrukturen 20, die die
Popmusik insgesamt durchziehen. Da ich allerdings nur sehr wenige Songs im Rahmen
dieser Arbeit ausführlicher betrachten kann, sind meine Ergebnisse als Thesen zu
19 Mulvey geht es in ihrer Filmanalyse weniger darum, dass Männer im Film Helden und Frauen Opfer,
jeweils mit entsprechenden Eigenschaften, sind, sondern dass der Aufbau der Filme, die Struktur der
Erzählung usw. den männlichen und weiblichen Figuren bereits deutlich voneinander unterschiedene
Positionen auch im Bezug zur Erzählung und zu dem den Film betrachtenden Publikum zuweisen. Diese
Positionierungen stehen für Mulvey mit psychoanalytischen Mustern, v.a. der Kastrationsdrohung, in
Beziehung, wodurch sie besonders überzeugend wirken [Vgl. Mulvey (1994), insbesondere S.55].
20 Ich beziehe mich auf Michel Foucaults Machtbegriff; vgl. z.B. Foucault (1983), S.83-102.
6
verstehen, die mit weiterem musikalischem Material belegt oder verändert werden
müssten.
Meine Methode ist die exemplarische Musikanalyse und Interpretation einzelner Songs,
die einen großen Teil meiner Arbeit ausmacht. Ausgehend von der in den Eingangszitaten
geäußerten Position, dass Geschlecht in irgendeiner Weise etwas mit Authentizität oder
„realness“ zu tun hat, werde ich zuerst drei von Sängern[sic] gesungene Songs betrachten,
bei denen ich auf eine gemeinsame stimmlich-klangliche Eigenschaft hinweisen möchte,
die ich die „echte“ Stimme nenne. Damit bezeichne ich sowohl einen bestimmten
Stimmeinsatz als auch ein bestimmtes ästhetisches Kommunikationsmodell, das sich
verbunden mit einem spezifischen Subjekt- und Körperbild an der Stimme festmachen
lässt.
Daraufhin werde ich mich vier von Sängerinnen gesungenen Popsongs zuwenden, deren
hauptsächliche Gemeinsamkeit es ist, nicht nach dem zuvor entwickelten Modell der
„echten“ Stimmen verständlich zu sein. Die hier präsentierten Körper- und Subjektbilder
lassen sich dabei nach jeweils anderen ästhetischen Kommunikationsmodellen
entschlüsseln, die ich jedoch abschließend miteinander und mit dem zuvor entwickelten
Modell der „echten“ Stimme in Beziehung setzen werde. Ich konzentriere mich bei
meinen Analysen dabei ausschließlich auf die Musik, lasse Kontexte, wie Musikvideos,
Images der Sänger_innen oder Interviews, unberücksichtigt und werde auch die
Bedeutung der Songtexte nur sehr eingeschränkt betrachten.
Allerdings erscheint es mir, wie ich bereits dargestellt habe, aus einer feministischen
Perspektive notwendig, vor der Analyse die Analysemethoden und die zu betrachtenden
Ebenen der Musik zu reflektieren. Ich werde aus diesem Grund meinen Analysen eine
ausführliche theoretische Darstellung von möglichen Analysewerkzeugen, ihrem Potenzial
und ihren Vor- und Nachteilen für eine feministische Musikbetrachtung voranstellen.
Außerdem erscheint es mir sinnvoll, die menschliche Stimme genauer zu verstehen, um
klangliche Unterschiede genauer beschreiben zu können. Die Stimme ist eine komplizierte
körperliche Aktivität und der Klang von Stimme ermöglicht Aussagen über den singenden
Körper, der an verschiedenen Stellen angespannt, verschlossen oder offen erscheinen
kann. Ich halte daher ein Wissen über die körperlichen Komponenten der Stimme für
meine Musikanalysen, die zu einem großen Teil Analysen solcher Körperklänge darstellen
werden, für hilfreich.
7
Diese Reflexionen über die Möglichkeiten von Musikanalyse und die körperlichen
Aspekte der Stimme stellen dabei die Werkzeuge für die anschließenden Musikanalysen
bereit. Im ersten Abschnitt der Arbeit möchte ich jedoch die Rahmenbedingungen klären
unter denen meine Analysen stattfinden. Ich werde darin näher auf zwei zentrale Begriffe
des Titels – Feminismus und Popmusik – eingehen. In diesem ersten Teil entwickle ich
den theoretischen Raum, in dem ich mich bewegen möchte und den ich theoretisch
abstecke, um mich anschließend darin orientieren zu können.
Ich beginne meine Arbeit dabei mit der Darstellung zweier wichtiger feministischer
Theorien – weniger weil ich fürchte, dass diese in der Musikwissenschaft eventuell immer
noch unbekannt sein könnten, sondern viel mehr, weil die Theorien über Geschlecht und
Sexismus von Simone de Beauvoir und Judith Butler eine Art grundlegende und sich
durchziehende Basis für diese Arbeit darstellen. Dabei werde ich Feminismus nicht nur als
eine politische Position betrachten, sondern vor allem als theoretische Grundlage für
meine Arbeit. Diese hat meiner Meinung nach auch ein gewisses musikanalytisches
Potential, das ich versuchen werde in meiner Arbeit zu nutzen. Außerdem bildet dies eine
notwendige Bedingung für die Formulierung einer über einzelne Songs hinausgehenden
Kritik an Sexismus in Popmusik.
Des Weiteren werde ich ein Modell von dem formulieren, was ich unter Popmusik
verstehe: Weniger eine spezielle aktuelle Musikform, als ein dynamischer gesellschaftlichkultureller Sozialisierungs- und Machtmechanismus, für den ich die Verwendung des
Foucaultschen Dispositivbegriffs vorschlagen möchte. Ein solcher differenzierterer
Begriff von Popmusik erscheint mir ebenfalls erforderlich, um zu einer feministischen
Kritik zu gelangen, die Popmusik insgesamt als sexistisch strukturierten Machtkomplex
versteht.
Dabei re-/produziert dieses Popmusikdispositiv allerdings nicht nur Geschlecht und
Sexismus, sondern auch viele weitere gesellschaftlich wirksame Diskriminierungen,
insbesondere Rassismus, auf die ich jedoch in dieser Arbeit nicht eingehen werde. Hierbei
ist allerdings kritisch anzumerken, dass fast alle von mir analysierten Songs von Weißen
gesungen werden.
Diese Auswahl ist dabei nicht ganz zufällig und basiert vor allem darauf, dass ich die
Position weißer Männlichkeit als eine Art gesellschaftliche Zentralposition ansehe, gegen
die sich weiße Weiblichkeit, nicht-weiße Männlichkeit und nicht-weiße Weiblichkeit
jeweils anders abgrenzen. In einer solchen Matrix stellt nicht-weiße Weiblichkeit eine
8
mehrfach diskriminierte Position dar, die sich negativ gegen alle anderen Kategorien (also
auch weiße Weiblichkeit und nicht-weiße Männlichkeit) abgrenzt. Ich bewege mich in
meiner theoretischen Betrachtung der Popmusik als einem machtvoll strukturierten Raum
vom Zentrum ausgehend, weshalb ich als ersten Schritt die nur „einfache“
Diskriminierung weißer Weiblichkeit analysieren werde. Das zusätzliche Miteinbeziehen
weiterer Diskriminierungen erschien mir hingegen zu kompliziert für die Entwicklung
eines ersten Ansatzes, weshalb ich mich insbesondere ausschließlich für die Untersuchung
von Songs weißer Frauen entschieden habe.21
Außerdem werde ich in dieser Arbeit ziemlich klar eine feministische Perspektive
einnehmen, was nicht nur theoretische, sondern auch politische und ethische Grundsätze
bezeichnet. Dies meint nicht, dass ich meine Positionen nicht rechtfertigen werde, sondern
vielmehr, dass sie sich an einem feministischen Wertesystem orientieren werden. Auf der
politischen Ebene bedeutet das, dass ich diese Arbeit als Teil einer politischen
Auseinandersetzung ansehe und deshalb die Entwicklung eines Ansatzes anstrebe, der gut
anwendbar und übertragbar ist und der so eine kraftvolle feministische Kritik ermöglicht.
Ich positioniere mich damit außerdem auch in einem feministischen Diskurs, weshalb ich
versuchen möchte, in meinen Musikanalysen eine möglichst interdisziplinär verständliche
Sprache zu verwenden. Eine feministische Perspektive bedeutet für mich aber auch, die
Reproduktion sexistischer Stereotype, Ausschlussmechanismen und anderer sexistischer
Logiken auf allen Ebenen zu vermeiden.
Aus diesem letzten Grund werde ich in dieser Arbeit kein generisches Maskulinum zur
allgemeinen Bezeichnung von Männern, Frauen und allen weiteren Menschen verwenden,
die sich in diesen beiden Kategorien nicht wiederfinden, sondern stattdessen einen
Unterstrich, das sogenannte „Gendergap“, verwenden.22 Mit „Sänger_innen“ meine ich
somit Sängerinnen, Sänger sowie – symbolisiert durch die mit dem Unterstrich
entstehende Lücke – alle weiteren denkbaren geschlechtlichen Identitäten. Ebenso werde
ich bei Pronomen und Artikeln vorgehen.
21 Da ich insgesamt Hautfarbe als Kategorie nicht in den Musikanalysen reflektiere, halte ich es auch nicht
für sinnvoll diese explizit mit zu bezeichnen; das soll heißen, dass ich mich dagegen entschieden habe,
explizit von weißer Weiblichkeit zu sprechen, da ich keine Aussage dazu machen kann, inwieweit die
Hautfarbe Auswirkungen auf die klangliche Darstellung hat. Mir ist bewusst, dass ich so möglicherweise
die machtvolle Position und Normierung von weißen Körpern reproduziere, indem ich im Folgenden
ohne weitere Benennung der Hautfarbe von Weiblichkeit und Männlichkeit sprechen werde.
22 Vgl. Antje Kirschnings „Hinweise und Empfehlungen für geschlechtergerechte Sprache an der ASH“, die
einen guten Überblick über verschiedene Möglichkeiten geschlechtergerechter Sprache gibt. [Kirschning
(2012)]
9
Da diese Verwendung einschließender Sprache aber leider noch immer eher die Ausnahme
als die Regel darstellt, erscheint es mir notwendig, die Verwendung des Maskulinums
zusätzlich zu markieren. Wenn ich also ausschließlich Sänger[sic] meine, so bezeichne ich
dies jeweils nochmals ausdrücklich mit einem nachgeschobenen [sic]. Dies erscheint mir
einerseits sinnvoll um Missverständnissen vorzubeugen, ist aber auch als eine kritische
Intervention gegen das männliche Privileg, sich als unmarkierte „Normalform“ des
Menschen darstellen zu können, zu verstehen.
10
2. Rahmen
2.1 Feministische Grundlagen
An dieser Stelle ist es nicht mein Ziel zu erklären, was Feminismus ist. Dies zu versuchen
wäre angesichts der vielfältigen unterschiedlichen aktuellen und historischen Strömungen
wahrscheinlich ohnehin nicht sehr erfolgversprechend. Stattdessen möchte ich einige
theoretische Positionen darstellen, die im Kontext des Feminismus stehen und für das
Verständnis dieser Arbeit grundlegend sind. Vor allem auf die beiden Autorinnen Simone
de Beauvoir und Judith Butler möchte ich dabei näher eingehen.
2.1.1 Simone de Beauvoir –
Die Positionierung von Frauen als unwesentliche Subjekte
Schon in ihrem Titel „Das andere Geschlecht“ deutet Simone de Beauvoir ihre Kernthese
an, dass nämlich sexistische Diskriminierung nicht einfach nur eine mehr oder minder
symmetrische Aufteilung der Welt bezeichnet, sondern eine Hierarchie zwischen den
Geschlechtern,
bei denen
den einen
(Männern)
das
Privileg
zukommt sich
selbstverständlich als Norm zu verstehen, während die anderen (Frauen) von dieser
Position ausgeschlossen und negativ dagegen abgegrenzt werden. Sie schreibt
beispielsweise:
„[D]er Mann vertritt so sehr zugleich das Positive und das Neutrale[...]. Die Frau dagegen
erscheint als das Negative, so daß jede Bestimmung ihr zur Einschränkung gereicht, ohne daß
die Sache umkehrbar wäre.“23
Diese Aufteilung hat weitreichende Folgen, nicht nur für die gesellschaftliche
Berücksichtigung der Interessen der jeweiligen Geschlechter, sondern auch für die
Bildung der Subjektivität, die sich an dieser unterschiedlichen Bewertung der
gesellschaftlichen Positionen als einer[sic] oder andere ausrichtet.
23 Beauvoir (2012), S.11.
11
Beauvoir spricht in ihrem Buch von einer „männliche[n] Naivität“24 und meint damit,
dass aus einer (unreflektierten) männlichen Perspektive die männliche Subjektivität als
normative, als normale selbstverständliche und objektive erscheint. Dass es überhaupt eine
andere ebenso legitime Weltsicht geben könnte, wird aus dieser Position ausgeblendet: „Er
[= der Mann] begreift seinen Körper als direkte, normale Verbindung zur Welt, die er in
ihrer Objektivität zu erfassen glaubt“.25 Aus der in diesem System privilegierten
männlichen Perspektive erscheint die eigene Weltsicht dabei so selbstverständlich, dass
sie, ebenso wie die Legitimität anderer Perspektiven, regelrecht unsichtbar wird.
Die weibliche Subjektposition hingegen wird in einen inneren Konflikt „zwischen dem
fundamentalem Anspruch jedes Subjekts, das sich immer als das Wesentliche setzt, und
den Anforderungen einer Situation, die sie als unwesentlich konstruiert“26 getrieben. In der
Folge kann sich weibliche Subjektivität nicht in derselben Einfachheit oder „Naivität“
entwickeln, sondern beinhaltet immer eine gewisse Doppelposition. Dabei ist eine
wirkliche Identifikation mit der „anderen“ Position nicht möglich, da diese eigentlich eine
positive Subjektsetzung ausschließt. Entsprechend ist eine weibliche Subjektposition
eigentlich nur als ein innerer Konflikt zu denken, der zwischen einer Identifikation mit
dem als männlich konstruierten wesentlichen Subjekt und einer Identifikation mit der als
anderes konstruierten Weiblichkeit, die in dieser Konstruktion eher als Objekt und nicht
als Subjekt verstanden werden muss, wechselt und so eigentlich nicht zur Ruhe kommen
kann:
„Wenn sie [= die Frau] spielt ein Mann zu sein, muß sie natürlich scheitern; aber auch wenn
sie spielt eine Frau zu sein, ist dies eine Illusion: Frau sein hieße das Objekt, der Andere sein;
und der Andere bleibt in seiner Selbstaufgabe unterworfen.“27 [Hervorhebung im Original]
Dieser Konflikt ist für Beauvoir eigentlich für jede Subjektivität grundlegend, denn „[d]as
Subjekt setzt sich nur, indem es sich entgegen-setzt: es hat den Anspruch sich als das
Wesentliche zu behaupten und das Andere als das Unwesentliche, als Objekt zu
konstituieren.“28 In einem gleichberechtigten Austausch miteinander würde jedes Subjekt
also immer wieder in einen Konflikt zwischen eigener Setzung und der Betrachtung durch
den_die Andere_n, geraten.
Durch Gesetze, Mythen, Diskurse und kulturelle Artefakte aller Art werden diese beiden
Pole aber mit den Geschlechtern, also männlich (d.i. Wesentliches, Subjekt) und weiblich
24
25
26
27
28
Dies., S.22.
Dies., S.12.
Dies., S.26.
Dies., S.76.
Dies., S.13.
12
(d.i. Unwesentliches, Objekt), mehr oder minder fest verbunden,29 was für die männliche
Subjektivität den Vorteil bringt, die eigene Position weniger hinterfragen zu müssen. Diese
kann sich somit selbstverständlich als wesentlich und normativ wahrnehmen, während
eine weibliche Perspektive regelmäßig damit konfrontiert ist, dass die eigene Position von
anderen Subjekten, aber auch von verschiedenen Kulturprodukten, nicht als wesentlich
anerkannt wird.
Verschiedene Feministinnen haben dieses Dilemma in unterschiedlichen Bereichen
belegen
können,
wie
beispielsweise
die
schon
in
der
Einleitung
erwähnte
Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey, die erklärt, dass sich auch die Zuschauerin im Kino30
mit dem männlichen Helden[sic] identifiziert und so zwischen den Geschlechtern
oszilliert.31 Während Sehen dabei zu einer männlichen Aktivität wird, konstruieren die von
ihr betrachteten Filme Weiblichkeit dem Blick gegenüber als passiv und als Symbol für
ein exhibitionistisches „Angesehen-werden-Wollen“.32 Dies ist jedoch nicht die Position
der Zuschauerin, die den Film betrachtet und sich schließlich einerseits zwar in diesem
Bild von Weiblichkeit wiedererkennen kann, sich aber zugleich, um dem Film folgen zu
können, mit dem Helden[sic] und seinem[sic] Blick identifiziert.
Wie die Film- und Medienwissenschaftlerin Mary Ann Doane am Beispiel einiger
offensichtlich für eine männliche Perspektive produzierter Bilder herausarbeitet, ist eine
weibliche Perspektive auf solche kulturelle Artefakte ein Paradox, das nur durch die
ambivalente Identifikation entweder mit dem Objekt des Blickes oder der männlichen
Perspektive lösbar erscheint.33 Insgesamt sind in vielen verschiedenen kulturellen
Produkten,
wie
z.B.
Photographien,
Kleidung
und Werbung,
gesellschaftliche
Machtverhältnisse eingeschrieben, indem sie permanent eine männliche Perspektive
privilegieren. Diese wird damit als neutrale normalisiert und legitimiert, während jede
andere Perspektive mit der eigenen Abweichung konfrontiert wird, was schließlich auch
zu einer anderen Selbst- und Weltwahrnehmung führt. Simone de Beauvoirs viel zitierter
29 Vgl. Dies., S.86 -189.
30 Mulvey betrachtet vor allem Hollywood-Klassiker, als Beispiele bezieht sie sich unter anderem auf
Hitchcock und Sternberg .
31 Vgl. Mulvey (1994), S.39-40 und Mulvey (2009), S.34-35: „for women (from childhood onwards) transsex identification is a habit that very easily becomes second nature. However, this Nature does not sit
easily and shifts restlessly in its borrowed transvestite clothes.“ [S.35].
32 Mulvey (1994), S.55.
33 Vgl. Doane (1994), S.86: „Die Wirksamkeit von Maskerade liegt genau in ihrem Vermögen eine Distanz
zum Bild herzustellen, eine Ungewißheit zu erzeugen, in der das Bild manipulierbar, produzierbar und
für Frauen lesbar gemacht wird. Dosineaus Photo kann vom weiblichen Zuschauer nicht gelesen werden
– nur im Masochismus kann sie es genießen. Um den Witz zu verstehen, muß sie wiederum die Position
der Transvestitin einnehmen.“
13
Satz „Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ 34 ist dabei auch so zu verstehen,
dass sich diese Gesellschaftsverhältnisse auf die individuelle weibliche Subjektivität
auswirken, die somit immer bedeutet, einen eigenen Umgang mit dieser Diskriminierung
zu finden.
Ich möchte nun über ein paar mögliche Konsequenzen für die Popmusik nachdenken: Es
liegt hier die These nahe, dass eine männliche Perspektive auch in der Popmusik immer
wieder normalisiert und privilegiert wird. Einige Texte haben solche Privilegierungen
bereits auf verschiedenen Ebenen belegt. Z.B. beschreiben Vaughn Schmutz und Alison
Faupel, dass in der Bewertung von Rockmusik die Musik von Frauen als weniger
normativ, wichtig oder relevant eingestuft wird und ihr Wert nicht allgemein, sondern
spezifisch für eine angebliche Tradition weiblicher und damit als anders markierter Musik
diskutiert wird.35 Ebenso gibt es Aufsätze, die sich mit den Problemen von Frauen in
verschiedenen musikalischen Aktivitäten beschäftigen36 oder die Situation von Frauen als
(diskriminierter) Zielgruppe diskutieren.37 Außerdem ist die Dominanz von Männern in
vielen Musikgenres, beispielsweise Rock, Metal, HipHop usw., offenkundig.38
Mein Projekt ist es allerdings, hier auf der Ebene des Klangs zu bleiben und einer
impliziten männlichen Perspektive in der Musik selbst auf die Spur zu kommen. Darüber
hinaus können sich aber auch die beiden mit dem Geschlecht verbundenen
unterschiedlichen Subjektpositionen in der Musik niederschlagen: Sowohl eine männliche
Perspektive, die sich selbst unhinterfragt als Wesentliches ansieht, als auch die
Schwierigkeiten einer weiblichen Perspektive, die versucht sich innerhalb eines
kulturellen
Zusammenhangs
musikalisch
auszudrücken,
der
ihre
Position
als
unwesentliche zurückweist und abwertet, könnten sich in der der Musik zeigen. Diese
Unterschiede in der musikalisch ausgedrückten Subjektivität könnten sich außerdem
bereits so verfestigt haben, dass sie zu klanglichen Mustern für die Präsentation eines
Geschlechts geworden sind.
34 Beauvoir (2012), S.334.
35 Vgl. Schmutz/Faupel (2010).
36 Vgl. beispielsweise Mavis Bayton (1996), der die geschlechtsspezifischen Hürden der Musikpraxis für
Frauenbands beschreibt, und Will Straws (1997), der sich mit geschlechtsspezifischem
Plattensammelverhalten beschäftigt.
37 Vgl. Garratt (1996): „On the whole, the word „fan“, when applied to women, is derogatory. It is always
assumed, that they are attracted to a person for the «wrong» reasons, that they are uncritical and stupid.
As an audience, they are usually treated with contempt by both bands and record companies. The «real»
audience is assumed to be male, and advertisements, record sleeves, and even stage presentations are
nearly always aimed at men.“ [S. 409].
38 Vgl. O'Brien (1995), S.1-6, Gaar (1994), S.15-19, Litzbach (2011), S.9 oder Binas (1992).
14
2.1.2 Judith Butler –
Die Einverleibung des heterosexuellen Körpers
Damit möchte ich zur zweiten für diese Arbeit grundlegenden Theorie kommen: Judith
Butlers Performanztheorie. Performativität meint die ständige Re-/Produktion des
Subjekts innerhalb des Intelligibilitätsrahmens, eines zugleich einschränkenden wie
hervorbringenden Sets an zitierfähigen und gesellschaftlich als solche Zitate
verständlichen (=intelligiblen) Verhaltensmustern. Für Butler entsteht das Subjekt dabei
nicht nur einmal in der Kindheit, sondern es muss sich in gesellschaftlichen Prozessen
laufend als solches behaupten. Hierzu ist es notwendig, von außen als Subjekt erkennbar
zu werden, was dadurch geschieht, dass auf die allgemein bekannten Muster des
Intelligibilitätsrahmens Bezug genommen wird.
Der Intelligibilitätsrahmen strukturiert dabei die Möglichkeit von Subjekten und Körpern,
indem er diese innerhalb der heterosexuellen Matrix in eine durch Begehren strukturierte
Beziehung setzt und anordnet, wobei Geschlecht als Basis für das normativ heterosexuelle
Begehren rückwirkend naturalisiert wird. Anders gesagt ist Geschlecht damit nur eine
Funktion des vorweg als heterosexuell normierten und damit auf einem grundlegenden
Dualismus basierenden Begehrens.39 Geschlecht ist also keine statische Eigenschaft,
sondern ein wiederholendes und wiederholtes Handeln, das als zitierende Reproduktion
des Intelligibilitätsrahmens gesellschaftlich verständlich wird.
Dies beschränkt Butler ausdrücklich nicht auf das soziale Geschlecht (d.h. gender)
sondern besteht darauf, dass auch das biologische Geschlecht (sex) sich so erst
materialisiert; da „es keine Bezugnahme auf einen reinen Körper gibt, die nicht zugleich
eine weitere Formierung dieses Körpers wäre“.40 Es gibt also nicht vorweg einen
natürlichen Körper, auf dem kulturelle Prozesse aufbauen würden, sondern der Körper
selbst ist ein kulturell geprägtes Artefakt, zu dessen Natur es eigentlich keinen Zugang
gibt. Es existiert somit auch kein unveränderlicher Kern in oder eine unveränderliche
Wahrheit über irgendein beliebiges Subjekt oder ein Geschlecht. Der Eindruck eines
solchen ist ein Resultat der erfolgreichen Performanz.
In ihrem stark von der Psychoanalyse geprägten zweiten Kapitel von „Das Unbehagen der
Geschlechter“ beschreibt Butler dabei den Prozess der Annahme eines körperlichen
Geschlechts als „Einverleibung“.41 Sie bezieht sich dabei auf Sigmund Freuds
39 Vgl. Butler (1991), S.120-122.
40 Butler (1997), S.33.
41 Butler (1991), S.108.
15
Melancholie, die einen emotionalen Verlust verleugnet, indem sie das verlorene Objekt als
Introjektion in den Körper aufnimmt und dort als „radikal Unnennbares bewahrt“. 42 Dies
bezieht sie auf die heterosexuelle Matrix, die ein homosexuelles Begehren so sehr
verleugnet, dass es vom Subjekt selbst nicht zugelassen werden kann und noch vor jeder
Verdrängung verleugnet wird. Dadurch wird insbesondere eine Beziehung dieses Verlusts
zur Sprache unmöglich, die ihm eine Bedeutung geben könnte. Die Introjektion ist also
außersprachlich. Es geht so „nicht nur das Objekt verloren, sondern das Begehren wird
vollständig verneint“.43
Die Introjektion bzw. Verschiebung des Liebesobjektes in den Körper ist dabei Basis für
die vergeschlechtlichte Identifizierung oder Einverleibung des Geschlechts. Dies
beinhaltet vor allem auch die somatische speziell erotische Selbstbeziehung des
vergeschlechtlichten Subjekts:
„[B]estimmte Körperteile werden genau deshalb zu Vorstellungszentren der Lust, weil sie dem
normativen Ideal eines solchen, für die Geschlechtsidentität spezifischen Körpers entsprechen.
In bestimmtem Sinne werden die Lüste durch die melancholische Struktur der
Geschlechteridentität determiniert, die manche Organe für die Lust abtötet, andere wiederum
zum Leben erweckt.“44
Nun sollte hieraus aber nicht eine vorgängige Bisexualität aller Menschen geschlossen
werden. Unter Rückgriff auf den produktiven Machtbegriff von Foucault45, legt Butler dar,
wie auch dieses vollständig verdrängte homosexuelle Begehren erst durch das Verbot
hervorgebracht wird. Gewissermaßen wird in diesem Prozess überhaupt erst die Spaltung
der Menschheit in zwei Geschlechter vorgenommen, ja regelrecht „erzwungen“,46 indem
das Verbot alle Menschen in Begehrenswerte und Unbegehrbare unterteilt. Die Annahme
einer vorgängigen Bisexualität würde qua Begriff diese Zweiteilung vorwegnehmen.
Die Einverleibung darf aber nicht als ein einmaliger vergangener Prozess vorgestellt
werden, so wie es die Psychoanalyse im Ausagieren von Kastrations- und Ödipuskomplex
im frühkindlichen Alter47 postuliert, sondern ist der fortwährenden Performativität
unterworfen. Anders gesagt: Die melancholische Einverleibung wird ständig wiederholt
und das eigene Geschlecht damit ebenso bestätigt und reproduziert, wie die diesen Prozess
ermöglichende heterosexuelle Matrix.48
42
43
44
45
Butler (1991), S.108.
Butler (1991), S.109.
Butler (1991), S.111.
Vgl. Foucault (1983), S. 94: „Die Machtbeziehungen bilden nicht den Überbau, der nur eine hemmende
oder aufrechterhaltende Rolle spielt – wo sie eine Rolle spielen, wirken sie unmittelbar hervorbringend.“
46 Butler (1991), S.110.
47 Vgl. Freud (1925).
48 Vgl. Butler (1991), S.199.
16
Die körperliche Annahme deines Geschlechts ist dabei die Vorraussetzung für das Subjekt:
„Die «Aktivität» dieses Geschlechtlich-Werdens kann streng genommen kein menschliches
Handeln oder menschlicher Ausdruck sein, keine willentliche Aneignung, und ganz sicher ist
sie keine Frage einer Maskierung; sie ist eine Matrix, durch die alles Wollen erst möglich
wird, sie ist die kulturelle Bedingung seiner Möglichkeit.“49 [Hervorhebung im Original]
Der Intelligibilitätsrahmen wirkt jedoch nicht nur produktiv sondern auch repressiv. Er
erhält seine Macht durch den verwerfenden Ausschluss, mit dem Körper bestraft werden,
die nicht intelligibel – also nicht sinnvoll in die heterosexuelle Matrix einfügbar – sind,
und deren „Menschsein selbst [...] fraglich wird“.50 Dabei ist dieses Außen konstitutiv für
das Funktionieren des Intelligibilitätsrahmens und der heterosexuellen Matrix. Indem
Menschen nicht nur nach Geschlecht sondern zusätzlich in legitime und illegitime
Identitäten eingeteilt werden,51 erklärt sich denn auch die Wirksamkeit des fortwährenden
Zwanges zur reproduzierten und reproduzierenden Annahme eines Geschlechts, die durch
die zitierende Wiederaufrufung des Intelligibilitätsrahmens ebenfalls zur Kollaboration
mit diesem umfassenden Zeichensystem und seiner verwerfenden Macht zwingt.52
Dennoch schafft es Butler, gerade aus dieser zwanghaften wiederholten Performanz des
Geschlechts eine politische Handlungsoption abzuleiten. Da die Hervorbringung
vergeschlechtlichter Körper und Identitäten niemals abgeschlossen ist und auch nie
vollständig oder perfekt möglich ist, es sich also immer nur um imperfekte Abbildungen
eines impliziten aber unmöglichen Ideals handelt, lässt sich durch gezielt abweichende
Reproduktion einerseits der Rahmen verschieben oder erweitern, andererseits das
implizite Ideal als Unmögliches angreifen. Die Natürlichkeit von Geschlecht wird somit
als scheinbare entlarvt und dekonstruiert, während zuvor ausgeschlossene queere 53 Körper
und Identitäten Handlungsfähigkeit erwerben, indem sie in die Intelligibilität und damit in
das System symbolischer Repräsentation eintreten.
In meinen Musikanalysen werde ich die einzelnen Songs als performative Akte betrachten,
in denen ein singendes Subjekt, samt Geschlecht und Körper, entsteht, wobei der Klang
über die spezifische Konfiguration diese Körper-Subjekts Auskunft gibt. Dabei entsteht
49
50
51
52
Butler (1997), S.29.
Butler(1997), S.30.
Vgl. Butler (1997), S. 30
Vgl. Butler (1997), S. 39: „Der Prozeß jener Sedimentierung oder das, was wir auch Materialisierung
nennen können, wird eine Zitatförmigkeit sein, ein Erlangen des Daseins durch das Zitieren von Macht,
ein Zitieren, das in der Formierung des «Ichs» ein ursprüngliches Komplizentum mit der Macht
herstellt.“ [Hervorhebung im Original].
53 Butler findet im Queeren schließlich einen nicht normativen Kollektivbegriff. Queer sind Körper die die
Intelligibilität durchkreuzen. Vgl. Butler (1997), S.307.
17
dieses Subjekt nur temporär im Rahmen des Songs, und lässt keine automatischen
Rückschlüsse auf die tatsächlichen Charaktere der Sänger_innen zu. Ich betrachte die
Songs
dabei
als
kurze
fixierte
klangliche
Performanzen,
die
zu
zitierbaren
Verhaltensmustern im Intelligibilitätsrahmen werden können und die das Potential haben
nicht nur die klangliche Präsentation von Geschlecht innerhalb der Popmusik zu
beeinflussen, sondern über diese hinaus zu allgemeinen gesellschaftlichen Mustern von
emotionalem, subjektivem und körperlichem Ausdruck zu werden.54
Dabei ist der Intelligibilitätsrahmen grundsätzlich wandelbar, so dass diese Muster nicht
als unveränderliche, sondern als temporärer Ausdruck weiblicher oder männlicher
Subjektivität verstanden werden müssen. Eine historische Untersuchung der Veränderung
in der klanglichen Darstellung von Männern und Frauen wäre hier perspektivisch sinnvoll,
ich werde in dieser Arbeit jedoch die historische Perspektive ausklammern, da das
Material, mit dem ich arbeite, keine Aussagen über eventuelle Entwicklungen zulässt.
Außerdem werde ich mich darauf beschränken ausschließlich Geschlechterbilder von
Männern und Frauen zu analysieren. Auf die Möglichkeiten von intersexuellen,
uneindeutigen und queeren musikalischen Performanzen werde ich im Rahmen dieser
Arbeit nicht ausführlich eingehen. Mein Ziel ist es hier, nicht Musik zu untersuchen, die
Geschlecht dekonstruiert, sondern zuerst einmal die Konstruktion von Geschlecht in
Popmusik zu verstehen. Ich denke, alle in den von mir ausgewählten Songs präsentierten
stimmlichen Performanzen erscheinen eindeutig als männlich oder weiblich und ich werde
von dieser Annahme ausgehend versuchen herauszufinden, wie das Geschlecht jeweils
klanglich hergestellt wird.
54 Einen bemerkenswerten Versuch für die Anwendung der Performanztheorie Butlers auf Gesang hat
bereits die Musikwissenschaftlerin Suzanne Cusick vorgelegt. Für sie steht dabei die Position der
Stimme als Vermittlungsmoment zwischen dem einem Innen und Außen des Körpers im Fokus
„it[=Song] literally crosses the body's borders, defining and performing them as it does so. [...] it is often
taken to express or represent an interior truth: the truth from within the body's borders moved by breath
[…] beyond those borders. […] Song […] is always a performance of the idea of subjectivity.“ [Cusick
(1999), S.30] Sie formuliert schließlich die These, dass Geschlecht in der Stimme vor allem über eine
hörbare Anpassung (weiblich) oder eben Nicht-Anpassung (männlich) an kulturelle Normen geschieht
[Vgl. S.38], wobei sie jedoch vor allem die kulturellen Normen des Singens in einem wahrscheinlich
eher traditionellen Verständnis meint [Vgl. S.34]. Diese kulturelle Normierung dringt dabei mehr
(weiblich) oder weniger (männlich) tief in den Körper ein, was durch die geöffneten oder geschlossenen
Resonanzräume hörbar wird.
18
2.2 Popmusik als Dispositiv und Mimesis als Weltzugang
„...wäre da nicht der begründete Verdacht, daß die populären
Musikformen gerade deshalb so allgegenwärtig geworden sind,
weil die von ihnen produzierten Werte, Bedeutungen und sozialen
Erfahrungen
einen
ganz
entscheidenden
kulturellen
Reproduktionsfaktor moderner Industriegesellschaften darstellen,
der mit den subtilen Mechanismen kulturelle Machtausübung
ebensoviel zu tun hat wie mit der Entwicklung von Subjektivität,
von sozialer und persönlicher Identität.“55
Ich möchte nun darstellen, was ich unter Popmusik verstehe. Dabei ist wahrscheinlich
bereits klar geworden, dass ich mit Popmusik nicht nur eine bestimmte aktuelle
Musikform bezeichne, sondern ein um diese Musikform organisiertes machtvolles
gesellschaftliches Sozialisierungssystem. In Anlehnung an Michel Foucault verstehe ich
Popmusik als ein Dispositiv.
Ein Dispositiv nach Foucault ist kurz gesagt eine strategische Formation von Macht, 56 die
aus einer Vielzahl heterogener, diskursiver und nicht-diskursiver Elemente besteht. 57 Diese
können beispielsweise sein:
„Diskurse, Institutionen, architekturale Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen,
Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische
oder philanthropische Lehrsätze, kurz: Gesagtes ebenso wohl wie Ungesagtes“58
Bezogen auf Popmusik lassen sich hierunter Musikindustrie, Radio, Charts, populäre und
akademische Diskurse, Tanz, Fangemeinden, Stars, musikzentrierte Subkulturen und ihre
Wertesysteme,
Diskotheken,
Popsongs,
Popmusik-Genres,
die
Strukturen
des
Musikmarktes, der «Mainstream» und vieles mehr fassen. All diese vielfältigen Elemente
funktionieren innerhalb der machtvollen Strategie des von mir an dieser Stelle postulierten
Popmusik-Dispositivs als taktische59 Momente. Als übergreifende Strategie dieses
Dispositivs lässt sich dabei, so meine These, die Sozialisierung und damit auch die
55
56
57
58
59
Wicke (1998), Absatz 10.
Vgl: Foucault (1983), S.95.
Foucault (1978), S.119/120.
Ebd.
Foucault differenziert zwischen Taktiken und Strategien: Die Strategie verfolgt ein globales Ziel mithilfe
verschiedener temporärer und lokaler einzelner Taktiken. Die Strategie und ihr Ziel lassen sich dabei aus
der Wirkung der Taktiken aus ihrem „Kalkül“ [Foucault (1983): S. 95] erschließen. In der „Regel des
zweiseitigen Bedingungsverhältnisses“[Foucault (1983): S.99/100] führt Foucault weiter aus, wie sich
Taktiken und Strategie gegenseitig bedingen; eine Strategie nur aus einzelnen Taktiken besteht und
einzelne Taktiken nur innerhalb der Strategie ihre Macht entfalten können. Einzelne Taktiken können
dabei durchaus temporär oder scheinbar der Strategie zuwiderlaufen [Vgl. Foucault (1983) S.101].
19
Aktualisierung der gegenwärtigen Gesellschaft im Bewusstsein ihrer Individuen60
beschreiben.
Popmusik als Medium gesellschaftlicher Sozialisierung zu sehen, ist dabei keine neue
These, sie durchzieht die Popmusikforschung unter verschiedenen Gesichtspunkten seit
ihrem Beginn. Darunter lässt sich bereits Theodor W. Adornos Manipulationsthese61
fassen, ebenso, wie die von einer subversiven Sozialisation in der Subkultur ausgehenden
Texte des Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies [CCCS],62 wobei aber
bemerkt werden muss, dass hierbei zwei antagonistisch gedachte Gruppen (bei Adorno die
Kulturindustrie, im CCCS die Konsument[_innen]63 in der Subkultur) jeweils als
Handelnde
erscheinen
und
Popmusik
in
der
einen
Theorie
repressives
Manipulationsinstrument ist, in der anderen Mittel subversiver Veränderung darstellt.
Bereits Paul Willis Text „Symbolism and Practice“ von 1974 geht dabei von einer
wechselseitigen Beziehung zwischen der Musik und ihren Konsument_innen aus, in dem
sich strukturelle Ähnlichkeiten zwischen der Alltagserfahrung und den Werten einer
Subkultur und ihrer Musik ausbilden. Es wird also davon ausgegangen, dass es eine enge
homologe Beziehung zwischen Musik und Wertesystemen gibt.
Ich gehe im Dispositiv ebenfalls von einer wechselseitigen Beziehung aus, in der die
Popmusik ein kontinuierlich von der Gesellschaft hervorgebrachtes Mittel zur eigenen
Aktualisierung ist.64 Diese Beziehung ist zirkulär, so dass sich sowohl die Gesellschaft, als
60 Ich denke dabei, dass Popmusik insbesondere die globale und kapitalistische Organisationsform der
gegenwärtigen Gesellschaft transportiert. Gerade das Medium Musik scheint mir besonders gut für eine
internationale Zirkulation geeignet zu sein und damit globale kulturelle Verbindungen zu schaffen.
Daraus folgt allerdings nicht automatisch eine global einheitliche Musikkultur, sondern eher ein globaler
Bezugsrahmen, mit jeweils unterschiedlichen lokalen Ausprägungen. Ebenso erscheint mir die Funktion
von Popsongs, die zugleich Waren und symbolträchtige Kulturprodukte sind, besonders geeignet eine
kapitalistische Weltordnung zu naturalisieren.
61 Für Adorno wird das Publikum durch den Konsum von populärer Musik so manipuliert, dass es die
autoritären Gesellschaftsverhältnisse akzeptiert und zu einer passiven Haltung, statt aktiver Analyse und
Bewertung von Musik, verführt. Vgl. Adorno (1941), Abschnitt III, „Theory about the listener“, Absatz
27-34.
62 Vgl. Willis (1974), Abschnitt I, Absatz 22.
63 Ich setze den weiblichen Term hier in Klammern, da mir dies die (Nicht-)Berücksichtigung von Frauen
in den Texten des CCCS am besten widerspiegelt. Für eine entsprechende Kritik siehe Angela McRobbie
(1996).
64 Diese Rückkopplunglässt sich beispielsweise an der ökonomischen Funktionsweisen von Popmusik in
der Werbung darstellen: Insbesondere im kommerziellen Radio, aber nicht nur dort, wird durch
Musikauswahl eine spezifizierte Zielgruppe produziert – damit ist aber nicht nur die Zielgruppe der
Musik, sondern auch die Zielgruppe der Werbung gemeint, die auf diesem Radioprogramm geschaltet
wird. Eine homogene und bestimmbare Gruppe von Hörer_innen ermöglicht es den werbenden
Unternehmen ihre Produkte zielgerichteter zu präsentieren. Schließlich bekommt die Zielgruppe auch
durch den Konsum ähnlicher Produkte, ja, schon durch ein in der Werbung gewecktes vergleichbares
Begehren Substanz [Vgl. z.B. Buxton (1996)].
In der Konsequenz wird dieses Konsumverhalten jedoch auch symbolisch, d.h. in der medialen
20
auch die Popmusik als Klang wie als Dispositiv, d.h. mit all ihren institutionellen,
diskursiven, praktischen und musikalischen Teilaspekten, kontinuierlich verändern.
Das Dispositiv erscheint mir außerdem ein geeigneter Begriff, da es damit möglich ist
auch scheinbare Widersprüche sinnvoll einzuordnen, so dass sich beispielsweise auch die
paradoxen Positionen verschiedener musikalischer Subkulturen zwischen Affirmation und
Ablehnung von Gesellschaft und Konsumverhalten theoretisch fassen lassen. Die
mögliche Subversivität von musikalischen Subkulturen kann so beispielsweise auf einer
Ebene anerkannt werden, ohne dass dies einen Widerspruch zu anderen Ebenen darstellt,
auf denen ihre Mitglieder dennoch gesellschaftliche Grundwerte bestätigen oder sinnvoll
gesellschaftlich integriert werden. Ebenso lassen sich verschiedene ästhetische oder
ideologische Werte, beispielsweise die regelmäßig praktizierte Abgrenzung vom
sogenannten «Mainstream» oder das Verlangen nach Authentizität oder Echtheit der
musikalischen Präsentation, als Momente eines Dispositivs fassen.
Dabei sind solche ideologischen oder ästhetischen Kategorien nicht isolierbar, sondern
können in vielfältiger Weise innerhalb des Dispositivs wirken. Auch die Darstellung von
Geschlecht im Popmusikdispositiv lässt sich als mit anderen Kategorien sowie deren
ideologischer Bewertung verwoben verstehen und wird sich auch nur in Verbindung mit
diesen vollständig erschließen.
Das Dispositiv soll dabei als ein Modell für die gesellschaftliche Funktion von Popmusik
verstanden werden, wobei es mir insbesondere wichtig ist, Popmusik als ein Ganzes zu
verstehen, das zwar immer nur in Teilaspekten konkret begegnet, die jedoch in einen
größeren Zusammenhang eingeordnet werden müssen, um verständlich zu werden.
Beispielsweise ist für die Entwicklung einer Identität die negative Abgrenzung ebenso
wichtig wie eine positive Identifikation.65 Ausschließlich positive Bezugnahmen auf
Repräsentation, privilegiert, wodurch wiederum Normierungsprozesse in Gang gesetzt werden: Wer
durch die Werbung angesprochen werden soll, wird in den kommerziellen Medien stärker repräsentiert,
was bezogen auf Popmusik bedeutet, dass deren_dessen Interessen stärker berücksichtigt werden, und
erhält eine normalere und symbolisch privilegierte gesellschaftliche Rolle. Dabei zeigt sich nicht nur die
einordnende Wirkung der Popmusik, sondern vor allem eine privilegierte Rückkopplung für diejenigen,
die von Werbung angesprochen werden sollen: Veränderungen in den von Unternehmen anvisierten
Zielgruppen oder in den ökonomischen Möglichkeiten einzelner Schichten haben folglich Auswirkungen
auf die produzierte und besonders stark beworbene Popmusik und deren mediale Präsenz.
65 Vgl. Hall (1996), S.4-5: „Above all, and directly contrary to the form in which they are constantly
invoked, identities are constructed through, not outside, difference. This entails the radically disturbing
recognition that it is only in relation to the Other, the relation to what it is not, to precisely what it lacks,
that what has been called its constitutive outside that the «positive» meaning of any term – and thus its
identity – can be constructed.“ oder Wicke (1993), Absatz 21: „Identität setzt Differenz voraus, ohne
Abgrenzung sind auch kulturelle Identitäten nicht möglich.“
21
Popmusik zu betrachten, reicht also zum Verständnis dieses Prozesses nicht aus. Die
Abgrenzung nur als Negativbild mit einzubeziehen, erfasst jedoch auch noch nicht, dass
sowohl die gewählte Identität, als auch die abgelehnte, sich in einem gemeinsamen
Rahmen bewegen und sich unter anderem dadurch gegeneinander abgrenzen, dass sie sich
innerhalb desselben verschieden platzieren. Bezogen auf Popmusik wird durch die Wahl
eines Stars, einer Band oder eines Genres nicht nur anderes abgelehnt, sondern das Eigene
und das Abgelehnte auch in Beziehung zueinander gesetzt und in einem gemeinsamen
Kontext verortet.
Zwar
blende
ich
in
dieser Arbeit
zur
Vereinfachung
meiner
Fragestellung
außermusikalische Zusammenhänge weitgehend aus, aber auch auf der musikalischen
Ebene lässt sich die Popmusik als ein übergreifender Kontext verstehen, in dem die
einzelnen Songs miteinander in Beziehung stehen. Damit meine ich hier allerdings nicht
nur musikästhetische Kriterien, wie die musikalischen Attribute einzelner Genres,
sondern, wie später klar werden wird, vor allem die musikalisch produzierten Bilder von
Subjektivität und Körper, sowie die möglichen Beziehungen zwischen singendem Subjekt
und Publikum, die ich für relevant für die musikalische Produktion von Geschlecht halte.
Meine These ist es, dass darüber auch der Klang von Popmusik durch normative Bilder
von
Geschlecht
strukturiert
wird
und
so
andererseits
normative
akustische
Geschlechterbilder entstehen.
Wie im Intelligibilitätsrahmen von Butler bilden sich hierbei, so meine These, zitierbare
Muster sowohl für die musikalische Präsentation von Geschlecht als auch für die
rezipierende Beziehung zum Song heraus, die eine normative Wirkung entfalten und dabei
diskriminierende Gesellschaftsverhältnisse auf einer musikalisch-emotionalen Ebene
mithervorbringen, legitimieren und verstärken. Zugleich könnten allerdings dieselben
Muster innerhalb des Popmusik-Dispositivs auch Ausgangspunkt für Gegenstrategien und
Veränderungen sein und zu positiven Momenten für eine feministische Veränderung
werden.
Diese Produktion von gesellschaftlichen Strukturen geschieht dabei mithilfe der Musik
vor allem auf einer nonverbalen Ebene. So schreibt beispielsweise Simon Frith:
„«Frauenmusik» zum Beispiel interessiert dort [in den special charts von Billboard] nicht als
Musik, die irgendwie «Frauen» ausdrückt, sondern als Musik, die versucht, diese zu
definieren, genauso wie «schwarze Musik» dazu da zu sein scheint, eine bestimmte
Vorstellung davon, was «schwarz» ist, hervorzubringen“66
66 Frith (1992), Absatz 13.
22
Musik produziert also gesellschaftlich relevanten Sinn ohne dabei auf Worte
zurückzugreifen. Um dies zu verstehen, muss Musik als eine körperlich-emotionale, d.h.
eine somatische Erfahrung verstanden werden. Die Tanzwissenschaftlerin Gabriele Klein
hat hierfür einen äußerst produktiven Ansatz zur Analyse geliefert, indem sie den von
Christoph Wulf und Gunter Gebauer entwickelten Mimesis-Begriff auf Popmusik
anwendet.67
Gebauer und Wulf beschreiben Mimesis als ein kreatives Nachformen der Welt im Innern
des Individuums: „In mimetischen Akten erzeugt das Subjekt durch seine eigene
Formgebung die vorgefundene Welt noch einmal.“68 Dieser Prozess nimmt zwar Bezug
auf das Gegebene, wiederholt es aber nicht passiv, sondern erzeugt etwas Eigenes. Es
entsteht so eine zweite mimetische Welt im Subjekt, die von der äußeren Welt durchaus
abweichen kann, aber immer in Beziehung zu dieser steht.
„Das Weltverhältnis des Menschen kann beschrieben werden als eine Verschränkung
wechselseitiger Aktivitäten: Ein Subjekt, das sich machen muss, nimmt Beziehungen zu einer
Welt auf, die es als geformte und strukturierte schon gibt und die ihrerseits das Subjekt
macht.“69
Dabei sehen Gebauer und Wulf mimetische Prozesse als basale vorbewusste 70
Weltzugänge des Menschen, die sowohl das symbolische Weltverständnis als auch die
Körper der Subjekte prägen und dabei schließlich auch die Basis für jede Erkenntnis
darstellen.71 Es gibt also ein mimetisches Verhältnis zwischen einer vorgefundenen
äußeren Welt, die bereits durch das Handeln anderer symbolisch kodiert ist, und einer
darauf im Innern des Subjekts nachgebildeten Welt, über die sich dieses die Welt und
damit Handlungsfähigkeit in der derselben erschließt. Dabei lässt sich die Mimesis
insofern als performativ im Sinne Butlers verstehen, als dass auch das Nachgebildete seine
symbolische Bedeutung für das Subjekt erst durch die Nachbildung erhält.72
Für mein Vorhaben ist dieses Konzept auf einigen Ebenen interessant: Es dient erst einmal
als ein Konzept, das die Vermittlung zwischen einer im Popmusik-Dispositiv präsentierten
symbolischen Weltordnung und dem individualisierten Weltverständnis einzelner
67 Klein (2004): S.244-262: „Das Konzept der Mimesis eignet sich um eine Antwort auf die Frage nach
dem Wie, also der Art und Weise der Aneignung von Kultur zu geben.“ [Klein, S.261]
68 Gebauer/Wulf (2003), S.7.
69 Dies., S.101.
70 Dies., S.28.
71 Vgl. Dies., S.75.
72 Vgl. Dies., S.8.
23
Personen herstellt, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit dieser Welt in Beziehung
setzen und sie in ihrem Innern mit Abweichungen nachbilden. Aber auch der Umgang mit
einzelnen Popsongs hat auf vielen Ebenen mimetische Züge: Vom empathischen
Nachempfinden der Musik, über das Tanzen oder Luftgitarre spielen, bis hin zur
imitierenden eigenen Musikpraxis, dem Mitsingen oder dem Spielen von Cover-Songs.
Der Körper spielt dabei eine entscheidende Rolle: Er ist einerseits das Medium der
musikalischen Erfahrung, andererseits ist er durch den Habitus, der sich als Folge der
mimetischen Nachbildung im Körperinnern auf das soziale Handeln überträgt, auch ein
Ergebnis, wie Klein mit Rückgriff auf Bourdieu deutlich macht.73
„Da der Habitus leiblich strukturiert ist wird es zudem möglich, den Vorgang zu verstehen,
wie leibliche Erfahrung sich körperlich darstellt und nach «außen» getragen wird. Auch dieser
nach «außen» gerichtete Prozeß ist ein mimetischer Akt, ein Angleichen der «inneren
Erfahrung» an die «äußere Realität» in sozialen Handlungen, die sich körperlich vollziehen.“74
Die Nähe dieser mimetischen Körperherstellung zur Performanztheorie Butlers ist hier
auffällig. Beide Theorien lassen sich meines Erachtens verbinden, wenn die scharfe
Trennung von innerem und äußerem Körper, d.h. Leib und Körper, auf die Klein ihre
Theorie basiert, berücksichtigt wird. Für Klein erklärt die Mimesis die Einschreibung der
symbolischen Welt in den Leib, also die innere Körperwahrnehmung, die sich im zweiten
mimetischen Schritt erst an der Oberfläche äußert und so zum Habitus wird. 75 Bei Butler
scheinen die beiden Schritte in eins zu fallen: Mit der als mimetische Nachahmung
auffassbaren Performanz wird zugleich der eigene Körper performativ erzeugt. Dabei gehe
ich davon aus, dass diese beiden Schritte zwar zeitlich in eins fallen, allerdings lässt sich
durch die theoretische Trennung dieser beiden Schritte die innerliche bzw. leibliche
Musikerfahrung eher fassen, als wenn diese immer nur in ihrem nach außen wirkendem
performativem Ergebnis betrachtet würde, weshalb mir diese Zweiteilung auf der
theoretischen Ebene sinnvoll erscheint.
Das Popmusik-Dispositiv wirkt dabei, so meine These, vermittelt über mimetische
Beziehungen zwischen dem Klingenden und dem Selbst- und Weltbild der Hörenden
insbesondere auf die somatische und emotionale Selbstwahrnehmung von Menschen und
bringt diese hervor.
Auf Basis dieser These ist es notwendig auch in der Musikanalyse die Beziehung
zwischen Klang und Körper zu verstehen. So schreibt auch Susan McClary:
73 Vgl. Klein (2004), S.262.
74 Ebd.
75 Klein (2004), S.261.
24
„A more productiv approach to music – not just pop, but all music, including the ostensible
cerebral classical canon – would be to focus on its correspondences with the body. […] I want
to propose, that music is foremost among cultural «technologies of the body», that it is a site
where we learn how to experience socially mediated patterns of kinetic energy, being in time,
emotions, desire, pleasure and much more.“76
Das Popmusikdispositv wirkt somit nicht nur ideologisch (im Sinne von mehr oder minder
bewussten Vorstellungen) sondern körperlich. Popmusik, als konkrete Klangerfahrung,
kann dabei als eine Technologie zur Strukturierung und Produktion von Körpern
angesehen werden.
Im nächsten Abschnitt werde ich daher nach Methoden für eine feministische Betrachtung
von Popsongs suchen, wobei mein besonderes Anliegen Werkzeugen gilt, die einer
solchen körperzentrierten Annäherung an die Popmusik gerecht werden können. Ich werde
dabei nicht nur etablierte Methoden betrachten, sondern auch versuchen, neue
Vorgehensweisen aus den Ansätzen anderer Autor_innen zu entwickeln.
76 McClary (2007), S.205.
25
3. Werkzeuge
3.1 Möglichkeiten sich dem Klang zu nähern
Was mich in diesem Abschnitt interessiert ist zuerst einmal eine Darstellung von
gegebenen musikanalytischen Werkzeugen, als auch die Weiterentwicklung derselben und
die Suche nach neuen Methoden zur analytischen Musikerfassung. Mein Ziel ist es dabei,
vor allem methodische Werkzeuge zu finden, die die innere wie äußere Kodierung der
Körper durch Musik fassen und beschreiben können.
Wie bereits klar sein sollte, erscheint mir eine harmonische oder formale Analyse von
Musik wenig erfolgversprechend, wenn nicht sogar hinderlich. Diese Ebene der Musik
werde ich allenfalls als Bezugspunkt zur besseren Orientierung verwenden. Für die
eigentliche Musikanalyse erscheinen mir ganz andere Ebenen des Klangs relevant. Ich
möchte dabei fünf Gruppen von Methoden zur Interpretation von Musik differenzieren,
die ich für die feministische Musikanalyse produktiv machen möchte. Ich unterscheide
zwischen Assoziationen, Homologien, Intertextualität, Materialität und Psychoanalyse, die
ich jeweils als analytisches Werkzeug im Folgenden darstellen möchte.
Diese Werkzeuge haben dabei jeweils ihre Grenzen, bilden aber gemeinsam ein
produktives Set an Möglichkeiten, sich dem Klang diskursiv zu nähern. Entsprechend
werde ich sie in meinen Analysen auch nicht getrennt, sondern in Kombination
verwenden. Da es jedoch mein Ziel ist, in dieser Arbeit nicht nur Musik zu analysieren,
sondern auch die Möglichkeiten der Analyse zu reflektieren, erscheint es mir sinnvoll und
notwendig, mein analytisches Werkzeug zuerst einmal getrennt und theoretisch zu
beschreiben.
3.1.1 Assoziation
Unter einer Assoziation verstehe ich jede Interpretation von Musik oder musikalischen
Elementen, die auf etwas außerhalb des jeweils betrachteten Musikstücks verweist. Ein
sehr naheliegendes Beispiel wäre eine Fanfare, die als Zeichen für höfisches Zeremoniell
26
oder aber für militärische Manöver gedeutet werden kann. Die Popmusik ist von solchen
Assoziationen regelrecht durchdrungen, sie verweist permanent: So können bestimmte
Instrumente auf Orte hinweisen, wie z.B. der Einsatz einer Sitar mit Indien assoziiert wird,
oder bestimmte deutlich erkennbare Tanzrhythmen, wie die Samba, zusammen mit einer
entsprechenden Instrumentation, Assoziationen an Südamerika und Afrika oder einfach
nur „Exotik“ weckt. Diese Assoziationen können dann aber wieder weiterführen, so dass
die indische Sitar weitere Assoziationen an die Hippie-Subkultur der 60er weckt und die
exotische Assoziation zur Samba dann mit Sonnenschein und guter Laune verbunden wird
– oder mit der schwingenden Hüfte einer Tänzerin, wie sich wahrscheinlich beim Hören
von Shakiras Song „loca“ recht gut nachvollziehen lässt.
Aber auch ganze Popsongs, Stars bzw. Bands oder sogar Genres können einen solchen
Zeichencharakter erhalten und auf Generationen, bestimmte Zeiträume, Ereignisse, Städte
oder Subkulturen hinweisen, die den historischen oder gesellschaftlichen Kontext für die
mit ihr assoziativ verbundene Musik bilde(te)n.77 Die Samplingtechnik des frühen HipHop
arbeitete beispielsweise direkt mit diesen Assoziationen, indem Ausschnitte aus bekannten
Popsongs eingespielt, neu kontextualisiert und dabei von der Subkultur angeeignet
wurden78 und auch in Coverversionen bekannter Popsongs werden in ähnlicher Weise
Assoziationen wachgerufen und musikästhetisch verwendet. Da schließlich Musikpraxis
immer Beziehung auf vorangegangene Musikpraxis nimmt und nehmen muss, um
verständlich zu sein, sind Assoziationen innerhalb des popmusikalischen Raumes
allgegenwärtig: Jeder Popsong erinnert irgendwie an vorangegangene Popsongs.
Allerdings ergeben sich in der Musikanalyse einige Probleme, denn Assoziationen sind
nicht innermusikalisch. Die Bedeutungen dieser musikalischen „Zeichen“ können also
nicht unmittelbar aus der Musik abgelesen werden. Außerdem sind sie sehr wandelbar 79
und damit nur in einem bestimmten kulturellen Kontext zu einer bestimmten Zeit
anwendbar und müssen nicht von allen Menschen in der gleichen Weise verstanden
77 Dies ist allerdings kein einseitiger Prozess. Indem bestimmte Popsongs gewählt werden, um eine Zeit
oder ein Ereignis zu repräsentieren, wird das Repräsentierte auch interpretiert. Über Popmusik
funktioniert auf diese Weise auch eine gesellschaftliche Ausdeutung des Geschehenen, ja schon das
Gegenwärtige wird mit der jeweils aktuell präsenten Popmusik verbunden und kann entsprechend
interpretiert werden. So kann Popmusik als Speicher gesellschaftlicher Bedeutungsfelder verstanden
werden.
78 Toop (2000), S.25: „ [Man] wird […] sprachlos angesichts der Geschwindigkeit, mit der die Elemente
einer Collage aneinandergesetzt werden, die einen vergeblich nach fixen musikalischen Bezugspunkten
suchen lässt. Die Schönheit solcher Zergliederung liegt darin, wie Vertrautes aus dem Zusammenhang
gerissen wird.“
79 Viele Popmusikbeschreibungen in Musikzeitschriften lassen sich als ein kontinuierliches Weiterschreiben
und Umkodieren von solchen musikalischen Zeichen verstehen.
27
werden. Sie sind nicht eindeutig. Aber sie sind deshalb auch nicht beliebig, sondern durch
kulturelle Kodierung mehr oder minder stark vorgegeben.
Viele Klänge sind also kulturell kodiert. Um musikalische Assoziationen aber in der
wissenschaftlichen Musikanalyse zu rechtfertigen, müssen diese „Zeichen“ historisch oder
kontextuell rückgebunden werden. Es muss also eigentlich eine Genealogie ihrer
Kodierung gemacht werden, d.h. ihr Auftreten in Filmen oder Oper dargestellt werden
oder die historische oder mediale Verbindung des Klangs oder Songs mit einer bestimmten
Thematik - ein äußerst aufwendiges Verfahren also.
Wie McClary und Walser darstellen, ist das Fehlen einer popmusikalischen Semiotik eines
der zentralen Probleme der Popmusikanalyse: Es gibt keinen Rahmen, in dem die
assoziativen Bedeutungen von Musik Raum hätten und an dem eine entsprechende
Argumentation halt fände.
„[T]o try to make the case that a particular configuration sounds mournful […] is to have to
invent a philosophical argument for meaning in music and to try to reconstruct forgotten codes
out of centuries of music.“80
Dieses Problem trifft dabei auf emotionale Assoziationen besonders stark zu, denn die
Kodierungen sind hier oft viel älter, als die assoziative Verbindung von Sambarhythmus
mit tanzenden Hüftbewegungen und lassen sich nur schwer dekodieren, da die Darstellung
von Gefühlen auch in Sprache und Film oft nur indirekt geschieht. Dass etwas
verführerisch, traurig, gruselig oder fröhlich klingt, mag offenkundig erscheinen, es
basiert dennoch auf der kulturellen Kodierung vieler einzelner musikalischer Zeichen,
deren Bedeutung wir bereits unbewusst verinnerlicht haben.
Das schlichte Aufzählen von Assoziationen, wie es manchmal betrieben wird, kann aus
kritischer Perspektive nicht ausreichen, denn mindestens müssen die musikalischen
Elemente benannt werden, die diese Assoziationen auslösen, eher noch sollten diese
historisch hergeleitet werden. Das aus solchen assoziativen Musikbeschreibungen
resultierende Problem ist dabei weniger, dass solche Darstellungen keinen Aussagewert
hätten, denn den haben sie trotzdem, als dass der Grund für die Assoziation nicht benannt
wird. Die einfach nur geäußerten Assoziationen lassen sich damit nicht auf andere Songs
übertragen, was auch Vergleiche zwischen verschiedenen Songs erschwert.
Um das Problem aus feministischer Sicht zu beschreiben, möchte ich auf Simon Frith und
Angela McRobbies Aufsatz „Rock and Sexuality“ eingehen, in dem sie die These
80 McClary/Walser (1996), S.283.
28
formulieren, dass die Hörer_innen von Kate Bushs Song „Feel It“ in eine voyeuristische
Position versetzt werden. Sie rechtfertigen dies, indem sie auf die mädchenhafte Stimme
(„voice of a little girl“), die intime
Instrumentation (nur Stimme und Klavier), die
Unregelmäßigkeit von Rhythmus und Melodie in beiden Instrumenten und eine
beunruhigende Betonung (unsettling stress) hinweisen.
Sie erklären nicht, was die Stimme so kindlich oder mädchenhaft macht oder wodurch die
Betonung so beunruhigend wird (beides sind Assoziationen). Wie genau musikalisch die
voyeuristische Position entsteht, wird ebenfalls nicht deutlich. Bei genauer Lektüre wird
außerdem klar, dass sie die sexuelle Konnotation in dieser kurzen Beschreibung
ausschließlich aus dem Text ableiten. Es bleibt unklar (wenn es nicht sogar implizit
verneint wird), ob es auf der musikalischen Ebene überhaupt eine sexuelle Konnotation
vorliegt, oder ob der Song genauso gesungen und gespielt mit einem anderen Text
komplett frei von sexuellen Assoziationen wäre.
Damit sind die Ergebnisse nicht übertragbar und jede neue Musikanalyse entwickelt ein
neues assoziatives Vokabular für musikalischen Voyeurismus, ohne dass Beziehungen
zwischen diesen Ergebnissen hergestellt werden können81. Wenn es aber einen solchen
gibt, so wäre es aber aus feministischer Sicht sehr hilfreich, analytisches Wissen über das
Funktionieren eines musikalischen Voyeurismus zu entwickeln.
Mein Anspruch ist es in meinen Analysen Assoziationen am Klang zu belegen und so die
Quelle meiner Assoziation möglichst genau zu bestimmen, sowie nach Möglichkeit zu
erklären, wieso ein bestimmtes musikalisches Element diese Assoziationen weckt. Hierzu
kann neben einem musikhistorischen Rückbezug auf ältere Klangdarstellungen, die ich in
dieser Arbeit nicht leisten kann, auch die Anwendung anderer musikanalytischer
Werkzeuge sinnvoll sein, wie ich sie im Folgenden vorstellen werde. Außerdem werde ich
mich unter Umständen auf die in anderen Musikbetrachtungen geäußerten Assoziationen
beziehen und versuchen die klangliche Basis derselben zu identifizieren. Aus diesem
Grund habe ich mich insbesondere entschieden, den von McRobbie und Frith betrachteten
Song „Feel It“ von Kate Bush in dieser Arbeit selbst noch einmal zu untersuchen, um den
von ihnen geäußerten Eindruck des Voyeurismus zu überprüfen.
81 Beispielsweise verweist auch Nikola Dibben auf einen Voyeurismus in „Ohh, Ahh... Just a little bit“ von
Gina G, ohne diesen musikalisch genauer zu fassen („Gina G forms the visual and musical focus in a
voyeuristic display“) [Vgl. Dibben (1999), S.336]. Dabei sind beide Songs extrem unterschiedlich. Ob es
überhaupt Parallelen zwischen beiden gibt, wie das Wort suggeriert, ist unklar.
29
3.1.2 Homologie
Als zweite grundlegende Methode der Musikinterpretation möchte ich die Homologie
betrachten. Der Begriff wurde für die Popmusikforschung in der ersten Hälfte der 70er
Jahre von Paul Willis geprägt. Die Methode, Bedeutungszusammenhänge durch
strukturelle Ähnlichkeiten herzustellen, ist jedoch älter. Sie ist mindestens präsent in den
Musikinterpretationen Adornos82 und lässt sich auch Arnold Schönberg 83 unterstellen,
sofern seine Vergleiche zwischen der Tonalität und der hierarchischen Struktur einer
Monarchie in seiner Harmonielehre nicht nur als Illustrationen zum besseren Lernen
angesehen werden. Dabei ist die homologe Struktur insbesondere in der Analyse sozialer
Bedeutungen von Musik relevant, denn sowohl Adorno als auch die Vertreter_innen des
CCCS nutzten Homologie, um die soziale Wirkmächtigkeit von Musik zu beschreiben.
Paul Willis beschreibt sein Konzept folgendermaßen:
„Essentially it[=Homologie] is concerned with how far, in its structure and content, the music
parallels and reflects significant values and feelings of the particular social group involved
with it. Such analysis is homological because it investigates what are the correspondences, the
similarities of internal relation, between a style of life and an artefact or object. Basic
homologies are best understood in terms of structure and style, though it may be possible at
times to identify homologies of content. […] One can understand this partly as
communication, but much more profoundly it should be understood as a process of cultural
resonation, and concretization of identity.“84
Auch John Shepherd analysiert Musik in Homologien, wenn er Ähnlichkeiten zwischen
der grundsätzlichen Organisation von Gesellschaft oder sozialen Gruppen (z.B. Feudal)
und der grundsätzlichen Organisation von Klang (Pentatonik) herausstellt. 85 Die
Homologie arbeitet dabei oft auf einem unbewussten Level, ist aber im Gegensatz zur
Assoziation nicht unbedingt intuitiv verständlich, sondern basiert analytisch auf einer
Abstraktion, die mit einer anderen Abstraktion in Beziehung gesetzt wird. Auch wenn dies
zunächst eher unintuitiv erscheint, wird eine solche Beziehung plausibler, wenn die im
82 Vgl. Adorno (1978), S.20: Adorno arbeitet beispielsweise mit einer Homologie zwischen Tonalität und
Kapitalismus: „Die zweite Natur des tonalen Systems ist historisch entsprungener Schein. Sie hat die
Würde des geschlossenen und exklusiven Systems der Tauschgesellschaft zu verdanken, deren eigene
Dynamik auf Totalität hinauswill und mit deren Fungibilität die aller tonalen Elemente aufs tiefste
übereinstimmt.“ Zahlreiche weitere Beispiele ließen sich hierfür anführen.
83 Vgl. Schönberg (2003), S.34: „es sei gleich erwähnt, daß vieles von dem, was ich über die Werte der
Stufen mit Rücksicht auf ihre Fähigkeit, Folgen, Akkordfolgen zu bilden, sagen werde, auf dieser
Erkenntnis beruht, nämlich, daß die Tonika die beherrschende und die Dominante die beherrschte ist. [..]
Und wenn die Tonika der Dominante folgt, so ist das nur so, wie wenn ein König seinen Vasallen,
Zeremonienmeister, Quartiermacher voranschickt“, Schönbergs diesbezügliche Anmerkungen sind vor
allem bemerkenswert, da sich entsprechende Analogien zwischen der von ihm entwickelten 12-Tonmusik
und der sich durchsetzenden Demokratie anbieten.
84 Willis (1974), Abschnitt II, 2. „The Homological Level of Cultural Relation“, Absatz 1.
85 Vgl. Shepherd (1991), S.107-111.
30
letzten Abschnitt erwähnten mimetischen Weltzugänge und die Ziele des postulierten
Dispositivs berücksichtigt werden.86
Der Vorteil dieser Interpretationsebene ist es insbesondere auf diese Weise Zugang zu
einer unbewussten Vermittlung zwischen Musik und Gesellschaft zu finden. Gerade die
unbewusst mitkonsumierten Grundstrukturen erscheinen mir dabei für meine Zwecke
vielversprechend, da hierüber eben kein bewusstes Verständnis besteht, gleichzeitig aber
durch die strukturelle Ähnlichkeit gesellschaftliche Verhältnisse bestätigt und naturalisiert
werden.
Auch McClary arbeitet in ihrer Einleitung zu „Feminine Endings“ ein analytisches
Hilfsmittel aus, das als Homologie verstanden werden kann und das für meine Zwecke
besonders spannend ist: das Begehren („desire“).
McClary betrachtet die von der Tonalität erzeugte harmonische Spannung (durch
Entfernung von Grundton oder von der Grundtonart) als Homologie zu einem Begehren,
das ständig nach Befriedigung, d.h. klanglich nach einer Kadenz in der Grundtonart,
strebt.87 McClary sieht hierin eine homologe Darstellung von Sexualität und vorwärts
strebender Subjektivität.
Popmusik wird allerdings, im Gegensatz beispielsweise zu einer Sonate, nicht
grundlegend durch harmonische Entwicklungen organisiert, entsprechend möchte ich
McClarys Ansatz etwas weiter fassen, indem ich ihn auf jede Art der musikalischen
Erzeugung einer Erwartungshaltung anwende. Begehren kann also auch auf rhythmischer,
melodischer, dynamischer, formaler oder klanglicher Ebene entstehen.
In Musik ließen sich so Formen der Befriedigung, des Aufschubs oder der Enttäuschung
von Erwartungen analysieren. Ich sehe dies ebenfalls in enger homologer Beziehung zu
sexuellem Begehren, wobei sich allerdings jeweils am konkreten Song die Frage stellt,
von wem ein solches Begehren ausgeht, auf wen oder was es sich richtet und wie es genau
86 Eine weitere Anwendung dieses Konzepts liefert Susanne Binas in ihrer kurzen Untersuchung des Heavy
Metal, die die homologe Resonanz zwischen subkulturellem Stil und musikalischer Darstellung
heldenhafter kämpferischer Männlichkeit überzeugend darlegt [Vgl. Binas (1992)]. Die Untersuchung
folgt dabei zwei Schritten, die Willis in seiner theoretischen Entwicklung des Homologie-Konzeptes
entwickelt: Zuerst wird die Subkultur selbst mit ihren zentralen Werten und Artefakten dargestellt, dann
erst wird die Musik untersucht, wobei musikalische Mittel, die relevante Ähnlichkeiten oder
Resonanzen zu den bereits herausgearbeiteten Werten der Subkultur aufweisen, identifiziert werden.
Solche Parallelstrukturen lassen sich dabei oft viel leichter belegen, als eine Assoziation. Es genügt
strukturelle Ähnlichkeiten zwischen symbolisch aufgeladenen Objekten, Grundwerten oder
Verhaltensweisen und der Musik aufzudecken.
87 Vgl. McClary (1991), S.12: „Music itself often relies heavily upon the metaphorical simulation of sexual
activity for its effects. I will argue […] that tonality itself – with its process of instilling expectations and
subsequently withholding promised fulfillment until climax – is the principal musical means during the
period from 1600 to1900 for arousing and chanelling desire.“
31
organisiert ist. Dieses musikalische Begehren arbeitet jedoch in jedem Fall mit der
Produktion einer Abwesenheit, die in der Spannung zwischen erwartetem und
eingetretenem musikalischem Verlauf entsteht. Die Abwesenheit setzt die Hörer_innen
dabei in eine aktive involvierte Beziehung zu Musik.
Das Begehren ist hier allerdings nicht nur eine abstrakte homologe Struktur, sondern
erzeugt tatsächlich Gefühle in den Hörer_innen, die mit homologen Gefühlen von
sexueller Anziehung in Beziehung gesetzt werden können. Diese musikalische Produktion
von Begehren geschieht dabei eher unbewusst, sie erscheint also, da die musikalischen
Gründe für das produzierte Begehren in der Regel nicht erkannt werden, als unmittelbare
emotionale Reaktion, die dann auf Außermusikalisches, beispielsweise den Körper der_s
Sänger_in projiziert werden kann. Gerade die scheinbar unmittelbare emotionale Reaktion
ist dabei aus feministischer Sicht interessant, da die so unter Umständen stattfindende
Reproduktion und Naturalisierung von Geschlechterbildern kaum reflektiert wird und
damit auch nur schwer diskursiv angreifbar ist.
Neben diesen Homologien, die sich eher auf die größer angelegte Organisation von Klang
beziehen, lassen sich Ähnlichkeiten zwischen einem musikalischen und einem
außermusikalischen Element aber auch für einzelne Details analytisch anwenden. Hohe
Töne können so als Homologie für räumliche Höhe interpretiert werden, was wiederum
Assoziationen, wie z.B. himmlisch, Luft, fliegen oder göttlich, hervorrufen kann.
Homologe Beziehungen zwischen musikalischen und außermusikalischen Elementen
können so ein hilfreiches Werkzeug sein, um auch auf der assoziativen Ebene vom Klang
erzeugte Eindrücke zu verstehen.
Grundsätzlich sind dabei auch Homologien kulturell geprägt und keinesfalls interkulturell
unmittelbar verständlich. Eher im Gegenteil, folgt man Willis, so entfalten sie ihren Sinn
ausschließlich vor dem Hintergrund der sie hervorbringenden (Sub-)Kultur.88
3.1.3 Intertextualität
Die intertextuelle Musikanalyse setzt die Musik mit anderen Medien in Beziehung.
Besonders üblich sind hierbei der Text eines Songs, das zugehörige Musikvideo, der
Entstehungskontext
oder
eine
Aufführung
im
Konzert.
Ein
Vorteil
dieses
88 Vgl. Willis (1974), Abschnitt II, 2. The Homological Level of Cultural Relation, (ii)The Music, Absatz 4:
„They [=Homologien] only come alive and become capable of holding meaning when they are rubbed
against the real life experience of a particular group.“
32
Analysewerkzeugs ist es insbesondere, dass Assoziationen nicht musikalisch gerechtfertigt
werden müssen, sondern aus dem sich sprachlich oder bildlich erschließenden Vokabular
abgeleitet werden können, das mit dem Song in Beziehung gesetzt wird.
Wie ich schon erwähnte, möchte ich in dieser Arbeit jedoch den Kontext der Musik
ausblenden, Videos und Aufführungssituationen werde ich also nicht berücksichtigen.
Allein der Text, der sich auch im Klang des Songs entfaltet, wird als weiteres Medium in
dieser Arbeit eine Rolle spielen. Daher werde ich im Folgenden über mögliche
Analysemethoden für den Songtext nachzudenken, wobei ich diesen jedoch nicht vom
Song trennen möchte, sondern als Teil der Klanglichkeit betrachte.
Zwar haben Sprache und Musik einige Gemeinsamkeiten – sie funktionieren beide
akustisch und entwickeln sich in der Zeit – dennoch handelt es sich beim Text um ein von
der Musik verschiedenes Medium, für das andere „Gesetze“ gelten. Worte haben
Bedeutungen und Sprache wird durch Grammatik organisiert, d.h. die Worte stehen in
einer bedeutungsvollen Beziehung zueinander. Durch Grammatik bildet Sprache
Sinneinheiten, wie zum Beispiel Sätze, für die relativ feste Regeln gelten.
Sprache als Medium der Verständigung zu verstehen, bedeutet die Klanglichkeit der Worte
nicht primär durch ästhetische Kriterien sondern durch Bedeutung strukturiert anzusehen.
Der sehr spezifische aus Konsonanten und Vokalen bestehende Klang der Sprache ist für
die Verständigung relevant und bedeutet ein ständiges Abgrenzen dieser Laute innerhalb
des sprachlichen Raums. In anderen Worten: Für das akustische Verstehen eines Wortes ist
es notwendig, es von anderen Worten zu unterscheiden, es mit diesen in Beziehung zu
setzen und in einem sprachlichen Gesamtkontext zu verorten.89 Sprache produziert so eine
involvierende Aktivität des Verstehens und Dekodierens, die für Musik nicht in der Form
angenommen werden kann.90
Die sprachliche Organisation in Sinneinheiten, d.h. in Worten, Nebensätzen und Sätzen,
verlangt dabei immer eine Vervollständigung. Beginnt also der Gesang mit einer
langgezogenen Silbe, wie z.B. „Sü-“, so mag das ganze Wort zwar schon erahnt werden,
dennoch produziert die Silbe eine Erwartung, die sich erst in der Vervollständigung „ßer“ löst. Aber dieses Wort verlangt grammatisch eine Fortführung, es kann nicht alleine
für sich stehen bleiben, da es keinen Satz bildet. So produziert Sprache auf einer eigenen
89 Vgl. Wicke/Shepherd (1997), S.25: Sie argumentieren auf Saussure bezugnehmend: „we only recognize
sounds as meaningful in terms of their relationship of difference from other sounds recognized as well as
meaningful by the structure of language.“
90 Zur kognitiven Worterkennung vgl. Wendt (2007), S.20ff.
33
Ebene Erwartung und Erfüllung; es ließe sich so auch auf der sprachlichen Ebene das
Aufrufen und Auflösen von Begehren im Sinne McClarys analysieren.
Schließlich hat der Text durch den heterogenen Lautvorrat der Sprache auch die
Möglichkeit ganz besondere eigene Rhythmen, z.B. durch Wortwiederholungen, Reime
oder Alliterationen, zu produzieren. Diese können wiederum in Beziehung zu den
sprachlichen Sinneinheiten und zu den verschiedenen Ebenen der musikalischen
Organisation eines Songs stehen.
Was ich an dieser Stelle nahe lege, ist Sprache als ein zweites sich innerhalb der Zeit eines
Songs entwickelndes System zu betrachten, das jenseits der semantischen Bedeutung
emotionale Effekte hervorrufen kann. Das Publikum wird dabei, beispielsweise durch die
Art und Weise, in der es angesprochen wird, in eine bestimmte Beziehung zum Song (hier
verstanden als bestehend aus sprachlichem Text und Musik) gesetzt oder mehr noch, es
setzt sich selbst in Beziehung, indem es beispielsweise gespannt auf das Ende eines Satzes
wartet, der für einen halben Takt unterbrochen wurde.
Das, was ich hier beschrieben habe, weist einige Ähnlichkeiten zu dem auf, was Julia
Kristeva als Genotext bezeichnet91 und gegen die bedeutungstragenden Schichten der
Sprache, die sie Phänotext nennt, abgrenzt.92 Mit dem Genotext verbunden ist für Kristeva
das Semiotische (in Abgrenzung zum Symbolischen, das mit dem Phänotext
korrespondiert), das sie unter anderem als „«Musik» in den Buchstaben“93 bezeichnet und
auch an anderer Stelle mit Musik vergleicht. 94 Diese Ebene der Sprache steht für sie
außerdem mit dem Körper in Beziehung: Sie produziert Lust95 und ist insgesamt eng mit
der eigenen Körperempfindung verbunden.96
Kristeva bezieht sich in ihrer Begriffswahl auf die Bedeutung des griechischen Wortes
«σημειον», das sie mit „Unterscheidungsmal, Spur, Kennzeichen, Vorzeichen, Beweis,
91 Vgl. Kristeva (1978), S.94-5 „Wollte man in einem Text den Genotext bloßlegen, so müßte man die
Energieschübe der Triebe freilegen, wie sie sich beobachten lassen im phonematischen Apparat
(Phonemhäufung und -wiederholung, Reim ect.) und im melodischen Apparat (Intonation, Rhythmus
ect.), aber auch in der Anlage der semantischen und kategoriellen Felder, wie sie sich in syntaktischen
und logischen Feldern oder in der Ökonomie der Mimesis (Phantasma, Aufschub der Denotation,
Erzählung ect.) zu erkennen gibt.“ [Hervorhebungen im Original]
92 Vgl. dies., S.95: „Darunter [ = unter Phänotext] verstehen wir jene Sprache die der Kommunikation
dient“
93 Dies., S.72.
94 Vgl. dies., S.35: „Die sogenannte «natürliche» Sprache läßt verschiedene Artikulationsweisen des
Semiotischen mit dem Symbolischen zu. Andererseits gibt es nicht-verbale Zeichensysteme, die
ausschließlich auf dem Semiotischen aufbauen (wie die Musik z.B.)“
95 Vgl. dies., S.90-91.
96 Vgl. dies., S.35-42.
34
graviertes oder geschriebenes Zeichen, Aufdruck, Hinweis, Gestaltung“ übersetzt. 97 Sie
leitet hieraus eine Bedeutung von Semiotisch ab, die nicht symbolische Bedeutung
impliziert, wie dies in der Semiotik als Wissenschaft vom Zeichen verstanden wird,
sondern dem Symbol vorangehende Unterscheidungen nicht von Bedeutungen, sondern
von Strukturierungen eines noch unstrukturierten Raumes, in dem sich später die Zeichen
mit ihren Bedeutungen bilden können.98 Es lässt sich vielleicht als die Unterscheidung
zwischen einem O und einem A verstehen, das klanglich differenziert werden muss, bevor
ein Unterschied zwischen „Hase“ und „Hose“ auf der Bedeutungsebene überhaupt
verständlich wird, ja bevor Worte überhaupt möglich werden. Dabei sind die Vokale A und
O, bevor sie bedeutungstragende Elemente der Sprache werden, Körperzustände oder
mehr noch Spielzeuge99 von klanglicher Selbst- und Welterfahrung, die dem Spracherwerb
vorangehen.
Barbara Bradby hat bereits gezeigt, wie Kristevas Semiotisches für die Popmusikanalyse
produktiv gemacht werden kann. Sie analysiert damit insbesondere den Rhythmus und den
nonverbalen Text von Hintergrundstimmen und kommt so zu sinnvollen Interpretationen
von „Aah“-Klängen oder „Dum-de-dum-dum“-Stimmen:
„Kristeva's «semiotic» is a material aspect of language, bound up with musical features that
continually recall the rhythms and melodies of pre-verbal communication with the mother.“100
„«Aah», for instance, is a «word» that passes between mother and baby (in my experience as
young as three months) as a kind of verbal transformation of the smile that is the earliest
reciprocal communication.“101
Auch ich möchte den Begriff des Semiotischen von Kristeva übernehmen. Diesen halte
ich, wie ich später zeigen werde, auf die musikalische oder allgemein klangliche Ebene
des Gesangs für sinnvoll anwendbar.
97 Dies., S.35.
98 Kristeva geht es dabei insbesondere auch um die Entwicklung von Subjektivität und Körperlichkeit in
einem vorsprachlichen Raum. Ihre Unterscheidungen beziehen sich vor allem auf energetische
Aufladungen des Körpers, der in diesem Prozess überhaupt erst sozial, so wie für das Kind selbst
hervorgebracht wird. Die Kommunikation zwischen Bezugsperson (bei Kristeva immer die Mutter) und
Kind geschieht dabei in dieser Zeit durch Gesten, Laute oder Stimmklang, die noch keine symbolische
Bedeutung haben. Vgl. dies., S.35-42.
99 Vgl. dies., S.37: „Weder Modell noch Abbild geht sie [= die chora, d.h. der frühkindliche Zustand von
Einheit mit der Mutter] der Gestaltgebung und insofern auch der Spiegelung voraus, denen sie später
zugrunde liegt, und sie duldet keine andere Analogie als den Rhythmus von Stimme und Geste. Erst
wenn diese Beweglichkeit wieder im Lichte des Gebärden- und Stimmspiels sieht […], eines Spiels, das
sie auf dem Register des sozialisierten Körpers vollführt, wird dieser Körper von der Ontologie und der
Leblosigkeit befreit, in die Platon ihn versetzte, wohl um ihm den Rhythmus zu nehmen, den Demokrit
ihm noch zugedacht hatte.“
100Bardby (2002), S.70.
101Bracby (2002), S.72.
35
In meinen Musikanalysen werde ich insgesamt die textliche und die musikalische Ebene
nicht explizit trennen. Ich habe hier auf die Besonderheiten der sprachlichen Organisation
gegenüber der musikalischen hingewiesen, werde diese beiden Ebenen aber später
gemeinsam und in enger Beziehung zueinander, als analytische Betrachtungen des
zugleich sprachlichen wie musikalischen Klangs bearbeiten. Emotionale Effekte können
dabei insgesamt sowohl in der sprachlichen, als auch in der musikalischen Ebene und in
der Beziehung zwischen beiden ihren Grund haben.
3.1.4 Materialität
Als nächstes Analysewerkzeug möchte ich einen Begriff einführen, der zuerst ungewohnt
erscheinen mag: Die Materialität von Musik. Worauf ich damit verweisen möchte, ist eine
Ebene der Musik, die sich nicht auf eine Assoziation oder eine homologe Ähnlichkeit mit
etwas anderem reduzieren lässt. Der Klang selbst hat Eigenschaften, die scheinbar direkt
und unmittelbar Bedeutungen oder Informationen transportieren können.
Ein plakatives Beispiel für das, was ich hier bezeichnen möchte, ist der Klang einer
aggressiven Stimme, die als solche erkennbar ist, ohne dass hier offenbar der Umweg über
eine Homologie, ein Symbol oder eine Assoziation gemacht wird. Vielmehr scheint bei
dieser Kommunikation eine Art mimetischer Identifikation relevant zu sein oder eine
Spiegelung, in der das hörende Subjekt die innere Verfasstheit der gehörten Stimme in
sich nachbildet oder zumindest körperliches Wissen darüber hat. Freya Jarman-Ivens sieht
hier sogar eine Beziehung zu Lacans Spiegelstadium,102 worauf ich im nächsten Teil
eingehen werde.
Die
als
Beispiel
genannte
aggressive
Stimme
transportiert
viele
körperliche
Informationen, beispielsweise Anspannung von Zwerchfell, Stimmlippen, Rachen, Hals,
der Resonanzräume in Kopf und Brust, sowie Bewegungen der Zunge, des Kiefers und der
Lippen, die offenbar – ob kulturell erlernt oder tatsächlich aufgrund biologischer
Dispositionen möchte ich hier nicht diskutieren – wiederum mit emotionalen Zuständen
verbunden werden. Diese Form der emotional-körperlichen Kommunikation möchte ich
ab jetzt somatisch nennen.
Dabei lässt sich annehmen, dass sich diese somatische Materialität des Klangs auch auf
Musikinstrumente übertragen lässt, wobei sicherlich nicht nur (aber auch) die Ähnlichkeit
des Instrumentalklangs zur menschlichen Stimme, sondern auch die mit diesem
102Vgl. Jarman-Ivens (2011), S.30-31.
36
Instrument verbundenen Spielweisen, die auf diese Weise hörbaren Körperbewegungen,
die verwendete Kraft, Anspannung und Entspannung, somatische Informationen
transportieren.103
Ich übernehme den Begriff „Materialität“ dabei einerseits von Jarman-Ivens, die damit die
körperliche Anbindung der Stimme bezeichnet,104 und andererseits von John Shepherd und
Peter Wicke, die in ihren theoretischen Ausführungen über Bedeutungskonstruktion in und
durch Musik in „Music and Cultural Theory“ von klingender und musikalischer Materie
(„sonic matter“105bzw. „musical matter“106) sprechen. Offenbar geht es letzteren dabei
ebenfalls um eine Beziehung zwischen Klanglichkeit und Körper: „the experience of
sound in music is based upon a dialectical interaction between sounds material
characteristics and the human body as itself a material site for the mediation of cultural
and subjective processes.“107 Und später erklären sie zur Beziehung zwischen Körper und
Klang:
„it [=music] resonates powerfully within the lived, corporeal and somatic experience of the
listener. To hear a voice, a musical sound, is to «have knowledge» of the corporeal and
somatic state wich produced it. The reaction is both sympathetic and empathetic.“108
Mit Bezug auf Jarman-Ivens möchte ich hier davon ausgehen, dass die Stimme in ihrem
Klang einen Körper produziert.109 Dieser Körper erhält dabei im Stimmklang nähere
Bestimmungen, z.B. Anspannung usw., die sich in Popsongs analysieren ließen.
Allerdings ist die Frage nach der Verwendung oder genauer der Anwendbarkeit dieses
Analysemittels noch nicht beantwortet: Insbesondere eine Abgrenzung zwischen einer
somatischen Materialität, die scheinbar unmittelbar und direkt Informationen über den
körperlichen Zustand des singenden Subjekts transportiert, und einer Assoziation, die
diesen Zustand nur über kleinere oder größere Umwege mitteilt, lässt sich nicht immer
eindeutig vornehmen. Aus pragmatischen Gründen habe ich mich entschieden, von
somatischer Kommunikation nur dann zu sprechen, wenn der singende oder musizierende
Körper im Klang eindeutig identifizierbar, begrifflich fassbar und nachvollziehbar ist.
103Beispielsweise Luftgitarrenwettbewerbe ließen sich als ein Beleg für die Realität einer solchen
Beziehung anführen, indem die somatischen Informationen des Gitarrenklangs wieder in Körperbilder
zurückübersetzt werden.
104Vgl. Jarman-Ivens (2011), S.4: „The (material) voice can be a mediator between body and language; it
gives language meaning, in its inflections, its accent, its bodiliness, but it is also an object apart from
language. It speaks more of the body than of syntax“.
105Shepherd/Wicke (1997), S.164.
106Dies., S.163.
107Dies., S.147.
108Dies., S.180.
109Vgl. Jarman Ivens (2011), S. 7-8.
37
Die Materialität der Klangs lässt sich aber auch auf einer anderen Ebene anwenden: als
Bezeichnung der klanglichen Eigenschaften, also des Timbres einer Stimme oder des
genauen Klangs eines Instruments und der Spielweise.
Shepherd unternimmt in seinem Buch „Music as Social Text“ einen Versuch, das Timbre
von Gesangsstimmen in Popmusik zu interpretieren. Er kommt dabei zu vier Typen, die er
auch in einer zweigeschlechtlichen Matrix in Beziehung zueinander setzt.110
Dieses System möchte ich hier kurz vorstellen, da es als Referenzpunkt hilfreich sein
wird: Shepherd übernimmt zuerst zwei bereits von McRobbie und Frith entworfene
Kategorien des „cock rock“ und „teenybop“ bzw. „soft rock“, denen er jeweils
archetypische Timbres zuweist und die er mit den weiblichen Timbres der „woman-asnurturer“ und „woman-as-sex-object“ ergänzt. Diese Timbres beschreibt er wie folgt:
„The typical «cock» rock vocal sound is hard and rasping […] produced overwhelmingly in
the throat and mouth, with a minimum of recourse to the resonating chambers of the chest and
head.[...] The sound relies on a highly constricted use of the vocal chords, presumably
reproducing physiologically the tension and experiencial repression encountered as males
engage with the public world.“111
„The typical sound of the woman-as-nurturer […] is soft and warm, based on much more
relaxed use of the vocal chords and using the resonating chambers of the chest in particular in
producing a rich resonating sound. The physiology of sound production in this case seems to
speak to a person more fully aware of her inner experiential being in offering herself as a
source of emotional nourishment.“112
„The typical sound of «the boy next door» [=softrock][...] is also soft and warm by
comparison with the hard and rasping «cock» rock sound, but the softness and warmth here
depends […] on the use of head tones. The sound is consequently much more open than the
typical «macho» voice. However, the physiology of the sound production still reflects an
experiential emptiness in avoiding the resonating chambers of the chest cavity[…]. The music
of the vulnerable male is thus essentially «head» music, an appeal for emotional nurturance
that does not, however, abdicate the supposed supremacy of traditional rationality.“113
„The typical sound of the woman-as-sex-object involves a similar comparison. The softer,
warmer hollower tones of the woman singer as emotional nurturer becomes closed off with a
certain edge, a certain vocal sheen that […] are essentially head tones“114
Dabei argumentiert Shepherd weiterhin, dass die verschiedenen Timbres bestimmte
Reaktionen beim Publikum hervorrufen, wobei die Idee eines vollständigen harmonischen
Obertonspektrums für ihn ein Ideal darstellt, zu dem die Abweichungen in Beziehung
gesetzt werden müssen: Für ihn lösen unvollständige Obertonspektren beim Publikum das
Bedürfnis aus, diese zu vervollständigen.115 Außerdem verwendet er das Timbre
110Vgl. Shepherd (1991) S. 167-168
111Ders., S.167.
112Ebd.
113Ebd.
114Shepherd (1991) S.167-168.
115Vgl. ders., S.165: „«Dirty» or «un-pure» timbres, as heard in various genres of «popular» music […]
only use some of the harmonics inherent in the ideally pure sound of the voice or the instrument. This, it
can be argued, renders such timbres immediately implicit or «writerly» because they invite completion
38
offensichtlich als Quelle für Homologien, beispielsweise zwischen Kopfstimme und
Rationalität
(woman-as-sexobject
und
boy-next-door),
zwischen
angespannten
Stimmlippen und gesellschaftlicher Unterdrückung («cock» rock) und zwischen einem
vollständigen Obertonspektrum und emotionaler Fülle (woman-as-nurturer).
Insgesamt kommt Shepherd somit zu einer Möglichkeit das Timbre jenseits einer
empathischen Nachempfindung in seinen spezifischen Eigenschaften zu interpretieren.
Wesentlich ist dabei in dem hier betrachteten Kontext vor allem, dass für Shepherd der
Klang selbst beim Publikum eine Reaktion, den Wunsch das unvollständige Spektrum zu
ergänzen, auslöst.
Auch hier, auf der Ebene der klanglichen Materialität, wäre es damit möglich ein
Begehren im Sinne McClarys zu analysieren. Welche Momente des Klangs auf welche
Weise hier eine solche Wirkung hervorrufen, möchte ich allerdings an den
Musikbeispielen selbst analysieren.116
Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass ich in diesem Abschnitt zwei Arten der
Materialität differenziert habe: eine somatische, die Informationen über den Körper
transportiert, sowie eine klangliche, die sich z.B. auf das Timbre, bezieht. Da in beiden
Formen der Materialität der Klang nach wie vor bedeutungstragend ist, sollte Materialität
dabei nicht mit der akustischen Physik verwechselt werden.
Allerdings ist diese Bedeutungsebene der Musik nun nicht mehr in einem (homologen
oder assoziativen) Verweis auf anderes zu suchen, sondern vielmehr ist es nötig, den
Klang selbst in seinen spezifischen Eigenschaften als bedeutend zu verstehen. Dabei bleibt
allerdings noch zu klären, wie dieses Bedeuten ohne Verweis funktioniert. Hierauf scheint
mir mein letztes Analysewerkzeug, die Psychoanalyse, geeignete Antworten zu geben.
from the outside.“
116Ich bin durchaus skeptisch, was Shepherds konkretes Modell angeht: Bezeichnenderweise wird das Ideal
eines vollständigen Timbres vor allem von dem weiblichen Typ („woman-as nurturer“) erfüllt, der dem
Bild einer idealisierten Mutter am nächsten kommt.
Schon in seinen Bezeichnungen der Stimmtypen fällt außerdem auf, dass weibliche Stimmen für ihn nur
in Bezug zu einem männlichen Publikum gedacht werden, für das Frauen begehrte Objekte sexueller
Erfüllung (woman-as-sexobject) oder emotionaler Zuwendung (woman-as-nurturer) sind. Für die
männlichen Timbres gilt dies dabei nicht im selben Maße. Zwar denkt Shepherd offensichtlich auch den
„boy-next-door“ in Bezug zu einem weiblichen Publikum, das ihn „vervollständigt“, aber dies drückt
sich nicht wie bei den Frauen in der Bezeichnung aus. Außerdem erscheint das unvollständige Timbre
hier dennoch weit mehr als eine emotionale Selbstdarstellung des eigenen Mangels, während er das
weibliche Timbre jeweils als ein Sich-Anbieten („offering herself“) bzw. orientiert an einer männlichen
Perspektive („male-appropriated“) interpretiert wird [Vgl. S.167].
39
3.1.5 Psychoanalyse
Die Psychoanalyse, die ich nun auf ihre Tauglichkeit zur Musikbetrachtung untersuchen
möchte, ist bekanntlich kein musikanalytisches Werkzeug im engeren Sinne. Außerdem
war und ist die Psychoanalyse aus feministischer Sicht einiger Kritik unterworfen, die auf
der Reproduktion oder Rechtfertigung patriarchaler Hegemonie basiert.117
Allerdings bietet sich die Psychoanalyse andererseits gerade deswegen als Quelle zur
Analyse gesellschaftlich relevanter aber tendenziell unbewusster Prozesse an. Daher kann,
wie Laura Mulvey es formuliert, „die psychoanalytische Theorie in ihrer gegenwärtigen
Version wenigstens dazu beitragen, den Status quo, die patriarchalische Ordnung, in der
wir gefangen sind, zu erhellen.“118 Insbesondere ermöglicht die Psychoanalyse aber
Aussagen über unbewusste Reaktionen, was sie gerade für meine Betrachtung von Musik,
Geschlecht und Körper interessant macht. Ich halte es somit für hilfreich, mir an dieser
Stelle einige psychoanalytische Vorstellungen bewusst zu machen, von denen ich mir vor
allem ein tieferes Verständnis möglicher Hörweisen verspreche.
Ich möchte dabei im Folgenden drei Aspekte näher beschreiben, die mir für meine Arbeit
relevant erscheinen: Zuerst möchte ich mich mit Jacques Lacans Konzept des Begehrens,
insbesondere mit seinem Objekt a, befassen. Dann möchte ich auf eine Interpretation des
Kastrationskomplexes von Kaja Silverman eingehen und schließlich das ebenfalls von
Lacan entwickelte Spiegelstadium betrachten.
Für Lacans Verständnis von Begehren ist es wichtig, dass sein psychoanalytisches Denken
wesentlich von Verschiebungen strukturiert ist.119 Damit ist gemeint, dass ein Gegenstand
oder ein Wort im Unbewussten einfach symbolisch mit einem anderen ersetzt werden
kann, sofern auf irgendeiner Ebene, die von Mensch zu Mensch eine andere sein kann,
Ähnlichkeiten oder ein Zusammenhang zwischen den beiden Worten oder Gegenständen
bestehen.120 Diese Verschiebungen betreffen dabei für Lacan unter anderem das Begehren,
117 Sie orientiert sich beispielsweise implizit immer wieder an einem männlichen Subjekt, wie Simone des
Beauvoir schreibt [vgl. Beauvoir (2012), S. 76] und nimmt in der Regel auf die heterosexuelle
Kleinfamilie Bezug, die sie damit normiert und idealisiert. Andererseits gibt es auch zahlreiche
feministische Texte die positive Impulse aus der Psychoanalyse übernommen haben, wie beispielsweise
die ausführlich in dieser Arbeit zitierten Judith Butler, Julia Kristeva und Laura Mulvey.
Siehe hierzu auch Mulvey (1994), S. 48-50.
118Mulvey (1994), S.50.
119Vgl. Pagel (2012), S.40-47.
120Musikalisch ließe sich diese vielleicht mit Assoziationen und Homologien vergleichen. Das
Musikalische steht dabei jeweils für etwas anderes, ohne dass es dieses andere im verbalen Sinne
bezeichnet.
40
so dass das eigentlich Begehrte immer wieder durch anderes gewissermaßen „vertreten“
wird.121
Dieses Vertretungsobjekt nennt Lacan Objekt a.122
Das Objekt a ist dabei nicht das begehrte Objekt, das das Begehren stillen oder
befriedigen würde, sondern ein Objekt, das das Begehren erzeugt, in Bewegung hält und
dabei eigentlich seine Erfüllung verhindert.123 An einem Bikini lässt sich dies vielleicht
erklären: Dieser repräsentiert die Nacktheit durch die minimale Verhüllung, und erzeugt so
überhaupt erst den Wunsch oder das Begehren nach Nacktheit, verhindert die Erfüllung
aber ebenso, indem er eben verhüllt.
Das Begehren wird dabei für Lacan ursprünglich durch einen „Mangel an Sein“ erzeugt, 124
womit er meint, dass sobald das Subjekt in die Sprache eintritt, 125 es grundsätzlich von
sich selbst entfremdet ist, sich sprachlich immer nur als ein fremdes Bild, als ein_e
andere_r, repräsentieren kann.126 Dieser Mangel kann dabei als eine körperliche
Amputation verstanden werden bzw. als „symbolische Kastration“, 127 der bei Lacan beide
Geschlechter unterliegen.128 Der dabei vom Subjekt symbolisch abgetrennte oder
verlorene Teil wird nun verschoben, d.h. von anderen Objekten repräsentiert, die als
Objekt a das Begehren produzieren.
121Vgl. Pagel (2012), S.77-78.
122Krips beschreibt das „ursprüngliche“ Objekt a folgendermaßen: „the object a is not merely […] a
substitute for a specific other object. Rather, it is a catachresis, a substitute for an object constituted
retrospectively through the act of substitution.“ [Krips (1999) S. 21]
123Vgl. ders., S.29.
124Adam (2006), S.48. Vgl. außerdem Braun (2007), S.87.
125Und eigentlich beginnt dies bereits in der imaginären Verkennung des Spiegelstadiums. Vgl. Braun
(2007), S.87
126Vgl. Adam (2006), S.61 und Pagel (2012), S.67.
127Vgl. Braun (2007), S.126-127. „Sie (=Die Kastration] ist symbolisch in dem Sinne, in dem das Symbol
der «Mord am Ding» ist“ [S. 126]. Dies lässt sich auch so fassen: mit dem Eintritt in die Sprache müssen
die eigenen Bedürfnisse sprachlich artikuliert werden. Da das Subjekt jedoch in der Sprache entfremdet
ist, spricht es seine Bedürfnisse mit Worten aus, die nicht die Seinen sind, womit er auch sein Bedürfnis
als eigenes verliert. Vgl. Lacan (1991), S.4: „Es ist dies [= Die Entfremdung von den eigenen
Bedürfnissen] nicht die Folge seiner realen Abhängigkeit […], sondern vielmehr die Folge der
signifikanten Ausformung als solchen und des Umstands, daß seine Mitteilung vom Ort des Anderen aus
ergeht.“
128Vgl. Braun (2007), S.140. Hier wäre eigentlich auf die besondere Funktion des Phallus für das Begehren
in Lacans Denken einzugehen. Dieser lässt sich als Symbolisierung des mit dem Eintritt in die Sprache
vollzogenen Verlust (Mord am Ding) verstehen. Der Phallus ist damit ein Signifikant für eine
Abwesenheit, bzw. der Unmöglichkeit (Phallus oder das Begehren der Mutter [vgl. Lacan (1991), S.6])
zu sein. Insofern löst dieser eigentlich in Lacans Denken das Begehren aus [Vgl. Lacan (1991), S.5-6].
Die Beziehung zwischen Phallus und Objekt a lässt sich dabei in etwa so denken, dass der Phallus die
hinter dem Objekt a verborgene Leere (da das Begehren nie erfüllt werden kann) repräsentiert.
41
Das Objekt a lässt sich dabei wie ein Köder oder eine Verlockung („lure“) 129 verstehen, die
die Vervollständigung des Subjekts verspricht, aber nie erfüllt, auch gar nicht erfüllen
kann oder soll. Wie Jochen Adam schreibt, ist „[d]as Begehren, als «Metonymie des
Seinsverfehlens», [...] nicht Beziehung zu einem Objekt, sondern Beziehung zu einem
Mangel“.130 Das Objekt a ist dabei wie ein Platzhalter der Vervollständigung, der aber
eben als Platzhalter den Mangel bzw. die Lücke, die er kennzeichnet, auch hervorruft,
betont (so dass Begehren nach dem Fehlenden entsteht) und zugleich dennoch schließt.
Insgesamt lässt sich mit dem Objekt a auch McClarys harmonisch-tonales Begehren nach
der Kadenz nochmals differenzierter verstehen: Nicht die Kadenz produziert das Begehren
und damit den Spaß an der Musik, sondern der ständige Aufschub und die Vermeidung.
Das eigentliche Ziel der Musik ist dabei nicht ihr Ende auf dem Grundton, sondern die
Zeit davor, wobei die die Kadenz aufschiebenden Harmonien, Modulationen oder
Trugschlüsse als Objekte a verstanden werden können.
Übertragen auf die bereits angedeuteten anderen Ebenen musikalischen Begehrens lassen
sich so auch unvollständige Obertonspektren oder unterbrechende Pausen als Objekte a
verstehen, die ein Begehren produzieren. Dabei entsteht jeweils eine Beziehung zu etwas,
was gerade im Klang nicht präsent ist.
Allerdings entsteht Mangel für Lacan nicht erst durch die symbolische Ordnung (obwohl
diese den Mangel stark verändert), sondern ist eine zentrale Erfahrung der frühkindlichen
Lebenswelt, in der der Säugling aufgrund seiner körperlichen Unselbstständigkeit
vollständig auf seine Eltern/Bezugspersonen angewiesen ist.131 Die Filmwissenschaftlerin
Kaja Silverman entwickelt hiervon ausgehend einige Theorien zur Darstellung von
Geschlecht im Klang von Filmen.
Sie vertritt die These, dass die einseitige Projektion der Kastration auf Frauen, wie sie
insbesondere von Freud vorgenommen wird,132 ein Verdrängungsmechanismus ist, der
männliche Subjekte davor schützt, die existenzielle Spaltung der Subjektivität, d.h. den
eigenen Mangel an Sein, in sich selbst anerkennen zu müssen. Silverman argumentiert,
129Vgl. Krips (1999), S.25-27: Krips erklärt, dass dieser Köder dabei eine doppelte Täuschung verfolgt. Am
Beispiel der Maske oder visuellen Täuschung (Trompe l'oeil) macht er deutlich, dass die eigentliche
Faszination oder die Lust (Pleasure) darauf basiert, dass die Täuschung der Maske durchschaut wird, d.h.
die Maske wird als unecht erkannt. Dennoch symbolisiert sie gewissermaßen einen Blick oder ein
Gesicht, das hinter der Maske steckt, auch wenn die Maske an der Wand hängt und offenkundig leer ist,
so dass eine zweite Täuschung entsteht. Ebenso erklärt Krips den von Parrhasios gemalten Schleier im
Mythos, der ein Bild hinter dem Schleier als Täuschung verspricht, das jedoch überhaupt nicht existiert.
130Adam (2006), S.61.
131Vgl. Braun (2007) S. 44.
132Vgl. Freud (1925), Absatz 17.
42
dass die Erkenntnis des anatomischen Unterschieds deshalb von Freud als „unheimlich“ 133
(uncanny) bezeichnet wird, da es an etwas bereits bekanntes erinnert: eine Amputation, die
allen Menschen gleichermaßen widerfährt, so dass der anatomische Unterschied nur, weil
er daran erinnert, überhaupt Angst macht und machen kann.
Die einseitige Projektion der Kastration auf Frauen ist für Silverman Resultat eines
kulturellen
Prozesses,
der
zugunsten
einer
Verdrängung
der
Spaltung
oder
Unvollständigkeit für Männer funktioniert.134 Aus dieser Interpretation folgt dann die
Notwendigkeit Mangel kontinuierlich durch verschiedene Kulturprodukte auf der
weiblichen Seite zu fixieren, was Silverman am Beispiel des Films belegt.135
Dabei geht sie von einer zweiseitigen Interpretation des vorsprachlichen Zustandes des
Kleinkindes aus: Einerseits produziert dieses Urbild Ängste, da das Kind absolut abhängig
ist. Dies sieht Kaja Silverman im Zusammenhang mit dem im Film oft von Frauen zu
hörenden Schrei, den sie mit dem Schrei eines Kleinkindes assoziiert, das mit dieser
Äußerung gerade den eigenen Mangel mitteilt.136
Das frühkindliche Bild hat jedoch auch eine andere positivere Seite: als sorgloser Zustand
vor der Spaltung des Subjekts, als regelrechtes Paradies.137 Dieser Idealzustand
ursprünglicher Vollständigkeit wird dabei im Film ebenfalls für das Publikum
wiedererfahrbar, wobei dies erneut durch die weibliche Stimme ermöglicht wird. Als
„sonorous envelope“138 bezeichnet Silverman eine Art klangliche Umarmung oder
Einhüllung, in der die Stimme nicht mehr als bedeutungstragend und sprachlich, sondern
als reiner Klang relevant wird.139 Diese Stimme hat damit die Aufgabe den erfahrenen
Mangel wieder gut zu machen,140 wobei sich auch diese Stimme als ein Objekt a verstehen
lässt, das hier Vervollständigung suggeriert.
Ich möchte nun auf das Spiegelstadium eingehen. Das Spiegelstadium ist für Lacan eine
Situation der Subjektbildung, die einen imaginären Ausweg aus der Mangelsituation des
Säuglings darstellt. Das Kind erkennt sich im Spiegel (oder auch in einem anderen
Menschen) als ganzen oder vollständigen Menschen und verkennt sich damit, denn seine
reale Situation ist immer noch durch Unselbständigkeit und Abhängigkeit von Versorgung
133Freud (1927), Absatz 6.
134Vgl. Silverman (1988), S.14-18.
135Vgl. beispielsweise dies., S.78-79.
136Vgl. dies., S.77.
137Vgl. dies., S.72-73.
138Dies., S.72.
139Vgl. dies., S.85.
140Ebd.
43
geprägt. Im Spiegelbild antizipiert es hingegen sich selbst als vollständig und
selbstständig, als ein Ideal seiner Selbst, das jedoch nie schon erreicht ist.141
Dieses (V)Erkennen ist dabei nicht symbolisch zu verstehen, d.h. das Spiegelbild steht
nicht symbolisch für das sehende Subjekt, sondern ist imaginär das Subjekt.142 Für das
Kind ist zuerst kein Unterschied zwischen sich und seinem Spiegelbild auszumachen. Das
Spiegelbild oder die Person, in der es sich selbst wiedererkennt, ist das Bild des Selbst,
das damit gewissermaßen von außen betrachtet wird und sich somit auch auf einer anderen
Ebene entfremdet, indem es sich an einen Ort verschiebt, an dem es nicht ist.143
Schließlich erlernt das Kind letztlich durch die symbolische Ordnung, sich von diesem
anderen im Spiegel zu trennen.144 Die imaginäre Verkennung des eigenen und anderen
endet aber damit nicht vollständig, sondern wiederholt sich beispielsweise in der
Verliebtheit:145 Der_die Liebende (v)erkennt sich selbst in der_dem (idealisierten)
anderen.146
Kaja Silverman deutet nun bereits mit dem Titel ihres Buches „the acoustic mirror“ an,
dass auch die Stimme als ein solcher Spiegel funktionieren kann, was für die
Musikanalyse von Freya Jarman-Ivens produktiv gemacht wird. Mit Bezugnahme auf
Silverman entwickelt sie die theoretische Annahme einer Hörweise, die sie als
Identifikation bezeichnet. Sie argumentiert:
„at one level, the voice [= die eigene Stimme] – being both spoken and heard at the same time
– forces an oscillation between subject and object that crosses crucial thresholds.
Identification [mit der gehörten Stimme], though, takes this into another realm, as we place
ourselves in the space behind the voice with which we identify – wanting, in a sense, to make
that voice – at the same time as also hearing that voice“147
141Vgl. Adam (2006), S.45-51.
142Vgl. Gerome Taillandier in Adam (2006): „Wenn der im Spiegel von mir wahrgenommene andere mir
meine Statur und Erscheinungsform gibt, so heißt dies auch, daß er im transitiven Sinne mein Ich ist: Ich
ist der andere, es gibt eine imaginäre Übereinstimmung zwischen i(a) und i'(a), zwischen Ichlibido
(Libido zum eigenen Körper) und Objektlibido (insofern das das Objekt der andere ist).“[Adam, S.46],
sowie Braun (2007), S. 38: „Die sich aufdrängende Frage, wie der Unterschied, zwischen sich und dem
anderen bzw. zwischen dem Ich und dem Bild vom anderen, i(a) geartet ist, beantwortet Lacan dahin
gehend, daß eben die Beobachtung des Transitivismus lehrt, daß Kinder zwischen sich und dem
Spielgefährten zunächst keinen Unterschied machen“.
143Vgl. Adam (2006), S. 52: „Lacan hat in seiner Darlegung des Spiegelstadiums gezeigt, wie es dazu
kommt, dass das Subjekt ein vorgängig-substanzhaftes Ich supponiert, das durch das Spiegelbild
lediglich abgebildet werde. Tatsächlich aber gibt es nur die ursprüngliche Bildwahrnehmung, von der aus
der (Trug)Schluss auf ein zugrundeliegendes Ich gemacht wird. Dem Bild jedoch liegt nichts
Substanzielles zugrunde, das ihm entspräche, wovon es Abbild wäre; das substanzhafte Hypokeimenon
ist etwas Eingebildetes. Das Subjekt imaginiert sich somit als Einheit gerade dort, wo es nicht ist.“
144Vgl. Braun (2007), S.39.
145Vgl. ders., S.38.
146Vgl. Lacan (1990), S.182-3.
147Jarman-Ivens (2011), S.32.
44
Identifikation werde ich in dieser Arbeit als Begriff für eine spiegelhafte Vermischung von
hörender und sprechender bzw. singender Position verwenden. Während Jarman-Ivens in
ihrer Untersuchung queerer Stimmen dieses Oszillieren als einen subversiven Ansatzpunkt
für Queerness und Instabilität ansieht,148 will ich in meinen Musikanalysen die einer
Stimme eingeschriebenen Möglichkeiten zur Identifikation genauer untersuchen. Die im
Stimmklang enthaltene (Un-)Möglichkeit zur Identifikation wird dabei im Folgenden ein
relevanter Faktor für eine nach Geschlecht differenzierende Struktur im Klang von
Popmusik werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es mit der Psychoanalyse möglich erscheint
verschiedene unbewusste Prozesse, die möglicherweise im Hören von Musik eine Rolle
spielen, näher zu bezeichnen und gegeneinander abzugrenzen. Grundsätzlich möchte ich
dabei noch auf die Position der Stimme an der Grenze zwischen Körper und Sprache
hinweisen:
„The voice is the side of perhaps one of the most radical of all subjective divisions – the
division between meaning and materiality. […] The sounds the voice makes always exceed
signification to some degree, both before the entry into language and after. The voice is never
completly standardized, forever retaining an individual flavour or texture.“149
Diese beiden Funktionen, die die Stimme sowohl in Beziehung zum eher sprachlich
organisierten Subjekt wie zum Körper oder, anders gesagt, zum symbolischen
Allgemeinen und zum Individuellen des Stimmklangs, setzen, lassen es sinnvoll
erscheinen die körperlichen Aspekte des Stimmklangs näher zu untersuchen. Im
Folgenden möchte ich mich also mit der körperlichen Klangerzeugung auseinandersetzen.
3.2 Körperliche Klangproduktion: Die Stimme
Nachdem ich in meiner bisherigen Entwicklung von Werkzeugen bereits mehrmals dem
Körper als Entstehungsort der Stimme begegnet bin, möchte ich nun diese körperliche
Klangproduktion näher betrachten.150 Diese Betrachtung wird auch eine begriffliche Basis
für die Differenzierung der gehörten Stimmklänge liefern.
Da ich davon ausgehe, dass der_die Leser_in nicht notwendigerweise mit den akustischen
Grundlagen der Schallerzeugung und dem recht technischen Vokabular von Phonetik und
148Vgl. dies., S.33-37
149Silverman (1988)., S.44.
150Dabei lässt sich auch die Physik als ein Modell begreifen, das versucht die Realität abzubilden und sie so
zugleich konstruiert. Auch Atomkerne sind so gesehen wie Dispositive: nichts anderes als ein kulturell
produziertes Modell zum Verständnis und Umgang mit der Wirklichkeit.
45
Sprachwissenschaften vertraut ist, versuche ich hier, die Prozesse menschlicher
Lautbildung möglichst einfach zu erklären und auf Fachbegriffe weitgehend zu verzichten.
Soweit ich diese dennoch für notwendig halte, bemühe ich mich um eine leicht
nachvollziehbare Erklärung. Zur beispielhaften Beschreibung werde ich dabei häufig auf
den Klang von Buchstaben oder Worten verweisen, die ich für allgemein verständlicher
halte als die streng genommen korrektere Phonemschrift. Außerdem beschränke ich mich
auf dasjenige, was mir für das Verständnis meiner auf die Stimme fokussierenden
Musikanalysen wichtig erscheint.
Klang ist, physikalisch betrachtet, bewegte Luft, deren Bewegung sich als eine Summe
einzelner Sinusschwingungen mit unterschiedlichen Frequenzen und unterschiedlicher
Lautstärke [=Amplitude] verstehen lässt. Dabei sind Frequenzen etwa zwischen 20 Hz und
20.000 Hz für das menschliche Gehör wahrnehmbar. Diese Luftbewegungen lassen sich
grundsätzlich in harmonisch, d.h. alle enthaltenen Frequenzen [=Obertöne] sind ein
ganzzahliges Vielfaches der tiefsten Schwingung [=Grundfrequenz], und rauschhaft, d.h.
es gibt keine regelmäßige Struktur im Frequenzspektrum, unterteilen. Von der
menschlichen Stimme werden sowohl harmonische Klänge (Vokale und Nasale) als auch
rauschhafte (viele Konsonanten) produziert, sowie außerdem Mischklänge, wie
stimmhafte Konsonanten (W, J, ...), die sowohl harmonische als auch rauschhafte Anteile
haben.
Eine Aufschlüsselung aller in einem Klang enthaltenen Frequenzen mit zugehöriger
Lautstärke wird Frequenzspektrum genannt. Das Frequenzspektrum kann in bestimmten
Frequenzbereichen besonders laut und in anderen besonders schwach sein. Die
Ausprägung solcher Maxima und Minima [=Hüllkurve] im Frequenzspektrum ist
verantwortlich für die klanglichen Unterschiede zwischen einzelnen Vokalen (zwischen A
und O zum Beispiel) oder unterschiedlichen Rauschklängen (SCH, F und CH151).
Im menschlichen Körper, der diese unterschiedlichen Klänge produziert, bietet es sich an,
zwischen primärer Klangerzeugung und Resonanz- bzw. Filtereffekten zu differenzieren:
In der primären Schallerzeugung ist für die musikalische Klangerzeugung wohl die Glottis
[oder auch Stimmlippen] am relevantesten. Eigentlich jeder harmonische Klang152 wird
151Wie in „ich“. Die Buchstabenkombination „CH“ bezeichnet im Deutschen nicht nur einen sondern zwei
Laute, die ich jeweils mit Verweis auf die Worte „ich“ und „ach“ differenzieren werde.
152Es gibt darüber hinaus weitere Formen harmonischer menschlicher Lauterzeugung, beispielsweise das
Pfeifen, Bauchreden, etc., die jedoch für meine Analysen keine weitere Rolle spielen werden und bei
denen sich jeweils fragen lässt, ob diese unter dem Begriff „Stimme“ zu fassen sind.
46
von den Stimmlippen erzeugt, die durch periodisches Verschließen und Öffnen der
Luftröhre in der Lage sind eine regelmäßige harmonische Schwingung, also einen
Grundton mit Obertönen, zu produzieren. Diese periodische Schwingung wird dabei nicht
durch Muskeln, sondern durch den Luftstrom selbst erzeugt: Durch einen Überdruck
werden die Stimmlippen geöffnet und einen durch die Strömung der Luft entstehenden
Unterdruck153 wieder verschlossen. Mit Muskeln lässt sich jedoch die longitudinale
Spannung der Stimmlippen und damit deren Trägheit und Abstand zueinander
beeinflussen, wodurch es möglich ist, die Tonhöhe zu kontrollieren.154
Das so erzeugte Obertonspektrum wird physikalisch gerne mit einer Sägezahnwelle
verglichen; diese hat ein vollständiges harmonisches Obertonspektrum, wobei die
Obertöne nach oben hin an Lautstärke abnehmen. Allerdings ist dies nur eine idealisierte
Abstraktion und das konkrete erzeugte Spektrum hängt von der Tonhöhe ab, sowie vom
spezifischen Einsatz der Stimmlippen, wie ich weiter unten erklären werde.
Während die Sprechstimme dabei vor allem die Tonhöhen im unteren Drittel des
Tonumfangs [=Ambitus155] verwendet, da hier Eigenresonanzfrequenz der Glottis liegt,
also der Bereich an dem mit der geringsten Energie der lauteste Klang erzeugt werden
kann, wird im Gesang ein weitaus größeres Tonspektrum verwendet. Der bei Männern 156
in der Pubertät stärker wachsende Kehlkopf führt zur Ausbildung einer deutlich tieferen
Stimme, so dass die tiefsten von Männern gesungenen und gesprochenen Frequenzen
durchschnittlich knapp eine Oktave tiefer liegen als bei Frauen. Dieser Unterschied ist
dabei vor allem bei der Sprechstimme relevant.
Der Kommunikationswissenschaftler Joachim Neppert gibt in „Elemente einer
Akustischen Phonetik“ bei Frauen eine Sprechgrundfrequenz von 190 bis 250 Hz an, was
etwa den Tönen fis157 bis c' entspricht, und bei Männern von 100 bis 150 Hz, was etwa Gis
153Physikalisch ist dies der Bernoulli Effekt: Der Luftstrom ist in der durch die Glottis gebildeten
Verengung der Luftröhre schneller, produziert so einen Unterdruck und zieht die Seiten der Glottis, also
die Stimmlippen wieder zusammen. Vgl. Hierzu: Neppert (1999), S.119 ff.
154Außerdem hat aber auch der Luftdruck Anteil an der Tonhöhe, so dass bei gleicher Spannung der
Stimmlippen, aber unterschiedlichem Luftdruck unterschiedlich hohe Töne erzeugt werden können. Vgl.
ders., S.121.
155Ambitus bezeichnet den Tonumfang, also den Abstand vom tiefsten zum höchsten Ton. Dies kann sich
auf die Möglichkeiten der Singstimme ebenso beziehen, wie auf die Melodie eines Musikstückes.
156In Ermangelung besserer Begriffe spreche ich in diesem Abschnitt von Männern und Frauen als
physiologische Kategorien. Diese lassen sich in diesem Abschnitt als zwei verschiedene Typen
durchschnittlicher Werte von Körper- und Kehlkopfgröße verstehen deren kulturelle Bedeutung im
Klang ich im Folgenden untersuchen werde.
157Ich verwende Tonbuchstaben zur Beschreibung absoluter Tonhöhen, da diese im
musikwissenschaftlichen Kontext vertrauter sind als Frequenzangaben. Eine gute Darstellung der
Beziehung von Tonbuchstaben und Frequenzen ist: www.sengpielaudio.com/Rechner-notennamen.htm
47
bis d entspricht.158 Da zur Bestimmung des Abstands zwischen Frequenzen nicht die
Differenz sondern das Verhältnis gemessen werden muss, ist diese Abweichung (knapp
2:1) sehr auffällig und ein insbesondere bei der Sprechstimme deutliches akustisches
Geschlechtsmerkmal.
Ein weiterer Unterschied zwischen Sprech- und Singstimme besteht in der Kontrolle der
Tonhöhe, die in der Sprechstimme kontinuierlich variiert, während sie im Gesang zeitlich
auf einzelnen Tonhöhen konstant bleibt. Notwendig hierfür ist neben der kontrollierten
Spannung der Glottis auch die Kontrolle des Luftstroms. In der Gesangspraxis wird hier
von Stütze gesprochen, was einen möglichst konstanten stabilen Luftdruck unterhalb der
Stimmlippen bezeichnet. Dieser Luftdruck wird unterhalb der Lunge mit Hilfe einer nach
unten gerichteten Spannung des Zwerchfells erreicht, die eigentlich für das Einatmen
typisch ist, aber beim Singen auch beim Ausatmen beibehalten wird. 159 Dadurch kann die
Luft langsam gleichmäßig und über einen relativ langen Zeitraum entweichen, was den
von der Glottis produzierten Ton stabilisiert.
Im unteren Bereich des Tonumfangs schwingen dabei die gesamten Stimmlippen voll,
d.h., dass die in den Stimmlippen enthaltenen Muskeln mit ihrer relativ großen Masse in
entspanntem Zustand am periodischen Öffnen und Schließen beteiligt sind, bei höheren
Tönen sind aber nur noch Teile der Stimmlippen an der Schwingung beteiligt, da sich die
Muskeln nach und nach anspannen und dann nicht mehr frei schwingen, bis sich
schließlich nur noch die Schleimhäute der Stimmlippen ohne das darunter liegende
Gewebe bewegen.160 Die Unterschiede zwischen diesen einzelnen Einstellungen der
Glottis sind dabei beeinflussbar und durchaus hörbar: Die Vollschwingung ist durch einen
vollen obertonreichen Klang gekennzeichnet, während die Randschwingung der
Schleimhäute vor allem den Grundton ohne viele Obertöne produziert. 161 Wegen ihres
klanglichen Unterschieds werden sie als Stimmregister differenziert und mit den etwas
irreführenden Begriffen Kopf-, Mittel- und Bruststimme bezeichnet. 162
158Neppert (1999) S.125.
159Vgl. Göpfert (2002), S.96.
160Vgl. Barth in Haefliger (1993), S.65f sowie Göpfert (2002), S.135.
161Vgl. Göpfert (2002), S.135.
162Die Bezeichnungen der Register ist in der Musikpraxis nicht einheitlich: Insbesondere gibt es
Unterschiede in der Bezeichnung zwischen Männer und Frauenstimmen, sowie Uneinheitlichkeit
insbesondere bei der Verwendung des Begriffs Falsettstimme bei Männern, der sowohl für das
Pfeifregister (oberhalb der Kopfstimme), als auch für die Kopfstimme bei Männern verwendet wird [Vgl
Göpfert, S.138]. Ich stelle die Begriffe hier so vor, wie ich sie im Folgenden verwenden werde. Dabei ist
eine einheitliche Begrifflichkeit vor allem notwendig, da männliche und weibliche Stimmen im
Folgenden miteinander verglichen werden sollen. Die von mir verwendeten Begriffe stützen sich auf eine
Systematik der körperlichen Prozesse, die für beide Geschlechter weitgehend analog angenommen
werden.
48
Die sogenannte klassische Gesangsausbildung, die sich am Repertoire von Oper und
Kirchenmusik orientiert, strebt dabei im allgemeinen danach, die Übergänge zwischen den
einzelnen Bereichen möglichst unhörbar zu machen, so dass mit viel Übung schließlich
nur ein einziges möglichst bruchloses Stimmregister entsteht.163 In der Popmusik werden
die Unterschiede zwischen den einzelnen Registern jedoch, wie wir sehen werden, oft
deutlich hörbar eingesetzt und die Kontraste zwischen Brust-, Mittel- und Kopfstimme als
musikalische Stilmittel verwendet. Es ist daher notwendig, sich die Lagen dieser
Übergänge zu vergegenwärtigen: Der Wechsel von einem Register in ein anderes
geschieht dabei nicht immer auf demselben Ton sondern ist steuerbar. Die Vollschwingung
bzw. das Brustregister endet für Männer zwischen H und f, bei Frauen eine Oktave höher
zwischen h und f'.'164 Eine reine Randschwingung, bzw. das Kopfregister, tritt bei Frauen
bei Tönen höher als es'' bis f'', bei Männern eine Oktave tiefer ab es' bis f' auf.
Die Glottis kann aber auch andere Geräusche als harmonische Töne erzeugen. Hierfür ist
es notwendig zu verstehen, dass die Stimmlippen nicht nur longitudinal angespannt
werden können, sondern auch das Öffnen und Schließen der Stimmlippen, sowohl durch
Muskeln als auch durch bewegliche Knorpelstücke, im Kehlkopf kontrolliert werden
kann.165 Hierdurch gibt es mehrere Möglichkeiten der Stimmgebung, beispielsweise die
Flüsterstimme, bei der durch das sogenannte Flüsterdreieck 166 gesprochen wird und kein
periodisches Öffnen und Schließen stattfindet, so dass das Flüstern nur aus einem
Rauschen besteht. Indem die Stimmlippen andererseits leicht offen gehalten werden und
somit bei der Klangerzeugung nicht vollständig schließen, wird der harmonische Anteil
gedämpft und mit einem Rauschen ergänzt. Diese Stimmgebung wird in der Phonetik als
„behaucht“ bezeichnet.
Weiterhin kann die Glottis die sogenannte „Knarrstimme“ erzeugen: Klanglich ist dies
tatsächlich mit dem Knarren einer Tür vergleichbar. Dieser wird erzeugt, indem die Glottis
verschlossen wird, die Stimmlippen jedoch zugleich longitudinal relativ entspannt bleiben,
so dass sie mit relativ wenig Luft bewegt werden können. Dabei entsteht ein nur teilweise
periodisches Geräusch, das mitunter Schwingungsanteile weit unter dem eigentlichen
Ambitus der Stimme enthält und kein harmonisches Spektrum enthält.167
163Vgl. Göpfert (2002), S.136.
164Vgl. ders., S.141.
165Eine sehr ausführliche Darstellung der Funktionsweise der Glottis und der verschiedenen möglichen
Stimmgebungen findet sich bei Kienast (2002), S.18ff.
166Vgl. dies., S.20.
167Vgl. dies., S.21.
49
Die menschliche Stimme kann jedoch noch an anderen Stellen Geräusche erzeugen,
beispielsweise hinter den Zähnen, mit der Zunge am Gaumen oder im Rachen. Dort ist es
jeweils möglich eine Enge zu bilden, die dann zu Luftverwirbelungen führt, was ein
rauschhaftes Frequenzspektrum produziert.168 Obwohl das Spektrum eines Rauschens
zufällig ist, gibt es dabei hörbare Unterschiede je nach Erzeugungsort.
Außerdem ist es möglich, Geräusche durch ein Verschließen des Luftstroms und
anschließendes explosives Öffnen zu erzeugen,169 wodurch plosive Konsonanten (P, T, K,
B, ...) entstehen. Das dabei erzeugte Geräusch zeichnet sich durch ein einmaliges
plötzliches lautes Auftreten und schnelles Abschwellen aus.
Nachdem der menschliche Körper auf diese unterschiedlichen Weisen einen Klang erzeugt
hat, ist es ihm weiterhin möglich, dessen Frequenzspektrum zu verändern. Es ist hilfreich,
sich hierfür den menschlichen Körper als einen kontrollierbaren und äußerst komplizierten
Resonanzraum vorzustellen, der einzelne Frequenzbereiche verstärken und andere
dämpfen kann. Umso weiter vorne eine primäre Schallerzeugung stattfindet, desto
weniger ist sie jedoch veränderbar, d.h. ein an den Lippen oder Zähnen produziertes
Geräusch, wird kaum noch durch den Resonanzraum des Körpers verändert, während die
relativ weit hinten im Körper produzierten Klänge der Glottis recht starken akustischen
Veränderungen unterliegen.
Jeder Resonanzraum hat eine oder mehrere Resonanzfrequenzen, die er verstärkt, während
andere Frequenzbereiche gedämpft werden. Im menschlichen Körper gibt es viele
verschiedene differenzierbare Resonanzräume, beispielsweise im Brustraum und in den
verschiedenen Nebenhöhlen im Kopf, deren Mitschwingen mehr oder minder stark
kontrolliert werden kann. Die schon erwähnten Begriffe Brust- und Kopfstimme beziehen
sich dabei auch auf das Mitschwingen dieser verschiedenen Resonanzräume, wobei der
Brustraum bei eher tiefen Frequenzen mitschwingt und diese verstärkt, während die
verschiedenen Hohlräume im Kopf mit je unterschiedlichen höheren Frequenzbereichen
resonieren. Die dabei verstärkten Frequenzbänder im Obertonspektrum werden Formanten
genannt. In der klassischen Gesangsausbildung wird dabei ein Mitschwingen möglichst
vieler dieser Räume angestrebt, da dies den Ton insgesamt verstärkt.
Besondere Bedeutung kommt jedoch dem Resonanzraum in Mund und Rachen zu, der an
der Glottis beginnt und an den Lippen endet, das sogenannte Ansatzrohr. Das Ansatzrohr
168Vgl. Neppert (1999), S.94f zum Friktionsrauschen.
169Vgl. ders., S.93f zum Explosionsschall.
50
lässt sich mit einem einseitig offenen Rohr vergleichen, in dem schwingende Luft
Resonanzfrequenzen mit einer Wellenlänge von jeweils ungradzahligen vielfachen der
vierfachen Länge des Ansatzrohres aufweist.170 Das menschliche Ansatzrohr wird von
Neppert mit 17,5 cm bei Männern und „15 % kürzer“ 171 (also ca. 14,875 cm) bei Frauen
angegeben, was zu Formantfrequenzen von 500 Hz, 1500 Hz, 2500 Hz 172 usw. bei
Männern und näherungsweise 600 Hz, 1800 Hz, 3000 Hz173 usw. bei Frauen führt.174 Für
Kinder liegen die Formanten, je nach Größe und Alter, nochmals deutlich höher.
Etwa um diese Frequenzen herum werden also die von der Glottis erzeugten (Ober-)Töne
und Rauschfrequenzen verstärkt, während andere Frequenzen gedämpft werden. Die
Resonanzfrequenzen des Ansatzrohres sind individuell verschieden, aber für den einzelnen
Menschen konstant, da sie von der Anatomie abhängen.175
Diese Konstanz ist allerdings nur relativ, denn wir sind in der Lage zumindest die unteren
beiden Formanten, durch Verengungen an verschiedenen Orten des Ansatzrohres nach
oben oder unten zu verschieben, sowie durch Bewegung der Lippen und des Kehlkopfes
das Ansatzrohr insgesamt leicht zu verkürzen oder zu verlängern. Diese Verschiebungen
sind für die Sprache äußerst relevant, da sie die Klangfarben der einzelnen Vokale
produzieren: Ein stark nach oben verschobener zweiter und stark nach unten verschobener
erster Formant erzeugt beispielsweise ein I, ein nach unten verschobener zweiter und nach
oben verschobener erster Formant erzeugt ein A.176 Bleiben die beiden Formanten
unverändert, entsteht ein Vokal zwischen E, Ä und Ö.
170Vgl. ders., S.129ff: Die Resonanzfrequenzen sind außerdem von der Schallgeschwindigkeit, und damit
vom Luftdruck abhängig. Der hier beschriebene physikalische Prozess ist eventuell vertraut von
bestimmten Flöteninstrumenten, beispielsweise Klarinetten oder gedackten Orgelpfeifen [vgl. Briner
(2003), S.142ff. und S.200].
171Neppert (1999), S.132. Neppert setzt an viele Stellen die männliche Stimme als Norm und dann
weibliche und Kinderstimmen als entsprechende Abweichungen in Relation. Eine durchaus
kritikwürdige Praxis.
172Entspricht ca. h', fis''' und dis''''.
173Entspricht ca. d'', a''' und fis''''
174Die Formel für die Frequenz f ist: ungeradzahliges Vielfaches der Schallgeschwindigkeit (c) dividiert
durch die vierfache Länge (L) des Ansatzrohres: (2n-1)c/4L =f. Bei Körpertemperatur wird bei Neppert
eine Schallgeschwindigkeit von 350 m/s angegeben.
175Die bei Neppert praktizierte Zweiteilung in Geschlechter erscheint mir dabei an dieser Stelle weniger
relevant als beim Tonumfang der Glottis: Insgesamt stehen die Resonanzfrequenzen mit der Körper- und
Kopfgröße in Bezug. Durchschnittlich liegen sie wahrscheinlich bei Frauen vor allem deshalb etwas
höher, weil diese körperlich im Durchschnitt etwas kleiner sind. Der durchschnittliche Unterschied ist
außerdem hier außerdem deutlich geringer als bei der Sprechtonlage: Während der Abstand zwischen
den Sprechtonlagen knapp einer Oktave entspricht, liegen die beiden ersten Formanten mit 500Hz bzw.
600 Hz, entsprechend etwa ein h' (=494 Hz) bzw. einem Ton zwischen d''(=587Hz) und dis''(=622Hz),
nur etwas mehr als eine kleine Terz auseinander.
176Vgl. Neppert (1999), S.134.
51
Bisher habe ich vor allem die für die Produktion von phonetischen Lauten, also der
akustischen Entsprechung von Buchstaben, und Tönen relevanten Funktionen der Stimme
beschrieben. Darüber hinaus liefert die Stimme jedoch noch eine Vielzahl weiterer
Informationen; akustische Informationen zu Geschlecht und Körpergröße habe ich hier
bereits erwähnt. Außerdem liefert die Stimme über die Atmung, den sich auf die
Formantstruktur von Vokalen auswirkenden Gesichtsausdruck177 und die hörbaren
Resultate der An- oder Entspannung verschiedener Muskeln insbesondere in und um
Hals, Mund, Nase, Rachen und Brustkorb Informationen über den körperlichen und
emotionalen Zustand der_des Sprecher_in.178
Bisher vorliegende Untersuchungen zu Emotion und Stimme beziehen sich, soweit mir
bekannt, ausschließlich auf die Sprechstimme. Untersuchungen von emotionalem
Ausdruck in Gesang scheinen bisher nicht vorzuliegen und eine Übertragung ist, da beim
Gesang nicht (nur) die sprachliche Verständigung, sondern insbesondere der Klang der
Stimme im Fokus der bewussten Beeinflussung steht, durchaus problematisch. Dennoch
halte ich die Ergebnisse analytischer Betrachtungen emotionaler Sprechweisen für
hilfreiche Anhaltspunkte, um nicht einer Singstimme eine bestimmte Emotion
zuzuschreiben, sondern anders herum ein in dieser Stimme wahrgenommenes Gefühl auf
bestimmte
klangliche
Charakteristika
zurückzuführen,
sowie
über
diese
Klangcharakteristika körperliche Zustände, beispielsweise die Anspannung bestimmter
Muskelbereiche, identifizieren und belegen zu können.
Schließlich muss für die Analyse von Stimmen in Popsongs berücksichtigt werden, dass
der Klang dieser Stimmen nicht nur durch den sie erzeugenden menschlichen Körper,
sondern auch durch Aufnahme- und Klangbearbeitungstechnologien geprägt ist. Es sollte
dabei klar sein, dass jede Aufnahme auch, wenn sie natürlich erscheint, eine Veränderung
des Klangs bedeutet. Es gibt aber auch auffällig hörbare Bearbeitungen, wobei ich davon
ausgehe, dass sich auch auf dieser Ebene Geschlechterunterschiede feststellen lassen.
Dabei erscheint mir das Bezeichnen der verwendeten Effekte und Geräte (Delay,
Dopplung, Vocoder, Filter, Kompression) weniger sinnvoll, als das möglichst genaue
177Beispielsweise die beim Lächeln eingesetzte Spreizung der Lippen sorgt für ein Ansteigen des zweiten
Formanten, ähnlich dem Vokal I. Vgl. Kienast (2002), S.131.
178Miriam Kienast beschäftigt sich insgesamt mit den hörbaren Auswirkungen von Emotionen. Einen guten
Überblick liefert sie in ihrem dritten Kapitel [Vgl. Kienast (2002) S.17-39]. Die Notwendigkeit einer
geraden Körperhaltung, die in manchen Gesangsschulen betont wird, legt außerdem nahe, dass über den
Klang der Stimme Rückschlüsse auf diese möglich sind. Vgl Haeflinger (1993), S.109ff und Göpfert
(1988), S.94.
52
Beschreiben des akustischen Eindrucks (distant, hallig, gedämpft ect.), da dieser zum
einen leichter nachvollziehbar ist, und zum anderen, da die akustische Bearbeitung jeweils
zu einem Zweck eingesetzt wird, dem ich mit meinen Analysen auf die Spur kommen
möchte. Da mein Thema dabei der erzeugte Eindruck eines fertigen kulturellen Artefaktes
ist und nicht die technologischen Werkzeuge, die zu dessen Erzeugung eingesetzt wurden,
erscheint mir dieses Vorgehen stimmig.
53
4. Analysen
Nach dieser umfangreichen theoretischen Einführung möchte ich in diesem Abschnitt die
dargestellten Mittel zur Musikanalyse anwenden und eigene Thesen zu popmusikalischen
Inszenierungen von Männlich- und Weiblichkeit anhand von Musikbeispielen entwickeln.
Meine Auswahl basiert dabei auf einem persönlichen Eindruck, den ich vor allem aus
Radioprogrammen (Spreeradio, BBRadio, FluxFM jeweils als Internetradio) gewonnen
habe. Dabei erschienen mir bestimmte Muster sehr verbreitet, für die ich im Folgenden
mir typisch erscheinende Beispiele zur näheren Untersuchung gewählt habe.
Ich arbeite dabei in zwei Teilen, wobei ich mit der Darstellung von Sängern[sic] beginne,
da ich denke, dass diese auch in der Popmusik eine Norm definieren. Die musikalischen
Darstellungen von Frauen funktionieren, wie ich zeigen möchte, vor diesem Hintergrund
als Abweichungen, als Andere im beauvoirschen Sinne.
Meine Thesen sind als ein Modell zu verstehen, das versucht die Beziehungen zwischen
verschiedenen klanglichen Darstellungen in der Popmusik abzubilden und zu deuten. Ich
denke dabei nicht, dass sämtliche Popmusik sich in meinem Modell erschließen lässt; ich
habe jedoch versucht, vor allem dasjenige zu beschreiben, was ich als normative
Klangdarstellungen empfinde. Meine Annahme normativer Klangdarstellungen bedeutet,
dass andere Darstellungen möglich sind, aber auch, dass diese anderen Darstellungen nicht
unabhängig sind. Sie stehen mit den normativen in (einer wahrscheinlich negativen)
Beziehung. Es ist aber zu beachten, dass diese Arbeit anhand weniger Songs nur eine erste
möglichst konkrete These entwickelt, die durch weitere Beispiele aus der Popmusik
bestätigt, verändert oder widerlegt werden müsste.
Um den Nachvollzug meiner Analysen zu erleichtern, befinden sich im Anhang jeweils am
Text orientierte kurze formale Übersichten der Songs. Diese sind dabei nicht als eigener
Analyseschritt zu fassen, sondern sollen lediglich als visuelle Stützen dienen, um die von
mir bezeichneten Details schneller im Klang zu finden.
Außerdem erscheint es mir sinnvoll, kurz die von mir zur Analyse verwendete Technik zu
beschreiben: Alle analysierten Songs wurden von mir im MP3-Format verwendet und über
Kopfhörer (AKG K530, weiß) von meinem Laptop (lenovo ThinkPad X200 mit dem
54
Abspielprogramm Audacious) ohne jede Veränderung der Equalizer- oder anderer
Voreinstellungen abgehört. Ich gehe davon aus, dass alle von mir gemachten
Beobachtungen auch über andere Abspielsysteme nachvollziehbar sind, habe aber schon
die Erfahrung gemacht, dass unter ungünstigen Bedingungen, z.B. große kahle Räume,
Störgeräusche, PC-Boxen, Kopfhörer mit sehr eingeschränktem Frequenzbereich oder
Geräte mit speziellen an anderem akustischen Material orientierten Voreinstellungen, der
akustische Eindruck sehr verfälscht werden kann, so dass mitunter Details verschwinden
oder nur sehr schwer auszumachen sind.
4.1 Die „echte“ Stimme
Die der Einleitung vorangestellten Zitate suggerieren, dass es in der Popmusik eine
Beziehung zwischen Echtheit oder Authentizität und Männlichkeit gibt. Diese möchte ich
nun auf der musikalischen Ebene näher betrachten. Ich werde hierbei der Frage
nachgehen, was auf der Ebene des Klangs genau mit „Echtheit“ gemeint ist und wie diese
in der Musik entsteht.
Hierzu möchte ich nochmals ein paar theoretische Quellen betrachten, die dem
Zusammenhang von Klang und „Authentizität“ formulieren. Dabei ist Authentizität als ein
ideologischer Wert des Popmusikdispositivs zu verstehen, der sich vor allem in den
populären Auseinandersetzungen über Popmusik entfaltet. Terry Bloomfield beschreibt
dies etwas polemisch, aber für meine Zwecke gut geeignet, folgendermaßen:
„The illusion of the availability of the singer as artist is spelt out - when it is acknowledged at
all - as an ideology of authenticity. It is a discourse that takes over key elements of
Romanticism to structure the listener's common sense into a (naive-)realist (proto)theory of
song production and consumption. To list its main components:
(1) the singer reflects on personal experience that resonates with emotion,
(2) embodies the results of that reflection in a musico-narrative form,
(3) delivers a performance of (2) which serves to bring out fully its (inner) meaning. The
process is complete when
(4) the listener reads this emotional meaning by bringing his or her personal experience to
bear on the performance. “179
Der_die Sänger_in präsentiert also in der Musik einen emotionalen Inhalt. Der Popsong ist
in diesem Denken folglich eine Form emotionaler Kommunikation, in der Gefühle
der_des Sänger_in zum Publikum transportiert werden.
179Bloomfield (1993), S.17.
55
In diesem Kommunikationsmodell entsteht so die Möglichkeit, dass Musik wahr oder
falsch, bzw. echt oder unecht sein kann. Die Musik tritt dabei in eine Beziehung zu einer
Realität, die sie angeblich wahrheitsgemäß abbildet.
David Pattie stellt in seinem Aufsatz „4 Real: Authenticity, Performance, and Rock
Music“ dar, dass diese Wahrheit vor allem in der Musik konstruiert wird. Er erklärt:
„[A] standard rock trope: the music contains within itself a pre-existing truth, and that it is the
task of both performer and audience to rediscover and re-express that truth. The music, or
rather the myth constructed around the music, is the fixed element in an otherwise infinitely
transformable set of relations between the star and the audience. [...] in rock music [...] both
the audience and the performer look to the music to provide the ultimate validation, the
ultimate proof of authenticity. It is as though the music itself contains, beyond the meanings
attached to a particular chord structure and rhythm, a single set of lyrics or a specific delivery,
the ability to organise the audience’s and the star’s perception of it as inherently truthful.“180
Diese besondere authentische Wirkung von Musik lokalisiert Pattie in der durch die Musik
hergestellten Erfahrung („experience“181), die er als eine intime Erfahrung der Nähe, ja der
„communion“,182 mit dem Rocksänger[sic] beschreibt.183 Diese Vereinigung von Publikum
und Performer[sic], „where the boundary between the performer and the audience no
longer seems to exist“,184 wird dabei durch den Körper des Sängers[sic] ermöglicht. Pattie
stellt dies am Beispiel Richard Ashcrofts mit Verweis auf eine Konzertkritik dar:
„he (and the audience alongside him) sings with his eyes closed, his head thrown back, his
«throat muscles tense with the sweet pain of singing.»“185 [meine Hervorhebungen]
Pattie geht leider auf diesen körperlichen Einsatz in der Präsentation der Musik nicht
explizit ein (obwohl er in seinem Text weitere und noch extremere Beispiele
selbstzerstörerischen Körpereinsatzes als Garant für Authentizität liefert), ich halte diesen
jedoch für äußerst relevant für die Konstruktion musikalischer Wahrheit, denn er stellt die
scheinbar unmittelbare Beziehung zwischen dem Körperinnern des Sängers[sic], das ja im
Song ausgedrückt bzw. abgebildet werden soll, und dem Inhalt des Songs her.
Für die dabei entstehende besondere Erfahrung der Gemeinschaft mit dem Sänger[sic]
möchte ich den Begriff der Identifikation von Jarman-Ivens verwenden: Das Publikum
identifiziert sich mit dieser extrem körperlichen Stimme („throat muscles tense“), so dass
180Pattie (1999), Abschnitt 2, Absatz 5.
181Ders., Abschnitt 3, Absatz 7 und Absatz 9.
182Vgl. ders., Abschnitt 3, Absatz 16.
183Vgl. ders., Abschnitt 3, Absatz 9:„ it is profoundly private: we [...] share this experience with Richard
[Ashcroft]“
184Ders., Abschnitt 3, Absatz 8.
185Ders., Abschnitt 3, Absatz 9.
56
sogar die Grenze zwischen Richard Ashcroft und dem Publikum kurzzeitig aufgehoben zu
sein scheint.
Da dieser Körpereinsatz hörbar ist, muss er sich auch im Klang identifizieren und
analysieren lassen. Besonders körperliche Klänge halte ich dabei für klangliche
Einladungen zu einer solchen Identifikation mit der Stimme, die auch eine Identifikation
mit dem Körper darstellt, der diese Stimme produziert.
Dabei sollte allerdings nicht vergessen werden, dass diese Authentizität und die Idee einer
musikalischen Wahrheit eigentlich kulturelle Konstruktionen sind. Beispielsweise
argumentiert Simon Frith:
„Der wohl irreführendste Terminus in der Kulturtheorie ist «Authentizität». Was zu
untersuchen ist, das ist nicht, wie «wahr» ein Musikstück in Bezug auf etwas anderes ist,
sondern wie es die Vorstellung von «Wahrheit» als Moment des Musikalischen überhaupt erst
hervorbringt“186
Authentizität ist demnach ein Mythos, ein Konstrukt, das aber die ästhetische Rezeption
der Popmusik strukturiert.
Ich möchte nun im Folgenden versuchen, diese Konstruktion von Echtheit im Klang von
einigen Männerstimmen genauer nachzuvollziehen. Hierzu werde ich die Präsentation der
Stimme in drei Songs, „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana, „Feel“ von Robbie
Williams und „Billie Jean“ von Michael Jackson analysieren.
4.1.1 Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“
Als erstes Beispiel betrachte ich nun „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana. Sehr schnell
fällt beim Hören des Songs eine erhebliche Rauheit in der Stimme 187 insbesondere im
Refrain auf. Dies meint hier ganz konkret eine Geräuschlastigkeit, die sich mit einem
klassischem Gesangsverständnis – dem Ideal einer eindeutigen Tonhöhe, mit rein
harmonischem Obertonspektrum, weichen Übergängen, ausgehaltenen Vokalen und der
klaren Verständlichkeit des Textes – nicht vereinbaren lässt. Recht deutlich lässt sich hier
hingegen hören, was Shepherd als „«cock» rock vocal sound“ beschrieben hat: „hard and
rasping […] produced overwhelmingly in the throat and mouth, with a minimum of
recourse to the resonating chambers of the chest and head.“188
186Frith (1992), Absatz 11.
187Dies ist nicht mit der „Rauheit der Stimme“ bei Roland Barthes zu verwechseln. Barthes Begriff des
Genogesangs scheint, so wie ich ihn verstehe, sowohl Teile dessen zu bezeichnen, was ich in dieser
Arbeit als semiotisch bezeichne, wie auch das Somatische. Ich habe ihn daher für meine Zwecke
verworfen, da er zu unbestimmt ist und genau die Einteilung nicht vornimmt, die mir in meinen
Betrachtungen wichtig erscheint [Vgl. Barthes (1990)].
188Shepherd (1991), S.167.
57
Dieser raue Klang des Rachens lässt sich vor allem an einem Reibelaut, phonetisch ein
uvularer (also im Rachen erzeugter) Frikativ, der sich klanglich als ein Geräusch zwischen
einem R und einem CH189 beschreiben lässt, erkennen. Im Song lässt sich dies sehr gut in
der Textstelle „A mulatto, An albino, A mosquito, My libido“ und beim wiederholten „a
denial“ am Ende des Songs hören, da alle diese Worte eigentlich kein R oder CH
enthalten, aber dennoch ständig eine entsprechende Reibung in der Stimme hörbar ist.
Der Effekt ist, wie schon erwähnt, sehr geräuschhaft, wodurch nicht nur das
Obertonspektrum mit harmoniefremden Frequenzen (=Rauschen) „verunreinigt“ wird,
sondern auch die Verständlichkeit der Worte erschwert wird. Um diesen Effekt zu erzielen,
ist eine dauernde Anspannung des Kehlkopfes erforderlich, 190 was diese Gesangstechnik
anstrengend macht, sie aber mehr noch äußerst angestrengt klingen lässt (wohingegen
klassische Gesangstechnik zwar ebenfalls anstrengend ist, aber danach strebt diese
Anstrengung zu verstecken und am Ende nicht hörbar zu machen.).
Ich möchte nun den Refrain etwas genauer untersuchen: Melodisch lässt sich der Refrain
in kurze sequenzartige191 Abschnitte unterteilen, die jeweils aus einer Tonwiederholung
mit anschließender absteigender Sekunde192 bestehen, aber auf unterschiedlichen
Tonhöhen beginnen. Jede zweite Sequenz beginnt dabei auf dem Spitzenton b: „it's less
dangerous“, „entertain us“, „and contagious“, „entertain us“, „An albino“ und „My
libido“. Diese wechseln sich mit tieferen Passagen, entweder zwischen as und f („with
the lights out“) oder etwas tiefer zwischen f und es („Here we are now“), ab. Während
Cobain in der Strophe und vor allem in der der Strophe folgenden Überleitung („Hello,
Hello, ...“) noch größtenteils recht entspannt und ruhig in eher tiefer Lage singt,193 springt
er im Refrain in ein relativ hohes Register, zwischen es und b,194 wobei er zugleich die
Lautstärke erhöht.
189Wie in „ach“.
190Vgl. Kienast (2002), S.22: „Strenggenommen handelt es sich bei der rauen Anregung nicht um einen
eigenen Phonationsmodus, sondern um eine Modifikationsweise der übrigen Phonationsarten.
Charakteristisch ist eine überstarke Anspannung aller im Kehlkopf wirkenden Muskeln, was zu einem
unperiodischen Anregungssignal führt, das starken Mikroperturbationen hinsichtlich Amplitude und
Frequenz unterworfen ist.“
191Mit Sequenz werden in der Musikanalyse aufeinanderfolgende kurze melodische Abschnitte bezeichnet,
die sich sehr ähneln. Oft sind es genau Wiederholungen auf unterschiedlichen Tonhöhen.
192Es sind bei den Passagen, die auf as beginnen („with the ligths out“ und „I feel stupid“), zwei
absteigende Sekunden, dadurch wird aber der sequenzartige Eindruck nicht gemindert.
193Der Ambitus reicht von G bis f.
194Kontrastiert wird die Vehemenz des hohen Registers bei „Here we are now“ sowie bei „A mosquito“ mit
einer anderen Stimmeinstellung, die eine Quarte tiefer (zwischen f und es) liegt als der übrige Refrain.
Dabei wird die starke Anspannung kurz aufgelöst (entspanntere Stimmlippen sowie weniger Luftdruck),
wodurch die jeweils nachfolgenden Passagen durch den Sprung nach oben und die plötzlich wieder
einsetzende Spannung besonders betont werden.
58
In den tiefsten Passagen des Refrains (zu „Here we are now“ und „A mosquito“) ist dabei
ein gewisses Flackern oder Flattern in der Stimme hörbar, vor allem beim R von „here“
und „are“, das ein wenig an Heiserkeit erinnert. Dieses Geräusch entsteht dabei ganz
offensichtlich im Rachen und hat damit klar im Innern des Körpers des Sängers[sic]
seinen Ursprung.
Die hohen Abschnitte des Refrains wirken dabei besonders rau, angestrengt und regelrecht
schmerzhaft. Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Cobain hier in einer Vollschwingung
bleibt und somit seine Bruststimme in einer Tonhöhe einsetzt, in der diese eigentlich nicht
mehr möglich ist, bzw. als stimmschädigend gilt und von Bernd Göpfert sogar als
„gewaltsam“ benannt wird.195 Aber auch der hohe Luftdruck, mit dem dieser schreiende
laute Klang im Refrain erzeugt wird, kann für diesen schmerzhaften Eindruck
verantwortlich sein, da auch dieser mit Stimmschädigungen in Beziehung gesetzt wird.196
Cobain scheint hier also mit vollem Körpereinsatz für seine Mitteilung und gegen die
zugleich intensivierte Lautstärke der Band zu kämpfen. Er scheint sich dabei regelrecht
selbst zu verletzen.
Ein ähnlicher Eindruck entsteht auch bei hohen Tönen in der Strophe, beispielsweise bei
„bring“, „over bored“, „I“, „little“, obwohl diese etwas tiefer sind als die Spitzentöne im
Refrain. Auffällig ist beim Stimmeinsatz in der Strophe außerdem das kurze Abgleiten der
Stimme in die Kopfstimme, jeweils kurz vor Ende der ersten beiden Strophen bei „Oh
no“197 und „And al-“. Dies erinnert regelrecht an ein Aufheulen und erscheint
unkontrolliert, wie ein Ausrutschen der Stimme, obwohl der Einsatz dieses Effekts jeweils
an derselben Stelle der Strophe nahelegt, dass dieser Stimmeffekt bewusst eingesetzt wird.
Zwar ist die Gesangstechnik in diesem Song damit noch nicht erschöpfend behandelt, aber
die bisher herausgestellten Details reichen aus, um daran einige Funktionsweisen dessen
zu erläutern, was ich als „echte“ Stimme bezeichnen möchte. Ich denke, es lässt sich
nachvollziehen, dass der Körper Kurt Cobains in seinem Gesang deutlich hörbar ist und
dass die innerkörperlichen Erzeugungsorte der Stimme im Klang präsent sind. Die Frage,
195Vgl. Göpfert (2002), S.140f: „Das isolierte Höherziehen des Brustregisters stellt einen gewaltsamen
stimmschädigenden Akt dar (Forcieren)“.
196Buchholz, S.7-8:„Ist der Luftdruck und damit die Luftmenge zu groß, arbeitet der SchildRingknorpelmuskel nicht. Damit „flattern“ die ungespannten Schleimhäute wie Fahnen im Sturm. Sie
können sich zunächst wund reiben, was zu Heiserkeit und Hustenreiz führt, da die Sekretproduktion der
Schleimdrüsen der Schleimhaut zunimmt. Bei dauernder und stärkerer Beanspruchung können die
Schleimhäute reißen und über die Vernarbung der Risse sogenannte Polypen bilden. Das führt dann zu
einer chronischen Heiserkeit, weil die Stimmritze nicht mehr richtig schließen kann.“
197Oder „and all“.
59
der ich hier nachgehen möchte, ist nun, was für ein Körper uns hier klanglich präsentiert
wird und in welcher Beziehung er zum Inhalt des Songs sowie zum Sänger[sic] als
Subjekt dieser Kommunikation steht.
Ich möchte nun zuerst den Inhalt des Songs lokalisieren. Ein solcher lässt sich kaum im
Text verorten, da dieser im Klang fast nicht verständlich ist. Stattdessen denke ich, dass
ein Inhalt vor allem im Klang der Stimme zu finden ist: Der Inhalt des Songs entsteht
gewissermaßen performativ durch die Vehemenz der Artikulation; er entsteht dadurch,
dass wir glauben, dass Kurt Cobain etwas, und zwar auch etwas wichtiges, mitzuteilen
haben muss, wenn er sich in dieser Weise körperlich dafür anstrengt.
Dieser Inhalt entsteht dabei performativ durch den zitierenden Rückgriff auf emotionale
Sprechweisen, durch die hörbare körperliche und emotionale Involviertheit. 198 Die
Unverständlichkeit des Textes unterstützt dabei die somatische, also körperlich-emotionale
Komponente, da sie einerseits hohe emotionale Erregung suggeriert und andererseits nicht
vom Klang der Stimme ablenkt. Schließlich ist gerade die Rauheit der Stimme, d.h. der
Rachenklang und das heisere Flackern in der Stimme, klangliches Moment, das deutlich
hörbar vor allem aus dem Innern des Körpers des Sängers[sic] stammt.
Dieser Inhalt steckt also nicht im Text, er ist keine Mitteilung im semantischen Sinne,
sondern eine Mitteilung des körperlichen Zustandes, eine somatische Mitteilung. Kurt
Cobain teilt uns somit auch nicht wirklich etwas über die Welt mit, sondern etwas über
seinen Körper.199 Cobain drückt damit nicht etwas aus, das außerhalb seiner selbst liegt;
die somatische Mitteilung ist im Gegensatz zum traditionellen Kommunikationsmodell
kein Etwas, kein Drittes, kein Zeichen. Sie ist im Körper, sie ist der Körper. Auf diesen
Körper wird in dieser Kommunikation nicht verwiesen, der Körper selbst wird in der
klanglichen Materialität mitgeteilt.
Voraussetzung hierfür ist allerdings die Annahme einer Gleichzeitigkeit von Empfindung
und Mitteilung derselben. Das singende Subjekt drückt also nicht etwas aus, was es zuvor
empfunden hat, was somit bereits vergangen ist und zu dem eine Distanz besteht, sondern
es transportiert unmittelbar nach draußen, was es gerade im Moment des Singens fühlt.
Dabei kann ich aber selbstverständlich keine Aussagen darüber treffen, was wirklich in
Cobains Körper passiert. Ich meine damit eher eine Annahme, die allerdings für das
198Vgl. Paeschke (2003), S.242-243.
199Unabhängig davon kann es einen Inhalt im Text, einen verbalen Inhalt, geben und dieser wird im
Normalfall mit der somatischen Mitteilung in Beziehung stehen. Außerdem ist es möglich, Cobains
somatische Präsentation auf einen persönlichen oder gesellschaftlichen Kontext zu projizieren, so dass
sie scheinbar eine Aussage enthält, die über seinen Körper hinaus geht und Allgemeinheit erhält, indem
Nirvana beispielsweise als Ausdruck einer ganzen Generation interpretiert wird.
60
Funktionieren dieser somatischen Kommunikation notwendig erscheint, da die
Aufführung sonst nicht mehr das Kriterium der Wahrheit erfüllen würde.
Mit diesem distanzlos präsentierten körperlichen Gefühl der somatischen Mitteilung kann
sich das Publikum, wie mit dem idealisierten Spiegelbild identifizieren, indem es
empathisch nachempfindet, was in der Stimme transportiert wird. Diese Identifikation200
verstehe ich als eine distanzlose Erfahrung, in dem Sinne, dass vor allem die von mir
erwähnten besonders körperlich erscheinenden Details des Gesangs für die hörenden
Subjekte zu kurzen Momenten einer beide Körper vereinigenden Erfahrung führen. Die in
der Stimme transportierten somatischen Informationen können dabei im eigenen Körper
nachempfunden werden und die gehörte Stimme kann damit nicht mehr klar vom eigenen
Körper getrennt werden. Der Körper des Sängers[sic] und der des_der Hörenden fallen für
einen Moment in eins.
Der Körper des Sängers[sic] ist dabei ein Produkt der Stimme, denn wir erhalten nur über
den Klang einen Eindruck von ihm. Allerdings entsteht eben nicht der Eindruck eines von
außen betrachtbaren Körpers, sondern eines von innen nachempfindbaren Leibs, im Sinne
Gabriele Kleins, zu dem die somatische Mitteilung keine Distanz zulässt.
Dabei lässt sich der gesamte Prozess als komplexe performative Produktion eines
körperlichen Subjekts im Sinne Butlers verstehen. So gesehen entsteht Cobain als Subjekt
erst durch die emotionale Mitteilung seiner Stimme. Er entsteht als authentisches Subjekt
durch die (scheinbare) Wahrheit seiner Mitteilung. Diese Wahrheit entsteht jedoch
wiederum – da sie sich nicht objektiv an etwas messen lässt – durch die emotionale
Involviertheit, die sich klanglich in den von mir erwähnten somatischen Informationen in
der Stimme wiederfinden lässt.
Ich möchte an dieser Stelle von einem somatischem Subjekt sprechen, einem Subjekt, das
sich performativ als fühlendes und innerkörperliches und weniger als denkendes und
sprechendes produziert – einem Subjekt, das notwendig in einem Körper verortet ist.
Körper und Subjekt lassen sich dabei jedoch eigentlich kaum trennen: Einzig die
Mitteilung als Handlung des Subjekts unterscheidet dieses von seinem Körper, so dass
eine diskursive Trennung möglich ist, obwohl es keine eigentliche Distanz zwischen
Körper und somatischem Subjekt gibt.
Durch die Mitteilung überschreitet das Subjekt allerdings seinen Körper, es richtet sich
nach außen auf das Publikum und wird eben dadurch Subjekt, dass es in, mit und
gegenüber dieser äußeren Welt agiert. Im analysierten Song lässt sich diese Intention
200Vgl. auch S.45 dieser Arbeit.
61
klanglich vor allem an der Vehemenz, also der hörbaren Anspannung und der scheinbar
selbstverletzenden Lautstärke, des Gesangs ablesen, der vor allem im Refrain regelrecht
darum zu kämpfen scheint, beim Publikum Gehör zu finden. Insbesondere die dabei gegen
den eigenen Körper gerichtete Kraft legt einen Willen nahe, die eigenen Empfindungen
mithilfe der Stimme über den eigenen Körper hinauszutragen.
Mit diesem Willen möchte ich nun auf einen letzten Aspekt eingehen, den ich im
Zusammenhang dieses Stimmklangs und der spiegelnden Identifikation mit diesem für
bedeutsam halte: Die intentionale Mitteilung suggeriert eine Handlungsfähigkeit des
singenden Subjekts. Cobains Anstrengungen im Refrain wirken, wie schon erwähnt,
kämpferisch, wobei das Ziel dieses Kampfes das erfolgreiche Transportieren der
somatischen Mitteilung an das Publikum ist. Bloomfield formuliert dies wie folgt:
„This (hyper)reality coexists today with the pursuit of the ever more soulful vocal, as if in a
doomed attempt to crack open the reified commodity, by dint of the singer's passion to force
something human across the gulf between exchange value and use value.“201
Diese Art des emotional-sängerischen Kampfes für die Vermittlung der somatischen
Mitteilung erscheint dabei regelrecht heldenhaft, wobei die erfolgreiche Identifikation des
Publikums mit der Stimme des Sängers[sic] damit zugleich eine Identifikation mit dem
siegreichen Heros[sic] dieser Vermittlung bedeutet. Wie in Lacans Spiegelstadium
erscheint damit das Spiegelbild idealer als das Selbst, verkörpert es doch gesellschaftliche
Handlungsfähigkeit, und entschädigt den kurzen Selbstverlust positiv mit einem
machtvollen Gefühl.
Ich möchte nun zusammenfassen: Die „echte“ Stimme, von der ich hier spreche, ist nicht
natürlich
oder
ursprünglich,
sondern
suggeriert
Echtheit
(daher
auch
die
Anführungszeichen), indem sie scheinbar eine unmittelbare Verbindung zum somatischen
Innern des Sängers[sic] herstellt. Diese „echte“ Stimme ist, wie deutlich geworden sein
sollte, ein äußerst komplexes Konstrukt; sie existiert nur innerhalb einer ästhetischen
Ideologie, die ihr einen durch Begriffe wie Authentizität und Echtheit strukturierten
Rahmen gibt. In ihr verschwimmen Körper, Subjektivität und Mitteilung miteinander,
wobei diese drei Terme auch als ständig ineinander umschlagende Momente der Stimme,
als Quelle, Vermittler_in und Inhalt, erscheinen, die sich zwar diskursiv differenzieren,
aber nicht grundsätzlich voneinander trennen lassen.
Körper, Subjekt und Mitteilung sind Effekte des Stimmklangs. Ihr Entstehen im
performativen Prozess ist am Ende von der erfolgreich suggerierten „Echtheit“ der
201Bloomfield (1993), S.13.
62
Stimme abhängig. Notwendig für die erfolgreiche Performanz dieser „echten“ Stimme ist
dabei in meiner Deutung, dass der somatische Körper hörbar wird und über diesen die
Wahrheit des ästhetischen Ausdrucks generiert und gewissermaßen „körperlich
beglaubigt“ wird.
Ich habe nun die These, dass diese Art der musikästhetischen Kommunikation in der
Popmusik für die klangliche Herstellung von Männlichkeit verwendet wird. Als Beleg
möchte ich nun zwei weitere von Sängern[sic] gesungene Songs betrachten, in denen
ebenfalls eine „echte“ Stimme zu hören ist.
Ich habe dazu bewusst zwei Beispiele ausgewählt, die wahrscheinlich nicht unbedingt
sofort mit Echtheit verbunden werden. Da mein Fokus dabei ausschließlich die „echte“
Stimme sein soll, werde ich jeweils auf eine ausführliche Analyse der Songs verzichten
und nur auf bestimmte, vor allem stimmliche, Details eingehen, die ich für die Produktion
einer „echten“ Stimme als relevant erachte. Ich möchte damit zeigen, dass die „echte“
Stimme ein verbreitetes Phänomen ist und außerdem weitere Gesangstechniken darstellen,
die den Eindruck eines direkten Zugangs zum Innenleben des Sängers[sic] unterstützen.
4.1.2 Robbie Williams: „Feel“
Zuerst möchte ich mich mit „Feel“ von Robbie Williams beschäftigen. In diesem Song ist
die Stimme des Sängers größtenteils sehr zentral und nah im imaginären Klangraum
platziert; die in der ersten Strophe eher leichte Stimme hat keine Schwierigkeiten sich
gegen die sparsame Instrumentation (Klavier und sehr wenig Perkussion) durchzusetzen
und scheint so leise zu singen, dass sie in einer imaginären Aufführungssituation ohne
künstliche Verstärkung nur in einem sehr kleinen Kreis hörbar wäre. Es lässt sich hier
leicht eine eher persönliche Szene assoziieren.
Gerade bei den tieferen Tönen der Strophe, wie bei „gi-ven“, und bei den absteigenden
Melismen,202 z.B. auf „Not sure I understa-a-and“, „my pla-ans“, ist dabei ein Vibrieren
hörbar, das wie aus dem tiefsten Körperinnern zu kommen scheint. Die jeweils nach unten
gleitenden Töne bekommen so eine deutlich hörbare körperliche Komponente und
erzeugen eine extreme Nähe zum singenden Körper, dessen Vibration regelrecht spürbar
wird.
202Ein Melisma bezeichnet eine Silbe, die über mehrere Gesangstöne hinweg ausgehalten wird. Der
Gegenbegriff zu Melisma ist Syllabik, d.h. jeder Note ist genau eine Silbe zugeordnet.
63
Besonders markant an diesem Song erscheint mir der Refrain, der allerdings bei jedem
neuen Auftreten klanglich deutlich von seinen vorherigen Versionen abweicht. Wie schon
bei „Smells Like Teen Spirit“ wird auch hier im Refrain der Tonumfang der Strophe
deutlich nach oben hin überschritten (bei: „feel real lo-“) und dabei die Lautstärke,
genauer die Energie des Luftstroms, erhöht, so dass der Stimmklang bei „I just wanna
feel“ an ein Rufen erinnert. Ich möchte nun vor allem den Klang des äußerst auffälligen
Wortes „feel“ untersuchen.
Mit einem f erklingt dieses Wort auf dem bis dahin höchsten Ton des Songs, der im
nachfolgenden „real love“ noch kurz nach oben überschritten wird. Der Konsonant F, mit
dem das Wort beginnt, entsteht als Geräusch an den Lippen, also sehr weit vorne im
Sprechtrakt, er wird allerdings mit viel Luft und Spannung produziert, so dass die Kraft
der Lungen ebenfalls hörbar ist. Dieses Lungenvolumen erschöpft sich jedoch scheinbar
auf dem folgenden Vokal, so dass das das Wort abschließende L regelrecht aus dem
Körper heraus gepresst zu werden scheint. Der Konsonant bildet sich dabei auch nicht
mehr wirklich aus, sondern verbindet sich mit dem Geräusch des erschöpfenden
Ausatmens; statt „feel“ erklingt also vielmehr etwas wie „fee-hl“.
Wie in der schmerzhaft hochgezogenen Stimme in „Smells Like Teen Spirit“ wird dabei
eine Anstrengung gegen den eigenen Körper unternommen; der Körper wird für die
Mitteilung eingesetzt. Mitgeteilt wird dabei aber vor allem die Anspannung des Körpers,
genauer des Atmungsapparates, die zur Erzeugung dieses Klangs notwendig ist.
Ich möchte nun noch auf die äußerst auffällige an den zweiten Refrain anschließende
Passage mit dem Text „And I need to feel Real love, And a life ever after“ (etwa ab 2:05
Minuten) eingehen, in der die Stimme deutlich den bereits bei Kurt Cobain analysierten
rauen Rachenklang aufweist, so dass das L von „feel“ z.B. mehr wie ein R klingt und mit
dem nach folgenden „real“ verschwimmt. Diese Passage ist dabei relativ hoch und
erreicht mit b den absoluten Spitzenton des Songs, wobei die Stimme wie im Refrain in
„Smells Like Teen Spirit“ ziemlich laut singt und regelrecht zu schreien scheint. Auch hier
wirkt der singende Körper sehr angespannt und die Stimmgebung regelrecht schmerzhaft,
auch wenn dieser Eindruck kürzer und weniger intensiv ist als bei Cobain. Der Eindruck
entsteht auch hier wahrscheinlich durch das Hochziehen der Bruststimme.
Auch Robbie Williams ist also hörbar körperlich involviert, um sich seinem Publikum
mitzuteilen. Durch die Stimme erscheint sein Körper dabei von Innen erfahrbar; die
Vibration der tiefen Basstöne, ebenso, wie die Anspannung der Atmung können nicht nur
64
gehört, sondern regelrecht gefühlt werden. Relevant hierfür scheint mir vor allem das
regelmäßige akustische In-Erscheinung-Treten von Körperregionen, z.B. Rachen oder
Brustraum, die unter der Haut liegen.
4.1.3 Michael Jackson: „Billie Jean“
Als weiteres Beispiel möchte ich mich außerdem mit „Billie Jean“ von Michael Jackson
beschäftigen. Schon kurz bevor die erste Strophe beginnt, sind leise aber dennoch deutlich
vernehmbar glucksende Stimmgeräusche hörbar. Diese klingen wie stimmhafte kurze
Atemstöße und erinnern leicht an einen Schluckauf oder ein Schluchzen. Solche und
ähnliche Geräusche produziert Jackson nach fast jedem Zeilenende; sie haben meist einen
U-artigen stimmhaften und einen an ein G, KH, H oder CH203 erinnernden Geräuschanteil,
haben keine genaue Tonhöhe und bilden fast immer einen sehr kurzen Impuls, der
wahrscheinlich vom Zwerchfell ausgeht. Teilweise klingen sie aber auch eher wie ein
entspannendes Ausatmen (z.B. nach „movie scene“). Diese lassen sich sowohl als
Ausdruck von Trauer als auch von Anstrengung deuten; es sind in jedem Fall nonverbale
Äußerungen, die vor allem somatische Informationen, wie Anspannung und Atmung,
transportieren.
Jacksons Gesang in der Strophe ist äußerst abwechslungsreich, spiegelt aber generell ein
hohes Maß an Erregung wieder, was sich beispielsweise in der ersten Zeile an der hohen
Stimmlage (vom cis'(!) absteigend) den relativ häufigen Betonungen und dem schnellen
Sprechtempo ablesen lässt.204 So hat beispielsweise gleich die erste Zeile „She was more
like a beauty queen from a movie scene“ 13 Silben und drei Betonungen in nur zwei
Takten. Relevant ist für diesen Eindruck jedoch auch die hörbare Körperspannung, die
notwendig ist, um für die relativ langen Phrasen ausreichend Luft zu haben.
Auffällig ist in der Strophe auch ein häufiger schneller Wechsel zwischen einer fast
heulenden und einer stark angespannten Aussprache, was besonders in der Zeile „She told
me her name was Billie Jean, as she caused a scene“ deutlich wird. Bei „She told me her
name“ rutscht die Stimme weiter ins Kopfregister, sie klingt relativ dünn und hoch. Dies
lässt sich dabei besonders gut im Kontrast zum folgenden „was Billie Jean, as she caused
a scene“ wahrnehmen, bei dem Jackson wieder das mittlere Stimmregister verwendet. Mit
dem Aussprechen des Namens wechselt er außerdem in eine sehr angespannte
203Wie in „ach“.
204Vgl. Wendt (2007), S.226: Emotionen mit hoher Erregung [Siehe Paeschke (2003), S. 57 und 65]
zeichnen sich durch hohes Sprechtempo aus.
65
Artikulation, die fast perkussiv klingt und in der die Konsonanten von einem
Zwerchfellimpuls verstärkt werden. Dadurch scheint der Gesang ähnlich aus dem Körper
herausgepresst zu werden, wie bei dem Wort „feel“ bei Robbie Williams. Vergleichbar
betont klingt auch die sich regelmäßig wiederholende Zeile „Who will dance on the floor
in the round“, wobei der Impuls besonders gut zu hören ist beim abschließende Zischlaut
von „dance“.
Während sich bis hierhin Anstrengung vor allem am Zwerchfell und in der Atmung zeigt,
gibt es im weiteren Verlauf des Songs außerdem einige Passagen, die sich durch eine
angestrengt hochgezogene Bruststimme auszeichnen. Insbesondere der mit „People
always told me...“ beginnende Formteil, der eigentlich mit dem Tonraum von f bis a im
Kontext dieses Songs eher tief ist, erscheint angestrengt hoch, da hier die schon aus den
anderen
Beispielen
bekannte
schreiend-schmerzhafte
hochgezogene
Bruststimme
eingesetzt wird. Vor allem am Ende dieses Abschnitts, bei den Worten „the lie becomes
the truth“ bzw. „She called me to her room“, ist dies sehr gut zu hören. Außerdem sind in
diesem Abschnitt die K-Laute bei dem wiederholten „careful“ auffällig: Sie werden mit
einem starken plosiven Impuls mit viel Luft gebildet, so dass sie regelrecht aus dem
Körperinnern hervorzustoßen scheinen. Sie klingen sehr rau und wirken ebenfalls
schmerzhaft.
4.1.4 Zusammenfassung:
Die „echte“ Stimme als männliche Performanz
In allen drei Songs wird der Körper des Sängers[sic] somatisch hörbar, d.h., dass sich die
körperlichen Anspannungen und Anstrengungen im Klang abbilden. Sie können so
nachempfunden werden, was zu einer spiegelhaften Identifikation mit dem Körperzustand
des Sängers[sic] und seinen Gefühlen führt oder zumindest führen kann. Diesen
emotional-somatischen Körperzustand halte ich dabei für eine zentrale Mitteilung der
Songs, deren Wahrheit und Echtheit vom Sänger[sic] jeweils durch extreme teilweise
schmerzhaft erscheinende Anstrengung körperlich bezeugt wird.
In Bezug auf eine Männlichkeit produzierende Performanz in diesen Songs fallen dabei
die mit Männlichkeit assoziierten Attribute, wie die in der stimmlichen Anstrengung
enthaltene Kraft oder der heldenhafte Kampf um die Mitteilung, auf. Im Vordergrund
stehen für mich allerdings außerdem die in der Stimme transportierte Einheit von Körper
66
und Subjekt und die mitteilende Aktion, in der sich die somatische Selbstwahrnehmung
direkt als Mitteilung sozial transzendiert.
Die Emotionalität des männlichen Subjekts wird dabei im gesamten Prozess der
Präsentation und Anerkennung dieser Musik nicht nur als mitteilungswürdig, also
gesellschaftlich relevant, bestätigt, sondern auch mit dem Siegel der Wahrheit oder
Echtheit geadelt. Auch wenn in diesem Prozess sich einzelne Sänger[sic] nicht erfolgreich
als authentisch und echt präsentieren können oder ihnen von ablehnenden Hörer_innen
diese Authentizität aberkannt wird, so ist die Präsentation einer „echten“ Stimme dennoch
eine, die einen Anspruch auf Wahrheit erhebt.
Der Sänger[sic] ist dabei nicht fragmentiert, sondern bildet eine Einheit, die nicht einmal
von der sonst so üblichen Bias von Körper und Geist beeinträchtigt zu sein scheint. Als
solche agiert er[sic] auch in der sozialen Welt; seine[sic] Handlungsfähigkeit basiert auf
dieser Ganzheit, in der somatische Regungen quasi sofort zu sozialen Aktionen werden.
Was er[sic] tut, ist ebenso wie, was er[sic] fühlt: richtig, wahr, echt und authentisch.
So drückt sich noch in den „unmännlichsten“ Expressionen eines Popsängers[sic] 205 ein
Anspruch auf die Welt aus, das heißt auf Anerkennung seiner[sic] Subjektivität, seiner[sic]
Emotionalität und seiner[sic] Handlungen. Diese kann jedoch bereits als Ausdruck einer
privilegierten gesellschaftlichen Position interpretiert werden, in der das Subjekt nicht in
Frage steht, sondern sich ganz selbstverständlich als Wesentliches annehmen und setzen
kann.
Dabei liegt es nahe, sich an die von Simone de Beauvoir beschriebene „männliche
Naivität“206 zu erinnern, also die Unfähigkeit oder den Unwillen die eigenen Privilegien,
insbesondere die Selbstverständlichkeit männlicher Subjektivität und Zentralität,
überhaupt wahrzunehmen. Eine solche Position wird, so meine These, in der analysierten
Popmusik auf einer somatischen Ebene bestätigt und reproduziert.
205Shana Goldin-Perschbacher beschreibt Jeff Buckleys Stimme in einem Aufsatz mit dem Titel „«Not With
You But of You» - «Unbearable Intimacy» and Jeff Buckleys Transgendered Vocality“ mit deutlichem
Schwerpunkt auf dem hörbaren Körper: „the presence of tongue and mouth sounds (especially singing
the words „touch my skin“) makes him appear very close (close to the microphone and thus to the
listener) and reveals the source of the words and sounds emerging from his body. Using a vulnerable
voice to remind the listeners of the excesses and unconrollability of the body is certainly an unusual way
to evoke masculinity in popular music.“ Zwar vertritt die Autorin die Position, dass diese
Gesangstechnik, eben weil sie verletzlich und tendenziell unkontrollierbar ist, eher unmännlich und
sogar „transgendered“ ist, wie sie im Titel ihres Aufsatzes ankündigt, gerade die Verletzlichkeit und der
drohende Kontrollverlust produziert jedoch meiner Meinung nach den Eindruck extremer körperlicher
Involviertheit, der für die „echte“ Stimme so typisch ist. Weniger die Körperlichkeit als im Gegenteil die
Loslösung der Stimme vom Körper, die in Teilen des Songs geschieht, erscheint mir eher Auslöser für
die geschlechtliche Uneindeutigkeit zu sein, die Goldin-Perschbacher hier empfindet [Vgl. GoldinPerschbacher (2007) und der Song „Mojo Pin“, von Jeff Buckley].
206Vgl. S.12 dieser Arbeit.
67
Die Mitteilung als Handlung sichert dabei den Subjektstatus des Sängers[sic], so dass
weder er[sic] noch seine[sic] Stimme zum Objekt wird. Schließlich entsteht durch das
empathische
Nachempfinden
der
in
der
Stimme
transportierten
somatischen
Empfindungen eine emotionale Gleichheit zwischen Sänger[sic] und Publikum. In der
Identifikation mit dem Sänger[sic] wird dessen Position vom Publikum geteilt, wodurch
er[sic] leicht in die Position einer emotionalen Identifikationsfigur für eine Gesellschaft,
eine Generation, eine Subkultur o.ä. erhoben werden kann. Fast automatisch können
„echte“ Stimmen so zur gesellschaftlich relevanten emotionalen Repräsentation des
Eigenen und zum normierten kulturellen Selbstbild werden.
Allerdings habe ich das Publikum bisher nicht differenziert: Bisher war meine These, dass
alle Hörer_innen sich mit der Stimme identifizieren, nun möchte ich das Publikum nach
Geschlecht aufschlüsseln. Hierfür möchte ich auf Butlers These der Einverleibung
gleichgeschlechtlicher Körperlichkeit durch Verdrängung des Begehrens nach derselben
zurückkommen.207
Norma Coates, die selbst zugibt, die Rolling Stones zu mögen, befragte einige Frauen
weshalb sie deren Musik hören:
„[S]ome respondents, when asked why they like the stones, reply «because they are sexy». In
this case «they're» does not necessarily refer to the manly beauty of Mick, Keith or even Bill
or Charlie. It refers to the sound of the Stones, the totality of the mix and the beat, the way the
music hits the body and the hormones instantaneously. [..] This sound, perhaps some of the
most definitional sound of ultimately undefinable rock, is coded as unmistakably phallic, and
masculine.“208
Auch wenn dieses Zitat nicht direkt auf die Stimme eingeht, so wird hier eine Beziehung
zwischen Musik und Körper aufgemacht, wobei beides als „sexy“ und „phallic“
erscheint. Die Identifikation mit der „echten“ Stimme, die zu einer kurzzeitigen
Undifferenzierbarkeit von Eigenem und Anderem führt, kann dabei durchaus als ein
erotisches Moment gedeutet werden, wobei sicherlich auch die starke Präsenz des Körpers
in der Stimme eine Rolle spielt. Mit Bezug auf Lacan ließe sich hier außerdem auf die
Verliebtheit verweisen, die er als eine Wirkung imaginärer Spiegelung betrachtet.209
207Vgl. S.15 dieser Arbeit.
208Coates (1997), S.50.
209Vgl. S.44 dieser Arbeit.
68
Somit lässt sich gegenüber der „echten“ Stimme durchaus auch ein Begehren 210
annehmen, das von Frauen innerhalb der heterosexuellen Matrix legitim verspürt werden
kann, das jedoch für sich als heterosexuell verstehende Männer zu einer verstärkten
Materialisierung des in der Musik vermittelten Körperbewusstseins als Schutz gegen ein
Empfinden dieser homoerotischen Konnotation führen müsste.211 Es ließe sich damit
erklären, dass die bisher in der „echten“ Stimme festgestellten Attribute, wie Ganzheit und
Aktivität, sich – das normative Funktionieren der heterosexuellen Matrix und einen
affirmativen
Musikkonsum
vorausgesetzt
–
verstärkt
in
männlichen
Körpern
materialisieren, für Frauen hingegen eher die auf einen Wunschpartner[sic] projizierten
erotischen Idealbilder formt. Insbesondere der musikalische Ausdruck von Sexualität in
der „echten“ Stimme könnte einen solchen Prozess der Materialisierung erotischer
Körperbilder vorantreiben.
Bemerkenswerterweise wird bei diesem Begehren jedoch der männliche Körper nicht zum
Objekt. Notwendig ist nach wie vor die Kommunikation somatischer Innerlichkeit und
damit die erfolgreiche Produktion des Sängers[sic] als somatisches Subjekt.212
All diese Effekte wirken dabei absolut natürlich, entspringen sie doch (scheinbar) dem
physischen Körper und dem angeblich authentischen Gefühl des Sängers[sic]. Sie sind
jedoch dennoch Resultat der stimmlichen Performanz des Sängers[sic] und der
ästhetischen Ideologien der Popmusik (die hier als Intelligibilitätsrahmen funktionieren),
in denen diese Performanz stattfindet.
4.2 Andere Stimmen
In diesem Abschnitt möchte ich nun einige Songs von Sängerinnen analysieren, wobei ich
mich ebenfalls der Beziehung zwischen Stimme und hörbarer Performanz von Körper und
210Es ist durchaus diskutierbar, ob hier der Lacansche Begriff des Begehrens angemessen ist, da die
imaginäre Spiegelung der symbolischen Ordnung vorangeht, die das Begehren produziert. Einerseits
verwendet Lacan diesen Begriff jedoch selbst zur Beschreibung seiner Verliebtheit [Vgl. Lacan (1990)
S.182] andererseits lässt er sich rechtfertigen, wenn der illusorische Charakter der Spiegelung in Betracht
gezogen wird, der nur für einen Moment etwas suggeriert, von dem jedoch auch im Spiegelmoment klar
ist, dass es eine Täuschung darstellt. Damit entsteht auch in der Spiegeltäuschung keine wirkliche
Anwesenheit sondern eigentlich die Erfahrung einer unüberwindbaren Abwesenheit. Der Spiegelmoment
selbst könnte dabei als Objekt a verstanden werden, der ein Begehren erzeugt.
211Dies erklärt vielleicht auch einen Teil der Ängste, mit denen in den manchmal entsprechender Musik
begegnet wird.
212Auch dies lässt sich mit Lacans Konzeption der Verliebtheit verstehen: Dieses Begehren geht vom
spiegelhaften Moment der Identifikation aus und ist somit immer mit einem Verwechseln des anderen
mit dem eigenen verbunden. Lacans Liebe erscheint als eine „Unterwanderung des Symbolischen“
[Lacan (1990), S.182] und führt zu einer Vermischung von imaginärem Ideal-Ich und symbolischem IchIdeal [S.183], so dass sich auch diese beiden Ebenen (imaginär und symbolisch) vermischen. Der_die
Begehrte wird dabei nicht Objekt, sondern bleibt als idealisiertes Selbstbild ein Subjekt.
69
Subjekt zuwende. Dabei werde ich hier nicht, wie bei der „echten“ Stimme von einem
ästhetischen Paradigma ausgehen. Stattdessen werden die einzelnen Songs den
Ausgangspunkt bilden, um ihre jeweils eigenen Funktionsweisen zu entschlüsseln. Aus
diesem Grund werden die Analysen im Folgenden auch umfangreicher, da ich die Songs
nicht auf ein bereits bekanntes Muster hin untersuchen kann, sondern anhand des
musikalischen Materials Thesen über die ästhetische Wirkungsweise entwickeln werde.
Ich habe hierzu vier Songs ausgewählt, die ich für repräsentativ für verschiedene
verbreitete Muster weiblicher Stimmpräsentationen in der Popmusik halte und die mir
zudem geeignet erschienen an ihnen entsprechende Theorien und Methoden zu
entwickeln. Ich beginne mit „Feel It“ von Kate Bush, wobei ich die bereits erwähnten
Assoziationen und Positionen von Frith und McRobbie aufgreifen werde.
4.2.1 Kate Bush: „Feel It“
Ich möchte mit dem Song „Feel It“ von Kate Bush beginnen, der bereits von Frith und
McRobbie in ihrem Aufsatz „Rock and Sexuality“ besprochen wurde. Wie ich bereits
erklärt habe, ist die Analyse von Frith und McRobbie nicht sehr ausführlich und kommt
sehr schnell zu dem Schluss, dass hier das Publikum in eine voyeuristische Position
versetzt wird, ohne dass diese These meines Erachtens ausreichend am musikalischen
Material belegt wird. Ich möchte nun in einer ausführlicheren Betrachtung dieses Songs
und insbesondere des Einsatzes von Kate Bushs Stimme die Ansichten von Frith und
McRobbie überprüfen und hinterfragen.
Zunächst ein kurzer Überblick: Der Song folgt einer relativ einfachen Form, 213 das Tempo
ist recht langsam,214 wobei das Metrum nicht stabil ist, sondern bisweilen langsamer und
schneller wird und der eigentlich zugrunde liegende 4/4-Takt manchmal durchbrochen
wird. Die Tonart schwankt ebenfalls (zwischen g-Moll im Refrain und d-Moll in der
Strophe). Der Song ist nur mit Klavier und Gesang instrumentiert. Die Melodie ist
ziemlich kompliziert, d.h. sie verwendet tonartfremde Töne, enthält teilweise große
Sprünge und komplexe Rhythmen. Sie lässt sich keinesfalls einfach nach- oder mitsingen,
und umfasst einen Tonumfang von fast zwei Oktaven von g bis f''.
Frith und McRobbie beschreiben Bushs Stimme in ihrer kurzen Analyse als „the voice of a
little girl“, ein Eindruck, der wohl vor allem auf Bushs Einsatz einer hohen Kopfstimme
basiert. Dabei beziehen sich Frith und McRobbie vor allem auf die erste Strophe, die mit
213Etwa AABAB, wobei A die Strophen und B den Refrain bezeichnet. Siehe Anhang
214Etwa 75 bpm = „beats per minute“, d.h. die Anzahl von Viertelnotenschlägen pro Minute.
70
einem Tonumfang von d' bis f'' auch recht hoch ist. Da Kinderstimmen wegen der
geringeren Körpergröße insgesamt höher sind als erwachsene Stimmen und außerdem
aufgrund des proportional größeren Anteils des Kopfes an der gesamten Körpergröße die
Resonanzräume im Kopf einen stärkeren Anteil am Klang haben als der Brustraum, 215 ist
diese Assoziation nicht unbegründet und von der Sängerin wahrscheinlich auch intendiert.
Ich halte diese Beschreibung aber dennoch nicht ganz für zutreffend, denn ich bezweifle,
dass irgendjemand diese Stimme tatsächlich mit einer wirklichen Kinderstimme
verwechseln würde.
Unterschiede im Timbre zwischen Bushs Stimme und einer realen Kinderstimme lassen
sich an einigen Stellen deutlich ausmachen, beispielsweise klingt die Stimme deutlich
erwachsen bei „Feel it! See what you're doing to me“ am Ende des Refrains. Die Stimme
in der ersten Strophe klingt im Vergleich verstellt, wie ich kurz an den ersten beiden
Tönen darstellen möchte: Bush beginnt ihren Gesang relativ hoch auf dem d'' von dem aus
sie sofort eine Oktave abwärts zum d' springt. Auf diesem zweiten Ton behält sie die
gesangstechnische Einstellung des ersten Tons, also eher eine Kopfstimme oder hohe
Mittelstimme, weitgehend bei, so dass es fast klingt, als würde bei diesem Ton bereits das
untere Ende ihres Ambitus erreicht sein, obwohl sie am Ende des Refrains bei „see what
you...“ noch deutlich tiefere Töne erreicht. Diese klingen jedoch auch auffällig anders,
haben einen stärkeren Klang und erscheinen überhaupt nicht mehr kindlich.
Eindeutig hörbar und alles andere als kindlich ist außerdem die Kontrolle, die Bush über
ihre Stimme hat: Sie singt eine äußerst anspruchsvolle Melodie mit einem großem
Tonumfang,
einem
komplexen
Rhythmus
und
plötzlichen
harmonisch-tonalen
Modulationen (vor allem gut hörbar und sehr auffällig ist das des' über B-Dur bei „It
would be wonderful“) und setzt deutliche Veränderungen in ihrem Stimmklang ein.
Mit solchen Veränderungen des Klangs arbeitet Bush im Song sehr viel, so dass
regelmäßig deutliche und äußerst auffällige Unterschiede im Stimmklang auftreten. Gut
hören lässt sich dies auf dem lang gezogenen Wort „floor“ an dessen Ende, nach dem
Melisma, die Formantstruktur vom O zum A verändert wird, so dass sich die Klangfarbe
deutlich aufhellt. Auffällig sind aber auch die häufigen und äußerst starken Wechsel der
215Vgl. Mohr (2008), S. 5-7: „Das Größenverhältnis von Kopf und Rumpf ist beim Kind enormen
Veränderungen unterworfen. Findet man beim Neugeborenen fast ein Verhältnis von 1:1, so wachsen im
Verlauf der kindlichen Entwicklung der Rumpf und die Extremitäten erheblich mehr als der Kopf. Beim
ausgewachsenen Menschen beträgt schließlich das Größenverhältnis zwischen Kopf und Rumpf etwa 1:5
bis 1:9. Die schwingungsbeeinflussenden Kopfräume sind also beim Kind dominant, die Räume des
übrigen Körpers (vor allem der Brustraum) sind dementsprechend weniger klangprägend. Dies macht
sich akustisch bemerkbar in der deutlich stärkeren Helligkeit der Kinderstimme. Die Stimmen von
Kindern klingen «körperloser», «schwebender», «leichter» als die von Erwachsenen. “
71
Klangfarbe im Refrain, in dem sie mindestens drei deutlich unterscheidbare
Gesangseinstellungen einsetzt.216 Dieser Umgang mit dem Timbre ist dabei offenkundig
ein bewusst eingesetztes musikalisches Stilmittel und die verschiedenen Klangfarben des
Gesangs in diesem Song sind folglich Resultat eines intentionalen Einsatzes der Stimme.
Dieser Einsatz der Timbres wirkt dabei ein wenig wie ein kreatives Spielen oder
Experimentieren mit dem Klang der Worte, deren klangliche Möglichkeiten erkundet
werden. Einerseits unterstützt dieses Spielen dabei die Assoziation von Kindlichkeit 217 und
bildet einen Gegensatz zur kämpfenden Ernsthaftigkeit der „echten“ Stimme, andererseits
wird die Aufmerksamkeit in dieser Gesangstechnik auf den Wortklang und sowohl vom
Wortsinn als auch vom Körperklang weg gerichtet. Ich möchte diesen Gesangsstil dabei
mit Bezug auf Kristeva als semiotisch bezeichnen. Damit meine ich einen Gesangsstil, in
dem der Klang der Stimme zu einem kontrollierten vom Körper und vom semantischen
Sinn getrenntem Objekt wird, zu einer Art Klanggestalt.218
Die von Bush verwendete „Kinderstimme“ ist dabei keine Täuschung, die überzeugend
ein anderes Alter suggerieren würde, sondern eher mit einer Art Maske vergleichbar, an
deren Künstlichkeit kein Zweifel besteht und die niemals mit etwas Echtem verwechselt
werden würde. Diese künstliche Kinderstimme hat dabei zwei Wirkungen: Sie erzeugt
einerseits Assoziationen, die eben mit Kindlichkeit verbunden werden, und produziert so
eine Phantasiewelt, an deren irrealem Charakter aber dennoch kein Zweifel besteht.
Andererseits verweist diese Maske auf etwas Verborgenes, das dahinter versteckt wird,
denn hinter dem künstlichen Stimmklang steckt notwendig ein Subjekt, das diese Stimme
kontrolliert und bewusst einsetzt, das sich aber nicht direkt zeigt. Auch diese zweite Ebene
des maskenhaften Stimmklangs ist jedoch eigentlich phantastisch, da das verborgene
Subjekt, das sich hier performativ produziert, nicht eindeutig fixierbar ist und so ebenfalls
nur eine Projektionsfläche für unsere Phantasien bildet.
216Im Refrain arbeitet Bush mit mindestens drei deutlich von einander zu unterscheidenden Einstellungen,
die ich hier in kursiv, fett und kursivfett markiere:
Oh, feel it. Oh, oh feel it, feel it, my love.
Oh, feel it. Oh, oh feel it, feel it, my love.
Oh, I need it. Oh, oh, feel it, feel it, my love.
Feel it! See what you're doing to me?
See what you're doing to me?
217Er erinnert auch an den Prozess des Spracherwerbs, denn dem bedeutungsvollen Sprechen geht eine
solche Phase des spielenden Erprobens der stimmlichen Möglichkeiten voran (Lallphase im ersten
Lebensjahr) [Vgl. Bockmann (2006/07), S. 3].
218Es mag vielleicht irritieren, dass ich den Begriff „semiotisch“ hier genau für dasjenige verwende, was
nicht Zeichen ist. Ich möchte daher an Kristevas Übersetzung von «σημειον» mit unter anderem
„Gestaltung“ erinnern [Vgl. S.35 dieser Arbeit], was einen recht guten Ansatzpunkt für meine
Begriffsverwendung bildet .
72
Die verschiedenen Stimmeinstellungen, mit denen Kate Bush arbeitet, lassen sich dabei
insgesamt als wechselnde Masken verstehen; die „kindliche“ Stimme, die vielleicht
Unwissenheit, Zerbrechlichkeit oder Unvollständigkeit suggeriert, wird so kontrastiert mit
dem weichen erwachsenen Stimmklang bei „Feel it! See what you're doing to me“, der
einen tieferen Tonraum nutzt, dabei eine Brusttoneinstellung verwendet und relativ voll
und obertonreich klingt. Dies ließe sich nach Shepherds Einteilung der Stimmregister mit
emotionaler Fürsorge oder übertragen mit Mütterlichkeit assoziieren. Die häufigen und
plötzlichen Wechsel im Stimmklang (wie beispielsweise „flo-ar“) schließlich lassen sich,
insofern sie die Bedeutung und damit die Logik der Sprache in Frage stellen, sogar mit
Wahnsinn in Verbindung bringen. Bush präsentiert somit verschiedene weibliche
Klischees, die aber alle offenkundig nicht real sondern maskenhaft sind. Ein Kontrast zur
„echten“ Stimme besteht außerdem darin, dass sich das Subjekt nicht mit seiner
Emotionalität in der Stimme zeigt, sondern sich hinter offenkundig falschen und
künstlichen Stimmklischees „versteckt“.
Bemerkenswert ist neben dem Einsatz des Timbres aber auch die Melodie, die immer
wieder stockt und unterbrochen wird: Schon nach dem ersten Wort „after“ schweigt Bush
für über zwei Taktschläge, obwohl sowohl das Wort als auch die Melodie mit ihrem
eröffnenden Oktavsprung eine Fortführung erwarten lassen. Solche auffälligen Pausen
wiederholen sich im Song mehrfach (nach: „the party“, „Locking the door“, „My
stockings fall“, „Nobody else“, „can share this“, …). Jeweils werden dabei durch den
Text und die oft an solchen Stellen ansteigende Melodie Fortführungen angedeutet, die
aber erst verzögert kommen. Damit wird selbst in Abwesenheit der Stimme der Fokus der
hörenden Wahrnehmung auf dieselbe gerichtet und ein ständiges Warten erzeugt.
Andererseits wird an Stellen, die vielleicht eine Pause nahelegen würden, wie
insbesondere das Ende der ersten Strophe nach „Desperate for more“, nicht unterbrochen,
sondern das nächste Wort („nobody“) direkt angeschlossen. Die komplexe Melodie
scheint dabei mögliche Ruhepunkte regelrecht zu vermeiden,219 so dass sich über die
gesamten ersten beiden Strophen ein langer Phrasierungsbogen spannt, der auch bei
„wonderful“ am Ende der zweiten Strophe noch keinen wirklich überzeugenden
Abschluss findet.220
219Insbesondere am Ende der Strophen weicht die Begleitung jeweils plötzlich aus: Am Ende der ersten
Strophe nach B-Dur, am Ende der zweiten überraschend nach Es-Dur. Die Tonart bleibt dabei
unbestimmt, es könnte sowohl d, als auch g-Moll sein.
220Obwohl hier eine melodische Kadenz erreicht wird, ist diese nach dem vorangegangenen
überraschenden Anstieg bei „it would be“ und mit dem weiter treibenden Klavier nicht überzeugend.
73
Da sich damit die Melodie dem scheinbaren Naturgesetz der westlichen Tonalität, der
Kadenz, nicht unterwirft und nicht naheliegenden sprachlichen Phrasierungen folgt,
erzeugt sie auch auf dieser Ebene den Eindruck von Künstlichkeit. Der komplexe und
extrem lange Spannungsbogen produziert des Weiteren eine Erwartungshaltung, die sich
mit McClary wiederum als Begehren nach der verweigerten Kadenz bzw. nach einem
melodischen Ruhepunkt verstehen lässt.
Abwesenheiten produziert Bush außerdem auch auf der klanglichen Ebene, indem sie in
ihrer künstlichen Kinderstimme beispielsweise die Bruststimme und damit die tieferen
Frequenzen ihres Timbres ausspart. Auch generell lässt sich die offenkundig verstellte
maskenhafte Stimme als Abwesenheit der „echten“ Stimme interpretieren, die damit ein
Begehren weckt. Das ästhetische Paradigma der „echten“ Stimme tritt somit nicht wirklich
außer Kraft, sondern wirkt im Konsum dieser Musik weiter, indem in diesem Song eine
„echte“ Stimme und damit das Subjekt zu fixieren versucht wird.
In Bezug zu Lacans Psychoanalyse lässt sich hierbei Bushs Stimme insgesamt als Objekt
a verstehen, das ein Begehren ködert und produziert und in seiner offenkundig maskierten
Form auf eine Abwesenheit verweist. Bushs Gesangstechnik legt dabei für mich nahe,
dass sie mit einem solchen suchenden Hörverhalten rechnet und es gezielt anregt.
Bush scheint solche begehrenden Erwartungen in ihrem Gesang beispielsweise zu
verstärken, indem sie in der Passage „Locking the door, my stockings fall, Onto the floor“
nach und nach, aber immer nur sehr kurz, einen volleren Stimmklang zulässt. Der
steigende Brusttonanteil in den O-Vokalen in „stockings“, „fall“ und „onto“ erreicht auf
dem Melisma von „floor“ einen kurzen «Höhepunkt»221, wobei aber die bereits mehrfach
erwähnte Vokalveränderung vom O zum A – und dann noch mehr beim folgenden noch
höheren und sich ebenfalls vom O zum A verändernden „mo(-a-)re“ – wieder in die
Kinderstimmenmaske zurückführt.
Ich habe dabei den Eindruck, dass Bush hier regelrecht kurze verheißungsvolle akustische
„Einblicke“ in ihren volleren Bruststimmklang ermöglicht, ohne dass dabei jedoch ein
wirklich klarer klanglicher Eindruck entstehen kann. So komme ich nebenbei zu einer
Erklärung für Frith und McRobbies auf Voyeurismus hinweisende Interpretation des
Songs: Eben dieses in die Sängerin Hineinhorchen und das kurze Aufschimmern einer
versteckten „echten“ Stimme weist starke Gemeinsamkeiten zum aufdringlichen ins
Private eindringenden voyeuristischen Blick und dem damit verbundenen Wunsch nach
Insgesamt ließe sich eigentlich nur die wiederholte Zeile am Ende des Refrains als plausibler Ruhepunkt
werten.
221Gemeint ist hier eine Art „O“-Maximum.
74
Enthüllung auf. Die sexuelle Konnotation, die Frith und McRobbie hier hören, lässt sich
damit auch auf der klanglichen Ebene fassen.
Allerdings ist Kate Bush dabei kein passives Opfer, da die Sängerin mit ihrem bewussten
Einsatz von Gesangstechniken genau diese Situation erschafft. Während Frith und
McRobbie zu dem Schluss kommen „Kate Bush's aesthetic intentions are denied by the
musical conventions she uses“,222 habe ich eher das Gefühl, dass sie uns in der
voyeuristischen Position ertappt, deren musikalische Konventionen sie absichtlich
verwendet. Sie ist nicht das passive Objekt eines Blicks, sondern strukturiert aktiv die
Blickrichtung. Sie ist eigentlich vollkommen unerreichbar, lockt aber unser Interesse mit
der ständigen Andeutung einer Enthüllung, die jedoch nicht stattfindet.
Das Zitat von McRobbie und Frith deutet jedoch noch etwas anderes an: Sie unterstellen
eine Intention, die sie im Aufbau ihrer kurzen Betrachtung des Songs im Songtext
verorten. Dabei stellen sie ganz richtig eine Diskrepanz zwischen dem sprachlichen Inhalt,
den die beiden Autor_innen ganz treffend als das Feiern sexueller Lust („a celebration of
sexual pleasure“)223 beschreiben, und der musikalischen Darstellung fest. Zwar ist es
bereits schwierig, dass die beiden Autor_innen die Intention des Songs unhinterfragt auf
der sprachlichen und nicht der musikalischen Ebene suchen, ich finde jedoch schon den
Versuch, hier überhaupt eine Intention der Sängerin zu fixieren, bemerkenswert, denn
hinter diesem Versuch verbirgt sich die Annahme einer Ausdrucksästhetik, die von einer
einzigen eindeutigen Wahrheit des Songs ausgeht und somit die Ideale einer „echten“
Stimme anwendet, in der Intention und Emotion in eins fallen. Was in diesem Song jedoch
meines Erachtens nach passiert, ist eben die Produktion von Widersprüchen und
Uneindeutigkeiten, die die Projektion von Phantasien ermöglichen, aber keine Aussage
über die „wirkliche“ Intention der Sängerin zulassen.
Meine persönliche Interpretation des Songs ist dabei, dass Kate Bush nicht einfach nur
affirmativ eine sexualisierte Pose reproduziert, sondern dem Publikum kritisch sein
voyeuristisches Interesse spiegelt. Für diese Interpretation spricht dabei vor allem das
Unbehagen, das in dem Song durch die uneindeutige Molltonalität, das unregelmäßige und
damit sehr verunsichernde Metrum, die wie immer wieder in ihrer Linie abgebrochen
klingende Klavierbegleitung und nicht zuletzt die Ambivalenz der Stimme erzeugt wird,
und dabei einen beachtlichen Widerstand gegen eine entspannt affirmative Hörweise
222Frith/McRobbie (1996), S.386.
223Ebd.
75
aufbaut. Vor allem die letzte Zeile „See, what you do to me“, erscheint mir hierbei wie
eine Aufforderung zu sehen, was wir selbst zu diesem Song beitragen und wie, also mit
welchem Interesse, wir die Stimme hören. Ich höre also in diesem Song übertragen auch
eine (feministische) Kritik an einer gesellschaftlichen Situation, in der Frauen generell als
Projektionsflächen für eigene Wünsche dienen. Allerdings halte ich diese Interpretation
nur für eine Möglichkeit, die wahrscheinlich sehr viel über meine persönlichen Wünsche
aussagt, die ich selbst auf den Song projiziere.
Der Song ist jedoch grundästzlich uneindeutig, und zwar nicht nur auf der Ebene, auf der
musikalische Äußerungen grundsätzlich nicht über sprachlich-semantische Eindeutigkeit
verfügen. Vielmehr haben die Widersprüchlichkeiten von beispielsweise Text und Musik,
dem schwankenden Tempo, der tonalen Ambiguität oder der verschiedenen eingesetzten
Stimmklänge eine negierende Wirkung, die sämtliche scheinbaren emotionalen und
sprachlichen Mitteilungen des Songs mit einer ironischen Note – mit der impliziten Frage
„Meint sie das wirklich so?“ oder mehr noch „Was meint sie wirklich?“ – versieht.
Kate Bush produziert musikalisch wie inhaltlich Ambivalenzen und Widersprüche und
spielt dabei mit unseren Erwartungen und Wünschen. Offensichtlich wollen wir sie
fixieren und suchen nach einer Eindeutigkeit – in der Stimme, der Aussage oder den
musikalischen Parametern (Tonalität und Tempo) – welche Bush jedoch immer wieder
verweigert. Während die „echte“ Stimme danach strebt, eine eindeutige emotionale
Wirklichkeit und Wahrheit zu produzieren, zu der das Publikum einen unmittelbar
erscheinenden Zugang finden kann, wird von Kate Bush ein solcher Zugang verhindert.
Die Annahme, dass es dennoch eine zwar verborgene aber wirkliche Intention geben
müsse, produziert dabei nicht nur diese abwesende „Wirklichkeit“ sondern auch den
Wunsch, diese zu entdecken und zu enthüllen.
Wir erfahren jedoch im Song nichts unmittelbar über Kate Bushs „echte“ Gefühle oder
Intentionen. Bestenfalls ist es möglich, hier eine verweisende Beziehung zwischen der
musikalischen Darstellung und den Gefühlen der Sängerin anzunehmen, d.h., dass die
maskenhaften Verstellungen der Stimme zu einem bestimmen Zweck, beispielsweise
Verführung oder aber Kritik, eingesetzt werden, woraus dann ein bestimmtes Gefühl, wie
sexuelles Begehren seitens der Sängerin oder Wut auf die kritisierte Situation, geschlossen
werden kann. Diese Kette von Verweisen ist jedoch, wie ich denke gezeigt zu haben, alles
andere als eindeutig, denn meine Interpretation, dass es sich hier um ein kritisches
Bewusst-Machen gesellschaftlicher Projektionen sexueller Wünsche auf Frauen handelt,
76
geht mit ganz anderen Annahmen über die Intentionen und Gefühle von Kate Bush einher
als die Idee, sie würde aufgrund eigenen Begehrens verführen wollen. Auch erzeugen
solche Verweise eine Distanz, die mit der Funktionsweise der „echten“ Stimme nicht zu
vereinbaren ist, denn das Subjekt und seine Emotionen sind nur vermittelt zugänglich: Wir
hören nicht scheinbar unmittelbar die Gefühle eines Subjekts, sondern schließen aufgrund
einer verstellten Stimme auf ein Subjekt, das diese Stimme intentional einsetzt.
Da diese angebliche „Wirklichkeit“ von Kate Bushs Subjektivität somit aber nicht
zugänglich ist, können wir diesen Ort selbst mit unserer Phantasie füllen, wozu uns die
verschiedenen maskenhaften oder scheinbar natürlichen Einstellungen der Stimme eine
Auswahl an Ansatzpunkten bieten. Was sie fühlt, was sie uns mitteilen möchte und wer sie
ist, bleibt letztlich unserer Phantasie überlassen.
Der bewusst intentionale Einsatz der Stimme führt jedoch zu einem weiteren
entscheidenden Unterschied zur „echten“ Stimme, den ich hier abschließend ausführen
möchte: die Trennung von Stimme und Subjekt. Indem das Subjekt die Stimme bewusst,
kontrolliert und intentional einsetzt, ist die Stimme im Bezug zum Subjekt ein
funktionales Objekt, wohingegen im ästhetischen Paradigma der „echten“ Stimme Subjekt
Mitteilung und Stimme eine Einheit ohne funktionale Beziehungen bilden. Während in der
„echten“ Stimme das Subjekt mit dem Körper verbunden ist, entsteht mit dem
funktionalen Einsatz der Stimme eine Distanz zum Subjekt, das sich nun nicht mehr in der
Stimme zeigt, sondern hinter der Stimme versteckt. Dies hat Auswirkungen auf den Ort
dieses Subjekts, das sich nun eben nicht im körperlichen Stimmklang offenbart.
Da der bewusste Einsatz der Stimme auch eine entsprechende bewusste Kontrolle des
diesen Stimmklang erzeugenden Körpers beinhaltet, lässt sich diese Distanz zwischen
Subjekt und Stimme auch auf die Beziehung zwischen Körper und Subjekt übertragen.
Das Subjekt der „echten“ Stimme zeigt sich in einer körperlichen Stimme, die scheinbar
ungefiltert die Gefühle mitteilt, und bewohnt damit den eigenen Körper; die funktionale
Beziehung zur Stimme verschiebt das Subjekt an einen anderen Ort. Das Subjekt ist also
niemals wirklich da, es ist in der Stimme nicht anwesend, sondern an einem
transzendenten Ort, der nicht greifbar ist und in Form von körperlicher Ausdehnung
eigentlich auch nicht existiert. Kate Bush ist also so gesehen nicht ihr Körper, sondern
besitzt ihren Körper, sie kontrolliert ihn und setzt ihn ein. Auch der Körper wird dabei, wie
ihre Stimme zu einem Objekt.
77
Das Subjekt erhält so jedoch ebenfalls eine problematische Position: Es wird performativ
hergestellt, indem es sich hinter der Stimmmaske versteckt. Während dem sich in der
„echten“ Stimme offenbarenden körperlichen Subjekt mit empathischem Interesse, also
dem Wunsch zu verstehen und die Gefühle nachzuempfinden, begegnet wird, ist das
Interesse an diesem versteckten Subjekt auf Enthüllung gerichte. Dieses enthüllende
Interesse will das versteckte Subjekt aber eigentlich nicht primär verstehen, sondern
entdecken.
Paradoxer Weise wird das Subjekt dabei zugleich anerkannt und negiert, denn zur
Entfaltung dieser Dynamik ist zuerst die Annahme der Existenz notwendig. Wenn sich das
Interesse jedoch nicht auf das Verstehen des Subjekts richtet, so wird es in der
Kommunikation
eigentlich
nicht
als
solches
anerkannt.
Die
vielfache
und
widersprüchliche Stimme Kate Bushs macht es also unter Umständen unmöglich etwas
mitzuteilen, da weder den Worten noch dem Stimmklang geglaubt wird, sondern etwas
„Echtes“ angenommen und gesucht wird, das sowohl darin als auch außerhalb zu sein
scheint. Dieses „Echte“ ist jedoch das performativ produzierte Subjekt oder die
Innerlichkeit der Sängerin. In dem auf Enthüllung gerichteten Interesse an dieser
Subjektivität wird jedoch letztlich auch das Subjekt und nicht nur sein Körper potenziell
zum (begehrten) Objekt.
4.2.2 Kylie Minogue: „Can't Get You Out of My Head“
Ich möchte nun übergangslos ein anderes Musikbeispiel betrachten: Kylie Minogues
Erfolgshit „Can't Get You Out of My Head“. Es lassen sich in diesem Song vier
verschiedene Formteile differenzieren, die jeweils mit eigenen Stimmklängen einhergehen
und die ich hier kurz in der Reihenfolge ihres Auftretens darstellen möchte:
Nach einem kurzen Intro beginnt nicht nur eine, sondern gleich mehrere Frauenstimmen
beginnen mit „Lalala...“, wobei dieser imaginäre Chor durch die mehrfache Überlagerung
von Minogues Stimme entsteht. Einige hohe und sehr dünne Stimmen vermischen sich mit
tieferen, von denen allerdings keine einen sonoren Brustklang nutzt; allein schon diese
Fülle der Stimmen erzeugt dabei einen relativ weichen Gesamtklang, da rhythmische
Schärfen verloren gehen und verschwimmen, sowie harmonische Obertöne verstärkt
werden. Vor allem aber wirken diese Stimmen phantastisch, da ein solcher vervielfachter
und wieder mit sich selbst vermischter Stimmklang nur künstlich erzeugt werden kann
und nicht „natürlich“ klingt.
78
Die Melodie ist dabei recht einfach und besteht größtenteils aus rhythmischen
Wiederholungen224, wobei ein klarer, gut tanzbarer Rhythmus 225 entsteht. Der Einsatz von
Kopfstimmen, die Tonhöhe mit dem geringen Ambitus und der nicht sprachliche Text
legen dabei auch hier die Assoziation von maskenhaften Kinderstimmen226 nahe, wobei
der Rhythmus der Melodie mit den nicht ganz so anspruchslosen Offbeats dieser
Assoziation widerspricht.
Es folgt der Einsatz des Refrains mit einer einzigen zentralen Stimme und dem Text „I
just can't get you out of my head...“ in einem mechanisch klingenden Rhythmus, der das
Viertelmetrum deutlich betont. Die Stimme klingt dabei leicht gepresst und knarrend, was
sich u.a. an dem deutlich hörbaren Knarrgeräusch festmachen lässt, welches regelmäßig
bei „I“ z.B. bei „I just can't...“ auftritt. Die Knarrstimme wird hier nicht rein eingesetzt,
sondern der Stimme als Klangfarbe beigemischt; außerdem scheint die Klangbearbeitung
die Knarrgeräusche so zu verstärken, so dass sie sich klanglich an das perkussive ClapGeräusch auf der zweiten und vierten Zählzeit annähern. Dieser Einsatz der Knarrstimme
klingt einerseits verschlossen, durch die verschließende Anspannung der Stimmlippen, 227
presst aber andererseits immer noch Luft und Klang durch diesen selbst aufgebauten
Widerstand. Als knarrender Widerstand werden damit die Stimmlippen körperlich
hörbar.228
Auch hier ließe sich ein voyeuristisches Interesse annehmen, das durch das gleichzeitige
Verschließen und Öffnen der Stimmlippen hervorgerufen wird, so dass hier
gewissermaßen die Stimmlippen als eine Homologie zum Zugang zum Inneren der
Sängerin erscheinen können. Es liegt außerdem eine klangliche Nähe zum Stöhnen vor.
Insgesamt erscheint mir dieser Stimmklang dabei stark sexuell konnotiert, die Melodie mit
ihrem klarem Rhythmus bleibt jedoch relativ mechanisch, was eher Distanz erzeugt, die
sich aber wiederum auch als Begehren erzeugende Abwesenheit interpretieren ließe.
224Auf den Tönen f' und e'.
225 Etwa:│♩♩♩.♪│7 ♩♪♩♩│♩♩♩.♪│7 ♩♪♩♩│ Gute Tanzbarkeit zeigt sich in diesem Song auch in der klaren
viertaktigen Gliederung.
226Auch hier meine ich eine erkennbar maskenhafte Kindlichkeit.
227Zur Knarrstimme siehe S.49 dieser Arbeit. Diese Stimmgebung wird in der Popmusik relativ häufig
eingesetzt und ist beispielsweise der typische Stimmklang von Britney Spears [Vgl. Spears: „...Baby One
More Time“].
228Die Stimmlippen sind in jedem stimmhaften Klang hörbar, aber für gewöhnlich ist der Klang der
Stimmlippen so selbstverständlich, dass er kaum als solcher in Erscheinung tritt. Durch das Knarren, also
gewissermaßen durch diese bewusst eingesetzte „Fehlfunktion“ werden die Stimmlippen jedoch als
eigener Körperteil hörbar.
79
Nach einer fast unveränderten Wiederholung dieser beiden Abschnitte 229 folgt erneut ein
mehrstimmiger Abschnitt mit dem Text „Every night, Every day, Just to be there in your
arms.“. Der hier eingesetzte Stimmklang ist mit dem bei „Lalala...“ vergleichbar:
Mehrere Stimmen vermischen sich zu einem gemeinsamen Klang, der vor allem im
Kontrast zum direkt vorhergehenden knarrenden Refrain sehr weich und harmonisch
klingt. Dabei ist der Rhythmus der Melodie deutlich langsamer als in den
vorangegangenen Abschnitten, in denen der Viertelnotenpuls des Metrums durch den
Gesang unterstützt wurde. Der vergleichsweise kurze Text (13 Silben) verteilt sich auf
insgesamt sieben Takte,230 wobei deutliche Längen vor allem in der ersten Hälfte auftreten:
„E-v'ry nigh-t, E-very da-y“. Auch hier wird durch die Längen der Effekt eines
gespannten Wartens bei gleichzeitiger Fokussierung auf die Stimme erzeugt.
Ein solcher Fokus wird auch dadurch unterstützt, dass die Stimmen in der zweiten Hälfte
dieses Abschnitts, bei „Just to be there...“ sehr nahe erscheinen; insbesondere unter
Kopfhörern entsteht dabei der Eindruck, als würden die Stimmen auf beiden Seiten der_m
Hörenden direkt ins Ohr flüstern. Vor allem an dem direkt an den Lippen erzeugten
auffällig zischenden S-Laut in „just“ lässt sich dies gut nachvollziehen. Die Stimmen
klingen dabei in diesem Abschnitt insgesamt leicht behaucht und fast wie ein Seufzen.
Im folgenden Abschnitt fällt ein nochmals veränderter Stimmklang auf. Die Melodie mit
dem Text: „Won't you stay, Won't you lay, Stay forever and ever, and ever and ever“ liegt
im Tonraum von g' bis c'' und damit etwas höher als in den vorangegangenen Abschnitten,
die sich bisher zwischen c' und f' bewegten.231 Nach wie vor hören wir an dieser Stelle
mehrere Stimmen, die hier sehr stark behaucht sind. Behauchung wird mit den
Stimmlippen erzeugt, die bei der behauchten Stimmgebung nicht vollständig schließen,
wodurch ein Klang entsteht, der an ein Flüstern oder den Konsonanten H erinnert. 232 Der
Klang klingt dadurch in diesem Abschnitt nochmals deutlich weicher, da das weiche
Anlauten behauchter Worte für ein Verwischen rhythmischer Impulse sorgt. Die hohen
Kopfstimmen scheinen dabei in dem ganzen Abschnitt, aber vor allem auf dem extrem
229Es sollte erwähnt werden, dass der erste der beiden Abschnitte zu „lalala“ nur halb so lang ist. Da
dieser jedoch bei seinem ersten Auftreten in sich exakt wiederholt wird, kann an dieser Stelle von einem
einmaligen Auftreten dieses Formteils und beim ersten Auftreten von einem wiederholten gesprochen
werden. Im Gesang ist die Wiederholung so genau, dass hier wahrscheinlich erneut dieselben Aufnahmen
[=Takes] verwendet wurden.
230Der Abschnitt ist insgesamt acht Takte lang, wobei aber im letzten Takt nicht mehr gesungen wird.
231Die Tonangabe bezieht sich in den mehrstimmigen Abschnitten auf die tiefste Stimme. Insgesamt ist der
Ambitus des Songs relativ gering und leicht mitzusingen.
232Vgl. Kienast (2002), S.20.
80
langgezogenen (über drei Takte) „sta-ay“ und „la-ay“ körperlos zu schweben – einer
Assoziation, die sich an mehreren akustischen Merkmalen festmachen lässt:
Zunächst ist die Behauchung eigentlich nichts anderes als rauschhaft hörbare Luft, was
eine assoziative Nähe zu Schweben oder „sich-in-Luft-Auflösen“ aufweist. Dann sollte die
Kopfstimme bedacht werden, die hier eingesetzt wird und sich als ein Lösen vom
körperlicheren Brustklang interpretieren lässt, sowie die insgesamt höhere Tonlage, die in
eine direkte homologe Beziehung zu Höhe gesetzt werden kann. Außerdem lassen sich die
vermischten Stimmen auf den langgezogenen Vokalen von „stay“ und „lay“ nicht
fixieren, d.h. sie sind so sehr vermischt, dass es nicht möglich ist, sie zu differenzieren.
Aber zugleich können sie nicht in einem einzigen Ort im akustischen Raum zur Deckung
gebracht werden; es ist eher so, dass der Klang den Raum füllt und von überall her
kommt. Schließlich suggeriert die häufige textliche und melodische Wiederholung des
Phrasenendes „ever and ever and ever...“ eine gewisse Endlosigkeit.
Im gesamten Song wird schon durch die synthetische Instrumentierung ein phantastischer
Raum erzeugt und allein die Vervielfältigung der Stimme in weiten Teilen des Songs ist
weit von jedem Anspruch auf Echtheit entfernt, sondern verortet die Stimme(n) in einer
Phantasiewelt. Allein der knarrende Stimmklang erscheint dabei materiell oder körperlich,
ganz im Gegensatz zu den nicht fixierbaren vervielfältigten Stimmen im übrigen Song.
Allerdings wirkt dieser Stimmklang dennoch deutlich künstlich und vor allem im
Vergleich zum offenen Zugang, den die „echte“ Stimme bietet, eher verschlossen, so dass
ich diese klangliche Materialität des Körpers hier weniger als Präsenz des singenden
Subjekts, sondern eher als Ansatzpunkt für eine taktile Phantasie, also den vorgestellten
Zugang zum Körper der Sängerin, interpretieren würde.
Das Entschweben der Stimme(n) und das Verschließen der Stimmlippen in der
Knarrstimme lassen sich dabei einerseits als verschiedene maskenhafte Stimmklänge
interpretieren, die jeweils andere Phantasien ermöglichen, aber andererseits auch als
Zeichen der eigentlichen Unerreichbarkeit der Sängerin, die sich in Luft auflöst oder uns
zurückweist, damit aber unseren Wunsch nach einem entsprechenden Zugang nur
verstärkt. Insgesamt scheint dabei aber weniger ein Subjekt, sondern eher der Körper
Ansatzpunkt für ein begehrendes Hören zu sein: Dieser ist im Stimmklang zugleich
anwesend, als taktile Phantasie, wie abwesend, als reale Unberühr- und Unerreichbarkeit
der Sängerin.
81
Der imaginäre Chor der Stimmen platziert dabei den_die Hörer_in im Zentrum, was
besonders bei dem extrem nah erscheinenden Flüstern im Abschnitt nach „Every night,
Every day...“ gut nachzuvollziehen ist. Die vielfachen singenden Stimmen vermeiden
außerdem die Individuierung eines identifizierbaren singenden Subjekts; die Stimmen
kreisen vielmehr um den_die Hörende_n, der_die somit zum eigentlich relevanten Subjekt
des Songs wird.
Die deutlichen klanglichen Unterschiede in den einzelnen Abschnitten lassen sich dabei
verschiedenen Einsätzen der Stimmlippen als Klanggeneratoren zuordnen. Im Bezug zu
einer „echten“ Stimme erscheinen die unterschiedlichen Einsätze der Stimmklänge
(behaucht, knarrend) dabei weniger vom emotionalen Empfinden produziert, sondern eher
als bewusste und intendierte Zuordnungen zu den Abschnitten.
Der jeweilige Klang wird nicht aufgrund eines zu transportierenden Inhalts, sei dieser
somatisch oder auch textlich, erzeugt, sondern durch eine übergeordnete Entscheidung
kontrolliert. Wie bei Kate Bush lässt sich dieser Stimmklang dabei ebenfalls als semiotisch
bezeichnen: Zwar wird hier nicht mit dem Klang einzelner Worte gespielt, aber die
Abhängigkeit der Stimme vom Abschnitt (statt vom Inhalt) macht die Stimme ebenfalls zu
einem kontrollierten eigenständigen Objekt, das sich von den Empfindungen des Körpers
und vom sprechenden Subjekt trennt.
Die Unterschiede zu Kate Bushs Song sind dabei dennoch auffällig, denn Kylie Minogues
affirmativere Darstellung von sexualisierter Weiblichkeit wird hier nicht durch
ungewohnte Harmonien oder instabile Metren beunruhigend in Frage gestellt. Die klare
Trennung zwischen den jeweils eigenen Formabschnitten zugeordneten verschiedenen
Klangfarben lässt sich sicherlich leichter konsumieren als der ständige Wechsel, mit dem
Kate Bush uns konfrontiert. Und es ist dabei wahrscheinlich auch leichter sich auf die
produzierten Phantasien zu konzentrieren, da diese sich in einem konventionelleren
musikalischen Umfeld eher stabilisieren können, statt ständig durch Unterbrechungen und
Wechsel verunsichert zu werden.
Angesichts des künstlichen Klangs der Stimme ist die Annahme eines sich performativ
produzierenden Subjekts hier problematischer, denn wenn wir davon ausgehen, dass
dieses wie bei Kate Bush vor allem durch die Kontrolle entsteht, die über die Stimme
ausgeübt wird, so ist die Stimme hier hörbar Objekt technischer Bearbeitung und
unterliegt damit nicht der alleinigen Kontrolle des singenden Individuums. Es fällt mir
schwer in diesem Song ein performativ entstehendes Subjekt zu hören. Vielmehr erscheint
82
mir die Stimme als vollständig vom jedem Subjekt getrenntes Objekt, als ein rein
künstliches Phantasiegebilde.
Dieses Stimmobjekt ist dabei eine reine Oberfläche, ohne eine dahinter liegende
versteckte somatische Tiefe. Der Körper dieser Stimme lässt sich dabei ebenso nur als
Oberfläche interpretieren, über den visuelle oder taktile Phantasien entstehen können,
dessen somatisches Innenleben jedoch in diesem Klang nicht auftaucht.233
Es fällt nun leicht, diese klangliche Darstellung als objektivierende Sexualisierung von
Frauen zu kritisieren und eine solche Kritik ist durchaus angebracht, aber sie würde der
Heterogenität möglichen Konsumverhaltens nicht gerecht werden. Ich möchte nun einen
möglichen Umgang mit diesem Song skizzieren, der für Frauen ein nicht nur negatives
Potential birgt.
Hierzu möchte ich zuerst vorschlagen, diese klangliche Darstellung von Weiblichkeit als
eine akustische Entsprechung der allgegenwärtigen Präsenz von in der Regel namenlosen
und weitgehend entblößten gut aussehenden Frauenkörpern in der Werbung zu sehen. Ich
denke, dass die Parallelen zwischen diesen beiden Darstellungen auf der Hand liegen; der
weibliche Körper bzw. die weibliche Stimme wird entsubjektiviert und zum idealisierten
Objekt von Phantasie und Begehren gemacht. Überhaupt wird der weibliche Körper dabei
zu einem Objekt, das eher von außen betrachtet, bewundert und begehrt wird, als von
einem Subjekt bewohnt. Dabei ist vor allem die Allgegenwart dieser Darstellungen in
unserer Kultur zu berücksichtigen, die aus diesem idealisierten Frauenkörper nicht
irgendein begehrtes Objekt macht, sondern das begehrte Objekt schlechthin.234
233In Bezug auf Lacans Theorie des Objekt a lässt sich der Einsatz von Minogues Stimme als Fetisch
bezeichnen, indem das Objekt a das begehrte Objekt ersetzt bzw. die Beziehung zu diesem angestrebt
wird, statt ein wirkliches Subjekt oder einen wirklichen Menschen hinter der Stimme zu suchen, der z.B.
Liebe oder Begehren erwidern könnte [Vgl. Krips (1999), S. 28-32]. Ich möchte die Pathologisierung
gesellschaftlicher Zustände in dieser Arbeit vermeiden und habe mich daher gegen die Verwendung
dieses Begriffs im Fließtext entscheiden. Allerdings erzeugt diese Lesart Beziehungen zu anderen
Analysen von Fetischisierungen weiblicher Körper, beispielsweise in Mulveys Filmtheorie [Vgl. Mulvey
(1994)], die für eine tiefere Betrachtung durchaus produktiv sein könnten.
234Erneut würde sich hier die Interpretation als Fetisch anbieten, in der das das Begehren erzeugende
Objekt a selbst begehrt wird. Die dahinter liegende Leere (= die Abwesenheit eines realen Menschen in
der entsubjektivierten Darstellung) wird durch das Objekt selbst versteckt, wobei die Lust daraus
entsteht, die eigentlich offensichtliche Leere, für die das Objekt einsteht, möglichst lange zu verleugnen,
so dass das Begehren verlängert wird. Vgl. hierzu Krips (1999), S. 29: „ The sacrifice [= des eigentlich
Begehrten] is not without its compensation, since the suitor's engagement with the object a yields a
return of pleasure by stabilising his libido. Under such a regime, the object a takes on the role of what
Freud calls «the fetish».“ [Hervorhebung im Original] und ders. S. 32: „Fetishists are «irrational» in the
sense of not pursuing their desires. Instead, they attend perversely (as we say) to something else, the
fetish, which thereby functions as an impediment, a delaying mechanism, with respect to the attainment
of their desire. […] Nevertheless […] their actions, specifically their engagement with the fetish,
produces pleasure“.
83
Allerdings gibt es einen bedeutenden Unterschied zwischen einem Werbespot oder einem
Plakat und einem Popsong: Zu Musik kann getanzt werden. Damit meine ich, dass die
Beziehung zum Song tendenziell weniger distanziert ist, als zu einem Plakat, sondern im
Umgang mit Popmusik körperliche Aneignung zum Beispiel durch Tanzen, aber auch
durch andere körperliche Praxen, z.B. Mitsingen, möglich und wahrscheinlich ist.235
Gabriele Klein versteht Tanz als mimetische Aneignung der Musik, die dabei im eigenen
Körper aktualisiert und mit einem persönlichen Sinn versehen wird. Dieser ist zwar von
der Musik beeinflusst, aber nicht vollständig von ihr determiniert.236 Sicherlich gibt es
dafür bei diesem Song (wie bei jedem Song) unendliche Möglichkeiten, eine davon ist
jedoch sicherlich die verkörpernde Aneignung der sexualisierten und objektivierten
Stimme durch Frauen. Dies stellt eine aus feministischer Sicht sehr problematische
Reproduktion eines sexistischen Stereotyps dar, die den sexualisierten medialen
Frauenkörper in reale weibliche Körper einschreibt und so aktualisiert – und ich halte es
für notwendig diese Wirkungsweise von Popmusik, diese Vermittlung zwischen einem
medialen Stereotyp und realen menschlichen Körpern, als einen relevanten Faktor in der
gesellschaftlichen Reproduktion von Geschlecht zu erkennen und zu thematisieren. Doch
sollten wir ernst nehmen, dass diese Verkörperung aus den tanzenden Frauen nicht
automatisch passive Objekte macht, sondern es sich hierbei ganz im Gegenteil zuerst
einmal um eine körperliche Aktivität handelt, die freiwillig unternommen wird und
wahrscheinlich auch noch Spaß macht.
Diese Verkörperung eines sexualisierten und objektivierten Klischees von Weiblichkeit
bietet also eine positive Körpererfahrung, die sich nicht nur mit reinem Spaß an der
Bewegung erklären lässt – da dies für Sport in jeder Form zutreffen würde. Vielmehr
möchte ich die These vertreten, dass diese Verkörperung, die sich als eine bestimmte
kulturelle Kodierung des eigenen Körpers, konkret als eine Sexualisierung und
Verobjektivierung, verstehen lässt, auch eine Aneignung dieses kulturellen Kodes
beinhaltet, der damit nicht mehr äußerlich ist, sondern auch vom Individuum, das in der
Reproduktion Anteil an der Produktion des Intelligibilitätsrahmens hat, mitkontrolliert
wird. Anders gesagt wird der sexualisierte und objektivierte weibliche Körper als
begehrtes Objekt schlechthin von einem tanzenden Subjekt angeeignet, das damit über
235Ich denke nicht, dass dies bei visuellen Darstellungen unmöglich ist. Popmusik ist jedoch auch für den
körperlichen Umgang geschaffen worden und es gibt kulturelle Kontexte (Beispielsweise Diskotheken),
die ganz einem entsprechenden Konsum gewidmet sind. Daher ist es wohl angebracht, eine körperliche
Aneignung für einen Popsong als wahrscheinlicher anzunehmen, als für ein Plakat.
236Vgl. Klein (2004), S.260: „Aneignungsprozesse zwischen Leib und Wirklichkeit verlaufen auch im Tanz
als mimetische Vorgänge.“
84
dieses Objekt verfügen kann. Ich möchte also vorschlagen, diese tanzende Verkörperung
als Aneignung des eigenen Körpers in einer bestimmten kulturell geprägten Form zu
verstehen, oder, um es mit Butlers Performanztheorie zu sagen, die zitierende Performanz
von Weiblichkeit, die damit jedoch nicht nur einen objektivierten Körper sondern auch
und zugleich ein gesellschaftlich anerkanntes Subjekt herstellt, das diesen Körper besitzt.
Ich trenne hier also zwischen dem Körper, der tatsächlich zum Objekt wird, und dem
Subjekt, das zwar in diesem Körper steckt, aber nicht auf das Objekt reduzierbar ist. Was
hier meines Erachtens im Tanz entsteht, ist eine Handlungsfähigkeit, die zwar auf einer
den Körper objektivierenden Performanz von Weiblichkeit innerhalb der Grenzen des
Intelligibilitätsrahmens beruht, aber zugleich Macht und Kontrolle über diesen Körper in
seiner kulturell kodierten und damit gesellschaftlich lesbaren Form produziert.
Während also im Song ein phantastisches Objekt ohne Subjekt entsteht, so wird dieses auf
der Tanzfläche in wirklichen Körpern aktualisiert und von Subjekten angeeignet, die nach
Butlers Performanztheorie so überhaupt erst entstehen und dabei die symbolische Macht
dieses Objekts, insbesondere das gesellschaftliche Begehren danach, im eigenen Interesse
einsetzen können. Tanzen kann also, als eine Möglichkeit unter anderen, die Erfahrung des
eigenen sexuell kodierten Körpers als Quelle gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit
bedeuten. So entsteht eine positive Körpererfahrung, Lust oder Spaß, als Resultat der
Reproduktion einer objektivierenden Distanzierung vom eigenen Körper.237
Diese positive Erfahrung ist dabei sicherlich aufschlussreich für ein Verständnis der
weiblichen Beteiligung an der Reproduktion von Geschlecht. Ich möchte aber
vorschlagen, hier auch die Möglichkeit eines kritischen Potentials zu sehen, denn hier
steht die Erfahrung des eigenen Körpers, zwar als gesellschaftlich kodiertes Objekt, aber
dennoch als eigener, im Zentrum. Gerade vor dem Hintergrund der Geschichte
feministischer Kämpfe um diesen Körper wird vielleicht klar, wie wertvoll die Erfahrung
sein kann, selbst – und sei es nur im Tanz – über diesen Körper zu bestimmen.238 Die
Aneignung dieses sexualisierten Körpers und damit die Beteiligung an den
gesellschaftlichen Spielregeln einer bestimmten Geschlechterperformanz kann dennoch
für individuelle Tänzerinnen einen Zuwachs an Handlungsmöglichkeiten und einen
selbstbewussteren Umgang mit dem eigenen Körper bedeuten. Anders gesagt Frauen
beteiligen sich an der Reproduktion gesellschaftlicher Geschlechterperformanz, aber nicht
237Es stellt sich hier die Frage, ob diese positive Körpererfahrung nicht schließlich die Objektivierung des
Körpers überwinden kann. Die Frage lässt sich jedoch meines Erachtens nicht mehr anhand der hier
betrachteten Musik beantworten, weshalb ich ihr hier nicht weiter nachgehe.
238Die Bestimmung über den eigenen Körper, insbesondere der Kampf um sexuelle und reproduktive
Selbstbestimmung, ist eines der nach wie vor wichtigsten feministischen Themen.
85
als passive Objekte sondern als selbstbewusst Handelnde, was aus feministischer
Perspektive sicherlich kritisch zu sehen ist, aber aus individueller Perspektive einen
möglichen Umgang mit der problematischen gesellschaftlichen Positionierung als Frau
darstellt, die nicht entwertet werden sollte.
4.2.3 Björk: „All Is Full Of Love“
Ich möchte mich nun erneut einer anderen Sängerin und einer anderen akustischen
Subjekt- und Körper-Performanz zuwenden. Mein neuer Gegenstand ist der Song „All Is
Full Of Love“ von Björk. Auch hier lässt sich die Klanglichkeit des Songs als fiktiv
beschreiben: Es werden größtenteils synthetische Klänge eingesetzt sowie irreal wirkende
Echoeffekte. Die Instrumentation ist insgesamt relativ sparsam. Das Tempo ist recht
langsam (ca. 70 bpm), ein Viervierteltakt, der rhythmisch nur mit synthetisierten Bassund Perkussionsklängen markiert ist. Formal lässt sich der Song nicht so einfach gliedern,
zumindest erscheint mir eine Differenzierung in Strophe und Refrain nicht sinnvoll. Als
auffällige Zäsur bietet sich das Einsetzen einer zweiten zuerst höheren Stimme etwa in der
Mitte des Songs (bei 1:45 Minuten) an, die zwar nur eine Zeile „All is full of love“
wiederholt, aber im zweiten Teil des Songs zunehmend dominiert.
Im ersten Teil des Songs, also vor dem Einsetzen der zweiten Stimme, bewegt sich die
erste Stimme im Ambitus von b bis as', der dann mit dem Einsatz der zweiten Stimme im
Tonraum von f' bis des'' überschritten wird. Dabei ist das häufig wiederholte melodische
Motiv der zweiten Stimme zu „All is full of love“ [b'-des''-f'-as'-b'] sehr markant, das
bereits zu Beginn des Songs transponiert und in abgewandelter Form [f'-as'-b-des'-f] zu
„You'll be given love“ auftritt.
Der Rhythmus der Melodie ist allerdings schwer zu fixieren: Björk verzögert oft Töne
(beispielsweise bei „taken care of“) und singt insbesondere häufig gleichmäßige
Tonfolgen, die aber triolisch239 („Maybe not from the sources“) oder sogar quintolisch240
(„Maybe not from the directions“) sind und somit dem Vierviertelmetrum der Begleitung
widersprechen. Achtel werden nur sehr sparsam (z.B. bei „All is full of love“) eingesetzt
und kürzere Notenwerte werden im Gesang gar nicht verwendet. So wirkt die Melodie
ruhig und gleichmäßig, aber dennoch unvorhersehbar und relativ unabhängig von der
Begleitung, die dem klaren Vierermetrum folgt.
239Eine Triole ist ein Dreierrhythmus, der in der Regel einen erwarteten Zweierrhythmus ersetzt.
240Eine Quintole ist ein Fünferrhythmus, der einen geraden (Vierer- oder Zweierrhythmus) ersetzt.
86
Die Aussprache Björks erschwert dabei oft die Fixierung eines melodischen Rhythmus:
Worte werden hörbar in Silben und diese in Laute unterteilt, deren einzelne Klänge so
deutlich zu hören sind, dass eine auf sprachlichen Silben basierende Rhythmik die
wesentlichen Impulse des Gesangs zu verfehlen scheint. Beispielsweise in der Phrase „It's
all around you“ werden die Worte „around“ und „you“ klanglich miteinander verbunden
und die Konsonantenkette N-D-Y wird so langsam gesungen, dass jeder Laut einzeln
hörbar wird und es schwerfällt, einen einzigen rhythmischen Zeitpunkt für den
Silbenwechsel festzulegen. Ähnlich wird bei „You are staring at“ das S von „staring“ so
lange ausgehalten, dass das folgende T zu einem getrennten musikalischen Ereignis wird.
Der Rest des Wortes hingegen wird so undeutlich und unbetont ausgesprochen, dass es
fraglich ist, ob die zweite Silbe „-ring“ als eigener rhythmischer Moment zählen kann.
Insgesamt bietet sich auch hier die Bezeichnung semiotisch an, um diese Fokussierung auf
die Laute zu beschreiben. Diese ruhige Langsamkeit erzeugt dabei außerdem auch hier ein
begehrendes Warten, auf den nächsten Buchstaben, die nächste Silbe, das nächste Wort... .
Auffällig ist des Weiteren die häufig hörbare Atmung: Ein leises Einatmen (im folgenden
symbolisiert mit: [<]) ist häufig vor Zeilenbeginn hörbar, z.B. vor dem zweiten „You'll be
given love“, vor „You are staring at“, vor „Trust you head around“ und regelmäßig vor
„All is full of love“ im Gesang der ersten Stimme. Es tritt aber auch als verzögerndes
Moment innerhalb von Zeilen auf, z.B. beim zweiten „You'll be given [<] love“, bei „It's
all [<] around you“ und bei „All is full of [<] love“. Hierbei entwickelt sich durch die
hörbare Einatmung, an deren Ende körperliche Spannung steht, und die Unterbrechung
des Satzes eine Anspannung, die im singenden Ausatmen des jeweils nachfolgenden
Wortes gelöst wird, so dass sich hier beim Hören mit großer Wahrscheinlichkeit ein
Gefühl der Entspannung einstellt.
Der Klang der Sprache wird insgesamt häufig durch die Klangbearbeitung hervorgehoben,
z.B. bei „You'll be taken care of“ werden die Plosive bei „taken care“ mit einem
Echoeffekt betont, der auch im Folgenden häufig, vor allem bei plosiven und S-Lauten,
eingesetzt wird. Dabei ist bei diesem Echoeffekt seine Ähnlichkeit zur Klanglichkeit der
Begleitung zu bemerken. Vor allem in dem Abschnitt bei „Maybe not from the sources ...“
vermischt sich der Klang dieses Effekts mit der synthetischen Begleitung, die ebenfalls
einen leicht S- oder T-artigen Geräuschanteil in derselben Tonlage hat.
Solche klanglichen Verbindungen von Begleitung und Gesang lassen sich auch zwischen
den O-Vokalen von „all“, „around“ und „love“ und den sonoren Basstönen der
Begleitung feststellen. Schließlich, in der zweiten Hälfte des Songs nach dem Anstieg der
87
ersten Stimme in den Tonraum der zweiten, scheint sich der Gesang zunehmend mit der
nun dichteren Begleitung zu vermischen, so dass oftmals nicht klar zu unterscheiden ist,
welcher Klang von der Stimme und welcher von der Begleitung stammt.241
Die zweite Stimme, die nur ihre eine Zeile „All is full of love“ scheinbar endlos
wiederholt, entsteht dabei aus einer klanglichen Vorbereitung in der Instrumentation und
ist schon bei ihrem Einsetzen deutlich synthetisiert und klanglich mit der Begleitung
verbunden, so dass sie auch zuerst eher als Teil der instrumentalen Umgebung
wahrgenommen wird. Relevant für diesen Eindruck ist sicher auch, dass die erste Stimme
zentral und relativ nahe im akustischen Raum positioniert ist, während die zweite weiter
entfernt, nach links verschoben und wie durch eine Art akustisches Hindernis verändert zu
hören ist.
Die zweite Stimme erscheint klanglich stark behaucht und gewissermaßen sphärisch,
womit ich meine, dass ein h-artiges Geräusch im Klang präsent ist, der harmonische Anteil
gedämpft wirkt und ein starkes Echo die rhythmischen Impulse der Sprache verwischt;
dabei ist hier aber kaum entscheidbar, was von diesem Effekt durch den Gesang und was
durch die starke Bearbeitung entstanden ist. Diese Stimme ist zuerst noch relativ leise,
wird aber im weiteren Verlauf lauter. Schließlich setzt die erste Stimme zunehmend aus, so
dass am Ende des Songs diese zweite Stimme übrig bleibt und somit die erste Stimme
ersetzt.
Ab etwa 3:30 gehen die Echos des Gesangs der nun alleine übrig gebliebenen zweiten
Stimme so in die Hintergrundklänge über, dass Beginn und Ende der Phrasen kaum hörbar
sind bzw. fehlende Worte (wie das teilweise fehlende „All is“) oder Laute (das Ende von
„love“) in die Begleitung projiziert werden können. Stimmklang und Instrumente
erscheinen wie vollständig miteinander verschmolzen und der sprachliche Inhalt des
Satzes „All is full of love“ scheint sich musikalisch durch die Allgegenwart des Wortes
„love“, dessen Ende schließlich nicht mehr auszumachen ist und das echoartig von einer
Seite zur anderen durch den imaginären akustischen Raum pulsiert, auszudrücken. Auch
hier scheint mir die Bezeichnung semiotisch für diesen Einsatz der Stimme, in der der
Klang der Worte die Musik zu strukturieren scheint, angemessen.
241Auch der melodische Anstieg bei „Impeding me laying down“ gibt für diese Vermischung ein sehr gutes
Beispiel, denn der mit „down“ erreichte Zielton b' fällt mit dem Einsatz mehrerer synthetischer
Instrumente zusammen, von denen viele sehr weich streicher- oder klarinettenartig klingen und sich gut
mit dem ausgehaltenen Ton der Gesangsstimme vermischen, mit der sie eine Lage teilen. Auch der Klang
der ersten Stimme wird dabei stärker bearbeitet, er wirkt behauchter und scheint sich der synthetischen
Begleitung anzunähern.
88
Die Beziehung der beiden Stimmen zueinander lässt sich dabei zuerst – in den acht Takten
nach dem Einsatz der zweiten Stimme und vor dem Anstieg der Ersten – als eine starke
antagonistische Spannung, basierend auf der Nutzung unterschiedlicher Tonräume,
Stimmklänge und Melodien, beschreiben. Diese Spannung wird dann mit dem Anstieg der
ersten Stimme bei „Impeding me laying down“ und der nachfolgenden Übernahme von
Melodie, Ambitus und Text der zweiten Stimme gelöst. Ab diesem Zeitpunkt, der etwa bei
2:10 Minuten liegt, also noch vor der Hälfte des Songs, und den ich als musikalischen
Höhepunkt des Songs bezeichnen möchte, tritt eigentlich kein neues musikalisches oder
textliches Material auf, so dass in der gesamten zweiten Hälfte ein Zustand der
Entspannung nach dieser Entladung bestehen bleibt.
Der Song baut sich ab diesem Punkt nach und nach ab, Instrumente und die
Gesangstimmen setzen aus bzw. werden leiser und schließlich klingt der Song im Nichts
aus, wobei die Klanglichkeit des Outro an das instrumentale Intro erinnert, das sich ebenso
langsam aufgebaut hat. Der Song erhält so auch einen zyklischen Charakter und hat
keinen wirklichen Abschluss sowie keinen wirklichen Anfang; stattdessen scheint er
immer schon bzw. noch da zu sein.
Der in diesem Song performativ produzierte Körper ist erneut phantastisch: Die
synthetische Klanglichkeit des Songs, die Bearbeitung des Gesangs, Echoeffekte und das
zunehmende Verwischen der Grenze zwischen Gesang und Instrumenten verorten die
Stimme im Fiktiven, wobei jedoch im Gegensatz zu der sexualisierten Phantasiewelt, die
Kylie Minogue präsentiert, der Körper weniger zur Projektionsfläche wird, sondern sich
viel mehr aufzulösen scheint. Die Stimme hat keine menschlich-körperliche Quelle mehr,
sondern verschmilzt mit ihrer akustischen Umwelt, und diese körperlose Stimme weckt
Assoziationen einer Art göttlichen Stimme oder der Stimme der Natur, welche nicht von
dieser Welt zu sein scheint. Diese Stimme ist nicht die Stimme eines einzelnen
menschlichen Individuums, sondern die akustische Verkörperung eines absolut Anderen,
das hier wahrscheinlich nicht zufällig in einer weiblichen Stimme zu uns spricht.
Diese Stimme formuliert eine sprachliche Botschaft, „All is full of love“, die sie ständig
wiederholt und die im Gegensatz zur individuell emotionalen Mitteilung der „echten“
Stimme durch die übermenschliche Klanglichkeit der Stimme den Charakter einer
absoluten unumstößlichen und überindividuellen Wahrheit erhält. Diese verbale Botschaft
materialisiert sich zunehmend im Klang: Die sprachlichen Laute werden musikalisch von
der Instrumentation übernommen und das Wort „love“ erscheint schließlich überall im
89
Klang, was dem semantischen Sinn der Botschaft entspricht. Materiell wird hierbei jedoch
vielmehr die Sprache als der Körper der Sängerin, denn es ist hier der Klang der Worte
und nicht der eines Körpers, der im Zentrum der musikalischen Präsentation steht.
Ich bezeichne den sprachlichen Inhalt dabei nicht zufällig als Botschaft, denn Björks
Stimme erhält in diesem Song tatsächlich eine Art vermittelnde Position; sie transportiert
und verkörpert die Mitteilung einer dritten transzendenten und absoluten Subjektivität, die
allerdings auch nur durch diese spezielle musikalische Präsentation performativ entsteht.
Die Botschaft wird dabei mit einer entsprechenden Autorität ausgestattet; sie ist nicht die
emotionale oder subjektive Mitteilung einer einzelnen Person, sondern erhält den
Charakter einer objektiven Wahrheit. All dies geschieht jedoch auf Kosten eines
menschlichen individuellen Subjekts, das in diesem Song zum reinen Kanal für die
transzendente Botschaft wird.
Während ein solches menschlich individuelles Subjekt im Song tendenziell negiert wird,
entsteht eine Art übermenschliches Subjekt, dem sich Attribute, wie körperlos (durch die
wie beschrieben körperlos klingenden Stimmen) ewig (durch die zyklische Struktur des
Songs, die scheinbare Endlosigkeit und die ständige Wiederholung der Botschaft) und
Allgegenwart (durch das Verschmelzen mit der musikalischen Umwelt) zuordnen lassen.
Die Spannungsdynamik des Songs, die sich auf kleinem Raum in der entspannenden
Betonung von auf ein Einatmen folgenden Worten wie „love“ und „around you“
präsentiert und sich auf den gesamten Song bezogen in der affirmativen Bestätigung und
Wiederholung von „All is full of love“ durch beide Stimmen ausdrückt, enthält dabei eine
Art musikalisches Erfüllungsversprechen: Die körperlose Stimme einer belebten Umwelt
verspricht uns immer und überall Liebe.
Dabei erinnert diese Figur sehr an das in der Psychoanalyse verbreitete kulturelle Idealbild
ursprünglicher Ganzheit mit der Mutter. Kaja Silverman beschreibt dies in „The Accoustic
Mirror“ mit Bezug auf den Einsatz weiblicher Stimmen im Film folgendermaßen:
„the trope of the maternal voice as sonorous envelope grows out of a powerful cultural
fantasy, a fantasy which recent psychoanalytic theory shares with classic cinema. The fantasy
in question turns upon the image of infantile containment – upon the image of a child held
within the environment or sphere of the mother's voice.“242
Björks nicht mehr in ihrem Körper lokalisierbare und entgrenzte Stimme lässt sich als eine
Spielart dieser Klanghülle („sonorous envelope“), die hier nicht ein fiktives Kind sondern
ein wirkliches Publikum umgibt, verstehen. Mutter und Kind bilden dabei in diesem
242Silverman (1988), S. 72.
90
frühkindlichen Idealbild eine Einheit, wobei die Mutter eine, aus der Perspektive des
Kindes, noch nicht wirklich von dem Kind getrennte Umwelt bildet.
Im analysierten Musikbeispiel fiel bereits die Entkörperung des Stimmklangs auf. Wenn
wir den Song als klangliche Reminiszenz an einen angeblichen ursprünglich infantilen
Idealzustand interpretieren, so erscheint die Entkörperung der Stimme hier regelrecht
notwendig, da nur in der Grenzenlosigkeit des körperlosen Stimmklangs dem Publikum
die bruchlose vollständige Einheit und Einhüllung in die (mütterliche) Stimme vermittelt
werden kann, die das kulturelle Klischee der ursprünglichen Ganzheit mit der Welt
verspricht. Die Unmöglichkeit zwischen der Stimme und den Instrumenten eindeutig zu
unterscheiden, deutet außerdem eine weitere Homologie zur Ununterscheidbarkeit von
eigenem und anderem sowie der Unfähigkeit weiterer Differenzierung der Umwelt in
dieser idealisierten infantilen Vor-Subjektivität an.
Mit den Körpergrenzen verschwindet jedoch auch die Möglichkeit die „Mutter“, wenn wir
diese entkörperte sphärische Stimme vorübergehend so nennen wollen, als Individuum
wahrzunehmen. Sie wird dabei zugleich zum anderen, nämlich zu etwas Körperlosem
eigentlich nicht mehr Menschlichem aber dennoch Idealisierten, und zu etwas eigenem –
zuerst einmal als Umgebung, dann jedoch im nächsten Schritt zu einer Art Extension des
eigenen Körpers über dessen Grenzen hinaus.
Diese zauberhafte Vereinigung mit der Musik geschieht hier anders als bei der „echten“
Stimme nicht durch emotionale Empathie mit der mitgeteilten somatischen Empfindung,
sondern durch die Offenheit der körperlosen Stimme, die eben, da sie sich ohne
somatische Tiefe und ohne feste physische Körpergrenzen präsentiert, das Phantasma
einer solchen Verschmelzung zulässt.
4.2.4 Birdy: „People Help The People“
Ich möchte nun als letztes den Song „People Help The People“ von Birdy betrachten. Der
Song beginnt ähnlich wie „Feel It“ von Kate Bush allein mit Klavier und Gesang und
erzeugt somit eine eher intime Atmosphäre, es kommen jedoch im Verlauf des Songs
weitere Instrumente und Stimmen hinzu, die vor allem im letzten Refrain den Eindruck
von Kollektivität vermitteln. Der Song enthält damit eine sehr starke Entwicklung, die ich
in ihrer Bedeutung untersuchen möchte.
Zunächst jedoch ein Überblick: Der formale Aufbau lässt sich vor allem anhand der
Instrumente recht einfach heraushören: Nach einem kurzen instrumentalen Intro (Klavier
91
alleine) folgt die erste Strophe „God knows..“, die ebenfalls nur vom Klavier begleitet
wird. Im ersten Refrain „People help the People...“ wird das Klavier mit Bass und Cello
ergänzt, die jedoch in der anschließenden kurzen Überleitung „Oh and if I had...“ wieder
aussetzen. Diese Struktur von Auf- und Abbau wiederholt sich in der zweiten Strophe und
im zweiten Refrain, wobei die Instrumentation jedoch insgesamt voller ist: Mit der
zweiten Strophe setzen zusätzlich zum Klavier Bass, E-Gitarre, Schlagzeug und Streicher
ein. Und im folgenden Refrain wird der Gesang von einem Hintergrundchor unterstützt. In
der nachfolgenden Überleitung wird erneut die Instrumentation zurückgenommen; die
Stimme ist wieder ohne Hintergrundchor, das Schlagzeug setzt aus und die übrigen
Instrumente sind stärker zurückgenommen.
Es folgt nun ein instrumentales Zwischenspiel, in dem zuerst Streichinstrumente (Celli
und höhere Streicher in Oktaven) melodisch dominieren, die dann aber in der
Wiederholung weitgehend unisono mit der Gesangsstimme („Nana Nanana Uhhh...“)
ergänzt werden. Es folgt ein weiterer Refrain – erneut mit starker instrumentaler
Besetzung und Hintergrundchor und eine letzte Überleitung, die wieder sparsamer
instrumentiert ist und in der alle Instrumente nach und nach aussetzen, bis ganz zum
Schluss, wie zu Beginn des Songs, nur noch das Klavier übrig ist und ein paar letzte Töne
spielt.
Birdys Gesangstechnik verändert sich in den einzelnen Abschnitten ebenfalls. In der ersten
Strophe, deren wellenartige vor allem aus Terzbewegungen in entspannter Lage (b bis f')
bestehende Melodie bereits stark an «Seufzer» erinnert, wird von der Sängerin diese in der
Melodik enthaltene Assoziation durch besonders starke Betonung der hohen Noten auf der
jeweils ersten und dritten Zählzeit und sehr starke dynamische Rücknahme der tieferen
Noten dazwischen unterstützt. Des Weiteren werden einige dieser «Seufzer»,
beispielsweise auf dem ersten „weak“, auf „kissed“ und „angels“ leicht verzögert, was
vor allem durch die entsprechende verzögerte Reaktion des Klaviers gut zu hören ist und
den durch das Seufzen erweckten Eindruck von Trauer weiter verstärkt. Auf Worten wie
„what“, „weak“ und „hearts“ ist außerdem eine Art kurzes Vibrato, eine Art Zittern der
Stimme, im Wort hörbar, das eine leichte Unterbrechung im Wort erzeugt: „w-hat“, „weak“ und „he-arts“. Der dabei entstehende Effekt erinnert an eine unkontrollierte Atmung,
wie sie auch beim Weinen entsteht und unterstützen damit ebenfalls die Assoziation von
Trauer.
Im Refrain ändert sich die Melodie, die nun in einem deutlich höheren Tonraum bis b'
liegt und sehr stark das wiederholte Wort „people“ betont. Dieses Wort wird auf den
92
Tönen as', b' und f' gesungen. Die kurze Verzierung der ersten Silbe zum b' nach oben
wird dabei jedoch nicht melismatisch gebunden gesungen, sondern wie eine eigene Silbe
behandelt: „pe-he-ple“ [statt: „pe-e-ple“]. Diese Artikulation erinnert an das hörbar
stoßweise und unkontrollierte Atmen beim Schluchzen,243 was durch die hohe Tonlage
zusätzlich unterstützt wird. Diese Assoziation, die erneut Weinen suggeriert, wird
außerdem durch die sehr häufig hörbare Atmung244 und den erneuten Einsatz des schon
erwähnten Vibratos beispielsweise auf „h-and“ und „dra-ag“ verstärkt. So entsteht auch
hier der starke Eindruck mangelnder Kontrolle über die Atmung – wie im emotionalen
Zustand von Schmerz und Trauer.
Auch in der Überleitung, die melodisch insgesamt von einem wellenartigen Oktavabstieg
vom b' zu b geprägt ist, wird das schon erwähnte Vibrato beispielsweise auf „h-ad“ , „tuurned“ und „he-arts“ eingesetzt. Melodische Seufzer, wie bei „if I“ und dem gleich
folgenden „had a“ werden auch hier von der Sängerin mit einer deutlichen laut-leiseDynamik unterstützt. Insbesondere am Ende der Überleitung scheint dabei die leiser
werdende Stimme regelrecht zu versagen, wenn beispielsweise der abschließende
Konsonant von „goo[d]“ verschluckt wird, das Vibrieren in der Stimme auf „turned“ und
„hearts“ deutlich zunimmt und die abschließende Silbe von „a-wa-hy“ ebenso mit einem
erneuten Ansetzen unterbrochen wird, wie „pe-he-ple“.
Trotz des insgesamt einheitlichen Eindrucks von Schmerz und Trauer bis hierhin möchte
ich dennoch ein paar Veränderungen herausarbeiten: In der Strophe dominiert ein leises
Zögern, das sich vor allem in knackend knarrenden Unklarheiten am Ansatz der Worte,
Behauchung und insgesamt recht starkem Vibrato zeigt (wie bei „g-hod“ und „w-hat“).
Im Refrain, bei „Pe-he-ple“, wird dieses Zögern von einem sehr klaren plosivem Ansatz
in höherer Lage abgelöst, der deutlich mehr Körperspannung beansprucht. Während die
Strophe so einen eher introvertierten Eindruck vermittelt, ist der Einsatz des Refrains
stärker nach außen gerichtet; er wirkt deutlich appellativer und energischer, bleib aber
dennoch durch das scheinbar unkontrollierte Schluchzen im Zustand der Trauer gefangen.
Das singende Ich scheint hier verzweifelt um Hilfe zu bitten, weinend, schluchzend und
schreiend zugleich. Der Übergang von einem zum anderen Zustand passiert dabei nicht
abrupt, sondern wird in der Strophe nach und nach vorbereitet und im Refrain nach dem
expressiven „pe-he-ple“ auch schnell wieder abgebaut.
243 Ebenso: „Nothing will drag you-hu down.“
244 > = hörbare Einatmung: „> Peheple > help the peheple, >And if your homesick, > Give me your hand
and I'll hold it. > Peheple > help the peheple, > Nothing will drag you down.“
93
Auch in der zweiten Strophe lassen sich deutliche Zeichen von Trauer festmachen,
beispielsweise im schon erwähnten Vibrato auf „w-orld“, „th-ousands“, „he-arts“, „leoneliness“ und der auch im Vergleich zur ersten Strophe sehr häufigen hörbaren Atmung,
die teilweise innerhalb der Phrasen auftritt245 und ebenfalls an ein Schluchzen oder
Seufzen erinnert. Die zweite Strophe ist jedoch vor allem durch den Einsatz der
vollständigeren Instrumentation, insbesondere dem nun zum ersten Mal einsetzenden
Schlagzeug, geprägt.
Der Rhythmus geht nun gleichmäßig bis zum Ende der Strophe durch. Auch die Stimme
klingt kraftvoller, als in der ersten Strophe, was sich vor allem in der Lautstärke und dem
nun klaren Rhythmus zeigt. Sie erscheint dabei wie von den Instrumenten getragen, wobei
vor allem die halbtaktige Aufwärtsbewegung der E-Gitarre zu erwähnen ist, da sie einen
starken vorwärts treibenden und aufwärts strebenden Gegenpol zur traurigen abwärts
gerichteten Melodie bildet, während sie zugleich die halbtaktige Unterteilung der
melodischen Wellenbewegung unterstützt. Es entsteht so ein tröstender Eindruck: Die
Instrumente rahmen die Stimme harmonisch, bieten ein stabiles rhythmisches Gerüst und
eine aufwärts gerichtete Alternative zur traurigen Melodie.
Im zweiten Refrain schließlich wird die schon recht volle Instrumentation mit einem
Hintergrundchor ergänzt, der zwar mit Birdy unisono singt, aber klanglich schwächer ist,
so dass der Sologesang weiterhin im Vordergrund steht. Der Klangeindruck ist des
Weiteren von einem eher flächenartigen Streicherklang geprägt, der mit dem sehr weich
klingenden Chor246 verschwimmt. Birdys Gesang weicht auch hier vom ersten Refrain ab,
sie klingt insgesamt leicht kraftvoller und atmet deutlich weniger. 247 Die neu angesetzte
Silbe in „pe-he-ple“ erhält nun eine neue Bedeutung, denn sie erinnert im veränderten
klanglichen Kontext weniger an ein Weinen, sondern das weiche anlautende h verschmilzt
mit dem Hintergrundchor und den Streichern, was eher einen tröstenden Eindruck
hinterlässt: Die zuvor einsame Stimme wird von einem klanglichen Kollektiv, der vollen
harmonischen Einheit aus instrumentalem und Chor-Klang, aufgenommen. In der
nachfolgenden Überleitung fällt die Stimme jedoch wieder in die Einsamkeit zurück:
Schlagzeug und Chor setzen aus und die Instrumentation wird sparsamer.
245 > = Einatmen: „> God knows what is hiding, In this world of little consequence. > Behind the tears, >
inside the lies, A thousand slowly dying sunsets. God knows what > is hiding, > In those weak and
drunken hearts. > 'guess the loneliness came knocking, No one needs to be > alone, oh singing,“
246Dieser weiche Klang entsteht, weil das Anlauten nicht exakt ist, d.h. durch die nicht gleichzeitig
einsetzenden verschiedenen Stimmen verwischt.
247Nur nach „homesick“ und vor dem zweiten „People help the people“.
94
Es folgt der instrumentale Zwischenteil. Die zuerst von Streichern in Oktaven gespielte
Melodie wird zweimal wiederholt, wobei die höheren Streicher in den Wiederholungen
teilweise vom Gesang unisono ergänzt werden. Dabei wird kein Text gesungen, sondern
kaum verständliche Silben, zuerst wird die Melodie dabei syllabisch mit „Nana..“ oder
„Lala..“ ergänzt, dann folgt ein langgezogener melismatisch absteigender „Uhh“-Laut.
Die Stimme erscheint dabei offensichtlich bearbeitet, sie ist deutlich weiter entfernt, als
bisher im Song und klingt wie durch ein Hindernis hindurch, sie ist außerdem behaucht
und mit einem Halleffekt versehen. Der Klang der Stimme ist dabei teilweise, vor allem
beim „Uhh“, nur schwer von den Instrumenten zu unterscheiden und vermischt sich mit
dem oktavierten Klang der Streichinstrumente. Die Sängerin erscheint dabei wie in Trance
und ich möchte auch hier von einem sphärischen Klangeindruck sprechen. Der hier
verwendete leichte Stimmklang im Ambitus f' bis b' scheint sich dabei ebenfalls vom
Körper zu lösen und zu schweben.
Im anschließenden letzten Refrain tritt erneut der Hintergrundchor hinzu, der nun aber
etwas lauter ist, als im zweiten Refrain. Birdys Stimme scheint dadurch viel stärker mit
dem klanglichen Kollektiv des Chors verbunden; beide scheinen nun eine Einheit zu
bilden und Birdys Stimme ist nun Teil dieses trostspendenden Kollektivs.
Schließlich endet der Song mit einer letzten Überleitung, in der die Stimme wieder alleine
ist, das Schlagzeug aussetzt und auch die übrigen Instrumente nach und nach verstummen,
so dass letztlich das an den Anfang erinnernde Klavier alleine übrig bleibt. Die Stimme
wird dabei zunehmend leiser und fällt ebenfalls in den durch häufigen Vibratoeinsatz
geprägten zögernd-traurigen Stimmklang des Anfangs zurück.
Ich möchte diesen Song nun als klangliche Narration einer Verwandlung interpretieren, an
deren Beginn ein einsames Subjekt empfundenen Schmerz mitteilt, das dann aber in eine
trostspendende Figur transformiert wird, die stark an die im letzten Teil besprochene
„mütterliche“ Klanghülle erinnert. Dabei wird zuerst das traurige singende Subjekt von
den trostspendenden Instrumenten klanglich eingehüllt, um dann im nächsten Schritt
selbst zum Teil dieses Kollektivs zu werden, das seine emotionale Unterstützung
schließlich dem Publikum anbietet.
Die einsame Stimme zu Beginn des Songs lässt sich dabei durchaus als „echte“ Stimme
verstehen; sie ist geprägt durch somatischen unbewusst und unkontrolliert erscheinenden
Ausdruck. Wie bei den männlichen Beispielen der „echten“ Stimme lädt diese Darstellung
zum empathischen Nachempfinden und zur Identifikation ein, was die gerade
beschriebene narrative Dynamik beschleunigt, denn das sich identifizierende Publikum
95
wird bereits ab der zweiten Strophe gemeinsam mit dem singenden Subjekt von den
trostspendenden Instrumenten umhüllt und verschmilzt mit beiden.
Bevor ich mich jedoch dieser Transformation zuwende, möchte ich zuerst auf die im
ersten Teil des Songs präsente „echte“ Stimme eingehen und diese mit den zuvor
analysierten Beispielen dieses Stimmeinsatzes vergleichen. Dabei fällt auf, dass Birdy in
ihrem Song vor allem Trauer und Schmerz mitteilt.
Ihr Gesang und insbesondere ihre Atmung erscheint dabei stark von ihrem emotionalen
Zustand beeinflusst zu sein und nicht mehr ihrer bewussten Kontrolle zu unterliegen. Zwar
sind die hierfür verantwortlichen musikalischen Mittel, das Vibrato, die hörbare Atmung,
die starke Betonung der Seufzerbewegung usw., sehr wahrscheinlich bewusst für den
beabsichtigten Effekt eingesetzt worden, wie ich aber bereits argumentiert habe, ist die
Glaubwürdigkeit der somatischen Mitteilung notwendig für die „echte“ Stimme; wenn wir
also Birdy die Echtheit ihrer Trauer glauben, so glauben wir ihr auch, dass sie ihre Stimme
und ihre Atmung aufgrund ihres emotionalen Zustandes nicht bewusst kontrollieren kann,
d.h., dass die Stimme bricht, weil sie traurig ist. Sie erscheint dabei hilfloser, als die
behandelten Beispiele männlicher „echter“ Stimmen, die vor allem durch körperliche
Anspannung die Ernsthaftigkeit und Echtheit ihrer emotionalen Zustände betonen. Birdy
scheint demgegenüber ihren Gefühlen viel mehr ausgeliefert zu sein, sie kann ihre für die
Atmung notwendige Körperspannung scheinbar nicht mehr kontrollieren. Ihre
Expressivität erscheint weniger als eine selbstbewusste emotionale Mitteilung, sondern
als ein verzweifelter Hilferuf.
Ich möchte dies gerne auf einer anderen Ebene beleuchten und daher auf einen anderen
Song und eine Analyse von Laurie Stras verweisen: „Will You Still Love Me Tomorrow“
von den Shirelles ist ein Song aus den frühen 60er Jahren, dessen Erfolg Stras sehr
überzeugend auf die jugendlichen Schwächen der Stimme von Sängerin Shirley Owen
zurückführt.248 Stras schreibt in Bezug auf die äußerst auffällige Bridge des Songs:249
„The plaintive quality of her edged-up throat resonance accurately dates her voice without
exposing it too cruelly, but the comfortable, lower-pitched hook on the song's title phrase
allows the memory to retain the pleasanter sound of her relaxed chest voice.
The way this record exploited Owen's teenage vocal vulnerability to its best advantage, rather
than disguising it or avoiding problem areas, appears to have been something of a
revelation.“250
248Vgl. Stras (2011), S.47 – 49.
249Mit dem Text: „Tonight with words unspoken, you said that I'm the only one, but will my heart be
broken, when the night meets the morning sun“.
250Dies., S.49.
96
Die stimmliche Schwäche wird hier zur Attraktion des Songs. Stras' Wortwahl ist dabei
bemerkenswert: Die Stimme wird ausgestellt („expose“), ausgenutzt („exploit“) und
schließlich zur Offenbarung („revelation“). Offenbart und ausgestellt wird dabei vor allem
das jugendliche Alter und die Verwundbarkeit der Sängerin, 251 die sich in der stimmlichen
Schwäche zeigen. Owen hat dabei weder die Kontrolle über ihre Stimme noch über ihre
klangliche Selbstdarstellung, die wie Stras' Worte nahelegen, von dritter Seite inszeniert
wird.
Gerade das Unbeabsichtigte der Schwäche erscheint dabei als Garant für die sich
offenbarende „Echtheit“. Einen ähnlichen Zusammenhang beschreibt Kaja Silverman im
Bezug zum Schrei im Film:
„What is demanded from woman – what the cinematic apparatus and a formidable branch of
the theoretical apparatus will extract from her by whatever means are required – is involuntary
sound, sound that escapes her own understanding“252
Dieses Zitat legt nahe, dass die unkontrollierte Äußerung nicht nur ein schlichtes
kulturelles Attribut für Weiblichkeit ist, sondern auf ein gesellschaftliches Interesse oder
eine kulturelle Erwartungshaltung antwortet. Wie ich bereits dargestellt habe, interpretiert
Silverman den Freudschen Kastrationskomplex als die einseitige Projektion von
Kastration bzw. Mangel auf Frauen.253 Auch dieser Song kann als Unterstützung dieser
kulturellen Projektion von Mangel, Unvollständigkeit oder Schwäche auf den weiblichen
Körper gelesen werden.254
Wesentlich erscheint mir dabei, dass es offenkundig ein unbewusstes Vergnügen an der
Darstellung machtloser Frauen gibt, die darauf basiert, dass dieser Mangel in einer_m
anderen zugleich als Zeichen der eigenen Vollständigkeit bzw. Verdrängung der eigenen
Unvollständigkeit funktioniert.255 Birdys hilflose Verzweiflung lässt sich damit als eine
weitere kulturelle Darstellung und Bestätigung weiblicher Machtlosigkeit ansehen, die
neben Empathie beim Publikum auch das positive Gefühl eigener Überlegenheit (was
auch die Assoziation, ihr helfen zu können oder wollen, einschließt) auslösen kann.
251Vgl. auch dies., S.47: „Owen's teen voice could be heard for what it was: developing, vulnerable, sweet,
real.“
252Silverman (1988), S.77.
253Vgl. S.43 dieser Arbeit.
254Vgl. dies., S.75-79. Silverman argumentiert hier, dass die kindliche Erfahrung von Unvollständigkeit und
Bedürftigkeit auf die Mutter projiziert wird und beide so ihre Rollen vertauschen. D.h. im Schrei (aber
auch in der sinnlosen Stimme des „sonorous envelope“) wird die Mutter «sprachlos» und damit in der
sprachlich organisierten Welt hilflos, was eigentlich der alptraumhafte Zustand des Kindes ist.
255Vgl. auch Mulvey (1994), S.58/59 zum Sadismus.
97
Dazu möchte ich noch auf die akustische Repräsentation dieser Machtlosigkeit eingehen:
In den beiden Zitaten von Silverman und Stras war jeweils das Unkontrollierbare der
akustischen Expression relevant für die Faszination an der weiblichen Stimme. Wie ich
bereits erwähnte, produziert Birdy keine selbstbewusste emotionale Mitteilung, wie dies
bei der von den drei Sängern[sic] produzierten „echten“ Stimme tendenziell der Fall war,
sondern ihre Gefühle scheinen ihre Stimme zu kontrollieren und sich somit selbst
mitzuteilen. Hierbei findet eine Umkehrung statt, in der die eigentliche Aktivität den
Gefühlen und nicht mehr dem singenden Subjekt zugeschrieben wird. Die Gefühle
offenbaren sich regelrecht selbst.
Ein Reiz dieser Stimme könnte also durchaus auch darin liegen, dass sie ein Verraten der
Gefühle gegen den Willen der Sängerin suggeriert. Der Eindruck von „Echtheit“ würde
damit weniger durch den heldenhaften Kampf für die Mitteilung bezeugt, sondern
entsteht, weil sich der fühlende Körper gegen die Sängerin durchsetzt. Es geht damit um
eine unbeabsichtigte und unfreiwillige Expression, die dem weiblichen Körper scheinbar
unbewusst oder unwillentlich entweicht, statt einer selbstbewussten Präsentation der
eigenen somatischen Empfindungen, wie sie in den männlichen Beispielen der „echten“
Stimme zu finden waren.
Wenn diese Darstellung dabei auch als Bestätigung des Mangels oder der Kastration auf
weiblicher Seite funktionieren soll, so erscheint es außerdem plausibel, dass gerade für
diese Inszenierung eine „echte“ Stimme in Erscheinung tritt, denn die Bestätigung des
Mangels muss für diesen Zweck überzeugend, d.h. „echt“ oder wahr, sein. In ihrer
Eigenschaft eine körperlich-somatische Wahrheit mitzuteilen, produziert die „echte“
Stimme Birdys Verzweiflung und die Unkontrollierbarkeit ihres Körpers also überzeugend
als wahr und real und funktioniert als Bestätigung der angeblichen Realität eines
weiblichen Mangels. Indem dieser Mangel schließlich als Unfähigkeit zur Kontrolle in
den Körper eingeschrieben wird, so wird er zugleich naturalisiert. Die hier präsentierte
Machtlosigkeit ist damit nicht einfach nur Verzweiflung gegenüber einer vielleicht
änderbaren externen Situation, sondern im Versagen der Körperkontrolle auch
Machtlosigkeit gegenüber dem eigenen Körper.
Wesentlich an dieser Hörweise ist es jedoch, dass sich der_die Hörende nicht mit der
Stimme selbst identifiziert, sondern dagegen abgrenzt. Die Abgrenzung kann dabei
durchaus empathisch sein, d.h. den Wunsch der verzweifelten Birdy helfen zu wollen
einschließen, widerspricht dabei aber einer spiegelhaften Identifikation. Ich möchte damit
andeuten, dass es wahrscheinlich verschiedene Hörweisen für die hier inszenierte „echte“
98
Stimme gibt. Eine Identifikation mit Birdys Verzweiflung halte ich dabei ebenso für
möglich, wie eine sich selbst aufwertende Abgrenzung gegen diese Stimme. Die
Vermutung liegt nahe, dass sich Hörerinnen eher identifizieren, während Hörer[sic] sich
eher abgrenzen, es ist aber ebenso möglich, dass dieses Hörverhalten vom jeweils
aktuellen emotionalen Zustand der Hörer_innen abhängt.
Ich möchte mich nun noch der im Song inszenierten Verwandlung dieser hilflosen
unkontrollierten Stimme in die tröstende „mütterliche“ Klangumarmung zuwenden. Wie
ich bereits beschrieben habe, wird diese durch die Instrumente und den Hintergrundchor
motiviert, die die verzweifelte Stimme ab der zweiten Strophe klanglich einhüllen. Die am
Beispiel von Björks „All Is Full Of Love“ besprochene „mütterliche“ Klanghülle ließe
sich hier zuerst einmal auf diese klangliche Umgebung der Stimme projizieren, wobei
insbesondere die weiche leicht mit der Stimme und übrigen Instrumenten verschmelzende
Klanglichkeit von Chor und Streichinstrumenten einen relativ entkörperten und
entgrenzten Klangteppich bilden.
Im instrumentalen Zwischenteil bemüht sich nun die Stimme um Verschmelzung mit dem
Streicherklang. Das mit sphärischer Stimme singende Subjekt scheint dabei die physische
Welt zu verlassen und in dem phantastischen Raum aufzugehen, aus dem zuvor die
Instrumente und der Chor als tröstende Kollektivität auftauchten. Dabei wird jedoch die
(physische) Individualität aufgegeben und die Stimme geht im klanglichen Kollektiv auf.
Das sich zuvor möglicherweise mit der Stimme identifizierende Publikum hat, denke ich,
zwei Möglichkeiten mit dieser Passage umzugehen. Entweder die Identifikation wird hier
abgebrochen und das hörende Individuum auf seine eigene Situation zurückgeworfen,
wobei es dennoch in der „mütterlichen“ Klanghülle, in der nun Chor, Instrumente und
Stimme eine Einheit bilden, Geborgenheit finden kann. Andererseits ist es möglich, die
Identifikation
beizubehalten
und
Birdys
Transformation
und
Selbstauflösung
mitzumachen, so dass der_die Hörer_in sich selbst schließlich als Teil der klingenden
Kollektivität begreifen kann.
Hierbei entsteht der tröstende Effekt eher durch die Auflösung des Körpers, was in der
Konsequenz praktischerweise von somatischen Beschwerlichkeiten wie Trauer und
Verzweiflung enthebt: Das im klingenden Kollektiv von Chor und Instrumenten
aufgehobene Individuum wird selbst zu einem Teil desselben, wodurch es unempfindlich
gegen die physischen und psychischen Schrecken dieser Welt wird. Diese Verwandlung
hat dabei durchaus positive Momente, da sie zuerst einmal überhaupt einen Ausweg
99
aufzeigt und weiterhin da die von Birdy präsentierte Entkörperung mit einer gewissen
Macht, der Macht zu trösten und emotionale Verletzungen zu heilen, aber auch einer
gewissen übermenschlichen Unberührbarkeit, ausgestattet ist.
Der Preis für diese Machtposition, die wiederum mit der Verkörperung eines kulturellen
Klischees von Weiblichkeit – Mutter als Umgebungsklang – einhergeht, ist auch hier der
Verlust des eigenen Körpers. Die emotionale Bedürftigkeit, die Birdy zu Beginn des Songs
mitteilt, wird ersetzt mit körperlicher und emotionaler Bedürfnislosigkeit, was angesichts
der zu Beginn des Songs vermittelten Trauer und Verzweiflung als ein durchaus
verführerischer Ausweg erscheint.
Und wieder ist dies eine Verführung zur Reproduktion hochgradig problematischer Bilder
von Weiblichkeit: Zwar vermittelt die im Song präsentierte Auflösung des Individuums in
der klanglichen Umhüllung einen durchaus überzeugenden Trost, sie versetzt das
Individuum aber schließlich selbst in die Position der_des Tröstenden und negiert dessen
eigenen emotionalen Bedürfnisse, was an die Selbstentsagung eines Idealbilds von
Hausfrau und Mutter erinnert: ohne eigene Bedürfnisse immer emotional verfügbar für
ihre Familie.
Die im Song präsentierte Verwandlung ließe sich dabei auch als eine Art emotionales
Muster verstehen, das die Überwindung eigener Gefühle durch Loslösung vom eigenen
Körper demonstriert.256 Zwar ist dies sicherlich als Reproduktion eines aus feministischer
Sicht abzulehnenden Verhaltens anzusehen, andererseits bietet es auch eine hilfreiche
emotionale Überlebensstrategie, die eine gewisse Unabhängigkeit von der emotionalen
Unterstützung anderer erzeugt.
4.2.5 Zusammenfassung:
Die Fragmentierung der Anderen und der semiotische Stimmklang
Ich möchte nun diese vier untersuchten Beispiele miteinander in Beziehung setzen. Dabei
ist es nicht mein Ziel die Heterogenität dieser Songs zu reduzieren und auf eine
gemeinsame Formel zu bringen. Vielmehr lassen sie sich als Orientierungspunkte in einem
256Sicherlich imitiert auch der Song diesen emotionalen Umgang mit Trauer. Indem er diesen emotionalen
Prozess jedoch klanglich darstellt, wird dieser öffentlich zugänglich gemacht und damit auch als
allgemeines Muster, statt eines individuellen Umgangs erkennbar. Dabei ist dieser Song sicher nicht die
erste kulturelle Darstellung dieses Verhaltens, sondern ließe sich bei näherer Betrachtung sicherlich in
eine ganze Reihe klanglicher, literarischer oder filmischer Darstellungen dieses emotionalen Prozesses
einordnen. Simone de Beauvoir [Beauvoir (2012), S.260-362] beschreibt beispielsweise ähnliches:
Durch Märchen (Aschenputtel, Dornröschen) und religiöse Demut lernen weibliche Kinder Verzicht,
Warten und Leid als weibliche Heldentaten zu begreifen: „Ganz gleich, ob es um Gott oder einen Mann
geht, das Mädchen merkt, daß es durch die Bereitschaft zu unbedingter Demut allmächtig werden kann“
[S.362]
100
musikästhetischen Feld außerhalb der „echten“ Stimme verwenden. Sie sollen dabei als
Beispiele verstanden werden und sollten, obwohl ich diese Songs gewählt habe, da ich die
darin auftretenden Dynamiken für relativ gängige Muster in der Popmusik halte, nicht
dazu verführen, sie als ein Raster zur Einteilung von Musik zu verwenden.
Allerdings gibt es Gemeinsamkeiten zwischen allen vier Songs, die sich vor allem im
Gegensatz zur „echten“ Stimme erschließen. Hierbei erscheinen mir zwei Faktoren
relevant: die Positionierung der Sängerin als Andere im Verhältnis zur_zum Hörenden und
die Fragmentierung von Stimme, Körper und Subjekt. Diese beiden Faktoren möchte ich
nun nacheinander ausführlicher betrachten:
Wird die „echte“ Stimme als normative Expression eines emotionalen Selbstbildes des
Publikums angesehen, so sind die hier behandelten vier Beispiele als unterschiedliche
Formen des Anderen interpretierbar. Vor allem in den Beispielen von Bush, Minogue und
Björk lässt sich erkennen, dass hier keine emotionale Kongruenz zwischen singendem Ich
und Publikum angestrebt wird, sondern die Sängerinnen in einer antagonistischen Position
zum Publikum stehen: Sie erscheinen als Reaktionen auf emotionale und erotische
Wünsche des Publikums.
Musikalisch wird dabei das hörende Subjekt vom singenden getrennt und im Zentrum des
Songs platziert, was vor allem an Kylie Minogues „Stimmchor“ gut nachvollziehbar ist,
der sich um ein imaginäres hörendes Individuum herum anordnet. Aber auch Kate Bushs
Verführungen und die sphärische Klanghülle, mit der Björks Stimme uns umgibt,
orientieren sich klanglich auf ein hörendes Subjekt, das in der Organisation des Songs die
Position des eigentlich Wesentlichen einnimmt.
Birdys traurige somatische Expression, die als „echte“ Stimme angesehen werden kann,
weist ebenfalls einige relevante Unterschiede zu den vorher analysierten Beispielen der
männlichen Sänger[sic] auf. Insbesondere funktioniert ihre Stimme nicht als Mittel
sozialer Handlungsfähigkeit, die sich in den männlichen Beispielen der „echten“ Stimme
vor allem durch den im körperlichen Kampf um die Mitteilung präsentierten Willen
ausdrückt, sondern eher als Zeichen körperlicher Ohnmacht und Hilfsbedürftigkeit.
Schließlich löst sich ihre Stimme im instrumentalen Zwischenspiel sogar regelrecht vom
Körper, was eine somatische Nachempfindung fast unmöglich macht, und steht dem
emotionalen Trostbedürfnis des Publikums damit ebenfalls als Gegenpart zur Verfügung.
Der Song „People Help The People“ kann also auch als ein Wechsel von der einen in die
andere Rolle angesehen werden.
101
Insgesamt werden in den vier Songs dabei verschiedene Klischees von Weiblichkeit
aufgerufen. Die präsentierten Frauenfiguren lassen sich überspitzt als undurchschaubare
Femme Fatal, als verfügbares Sexobjekt, als übernatürliche Mutter und als hilfloses Opfer
interpretieren. Schon diese Klischees positionieren den_die Hörer_in dabei als einen
antagonistischen Gegenpol, statt in der spiegelhaften somatischen Gleichheit, die in der
Identifikation mit der „echten“ Stimme entsteht.
Die dabei entstehenden Subjekte der Stimmen erscheinen außerdem in ihrer
Handlungsfähigkeit jeweils auf den_die Hörer_in hin ausgerichtet, indem sie verführen,
trösten oder Botschaften überbringen. Einzig Birdys „echte“ Stimme fällt zuerst durch
Ohnmacht auf, die sie allerdings in ihrem Verschmelzen mit dem Hintergrundchor
überwindet: Nun kann auch sie tröstend helfen, statt hilflos um Trost zu bitten. In Bezug
zu Butlers Performanztheorie lässt sich dabei die These formulieren, dass in diesen
Beispielen ein handlungsfähiges und intelligibles Subjekt jeweils entsteht, wenn es sich
auf eine_n andere_n als Zentrum ihres Tuns hin orientiert. Selbst die so entstehenden
Subjekte erscheinen dabei als unwesentlich gegenüber der_dem Hörer_in im Zentrum des
Songs.
Damit möchte ich auf den zweiten Faktor, die Fragmentierung eingehen, die sich im
Gegensatz zur Einheit von Subjekt, Körper und Stimme im somatischen Stimmklang
zeigt: Hierbei erscheint mir vor allem der Einsatz des Semiotischen bemerkenswert, das
ich jetzt als Gegenbegriff zum in der „echten“ Stimme präsenten Somatischen
vorschlagen möchte. Ich habe das Semiotische beschrieben als einen Gesangsstil, in dem
der Klang zu einem kontrollierten, vom Körper und vom semantischen Sinn getrennten
Objekt wird.257 Die Stimme wird dabei zu einer Art Klanggestalt, die sich als solche
eigenständig materialisiert, d.h. sie erhält Präsenz und ist nicht auf eine verweisende
Funktion reduziert. Die Klanggestalt steht also nicht, wie ein Zeichen für etwas Drittes
abwesendes, sondern ist in seiner eigenen Anwesenheit bedeutend.258
Die semiotische Stimme lässt sich dabei als ein vom singenden Subjekt getrenntes Objekt
verstehen. Dabei habe ich bereits argumentiert, dass diese Beziehung zwischen Stimme
und Subjekt sich auch auf den Körper übertragen lässt, der als Klanggenerator ebenfalls
zum kontrollierten Objekt des Subjekts wird. Es entsteht so eine Distanz zwischen dem
257Vgl. S.72 dieser Arbeit
258Dabei kann die Lautfolge der Klanggestalt auch als Wort verständlich und damit ein Zeichen sein, doch
ihr bewusster semiotischer Einsatz als Klanggestalt produziert etwas, das deutlich über diese
Zeichenfunktion des Wortes hinausgeht. Dieses Zusätzliche ist es, worauf ich hier hinaus will.
102
singenden Subjekt und seiner Stimme bzw. seinem Körper. Insofern „Echtheit“ oder
Authentizität, wie ich bei der „echten“ Stimme argumentiert habe, den Ausdruck
innerkörperlicher oder somatischer Wahrheit bedeutet und damit auf einer distanzlosen
Beziehung zwischen Stimmklang und Körperempfinden basiert, so ist diese in einem
semiotischen Stimmklang nicht mehr möglich.
Dabei halte ich genau diese hörbare Distanz für einen wesentlichen Aspekt des
Semiotischen: Die Präsenz und Materialität des Semiotischen basiert darauf, dass es eine
eigenständige Existenz erhält, die nur in der Loslösung vom Subjekt entstehen kann.
Gerade vom weiblichen Körper wird so jedoch wiederholt etwas abgetrennt, wobei gerade
das Abgetrennte, d.h. die Stimme, sich als vom Körper abgelöstes und das Begehren
antreibende Objekt a im Lacanschen Sinne verstehen lässt.
Indem die Stimme den Körper verlässt und nicht mehr an diesen gebunden scheint, spricht
sie aus einem Ort im nirgendwo, der sich vor allem in Björks und Minogues Stimme auch
sehr gut hörend nachvollziehen lässt: Es können keine bestimmbaren somatischen Körper
mehr als Klangquelle dieser Stimmen fixiert werden.
Insgesamt möchte ich darauf hinweisen, dass diese Fragmentierung nur eine
Untergliederung, nicht aber automatisch eine Negation des singenden Körper-Subjekts
bedeutet. Wie ich am Beispiel von Kate Bush deutlich gemacht habe, kann dieses gerade
hinter der (und damit produziert durch die) Maske der semiotischen Stimme entstehen.
Auch die trostspendende Kollektividentität von Birdy oder die Autorität von Björks
Botschaft sind Formen der Handlungsfähigkeit, die gerade durch das Trennen der Stimme
vom eigenen somatischen Körper zu entstehen scheint. Ebenso habe ich den Tanzspaß,
den ich zu Kylie Minogues „Can't Get You Out of My Head“ beschrieben habe, als Freude
über die mit der Aneignung des Körpers verbundene Handlungsfähigkeit interpretiert, was
auch hier eine Handlungsfähigkeit auf Basis von Fragmentierung, d.h. der eigene Körper
wird als Objekt vom Subjekt angeeignet, bedeutet.
Im Rahmen der Performanztheorie lässt sich hiermit die These aufstellen, dass
gesellschaftlich intelligible handlungsfähige weibliche Subjekte vor allem entstehen,
indem sie eine distanzierte Haltung zu ihrem eigenen Körper einnehmen und diesen nicht
als Teil ihrer selbst, sondern als Objekt ansehen und einsetzen. Der weibliche Körper wird
damit nicht nur auf einer gesellschaftlichen oder ideologischen Ebene, sondern selbst für
Frauen zur Ressource. Er ist dabei immer schon ein kulturell kodiertes Objekt, in das
103
verschiedene Bedeutungen eingeschrieben sind, die es von einer zentralen (männlichen)
Perspektive zum begehrten Anderen machen.
In Bezug zu Butlers Einverleibungsthese lässt sich auch hier argumentieren, dass dieses
Objekt, da es als begehrenswert kodiert ist, vor allem von sich als heterosexuell
verstehenden Frauen in den eigenen Körper aufgenommen wird, womit zugleich eine
fragmentierte Selbstbeziehung im eigenen Körper reproduziert wird.
Zur Abgrenzung möchte ich für einen letzten Punkt hier nochmals auf die „echte“ Stimme
in den Beispielen der männlichen Sänger[sic] eingehen: In dieser entstehen intelligible
und anerkannte Handlungsfähigkeit und Subjektivität gerade auf Basis einer somatischen
Artikulation. Insofern die „echte“ Stimme auch als ein Prozess der kulturellen Produktion
der somatischen Empfindungen und ihrer Verarbeitung angesehen werden kann, so
produziert sie hier eine Einheit, in der eine Trennung von Stimme, Subjekt und Körper
nicht einmal denkbar erscheint. Der so konstituierte männliche Körper ist dabei aber nicht
weniger kulturell kodiert und geformt, allerdings geschieht diese Kodierung des Körpers
auf einer anderen Ebene: Es werden Gefühle und somatische Körperlichkeiten samt ihrer
gesellschaftlich intelligiblen Artikulationsform in einer
spontan erscheinenden
Gleichzeitigkeit produziert, wobei dieser Prozess, da er auf die Einheit von Subjekt und
Körper wirkt, das Subjekt notwendig auf einer Ebene formt, die ihm unbewusst bleiben
muss. Hier wird nicht nur eine Handlungsweise, sondern der dieser Handlung zugrunde
liegende somatische Impuls, um nicht zu sagen „Wille“,259 als Teil des Selbst mit erzeugt.
Eine solche natürlich und spontan erscheinende Verbindung zwischen Innen und Außen
kann jedoch in der durch die semiotische Stimme produzierten Fragmentierung nicht
entstehen. Indem Subjekt und Körper voneinander getrennt werden, erfolgt die
Kommunikation von Innen nach Außen gewissermaßen über den Körper als ein Medium,
das vom Subjekt zu diesem Zweck eingesetzt wird.
Während das somatische Subjekt der „echten“ Stimme im Körper und damit in der Welt
ist, erscheint das Subjekt der fragmentierten Stimme außerhalb; sein Körper bzw. seine
Stimme nimmt eher eine stellvertretende Position ein. In der Musik wird so die Stimme zu
einem Zeichen für ein Subjekt, das nicht unmittelbar zugänglich wird, wie in der „echten“
Stimme, und damit eher abwesend als anwesend ist.
259Es ist nicht mein Ziel zu klären, was Wille ist, aber ich denke, dieses Wort macht die Distanzlosigkeit
zwischen subjektiver und somatischer Empfindung besonders klar.
104
Die semiotische Stimme oder die Stimme als Objekt lässt sich dabei insgesamt sehr
unterschiedlich
einsetzen.
Das
Semiotische
bietet
eine
Vielzahl
ästhetischer
Möglichkeiten, die in dem Objekt „Stimme“ und seiner Beziehung zur Sprache angelegt
sind und die der bewussten Formung durch ein Subjekt unterworfen werden.
Die semiotische Stimme erscheint damit aus feministischer Sicht durchaus ambivalent:
Einerseits stellt sie die Reproduktion einer Fragmentierung des weiblichen Körpers dar
und produziert eine klare Abgrenzung zur „echten“ Stimme mit ihrer scheinbaren Einheit.
Andererseits bietet sie auch Möglichkeiten des ästhetischen Ausdrucks, die sich als
Aneignungsprozesse, d.h. Aneignung von Stimme und Körper (als Objekte), verstehen
lassen. Vor dem Hintergrund von Butlers Performanztheorie kann sie dabei auch einen
produktiven Ansatzpunkt für Veränderungen sein, in denen der angeeignete Körper oder
seine Stimme neu kodiert werden. Eine grundsätzliche Ablehnung dieses Stimmklangs
halte ich daher für ebenso falsch, wie ein Ignorieren der potentiellen Möglichkeiten von
Handlungsfähigkeit und Selbstwahrnehmung, die in einer positiven und selbstbewussten
weiblichen „echten“ Stimme enthalten wären.260
260Ein spannender Song für eine weitere Analyse und ein gutes Beispiel für einen äußerst interessanten und
kreativen Umgang mit der semiotischen Stimme scheint mir „One way or another“ von Blondie zu sein,
in dem der Gesang teilweise klar semiotisch ist, aber dennoch oft sehr körperlich klingt.
105
5. Klangliche Körperproduktionen – Ein Fazit
„Wir alle sind zutiefst verletzt worden.“261
5.1 Worte
Ein Ziel in dieser Arbeit war es, nach Begriffen für die bessere Differenzierung von
Unterschieden in der Musikerfahrung zu suchen, die für eine feministische
Musikbetrachtung produktiv sein können. Ich denke, es ist mir gelungen, verschiedene
distanzlose Musikerfahrungen gegeneinander abzugrenzen.
Während in der „echten“ Stimme Distanzlosigkeit durch die emotionale Identifikation mit
der Stimme entsteht, produzieren die hier dargestellten anderen Stimmen ebenfalls
Distanzlosigkeit. Diese basiert allerdings demhingegen auf der körperlichen Auflösung der
Stimme als „sonorous envelope“, die zur Umgebung der_s Hörenden wird, auf der
eindringlichen Penetranz einer voyeuristischen Hörweise, die der Stimme ihre inneren
Geheimnisse zu entlocken trachtet, oder auf einer taktilen Phantasie, die durch die Präsenz
körperlicher Klanglichkeit erzeugt wird. In der scheinbaren Unmittelbarkeit einer
distanzlosen Musikerfahrung lassen sich so bei näherer Betrachtung verschiedene Modi
differenzieren, die ich in dieser Arbeit auch verbal gegeneinander abgegrenzt habe.
Dabei habe ich ein Vokabular entwickelt, das beispielsweise zwischen einer empathischen
Identifikation mit der „echten“ Stimme und der tanzenden Verkörperung einer
objekthaften Stimme differenziert. Ich habe die Mitteilung, die somatische und emotionale
Informationen mit dem Publikum teilt, gegen eine transzendente Botschaft abgegrenzt, die
das singende Subjekt nur als Medium oder eben Bot_in zu nutzen scheint. Außerdem habe
ich Unterschiede zwischen der somatischen Präsenz des Körpers und der damit
verbundenen Wahrheit des Gefühls in der „echten“ Stimme, der Stimme als
phantastischer Projektionsfläche ohne Anspruch auf Echtheit und einer scheinbar
körperlosen Vervollständigung versprechenden stimmlichen Klanghülle herausgearbeitet.
Auf der klanglichen Ebene habe ich zudem insbesondere zwischen somatischen und
semiotischen Einsätzen der Stimme unterschieden.
261Haraway (1995a), S.71.
106
Die verschiedenen Modi distanzloser Musikerfahrung ließen sich in Anlehnung an Laura
Mulveys „visual pleasures“ vielleicht als verschiedene auditive Lüste oder verschiedene
Formen von auditivem Vergnügen bezeichnen. Wie bei Mulvey lassen sich diese
verschiedenen unbewussten „Pleasures“ dabei mit Geschlecht in Beziehung setzen. Ich
möchte einen kurzen Vergleich zwischen Mulveys visuellen und meinen hier entwickelten
auditiven Lüsten versuchen.
5.2 Verschiedene Modi auditiver Lust
Mulvey arbeitet vor allem mit zwei verschiedenen visual pleasures, die sich allerdings mit
zwei der von mir erarbeiteten auditiven Lüsten in Beziehung setzen lassen: Mit
Bezugnahme auf Freud wiederholt sie sein Konzept der Schaulust oder Skopophilie, die
Lust bereitet, indem „andere Leute zu Objekten gemacht werden, dem kontrollierenden
und neugierigen Blick ausgesetzt werden“262 und von Freud in Beziehung gesetzt wird, zu
den „voyeuristischen Aktivitäten von Kindern, ihr Bedürfnis, das Private und Verbotene zu
entdecken“.263 Dieser Skopophilie setzt sie das Spiegelstadium von Lacan entgegen, bei
dem die Identifikation mit einem idealisierten Selbstbild Freude bereitet. Während Frauen
dabei im Film zu schaulustig betrachteten Objekten der Skopophilie werden, identifiziert
sich das Publikum im Film spiegelhaft mit dem Helden, aus dessen Perspektive sich die
Erzählung entwickelt.
Diese beiden visuellen Lüste lassen sich dabei recht gut auf zwei der von mir
differenzierten verschiedenen lustvollen Hörweisen übertragen: Die im Spiegelstadium
präsentierte Identifikation lässt sich auf die Identifikation mit der „echten“ Stimme
anwenden; insbesondere da in den männlichen Beispielen diese Stimme unter anderem mit
Attributen wie Ganzheit und sozialer Handlungsfähigkeit ausgestattet ist, die sich mit der
Verkennung des Spiegelbildes als perfekterem Selbst in Beziehung setzen lässt.
Der objektivierende Blick der voyeuristischen auf neugieriges Entdecken gerichteten
Schaulust hingegen lässt sich leicht in Beziehung mit der Stimme als einer Art
entsubjektiviertem Klangobjekt sehen, wie es vor allem in „Can't Get You Out of My
Head“ entsteht. Aber auch der Einsatz einer semiotischen Klanggestaltung, wie sie bei
Kate Bush und Björk zu hören ist, kann als eine Betonung der Klangfarbe der Worte und
der Stimme interpretiert werden, in der Worte wie Stimme aus einer distanzierten
262Mulvey (1994), S.51.
263Mulvey (1994), S.52.
107
Perspektive zu Objekten bzw. zu „betrachtbaren“ Klangereignisse werden, nicht zu
bedeutenden Mitteilungen eines Subjekts.
Für Mulvey werden schließlich aufgrund des durch den Kastrationskomplex ausgelösten
Unbehagens beim Anblick der Frau zwei psychische Reaktionen auf den weiblichen
Körper aufgezählt: die zur Fetischisierung oberflächlicher Schönheit führende Leugnung
oder die entmystifizierende Wiederholung des Traumas der Entdeckung weiblicher
„Unvollständigkeit“.264 Auch diese beiden ließen sich klanglich einerseits mit der auf die
durch das Semiotische entstehende oberflächliche Klanggestalt und andererseits mit dem
Entdecken vor allem ungewollter und unkontrollierter Laute, wie dem Schluchzen bei
Birdy und den scheinbaren akustischen Einblicken in Kate Bushs Inneres in Beziehung
setzen und produzieren dabei jeweils ein Begehren nach einer entsprechenden
Offenbarung.
Allerdings lässt sich für die Musik eine weitere Form der auditiven Lust feststellen, die
sich in Mulveys Aufsatz direkt nicht wiederfinden lässt: die mit Mütterlichkeit konnotierte
Klanghülle. Auch diese lässt sich mithilfe von Kaja Silverman mit der feministischen
psychoanalytisch beeinflussten Filmtheorie verbinden, wie ich im Kontext meiner
Interpretation von Björks „All Is Full Of Love“ dargestellt habe.
Die Ähnlichkeit meiner Beobachtungen zu den am Film analysierten Darstellungen von
Männern und Frauen legt dabei nahe, dass Film und Popmusik in einem gemeinsamem
kulturellen Rahmen von wahrscheinlich unbewussten Vorstellungen von Geschlecht
verortet werden können, der sich zumindest teilweise mit psychoanalytischen Begriffen
beschreiben lässt.
Dabei wäre eine ausführlichere Betrachtung psychoanalytischer Konzepte und ihrer
möglichen Anwendungen auf die Musik sicherlich ein viel versprechendes Thema, um
sich weiter aus feministischer Perspektive mit Popmusik auseinanderzusetzen.
Insbesondere Lacans Begehrens- und Subjekttheorie und die Verwendung seines Objekt a
scheinen mir dabei noch ein großes Potenzial für ein tieferes Verständnis unbewusster
Prozesse bei der Musikrezeption zu haben.
264Vgl. Mulvey (1994), S.58.
108
5.3 Eigenes und Anderes
Auf einer allgemeinen Ebene ließ sich in dieser Arbeit sehr gut zeigen, dass Simone de
Beauvoirs theoretisches Konzept der Einteilung in die privilegierte und normative Position
des Einen bzw. Eigenen und die davon abgegrenzte und als Abweichung markierte
Position der Anderen sich auch in der klanglichen Gestaltung von Popmusik wiederfinden
lässt: Die von Männern gesungene „echte“ Stimme nimmt ganz selbstverständlich eine
zentralisierte gesellschaftliche Position ein, indem sie als unfragmentierte Einheit den
Anspruch auf allgemeine Wahrnehmung und Anerkennung ihrer subjektiven somatischen
Mitteilung erhebt und damit den eigenen Körper und die eigene Subjektivität sozial
transzendiert.
Die verschiedenen anderen Stimmen, die ich in dieser Arbeit analysiert habe, nehmen
jeweils nicht die Position dieser selbstbewussten Subjektivität ein, die auf dem eigenen
Körper und eigenem Gefühl basiert, sondern erscheinen in verschiedener Weise
dezentralisiert. Sie sind fragmentiert, körperlos, künstlich, objekthaft, unkontrolliert oder
manipulierend und reproduzieren tendenziell sexistische Frauenbilder. Schließlich lädt die
„echte“ Stimme das Publikum zur Identifikation ein, während vor allem Kylie Minogue,
Kate Bush und Björk die Hörenden in eine antagoistische Positionierung zu ihrer Stimme
treiben.
5.4 Intelligibilität und Reproduktion
Mit Judith Butlers Performanztheorie lässt sich argumentieren, dass das Reproduzieren
von aus dem Intelligibilitätsrahmen bekannten Formeln für die gesellschaftliche
Anerkennung als Subjekt notwendig ist. Da für Butler jedes Subjekt auch ein Geschlecht
hat, wären die hier festgestellten stimmlichen Stilmittel, als zitierbare Performanzmuster
eines popmusikalischen nach Geschlecht differenzierenden Intelligibilitätsrahmens zu
verstehen.
Die zitierende Reproduktion dieses Intelligibilitätsrahmens durch Sängerinnen ist dabei
einerseits einschränkend, sie gibt ihnen aber zugleich die Möglichkeit gesellschaftlicher
Handlungsfähigkeit, indem sie wiedererkennbare Muster ästhetisch einsetzen, so dass
beispielsweise Björk ihrer Aussage den Anstrich einer absoluten transzendenten Wahrheit
geben kann oder Kate Bushs vielfältiger Einsatz widersprüchlicher Klischees auch als
Kritik am Konsum von sexualisierten Frauenbildern interpretierbar wird.
109
Am Beispiel Kylie Minogues habe ich außerdem argumentiert, dass auch die Präsentation
des weiblichen Körpers als Sexobjekt auf Basis der sexualisierten Aufladung dieses
kulturellen Artefaktes für Frauen als den Besitzenden dieses Körpers Quelle von Macht
und Kontrolle über den Zugang zu diesem Objekt sein kann, die im verkörpernden Tanz
lustvoll angeeignet und erfahren wird. Gerade im Kontext von Musik als ästhetischer
Praxis
lassen
sich
dabei
auch
die
im
Intelligibilitätsrahmen
vorgegebenen
Verhaltensmuster als Material verstehen, aus dem weitere neue und komplexere
Bedeutungen entwickelt werden können, die auch den ursprünglichen repressiven
Tendenzen von stereotypen Klischees entgegenstehen können.
All diese Argumentationen basieren dabei auf der Annahme, dass die performative
Produktion singender Subjektivität durch Sänger_innen in der Popmusik durch einen
Intelligibilitätsrahmen strukturiert ist, dessen Funktionsweise ich in dieser Arbeit
allerdings nur anhand weniger Beispiele thesenhaft skizzieren konnte. Ich bin
grundsätzlich überzeugt, dass ein solcher Mechanismus in der Popmusik existiert, ob
meine hier präsentierten Ansätze diesen insgesamt korrekt abbilden, müsste anhand
weiterer Musikbeispiele verifiziert werden.
5.5 Feministische Konsequenzen
Eine sinnvolle feministische Kritik an Popmusik sollte, wie ich in der Einleitung erklärt
habe, eher auf der strukturelle Ebene ansetzen und die Auswirkungen des
Intelligibilitätsrahmens als Ganzem kritisieren, statt einzelne vor allem weibliche
Performanzen als Reproduktionen sexistischer Klischees abzuwerten. Auf dieser Ebene
erscheinen mir aufgrund meiner Ergebnisse folgende Punkte relevant:
Ersteinmal lässt sich „Echtheit“ als allgemeiner impliziter oder expliziter ästhetischer
Bewertungsmaßstab kritisieren, da eine Formel, die behauptet nur „echte“ Musik sei auch
gute Musik, in einem Kontext, der von Frauen deutlich weniger „echte“ Musik erwartet
und fordert, ziemlich automatisch zu asymmetrischen ästhetischen Bewertungen zu
Ungunsten von Frauen kommt und die ästhetischen Äußerungen von Männern als
qualitativ besser bewerten würde. Demgegenüber möchte ich vorschlagen, die
verschiedenen
in
dieser Arbeit
betrachteten
Stimmgebungen
als
verschiedene
gleichberechtigte ästhetische Möglichkeiten der singenden Äußerung zu betrachten.
Die
Annahme
eines
den
akustischen
Raum
der
Popmusik
strukturierenden
Intellgibilitätsrahmens hat außerdem Folgen für die Bewertung von ästhetischen
110
Innovationen, da, wenn davon ausgegangen werden muss, dass verschiedene
Äußerungsmöglichkeiten nur nach Geschlecht differenziert zur Verfügung stehen, die
Verwendungen von für das eigene Geschlecht untypischen Stimmgebungen als ästhetische
Innovationen zu verstehen sind, die zudem den Intelligibilitätsrahmen verschieben
könnten. Dies wirft auch die Frage nach musikgeschichtlichen Veränderungen in diesem
Feld auf, insbesondere wann sich die geschlechterbezogene Aufteilung verschiedener
Stimmgebungen in der Popmusik entwickelt hat und in welche Richtung sie sich seitdem
verändert. Auch eine Differenzierung in verschiedene Musikgenres sollte bei einer solchen
detaillierteren Betrachtung mit einbezogen werden.
Aus einer feministischen Perspektive ist insgesamt jedoch nicht eine ästhetische
Bewertung von Musik anzustreben, sondern eine politische. Eine feministische
Betrachtung von Musik zielt also eher darauf, ob im Klang patriarchale gesellschaftliche
Strukturen bestätigt und reproduziert, oder ob positive Veränderungen ermöglicht werden.
Dabei erscheint mir vor allem eine Kritik der von Männern gesungenen „echten“ Stimme
wichtig, da hier die männliche Perspektive im Zentrum der Popmusik als
gesellschaftlicher Praxis beständig reproduziert wird.
Insbesondere das in der von den analysierten Sängern[sic] in der „echten“ Stimme
präsentierte
Körpergefühl,
die
selbstverständliche
subjektive
Haltung
und
das
Selbstbewusstsein in der Mitteilung eigener Befindlichkeiten, wiederholt dabei einen
Anspruch auf die Welt, der hier erneut in einem männlichen Körper aktualisiert wird. Der
von Männern gesungenen „echten“ Musik kommt dabei außerdem das Attribut der
Wahrheit zu, d.h., dass die artikulierten Positionen einen Anspruch darauf erheben, als
Realitätsabbildungen zu gelten.265 Es gilt diese Position als Konstruktion zu erkennen und
gegenüber ihren naturalisierenden Konsequenzen ein kritisches Bewusstsein zu
entwickeln.
Die verschiedenen von Sängerinnen eingesetzten Stimmgebungen, die ich in dieser Arbeit
untersucht habe, sind dabei nicht nur Ausdruck einer dezentrierten Position, sie
konstruieren insgesamt eine verkomplizierte Beziehung zum eigenen Körper, der
regelrecht erst als durch gesellschaftliche Kodierung entfremdetes Objekt vom Subjekt
angenommen werden kann. Dies sollte aus feministischer Perspektive gleichzeitig als
Reproduktion einer problematischen Realität, wie auch als eine Strategie zum Umgang
mit und in dieser verstanden werden.
265Auch wenn die abgebildete Realität nur die innere Welt des Sängers[sic] ist.
111
Verstehe ich die Rolle von Frauen in Popmusik dabei als Reproduktionen einer
entfremdeten Beziehung zum eigenen Körper, so lässt sich dies insgesamt als eine
Verletzung ansehen, die für Frauen einen somatischen Zugang zum eigenen Körper negiert
oder zumindest erheblich erschwert. Ihr eigener Körper ist in dem Moment, in dem er von
ihnen angeeignet wird, bereits kulturell kodiert und zum anderen gemacht.
Insofern dieser Zustand der Fragmentierung jedoch immer auf bereits vorhandenes Bezug
nimmt und damit jedem einzelnen Popsong bereits vorangeht, lässt sich der einzelne Song
jeweils als auch als Ausdruck der damit bereits vorhandenen Verletzung (Birdys „echte“
Trauer) oder als produktiver Umgang damit (insbesondere Bushs negatives Infragestellen
jeder Mitteilung) interpretieren.
Schließlich halte ich es für wahrscheinlich, dass die verschiedenen mit den
Gesangstechniken verbundenen Haltungen auch über die Popmusik hinaus eine Wirkung
entfalten, indem sie den allgemeinen über die popmusikalischen Performanzmuster
hinausgehenden Intelligibilitäsrahmen beeinflussen und somit ganz allgemein normative
Beispiele für legitimes und intelligibles gesellschaftliches Verhalten von Frauen bzw.
Männern produzieren. Da sich dies vor allem auf die Stimme bezieht, halte ich dabei
insbesondere Auswirkungen auf die realen gesellschaftlichen Artikulationsmöglichkeiten
von Männern und Frauen für möglich, indem bestimmte Sprechweisen ermöglicht oder
verworfen werden.
Dabei ist aber weniger die schlichte Existenz dieser verschiedenen Stimmgebungen und
Haltungen in der Popmusik ein Problem, als die Bindung derselben an Geschlechter.
Wünschenswert wäre es aus feministischer Perspektive sicherlich, wenn sich die
verschiedenen Modi der Stimmgebung von ihrer geschlechtlichen Konnotation lösen
würden und damit unabhängig vom Geschlecht zur Verfügung stünden. Allerdings
erscheint mir ein solcher Zustand von der aktuellen Popmusik, als Klang wie als
Dispositiv, recht weit entfernt.
Es stellt sich außerdem die Frage, wie feministische und queere Musik klingt oder klingen
könnte. Ich verstehe Queerness und Feminismus dabei als politische Gegenstrategien im
Kontext hegemonialer Geschlechtervorstellungen. Insbesondere Queerness überschreitet
dabei tendenziell normative Bilder, übertreibt diese und greift sie damit insgesamt an. Sie
geht damit in verschiedenen Ebenen über das Bekannte und Hegemoniale hinaus. Ich halte
daher aber ein Verständnis der normativen Klangbilder von Männlichkeit und Weiblichkeit
112
für notwendig, um musikalische Performanzen, die subversive oder uneindeutige
Abweichungen darstellen, auch im Klang konkret analysieren zu können.
Jenseits eines Wunsches nach neuer feministischer Musik ist es jedoch auch möglich, die
eigenen Hörweisen zu reflektieren. Die von mir betrachteten Modi einer auditiven Lust,
lassen sich durch bewusstes Hören und durch Analysieren der zu ihrem Entstehen
notwendigen musikalischen Stilmittel „entzaubern“. Gerade die „echte“ Stimme lässt sich
dekonstruieren, wenn ihre akustischen Eigenschaften als Stilmittel und nicht mehr als
somatische Mitteilungen gehört werden.
Die „echte“ Stimme wirkt damit nicht mehr authentisch und natürlich, sondern lässt sich
als komplexe kulturelle Konstruktion erkennen. Eine bewusste Hörweise zerstört dabei
allerdings, indem es eine reflexive Ebene integriert, die scheinbare Unmittelbarkeit der
unbewussten auditiven Erfahrung und damit einen bedeutenden Teil der darin enthaltenen
Lust, sie erzeugt jedoch Selbstbestimmung.
Die Analyse von Popmusik wäre dabei insgesamt für die feministische Forschung eine
Bereicherung, da das Medium Musik, eine größere Nähe zum Körper aufweist als viele
andere Medien und sich somit als Quelle für die Betrachtung kultureller Konstruktion von
Gefühlen und anderen körperlichen Empfindungen anbietet. Die feministische
Auseinandersetzung mit Klang und Stimmen halte ich angesichts der dargestellten
klanglichen Kräfte für die Reproduktion von männlichen und weiblichen Körpern,
Stimmen und Subjekten für sehr wichtig.
113
Anhang
114
Quellenverzeichnis
Literatur [Internetquellen zuletzt abgerufen am 7.11.2013]
Adam, Jochen (2006): „Ich und das Begehren in den Fluchten der Signifikanten – Eine Vernähung
der Lacan'schen Psychoanalyse mit dem Zen-Buddhismus“, Oldenburg.
Adorno, Theodor W. (1941) (with the assistance of George Simpson): „On Popular Music“,
veröffentlicht in: Institute of Social Research: Studies in Philosophie and Social Sience,
S.17-48, New York
[url: http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/DATABASES/SWA/On_popular_music_1.shtml].
Adorno, Theodor W. (1978): „Die Philosophie der Neuen Musik“, Frankfurt am Main.
Barthes, Roland (1990): „Die Rauheit der Stimme“ in: ders. Der entgegenkommende und der
stumpfe Sinn – kritische Essays III, Frankfurt am Main.
Bayton, Mavis (1996): „How Women Become Musicians“, S.238-257, in: Frith, Simon/Goodwin,
Andrew (Hrsg.): On Record – Rock, Pop & the written word, London.
de Beauvoir, Simone (2012): „Das andere Geschlecht – Sitte und Sexus der Frau“, Hamburg.
Binas, Susanne (1992): „»Keep it Hard, Keep it Heavy« Zu einigen Aspekten soziokorporeller
Kommunikationsmuster im Prozess der Geschlechtersozialisation“, in: Popscriptum 01Begriffe und Konzepte, Berlin
[url: http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst01/pst01_binas.htm].
Bloomfield, Terry (1993): „Resisting songs: negative dialectics in pop“ in: Popular Music, 12,
S.13-31, [doi:10.1017/S0261143000005328].
Bockmann, Jörn (2006/07): „Merkblatt zum thematischen Block Spracherwerb“, zum Proseminar
A 2, Synchrone Linguistik II (WS 06/07), Christian-Albrechts-Universität Kiel
[url: http://www.linguistik-online.unikiel.de/germanistik/bockmann/material/Spracherwerb_Merkblatt.pdf].
Bradby, Barbara (2002): „Oh, Boy! (Oh, Boy!): mutual desrability and musical structure in the
buddy group“, in: Popular Music (2002) Volume 21/1, Cambridge.
Braun, Christoph (2007): „Die Stellung des Subjekts – Lacans Psychoanalyse“, Berlin.
Briner, Ermanno (2003): „Reclams Musikinstrumentenführer – Die Instrumente und ihre Akustik“,
Stuttgart.
Buchholz, Thomas (undatiert): „Stimmbildung als Grundlage des Sprechens und Singens “,
[url: http://www.buchholz-komponist.de/downloads/Stimme.pdf].
115
Butler, Judith (1991): „Das Unbehagen der Geschlechter“, Frankfurt am Main.
Butler, Judith (1997): „Körper von Gewicht“, Frankfurt am Main.
Buxton, Davis (1996): „Rock Music, the Star System and the Rise of Consumerism“, in: Frith,
Simon/Goodwin, Andrew (Hrsg.): On Record – Rock, Pop & the writen word, London.
Coates, Norma (1997): „(R)evolution Now? Rock and the political potential of gender“ in:
Whitley, Sheila (Hrsg.): Sexing the Groove – popular music and gender, London.
Cusick, Suzanne G. (1999): „On Musical Performance of Gender and Sex“ in: Barkin,
Elaine/Hamessley, Lydia (Hrsg.): Audible Traces, Zürich/Los Angeles.
Dibben, Nicola (1999): „Representations of femininity in popular music“, in: Popular Music, 18,
S.331-355 [ doi:10.1017/S0261143000008904].
Doane, Mary Ann (1994): „Film und Maskerade: Zur Theorie des weiblichen Zuschauers“, in:
Weissberg, Liliane (Hrsg.): Weiblichkeit als Maskerade, Frankfurt am Main.
Foucualt, Michel (1978): „Dispositive der Macht – Über Sexualität, Wissen und Wahrheit“, Berlin,
1978.
Foucault, Michel (1983): „Der Wille zum Wissen – Sexualität und Wahrheit 1“, Frankfurt am
Main [14. Auflage].
Freud, Sigmund (1925): „Einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds“,
in: Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, Bd.11,(4), 1925, S. 401-410
[url: www.textlog.de/freud-psychoanalyse-psychische-folgen-geschlechtunterschieds.html].
Freud, Sigmund (1927): „Fetischismus“, in: Almanach der Psychoanalyse 1928, Wien, 1927, S.
17-24 [url: www.textlog.de/freud-psychoanalyse-Fetischismus.html].
Frith, Simon (1992): „Zur Ästhetik der Populären Musik“, in: Popscriptum 01 – Begriffe und
Konzepte, Berlin, 1992
[url: http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst01/pst01_frith.htm].
Frith, Simon/McRobbie, Angela (1996): „Rock and Sexuality“, in: Frith, Simon/Goodwin, Andrew
(Hrsg.): On Record – Rock, Pop & the written word, London.
Gaar, G. Gillian (1994): „Rebellinnen – Die Geschichte der Frauen in der Rockmusik“, Hamburg.
Garratt, Sheryl (1996): „Teenage Dreams“, in: Frith, Simon/Goodwin, Andrew (Hrsg.): On Record
– Rock, Pop & the written word, London.
Gebauer, Gunter /Wulf, Christoph (2003): „Mimetische Weltzugänge: Soziales Handeln – Rituale
und Spiele – ästhetische Produktionen“, Stuttgart.
Goldin-Perschbacher, Shana (2007): „«Not With You But of You» - «Unbearable Intimacy» and
Jeff Buckleys Transgendered Vocality“, in: Jarman-Ivens, Freya (Hrsg.): Oh Boy –
Masculinities in Popular Music, New York.
Göpfert, Bernd (2002): „Handbuch der Gesangskunst“, Wilhelmshaven.
Haefliger, Ernst (1993): „Die Singstimme“, Mainz/ London/ Madrid/ Ney York/ Tokyo/ Toronto.
116
Hall, Stuart (1996):„Who needs identity?“ in: Hall, Stuart /du Gay, Paul (Hrsg.): Questions of
Cultural Identity, London [url: http://www.northwestern.edu/clcst/pdf/hall.pdf].
Hanslick, Eduard (1982): „Vom Musikalisch-Schönen“ in: Klaus Mehner (Hrsg.): Eduard
Hanslick – Vom Musikalscih-Schönen, Aufsätze, Musikkritiken,, Leipzig.
Haraway, Donna (1995a): „Ein Manifest für Cyborgs“, in: Dies. Die Neuerfindung der Natur:
Primaten Cyborgs und Frauen, Frankfurt am Main.
Haraway, Donna (1995b): „Situiertes Wissen“, in: Dies. Die Neuerfindung der Natur: Primaten
Cyborgs und Frauen, Frankfurt am Main.
Jarman- Ivens, Freya (2011): „Queer Voices – Technologies, Vocalities and the Musical Flaw“,
New York.
Kienast, Miriam (2002): „Phonetische Veränderungen in emotionaler Sprechweise“,
Aachen/Berlin.
Kirschning, Anje (2012): „Hinweise und Empfehlungen für geschlechtergerechte Sprache an der
ASH “, Berlin.
Klein, Gabriele (2004): „Electronic Vibration – Pop Kultur Theorie“, Wiesbaden.
Krips, Henry (1999): „Fetish – an erotics of culture“, New York.
Kristeva, Julia (1978): „Die Revolution der poetischen Sprache“, Frankfurt am Main.
Lacan, Jacques (1990): „Das Seminar, Buch 1 (1953-1954) – Freuds Technische Schriften“,
Berlin.
Lacan, Jacques (1991): „Die Bedeutung des Phallus“, in: Schriften II, Weinheim/Berlin, S.119-131
[url: www.psychoanalyse-zuerich.ch/uploads/media/Lacan_Phallus_01.PDF].
Litzbach, Andreas (2011): „«Real Niggaz Don't Die» - Männlichkeit im HipHop“, Marburg.
McClary, Susan (1991): „Feminine Endings – Music, Gender and Sexuality“, Minnesota.
McClary, Susan (2007): „«Same as it ever was»: Youth Culture and Music“, in: dies.:Reading
Music – Selected Essays“, Burlington/Mapshire.
McClary, Susan/Walser, Robert (1996): „Start making sense – musicology wrestles with rock“, in:
Frith, Simon/Goodwin, Andrew (Hrsg.): On Record – Rock, Pop & the written word,
London.
McRobbie, Angela (1996): „Settling accounts with subcultures: a feminist critique“, in: Frith,
Simon/Goodwin, Andrew (Hrsg.): On Record – Rock, Pop & the written word, London.
Mohr, Andreas (2008): „Die Kinderstimme – Funktion und Pflege“, Osnabrück [url: http://schorverband.de/main?module=c4fr&action=download&sid=831&funktionundpflege.pdf].
Mulvey, Laura (1994): „Visuelle Lust und Narratives Kino“ in: Weissberg, Liliane (hrsg.):
Weiblichkeit als Maskerade, Frankfurt am Main.
117
Mulvey, Laura (2009): „Afterthoughts on «Visual Pleasure and Narrative Cinema» inspired by
King Vidor's Duel in the sun (1946)“ in: diesl.: Visual and other pleasures, Hampshire/New
York.
Neppert, Joachim M.H. (1999): „Elemente einer Akustischen Phonetik“, Hamburg.
O'Brien, Lucy (1995): „She Bop – The definitiv history of women in rock, pop, and soul“,
London/NewYork/Victoria/Toronto/Auckland.
Paeschke, Astrid (2003): „Prosodische Analyse emotionaler Sprechweise“, Berlin.
Pagel, Gerda (2012): „Jacques Lacan zur Einführung“, Hamburg.
Pattie, David (1999): „4 real: Authenticity, Performance and Rock Music“, in: Enculturation,
Vol.2, No. 2 Spring 1999. [url: http://enculturation.gmu.edu/2_2/pattie.html]
Schmutz, Vaughn/Faupel, Alison (2010): „Gender and Cultural Consecration in Popular Music“,
in: Social Forces, Vol. 89(2), S.685-707
[url: http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d5acd189-7604-426a-a310680b1edb2cbd%40sessionmgr111&vid=2&hid=113 ].
Schönberg, Arnold (2003): „Harmonielehre“, Wien.
Shepherd, John (1991): „Music as social text“, Oxford.
Shepherd, John/ Wicke, Peter (1997): „Music and Cultural Theory“, Cambridge.
Silverman, Kaja (1988): „The accoustic mirror“, Bloomington/Indianapolis.
Stras, Laurie (2011): „Voice of the Beehive: Vocal Technique at the turn of the 1960s“ in: dies.
(Hrsg.): She's so fine: Reflecions on Whiteness, Femininity, Adolescence and Class in 1960s
Music, Farnham/Burlington.
Straw, Will (1997): „Sizing up Record Collections – Gender and Connoisseurship in rock music
culture“, in: Whitley, Sheila (Hrsg.): Sexing the Groove – popular music and gender,
London.
Toop, David (2001): „Rap Attack #3 – African Jive bis Global HipHop“, Höfen.
Wendt, Beate (2007): „Analysen emotionaler Prosodie“, Frankfurt am Main.
Wicke, Peter (1993): „Popmusik als Industrieprodukt“ in: derselbe: Vom Umgang mit Popmusik,
Berlin [url: http://www2.hu-berlin.de/fpm/textpool/texte/wicke_popmusik-alsindustrieprodukt.htm].
Wicke, Peter (1998): „»Heroes and Villains« - Anmerkungen zum Verhältnis von Popmusik und
Musikgeschichtsschreibung“ veröffentlicht in: N. Schüler (Hrsg.), Zu Problemen der
'Heroen'- und der 'Geier'-Musikgeschichtsschreibung, S. 147-160, Hamburg
[url: http://www2.hu-berlin.de/fpm/textpool/texte/wicke_heroes-and-villains.htm].
Willis, Paul E. (1974): „Symbolism and Practice – A Theory for Social Meaning of Pop Music“,
veröffentlicht in: Centre for Contemporary Cultural Studies: Stencilled Occasional Paper,
Sub and Popular Culture Series, Birmingham
[url: http://www2.hu-berlin.de/fpm/textpool/texte/willis_social-meaning-of-pop-music.htm].
118
Musik
[Die Datierungen basieren auf den Angaben des Anbieters und dienen der Auffindbarkeit
der Quellen. Sie wurden auch auf Nachfrage bestätigt. Allerdings ist offensichtlich, dass
zumindest die Datierung von „Billie Jean“ fehlerhaft sein muss, da sie vor der Entstehung
des Songs liegt.]
Beyoncé (14.07.2003): „Naughty Girl“, MP3 [320 kbit/s], Columbia, Dauer: 03:29.
Birdy (01.01.2012): „People Help The People“, MP3 [256 kbit/s], Warner Bros., Dauer: 04:17.
Björk (06.11.2002): „All Is Full Of Love“ (Original Mix), MP3 [320 kbit/s], Polydor, Dauer:
04:44.
Blondie (03.03.2003): „One Way or Another“, MP3 [320 kbit/s], Parlophone UK, Dauer: 03:28.
Buckley, Jeff (30.08.2013): „Mojo Pin“, MP3 [320 kbit/s], Columbia, Dauer: 05:43.
Bush, Kate (27.07.1988): „Feel It“, MP3 [320kbit/s], Parlophone UK, Dauer: 03:03.
Jackson, Michel (01.01.1982): „Billie Jean“ (Single Version), MP3 [320 kbit/s], Epic, Dauer:
04:54.
Minogue, Kylie (14.02.2002): „Can't Get You Out of My Head“, MP3 [320 kbit/s], EMI UK,
Dauer: 03:52.
Nirvana (23.09.2011): „Smells Like Teen Spirit“ (Album Version), MP3 [320 kbit/s], Universal
Music International, Dauer: 05:02.
Shakira (15.10.2010): „Loca“ (Featuring Dizzee Rascal), MP3 [320 kbit/s], Sony Music
Latin/Epic, Dauer: 03:13.
Spears, Britney (01.01.1999): „...Baby One More Time“, MP3 [320 kbit/s], Jive, Dauer: 03:31.
The Shirelles (25.03.2011): „Will You Still Love Me Tomorrow?“, MP3 [320 kbit/s], AudioSonic
Music, Dauer: 02:46
Williams, Robbie (01.03.2003): „Feel“ (Album Version), MP3 [320 kbit/s], Parlophone UK,
Dauer: 04:25.
Internetseiten [Zuletzt aufgerufen am 16.11.2013]
Webradio:
BB Radio: http://bbradio.radio.de/
Flux FM: http://www.fluxfm.de/player/#
Spreeradio: http://webradio.spreeradio.de/
119
Lyrics:
A-Z Lyrics: www.azlyrics.com
http://www.azlyrics.com/lyrics/nirvana/smellsliketeenspirit.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/robbiewilliams/feel.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/michaeljackson/billiejean.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/katebush/feelit.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/kylieminogue/cantgetyououtofmyhead.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/bjork/allisfulloflove.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/birdy/peoplehelpthepeople.html
Lyricsfreak: www.lyricsfreak.com
http://www.lyricsfreak.com/k/kate+bush/feel+it_20077236.html,
http://www.lyricsfreak.com/n/nirvana/smells+like+teen+spirit_20101055.html,
http://www.lyricsfreak.com/b/bjoumlrk/all+is+full+of+love_20018850.html,
Magistrix: www.magistrix.de
http://www.magistrix.de/lyrics/Michael%20Jackson/Billie-Jean-11266.html,
Metrolyrics: www.metrolyrics.com
http://www.metrolyrics.com/cant-get-you-out-of-my-head-lyrics-kylie-minogue.html,
http://www.metrolyrics.com/feel-it-lyrics-kate-bush.html,
Songtexte.com: www.songtexte.com
http://www.songtexte.com/songtext/nirvana/smells-like-teen-spirit-73d0c625.html,
http://www.songtexte.com/songtext/robbie-williams/feel-5bd6ab80.html,
http://www.songtexte.com/songtext/michael-jackson/billie-jean-53da73f1.html,
http://www.songtexte.com/songtext/birdy/people-help-the-people-1b9595d0.html
Youtube: www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=JSuUjqVXAD8,
Sonstige Quellen:
Sengpiel, Eberhard: Internetseite zur Tonhöhenumrechnung.
Url: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-notennamen.htm
120
Songtexte
121
Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“266
Form
Text/Stimme
Zeit
Load up on guns, bring your friends
It's fun to lose and to pretend
She's over bored and self-assured
Oh, no, I know a dirty word
0:34
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello
0:51
With the lights out, it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto, An albino
A mosquito, My libido
1:06
Yeah
Hey!
1:30
Intro
Strophe
Refrain
Yeay!
Strophe
I'm worse at what I do best
And for this gift I feel blessed
Our little group has always been
And always will until the end
1:48
266Ich habe zum Erstellen des Textblattes auf folgende Internetseiten zurückgegriffen:
http://www.lyricsfreak.com/n/nirvana/smells+like+teen+spirit_20101055.html,
http://www.songtexte.com/songtext/nirvana/smells-like-teen-spirit-73d0c625.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/nirvana/smellsliketeenspirit.html
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Quellen habe ich mich für dasjenige entschieden, was meinem
eigenem Höreindruck am nächsten kommt. Ebenso habe ich nach eigenem Höreindruck Nebenstimmen
und -geräusche ergänzt.
Die Textblätter sollen nur zur leichteren Orientierung im Song dienen und stellen keine eigenen
Analyseschritte dar. Es fokussiert außerdem auf die Stimme und differenziert daher die rein
intrumentalen Passagen weniger genau. Zeitangaben orientieren sich entsprechend auch am
Gesangseinsatz.
122
Refrain
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello
2:04
With the lights out, it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto, An albino
A mosquito, My libido
2:20
Yeah
Hey!
2:44
Yeay!
Solo
Strophe
2:53
And I forget just why I taste
Oh, yeah, I guess it makes me smile
I found it hard, it's hard to find
Oh well, whatever, nevermind
3:34
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello, How Low
Hello, Hello, Hello
3:50
Refrain
With the lights out, it's less dangerous
Here we are now, entertain us
I feel stupid and contagious
Here we are now, entertain us
A mulatto, An albino
A mosquito, My libido
4:05
Outro
A denial! A denial!
A denial! A denial!
A denial! A denial!
A denial! A denial!
A denial!
4:30
123
Robbie Williams: „Feel“267
Form
Text/Stimme
Zeit
Come on hold my hand
I wanna contact the living
Not sure I understand
This role I've been given
0:09
I sit and talk to God
And he just laughs at my plans
My head speaks a language
I don't understand
0:28
Refrain
I just wanna feel real love
Feel the home that I live in
'Cause I got too much life
Running through my veins, going to waste
0:48
Strophe
I don't wanna die
But I ain't keen on living either
Before I fall in love
I'm preparing to leave her
1:08
I scare myself to death
That's why I keep on running
Before I've arrived
I can see myself coming
1:27
I just wanna feel real love
Feel the home that I live in
'Cause I got too much life
Running through my veins, going to waste
1:47
Intro
Strophe
Refrain
267Ich habe zum Erstellen des Textblattes auf folgende Internetseiten zurückgegriffen:
http://www.songtexte.com/songtext/robbie-williams/feel-5bd6ab80.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/robbiewilliams/feel.html
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Quellen habe ich mich für dasjenige entschieden, was meinem
eigenem Höreindruck am nächsten kommt. Ebenso habe ich nach eigenem Höreindruck Nebenstimmen
und -geräusche ergänzt.
124
And I need to feel
Real love
And a life ever after
I cannot get enough268
2:06
Solo
[Instrumentales Zwischenspiel und Gitarrensolo]
2:19
Refrain
I just wanna feel real love
Feel the home that I live in
I got too much love
Running through my veins, to go to waste
2:46
I just wanna feel real love
In a life ever after, there's a hole in my soul
You can see it in my face
It's a real big place
3:05
Frauenstimme!
Feel
[unverständlich]
[unverständlich]
Feel
3:26
Strophen-artig Come and hold my hand
I want to contact the living
Not sure I understand
This role I've been given
3:34
Outro
3:54
Not sure I understand
Not sure I understand
Not sure I understand
Not sure I understand
268Auch gehört wurde hier: „I cannot give it up“
125
Michael Jackson: „Billie Jean“269
Form/ Text/Stimme
Zeit
Hintergrundstimmen
Intro
('ugkh)
Strophe She was more like a beauty queen from a movie scene (ech)
ab 0:29 I said don't mind, but what do you mean I am the one (ukh)
Who will dance on the floor in the round (ukh)
She said I am the one will dance on the floor in the round (che)
0:53
[Dopplung]
[Dopplung]
She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene (he)
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
(ukh)
Who will dance on the floor in the round (uk)
[Dopplung]
1:10
People always told me be careful of what you do
And don't go around breaking young girls' hearts
And mother always told me be careful of who you love
And be careful of what you do 'cause the lie becomes the truth
(he-e-ey)
Refrain Billie Jean is not my lover (ukh)
ab 1:26 She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son (uuh!)
She says I am the one, but the kid is not my son
(no no, ukh)
1:50
2:15
For forty days and forty nights
Law was on her side (eh)
But who can stand when she's in demand
Her schemes and plans
'Cause we danced on the floor in the round (hey ugk)
So take my strong advice, just remember to always think twice
(Do think twice!) (Do think twice!)
She told my baby we'd danced till three, then she looked at
me
Then showed a photo my baby cried his eyes were like mine
'Cause we danced on the floor in the round, baby
he-e-e
oh oh oh oh
[Dopplung]
Oh babe
[Dopplung]
Oh babe
eh-eh-eh
[Dopplung]
[Dopplung]
oh, no!
[Dopplung],eheh-eh
269Ich habe zum Erstellen des Textblattes auf folgende Internetseiten zurückgegriffen:
http://www.azlyrics.com/lyrics/michaeljackson/billiejean.html http://www.magistrix.de/lyrics/Michael
%20Jackson/Billie-Jean-11266.html, http://www.songtexte.com/songtext/michael-jackson/billie-jean53da73f1.html
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Quellen habe ich mich für dasjenige entschieden, was meinem
eigenem Höreindruck am nächsten kommt. Ebenso habe ich nach eigenem Höreindruck Nebenstimmen
und -geräusche ergänzt.
126
2:31
People always told me be careful of what you do (dah)
And don't go around breaking young girls' hearts (dah)
She came and stood right by me
Then the smell of sweet perfume
This happened much too soon
She called me to her room
Don't break no
hearts
oh,
oh no
oh, uhh
2:48
Billie Jean is not my lover (uhh!)
She's just a girl who claims that I am the one (ugk)
But the kid is not my son, (nono no no no) (nono no no no)
[Dopplung]
[Dopplung]
[Dopplung]
3:05
Billie Jean is not my lover
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son (no, no!)
She says I am the one,
but the kid is not my son
(no)
[Dopplung]
[Dopplung]
[Dopplung]
oh jeah
Solo
ab 3:29
Hi hi hi
uh
uh
3:43
She says I am the one, (eck)
but the kid is not my son (no no no!) (uh!)
[Dopplung]
3:54
(De) Billie Jean is not my lover (ugk!)
She's just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son (no no) (nonono!)
She says I am the one, but the kid is not my son
nonono
[Dopplung]
(..dance to me,
babe)
no no
Uhh!
No no
4:15
She says I am the
one
You know what you did!
She says he is my
son
breaking my heart, babe!
She says I am the
one
Outro Billie Jean is not my lover (ugk)
ab 4:27 Billie Jean is not my lover (ugk!)
Billie Jean is not my lover (ugk)
Fade
Billie Jean is not my lover (ugk)
out
Billie Jean is not my lover...
(Unverständlich)
127
Kate Bush: „Feel It“270
Form
Text/Stimme
Zeit
Strophe I [A]
After …. the party
You took me back .. to your parlour.
A little nervous laughter .. Uuh!
Locking the door.
My stockings fall
Onto the floor.
Desperate for more.
0:11
Strohe II [A]
Nobody else .. can share this.
Here comes one and one makes one,
The glorious union.
Well it could be love,
Or it could be just lust,
But it will be fun.
It will be wonderful.
0:37
Refrain [B]
Oh, feel it. Oh, oh feel it,
Feel it, my love.
Oh, feel it. Oh, oh feel it,
Feel it, my love.
Oh, I need it. Oh, oh, feel it,
Feel it, my love.
1:08
Feel it!
See what you're doing to me
See what you're doing to me
1:27
Intro
270Ich habe zum Erstellen des Textblattes auf folgende Internetseiten zurückgegriffen:
http://www.azlyrics.com/lyrics/katebush/feelit.html, http://www.metrolyrics.com/feel-it-lyrics-katebush.html, http://www.lyricsfreak.com/k/kate+bush/feel+it_20077236.html
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Quellen habe ich mich für dasjenige entschieden, was meinem
eigenem Höreindruck am nächsten kommt. Ebenso habe ich nach eigenem Höreindruck Nebenstimmen
und -geräusche ergänzt.
128
Strophe III [A]
God, but you're .. beautiful, aren't you?
Feel your warm hand walking around.
I won't pull away.
My passion always wins.
Keep on a-moving in.
So keep on a-tuning in.
Synchronise rhythm now.
1:43
Refrain [B]
Oh, feel it. Oh, oh feel it,
Feel it, my love.
Oh, feel it. Oh, oh feel it,
Feel it, my love.
Oh, I need it. Oh, oh, feel it,
Feel it, my love.
2:13
Feel it!
See what you're doing to me
See what you're doing to me
See what you're doing to me.
2:32
129
Kylie Minogue: „Can't Get You Out of My Head“271
Form
Text/Stimme(n)
Zeit
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
0:15
I just can't get you out of my head
Boy your loving is all I think about
I just can't get you out of my head
Boy it's more than I dare to think about
0:29
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
0:45
I just can't get you out of my head
Boy your loving is all I think about
I just can't get you out of my head
Boy it's more than I dare to think about
0:52
Every night
Every day
Just to be there in your arms
1:08
Won't you stay
Won't you lay
Stay forever and ever and ever and ever
1:22
Intro
Refrain
Refrain
271Ich habe zum Erstellen des Textblattes auf folgende Internetseiten zurückgegriffen:
http://www.azlyrics.com/lyrics/kylieminogue/cantgetyououtofmyhead.html,
http://www.metrolyrics.com/cant-get-you-out-of-my-head-lyrics-kylie-minogue.html
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Quellen habe ich mich für dasjenige entschieden, was meinem
eigenem Höreindruck am nächsten kommt. Ebenso habe ich nach eigenem Höreindruck Nebenstimmen
und -geräusche ergänzt.
130
Refrain
Refrain/
Outro
Fadeout
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
1: 46
I just can't get you out of my head
Boy your loving is all I think about
I just can't get you out of my head
Boy it's more than I dare to think about
2:01
There's a dark secret in me
Don't leave me locked in your heart
2:17
Set me free
Feel the need in me
Set me free
Stay forever and ever and ever and ever
2:31
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
Lalala, Lala Lalala
3:02
I just can't get you out of my head
Lalala, Lala Lalala, Lalala, Lala Lalala
I just can't get you out of my head
Lalala, Lala Lalala, Lalala, Lala Lalala
I just can't get you out of my head
Lalala, Lala Lalala, Lalala, Lala Lalala
Uuhhh.... Uuhhh
I just can't get you out of my head
Lalala, Lala Lalala, Lalala, Lala Lalala
Uuhhh.... Uuhhh
3:17
131
Björk: „All Is Full Of Love“272
Form/Zeit
Text / 1. Stimme
Text / 2. Stimme
Intro, Instr.
[A]
ab 0:30 Min.
You'll be given love
You'll be taken care of
You'll be given love
You have to trust it
[B]
ab 0:56 Min.
Maybe not from the sources
You have poured yours
Maybe not from the directions
You are staring at
[A']
ab 1:20 Min.
Trust273 your head around
It's all around you
All is full of love
All around you
Einsatz 2.
Stimme
ab 1:45
All is full of love
You just ain't receiving
All is full of love
Your phone is off the hook
All is full of love
Your doors are all shut
All is full of love
impeding me laying down
[Höhepunkt]
2:12
274
All is full of love
272Ich habe zum Erstellen des Textblattes auf folgende Internetseiten zurückgegriffen:
http://www.azlyrics.com/lyrics/bjork/allisfulloflove.html,
http://www.lyricsfreak.com/b/bjoumlrk/all+is+full+of+love_20018850.html,
http://www.youtube.com/watch?v=JSuUjqVXAD8
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Quellen habe ich mich für dasjenige entschieden, was meinem
eigenem Höreindruck am nächsten kommt. Ebenso habe ich nach eigenem Höreindruck Nebenstimmen
und -geräusche ergänzt.
273Hier wird häufig auch „twist“ gehört, meinem Höreindruck entspricht „trust“ jedoch eher.
274Umstrittene Zeile. Auf vielen Lyrics-Seiten wird die Zeile ausgespart, teilweise wird sie als „Be my
lil'angel“ interpretiert, „Impeding me laying down“ wird auf wenigen Seiten gehört, entspricht aber eher
meinem Höreindruck.
132
2:14
All is full of love
All is full of love
All is full of love
All is full of love
A-a-all
All is full of love
2:32
All is full of love
All is full of love
Ju-ust
All is full of love
2:45
All is full of love
All is full of love
All is full of love
All is full of love
Instr.
ab 3:14
Ab 3:25
All is full of love
All is full of love
...full of love
...full of love
Outro, Instr.
ab: 3:52
133
Birdy: „People Help The People“275
Form/Zeit Text/Stimme
Instrumente
Intro
Klavier
Strophe
ab 0:21
0:36
Refrain
ab 0:50
God knows what is hiding
In that weak and drunken heart
I guess you kissed the girls and made them cry
Those Hardfaced Queens of misadventure
[kurze Pause!]
God knows what is hiding
In those weak and sunken eyes
A Fiery throng of muted angels
Giving love and getting nothing back
Klavier
People help the people
Klavier,
And if your homesick, give me your hand and i'll hold it Streicher,
People help the people
Bass
And nothing will drag you down
Überleitung Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
ab 1:13
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away
Klavier
Strophe
ab 1:37
God knows what is hiding,
In that world of little consequence
Behind the tears, inside the lies
A thousand slowly dying sunsets
Streicher,
Schlagzeug,
Gitarre, Bass,
Klavier
1:50
God knows what is hiding
In those weak and drunken hearts
I guess the loneliness came knocking
No on needs to be alone, oh singing276
275Ich habe zum Erstellen des Textblattes auf folgende Internetseiten zurückgegriffen:
http://www.songtexte.com/songtext/birdy/people-help-the-people-1b9595d0.html,
http://www.azlyrics.com/lyrics/birdy/peoplehelpthepeople.html
Bei Unstimmigkeiten zwischen den Quellen habe ich mich für dasjenige entschieden, was meinem
eigenem Höreindruck am nächsten kommt. Ebenso habe ich nach eigenem Höreindruck Nebenstimmen
und -geräusche ergänzt.
276Auch gehört wird hier: „save me“ .
134
Refrain
ab 2:04
People help the people
And if your homesick, give me your hand and i'll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Hintergrundchor, Klavier,
Streicher,
Schlagzeug,
Gitarre, Bass
Überleitung Oh and if I had a brain,
ab 2:25
Oh and if I had a brain
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away
Klavier,
Gitarre,
Streicher,
Bass
Instr.
Zwischenspiel
ab 2:42
[Instr: Streicher-Solo]
Nana Nanana277 Uhhh
Nana Nanana Uhhh
Schlagzeug,
Bass,
Streicher,
Klavier,
Refrain
ab 3:26
People help the people
And if your homesick, give me your hand and I'll hold it
People help the people
Nothing will drag you down
Hintergrundch
or, Streicher,
Schlagzeug,
Klavier,
Gitarre, Bass
Überleitung Oh and if I had a brain, Oh and if I had a brain
ab 3:48
I'd be cold as a stone and rich as the fool
That turned, all those good hearts away
Klavier,
Gitarre,
Streicher,
Bass
[nach und nach
aussetzend]
277Es lässt sich für mich nicht entscheiden, ob hier auf „Nana..“ oder „Lala..“ gesungen wird.
135
Trackliste der beigefügten CD
1. Nirvana
Smells Like Teen Spirit
5:01
2. Robbie Williams
Feel
4:24
3. Michael Jackson
Billie Jean
4:54
4. Kate Bush
Feel It
3:03
5. Kylie Minogue
Can't Get You Out of My Head
3:51
6. Björk
All Is Full Of Love
4:44
7. Birdy
People Help The People
4:16
136
Selbstständigkeitserklärung
Selbstständigkeitserklärung nach § 23 (7) der Magisterprüfungsordnung der HumboldtUniversität zu Berlin:
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich erkläre
ausdrücklich, dass ich sämtliche in der Arbeit verwendeten Quellen als solche kenntlich
gemacht habe. Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die Grundsätze der Selbstständigkeit
als Täuschung betrachtet und entsprechend der Allgemeinen Satzung für Studien- und
Prüfungsangelegenheiten der HU (ASSP) geahndet werden.
Die Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form bisher bei keiner anderen Institution
eingereicht.
Berlin, den _____________
___________________________
Lena Müller
Postfach 65 03 44
13303 Berlin
[email protected]
137
Inhalt
1. Klang, Körper, Stimme und Sprache – Eine Einleitung...................................................1
2. Rahmen................................................................................................................................11
2.1 Feministische Grundlagen........................................................................................11
2.1.1 Simone de Beauvoir –
Die Positionierung von Frauen als unwesentliche Subjekte........................11
2.1.2 Judith Butler – Die Einverleibung des heterosexuellen Körpers.................15
2.2 Popmusik als Dispositiv und Mimesis als Weltzugang............................................19
3. Werkzeuge...........................................................................................................................26
3.1 Möglichkeiten sich dem Klang zu nähern................................................................26
3.1.1 Assoziation...................................................................................................26
3.1.2 Homologie....................................................................................................30
3.1.3 Intertextualität..............................................................................................32
3.1.4 Materialität...................................................................................................36
3.1.5 Psychoanalyse..............................................................................................40
3.2 Körperliche Klangproduktion: Die Stimme .............................................................45
4. Analysen..............................................................................................................................54
4.1 Die „echte“ Stimme..................................................................................................55
4.1.1 Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“..............................................................57
4.1.2 Robbie Williams: „Feel“..............................................................................63
4.1.3 Michael Jackson: „Billie Jean“....................................................................65
4.1.4 Zusammenfassung: Die „echte“ Stimme als männliche Performanz ..........66
4.2 Andere Stimmen ......................................................................................................69
4.2.1 Kate Bush: „Feel It“.....................................................................................70
4.2.2 Kylie Minogue: „Can't Get You Out of My Head“......................................78
4.2.3 Björk: „All Is Full Of Love“........................................................................86
4.2.4 Birdy: „People Help The People“................................................................91
4.2.5 Zusammenfassung:
Die Fragmentierung der Anderen und der semiotische Stimmklang .......100
5. Klangliche Körperproduktionen – Ein Fazit ................................................................106
5.1 Worte.......................................................................................................................106
5.2 Verschiedene Modi auditiver Lust..........................................................................107
5.3 Eigenes und Anderes...............................................................................................109
5.4 Intelligibilität und Reproduktion............................................................................109
5.5 Feministische Konsequenzen..................................................................................110
ANHANG..............................................................................................................................114
Quellenverzeichnis ...............................................................................................................115
Literatur [Internetquellen zuletzt abgerufen am 7.11.2013].........................................115
Musik............................................................................................................................119
Internetseiten [Zuletzt aufgerufen am 16.11.2013].......................................................119
Songtexte...............................................................................................................................121
Nirvana: „Smells Like Teen Spirit“..............................................................................122
Robbie Williams: „Feel“...............................................................................................124
Michael Jackson: „Billie Jean“.....................................................................................126
Kate Bush: „Feel It“......................................................................................................128
Kylie Minogue: „Can't Get You Out of My Head“.......................................................130
Björk: „All Is Full Of Love“.........................................................................................132
Birdy: „People Help The People“.................................................................................134
Trackliste der beigefügten CD............................................................................................136
Selbstständigkeitserklärung................................................................................................137