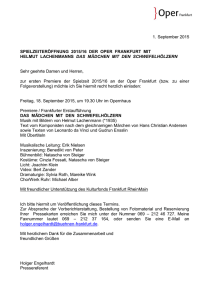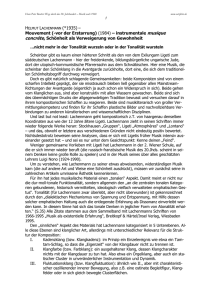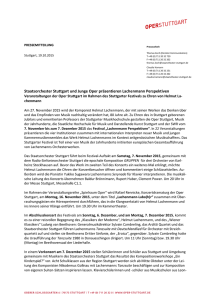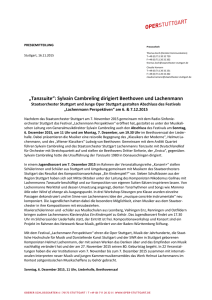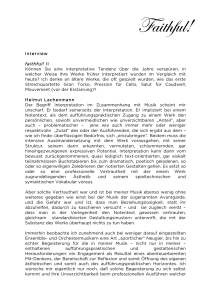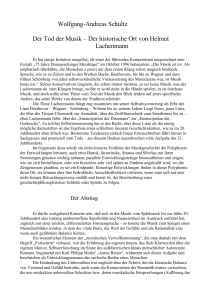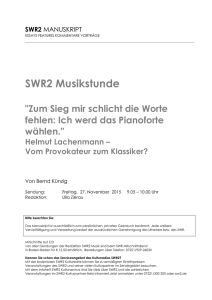Frank Hilberg Die Einheit von Denken, Fühlen und Handeln
Werbung
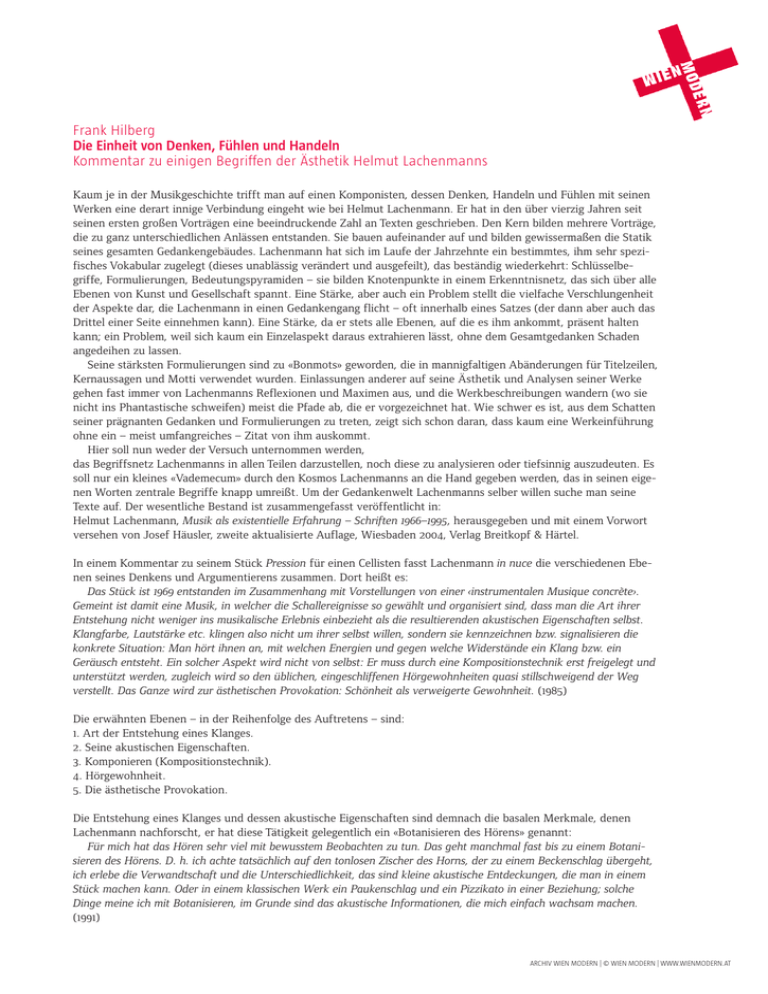
Frank Hilberg Die Einheit von Denken, Fühlen und Handeln Kommentar zu einigen Begriffen der Ästhetik Helmut Lachenmanns Kaum je in der Musikgeschichte trifft man auf einen Komponisten, dessen Denken, Handeln und Fühlen mit seinen Werken eine derart innige Verbindung eingeht wie bei Helmut Lachenmann. Er hat in den über vierzig Jahren seit seinen ersten großen Vorträgen eine beeindruckende Zahl an Texten geschrieben. Den Kern bilden mehrere Vorträge, die zu ganz unterschiedlichen Anlässen entstanden. Sie bauen aufeinander auf und bilden gewissermaßen die Statik seines gesamten Gedankengebäudes. Lachenmann hat sich im Laufe der Jahrzehnte ein bestimmtes, ihm sehr spezifisches Vokabular zugelegt (dieses unablässig verändert und ausgefeilt), das beständig wiederkehrt: Schlüsselbegriffe, Formulierungen, Bedeutungs­pyramiden – sie bilden Knotenpunkte in einem Erkenntnisnetz, das sich über alle Ebenen von Kunst und Gesellschaft spannt. Eine Stärke, aber auch ein Problem stellt die vielfache Verschlungenheit der Aspekte dar, die Lachenmann in einen Gedankengang flicht – oft innerhalb eines Satzes (der dann aber auch das Drittel einer Seite einnehmen kann). Eine Stärke, da er stets alle Ebenen, auf die es ihm ankommt, präsent halten kann; ein Problem, weil sich kaum ein Einzelaspekt daraus extrahieren lässt, ohne dem Gesamtgedanken Schaden ange­deihen zu lassen. Seine stärksten Formulierungen sind zu «Bonmots» ge­worden, die in mannigfaltigen Abänderungen für Titelzeilen, Kernaussagen und Motti verwendet wurden. Einlassungen anderer auf seine Ästhetik und Analysen seiner Werke gehen fast immer von Lachenmanns Reflexionen und Maximen aus, und die Werkbeschreibungen wandern (wo sie nicht ins Phantastische schweifen) meist die Pfade ab, die er vorgezeichnet hat. Wie schwer es ist, aus dem Schatten seiner prägnanten Gedanken und Formulierungen zu treten, zeigt sich schon daran, dass kaum eine Werkeinführung ohne ein – meist umfangreiches – Zitat von ihm auskommt. Hier soll nun weder der Versuch unternommen werden, das Begriffsnetz Lachenmanns in allen Teilen darzustellen, noch diese zu analysieren oder tiefsinnig auszudeuten. Es soll nur ein kleines «Vademecum» durch den Kosmos Lachenmanns an die Hand gegeben werden, das in seinen eigenen Worten zentrale Begriffe knapp umreißt. Um der Gedankenwelt Lachenmanns selber willen suche man seine Texte auf. Der wesentliche Bestand ist zusammengefasst veröffentlicht in: Helmut Lachenmann, Musik als existentielle Erfahrung – Schriften 1966–1995, herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Josef Häusler, zweite aktualisierte Auflage, Wiesbaden 2004, Verlag Breitkopf & Härtel. In einem Kommentar zu seinem Stück Pression für einen Cellisten fasst Lachenmann in nuce die verschiedenen Ebenen seines Denkens und Argumentierens zusammen. Dort heißt es: Das Stück ist 1969 entstanden im Zusammenhang mit Vorstellungen von einer ‹instrumentalen Musique concrète›. Gemeint ist damit eine Musik, in welcher die Schallereignisse so gewählt und organisiert sind, dass man die Art ihrer Entstehung nicht weniger ins musikalische Erlebnis einbezieht als die resultierenden akustischen Eigenschaften selbst. Klangfarbe, Lautstärke etc. klingen also nicht um ihrer selbst willen, sondern sie kennzeichnen bzw. signalisieren die konkrete Situation: Man hört ihnen an, mit welchen Energien und gegen welche Widerstände ein Klang bzw. ein Geräusch entsteht. Ein solcher Aspekt wird nicht von selbst: Er muss durch eine Kompositionstechnik erst freigelegt und unterstützt werden, zugleich wird so den üblichen, eingeschliffenen Hörgewohn­heiten quasi stillschweigend der Weg verstellt. Das Ganze wird zur ästhetischen Provokation: Schönheit als verweigerte Gewohnheit. (1985) Die erwähnten Ebenen – in der Reihenfolge des Auftretens – sind: 1. Art der Entstehung eines Klanges. 2. Seine akustischen Eigenschaften. 3. Komponieren (Kompositionstechnik). 4. Hörgewohnheit. 5. Die ästhetische Provokation. Die Entstehung eines Klanges und dessen akustische Eigenschaften sind demnach die basalen Merkmale, denen Lachenmann nachforscht, er hat diese Tätigkeit gelegentlich ein «Botanisieren des Hörens» genannt: Für mich hat das Hören sehr viel mit bewusstem Beobachten zu tun. Das geht manchmal fast bis zu einem Botani­ sieren des Hörens. D. h. ich achte tatsächlich auf den tonlosen Zischer des Horns, der zu einem Beckenschlag übergeht, ich erlebe die Verwandtschaft und die Unterschiedlichkeit, das sind kleine akustische Entdeckungen, die man in einem Stück machen kann. Oder in einem klassischen Werk ein Paukenschlag und ein Pizzikato in einer Beziehung; solche Dinge meine ich mit Botanisieren, im Grunde sind das akustische Informationen, die mich einfach wachsam machen. (1991) ARCHIV WIEN MODERN | © WIEN MODERN | WWW.WIENMODERN.AT Das Komponieren ist selbstverständlich die zentrale Tätigkeit des Komponisten, für Lachenmann hat sie aber einige Nebenimplikationen, die eben nicht selbstverständlich sind. Da ist zum einen die stets mitlaufende Reflexion über die gesellschaftlichen Zusammenhänge, innerhalb derer seine Werke entstehen (Produktion), aufgeführt (Distribution) und aufgenommen (Rezeption) werden. Sie sind keine naturgegebenen Tatsachen, sondern verstehbar und veränderlich. Mittel – gemeint ist damit das musikalische Material zunächst im engeren Sinn: jener Vorrat von Möglichkeiten, auf den der Komponist verwiesen ist, also jenes weithin vergesellschaftete Instrumentarium von Klängen, Klangordnungen, Zeitordnungen, Klangquellen: Instrumente also im engeren und im weiteren Sinn, ihre Spielpraxis, Notationspraxis, Aufführungspraxis, bis hinein oder hinaus in die Institutionen und Vermittlungsrituale – dieses ganze Musikmobiliar, wie es der Komponist nicht nur um sich herum, sondern ebenso in sich selbst vorfindet, kurz: jenes polypenhaft alles umschlingende und in alles sich hineinschlingende Monstrum, das ich anderswo den ‹ästhetischen Apparat› genannt habe. Immer wieder stelle ich mir vor, die ganze bürgerliche Welt sei ein Dorf, und die Musik sei eine Orgel auf dem Dorfplatz, an die sich immer wieder mal ein anderer Dorforganist setzt, heute Pierre Boulez, morgen Wolfgang Rihm, übermorgen Brian Ferneyhough, dann György Ligeti usw., wobei die Dorfbewohner die Organisten bestaunen, zugleich sich aber vergewissern, dass oder ob ihre Orgel auch funktioniert. […] Insofern es aber beim Bauen eines solchen Instruments um das Erschließen von verschiedenen, einander zugeordneten Ebenen geht, also um eine Art Polyphonie von charakteristischen Anordnungen, halte ich mich doch letztlich an die Idee einer imaginären ‹Orgel›, bestehend aus mehreren Manualen, kürzeren, längeren, auffälligeren, statischen, beweglichen, mehr und mehr hervortretenden usw., hervorgegangen aus der Beschäftigung mit jener imaginären Dorforgel, von der ich schon sprach, die es also ständig umzubauen, neu zu bauen gilt, auch auf die Gefahr hin, die bequemeren Dorfbewohner vor den Kopf zu stoßen. (1986) Zum anderen – und im Zusammenhang mit der Gesellschaft stehend – hat Lachenmann 1986 in seinem Vortrag Über das Komponieren noch drei für ihn maßgebende Bestimmungen angegeben: «Komponieren heißt: über die Mittel nachdenken.» «Komponieren heißt: ein Instrument bauen.» «Komponieren heißt: nicht sich gehen, sondern sich kommen lassen.» (1986) Komponieren ist, so oder so, ganz gewiss eine Form der Flucht, aber einer Flucht in die Höhle des Löwen. Sage mir, wohin du fliehst, und ich sage dir, was dich verfolgt. Zeige mir, in welchen Sand du deinen Kopf steckst, und ich sage dir, wie real die Bedrohung ist, die dich treibt. (1982) Wenn Helmut Lachenmann dieser Tage seinen siebzigsten Geburtstag feiert, so liegen zugleich über vierzig Jahre «Öffentlichkeitsarbeit» hinter ihm. Und was wie der Kampf in eigener Sache erscheinen könnte, diente weitaus mehr der Hebung der Musikkultur im Allgemeinen. Durch zeitraubende Erarbeitung mit Interpreten, Ensembles und Orchestern erklärte er Spieltechniken und verriet Ausführungstricks, die mittlerweile zum Allgemeingut geworden sind – sowohl für die Spieler als auch für die Komponisten. Mit dem Gang in die «Höhle des Löwen», wie er die Auseinandersetzung mit dem «philharmonischen Apparat» einmal nannte, wurde er zu einem Instrumentator ersten Ranges. Und durch stetiges Ausmerzen von Zweideutigkeiten oder Missverständlichkeiten und Pointierung des Gemeinten resultierten schließlich Werke, die bis zur letzten Nebennote ausgegoren und durchgehört sind. Es galt nicht, in irgendwelche Labors oder exotische Spielwiesen auszuweichen, sondern sich in den philharmonisch vorgeprägten Raum, gewissermaßen in die Höhle des Löwen zu begeben, und dort galt es, nicht Spaß, sondern Ernst zu machen. (1994) Das Zentrum seiner Argumentationen – und dies ist auch der Punkt, an dem Lachenmann seine Hebel ansetzt, um durch seine Musik gesellschaftsverändernd zu wirken – betrifft stets das Hören. In Siebenjahresabständen hat er seine Leitthesen zum Hören, stets ausführlich begründet, reformuliert: «Hören ist wehrlos – ohne Denken.» (1971) «Hören ist wehrlos auch ohne Fühlen.» (1978) «Hören ist wehrlos – ohne Hören.» (1985) Dabei «geht es eben nicht um das Hören einer Musik, die den traurigen Weltlauf durch Kratzgeräusche beweint, aber auch nicht um eine Musik, die vor dieser Welt in irgendeine Klangexotik flüchtet, sondern um Musik, bei welcher unse­ re Wahrnehmung sensibel und aufmerksam wird […].» (1985) Musik also, die sich auf das Abenteuer einlässt, den Begriff Schönheit unter veränderten, sprachlosen Bedingungen nochmals zu fassen in der berühmten Hoffnung, dass, was von Herzen kommt, trotz aller Sprachlosigkeit auch wieder zu Herzen gehe. (1985) Hören – in einer Zeit des täglichen Überangebots von Musik zugleich überfordert und unterfordert, und so verwal­ tet, muss sich befreien durch Eindringen in die Struktur des zu Hörenden als bewusst ins Werk gesetzte, freigelegte, provozierte Wahrnehmung. Darin sehe ich die wahre Tradition unserer abendländischen Kunst. (1990) Ich bin der Meinung, dass es ein Fortschritt im guten Sinne wäre – im Sinne von: Fortschreiten der Sensibilisierung –, wenn alle Dinge, die wir so ungefragt als Mobiliar unserer inneren guten Stube betrachten, genauer beobachtet wür­ den. Wenn die Dinge, bei denen wir im Allgemeinen aufhören zu hören, wo wir anfangen andächtig zu werden und anfangen zu gehorchen statt zu hören, wenn die einmal unter die Lupe genommen werden würden. Also etwas reiße­ risch gesagt, Musik soll nicht hörig machen, sondern hellhörig. (1991) Neben einer Reihe von Begriffen, die Lachenmann für konkrete kompositorische Details einsetzt – wie «Arpeggio» (in anderem Sinne, als die Instrumentalisten dies verstehen), «Manual» (hier oft in Verbindung mit der «Dorforgel»), «Klangfamilie» und «Klangtyp» – spielt die «Polyphonie von Anordnungen» eine entscheidende Rolle. Sie ist die Grundbedingung eines «integralen Komponierens», bei dem latent jeder Aspekt mit jedem anderen in einer definierten Beziehung steht. Dies wird gewährleistet durch serielle Techniken, derer sich Lachenmann bedient, die aber nicht Selbstzweck sind, sondern nur ein Hilfsmittel, um nicht an unbewusster Stelle doch wieder (im weiteren Sinne) «tonale» Dominanzen eindringen zu lassen und um materiale Dispositionen einfach und übersichtlich erstellen zu können. Am allerwenigsten aber ist «strukturell» das Gegenteil von «Expression». Meine letzte Bemerkung gilt nochmals dem Strukturbegriff, dessen Modell – Polyphonie von Anordnungen – sich einst als Schlüssel zur Überwindung der alten tonalen Vorherrschaft mitsamt den daran gebundenen Tabus ergeben und bewährt hatte. Das strukturelle Denken ist in letzter Zeit immer wieder verhimmelt und öfters noch verteufelt worden. Und es ist keine Frage, dass jenes Modell weithin zum akademistischen Bastelrezept verkommen ist. Der Strukturbegriff bedarf immer wieder der kritischen Befragung. Ich selbst glaube nicht, dass es ohne strukturelles Denken geht. Solches Denken aber und die strukturellen Techniken müssen sich immer von neuem in der Auseinandersetzung mit der Wirk­ lichkeit, das heißt: mit den übrigen realen Bestimmungen des Materials aufs Spiel setzen lassen, müssen sich verlieren, wieder finden und neu definieren. Musik hat Sinn doch nur, insofern sie über die eigene Struktur hinausweist auf Struk­ turen, Zusammenhänge, das heißt: auf Wirklichkeiten und Möglichkeiten um uns und in uns selbst. (1979) Lachenmanns Ästhetik beansprucht ein gesellschaftskritisches Potenzial für sich. Sie basiert auf einer Dialektik von «Angebot» und «Verweigerung». Dieses Diktum Lachenmanns ist ihm wie kein anderes immer wieder nachgetragen worden, es wurde in polemischer Absicht verkürzt oder in bequemer Ignoranz missverstanden. Denn anders als die Pharisäer es darstellen, verweigert Lachenmann keineswegs Musik schlechthin (bilderstürmende oder anarchistische Attitüden liegen ihm fern), ausschlaggebend für die Vermeidung alles allzu Vertrauten ist dagegen die Einsicht, dass der Hörer das Bekannte bloß registriert, statt auf das tatsächliche Klingende zu reagieren. So löst Musik nur noch Reflexe aus, statt Reflexionen zu erzeugen. Das Gewohnte hat in der Musik viele Gesichter, die Lachenmann unter dem Begriff des «Tonalen» zusammenfasst. Ge­meint ist zunächst die Tonalität selber, jene besondere Tonverknüpfung der Harmonik, die jeder Europäer mit der Muttermilch aufnimmt und die er in tausend Varianten kennt und wiedererkennt – egal ob er gerade einen Schlager, eine Arie oder eine Symphonie hört. Diese Muster erzeugen, zumeist unbewusst, eine Atmosphäre der Vertrautheit und sind häufig an bestimmte Gefühle gekoppelt, die zu Klischees erstarrt sind: Dur stimmt fröhlich, Moll macht melancholisch. Ein Komponist, der nicht noch einmal «Herz» auf «Schmerz» reimen will, wird sich solcher Mittel also enthalten müssen. Was man in- und auswendig kennt, was man bequem nachpfeifen kann, das wird nicht mehr bewusst wahrgenommen, sondern als Selbstverständliches hingenommen – es ist das Gewöhnliche. Ein Komponieren, das dem Hören neue, ungewohnte Zusammenhänge und damit ein neues Denken, Fühlen und Handeln nahe legen will, muss daher zuallererst auf das Vertraute und Bewährte radikal verzichten. Und das ist das meiste, denn nicht nur Tonalität und rhythmische Muster wirken tonal. Auch der Gebrauch von Dissonanzen, ja selbst der Zwölftönigkeit bietet keine Gewähr, der Tonalität zu entkommen. Der Hörer hört sich das Abweichende zurecht, eine Erfahrung, die schon Schönberg machen musste, als man sein erstes Streichquartett als «Beethoven mit falschen Tönen» bezeichnete. Vermutlich wirkt das temperierte System immer tonal. Eine Einsicht, die Lachenmann dazu bewog, mit den Tönen überhaupt Schluss zu machen und die weniger «kontaminierten» Geräusche, Spielweisen der Instrumente und Instrumentationskombinationen zu verwenden. Durch die «Verweigerung des Gewohnten» wirkt Musik als bewusstseinsbildende Maßnahme nur, wenn ein «Angebot von Schönheit» vorliegt, das auf der Ebene des rein Musikalischen liegt. Lachenmann bringt nicht lediglich neue Materialien ins Spiel, entscheidender ist, wie strikt dieses Spiel durchgeformt ist. Und da trachtet er als serieller Denker danach, alles mit allem in Beziehung zu setzen. Das hat Konsequenzen für das Verhältnis der kleinsten Bestandteile zum Gesamten. In diesem Sinne versteht Lachenmann «Schönheit als ‹Verweigerung von Gewohnheit›»: Meine Hilfsdefinition von Schönheit als ‹Verweigerung von Gewohnheit›: Im Zerrspiegel der Blödmacherei wurde daraus ‹Verweigerung von Genuss›. Gewohnheit und Genuss in eins gesetzt: Hier hat sich der Spießer entlarvt. (1982) Meine Definition von Schönheit als ‹Verweigerung von Gewohnheit› mag gewiss umso provozierender wirken, als sie eben den Schönheitsgedanken nicht moralisch, calvinistisch, masochistisch abschafft, sondern ihn im Gegenteil mit all seinen Tugenden von Reinheit, Klarheit, Intensität, Reichtum, Menschlichkeit in Anspruch nimmt, aber eben dort in Anspruch nimmt, wo so mancher selbst ernannte Hüter abendländischer Kultur meint sich alterieren zu müssen, ein­ fach, weil ihm das Ganze hier zu lästig ist. (1985) Dialektik von ‹Verweigerung› und ‹Angebot›: Indem die gewohnte Klangpraxis ausgesperrt wird, wird bisher Unterdrücktes offen gelegt. Die Klanglandschaft zeigt quasi die Rückseite der gesellschaftsüblichen philharmonischen Muster. (1972) Frank Hilberg: Die Einheit von Denken, Fühlen und Handeln. Kommentar zu einigen Begriffen der Ästhetik Helmut Lachenmanns, in: Katalog Wien Modern 2005, hrsg. von Berno Odo Polzer und Thomas Schäfer, Saarbrücken: Pfau 2005, S. 33-35.