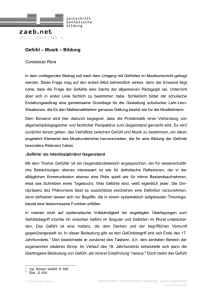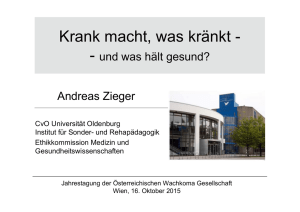Musik als "tönend bewegte Form"?
Werbung
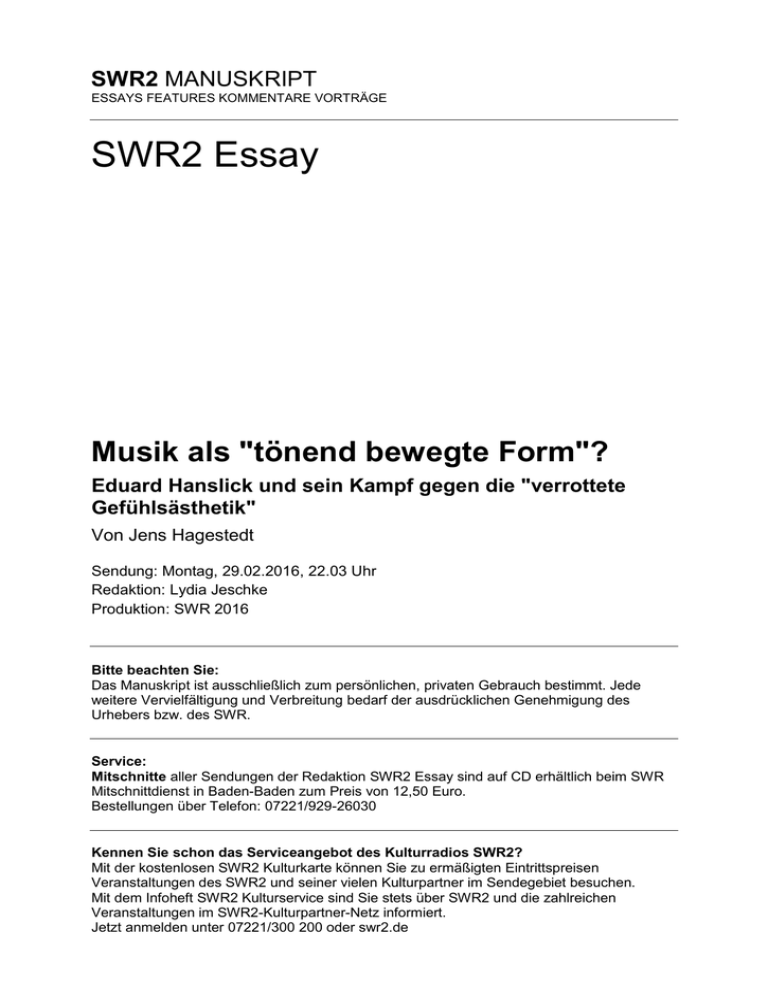
SWR2 MANUSKRIPT ESSAYS FEATURES KOMMENTARE VORTRÄGE SWR2 Essay Musik als "tönend bewegte Form"? Eduard Hanslick und sein Kampf gegen die "verrottete Gefühlsästhetik" Von Jens Hagestedt Sendung: Montag, 29.02.2016, 22.03 Uhr Redaktion: Lydia Jeschke Produktion: SWR 2016 Bitte beachten Sie: Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. Service: Mitschnitte aller Sendungen der Redaktion SWR2 Essay sind auf CD erhältlich beim SWR Mitschnittdienst in Baden-Baden zum Preis von 12,50 Euro. Bestellungen über Telefon: 07221/929-26030 Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de Musik als »tönend bewegte Form«? Eduard Hanslick und sein Kampf gegen die »verrottete Gefühlsästhetik« Eine Sendung von Jens Hagestedt <Musik 1: Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie g-moll KV 550 Concertgebouw-Orchester Amsterdam Leitung: Nikolaus Harnoncourt Teldec 4509-97490-2 3'00 <S 1> Exposition und Durchführung des Finales von Mozarts g-moll-Symphonie KV 550, gespielt vom Concertgebouw-Orchester Amsterdam unter der Leitung von Nikolaus Harnoncourt. Ist diese Musik ein einziger Ausdruck von Verzweiflung? <S 2> »Des Leidens müde«, <S 1> so ein Kommentator des 19. Jahrhunderts, <S 2> »des Leidens müde, wird die Seele unwillig und empört gegen das Leiden; sie überläßt sich einem ungestümen Zorne, der [...] beinahe in Wildheit ausartet. [...] Ich zweifle, daß es in der Musik etwas tiefer Einschneidendes, grausamer Schmerzliches, heftiger Bestürztes, trotziger Leidenschaftliches gibt, als die [Durchführung] dieses Finale's. [...] Aus welchem Begegnisse seines innern Lebens, aus welchem Paroxismus des Herzens hat Mozart diese wie irre redende und doch so classische Inspiration genommen, und wie hat dieser Ausfluß der Leidenschaft den Ausfluß der [kompositorischen] Wissenschaft überholt?«1 <S 1> Der Kommentator war der russische Musikkritiker Aleksandr Dmitrijewitsch Ulybyschew, das Zitat entstammt seiner dreibändigen Mozart-Monographie, die er in französischer Sprache 1843 in St. Petersburg veröffentlicht hatte. Für Ulybyschew, dessen Werk 1847 auch auf Deutsch erschien, brachte Mozarts g-moll-Symphonie, <S 2> »die Wünsche und Leiden einer unglücklichen Liebe« <S 1> zum Ausdruck, »einen rückhalts- und grenzenlosen Schmerz [...], welcher Angesichts der ganzen Welt ausbricht und diese mit seinen Seufzern erfüllen möchte«.2 S 1> Ulybyschews Kollege Eduard Hanslick, der namhafteste Musikkritiker des 19. Jahrhunderts, wollte von derlei Deutungen nichts wissen. <S 3> »Sind [sie] an sich schon vom Uebel, so [sind] sie es doppelt bei Mozart, welcher – die musikalischste Natur, so die Kunstgeschichte aufzuweisen hat – Alles was er nur berührt hat, in Musik verwandelte«, <S 1> schrieb Hanslick in seiner 1854 erschienenen Abhandlung Vom MusikalischSchönen. 1 <S 3> »Die G-moll-Symphonie ist Musik und weiter nichts. [...] Man suche nicht die Darstellung bestimmter Seelenprocesse oder Ereignisse in Tonstücken, sondern vor Allem Musik, und man wird rein genießen, was sie vollständig gibt.«3 <S 1> »Musik und weiter nichts«? Oder: »vor Allem Musik«, also Musik und noch etwas mehr? Was haben, Hanslick zufolge, »Tonstücke« zum Inhalt? Diese Fragen, aufgeworfen von den beiden nicht vollkommen deckungsgleichen Formulierungen des zitierten Satzes, stehen im Zentrum der Auseinandersetzungen, die seit mehr als 150 Jahren um seine Ästhetik geführt werden. Seine Extremposition hat Hanslick in einem Satz ausgesprochen, der die wohl berühmteste musikästhetische Formulierung des 19. Jahrhunderts enthält: <S 3> »Tönend bewegte Formen sind einzig und allein Inhalt und Gegenstand der Musik.«4 <S 1> »Tönend bewegte Formen« – was ist darunter zu verstehen? Hanslick antwortet mit einem Vergleich: <S 3> »In welcher Weise uns die Musik schöne Formen ohne den Inhalt eines bestimmten Affectes bringen kann, zeigt uns recht treffend ein Zweig der Ornamentik in der bildenden Kunst: die Arabeske. Wir erblicken geschwungene Linien, hier sanft sich neigend, dort kühn emporstrebend, sich findend und loslassend, in kleinen und großen Bogen correspondirend, scheinbar incommensurabel, doch immer wohlgegliedert, überall ein Gegen- oder Seitenstück begrüßend, eine Sammlung kleiner Einzelnheiten, und doch ein Ganzes. Denken wir uns nun eine Arabeske nicht todt und ruhend, sondern in fortwährender Selbstbildung vor unsern Augen entstehend. Wie die starken und die feinen Linien einander verfolgen, aus kleiner Biegung zu prächtiger Höhe sich heben, dann wieder senken, sich erweitern, zusammenziehen und in sinnigem Wechsel von Ruhe und Anspannung das Auge stets neu überraschen! Da wird das Bild schon höher und würdiger. Denken wir uns vollends diese lebendige Arabeske als thätige Ausströmung eines künstlerischen Geistes, der die ganze Fülle seiner Phantasie unablässig in die Adern dieser Bewegung ergießt, wird dieser Eindruck dem musikalischen nicht einigermaßen nahekommend sein?«5 »Die sinnvollen Beziehungen in sich reizvoller Klänge, ihr Zusammenstimmen und Widerstreben, ihr Fliehen und sich Erreichen, ihr Aufschwingen und Ersterben, – dies ist, was in freien Formen vor unser geistiges Anschauen tritt und als schön gefällt.«6 <S 1> Musik als bloßes Ornament, weder Ausdruck tiefer Gefühle und großer Leidenschaften noch auf diese beim Hörer zielend: wer war der Mann, der die musikalische Erfahrung als »geistiges Anschauen« klingender Linienkünste auffaßte oder aufzufassen vorgab? Eduard Hanslick wurde 1825 in Prag geboren. Der Vater, Bibliotheksschreiber, hatte sich dagegen entschieden, als Konzertpianist oder -sänger Karriere zu machen oder Professor für Philosophie zu werden, hatte dieses Fach aber studiert und seinen Lebensunterhalt derweil als Musiklehrer finanziert. Die Möglichkeit, eine seiner Schülerinnen, Tochter aus gutem Hause, zu ehelichen, verdankte er einem Lotteriegewinn. Seine fünf Kinder unterrichtete er selbst – in sämtlichen Fächern. Der musikalisch hochbegabte Sohn wurde, nachdem der Vater die Grundlagen gelegt hatte, zu strenger vierjähriger Ausbildung in Klavierspiel und Musiktheorie dem 2 Komponisten Wenzel Johann Tomaschek anvertraut. Nach dem Abitur studierte der junge Hanslick parallel Rechtswissenschaften, um mit dieser Qualifikation in den Staatsdienst einzutreten. Die beiden letzten Semester absolvierte er in Wien, wo er ab 1852 als Kritiker und ab 1856 als Privatdozent für Geschichte und Ästhetik der Musik wirkte – beides im Nebenberuf. 1861 nahm die Wiener Universität seine Abhandlung Vom Musikalisch-Schönen als Habilitationsschrift an und machte ihn zum Professor. Die Juristerei konnte er endlich an den Nagel hängen. Bleibt jedoch die Frage, warum sich Hanslick nicht für eine Musikerlaufbahn entschieden hatte. In seiner 1894 erschienenen Autobiographie Aus meinem Leben schreibt er: <S 3> »Nach vier Jahren war ich aus Tomascheks strenger Schule als tüchtiger Klavierspieler und wohlbeschlagen in der musikalischen Theorie hervorgegangen, wie das von ihm sehr förmlich abgefaßte, mit Stempel und Siegel versehene Absolutorium mir bezeugt. Mein Vater, liberal und ein Feind des Zwanges in allem, stellte es mir völlig anheim, ob ich die Musik als Lebensberuf wählen wolle. Trotz meiner Liebe zur Musik konnte ich mich nicht dazu entschließen. Die Virtuosenlaufbahn widerstrebte mir entschieden, obwohl Tomaschek dazu riet. Noch weniger reizte es mich, Musiklehrer zu werden oder eine Stelle als Dirigent anzustreben. Blieb also nur – das Schönste, der Beruf des Komponisten. Daß ich aber diesem nur in einem sehr begrenzten, unbedeutenden Teil zu genügen vermöchte, war mir selbst vollkommen klar. Ich hatte einige kleine Klaviersächelchen und einen ansehnlichen Haufen Lieder komponiert, deren melodiöser Zug und ungesucht innige Empfindung meinen Freunden zu Herzen sprach. Mit solchen Kleinigkeiten, das fühlte ich deutlich, ist der Welt nicht gedient und füllt man kein Leben aus. Mir fehlte der Mut, etwas Größeres zu versuchen, ein Quartett, eine Ouvertüre oder Symphonie; ich traute mir musikalisch starke, triebkräftige Ideen nicht zu.«7 <S 1> Wie immer man über Hanslicks Rolle in der Musikkritik des 19. Jahrhunderts denken mag: ein Kritiker, der sich so freimütig über seine Grenzen äußert, hat sein Metier nicht mit dem Ressentiment des verhinderten Musikers gewählt – um es denen heimzuzahlen, die mit größeren Begabungen gesegnet sind. Als »Kritikerpapst« wäre er sehr unzutreffend bezeichnet. Hanslick hatte nichts Päpstliches. Er war auch kein Eiferer, geschweige denn ein kleinlicher Krittler. Die Figur des Beckmesser, die Wagner polemisch auf Hanslick gemünzt hat, verfehlt dessen Persönlichkeit vollkommen. Den frühen Wagner, vor allem den des Tannhäuser, schätzte und förderte Hanslick übrigens, um den späteren hat er sich bemüht. Dass er ihn, mit Ausnahme etwa der Meistersinger, dass er auch den Liszt der programmusikalischen Symphonischen Dichtungen ablehnte, basierte jedenfalls nicht auf Voreingenommenheit. Im persönlichen Verkehr war Hanslick umgänglich. Seine Autobiographie erweist mit ihren Dutzenden Porträts von Zeitgenossen Hanslicks Fähigkeit, Menschen wahrzunehmen, Freundschaften zu unterhalten. Daß Liszt mit seinem entschiedensten Gegner entspannt und respektvoll verkehrte, mit ihm vierhändig spielte, ihn sogar in seiner Wiener Wohnung besuchte, bezeugt die Großherzigkeit des großherzigsten aller Komponisten, bezeugt aber auch seinen Glauben, daß Hanslick es wert sei. Wie sehr es Hanslick um die Sache zu tun war, geht es aus seiner Gepflogenheit hervor, in Konzertkritiken über keine Komposition zu urteilen, 3 <S 3> »ohne sie vor der Aufführung und nochmals nach derselben zu lesen oder durchzuspielen« – <S 1> eine Praxis, der er immer gewissenhaft treu geblieben sei.8 Was nun brachte den jungen, noch nicht dreißigjährigen Enthusiasten dazu, der Musik allen Gefühlsinhalt abzusprechen? Hanslick reagierte polemisch überzogen auf die Art und Weise, wie über Musik gesprochen und geschrieben wurde, und er tat dies auf der Basis theoretischer Vorannahmen, die der Sache nicht gerecht wurden, sondern das, was er sagen wollte, weiter zuspitzten. Was die historische Situation betrifft, in der Hanslicks Büchlein entstand, berichtet der Kritiker in seiner Autobiographie von der Lektüre ungezählter Bücher musikästhetischen Inhalts, die <S 3> »alle das Wesen der Musik in die durch sie erregten ›Gefühle‹ setzten und ihr eine sehr bestimmte Ausdrucksfähigkeit zuschrieben [...]. Gleichzeitig erhoben sich lärmend die ersten enthusiastischen Stimmen für Wagners Opern und Liszts Programm-Sinfonien.«9 <S 1> Die These, Hanslick habe sich Einseitigkeiten mit bewusster eigener Einseitigkeit entgegengestemmt, scheint plausibel. Er könnte sich etwa gefragt haben: Liegt darin, dass Musik zugestandenermaßen Gefühle erregt, wie es besonders deutlich der Wagner-Rausch des Publikums bezeugt, auch das Wesen der Musik? Vermag sie mit ihrer Ausdrucksfähigkeit Inhalte, selbst begriffliche Inhalte tatsächlich auf »sehr bestimmte« Weise auszudrücken, wie Liszts Symphonische Dichtungen angeblich beweisen? Und er hätte sich, da das Boot nach der einen Seite hin zu kentern drohte, auf die andere geworfen, indem er behauptete, Gefühle gehörten überhaupt nicht zum Inhalt der Musik: was Musik artikuliere, seien weder Gefühle noch gar Begriffe. Neben strategischen Rücksichten sind in Hanslicks Stellungnahme aber, wie gesagt, auch anfechtbare theoretische Vorannahmen eingegangen. Hanslick geht es um »objective Erkenntniß«10 musikalischer Sachverhalte, nicht darum, welche Wirkungen diese auf hörende Subjekte haben. So weit, so gut. Aber Hanslick denkt objektive Erkenntnis in Analogie zur visuellen Wahrnehmung. Wenn wir über die Sinneswahrnehmungen, vor allem über das Sehen und das Hören nachdenken, sind jahrtausendealte begriffliche Konnotationen im Spiel. Das Sehen etwa gilt als der auf den Raum bezogene Sinn schlechthin, obwohl das Hören ebenso auf den Raum bezogen ist. Ein Beispiel aus der Musik: welche Klänge wo im Orchester entspringen, das hört der aufmerksame Konzertbesucher ganz genau. Dennoch war zumindest das abendländische Denken immer geneigt, das Hören als einen subjektiveren Sinn aufzufassen: als weniger auf die drei Dimensionen des Raumes denn auf die vierte der Zeit gerichtet. Da die Zeit aber in der sogenannten »Außenwelt« nicht unmittelbar wahrnehmbar ist, müsse sie einer »Innenwelt« angehören (die freilich unauffindbar ist, was wiederum den Begriff der »Außenwelt« untergräbt). Für den von Hanslick genau gelesenen Hegel konnte die Musik, die Kunst des Zeitsinns, des »inneren« Sinns, ihre höchste Blüte erst in einem Zeitalter der »Innerlichkeit« – im christlichen Zeitalter – hervortreiben. Mit dem Begriff der Innerlichkeit verband Hegel die Vorstellung eines im Vergleich zur nach »außen« gewandten heidnischen Antike reicher ausgebildeten Gefühls- und Gedankenlebens: Gedanken und Gefühle gehören also der »Innenwelt« subjektiven Bewusstseins an. 4 Solche Konnotationen ruft Hanslick hervor, wenn er das Hören von Musik mit einer auf die visuelle Wahrnehmung zurückgehenden Metapher als »Anschauen« bezeichnet: Konnotationen, die die Musik im Rahmen der Unterscheidung von »Außenwelt« und »Innenwelt« aus der »Innenwelt« des Hörens und des Gefühls in die »Außenwelt« rein ästhetisch wahrgenommener Schönheit verlegen. Sie führen ihn, Hanslick, in seiner Bestimmung dessen, was Musik ihrem Wesen nach ist, in die Irre. Bezeichnend seine Formulierung, <S 3> »daß in ästhetischen Untersuchungen [...] das schöne Object und nicht das empfindende Subject zu erforschen sei«,11 <S 1> – das schöne Objekt, das »angeschaut«, nicht »empfunden« zu werden verlange, obwohl die Empfindungen des empfindenden Subjekts von ihm »hervorgerufen« werden, wie Hanslick schreibt.12 <S 3> »Das Schöne hat nichts Anderes zu thun als schön zu sein, mag es gleich immerhin leiden, daß wir außer dem Anschauen – der eigentlich ästhetischen Thätigkeit – auch im Fühlen und Empfinden ein Uebriges thun.«13 <S 1> Hanslick gebraucht in diesen Sätzen zweimal einen Begriff, mit dem eine weitere theoretische Vorannahme verbunden ist: den Begriff des »Ästhetischen«. Aber werden ästhetische Fragestellungen der wirkenden Macht und dem existentiellen Sinn von Kunst gerecht? Sind Kunstwerke letztlich ästhetische Gegenstände, dazu bestimmt, aus der Distanz angeschaut, d. h. in ihren Strukturen »genießend« nachvollzogen zu werden? Wir brauchen nur an Nietzsche zu denken, den bedeutendsten »Ästhetiker« der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der den höchsten Sinn von Kunst in der Erzeugung dionysischer oder genauer dionysischapollinischer Räusche sah, um zu erkennen, dass Hanslicks Auffassung nicht selbstverständlich war. Sie war »apollinisch« in jenem beschränkten Sinne, für den Nietzsche uns die Augen geöffnet hat. Kunst ist aber die höchste Form sprachlichen oder bildnerischen Verhaltens zur Wirklichkeit. Sie schafft daher keine abgesonderte Sphäre neben der vermeintlich eigentlichen Wirklichkeit, sondern repräsentiert genau diese eigentliche Wirklichkeit, und zwar angemessener als jede andere Form im weitesten Sinne sprachlichen Weltbezugs, mit Ausnahme des philosophischen Denkens. Sie stiftet Weltverständnis und hat insofern grundlegend existentielle, nicht nur ästhetische Bedeutung – ein Sachverhalt, aus dem im 20. Jahrhundert Martin Heidegger konsequenterweise die Forderung abgeleitet hat, die Ästhetik als die der Kunst vermeintlich adäquateste Betrachtungsweise zu verabschieden. Hanslicks Satz <S 3> »Dem Schönen entspricht ein Genießen, kein Erleiden, wie ja das Wort ›Kunstgenuß‹ sinnig ausdrückt«14 <S 1> – diesen Satz hätte Nietzsche nicht unterschrieben. Er hätte ihm vielmehr eine falsche Alternative attestiert und über den bildungsbürgerlichen Begriff »Kunstgenuß« gespottet. Nietzsche hätte eine Abhandlung über das Wesen der Musik auch nicht, wie Hanslick, mit dem Titel »Vom Musikalisch-Schönen« überschrieben: wobei Hanslicks Betonung auf »Musikalisch« liegt, weil er wie selbstverständlich davon ausgeht, dass Kunst es nur mit dem Schönen zu tun habe. Richard Strauss bezeichnet er später lakonisch als 5 <S 2 »großes Talent für falsche Musik, für das musikalisch Häßliche«.15 <S 1> Demgegenüber war Nietzsche durch die Erfahrung der »nicht mehr schönen« Künste gegangen, die in der Literatur mit Namen wie Baudelaire und Edgar Allen Poe verbunden ist, und hatte in die grässlichen Abgründe des schon angesprochenen, von ihm so genannten »Dionysischen« geblickt. Auch wenn Hanslick geltend zu machen versucht hätte, dass das Hässliche in der Kunst irgendwie »schön« sein müsse, um Kunst zu sein – man fühlt das Verharmlosende, das in der Rede von der Kunst als einem Reich des »Schönen« liegt. Und das Existentielle der Kunst liegt tiefer als ihre beiden ästhetischen Pole – tiefer als ihr Schönes und als ihr Hässliches. Musik, so Hanslick, kann Gefühle »erregen« – so wie alles und jedes Gefühle erregen kann. Gefühle »darstellen«, intentional »ausdrücken« kann Musik aber nicht.16 Eines der besten Argumente Hanslicks für diese These ist das sogenannte »Parodieverfahren« in der Vokalmusik: ein Verfahren, in dem einer textierten Melodie ein anderer Text unterlegt wird, der in extremen Fällen gegensätzlichen Gefühlsgehalt aufweisen kann. Bachs Weihnachtsoratorium ist ein klassisches Beispiel: ein Werk, dessen Sätze erwiesenermaßen fast ausnahmslos auf bereits existierende Bachsche Stücke, zumeist aus weltlichen Kantaten, zurückgehen. Ein extremer Fall ist die Alt-Arie »Bereite dich, Zion« aus dem ersten Teil, ein freudiger geistlicher Verheißungsgesang. Die Musik stammt aus der Kantate Laßt uns sorgen, laßt uns wachen BWV 213, genauer: sie basiert auf der Arie »Ich will dich nicht hören« des Herkules, einer Absage an Sinnlichkeit und »Wollust«. Wenn dieselben Melodien im geistlichen Zusammenhang den Ausdruck von Liebe – nämlich der zu Jesus Christus –, im weltlichen den Ausdruck von Absage an Liebe – nämlich an die sündige des Fleisches – haben: haben sie dann überhaupt einen bestimmten Gefühlsausdruck? Man würde es sich zu leicht machen, wenn man argumentierte, daß die geistliche Liebe zu Jesus Christus aufs beste mit der Absage an die Sexualität vereinbar sei. Die Grundhaltung des einen Textes ist nämlich bejahend, die des anderen verneinend – und insoweit sind die Texte nicht miteinander vereinbar. Aber hören wir beide Stücke darauf hin an, was sie musikalisch zum Ausdruck bringen und was nicht. Zunächst das frühere Stück, die Arie des Herkules. Der vollständige Text aus dem Libretto von Picander alias Christian Friedrich Henrici lautet: »Ich will dich nicht hören, ich will dich nicht wissen,/ Verworfene Wollust, ich kenne dich nicht./ Denn die Schlangen,/ So mich wollten wiegend fangen,/ Hab ich schon lange zermalmet, zerrissen.« Es singt Barbara Hölzl, es spielt das Arco Baroque Orchestra unter der Leitung von Heinz Hennig. <Musik 2: Johann Sebastian Bach: „Laßt uns sorgen, laßt uns wachen“ BWV 213 Arco Baroque Orchestra Leitung: Heinz Hennig Ars Musici 232335 1'34 Hat diese Musik den verneinenden Charakter einer Absage? Oder ist sie lediglich vereinbar mit einer vom Text artikulierten Absage? Und sollte das letztere der Fall sein: würde dies bedeuten, dass die Musik überhaupt keinen eigenen gefühlsmäßigen Ausdruck besitzt? Hören wir, mit diesen Fragen im Hinterkopf, die 6 Arie aus dem Weihnachtsoratorium. Der Text, wahrscheinlich wieder verfasst von Picander, lautet: »Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben,/ Den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehn./ Deine Wangen/ Müssen heut viel schöner prangen,/ Eile, den Bräutigam sehnlichst zu lieben!« Die Solistin ist Anne Sofie von Otter, unter der Leitung von John Eliot Gardiner spielen The English Baroque Soloists. <Musik 3: Johann Sebastian Bach: 3‘02 „Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben“ aus dem Weihnachtsoratorium BWV 248 Anne Sofie von Otter The English Baroque Soloists Leitung: John Eliot Gardiner DG 423 232-2 Denken wir, mit dem intimeren Mittelsatz über die prangenden Wangen im Ohr, an die Parallelstelle über die versucherischen Schlangen der »verworfenen Wollust« zurück: Klingen die musikalisch im wesentlichen identischen Passagen im Lichte der ihnen unterlegten grundverschiedenen Verse der weltlichen Kantate und des geistlichen Oratoriums in ihrem Gefühlsausdruck so grundverschieden, dass man ihnen, wie Hanslick behaupten würde, keinen eigenen Gefühlsausdruck attestieren kann? Albert Schweitzer beispielsweise hat diese Frage implizit verneint und Bachs Adaption kritisiert: die Vertonung werde nur dem Text der Kantate gerecht. Schweitzer verwies auf die sich in Sechszehnteln ergehende Bassfigur der Passage, ein <S 2> »bekanntes Motiv, das die windende Bewegung einer Schlange oder eines Drachens« <S 1> darstelle.17 Es handelt sich um ein abstraktes musikalisches Symbol, das als solches aber auf dem konkreten Eigen-Sinn dieser und ähnlicher Tonfolgen aufruht: Nur weil derartige Tonfolgen unwillkürlich unter anderem an Schlangen und alles, was mit Schlangen zusammenhängt, denken lassen, können sie zum abstrakten Symbol gemacht werden. Mit der Vorstellung Schlange evozieren diese Tonfolgen natürlich auch den Begriff der Versuchung und – worum es hier ja geht – darüber hinaus ein Gefühl: nämlich das Unbehagen, es mit einem Appell an »niedere Triebe« zu tun zu haben, die sich die Oberhand über die Vernunft verschaffen könnten. Damit wäre der eigenste Gefühlsgehalt der Passage umrissen – ein musikalischer Gehalt, von dessen Existenz Hanslick nichts wissen will. Dass Musik zum Träger symbolischer Bedeutungen werden kann, erkennt Hanslick übrigens an. Er übersieht aber, dass musikalische Symbole selten auf vollkommen willkürlicher Zuweisung von Bedeutungen zu Tonkomplexen beruhen. Wenn der verminderte Septakkord, eines von Hanslicks Beispielen, einst als symbolischer Ausdruck für Verzweiflung verwendet werden konnte, dann deshalb, weil er im Rahmen einer bestimmten historischen Formation der musikalischen Sprache unmittelbar als Ausdruck eines sehr unlustvollen Gefühls gehört wurde. Aus ihm ein Symbol zu machen, bedeutete nur, ihn aufgrund dieses unmittelbaren Ausdrucks zum Zeichen zu verfestigen. Als Produkt menschlichen Geistes ist Musik immer Ausdruck von Befindlichkeit, Gestimmtheit, »Gefühl« im weitesten Sinne. Was sie von den anderen Künsten unterscheidet, ist, daß sie sich auf die Artikulation dieser Schicht des Geistigen 7 weitgehend beschränkt und spezialisiert. Hanslick mißversteht die von ihm so genannte »verrottete Gefühlsästhetik«,18 wenn er deren Grundthese dahingehend wiedergibt, daß Musik die »Ideen«, d. h. die anschaulich gewordenen Begriffe »der Liebe, des Zornes, der Furcht« usw. darstelle.19 Dergleichen hat nur Programmusik versucht, etwa die allegorische des 18. Jahrhunderts, die bereits von E. T. A. Hoffmann gegeißelt worden war.20 Während aber Werke wie Dittersdorfs Combattimento delle umane passioni, »Der Kampf zwischen den menschlichen Leidenschaften«, vom Hörer erwarten, daß er die in Tönen artikulierten Leidenschaften ihren Begriffen nach erkennt, d. h. in Worte übersetzt, soll Musik den Hörer in der Regel nur in die artikulierten Gefühle und Gestimmtheiten einstimmen und deren Wechsel rein emotional nachvollziehen lassen. In der für das breite Publikum bestimmten Werkschicht ist das sogar die Hauptsache. Man denke an das »Per aspera ad astra« Beethovenscher Sonaten und Symphonien, an jene psychologischen Prozesse und gleichnishaften Schicksalsdramen, die in eine Schlußapotheose, ein »Alles wird gut« münden: wie kann Hanslick bestreiten, dass es in solcher Musik zentral um den Ausdruck von Gefühlen geht? Dass diese emotionale Schicht beim Hören von Musik auch weit zurücktreten kann gegenüber dem, was Hanslick das »spezifisch Musikalische« nennt,21 sei zugestanden. Die modern-modernistischen Ostinatostudien, die der späte Liszt in seinen Mephisto-Walzern Nr. 2 bis 4 und in seiner Mephisto-Polka komponiert hat, sind für Kenner mit Sinn für das kompositorisch Experimentelle bestimmt. <Musik 4: György Ligeti: Musica Ricercata Cathy Krier, Klavier LC 15080 CAvi-music, Best.-Nr. 8553308 2‘32 György Ligetis Musica ricercata ist eine geistreiche Probe aufs Exempel, was sich mit zwei, drei, vier Tönen der chromatischen Tonleiter alles anstellen lässt, ein Zyklus, der vom Hörer erwartet, daß er den Stufengang nachvollziehe, bis im letzten, alle zwölf Halbtöne verwendenden Stück gleichsam die ganze Musik beisammen ist. Dennoch war Ligeti darauf bedacht, den Stücken klare, deutlich voneinander unterschiedene Ausdruckscharaktere einzukomponieren, und Liszt dürfte Walzer und Polka im Titel mit der Figur des Mephisto verknüpft haben, damit dem Hörer aus der teuflischen Monotonie der Strukturen Schwefelgeruch in die Nase steige... Daß in der musikalischen Erfahrung auch ohne verbale Winke von Texten und Titeln in eminentem Maße Gefühle im Spiel sind, diese Tatsache hat Hanslick nicht bestritten. Sie hat ihn vielmehr bewogen, ihr in einem längeren Kapitel seiner Abhandlung nachzugehen und seine Auffassung vom »Inhalt« des musikalischen Werkes gegen sie zu verteidigen. Hanslick spricht zunächst von zweierlei musikalischer Erfahrung, nämlich der des Komponisten und der des Hörers, und äußert sich zum Interpreten erst später. Seine Darlegungen müssen jedoch ihr Ziel verfehlen, weil sie Gefühle nur als psychische Gegebenheiten behandeln, nicht auch als Gehalte sprachlichen Ausdrucks: Komponisten haben Gefühle, Hörer haben Gefühle, musikalische Werke haben keine Gefühle. Richtig. Aber bedeutet das, daß Gefühle nicht den Inhalt der Werke mit ausmachen? Dass die Gefühle eines Komponisten nicht in seine Werke eingehen und die des Hörers nicht aus ihnen hervorgehen? 8 <S 3> »Streng ästhetisch können wir von irgend einem Thema sagen, es klinge stolz oder trübe, nicht aber: es sei ein Ausdruck der stolzen oder der trüben Gefühle des Componisten.«22 <S 1> Hanslick wendet sich damit gegen die psychologisch-biographische Deutungsmethode, die den »streng ästhetischen« Aspekt vernachlässigt oder gar ignoriert und über ein Kunstwerk alles Wesentliche gesagt zu haben glaubt, wenn sie es aus den Lebensumständen des Künstlers »erklärt« hat. Und doch ist das musikalische Thema »Ausdruck« von Gefühlen, nämlich intersubjektiv verständlicher, Sprache gewordener Ausdruck stolzer oder trüber Gefühle des Komponisten, die, wie gedämpft auch immer, in ihm lebendig sein mußten, wollte er in der Lage sein, das Thema zu gestalten. Wenn Hanslick sagt, die Stimmung des arbeitenden Komponisten nehme die »Färbung« des werdenden Werkes an,23 so gilt eher das Umgekehrte. Und was ist die »Färbung« des Werkes anderes als der sprachliche Ausdruck von Stimmung, von Gefühl? Das Gefühl ist daher, was zu sein Hanslick ihm abspricht: »schaffender Factor«,24 wenn auch nur, neben der musikalischen »Phantasie« im engeren Sinne, einer von zwei Faktoren. Es ist die Grundlage des künstlerischen Urteilsvermögens, und es ist die treibende Kraft, wenn das gestaltende Tun jene inspirierte Intensität erlangt, die nicht zu Unrecht oft als schaffende Begeisterung oder als Schaffensrausch bezeichnet worden ist. Dagegen Hanslick: <S 3> »Gesetzt selbst, ein starkes, bestimmtes Pathos erfüllte [den Komponisten] gänzlich, so wird dasselbe Anlaß und Weihe manches Kunstwerks werden, allein [...] niemals dessen Gegenstand. Ein inneres Singen, nicht ein inneres Fühlen treibt den musikalisch Talentirten zur Erfindung eines Tonstücks.«25 <S 1> Doch, auch ein inneres Fühlen, denn das innere Singen ist in ein Gefühl gestimmt. Doch das Gefühl wird »vom Kunstwerk aufgesogen«, wie Hanslick im Hinblick auf den ausnahmsweise aus dem Affekt heraus schaffenden Komponisten richtig sagt. Es wird »aufgesogen« und <S 3> »interessiert [...] sodann nur mehr als musikalische Bestimmtheit, als Charakter des Stücks, nicht mehr des Componisten«.26 <S 1> Aufgesogen ist aber nicht aufgehoben! Ja, faktisch, so Hanslick selbst, ist Musik stets Musik mit Gefühl, und je »subjektiver« ein Komponist ist, je mehr es ihm um »Aussprache« seiner »Innerlichkeit zu thun ist«, umso subjektiver stattet er seine Werke in den Grenzen »objektiven« Formens aus. <S 3> »Ins Extrem gesteigert, läßt sich daher wohl eine Musik denken, welche blos Musik, aber keine, die blos Gefühl wäre.«27 <S 1> So zutreffend das Letztere ist, so entschieden sei das Erstere bestritten: nicht einmal denken lässt sich Musik, die »blos Musik« wäre. Entscheidend aber ist, daß Hanslick eine solche Musik denken, sich vorstellen muß: weil es sie eben nicht gibt. Nicht mehr vollständig aufgesogen vom Werk, so Hanslick, wird das Gefühl im Akt der Reproduktion, der klingenden Darstellung. Gemeint ist das Gefühl des ausführenden Interpreten: 9 <S 3> »Dem Spieler ist es gegönnt, sich von dem Gefühl, das ihn eben beherrscht, unmittelbar durch sein Instrument zu befreien und in seinen Vortrag das wilde Stürmen, das sehnliche Glühen, die heitere Kraft und Freude seines Innern zu hauchen. Schon das körperlich Innige, das durch meine Fingerspitzen die innere Bebung unvermittelt an die Saite drückt oder den Bogen reißt oder gar im Gesange selbsttönend wird, macht den persönlichsten Erguß der Stimmung im Musicieren recht eigentlich möglich. Eine Subjectivität wird hier unmittelbar in Tönen tönend wirksam, nicht blos stumm in ihnen formend.«28 <S 1> »[I]n Tönen tönend«: das Gefühl des Sängers oder Spielers äußert sich letztlich in den Tönen, die er singt oder spielt – und die doch angeblich unvermögend sind, »bestimmte Gefühle darzustellen«.29 Hanslick spricht sogar von der <S 3>»Offenbarung eines Seelenzustandes durch Musik«!30 <S 1> Woher aber kommt das Gefühl, das den Sänger oder Spieler »eben beherrscht«, wie Hanslick schreibt, wenn nicht aus den Tönen selbst? Woher kommt der sich offenbarende Seelenzustand, wenn nicht aus der Musik, in der er sich offenbart? – »Formend«, »Schöpfung des Geistes aus geistfähigem [...] Material«, wie Hanslick es vom Komponieren sagt,31 ist im übrigen auch das Reproduzieren. Es ist gleichgültig, ob diese Schöpfung nur die Dauer der Echtzeit des Stückes in Anspruch nimmt oder Stunden, Tage, Wochen, Monate, gar Jahre des immer wieder Ansetzens mit den Gefühlen, die »stumm« den Prozeß des Formens leiten. Das Resultat des Formens aber, sowohl des komponierenden als auch des reproduzierenden, sind die vielzitierten »tönend bewegten Formen«: »beseelte«, nicht »leere« Formen, wie Hanslick in seiner Autobiographie präzisiert.32 Alles Beseelte aber ist in Befindlichkeiten, Gefühle gestimmt. Hanslick selbst widerspricht der reinen Lehre seiner musikästhetischen Grundlagenschrift selbst mehrfach. In der Autobiographie erinnert er sich seiner frühen Lieder, deren, so wörtlich, »ungesucht innige Empfindung« seinen Freunden zu Herzen gegangen sei. Und natürlich drängt sich die Frage auf, inwieweit er seine radikale ästhetische Position in seinen Hunderten von Kritiken durchgehalten hat. Schon 1922 hat sich Rudolf Schäfke durch das vielbändige kritische Schaffen Hanslicks gearbeitet, um dieser Frage nachzugehen, mit dem Ergebnis, dass Hanslick vor 1854, dem Erscheinungsjahr seiner berühmten Schrift, von einer gefühlsästhetischen Position ausgegangen und nach 1854 allmählich zu ihr zurückgekehrt sei. So schrieb Hanslick beispielsweise 1849, dass <S 3> »kein zweiter Komponist einen solchen Schatz subjektiver Religion in seinen Werken niedergelegt« <S 1> habe wie Beethoven33 – womit nichts anderes gemeint sein konnte als der Ausdruck subjektiver religiöser Gefühle. <S 3> »Edle Kompositionen«, <S 1> so derselbe Autor, der kurz darauf mit der »verrotteten Gefühlsästhetik« abrechnen wird, 10 <S 3> »edle Kompositionen sind aus der Tiefe des Menschenherzens geholt und müssen darum wieder das Menschenherz in seiner Tiefe bewegen. Sie halten jeglichem, der Gleiches gefühlt, einen tönenden Spiegel entgegen, aus dem ihn sein Eigenbild mit so treuen, festen Augen anschaut, daß sich die eigenen mit Tränen füllen.«34 <S 1> An Beethoven bewunderte Hanslick später das »schöne, edle Pathos, das Großartige in Empfindung und Phantasie«, und Schubert attestierte er, dem Lied eine vorher nie dagewesene »psychologische Vertiefung« gestiftet zu haben.35 Vom späten Brahms schrieb er: <S 3> »Immer [...] bewußter findet er seine Stärke im Ausdruck gesunder, verhältnismäßig einfacher Gefühle.«36 <S 1> Der italienischen Musik sagte Hanslick nach, dass ihr im Unterschied zur deutschen »der Ausdruck ruhiger, seelenvoller Innigkeit nicht gegeben« sei, und der französischen, dass sie einen »Mangel an Innigkeit und Vertiefung des Gefühls« aufweise. Was nicht hieß: einen Mangel an Gefühl überhaupt. Die französische Musik liebe es vielmehr <S 3> »jede Leidenschaft bis zum lautesten Aufschrei, jede Empfindung auf die äußerste Spitze zu treiben«.37 <S 1> Historisch betrachtet hatte die Musik <S 3> »in der Schilderung der Seelenzustände, in der Stimmungsmalerei, kurz in ihrem psychologischen Teile« <S 1> große Fortschritte gemacht und <S 3> »mit der psychologischen Sonde in jeden Gefühlsreflex einzudringen gelernt«.38 <S 1> Man traut seinen Augen kaum: all dies vom selben Autor ausgesprochen, der in jeder neuen, durchgesehenen Auflage seines ästhetischen Traktats weiterhin die These vertrat, Musik könne keine Gefühle zum Ausdruck bringen... In der Oper billigte Hanslick das »instinktive, stetige Vorwärtsdrängen« der Gegenwartsproduktion <S 3> »vom Rein-Musikalischen zum Charakteristisch-Dramatischen«.39 <S 1> Und der Programmmusik bescheinigte er, dass sie, »mit der deutlichen Benennung an der Stirne«, ihr Sujet zwar nicht »darzustellen«, wohl aber darauf »anzuspielen« und seine »Grundstimmung« zu evozieren vermöge.40 Ein Titel wie »Aus der neuen Welt«, der <S 3> »wie eine angeschlagene Stimmgabel nur den durchklingenden poetischen Grundton des Stückes angibt«, 11 <S 1> lasse dem Hörer »Freiheit genug«: allerdings nur dann, wenn der Komponist selbst sich die Freiheit gelassen habe, seiner musikalischen Phantasie zu folgen.41 In seiner Rezension von Joseph Joachims Ouvertüre In Memoriam Heinrich von Kleist konnte Hanslick sogar schreiben, dass in dem Stück »der grübelnde, melancholische Zug« Kleists lebe. Und er konnte den Ausdruck eines anderen Gefühlskomplexes vermissen, nämlich <S 3> »das leidenschaftliche Aufflammende, Gewaltige, ja Gewaltsame, das Kleists Wesen kennzeichnet und seine Dichtungen prägt«.42 <S 1> Dennoch, so berechtigt es ist, Hanslick gegen sich selbst, gegen seinen Traktat Vom Musikalisch-Schönen zu verteidigen, so bedenkenswert ist Rudolf Schäfkes Urteil, dass in eben diesem Traktat und den darin vertretenen radikalen Ansichten die »historische Bedeutung« Hanslicks liege:43 nicht nur, weil die überspitzte These, Musik artikuliere keine Gefühle, ein willkommenes Korrektiv der überzogenen Gefühlsästhetik war und ist, derzufolge der Sinn von Musik allein die Darstellung und Erregung von Gefühlen sei. Die »historische Bedeutung« Hanslicks könnte vielmehr auch deshalb in seiner überspitzten These liegen, weil diese, die fast die gesamte Musik seiner Zeit verfehlte, Kategorien für das Verständnis von Musik an die Hand gibt, die vom Ausdruck von Gefühlen und Stimmungen zugunsten anderer gestalterischer Intentionen so weit wie möglich abzusehen scheint. Ob die Kontrapunktik des Barock so weit ging? Hanslick war natürlich dieser Meinung. Von den zweimal achtundvierzig Fugen und Präludien aus Bachs Wohltemperiertem Klavier etwa heißt es in seiner Abhandlung, <S 3> »daß Niemand« in einem dieser Stücke »ein Gefühl werde nachweisen können, das den Inhalt de[s]selben bilde«.44 <S 1> Nach dem Erscheinen von Philipp Spittas monumentaler zweibändiger BachMonographie ergänzte Hanslick polemisch, dass <S 3> »Bachianer wie Spitta die Fugen und Suiten [ihres Meisters] mit ebenso beredten und positiven Gefühlsergüssen interpretieren, wie nur ein subtiler Beethovenianer seines Meisters Sonaten«.45 <S 1> Nun, »Gefühlsergüsse« finden sich bei Spitta nicht, wohl aber attestiert der bedeutende Forscher seinem »Meister«, in seinen Kompositionen Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Zu Recht oder zu Unrecht? Bilde sich jeder sein eigenes Urteil anhand einer Fuge aus dem ersten Band des Wohltemperiertem Klaviers, über die Spitta schreibt: <S 2> »Ein scharf geschnittenes Charakterbild bietet die D dur-Fuge, deren Thema mit trotzigem Lockenschütteln das Haupt erhebt, um dann stolz und mit etwas steifer Würde einher zu schreiten. Höchst interessante motivische Bildungen« – »jähes Aufbrausen und pathetische Grandezza« – »nehmen einen nicht unbedeutenden Raum ein, was bei der eigentümlichen Gestalt und der Kürze des Themas geboten war [...].«46 <S 1> Am Klavier Angela Hewitt. 12 <Musik 5: Johann Sebastian Bach: Ausschnitt aus dem Wohltemperierten Klavier BWV 855 Angela Hewitt Hyperion CDA67301/2 1‘15 <S 1> Von »trotzigem Lockenschütteln« hatte Spitta gesprochen, von »[S]tolz« und »steifer Würde«, von »jähem Aufbrausen« und »pathetischer Grandezza«: man mag das nuanciert anders empfinden, aber sind diese Charakterisierungen, wie Hanslick behauptet hätte, völlig aus der Luft gegriffen? Für Hanslicks These, Musik bringe keine Gefühle zum Ausdruck, werden die meisten Kenner in dieser Fuge und allgemein in der barocken Kontrapunktik wohl kein gutes Argument sehen. Dagegen wird man jede Menge Musik der Moderne, beginnend mit der SchönbergSchule, finden, die keine Gefühle im traditionellen Sinne mehr darstellt, sondern sich auf sehr vermittelte Weise zum Ausdruck komplexerer Befindlichkeiten macht. Schon am Horizont erblickt hat solche Musik zu Hanslicks Lebzeiten vielleicht Franz Liszt, als er 1885 die Bagatelle ohne Tonart schrieb. Liszt hat sich in diesem Stück, das ursprünglich Vierter Mephisto-Walzer (ohne Tonart) heißen sollte, zum advocatum diaboli gemacht, indem er dem impliziten Hörer nicht nur die Möglichkeit tonaler Orientierung verwehrte, sondern auch, soweit möglich, den Ausdruck von Gefühlen, in die der Hörer sich mehr oder minder behaglich hätte einfühlen können. Pure Bosheit? Kaum. Eher hätte Liszt auf diese Frage ironisch und zugleich doch voller Vertrauen auf seinen künstlerischen Instinkt mit Goethe geantwortet, er sei »ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft«. Dagegen dürfte Hanslick das Stück, sollte er es gekannt haben, was unwahrscheinlich ist, ähnlich wie Liszts ersten Mephisto-Walzer empfunden haben, bei dem dem Hörer <S 3> »eine Schlangenhaut über den Rücken läuft und die Zähne wehtun«, <S 1> so Hanslick in einem Verriss. <S 3> »Unfähig, aus eigenen Mitteln Schönes zu schaffen, ersinnt Liszt mit Absicht das Häßliche.«47 <S 1> Und doch entsprach dieses Stück, ob schön oder häßlich, der Ästhetik von Hanslicks Traktat mehr als das Allermeiste, was seit der Renaissance bis dahin komponiert worden war. Auch darin liegt eine Ironie. <Musik 6: Franz Liszt: Bagatelle ohne Tonart Cyprien Katsaris TELDEC 8.42829, tr. 5; 2'36> 2‘41 *** 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Mozarts Leben, nebst einer Uebersicht der allgemeinen Geschichte der Musik und einer Analyse der Hauptwerke Mozart's von Alexander Oulibicheff, Ehrenmitglied der philharmonischen Gesellschaft zu St. Petersburg. Für deutsche Leser bearbeitet von A. [Albert] Schraishuon. Dritter Theil. Stuttgart 1847, 314 f. Ebd. 310 f. Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen: ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst. Darmstadt 1976, 42. Ebd. 32. Ebd. 32 f. Ebd. 32. Eduard Hanslick, Aus meinem Leben. Mit einem Nachwort herausgegeben von Peter Wapnewski. Kassel 1987, 26. Ebd. 39. Ebd. 150. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen 1. Ebd. 2. Ebd. Ebd. 3 f. Ebd. 77. Zitiert nach Werner Abegg, Musikästhetik und Musikkritik bei Eduard Hanslick. Regensburg 1974, 75. Ebd. 14. Albert Schweitzer, J. S. Bach. Vorrede von Charles Marie Widor. Wiesbaden 1976, 616. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen V. Ebd. 16. E. T. A. Hoffmann, »Ludwig van Beethoven: 5. Sinfonie«, in Hoffmann, Schriften zur Musik: Aufsätze und Rezensionen. Neubearbeitete Ausgabe. Nach dem Text der Erstdrucke und Handschriften herausgegeben sowie mit Nachwort und Anmerkungen versehen von Friedrich Schnapp. München 1977, 34. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen 31. Ebd. 55. Ebd. 52 f. Ebd. 54. Ebd. Ebd. Ebd. 55. Ebd. 57. Ebd. 18. Ebd. 58; meine Hervorhebung. Ebd. 104. Hanslick, Aus meinem Leben 155. Zitiert nach Rudolf Schäfke, Eduard Hanslick und die Musikästhetik. Reprint der Ausgabe Leipzig 1922, Nendeln/Liechtenstein 1976, 63. Zit. ebd. 69 f. Zit. ebd. 63. Zit. nach Abegg, Musikästhetik und Musikkritik bei Eduard Hanslick 65. Zit. nach Schäfke, Eduard Hanslick und die Musikästhetik 64. Zit. ebd. 65. Zit. ebd. 67. 14 40 41 42 43 44 45 46 47 Zit. nach Abegg, Musikästhetik und Musikkritik bei Eduard Hanslick 93. Zit. ebd. 101 f. Zit. ebd. 100. Schäfke, Eduard Hanslick und die Musikästhetik 70. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen 19. Dietmar Strauß, Eduard Hanslick: Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik in der Tonkunst. Teil 1: Historisch-kritische Ausgabe. Mainz 1990, 52. Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach. Bd. 1, Leipzig 1873, 776. Zit. nach Abegg, Musikästhetik und Musikkritik bei Eduard Hanslick 74. 15