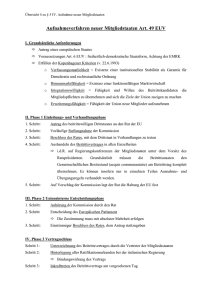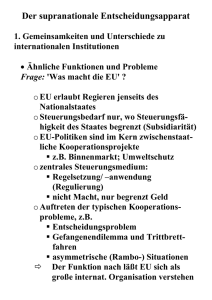Europäisches Semester 2017: das Winterpaket im
Werbung

Europäische Kommission - Factsheet Europäisches Semester 2017: das Winterpaket im Überblick Brüssel, 22. Februar 2017 Woraus besteht das heute vorgelegte Winterpaket? Heute veröffentlicht die Kommission: - 27 Länderberichte (für alle Mitgliedstaaten außer Griechenland, das in einem Stabilitätsprogramm ist) sowie eingehende Überprüfungen in Bezug auf die 13 im Warnmechanismus-Bericht vom vergangenen November genannten Mitgliedstaaten; - eine allgemeine Mitteilung, in der die wichtigsten Ergebnisse der Länderberichte und der eingehenden Überprüfungen zusammengefasst werden; - einen Bericht über die Umsetzung des Fiskalpakts in den jeweiligen nationalen Rechtsrahmen sowie eine begleitende Mitteilung mit dem Titel „Der Fiskalpakt: Bestandsaufnahme“; - einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags über die Einhaltung des Schuldenstandskriteriums durch Italien; - einen Bericht und einen Vorschlag an den Rat über eine Geldbuße für Österreich wegen falscher Darstellung statistischer Daten in Bezug auf das Land Salzburg. Länderberichte Was sind Länderberichte? In einem Länderbericht werden die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen in dem jeweiligen Mitgliedstaat analysiert und zusammengefasst. Die Berichte sind ein Instrument im Rahmen des sogenannten Europäischen Semesters, das der wirtschaftspolitischen Koordinierung zur Überwachung von Reformen dient und dazu beitragen soll, dass mögliche Probleme, die die Mitgliedstaaten angehen sollten, frühzeitig erkannt werden. Bei Ländern, für die laut dem im November von der Kommission vorgelegten Warnmechanismus-Bericht eine eingehende Überprüfung durchgeführt werden muss, wird im jeweiligen Länderbericht außerdem untersucht, ob makroökonomische Ungleichgewichte vorliegen und wenn ja, wie schwerwiegend diese sind. Die Länderberichte dienen als Grundlage für die Fortsetzung des Dialogs mit den Mitgliedstaaten und Interessenträgern auf allen Ebenen, bevor im April die nationalen Programme vorgelegt und im Laufe des Frühjahrs neue länderspezifische Empfehlungen ausgearbeitet werden. In diesem Jahr wurden die Mitgliedstaaten erstmals bereits vor der Veröffentlichung zu den analytischen Abschnitten der Berichte konsultiert, um ihnen Gelegenheit zu geben, die Korrektheit der Zahlen und Sachverhalte zu prüfen. Die abschließende Analyse wird jedoch nach wie vor von der Kommission vorgenommen. Die Länderberichte für bestimmte Mitgliedstaaten enthalten auch „Policy Highlights“, die für die betreffenden Länder von Bedeutung sind oder als Vorbild für andere dienen können. Wie sehen die Ergebnisse der Länderberichte insgesamt aus? In den 27 Länderberichten (für alle Mitgliedstaaten außer Griechenland, das in einem Stabilitätsprogramm ist) wird untersucht, welche Fortschritte der jeweilige Mitgliedstaat bei der Bewältigung der in den länderspezifischen Empfehlungen vom vergangenen Juli genannten Problemen erzielt hat. Besonders ermutigend sind die Fortschritte im Finanzsektor und in der Arbeitsmarktpolitik, wo viele Mitgliedstaaten Schritte unternommen haben, um im vergangenen Jahr festgestellte Schwierigkeiten anzugehen. Angesichts des Niedrigzinsumfelds sind auch Fortschritte bei der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen festzustellen. Bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen für Unternehmen und der Investitionsförderung ergibt sich ein gemischteres Bild. Die geringsten Fortschritte waren u. a. bei der Liberalisierung von Waren- und Dienstleistungsmärkten und der Bekämpfung sozialer Ausgrenzung festzustellen. Die meisten Mitgliedstaaten sind auf einem guten Weg, um ihre Ziele im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ in Bezug auf Emissionssenkungen, erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu erreichen, während hinsichtlich der Ziele in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Armutsbekämpfung sowie Ausgaben für Forschung und Entwicklung weitere Anstrengungen erforderlich sind. Die Inanspruchnahme von EU-Mitteln hat sich verbessert, wobei die Mitgliedstaaten die bereitgestellten Mittel für die Ausarbeitung und Durchführung von Strukturreformen nutzen. Neben den europäischen Struktur- und Investitionsfonds stehen den Mitgliedstaaten Mittel aus dem europäischen Fonds für strategische Investitionen (dem sogenannten Juncker-Fonds) sowie anderen direkt verwalteten EUFonds wie „Horizont 2020“ und der Fazilität „ Connecting Europe“ zur Verfügung. Bei der Umsetzung wichtiger Reformen können sie zudem technische Hilfe in Anspruch nehmen, indem sie beim Dienst zur Unterstützung von Strukturreformen einen entsprechenden Antrag stellen. Wie tragen die Länderberichte im Rahmen des Europäischen Semesters zu einer Ausrichtung auf die Prioritäten in den Bereichen Beschäftigung und Soziales bei? Die Juncker-Kommission hat seit ihrem Amtsantritt die Prioritäten aus den Bereichen Beschäftigung und Soziales stärker in den Vordergrund des Europäischen Semesters gerückt, welches der wirtschaftspolitischen Koordinierung dient. Die Mitgliedstaaten haben ein breites Spektrum an Reformen in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und Soziales fortgeführt. Diese Reformen sollen zur Verwirklichung der beschäftigungs- und sozialpolitischen Ziele der Strategie „Europa 2020“ beitragen: Menschen Arbeit zu bringen, ihnen die passenden Qualifikationen zu vermitteln und Armut abzubauen. Im Jahr 2016 hat die Beschäftigung in der EU mit 232 Millionen Erwerbstätigen einen neuen Höchststand erreicht. Die Arbeitslosenquote ging auf 8,5 % zurück, die Zahl der Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind, fiel auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren, und die Einkommensverteilung ist insgesamt ausgewogener als in anderen großen Volkswirtschaften. Es gibt jedoch nach wie vor große Herausforderungen, denn einige Länder stehen wegen hoher Arbeitslosigkeit, Armut und Ungleichheit seit der Wirtschafts- und Finanzkrise vor großen Schwierigkeiten. Außerdem müssen die Konvergenzbemühungen verstärkt werden, da nach wie vor große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bestehen. Um die Entwicklung in den Bereichen Beschäftigung und Soziales besser bewerten zu können, hat die Kommission im Jahr 2014 neue soziale und Beschäftigungsindikatoren wie die Erwerbsquote, die Langzeitarbeitslosenquote und die Jugendarbeitslosenquote in ihren Anzeiger (Scoreboard) für das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten aufgenommen. In dem heute vorgelegten Paket werden insbesondere folgende Themenbereiche beleuchtet: allgemeine und berufliche Bildung und Qualifikation, Renten und die besondere Lage älterer Arbeitnehmer, Armut und soziale Inklusion, Frauenerwerbsquote sowie aktive Arbeitsmarktpolitik einschließlich der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Schritte im Rahmen des Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht Was ist mit „eingehende Überprüfung“ gemeint? Eine eingehende Überprüfung wird im Rahmen des Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht durchgeführt, um potenziell schädliche makroökonomische Ungleichgewichte, die die wirtschaftliche Stabilität in einem einzigen Land, im Euro-Währungsgebiet oder in der gesamten EU gefährden könnten, aufzudecken bzw. zu verhindern. Zunächst wird im Warnmechanismus-Bericht, der jedes Jahr im November erscheint, auf der Grundlage eines Anzeigers (Scoreboard) mit bestimmten Indikatoren ermittelt, welche Mitgliedstaaten möglicherweise wirtschaftliche Ungleichgewichte aufweisen. Anschließend unterzieht die Kommission diese Länder einer eingehenden Überprüfung, um zu ermitteln, ob tatsächlich ein Ungleichgewicht bzw. übermäßiges Ungleichgewicht vorliegt, und wenn ja, wie schwerwiegend es ist. Die Ergebnisse der eingehenden Überprüfung werden im jeweiligen Länderbericht vorgestellt. In den eingehenden Überprüfungen wird unter anderem die Nachhaltigkeit folgender Kenngrößen in den Mitgliedstaaten beurteilt: Außenbilanz, Ersparnis und Investitionen, effektive Wechselkurse, Exportmarktanteile, kostenabhängige und kostenunabhängige Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität, private und öffentliche Verschuldung, Wohnimmobilienpreise, Kreditflüsse, Finanzsysteme und Arbeitslosigkeit. Seit der Veröffentlichung des Warnmechanismus-Berichts haben die Dienststellen der Kommission in enger Zusammenarbeit mit Experten der nationalen Behörden und Interessenträgern die neuesten Informationen gesammelt und analysiert. Was ist ein „makroökonomisches Ungleichgewicht“ ? Im Rahmen des Europäischen Semesters sind makroökonomische Ungleichgewichte definiert als „Trends, die zu makroökonomischen Entwicklungen führen, die sich nachteilig auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschaft eines Mitgliedstaats oder der Wirtschafts- und Währungsunion oder der Union insgesamt auswirken oder potenziell auswirken könnten“ und übermäßige Ungleichgewichte als „schwere Ungleichgewichte, einschließlich Ungleichgewichte oder Risiken, die das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion gefährden“. Konkret geht es also um Situationen, die die makroökonomische Stabilität der Wirtschaft des jeweiligen Mitgliedstaats selbst, des Euro-Währungsgebiets oder der EU insgesamt gefährden. Beispiele dafür wären etwa nicht nachhaltige Entwicklungen (z. B. ein anhaltender übermäßiger Anstieg der Wohnimmobilienpreise), die zu abrupten Anpassungen führen können, oder bestimmte Schwachstellen (z. B. ein hoher Schuldenstand), die die Wirtschaft belasten und die Auswirkungen makroökonomischer Schocks verstärken. Welche Länder hat die Kommission einer eingehenden Überprüfung unterzogen? Welche Länder weisen Ungleichgewichte auf? Im Warnmechanismus-Bericht 2017 hat die Kommission festgestellt, dass bei folgenden 13 Mitgliedstaaten eine eingehende Überprüfung angebracht ist: Bulgarien, Kroatien, Zypern, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, Portugal, Slowenien, Spanien und Schweden. Alle 13 Länder wiesen 2016 Ungleichgewichte bzw. übermäßige Ungleichgewichte auf. Im Falle Griechenlands erfolgen die Überwachung der Ungleichgewichte und das Monitoring der Korrekturmaßnahmen weiterhin im Kontext des makroökonomischen Anpassungsprogramms. Die wichtigsten Ergebnisse der diesjährigen eingehenden Überprüfungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: - Finnland weist offenbar keine wirtschaftlichen Ungleichgewichte im Sinne der Verfahrensvorschriften auf. - Deutschland, Irland, Spanien, die Niederlande, Slowenien und Schweden weisen offenbar wirtschaftliche Ungleichgewichte auf. - Bulgarien, Frankreich, Kroatien, Italien, Portugal und Zypern weisen offenbar übermäßige wirtschaftliche Ungleichgewichte auf. Im Vergleich zu 2016 ist die Zahl der Mitgliedstaaten, in denen Ungleichgewichte festgestellt wurden, also zurückgegangen. - Irland und Slowenien weisen nach wie vor Ungleichgewichte auf. Eine Reihe positiver wirtschaftlicher Entwicklungen und durchgeführter Reformen deuten auf ihre allmähliche Korrektur hin. Die nachhaltige Korrektur ihrer Ungleichgewichte liegt in Reichweite, sofern weitere Anstrengungen unternommen werden. Die Kommission wird deshalb die wirtschaftlichen Entwicklungen in beiden Ländern und die künftigen Selbstverpflichtungen, insbesondere die nationalen Reformprogramme (NRP), beobachten, um die nächste eingehende Überprüfung vorzubereiten. - Deutschland weist Ungleichgewichte auf, die sich in einem großen Leistungsbilanzüberschuss widerspiegeln. Die jüngsten wirtschaftlichen Entwicklungen deuten nicht auf eine Korrektur dieser Ungleichgewichte hin, wenngleich gewisse Fortschritte bei der Umsetzung der letztjährigen länderspezifischen Empfehlungen in Bezug auf das Verfahren bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht erzielt wurden. Die Kommission wird deshalb die wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und die künftigen Selbstverpflichtungen, insbesondere das nationale Reformprogramm und ein möglicherweise von der nächsten Bundesregierung vorgelegtes neues nationales Reformprogramm, beobachten, um die nächste eingehende Überprüfung vorzubereiten. - Frankreich weist weiterhin übermäßige Ungleichgewichte auf, aber eine Reihe wirtschaftlicher Entwicklungen und durchgeführter Reformen deuten auf ihre allmähliche Korrektur hin. Für eine nachhaltige Korrektur dieser Ungleichgewichte sind jedoch weitere Anstrengungen erforderlich. Die Kommission wird deshalb die wirtschaftlichen Entwicklungen in Frankreich und die künftigen Selbstverpflichtungen, insbesondere das nationale Reformprogramm und ein möglicherweise von der nächsten Regierung vorgelegtes neues nationales Reformprogramm, beobachten, um die nächste eingehende Überprüfung vorzubereiten. Auf der Grundlage dieser Überprüfung könnte die Kommission es in Betracht ziehen, die Einstufung von „übermäßige Ungleichgewichte“ in „Ungleichgewichte“ zu ändern. - Bei drei weiteren Ländern mit übermäßigen Ungleichgewichten – Zypern, Italien und Portugal – wird die Kommission angesichts der anhaltenden strukturellen Schwächen, die bei der eingehenden Überprüfung festgestellt wurden, ihre Bewertung im Mai im Lichte der in den nationalen Reformprogrammen dieser Länder zum Ausdruck kommenden Zielvorstellungen überprüfen. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Die von der Kommission vorgelegten Länderberichte und ggf. die Ergebnisse der eingehenden Überprüfungen werden nun vom Rat erörtert. Anschließend wird die Kommission die Länderberichte im Rahmen bilateraler Treffen mit den Mitgliedstaaten erörtern. Die Kommissionsvizepräsidenten und - mitglieder werden in den Mitgliedstaaten mit Regierungsvertretern, nationalen Parlamenten, Sozialpartnern und anderen Interessenträgern zusammentreffen. Bis Mitte April müssen die Mitgliedstaaten ihre nationalen Reformprogramme und ihre Stabilitätsprogramme (für Mitglieder des Euro-Währungsgebiets) bzw. Konvergenzprogramme (für die übrigen EU-Länder) vorlegen, mit denen sie die ermittelten Herausforderungen angehen wollen. Dabei sollen sie die nationalen Parlamente und Sozialpartner eng einbinden und die Übernahme von Eigenverantwortung für den Reformprozess seitens einer größeren Bandbreite an Interessenträgern gewährleisten. Außerdem sollen die Mitgliedstaaten erläutern, wie die regionalen und lokalen Behörden in die Vorbereitung des Programms einbezogen werden, denn der Erfolg der Umsetzung hängt von verschiedenen Regierungsebenen ab. Auf der Grundlage dieser Quellen wird die Kommission im Frühjahr neue länderspezifische Empfehlungen vorschlagen, in denen sie auf die wichtigsten Herausforderungen eingeht, die zu bewältigen sind. Fiskalpakt Was ist der Fiskalpakt? Der Fiskalpakt ist ein zentrales Element des zwischenstaatlichen Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung (SKSVertrag) im Rahmen der Wirtschafts- und Währungsunion. Er wurde am 2. März 2012 von den Staats- und Regierungschefs von 25 EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet und ist am 1. Januar 2013 in Kraft getreten. Insbesondere durch die „Regel des ausgeglichenen Haushalts“ wurden mit dem Vertrag eine Stärkung der Haushaltsdisziplin und eine strengere Überwachung innerhalb des Euro-Währungsgebiets eingeführt. Der Fiskalpakt ist aus der gründlichen Überprüfung der Regeln für die wirtschaftspolitische Steuerung für die EU und das Euro-Währungsgebiet nach der Finanz- und Wirtschaftskrise entstanden. Unter anderem sollte er den Stabilitäts- und Wachstumspakt als regelgebundenen haushaltspolitischen Rahmen der EU um Bestimmungen auf nationaler Ebene ergänzen und so eine solide Haushaltspolitik fördern und übermäßige Defizite verhindern. Der Fiskalpakt sieht vor, dass die Haushalte der Mitgliedstaaten nach der genannten Regel des ausgeglichenen Haushalts entweder ausgeglichen sein oder einen Überschuss aufweisen müssen. Dieses Ziel gilt als erreicht, wenn das strukturelle gesamtstaatliche Defizit im betreffenden Jahr 0,5 % des BIP zu Marktpreisen nicht übersteigt. Die Haushalte müssen ferner mit dem mittelfristigen Haushaltsziel für das jeweilige Land gemäß der Definition im Stabilitäts- und Wachstumspakt der EU im Einklang stehen. Die Regel des ausgeglichenen Haushalts mussten die Mitgliedstaaten innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Vertrags, d. h. spätestens am 1. Januar 2014, in das nationale Rechtssystem übernehmen, und zwar vorzugsweise auf Verfassungsebene. Nach Ablauf dieser Frist befragte die Kommission die Mitgliedstaaten, die den Vertrag unterzeichnet hatten, im Juli 2015 zu diesen nationalen Bestimmungen. Im Mai 2016 forderte die Kommission die Mitgliedstaaten, bei denen sie Zweifel an der vollständigen Umsetzung der Regel hatte, zu einer förmlichen Stellungnahme auf. Der heute veröffentlichte Bericht bildet den Abschluss dieses Verfahrens. Aus dem heute vorgelegten Bericht geht hervor, dass alle Mitgliedstaaten, die den Fiskalpakt unterzeichnet haben, die wesentlichen Bestimmungen des Pakts in ihren jeweiligen nationalen haushaltspolitischen Rahmen übertragen haben. Die Bestimmungen wurden nicht von allen Mitgliedstaaten in derselben Weise umgesetzt, doch ist dies eine Folge des durch den Vertrag gesetzten Rahmens, der Grundsätze und relativ allgemeine Anforderungen enthält. Der Fiskalpakt erhielt die Form eines zwischenstaatlichen Vertrags, da es zum Zeitpunkt der Unterzeichnung nicht möglich war, ihn innerhalb der Rechtsordnung der EU abzuschließen. Es sollten jedoch Schritte hin zur Eingliederung des SKS-Vertrags in das Unionsrecht unternommen werden, um die demokratische Rechenschaftspflicht und Legitimität unionsweit zu erhöhen. Der Fiskalpakt dient außerdem der Stärkung der Haushaltsregeln, da sich die Unterzeichnerstaaten des Euro-Währungsgebiets verpflichten, Empfehlungen und Beschlüsse des Rates der EU im Rahmen des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit anzunehmen, sofern sich nicht eine qualifizierte Mehrheit dagegen ausspricht. Es herrscht politisches Einvernehmen darüber, dass weitere finanzielle Unterstützung im Rahmen des europäischen Stabilitätsmechanismus nur unter der Voraussetzung gewährt werden kann, dass der Fiskalpakt ratifiziert und die Regel des ausgeglichenen Haushalts rechtzeitig in nationales Recht umgesetzt wird. Bei dem Fiskalpakt handelt es sich um ein rechtsverbindliches internationales Übereinkommen. Er gilt nur für Vertragsparteien, deren Währung der Euro ist. Für die anderen Mitgliedstaaten werden die Vertragsbestimmungen verbindlich, sobald sie den Euro einführen, oder bereits vorher, wenn sie den Wunsch äußern zu einem früheren Zeitpunkt an die Bestimmungen gebunden zu sein. Wozu dient der heute vorgelegte Bericht über den Fiskalpakt? In dem Bericht wird auf der Grundlage einer förmlichen Prüfung dargelegt, ob die von den Mitgliedstaaten angenommenen nationalen Bestimmungen mit dem Fiskalpakt im Einklang stehen. Dabei geht es nicht darum, zu bewerten, ob die Bestimmungen zur Umsetzung ordnungsgemäß funktionieren, da dies von dem der Kommission erteilten Mandat nicht abgedeckt wird. Wieso wird der Bericht jetzt veröffentlicht? Seit Inkrafttreten des Fiskalpakts 2013 wurden mehrere Gesprächsrunden zwischen der Kommission und den betreffenden Mitgliedstaaten organisiert, um die Fortschritte bei der Umsetzung der Bestimmungen in nationale Rechtsvorschriften zu überprüfen und zu begleiten. Die Gespräche haben zwei positive Ergebnisse hervorgebracht: Erstens konnte ein qualitativer Beitrag zu den nationalen Vorschriften geleistet werden, da einige Mitgliedstaaten der Aufforderung gefolgt sind, bestimmte Änderungen vorzunehmen, und zweitens konnte die Kommission bestimmte Aspekte der Umsetzung dank erklärender Angaben der Mitgliedstaaten auf besserer Grundlage prüfen. Die Kommission hält die Mitgliedstaaten im Wirtschafts- und Finanzausschuss regelmäßig über den Prüfungsverlauf auf dem Laufenden. Schuldenlage in Italien Was hat die Kommission heute zu Italien beschlossen? Die Kommission hat heute einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu Italien angenommen, in dem sie die Einhaltung des Schuldenstandskriteriums des Stabilitäts- und Wachstumspakts und das Ausmaß der zu seiner Erreichung notwendigen haushaltspolitischen Anstrengungen überprüft hat. Dem Bericht zufolge sollte das Schuldenstandskriterium nach der Definition im Vertrag und in der Verordnung (EG) Nr. 1467/1997 als derzeit nicht erfüllt angesehen werden, sofern nicht die zusätzlichen strukturellen Maßnahmen im Umfang von mindestens 0,2 % des BIP, zu denen sich die Regierung verpflichtet hat, wie zugesagt bis spätestens April 2017 glaubhaft durchgeführt werden, um einer weitgehenden Erfüllung der Anforderungen nach der präventiven Komponente 2017 (und somit 2016) näherzukommen. Über die Einleitung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit wird erst auf der Grundlage der Frühjahrsprognose 2017 der Kommission getroffen, wobei die Ist-Daten für 2016 und die Umsetzung der haushaltspolitischen Zusagen der italienischen Behörden vom Februar 2017 berücksichtigt werden. Weshalb musste die Kommission diesen Bericht vorlegen? Die Europäische Kommission hatte im Frühjahr 2016 angekündigt, für Italien einen neuen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV vorzulegen, sobald neue Informationen zum Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel 2017 zur Verfügung stehen und der Haushalt genehmigt ist. Mit der Vorlage des aktualisierten Berichts nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV kommt die Kommission dieser im vergangenen Frühjahr gegebenen Zusage nun nach. Gleichzeitig wird es Italien dadurch ermöglicht, im Laufe des Jahres 2017 Maßnahmen für eine hinreichende Anpassung in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel zu ergreifen, was für die Bewertung der Einhaltung der Schuldenregel von zentraler Bedeutung ist. Nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV erstellt die Kommission einen Bericht, falls ein Mitgliedstaat die Kriterien in Bezug auf das Defizit und/oder den Schuldenstand nicht erfüllt. In dem Bericht müssen alle einschlägigen Faktoren berücksichtigt werden, einschließlich der mittelfristigen Wirtschafts- und Haushaltslage des Mitgliedstaats. Im Falle Italiens wurde der Bericht zur Überprüfung der Einhaltung des Schuldenstandskriteriums erstellt. Ein Mitgliedstaat verstößt dann gegen das Schuldenstandskriterium, wenn der gesamtstaatliche Schuldenstand 60 % des BIP übersteigt und nicht rasch genug zurückgeht. Der Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 ist der erste Schritt im Rahmen der Prüfung, ob ein Verfahren bei einem übermäßigen Defizit einzuleiten ist. Wie geht es nach der Veröffentlichung dieses Berichts weiter? Innerhalb von zwei Wochen wird nun der Wirtschafts- und Finanzausschuss zu dem Bericht der Kommission nach Artikel 126 Absatz 3 AEUV Stellung nehmen und bewerten, ob Italien das Schuldenstandskriterium einhält oder nicht. Verfälschte statistische Darstellung in Österreich Über welche Befugnisse verfügt die Kommission zur Untersuchung von Unregelmäßigkeiten in den Statistiken der Mitgliedstaaten? Die Kommission (Eurostat) ist seit 2011 befugt, die Qualität der Statistiken der Mitgliedstaaten genauer zu prüfen, um zu gewährleisten, dass die wirtschafts- und haushaltspolitische Überwachung auf verlässlichen Daten aufbaut. Sie kann Vor-Ort-Kontrollen durchführen und die Haushaltsdaten der Mitgliedstaaten auf zentraler, regionaler und lokaler Ebene einschließlich der zugrunde liegenden Rechnungslegungsdaten und anderer einschlägiger Quellen prüfen. Besteht der Verdacht, dass ein Mitgliedstaat seine Angaben zum Defizit und zum Schuldenstand absichtlich oder aufgrund schwerwiegender Nachlässigkeit falsch dargestellt hat, so kann die Kommission eine offizielle Untersuchung einleiten. Wenn die Untersuchung belegt, dass Daten manipuliert wurden, kann die Kommission dem Rat nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des „Sechserpakets“ vorschlagen, eine Geldbuße gegen das jeweilige Mitglied des EuroWährungsgebiets zu erlassen. Ein separates Memo zu diesem Thema finden Sie hier. Weitere Informationen: Pressemitteilung Mitteilung Länderberichte Winterprognose 2017 Auftakt zum Europäischen Semester 2017: Herbstpaket Die wirtschaftspolitische Steuerung der EU im Überblick Warnmechanismus-Bericht 2017 Mitteilung zum fiskalpolitischen Kurs Jahreswachstumsbericht 2017 Empfehlung für das Euro-Währungsgebiet 2017 Entwurf des gemeinsamen Beschäftigungsberichts 2017 MEMO/17/309 Kontakt für die Medien: Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53) Annikky LAMP (+32 2 295 61 51) Corentin CASSIERS (+32 2 295 32 08) Kontakt für die Öffentlichkeit: Europe Direct – telefonisch unter 00 800 67 89 10 11 oder per E-Mail