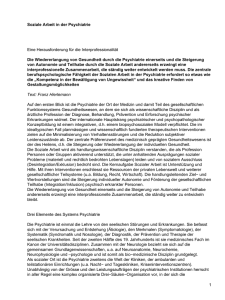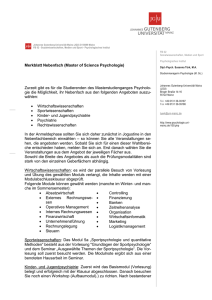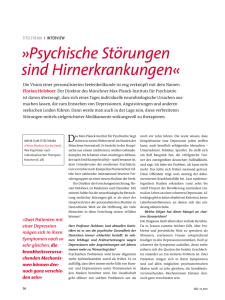Selbsterleben und Subjektivität. Eine Herausforderung der
Werbung

Selbsterleben und Subjektivität. Eine Herausforderung der Psychiatrie Antritts- und Habilitationsvorlesung 03.12.2015 Daniel Sollberger Sehr geehrte Frau Prof. Lang, liebe Undine verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, liebe Familie 1. Einleitung Keine Frage: Die Medizin als angewandte Wissenschaft ist darauf bedacht, ihre Erkenntnisse möglichst objektiv, d.h. reproduzierbar und damit auch voraussagbar zu erlangen. Darauf baut letztlich die Heilkunst, dass wir bei korrekter Diagnose einer Krankheit oder eines pathologischen Phänomens wissen, welche Therapie, welches Medikament, welche Prozedur den besten Heilungserfolg versprechen. Dies gilt auch für die Psychiatrie als medizinische Disziplin. So ist unbestritten, dass mit der Einführung und Etablierung kriteriengeleiteter und manualisierter Diagnosesysteme in der Psychiatrie seit den 1980er Jahren die Diagnosen – zumindest – in der Schulmedizin an Präzision und Reliabilität gewonnen haben. Das heisst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung einer Schizophrenie, die hier in Basel diagnostiziert wurde, beim selben Patienten auch in Japan, Indien, Südafrika oder den USA diagnostiziert würde, grösser geworden ist seit Einführung der psychiatrischen Diagnosesysteme. Gleichzeitig fällt aber auf, dass mit dieser normierenden, auf Objektivität der Befunde ausgerichteten Entwicklung die Psychopathologie ihre inhaltliche Differenzierung eingebüsst hat. So dass man sich fragen kann, wie viel psychopathologische Befunde denn tatsächlich zum Verständnis der durch sie beschriebenen Phänomene beitragen, wie valide die Befunde also eigentlich sind. 1 Das griechische Wort Psychiatrie, zusammengesetzt aus „psyche“ und „iatros“, zu Deutsch Seelenheilkunde, hat es nun aber offensichtlich mit ganz speziellen Phänomenen zu tun, die sich einer Objektivierung, wie sie den genannten Klassifikationsinstrumenten zugrunde liegen, zu widersetzen scheinen. Das wird rasch deutlich, wenn wir an für psychische Erkrankungen so zentrale Phänomene denken wie „seelisches Leiden“ oder „geistige Verwirrung“, „Ich-Störung“, „Identitätsdiffusion“, „Depersonalisation“ oder „Störungen des Selbst“. Sie sehen schon, diese Begriffe, die jeweils eine Störung oder Pathologie bezeichnen, beziehen sich auf höchst komplexe Phänomene und Grössen, bei denen es uns ähnlich geht, wie Augustinus es von der Zeit sagt: „Wenn man mich danach fragt, weiss ich es, wenn ich es aber einem, der mich fragt, erklären sollte, weiss ich es nicht.“ Was ist das die Seele, das Ich, die Identität, die Person, das Selbst? Diese Grundbegriffe haben ihre philosophischen Wurzeln. Der Versuch, ihre Bedeutung am objektiv beobachtbaren Faktum bzw. nach konventionell vereinbarten Prozeduren zu definieren, wie es die modernen Klassifikationsinstrumente tun, entstammt denn auch einer ganz bestimmten philosophischen Tradition: jener des logischen Positivismus. Wir tun gut daran, uns dessen in unserem Fach bewusst zu bleiben und diese Wurzeln nicht zu vergessen. Denn, so gross die Fortschritte einer auf dem logischen Positivismus basierenden Psychiatrie sind, so sehr unterliegen sie den Begrenzungen, die aus philosophiekritischer Perspektive längst vorgebracht wurden. Man kann leicht erkennen, dass alle die in meiner kleinen Auswahl genannten zentralen Begriffe der Psychiatrie, Selbst, Person, Identität, Ich, Geist und auch heute noch Seele einen qualitativen Aspekt an sich tragen, der sich der genannten Objektivierung und Beobachtbarkeit entzieht: Es ist der Aspekt des Erlebens, des subjektiven Selbsterlebens. Ich möchte Ihnen in meiner Vorlesung vor Augen führen, dass dieses Selbsterleben und die Subjektivität in der Psychiatrie einen besonderen Stellenwert haben und im Doppelsinn eine Herausforderung darstellen. Es ist einerseits eine Herausforderung, der sich die Psychiatrie in ihrer klinischen Anwendung und in der Lehre und Forschung stellen muss. Es ist andererseits aber zugleich eine Herausforderung der Psychiatrie, die sie an andere Disziplinen richtet, insbesondere an die modernen 2 Neurowissenschaften. Es ist damit die Forderung verbunden, diese Phänomene nicht vorschnell als Scheinphänomene und als eigentlich auf biologische Prozesse rückführbare „Dinge“ zu eliminieren, sondern sie vielmehr als Herausforderung an die Wissenschaften zu verstehen. Ich meine, dass sich damit letztlich die Frage der Identität unseres Fachs, die Frage des Selbstverständnisses der Psychiatrie zwischen Neurowissenschaften und Seelenheilkunde stellt. 2. Zur Paradoxie des sich selbst erkennenden Gehirns Mein guter Kollege und einer der Mentoren in meinem Habilitationsverfahren, Prof. Stefan Borgwardt, hat anlässlich seiner Antrittsvorlesung vor Jahren ein Zitat gebraucht, welches mich damals weiterbeschäftigt hatte, weil es in wunderbar kurzer Form die Komplexität des Problems, auf welches ich zusteuern will, zum Ausdruck bringt. Es stammt von Emerson E. Pugh aus seinem Buch: „The Biological Origin of Human Values“ (1978) und lautet: „If the human brain were so simple, that we could understand it, we would be so simple that we couldn’t.” Wenn unser Gehirn tatsächlich so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, wären in der Tat wir selbst es, die so einfach wären, dass wir es gerade wiederum nicht verstehen könnten. Die Komplexität des Gehirns führt wie bei keinem andern Organ in eine Paradoxie. Wie ist sie zu verstehen? Komplex nennen wir etwa die molekulare Steuerung einer Genexpression und sagen, dass sie in ihrer Prozessierung derart komplex aufgebaut sei, dass wir ihren Mechanismus noch nicht ganz verstehen. Es wäre in diesem Sinn eine Frage der Zeit und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, bis das Gehirn in all seinen Strukturen und Prozessen aufgeklärt ist. Darin ist keine Paradoxie zu erkennen. Die Paradoxie im Satz von Pugh hat vielmehr damit zu tun, dass der Satz selbst eine reflexive, selbstbezügliche Struktur aufweist. Sie führt zu einer Art Zirkelschluss eines sich selbst erkennenden Gehirns: Es wird genau das vorausgesetzt, nämlich 3 eine komplexe Struktur, mit der der Nachweis eben dieser Komplexität geführt werden soll. Man kann sich natürlich fragen, ob es nicht eine unzulässige Redeweise ist zu sagen, dass das Gehirn sich selbst erkennt. Personen erkennen, nicht Gehirne. So unterscheiden wir auch zwischen Gehirn (brain) und Geist (mind) und fragen dann allenfalls weiter, ob beides dasselbe ist und wir bloss einen sprachlichen Unterschied machen, aber eigentlich mit den beiden Begriffen zwei Perspektiven auf dasselbe eingenommen wird. Oder ob es sich bei Gehirn und Geist um zwei wirklich verschiedene Dinge handelt. Die Antworten auf diese Frage sind vielfältig und u.a. Gegenstand philosophischer Leib-Seele-Debatten. Die Selbstbezüglichkeit, die im Satz von Pugh angesprochen ist, betrifft letztlich die Selbstbezüglichkeit des menschlichen Bewusstseins, mit der ich mich in meinen philosophischen Arbeiten zu Kant, Schelling und moderner Sprachphilosophie vor Jahren herumgeschlagen hatte. In der Psychiatrie nun haben wir es in besonderer Weise mit dieser Selbstbezüglichkeit zu tun. Offensichtlich weiss ich, dass ich nicht nur etwas wissen kann, sondern zugleich auch wissen kann, dass ich dieses etwas weiss. Also: Ich beziehe mich auf mich, wenn ich sage „Ich höre, dass ich jetzt zu Ihnen spreche“ oder „Ich denke, dass ich denke“. Wie aber weiss ich, dass ich, welcher ich höre, dass ich spreche, derselbe bin, wie jener, der spricht? Die Frage scheint unsinnig, da wir uns dessen doch unmittelbar bewusst sind. In der Psychiatrie haben wir es aber mit Phänomenen des menschlichen Bewusstseins zu tun, die genau diese Selbstverständlichkeit einer Identität zwischen dem wahrnehmenden Subjekt und dem wahrgenommenen Subjekt, also dem Ich als Subjekt und dem Ich als Objekt verloren gehen lassen, bspw. im Fall von Depersonalisationserleben. Wenn mir ein psychotischer Patient mit einer schizophrenen Ichstörung berichtet, dass er Gedanken habe, die von aussen gesteuert seien, dann ist zwar klar, dass er es ist, der diese Gedanken hat, das heisst Subjekt dieser Selbstzuschreibung ist (owner). Zugleich aber ist auch klar, dass diese Gedanken, die er als zu ihm selbst gehörig sich zuschreibt, als nicht selbst produziert und insofern von ihm auch nicht als zu ihm selbst gehörig erlebt wird (agency). Ich komme darauf zurück. 4 Es stellt sich also – nochmals – die Frage, ob das Subjekt als Geist sich als Objekt in der materiellen Form seines Gehirns erkennt und daraus korrekt der Schluss gezogen werden kann, dass auch das erkennende Subjekt nichts anderes als ein neurobiologisch funktionierendes Gehirn ist? Wie also ist das Verhältnis von Subjekt des Bewusstseins und bewusstem Objekt, von Geist und Gehirn zu bestimmen? Eine ontologische Frage. Und wie steht es um die Möglichkeiten der Erkenntnis dieses Verhältnisses? Eine epistemologische Frage. Ich möchte nach diesem „amuse bouche“ das Rätsel „Bewusstsein“, welches immer auch Selbstbewusstsein ist, etwas vertiefen und Ihnen damit die Begriffe des Selbsterlebens und der Subjektivität näher bringen, um in der Folge die herausfordernde Bedeutung der Erlebensperspektive für die psychiatrische Diagnostik und Therapie zu skizzieren. 3. Das Rätsel „Bewusstsein“ Der intuitive und pragmatische Dualismus von Geist und Gehirn prägt im Einklang mit einem breiten Alltagsverständnis auch die Psychiatrie. Psychische Zustände versuchen wir sowohl psychologisch wie psychopharmakologisch zu verändern. Allerdings wissen wir nicht wirklich, ob bspw. die Einflussnahme auf das serotonerge Transmittersystem eines Patienten mittels Antidepressiva der Klasse der SSRI mit der Hemmung der Wiederaufnahme des ausgeschütteten Serotonins in die präsynaptische Zelle letztlich denselben biologischen Mechanismus nutzt wie die Einflussnahme auf denselben Patienten mittels psychotherapeutischem Gespräch. Wir sehen, dass Antidepressiva psychologische Wirkungen wie eine Stimmungsaufhellung oder Antriebssteigerung erzeugen; und seit noch nicht so langer Zeit ist auch nachgewiesen, dass psychotherapeutische Interventionen hirnfunktionelle und hirnstrukturelle Veränderungen bewirken 1. Offensichtlich führen verschiedene Wege nach Rom. 1 Vgl. Goldapple K, Segal Z, Garson C. et al. Modulation of cortical-limbic pathways in major depression. Treatment-specific effects of cognitive behavioral therapy. Arch Gen Psychiatry 2004; 61: 34-41. Fuchs T. Neurobiology and psychotherapy: an emerging dialogue. Current Opinions in Psychiatry 2004; 17: 479-485. Buchheim A, Viviani R, Kessler H, Kächele H, Cierpka M, Roth G, 5 Aber: Bezieht sich denn das psychopathologische Phänomen der Hoffnungslosigkeit auf dasselbe Faktum wie der Nachweis einer vergleichsweise geringen Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt von Hirnnervenzellen? Meinen wir mit dem Gefühl des Zorns letztlich die Ausschüttung von Katecholaminen, oder beziehen wir uns mit dem Begriff Traum auf relevante elektrophysiologische Gehirnströme? Wenn dem so wäre, bräuchten wir aber doch nicht mehr zwei Beschreibungen für dasselbe Faktum – eine philosophische Position, die als eliminativer Materialismus bekannt geworden ist. Bis heute haben wir an beiden Beschreibungsarten festgehalten, der psychologischen wie auch der physiologischen. Das führt nun allerdings in eine logische Schwierigkeit. Denn aufgrund des Gesagten würden wir alle folgenden drei Thesen für korrekt beurteilen. Sie sind aber untereinander unvereinbar2: (1) Differenzthese: Geistige Phänomene sind nicht-körperliche Phänomene. (2) Wechselwirkungsthese: Geistige Phänomene haben kausale Wirkung im körperlichen Bereich. (3) Geschlossenheitsthese: Der Bereich körperlicher Phänomene ist kausal geschlossen, d.h. nur Körperliches kann Ursache körperlicher Phänomene sein. Bei der ersten These (1) gibt es drei Varianten. Wir können erstens sagen, dass die Phänomene tatsächlich verschieden sind, zweitens, dass wir sie als unterschiedlich erkennen (obwohl sie nicht verschieden sind) oder drittens, wir haben zwei sprachliche Beschreibungssysteme, um identische Phänomene verschieden zu beschreiben. Die zweite Wechselwirkungsthese (2) nun behauptet eine Interaktion zwischen Körper und Geist, muss also schon eine Version der ersten Differenzthese (1) voraussetzen. Sonst würde sie mit der dritten Geschlossenheitsthese (3) zusammenfallen, „der zufolge jegliche Veränderungen im Bereich des Physischen George C, Kernberg O, Bruns G, Taubner S (2012) Changes in prefrontal-limbic function in major depression after 15 months of long-term psychotherapy. PLoS ONE 7(3): e33745. doi: 10.1371/journal.pone.0033745 6 ausnahmslos auf der Basis der von den gegenwärtig herrschenden Naturwissenschaften unterstellten Gesetzmässigkeiten ablaufen“ (Sturma 2006, 9). Ich denke, dass die meisten von uns einem minimalen Materialismus anhängen und zustimmen würden, dass es keine Unterschiede im psychologischen Erleben gibt ohne Unterschied im physiologischen Geschehen. Angenommen wir würden alle einzelnen hirnphysiologischen Zusammenhänge detailliert kennen, dass wir sagen könnten, dass ein bestimmtes psychisches Phänomen auftritt, weil ein bestimmter physiologischer Prozess abläuft. Warum sollte es dann nicht möglich sein zu sagen, dass wir unser Bewusstsein aus seinen materiellen Bedingungen erklärt haben? Wäre damit das Rätsel „Bewusstsein“ nicht tatsächlich gelöst? Die Herausforderung der Psychiatrie entsteht dort, wo es gilt, Bewusstseinsphänomene wie das Selbsterleben und die Subjektivität ernst zu nehmen. Was meint denn Bewusstsein im Sinn von Selbsterleben? Das Wort „Bewusstsein“ ist vieldeutig. Wir meinen damit z.B., dass jemand wach ist; oder dass jemand in der Lage ist, auf einen äusseren Reiz kraft eines inneren Antriebs und einer inneren Steuerung sich koordiniert und einer Situation angemessen zu verhalten. Bewusstsein kann sich weiter auf eine Reihe kognitiver Kompetenzen beziehen. Es kann überdies heissen, dass wir ein reflexives Wissen um unsere mentalen Zustände haben – dessen neurobiologische Erforschung sicherlich komplexer ist als jene einer blossen Wahrnehmung. Aber ein grundsätzliches Problem ist hier noch nicht in Sicht. Erst Bewusstsein im Sinn von Erleben wird rätselhaft. Mit Erleben meinen wir verschiedenes: Sinnesempfindungen, Körperempfindungen, Emotionen, Stimmungen, Wünsche, Bedürfnisse, Wollen. Diese Zustände sind nicht nur vorhanden, sondern „es fühlt sich auf bestimmte Weise an, in ihnen zu sein“ – „what it is like to be …“, wie der amerikanische Philosoph Thomas Nagel die Formulierung gewählt hat. Die „what-it-is-likeness“ oder das „Zumutesein“ ist ein elementar-affektives Selbsterleben, mit dem eine grundlegende, unmittelbare Basis von Subjektivität 2 Vgl. Bieri P (Hg.). Analytische Philosophie des Geistes, 1981, 5. 7 angesprochen ist. Gemeint ist: Bewusstsein im Sinn von Erleben gibt uns den Grund, „dass wir uns als Subjekte unseres Tuns erfahren“ (Bieri 2006, 39). Was ist denn nun das Besondere an einem solchen phänomenalen subjektiven Bewusstsein? Ich will es am Phänomen der Angst kurz zu verdeutlichen suchen. Anders als im Verhältnis von Wasser und H2O, wonach zwei verschiedene Begriffe sich auf dasselbe beziehen, gilt dies bei der Beziehung zwischen Angstempfindung und einem bestimmten Amygdala-Reaktivitätsmuster nicht. Wasser, Sich-wässrigAnfühlen und H2O stehen in anderem Verhältnis zueinander als Angst und Amygdala-Hyperreaktivität. Während ein Zustand, der sich angstvoll anfühlt, unzweifelhaft auch Angst ist, 3 kann sich etwas durchaus wässrig anfühlen, ohne Wasser zu sein. Angst und angstvoll sich anfühlen sind identisch, nicht aber Angst und Amygdala-Hyperreaktivität. Es wäre widerspruchsfrei denkbar, dass ein bei Angstzuständen typisches Amygdala-Reaktivitätsmuster vorliegt, ohne dass ich Angst empfinde. So scheint es mir auch problematisch, bereits von einer Depression zu sprechen, wenn ein bestimmtes hormonelles Dysfunktionsmuster in der Hypothalamus-Nebennierenrinden-Achse und im Cortisol-Stoffwechsel zu finden ist, der Betroffene aber nicht (oder noch nicht) subjektiv eine depressive Erlebensweise hat. Das reduktionistische Argument, seelische Zustände seien recht eigentlich auf materielle Zustände rückführbar, muss sich an genau solchen Fällen phänomenaler subjektiver Erlebenszustände abarbeiten. Das ist die Herausforderung. 4. Selbstbewusstsein, Selbstwissen und das minimale Selbst Lassen Sie mich das noch etwas vertiefen. Der Begriff der Subjektivität lässt sich in zwei Aspekte differenzieren 4, in 1. Selbstbewusstsein und 2. Selbstwissen. Selbstbewusst heissen mentale Zustände wie Gefühle oder Wahrnehmungen, in denen uns irgendwie zumute ist. Solches 3 Dies hängt mit der Eigenschaft phänomenaler Zustände zusammen, die in der phänomenologischen Philosophie als Zusammenfallen von Sein und Sicherscheinen im Bewusstsein bezeichnet wird (J.-P. Sartre, Conscience de soi et connaissance de soi, zit. nach M. Frank (Hg.), Selbstbewusstseinstheorien von Fichte bis Sartre, 1991, 367-411, 379ff.). 4 Frank M. Lässt sich Subjektivität naturalisieren?, In: Fuchs T et al. (Hg.). Subjektivität und Gehirn, 2007, 29-48, 33ff. 8 Zumutesein ist eine Erst-Person-Perspektive und lässt sich nicht aus einer DrittPerson-Perspektive beschreiben. Ich komme darauf zurück. Selbstwissen dagegen ist zwar ebenso wenig auf eine Dritt-Person-Perspektive zurückzuführen, dennoch aber von Selbstbewusstsein zu unterscheiden. Ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Von Ernst Mach, Wiener Physiker, wird erzählt, er habe einmal beim Einsteigen in den Bus in etwas erschöpftem Zustand einen Mann auf der andern Seite des Busses einsteigen sehen und dabei gesagt: «Was steigt doch da für ein heruntergekommener Schulmeister ein.» 5 Weil er den Spiegel übersehen hat, weiss er nicht, dass er selbst es ist, den er von aussen als heruntergekommenen Fremden beschreibt, damit aber unwissend Bezug auf sich nimmt. So nimmt Mach zwar bei vollem Selbstbewusstsein auf sich Bezug, ohne sich aber zu erkennen. Er hatte in diesem Moment also ein Selbstbewusstsein, aber kein Selbstwissen. Selbstwissen impliziert nicht bloss, den richtigen Gegenstand des Wissens zu identifizieren – was Mach ja erfolgreich tut. Es bedarf vielmehr auch ein Wissen darüber, dass ich es selbst bin, auf den ich mich wissend beziehe. Selbstwissen ist also nicht bloss Wissen von sich selbst, sondern vielmehr komplexer ein selbstbewusster Selbstbezug, wonach eine Person sich auf sich als auf sich selbst bezieht. In umgekehrter Weise kann man diesen Zusammenhang auch in dem Fall sehen, wo fälschlich eine Art Selbstwissen provoziert wird. 6 Botvinik und Cohen, zwei amerikanische Neurowissenschaftler, habe erstmals 1998 ihre experimentelle Entdeckung publiziert. (Sie haben gezeigt, dass bei gleichzeitiger Reizung der eigenen, für die Augen verdeckten Hand und einer in derselben Position auf dem Tisch liegenden und für die Probanden sichtbaren Gummihand die Illusion entsteht, dass die Gummihand ein Teil des Körpers ist, d.h. eine Form der Selbstzuschreibung dieser Hand erfolgt, von der die Probanden sich aber bewusst sind, dass es eine Gummihand ist.) 5 Frank M. Ungegenständliche Subjektivität. In: ders. Auswege aus dem Deutschen Idealismus, 2007, 415-441, 425f. 6 Botvinick M, Cohen J. Rubber hands ‚feel‘ touch that eyes see. Nature 1998; 391, 756. 9 So erfolgt in diesem Experiment eine Zuschreibung der fremden Hand, d.h. eine körperliche Selbstzuschreibung oder –identifikation (ein Gefühl der Meinigkeit) bei gleichzeitigem kognitiven Wissen, das der Körperteil fremd ist. Täuschung ist im Fall von Selbstwissen also durchaus möglich, nicht aber im Fall von Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein im Sinn von Selbsterleben, so scheint es, basiert nicht auf einem Selbstwissen: Ohne die subjektive Erlebensperspektive, das Selbsterleben, das den Zustand ausmacht, in welchem uns irgendwie zumute ist und ein Gefühl der Meinigkeit entsteht – ohne diese Perspektive hätten wir keine Möglichkeit, uns bestimmte Bewusstseinszustände bewusst als die unseren zuzuschreiben. Wenn ich nicht ein Bewusstsein dafür hätte, wie es sich anfühlt, Angst zu haben, könnte ich weder als Proband in eine Bildgebungsstudie Eingang finden, noch mit meinem Therapeuten darüber sprechen, dass ich in bestimmten Situationen Angst habe. Ein Selbstwissen bedarf der Basis eines Selbsterlebens, nicht kann umgekehrt aus einer Reihe kognitiver Funktionen und dem daraus entstehenden repräsentationalen Selbstwissen ein Selbsterleben entstehen. Das Gefühl der Meinigkeit resultiert nicht daraus, dass ich mir eine Reihe von Bewusstseinszuständen selbst zuschreibe – wie sollte ich mir denn etwas zuschreiben können, wenn ich nicht schon ein Gefühl dafür hätte, was mit „mir“ gemeint ist. Keine noch so detaillierte Charakterisierung meines Selbst aus einer Drittperspektive, erfolgte sie nun auf neurobiologischer oder psychologischer Basis, führt je zum Erleben und zur Erst-Person-Perspektive. Sie erinnern sich an das Beispiel des Patienten mit der schizophrenen Ichstörung: Er hat das Gefühl, dass seine Gedanken von aussen gesteuert und eingegeben sind. Das heisst, er erlebt zwar seine Gedanken als nicht die seinen, aber dennoch ist er es, der dies so erlebt. Kognitionswissenschaftliche neurobiologische und Modelle bildgebende von Subjektivität Forschung sind und darauf fussende herausgefordert, solche Phänomene erklären zu können: Wie ist es etwa möglich, dass ich 1) eine Vorstellung haben kann, dass meine Gedanken nicht von mir gemacht, sondern fremdverursacht sind, 2) ich dennoch zugleich die Metarepräsentation habe, nämlich weiss, dass ich es bin, der das Gefühl hat, dass meine Gedanken fremdverursacht sind? 10 Selbst-Spezifität oder Subjektivität im Sinn des Selbsterlebens kommt in der unmittelbaren, intuitiven Erst-Person-Perspektive zum Ausdruck. Mit ihr ist ein „minimales“ oder „phänomenales Selbst“ gemeint – man könnte auch sagen: Es ist die Ich-spezifische Perspektive auf alle unsere Bewusstseinsinhalte oder der Ichgetönte Begleitgeschmack des Bewusstseins. Dieses „minimale Selbst“ sollte nicht verwechselt werden mit einem selbstbezüglichen Wissen. Das heisst, bildgebende Untersuchungen zu selbstreferentiellen Effekten (SRE) taugen nicht zur Aufklärung des „minimalen Selbst“. Selbstreferentielle Effekte meint zum Beispiel, dass Stimuli, die einen Bezug zu mir haben, rascher im Gedächtnis abrufbar sind, als Stimuli ohne Bezug zu mir. Also: Der Chirurg erinnert aus einer Vielzahl von Bildern rascher, dass da eines mit einem Skalpell war, als dass da vielleicht auch noch eines mit einer bestimmten Blume zu sehen war. Die Selbstbezüglichkeit, die hier zum Ausdruck kommt, klärt nicht den Aspekt der Selbst-Spezifität auf. Selbst-Spezifität oder Selbsterleben betrifft nicht ein irgendwie repräsentiertes Selbst, sondern zielt auf das repräsentierende Ich. 7 Subjektivität im Sinn des Selbsterlebens kann also nicht reflexiv entstehen, sondern ist präreflexiv immer schon da, wenn Bewusstsein möglich ist. Das Rätsel oder Paradox des Bewusstseins liegt darin, dass die Erklärung der Funktionsweise des Gehirns bzw. des Geistes anders als bei anderen Objekten des Erkennens nicht vollständig transparent gemacht werden kann durch eine Rückführung auf Grundstrukturen oder materielle Grundlagen und Funktionsweisen des Gehirns. Denn ohne das subjektive Erleben und das Phänomen des „Zumuteseins“ wüssten wir nicht, wonach wir in der Untersuchung von Hirnfunktionen suchen sollten. Wozu diese komplizierten Überlegungen? Ich will abschliessend kurz skizzieren, welche Konsequenzen das Festhalten an der Erst-Person-Perspektive für die psychiatrische Diagnostik und Therapie haben. Was bringt es, am Selbsterleben der Patienten und ihrer Subjektivität festzuhalten und damit einem vorschnell und zu ausschliesslich an einem positivistischen, an den objektivierenden Diagnosemanualen ausgerichteten Denken zu widerstehen? 7 Vgl. Legrand & Ruby 2009. 11 5. Der Einbezug der Erlebensperspektive in der Psychiatrie Wie eingangs betont, hat die Etablierung kriteriengeleiteter und manualisierter Diagnosesysteme in der Psychiatrie zu präziseren und verlässlicheren Diagnosen geführt. Der positivistische Dritt-Person-Zugang psychiatrischer Diagnostik mit Kriterien von Objektivität, subjektunabhängiger Reliabilität und Quantifizierung basiert letztlich darauf, dass eine psychiatrische Störung dann zu diagnostizieren ist, wenn ein bestimmter Katalog von einzelnen Symptomen und Verhaltensweisen, die gemäss einem vorgegebenen psychopathologischen Assessment zu prüfen sind, erfüllt ist. Mit dem Ziel, nicht die Subjektivität des Patienten in seiner kohärenten Ganzheit zu verstehen, sondern abnorme menschliche Verhaltensweisen möglichst genau und interreliabel zu erfassen, wurde damit auch eine Grundlage für Erklärungen geschaffen, die die beobachteten Phänomene letztlich auf ihre neurobiologischen Dysfunktionen hin untersuchen lassen. Wie Sie sehen, plädiere ich – nicht alternativ, aber unbedingt – für den Miteinbezug der Erst-Person-Perspektive. Sie führt zunächst zu einer differenzierteren Psychopathologie. So ist die Aussage eines Patienten, er sei bedrückt, deprimiert oder depressiv, in dieser Perspektive sehr viel ausführlicher zu verstehen und zu beschreiben. Meint depressiv, dass das Gefühl auf etwas gerichtet ist, d.h. der Patient wegen etwas bedrückt ist? Oder meint depressiv sehr viel mehr ein Gefühl der Leere, Langweile, Dumpfheit oder Missmutigkeit? Ist ein Gefühl der Gefühllosigkeit gemeint oder ein Gefühl des Selbstverlusts? Je nach Ausgestaltung der Psychopathologie führte die Diagnostik in Richtung einer reaktiven Depression, in Richtung eines Leeregefühls bei einer Borderline Persönlichkeitsstörung, einer major depression oder auch einer Leere im Sinn eines Selbstverlusts bei einer schizophrenen Störung. Das heisst, die deprimierte oder depressive Stimmung ist von äusserst verschiedener Qualität im Fall der neurotischen und der melancholischen Depression, der Borderline Störung und der Schizophrenie. Es ist klar, dass der systematische Einbezug der subjektiven Perspektive des Patienten auf ein Verstehen zielt, das nicht allein evidenzbasiert ist, sondern in der 12 Interaktion stattfindet und ebenso auf Empathie beruht. Es bedarf in der Medizin immer auch des Erfahrungswissens, welches seine Generalisierbarkeit einer qualitativen Typisierung verdankt und nicht ausschliesslich auf der Basis eines quantifizierbaren, methodisch-naturwissenschaftlichen Wissens eine Evidenzbasierung anstrebt. Evidence based practice braucht ebenso eine practice based evidence. Der Einbezug der Erst-Person-Perspektive führt zum zweiten dazu, dass dem Symptom selbst ein Eigenwert zugeschrieben wird. Das Symptom ist nicht nur einfach Ausdruck einer klassifizierten Störung, nicht bloss Zeichen von Krankhaftigkeit oder Index einer Krankheit. Wie dies in psychodynamischen Diagnostiken der Fall ist, wird es vielmehr bspw. als „Lösung“ eines Problems oder innerseelischen Konflikts des Patienten verstanden, eines Problems oder Konflikts, das bzw. der bisher nicht anders gelöst werden konnte als in der Symptombildung. So kann das psychopathologische Symptom eine ganz eigene Bedeutung erlangen, dies natürlich auch in seiner beziehungsgestaltenden Funktion. So kann bspw. das Klagen des Depressiven durchaus auch zum Anklagen werden. Und damit führt diese Verstehensweise schliesslich drittens dazu, dass auch eine Zweit-Person- oder Intersubjektivitätsperspektive wirksam wird, auf welche Joachim Küchenhoff und auch Thomas Fuchs, welchem letzteren ich nicht nur als dem Erstgutachter meiner Habilitationsschrift viel verdanke, in ihren Arbeiten aufmerksam machen. Diese Zweit-Person-Perspektive bemüht sich um die Kontextualisierung im Verständnis einer Symptomatik, indem sie diese vor dem Hintergrund einer interpersonalen Beziehungsgestaltung liest und ihre Bedeutung in Zusammenhängen einer narrativen Co-Konstruktion von Patient und Therapeut, d.h. in einem interpretativen Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen erschliesst. Mit dieser „Aufwertung“ des Symptoms wird auch das Leiden des psychisch Erkrankten nicht einfach auf ein passiv erlittenes Defizit reduziert, sondern letztlich der kranke Mensch selbst in einer Eigenaktivität gesehen, in einem, wenn vielleicht auch unbewussten intentionalen und kommunikativen Bezug zu seinem Gegenüber. Dieser Ansatz liegt letztlich der diagnostischen und therapeutischen Grundhaltung zugrunde, die mir selbst in der eigenen klinischen Arbeit am wesentlichsten ist und 13 die ich nicht nur durch die unzähligen Arbeiten von Otto F. Kernberg, dem wohl bekanntesten noch lebenden Psychoanalytiker und Theoretiker des 20. Jahrhunderts, studieren konnte, sondern auch das Glück und die Gelegenheit hatte, sie während meines Forschungsaufenthalts bei Kernberg und seiner Gruppe in New York im 2012 zu vertiefen und letztlich auch in den eigenen Forschungsarbeiten zu verfolgen. Gerade aus der subjektiven Erst-Person-Perspektive und jener der Zweit-PersonPerspektive im interaktionellen und kommunikativen Kontext wird unmittelbar einsichtig, dass eine kausale Einbahnstrasse von Gehirn zu Geist in jedem Fall zu kurz greift, wenn es zu klären ist, warum ein Patient in der Therapie bspw. plötzlich wütend wird. Eine solche Klärung wird nicht mehr unabhängig vom Bedeutungskontext der therapeutischen Beziehung und damit letztlich von biographischen Erfahrungen und gegenwärtiger Lebenssituation erklärbar sein. So wird die Wutentwicklung, die auf dem Boden einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur typischerweise nach Kränkungserlebnissen entsteht, dann doch anders zu verstehen, zu diagnostizieren und zu behandeln sein, als jene einer Patientin mit einer Borderline-Organisation ihrer Persönlichkeit, die mit Wut reagiert aufgrund ihrer ausgeprägten Ängsten vor Verlassenwerden. Und das heisst nicht, dass die plötzliche Wut eines Patienten nicht auch als Symptom einer Enthemmung im Rahmen einer organischen Veränderung im Bereich des Frontalhirns erklärt werden könnte, wenn denn eine solche vorliegt. Während also ein objektivierender Dritt-Person-Zugang in der Psychiatrie sicherlich angezeigt ist, selbstverständlich nicht auch nur im in der epidemiologischen klinischen Alltag, ist er Forschung, gerade im sondern Fall der letztgeschilderten Zusammenhänge für das Verständnis der Veränderungen im subjektiven Selbsterleben von Patienten und der damit zusammenhängenden intersubjektiven Interaktionen und Übertragungen diagnostisch nicht hinreichend und insbesondere therapeutisch unzureichend. Hierzu bedarf es der Erst- und ZweitPerson-Perspektiven. Die klinische Beachtung, Aufwertung und in Ausbildung und Forschung Förderung der Subjektivitäts- und Intersubjektivitätsperspektive neben der objektivierenden 14 Dritt-Person-Perspektive hat in der Psychiatrie – und letztlich generell in der ärztlichen und psychologischen Praxis – eine weitreichende Konsequenz: Das Verhältnis von klinischer Theorie und diagnostischer sowie therapeutischer Praxis geht nicht auf in der Begriffsdichotomie von Allgemeinem und Besonderem. Der Einzelfall wird nie bloss als Anwendungsfall einer klassifizierten Störung oder einer neurobiologischen Gesetzmässigkeit betrachtet. Vielmehr stellt er sich in seiner Individualität dar. Der individuelle Patient, die Psyche jedes Einzelnen bildet letztlich das Korrektiv, welches auf die Theorie, die Modelle und etablierten Gesetzmässigkeiten rückwirkt. Die Philosophie hat gerade bei solchen, unser eigenes Selbstverständnis und Selbstverhältnis tangierenden Fragen psychiatrischer Forschung und Praxis sowohl eine Reflexions- und Orientierungsfunktion, wie sie letztlich auch eine Grundlegungsaufgabe für die moderne Psychiatrie mit übernimmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 15