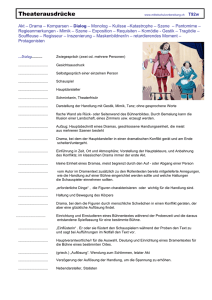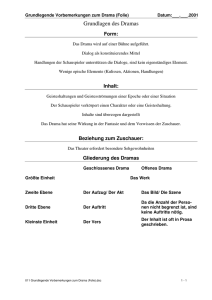Einführung in die Dramen-Analyse
Werbung

5. Das Drama als plurimediale Darstellungsform antiken Tragödie oder mittels Figuren, die wie im Prolog außerhalb der Handlung angesiedelt sind. Insoweit im Drama das vermittelnde Kommunikationssystem S2 – E2 fehlt, spricht man von seiner Absolutheit: „Das Drama ist absolut. Um reiner Bezug, das heißt: dramatisch sein zu können, muß es von allem ihm Äußerlichen abgelöst sein. Es kennt nichts außer sich. Der Dramatiker ist im Drama abwesend. Er spricht nicht, er hat Aussprache gestiftet […]; keineswegs dürfen sie [die Worte] als vom Autor herrührend aufgenommen werden. […] Sowenig die dramatische Replik Aussage des Autors ist, sowenig ist sie Anrede an den Zuschauer“ (Szondi 1963, 15; kritisch dazu Korthals 2003, 104 ff.). Im absoluten Drama, das vom Drama des französischen Klassizismus als Norm ausgeht, erscheint das Spiel so, als laufe es ohne Bezug auf den Zuschauer ab. Dieser Eindruck schlägt sich in der Rede von der ,vierten Wand‘ nieder. Spätestens in der Moderne wird diese Absolutheit durch variantenreiche Formen der Episierung irritiert oder gar aufgehoben. Absolutheit 5. Das Drama als plurimediale Darstellungsform – Verhältnis von Text und Inszenierung Auf der Bühne steuert das Drama als „szenisch realisierter Text“ (Pfister 1988, 24) alle fünf Sinne des Menschen an, vornehmlich das Hören und Sehen: So hört der Zuschauer eine Figur sprechen, wobei der Stil, die Stimmqualität, die Art und Weise der Artikulation (Gesang, Flüstern) und die Situation diese Rede nuancieren. Daneben vernimmt er weitere akustische Zeichen: Texte aus Bühnenlautsprechern, Geräusche oder Musik, die während der Aufführung zur Untermalung oder als Bestandteil der Handlung erklingen. Zudem kann der Zuschauer mit Schrifttafeln oder Spruchbändern im Bühnenraum konfrontiert werden, dies neben anderen visuellen Zeichen, zu denen die Physiognomie, die Maske und das Kostüm einer Figur gehören, aber auch die Bühne selbst (Bühnenbild samt Beleuchtung, Requisiten, Projektionen und alle anderen sichtbaren Elemente). Der polnische Theatersemiotiker Tadeusz Kowzan hat in diesem Zusammenhang den Theatercode als ein System von 13 Zeichenkomplexen beschrieben: word, tone, mime, gesture, movement, make-up, hair-style, costume, properties, settings, lightning, music, sound effects (Krieger 2004, 80; Esslin 1989, 53–56, 106 f.). Als ,szenisch realisierter Text‘ nutzt das Drama folglich nicht allein sprachliche Codes wie reine Lesetexte (z. B. Romane), denn es setzt vielmehr auch außersprachliche Zeichen ein. Unter dem Code versteht man ein System von Regeln, das die Deutung von Zeichen erlaubt: eine Art Dechiffrierschlüssel zur Einsicht in die Bedeutung einer Zeichenverwendung. Der Zeichenvorrat eines Senders überschneidet sich mit dem Zeichenvorrat eines Empfängers, so dass über diesen gemeinsamen Code Inhalte ausgetauscht werden können. Zeichentheoretisch formuliert ist der Code also diejenige Größe, die eine Verbindung zwischen dem Zeichen und seiner Bedeutung herstellt. Diese Verbindung entsteht, indem einem Zeichen durch einen Zeichenbenutzer Bedeutung zugeschrieben wird. Der Code ist daher kaum als feste Größe zu bestimmen, weil er auf einer kulturellen Übereinkunft basiert und damit historisch wandelbar ist. (Am Beispiel der Mode leuchtet dieser Fünf Sinne Codes – Kanäle 17 18 I. Gattungsbegriff Institution Theater Sachverhalt unmittelbar ein.) Wie die Aufführung selbst stellt der Einsatz aller außersprachlichen Codes in der theatralischen Umsetzung eine Interpretation der Textvorlage dar. Die fünf Sinne des Menschen (Sehen, Riechen, Fühlen, Schmecken, Hören) dienen als Kanäle der Informationsübertragung (Übersicht Pfister 1988, 27). Ein ,szenisch realisierter Text‘ s(t)imuliert für die Zeit der Aufführung damit die menschliche Sinneswahrnehmung. In erster Linie ist hier zwischen verbalen und nicht-verbalen Codierungen auf der Ebene des Sendersystems Figur/Bühne zu unterscheiden, so dass zusätzliche Informationen über die sprachlichen Mitteilungen hinaus durch die Statur, die Physiognomie oder die Maske einer Figur geliefert werden. Durch ihre Gestik und Mimik, ihre Position und Interaktion in einer bestimmten Situation an einem konkreten Ort, d. h. auch durch die Choreographie ihrer Bewegungen, erfährt der Zuschauer etwas über die handelnde Person auf der Ebene der optischen Codierung. Dieser Einsatz verschiedener Zeichensysteme markiert den einen Aspekt, das Drama als plurimediale Darstellungsform zu charakterisieren. Der zweite Aspekt bezieht sich auf Institutionen, Funktionen und Gruppen, die an einer Theateraufführung beteiligt sind, wobei deren Interessen wiederum institutionell, ästhetisch und sozial bedingt sind. Orientiert man sich an den Rubriken in der Textanthologie zur Theorie des Theaters (Lazarowicz/Balme 1991), sind folgende Gesichtspunkte relevant: die Schauspielkunst (Ausbildung, Beruf u. a.), die Regie und ihr Apparat (Dramaturgie, Maske usw.), das Theaterstück selbst, der Bühnenraum und das Bühnenbild (samt dazugehöriger Technik), schließlich die Formen der intratheatralen Kommunikation (Verhältnis zum Zuschauer) und die Frage nach dem Theater als einer moralisch-pädagogischen Anstalt, die sich auf das Volkstheater oder das politische Theater beziehen kann. Nicht zuletzt gehört die Performanz des Theaters und dabei die Frage nach dem Paratheater zu diesem Komplex: Gemeint sind damit die zusätzlichen bzw. angrenzenden Aspekte, etwa die Funktion des Theaters als Psychotherapie oder als Happening. Die Plurimedialität des Dramas – als Differenzkriterium und als Informationsüberschuss gegenüber Epik und Lyrik – betrifft daher insgesamt folgende Aspekte: Zunächst ist der dramatische Text selbst bereits mehrschichtig, insofern er auf die Aufführung hin konzipiert ist, aber auch, insofern bereits in seiner mündlichen Aktualisierung eine Reihe nichtsprachlicher Variablen wirksam werden. Darüber hinaus erscheint seine Struktur durch den Einsatz anderer Zeichensysteme synästhetisch, weil im inszenierten Text, der immer eine konkretisierende Interpretation der Textvorlage darstellt, verschiedene Codes gleichzeitig wirken. II. Forschungsbericht Forschungen zum Drama gibt es seit dem 4. Jahrhundert v. Chr., v. a. in Form von textkritisch kommentierenden Auseinandersetzungen: Abschriften, fortlaufende philologische Bearbeitungen und Neueditionen dramatischer Texte garantieren die Überlieferung der griechischen und lateinischen Komödien und Tragödien (Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes – Plautus, Terenz, Seneca). Erst aber in der italienischen Renaissance werden diese Dramatiker wiederentdeckt. Im Prozess dieser Bearbeitungsgeschichte richtet man die Dramen in der heute gewohnten typographischen Gestaltung mit Sprecherbezeichnungen und Hinweisen zur Darstellung auf der Bühne ein. In griechischen und lateinischen Dramen sind Haupt- und Nebentext dagegen kaum voneinander geschieden. Nebentexte bestehen meist nur aus Personenzuordnungen, Bühnenanweisungen liegen nicht vor. Für die terminologische Sicherung der neueren Forschung spielt die Übersetzung und Kommentierung der Poetik von Aristoteles seit dem 16. Jahrhundert die maßgebende Rolle. Aristoteles begründet die zentralen Kategorien in der Auseinandersetzung mit der Gattung: Redekriterium, Unterscheidung Tragödie/Komödie, Nachahmung und Ganzheit der Handlung, Organisationsprinzipien (Geschlossenheit), Bauformen und Wirkung. In der römischen Antike ist Horaz die prominenteste Stimme. Dessen Ars Poetica würdigt das Drama aber nur mit wenigen Versen und erfasst es im Vergleich mit Aristoteles weitaus weniger kategorial. In der Renaissance gehören Scaliger und im deutschsprachigen Bereich Martin Opitz zu den bedeutenden Stationen der Auseinandersetzung. Die Rezeption der aristotelischen Poetik verbindet sich in diesem Prozess mit frühneuzeitlichen Überschreibungen und Akzentverschiebungen, bis der französische Klassizismus Normen festschreibt. Hier stabilisiert sich die Lehre von den drei Einheiten im Abgleich mit der Wahrscheinlichkeit (vraisemblance) und Schicklichkeit (bienséance) der Darstellung zu einem System formaler Regeln. Die deutschsprachige Diskussion knüpft durch Gottsched und Lessing daran an, bis die an Aristoteles (und seit der Genieästhetik zunehmend an Shakespeare) orientierte Auseinandersetzung um 1800 zu einem gewissen Abschluss vor dem Einsatz der disziplinär begründeten Forschung kommt. Wissenschaftliche Zugänge, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts in den philologischen Disziplinen etablieren, entwickeln ihre Methoden, indem sie an die systematische Unterscheidung der literarischen Gattungen um 1800 anknüpfen. Noch im frühen 20. Jahrhundert orientiert sich die Erforschung des Dramas an den normativen Poetiken bis Ende des 18. Jahrhunderts. Erst mit der semiotisch und ritualtheoretisch begründeten Theaterwissenschaft (vor dem Hintergrund der primär auf Theatralität abzielenden Dramatik in der Moderne) verschiebt sich die Aufmerksamkeit weg vom dramatischen Text hin auf Aspekte der szenischen Realisierung. In wachsendem Maße fließen bei dieser Würdigung außerliterarischer Aspekte europäische und außereuropäische Theatertraditionen ein. Poetiken von der Antike bis zum Ende der Goethezeit Literaturwissenschaftliche Forschung 20 II. Forschungsbericht Tendenzen seit den 1980er Jahren Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Drama orientiert sich zunächst – ganz aristotelisch gedacht – am Begriff der Handlung, zunehmend dann auch an der Frage nach der Rolle des Charakters im antagonistischen Widerstreit der Kräfte (Werling 1989; Krieger 2004, 74 f.). Dieser Auffassung zufolge entsteht die dramatische Form aus einer durch Konflikt und Spannung erzeugten szenischen Konstellation. Diese primär inhaltliche Bestimmung prägt die Positionen in Hegels und Vischers ,Ästhetiken‘ bis hin zu Freytags Technik des Dramas (1863), der die Fünfaktigkeit aus dem Konfliktmodell, den „Bau des Dramas“ aus „Spiel und Gegenspiel“ erklärt (Freytag 1992, 93 ff.). In dieser berühmtesten der zahllosen wissenschaftlichen Dramentheorien aus dem 19. Jahrhundert werden elementare Regeln des Dramenaufbaus aus der empirischen Analyse gewonnen. Die wissenschaftliche Beschreibung von Fakten beansprucht überzeitliche Gültigkeit, obwohl sie ihre Befunde zur Geschlossenheit und Strenge deutlich an klassizistischen Auffassungen orientiert. Die dramatische Praxis seit Lenz kommt damit ebenso wenig in den Blick wie etwa Büchners Absage an die idealistische Dramatik der ,Kunstperiode‘. Die bei Freytag erkennbare Orientierung besteht noch in Robert Petschs systematischer Darstellung Wesen und Formen des Dramas. Allgemeine Dramaturgie (1945) und in Wolfgangs Kaysers Das sprachliche Kunstwerk (1948) fort, ein Buch, das die Diskussion nach 1945 prägte. Im Kern trägt sie sogar noch Peter Szondis Theorie des modernen Dramas (1956), weil auch hier der Dialog aus dem ,zwischenmenschlichen Bezug‘ abgeleitet wird (Szondi 1963, 14). Andererseits gehört Szondis Dissertation zu den einflussreichsten Arbeiten über die ,Krise‘ des Dramas in der Moderne: zum einen, weil sich die allgemeine Dramentheorie an ihrer kategorialen Grundlegung des absoluten Dramas abgearbeitet hat; zum anderen, weil sie die gesellschaftlichen und medialen Umbrüche seit Ende des 19. Jahrhunderts an Veränderungen der dramatischen Form selbst plausibel macht. Bereits Szondi verbindet die Frage nach der Historizität der Gattung mit strukturanalytischen und sozialgeschichtlichen Überlegungen. Er bereitet damit neue Paradigmen in der Literaturwissenschaft der 1960er Jahre vor (Scherer 2000). Die neu akzentuierte wirkungsästhetische Begründung durch Brecht und die literarhistorische Erschließung nicht-aristotelischer Dramenformen nach dem Vorbild Shakespeares von Lenz über Büchner und Grabbe bis zum Naturalismus ergänzen das bis dahin zugrundegelegte Modell der „in sich geschlossenen Handlung“ (Aristoteles 1982, Kap. 6, 19). Volker Klotz’ Buch Geschlossene und offene Form im Drama (1960) leitet daraus zwei gegenläufige Strukturprinzipien ab, die sich als Idealtypen historisch entfalten. In diesem Rahmen interessiert dann auch die Frage nach der dramatischen Spannung in der szenischen Organisation von Zeit (Pütz 1970). Die neuere Forschung bemüht sich um eine Formalisierung des Handlungsbegriffs, insoweit die Handlung im Drama intentional begründet sei (Pikulik 1982). Zunehmend spielen semiotische Kategorien (Pfister 1988, 1. Aufl. 1977; Andreotti 1996) und soziologische Handlungstheorien u. a. in Bezug auf Parsons und Goffman eine Rolle (Schwanitz 1977). Damit verschiebt sich die Aufmerksamkeit vom ,literarischen Textsubstrat‘ (Pfister 1988, 34–41) auf die ,Performance‘ (Krieger 2004, 76–84). Zugleich untersucht man nun verstärkt den Dialog bzw. die Figurenrede, um Formprinzi- II. Forschungsbericht pien des dramatischen Texts im Blick auf seine Mitteilungsqualitäten über die psychische Verfasstheit von Figuren in einer Szene zu ermitteln (Schmid 1976, Zimmer 1982, Greiner 1982, Hasler 1982). Hübler (1973) beschreibt das Drama mit Bezug auf Szondi als Vermittlung von Form (Sprache), Inhalt (Handlung) und pragmatischen Aspekten der Aufführung (Szene). Kiel (1992) sieht es im Zusammenhang durch Dialog und Handlung begründet. Aber auch in diesen Arbeiten ist noch die Folie der strukturalistischen Analyse bemerkbar (Schmid 1973). Erst in den semiotisch und ritualtheoretisch orientierten Theaterwissenschaften seit den 1980er Jahren, die auf Methoden der allgemeinen Semiotik bauen, verschiebt sich die Aufmerksamkeit weg vom dramatischen Text hin zur szenischen Realisierung (Fischer-Lichte 1983; dazu Krieger 2004, 72). Erst jetzt setzt sich die Abkehr vom bloßen Sprachkunstwerk hin zum Verhältnis von dramatischem Dialog und Alltagsdialog (Roumois-Hasler 1982) und zum ritualtheoretisch begründeten sozialen Drama (Turner 1989) durch. In diesem Rahmen entstehen Untersuchungen über die szenische Realisierung von Textvorlagen durch nichtsprachliche Zeichensysteme (Esslin 1989). In der Verbindung von Kommunikationsund Textforschung werden drameninterne Strukturen präzisiert, d. h. Aspekte der Informationsvergabe, der Kommunikation und Interaktion, indem soziologische und psychologische Erkenntnisse neue Bezugspunkte bilden. Das Rollenspiel des Menschen im Alltag dient hier als Vorgabe, um das Rollenspiel auf der Bühne nach Mustern alltäglichen Handelns zu begreifen. Das Drama ist vor diesem Horizont ein beispielhaftes, künstlerisch gestaltetes und ästhetisch produziertes Modell menschlichen Verhaltens, das im Theater genauso funktioniert wie im alltäglichen Leben. Zunehmend kommen dabei Perspektiven der Gendertheorie, etwa im Spiel mit Geschlechterrollen durch den Einsatz geschlechtsspezifischer Körperzeichen, in den Blick. Diese Verlagerung reagiert auf Tendenzen der Theatralisierung in der dramatischen Praxis der Moderne, insofern sich seit Brecht und dem Absurden Theater die Aufmerksamkeit auf nichtsprachliche Darstellungsformen verstärkt. Die Entliterarisierung des Dramas setzt sich seit den 1980er Jahren in den Befunden zum ,postdramatischen‘ Theater fort (Poschmann 1997, Lehmann 1999; resümierend Birkenhauer 2007). Lehmann unterscheidet das traditionelle Drama, das sich nach Aristoteles durch den Primat der Handlung auszeichnet, von prädramatischen und postdramatischen Formen, um so nicht zuletzt auch die Unabhängigkeit aktueller Theorieansätze von den bisher wirksamen Traditionsvorgaben zu demonstrieren. Neben den semiotischen Orientierungen begründet Lehmann eine Dramentheorie, in der die Rolle und Relevanz des Theaters im Rahmen konkurrierender Medien herausgehoben wird. Bereits zuvor hat Pfister erstmals systematisch das Drama als plurimediale Darstellungsform beschrieben. In jüngster Zeit häufen sich aber wieder die Befunde, die eine Rückkehr zum Handwerklichen und zum konventionell Dramatischen in der Abweisung des postdramatischen Theaters feststellen, weil man darin zunehmend Beliebigkeit und Dilettantismus identifiziert (Brincken/Englhart 2008, 104–106). Auch die Abwendung vom dramatischen Text wird mittlerweile wieder relativiert (Korthals 2003). Im Bereich der systematischen Forschung gibt es Untersuchungen und Anthologien zum Wechselverhältnis zwischen Drama und Theater (Platz-Waury 1978, Turk 1992, Balme 2008, Brincken/Englhart 2008), daneben zur Systematische Forschung 21