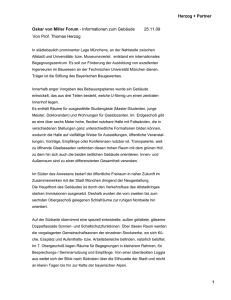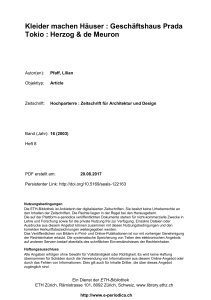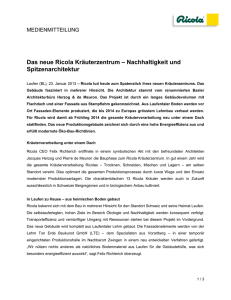Die Maske des Stils - Deutsche Gesellschaft für Semiotik
Werbung

Stil als Zeichen. Funktionen – Brüche – Inszenierungen. Beiträge des 11. Internationalen Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Semiotik (DGS) vom 24.-26. Juni 2005 an der Europa-Universität Viadrina. Frankfurt (Oder) 2006. (Universitätsschriften – Schriftenreihe der Europa-Universität Viadrina, Band 24). CD-ROM (ISSN 0941-7540). Bernhard Langer Die Maske des Stils: das Performative in der Architektur von Herzog & de Meuron Mit dem von Joseph Bayer 1886 geprägten Begriffspaar „Stilhülse“ und „Kern“ (s. auch Oechslin 1994) hat eine Betrachtungsweise ihre Formel gefunden, welche die Diskussionen in der Architektur spätestens seit Gottfried Sempers Der Stil prägt. Anhand dieser Metaphern lässt sich an einem Gebäude zwischen einer sinnlich wahrnehmbaren Oberfläche und einem konzeptuellen Kern unterscheiden und damit die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden Aspekte stellen. Wird unter dem Stil eines Gebäudes das Phänomen der Oberfläche verstanden, d.h. die äußere Schicht als Träger öffentlicher, expressiver, semiotischer oder ikonischer Aspekte, so tritt der Begriff meist im Plural auf und steht für jene Werte, die sich mit den Phänomenen der Bekleidung, des Modischen oder Ephemeren verbinden. Hatten die Stilkleider bei Semper die positive Funktion, die alltägliche Wirklichkeit, „die Mittel“ und „den Stoff“ der Architektur zu verschleiern und vergessen zu machen, um das Gebäude im positiven Sinn frei für seine soziale und kulturelle Funktion zu machen (1860/1977: 231 f, Anm. 2), so bewegt sich die Architektur der modernen Avantgarde in den Fußspuren der abendländischen Philosophie, für die die Oberfläche mit all ihren rhetorischen und sinnlichen Mitteln der Verführung bloß in Verdacht stand, das Wesen zu verstellen. Wenn etwa Hedrik Petrus Berlage die Wahrheit der Architektur sucht – ohne „Konfusion mit Kleidern“ – so ist diese Wahrheit eine unbekleidete: „die Wahrheit, die wir wollen, ist ganz nackt.“ (1908: 13) Die Wahrheit als nackte war auch das Ziel der traditionellen Form der westlichen Philosophie, der Metaphysik. Als ihre Aufgabe galt es, die sich in verschiedene Verhüllungen und Verkleidungen gebende Wahrheit zu entschleiern. Der Prototyp einer relativistischen Philosophie, die griechische Sophistik, wird dann auch von Platon mit einer der Mode verwandten Scheinkunst verglichen, „die gar verderblich ist und betrügerisch, unedel und unanständig, und die durch Gestalten und Farben und Glätte und Bekleidungen die Menschen (...) betrügt.“ (Platon, Gorgias: 465 b)1 Auch wenn es mit der jüngsten Renaissance von Gottfried Sempers „Bekleidungstheorie“ zu einer Reevaluierung der modernen Architektur und ihrer Selbstdarstellung kam und die Themen der Bekleidung, des Stils und der Mode ins Zentrum der Betrachtung rückten2, ist doch der Verdacht, dass sich in den glänzenden Oberflächen vieler der neuen, oft im kommerziellen Kontext entstandenen Architekturen doch nur ein Interesse an „oberflächlichen“, der Architektur nicht 1 Zur Wahrheitsmetaphorik der Metaphysik s. Blumenberg 1960. Zum Phänomen der Bekleidung in der Philosophie s. Niehues-Pröbsting 2001. 2 Insbesondere durch den von Deborah Fausch u.a. (1994) herausgegebenen Band Architecture: In Fashion und Mark Wigleys (1995) White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture. Zu dieser Diskussion s. Kinney 1999. 2 wesentlich zugehörigen Phänomenen verrät, verbreitet. „Stil – als innerer Zusammenhang – hat vor Styling abgedankt, das den Zusammenhang äusserlich herstellt“, schreibt etwa Martin Steinmann (1988: 14). Ich möchte im Folgenden exemplarisch die Position von Herzog & de Meuron besprechen, um von hier aus zu einem allgemeineren, in der neueren Diskussion vernachlässigten Aspekt der „Stilhülse“ von Architektur zu gelangen, nämlich jenen der Performativität im Sinne Judith Butlers. Ich gehe von Herzog & de Meuron aus, da sich in ihrem Werk nicht nur das Anliegen einer intensiven Erfahrungsweise im Zeichen von Unmittelbarkeit bzw. Distanzlosigkeit artikuliert, welche immer auch Kennzeichen performativer Handlungsmuster sind, sondern ebenso das Thema Oberfläche, Haut, Bekleidung und deren Verhältnis zum konzeptuellen Gehalt von Architektur auf anspruchsvolle Weise thematisiert wird. Die folgenden Überlegungen nehmen freilich nicht in Anspruch, das skizzierte Problemfeld erschöpfend zu behandeln, sondern verstehen sich im Sinn einer Arbeitsskizze. Die Architektur von Herzog & de Meuron gilt schon seit längerem, spätestens aber seit ihrer Bibliothek der Fachhochschule Eberswalde (Wettbewerb 1993, ausgeführt 1996–98) als Vorreiter einer neuen „Oberflächlichkeit“ in der Architektur. Indem sie die Flächigkeit der Architektur hervorheben und zu einem autonomen Problem machen, laufen sie jedoch für Kritiker wie Hans Frei Gefahr, „die Oberfläche durch architektonische Abstraktion von der räumlichen Wirklichkeit“ zu lösen (1996: 113). Kenneth Frampton rechnet Herzog & de Meuron gar einer Gruppe von Architekten zu, die „den halluzinatorischen Effekten der Medienwelt unterlegen zu sein scheinen“, da sie die sinnliche Wirkung der Architektur fetischisieren, und zwar „losgelöst vom Inhalt oder vom Zusammenhang.“ (1995: 12) Eine solche Beurteilung der Architektur von Herzog & de Meuron entspricht jedenfalls nicht ihrem Selbstbild. In einem Interview mit Jeffrey Kipnis 1993 meinte Jacques Herzog: „The strength of our buildings is in the immediate visceral impact they have on the visitor. For us that is all that is important in architecture.” (1993: 18) Und später: „It stands there, as if it created itself, without the laughable particularity of the author, without his mark (…) The architecture is understood only by means of itself, with no aids to understanding, capable of being produced only out of architecture, not out of anecdotes or quotes or functional processes. Architecture is its own substantiality in it‘s location.” (Herzog und de Meuron1996: 182) In diesen Zitaten kommen verschiedene Haltungen zum Ausdruck: einmal die modernistische Idee, Architektur von der „Partikularität“ ihres Autors zu befreien – eine in der modernen Kunst, in Literatur (etwa in der surrealistischen écriture automatique von Philippe Soupault und André Breton) und Musik (s. Schulze 2000) in vielen Spielarten verwirklichte Idee. Im Kontext der Architektur besitzt dieser Anspruch einen Anklang einerseits zur modernen Sachlichkeit, die, in ihrer radikalen Ausprägung etwa bei Hannes Meyer oder Ludwig Hilberseimer, sich um eine rein logische Deduktion des Architekturkörpers aus als notwendig anerkannten Bedingungen und Fakten wie von selbst ableitet; oder auch mit der beispielhaft von Adolf Loos vertretenen Sehnsucht nach einem „aufrichtigen“ (Loos würde sagen: „kultivierten“) Architekturschaffen, das sich allein aus den Fertigkeiten des Handwerks und den Regeln der Tradition ergibt. Das Idealbild des Architekten bei Loos ist das eines Professionisten, der, wie der Zimmermann oder der Bauer, ganz und gar auf seine Arbeit konzentriert ist, ohne sich um Originalität, kommerziellen Erfolg usw. zu kümmern. „Der zimmermann ... macht 3 das dach. Was für ein dach? Ein schönes oder ein häßliches? Er weiß es nicht. Das dach.“ (1987: 90f)3 Auf jeden Fall entspricht dem Anspruch, das Gebäude von der Partikularität des Autors zu befreien, ein Wille zur Ganzheit oder „Substanzialität“, die keine Zufälligkeiten oder unmotivierte Willkürlichkeiten verträgt. Substanzialität kennzeichnet ein aus sich selbst heraus stehendes, sich selbst von unten herauf- und hervorstellendes (sub-stare) Wesen, das sich ontologisch aus einem inhärenten Prinzip ableitet. Weniger philosophisch interpretiert spricht es von einer Konzentration auf das Wesentliche, auf das Notwendige und Einfache. Das würde Herzog & de Meuron in das Umfeld des „swiss essentialism“ setzen, um einen Ausdruck von Peter Buchanan (1991) zu gebrauchen. Von Seiten des Entwurfs bzw. der Produktion auf die Architektur geblickt, impliziert Substanzialität eine Art von innerer Einheit bzw. Kohärenz; also auch eine Einheit von „Schein“ und „Sein“, bzw. von Oberfläche und jenen Komponenten, die den Baukörper gleichsam „von innen heraus“ formen. Neben der Verankerung in Kontext und Kultur ist also auch eine produktionslogische Einheit von Form und Material, Tektonik und Konstruktion angesprochen, welche, konträr zum oben genannten Befund, auch immer wieder als ein Kennzeichen der Architektur von Herzog & de Meuron gilt (s. etwa Steinmann 1988). Wichtiger noch scheint mir die in diesen Zitaten angesprochene Einheit bzw. Ganzheit der Erfahrung, der Wahrnehmung und Rezeption von Architektur zu sein. Jacques Herzog postuliert hier eine bestimmte Form der Präsenz von Architektur: Architektur entfaltet sich autonom (sie bestimmt den Modus der Erfahrung und definiert ihren Horizont: „architecture is understood only by means of itself“), unmittelbar („immediate“) und körperbezogen („viszeral“). Das Insistieren auf Unmittelbarkeit impliziert, dass es keine Trennung gibt zwischen dem rezipierenden Subjekt und dem reinen, echten Ereignis. Keine Analyse ist notwendig, um sich konstruierend oder rekonstruierend an ein Geschehen oder ein Kunstwerk heranzuarbeiten. Alles ist in der Sache selbst präsent bzw. die Sache selbst ist präsent. Herzog postuliert, überspitzt formuliert, eine reine, unmittelbare, kontextfreie, kulturell unvermittelte4, autonome und authentische Präsenz von Architektur als solcher, von Architektur als Architektur. Was aber, und diese Frage soll im Folgenden weiter bearbeitet werden, kann „Unmittelbarkeit“ im Kontext der Architektur bedeuten? Was „Unmittelbarkeit“ heißen soll, leuchtet keineswegs unmittelbar ein. Die Schwierigkeit einer näheren Bestimmung zeigt sich schon darin, dass Unmittelbarkeit ein negativer Ausdruck ist, der keinen Hinweis darauf gibt, was positiv in ihm gemeint sein kann. Gewöhnlicher Weise nennen wir unmittelbar etwas, was in einer zeitlichen oder räumlichen Nähe zu uns steht, Unmittelbarkeit ist eine Form der Präsenz, die nicht durch Anderes verstellt ist. Unmittelbarkeit meint im allgemeinen Sprachgebrauch somit in erster Linie das Nahe, 3 Dem würde auch die von Herzog & de Meuron vielfach hervorgehobene Verwendung von konventionellen, alltäglichen architektonischen Elementen entsprechen, die, so Wilfried Wang, „sogar banal sein mögen“ (1998: 15). 4 So auch Peter Zumthor: Zumthor postuliert Konstruktion (das „Fügen“) und insbesondere das Material als fundamentale, gesellschaftlich und diskursiv unvermittelte Kerndimension der Architektur. Er sucht, „das eigentliche Wesen [der] Materialien, das bar jeglicher kulturell vermittelten Bedeutung ist, freizulegen.“ Was sich dann ergibt, sei eine „selbstverständliche Präsenz der Dinge, wo alles seinen richtigen Ort und seine richtige Form hat.“ (1998: 9) 4 Direkte, das Sofortige und Gegenwärtige. Warum aber sollten die Gebäude von Herzog & de Meuron uns physisch näher stehen als andere? Zwar spricht die Rhetorik von Jacques Herzog eine Sprache der Selbstständigkeit bzw. Authentizität, doch fällt ihr Werk ebenso durch sorgfältige mediale Inszenierungen auf. Das betrifft einerseits ihr besonderes Augenmerk auf das Thema Ausstellung (s. Ursprung 2002), andererseits die Präsentation ihrer Werke in den Medien. Die verführerisch-stilvollen Fotografien ihrer Gebäude werden manchmal von Portraitfotos begleitet, üblicher Weise von Jacques Herzog, die als authentifizierender Stempel, als Qualitätssiegel wirken. Kurz, die Konstruktion der Erfahrung ihrer Architektur ist weit davon entfernt, „objektimmanent“ zu sein; sie liegt nicht in der körperlichen Begegnung zwischen Subjekt und Gebäude, im viszeral impact, sondern zieht weite Kreise, eben auch über die Medien- und Publikationsmaschine des Architekturbetriebs. Julia Chance geht sogar so weit zu behaupten, dass, da es keinen einfach zu erkennenden, durchgehenden Stil in den Arbeiten von Herzog & de Meuron gebe, die Konstanz oder Kontinuität ihrer Arbeiten erst durch die Verknüpfung mit der Person Jacques Herzog, durch das von seinem Portraitphoto vermittelten Image hergestellt wird (Chance 2001). Ein zweiter Punkt, der gegen sinnliche Unmittelbarkeit spricht, ist, dass Herzog & de Meuron in ebenso starker und eindeutiger Vehemenz das Konzeptuelle, das Immaterielle oder, wie sie auch sagen, das „Geistige“ an ihrer Architektur betonen: „Die Wirklichkeit der Architektur ist (...) nicht das real Gebaute, das Taktile, das Materielle. Wir lieben zwar dieses Greifbare, aber nur in einem Zusammenhang innerhalb des ganzen (Architektur-)Werks. Wir lieben seine geistige Qualität, seinen immateriellen Wert.“ (In: Ursprung 2002: 29, Anm. 34) Diese Betonung des Konzeptuellen zieht sich genauso wie ein roter Faden durch das Werk von Herzog & de Meuron wie ihre Betonung sinnlicher Materialität bzw. purer Faktizität. HdM: Lagerhaus Ricola, Laufen, 1986−91 Foto: Margherita Spiluttini 5 Eines der am meisten diskutierten Werke, das Lagerhaus Ricola in Laufen (1986–91), veranschaulicht dieses doppelte Anliegen: Einerseits enthält das Gebäude eine Anspielung auf die Funktion der Lagerung (Schichtung), eine Vergegenwärtigung des Ortes (Aufnahme der Schichten des alten Steinbruches), und es thematisiert eine allgemein als fundamentale Eigenschaft der Architektur akzeptierte Dimension, nämlich „Schwere“ (verstärkt durch die dem gängigen Verständnis entgegengesetzte Anordnung der Fassadenfelder). Gleichzeitig ist ein Bemühen um semantische Entleerung zu beobachten, um Konkretheit und Buchstäblichkeit: Z.B. sind die Eternitpaneele der Fassade leicht geneigt, um einen Blick auf die Konstruktion hinter der Verkleidung freizugeben – hier wird alles gezeigt, die Elemente der Fassade wollen nichts sein bzw. nichts vorspiegeln, was sie nicht sind (s. Reichlin 1988). Dieses Streben nach Buchstäblichkeit stellt einen Anklang an die Strategien der Minimal Art dar. Für die Fassadenpaneele gilt, was Michael Fried für die Objekte der Minimal Art festhält: „[They] do not represent, signify, or allude to anything; they are what they are and nothing more.“ (Fried 1995: 143) HdM: Rudin House, Leymen, 1996-97 Foto: Margherita Spiluttini Diese doppelte Geste der Betonung von Buchstäblichkeit und Symbol kommt noch stärker im Haus in Leymen (1996–97) zum Tragen, welches auf der einen Seite ein überdeutliches Zitat in Form einer Beschwörung archetypischer Behausung verkörpert und gleichzeitig die Konkretheit des Objekts durch eine brutale Reduktion auf die elementare Hausform und sein materielles Gewicht (Sichtbeton) zur Anschauung bringt. Diese Doppelstrategie wird bzw. wurde von Herzog & de Meuron konsequent verfolgt. Sie schreiben: „Wir versuchen deshalb stets die materielle, die physische Erscheinungshaftigkeit von Architektur zu unterstreichen. In diesem Bereich werden spezifische Eigenschaften oft erst erkennbar! Was verkörpert Schwere? Woraus konstituiert sich Helligkeit? Was ist eine Mauer, was ist Licht etc. Immerhin sprechen all diese Begriffe von der menschlichen Wahrnehmung der physischen Welt auf einer gedanklichen, geistigen Ebene. Und genau diese gedankliche Ebene von Wahrnehmung 6 versuchen wir mit Architektur zu erreichen, zu treffen.“ (Wang 1992: 185f) Kennzeichnend für das frühe Werk von Herzog & de Meuron ist, dass sich die durch diese Doppelstrategie konstruierte Erfahrung von Architektur insofern „unmittelbar“ bzw. „substanziell“ zur Architektur verhält, als sich zeichen-, bildhafte und körperlich erspürte Gehalte immer auf klassische Themen der Architektur wie Schwere, Konstruktion, Materialität beziehen, auf das von Jacques Herzog so genannte „spezifische Gewicht“ von Architektur (1982). Ein medial konstruiertes Image, die Arbeit an der Qualität der sinnlichen Dimension von Architektur, die Strategie der Buchstäblichkeit und ein vertrautes Verhältnis zur Geschichte der Architektur erzeugen einen geschlossenen Horizont, innerhalb dessen Architektur „in ihrer eigenen Substanzialität“ präsent zu werden vermag. Diese Momente tragen dazu bei, dass sich Architektur scheinbar wie von selbst versteht und scheinbar nur durch sich selbst dem Verständnis nahe bringt, „understood only by means of itself“. Erzeugt wird jener Sinn von „Unmittelbarkeit“, der die Wendung vom „unmittelbaren Verstehen“ meint: Wenn etwas „unmittelbar einleuchtet“, so ist gemeint, dass etwas sich wie von selbst versteht, weil es so auf sich selbst bezogen ist, dass es, da selbstbezüglich und abgeschlossen, keiner weiteren Erklärung bedarf. HdM: Bibliothek Fachhochschule Eberswalde, 1994−99. Foto: Margherita Spiluttini Mit den Entwürfen der 1990er Jahre, in denen sich die Behandlung der Oberfläche ästhetisch und konzeptuell verselbständigt, scheint sich das zu verändern. In der Universitätsbibliothek der Fachhochschule Eberswalde (1994–99) wird ein elementarer, sockelloser, monolithischer Block, der wuchtig und schwer durch seiner Form erscheint, mit einer filigran wirkenden Haut aus Beton- oder Glasplatten umspannt, in denen Fotografien (aus dem Archiv von Thomas Ruff) eingeätzt sind. Hier ist, ebenso wie im Ricola Produktions- und Lagerhaus in Mulhouse-Brunstatt (1992–93), der Gehalt der Oberfläche strukturell und teilweise auch konzeptuell von der „Realität des Bauens“ weit entfernt. Die Oberfläche wird als autonomes, flächiges Gebilde behandelt, die Bildwirkung steht im Vordergrund. Weit davon entfernt, objekthaft zu sein, wirkt sie im Sinne einer Bekleidung verhüllend und enthüllend zugleich, doch bezieht sich die Funktion der Enthüllung nicht auf das Freilegen eines nackten Kerns. In diesen Werken kann man die Hülle mit Gottfried Semper als eine Maske bezeichnen, hinter der sich die 7 (banale) Individualität des Gebäudes versteckt. Der Karnevalskerzendunst, von dem Semper an derselben Stelle seiner Stil-Schrift als „wahre Atmosphäre der Kunst“ spricht (1860/1977: 231, Anm. 2), scheint sich in diesen Werken jedoch nicht einzustellen. Erst in der Zuwendung zu größeren, kommerziellen Baufaufgaben in jüngerer Zeit, insbesondere dem Allianz-Stadium in München und dem Prada Epicenter Store in Tokyo kommt so etwas wie festliche Stimmung wieder herein und verleiht ihren Arbeiten, wie ich zeigen möchte, wieder eine Art von „Einheit von Stilhülse und Kern“, jedoch unter gewandelten Vorzeichen. In der Suche nach Unmittelbarkeit und „viszeraler“ Körperlichkeit greifen Herzog & de Meuron auf die Erzeugung von Atmosphären zurück – nach Gernot Böhme (1995) der Name für das Einzige in der sinnlichen Wahrnehmung, dem man Unmittelbarkeit zuschreiben kann. Bei diesen jüngeren Arbeiten scheint es so, als ob Herzog & de Meuron die Mechanismen der medialen Inszenierung gleichsam in das Gebäude selbst inkorporiert hätten. Ich komme noch einmal auf die eingangs angesprochene Spannung zwischen Authentizität (oder Substanzialität) und Inszenierung (bzw. mediale Präsentation) zu sprechen. Eine (mediale) Inszenierung ist in gewisser Weise das Gegenteil zu Authentizität bzw. Selbst-Ständigkeit: Unter „Inszenierung“, verstanden in einer unspezifischen Alltagsbedeutung, versteht man ein absichtsvolles Handeln, das seine Effekte gegenüber einem Publikum ins Kalkül zieht. Inszenierungen sind diejenigen Akte, die für ein Publikum vollzogen werden, dessen Existenz dem Akteur bewusst ist und das er entsprechend einrechnet.5 Das Authentische hingegen scheint ohne eine strategische Bezugnahme auf Erwartungshaltungen, ohne Vorwegnahme von Bewertungsmechanismen, ohne ein Wirkungskalkül des Autors aus sich selbst heraus zu bestehen – es ist, wie es ist und was es ist. Das Wort „authentisch“ enthält die Bedeutung des sich selbst Vollendenden. Authentisch meint aber nicht nur das Wahre und Echte (eines Schriftstückes oder einer ethischen Haltung), sondern es schwingt auch die Bedeutung der „Unmittelbarkeit“ und Intensität einer Erfahrung mit: Man weiß z.B. zwar nicht, wie es wirklich ist, einen Rennwagen der Formel Eins zu fahren, aber die Cockpit-Kamera bringt uns hier ein Stück näher. (Hoffmann 2000) Der einfache Gegensatz zwischen Authentizität und Inszenierung lässt sich so formulieren: Was authentisch ist, kommt ohne Inszenierung aus bzw. was inszeniert ist, verliert die Unvoreingenommenheit, Offenheit und Integrität des einfachen So-Seins. Auf der anderen Seite gibt es schon von der Wortbedeutung her einen Zusammenhang zwischen Inszenierung und Authentizität. Etwas „inszenieren“ bzw. etwas „dramatisieren“ meint im Deutschen wie im Englischen „etwas auf die Bühne bringen“, d.h. etwas in einem sozialen Rahmen, geplant und in Form einer sinnlich erfahrbaren Gestalt vor einem Publikum zur Schau stellen. Die primäre Bedeutung von lat. scaena (Bühne) und gr. skené war nicht theatralisch, sondern bezeichnete eine generische Kennzeichnung von Orten: einen überdachten Ort, ein Zelt, einen Wohnort, einen Tempel. Der Begriff der Inszenierung hebt somit in erster Linie das einrahmende Moment hervor; weniger die Intensität und Glaubwürdigkeit von Handlungen oder Erfahrungen. Doch beinhaltet mise en scène, dass etwas Bedeutsames eingerahmt oder in Szene gesetzt worden ist. Die Szene stellt keinen neutralen Raum dar, sondern die Stätte, an der sich etwas Entscheidendes ereignet, was im heutigen Gebrauch des Wortes Szene als der Ort, wo sich etwas kulturell Bedeutendes abspielt, mitschwingt. 5 S. Erwing Goffmans Unterscheidung zwischen Vorder- und Hinterbühne (Goffman 1959). 8 Inszenieren bedeutet somit auch, „etwas als aufregender oder wichtiger behandeln oder so erscheinen lassen“: Was inszeniert wird, soll sich vom Alltag durch eine gesteigerte Erfahrung und Bedeutsamkeit abheben. Dieser Konnex zwischen Inszenierung und Authentizität (verstanden als gesteigerte Präsenz) ist nach Richard Shusterman (2001) konstitutiv für die Kunst als solche. Beide Mechanismen, der soziale Rahmen und die größere Lebendigkeit von Erfahrung und Handlung, dienen dazu, Kunst zu definieren, d.h. vom Rest der Welt zu unterscheiden und somit hervorzuheben. Mit anderen Worten: in Inszenierungen gibt es immer eine Doppelpräsenz von sinnkulturellen Elementen (am Beispiel Oper: die Handlung) und präsenzkulturellen Effekten (das Stimmvolumen von Orchester und Sängerinnen) (s. Gumbrecht 2001). Herzog & de Meurons Doppelstrategie der Betonung des körperlich-viszeralen und des „Geistigen“ bzw. Gedanklichen spiegelt diese konstitutive Dichotomie wider. Ein wichtiger Aspekt von Inszenierungen ist es somit, in Form eines Demarkationsrituals so etwas wie „Präsenz“ zu markieren. Demarkationen sind aber nie neutral, das Parergon eines Werkes geht konstitutiv in das Ergon mit ein, d.h. Inszenierungen geben soziale Rahmenbedingungen und Kontexte ab, die das Ereignis mitkonstituieren. Weiters sind Demarkationen bzw. Präsentationen eines Werkes nicht nur etwas Statisches, etwa in zeichen- oder bildhafter Form. Zeichen und Bilder sind immer Teil von Inszenierungen, verweisen aber auf einen rituellen oder performativen Kontext, in dem sie ihre Funktion ausüben. Um diesen Aspekt der Präsentation von Architektur zu beschreiben, kann man sich einer Begrifflichkeit bedienen, die dem Theater entliehen ist: eben Performance, Inszenierung, Spiel, Maskerade, Spektakel, Verkörperung usw. (s. dazu Fischer-Lichte 2001). Eine Architekturbetrachtung oder produktion unter dem Aspekt der Inszenierung versucht dementsprechend, die Architektur aus ihrem Verhaftet-Sein mit dem rein Bildhaften, Visuellen oder Kontemplativen hin zu einer umfassenderen, wirkungs- und handlungsbezogenen Erfahrung zu bringen. Nicht zufällig steht das Theater Pate für eine Auffassung von Kunst, die diesem Weg folgt: Insbesondere Nietzsche hat im Rückgriff auf die antike Tragödientheorie betont, dass ästhetische Erfahrung generell weniger mit Kontemplation und rationaler Erkundung etc. zu tun hat, sondern mit Rausch, Tanz, sexueller Ekstase, religiöser Verzückung. Der Ausdruck Performance bzw. performativ im engeren Sinn soll hier jedoch im Sinne Judith Butlers gebraucht werden. Butler führte den Begriff 1988 in die kulturwissenschaftliche Diskussion ein in dem Versuch zu zeigen, dass Geschlechtsidentität (gender) – bzw. Identität überhaupt – nicht biologisch oder ontologisch gegeben ist, sondern das Ergebnis bestimmter kultureller und sozialer Konstitutionsleistungen darstellt. Identität wird produziert durch eine „stylized repetition of acts“, d.h. durch nicht-referenzielle körperliche Handlungen, die sich nicht auf etwas beziehen, das sie zum Ausdruck bringen sollen, sondern Identität erst als ihre „Bedeutung“ hervorbringen (Fischer-Lichte 2004: 36ff). Durch die stilisierte Wiederholung performativer Akte werden bestimmte historisch-kulturelle Möglichkeiten verkörpert und auf diese Weise sowohl der Körper als historisch-kulturell markierter wie auch Identität allererst erzeugt. Butler vergleicht die Verkörperungen mit einer Theateraufführung: Wie bei einer Theateraufführung stellen die performativen Akte, die Identität konstituieren, keine individuellen Handlungen oder Entscheidungen dar, sondern reproduzieren eine „geteilte Erfahrung“ und damit eine Form von Kollektivität. Jede Wiederholung einer Handlung ist ein „re-enactment“ und ein „re- 9 experiencing“ eines Repertoires von Bedeutungen, die gesellschaftlich bereits etabliert sind. Butlers Theorie der Performance entspricht, freilich nur bis zu dem Grad, wie sie hier dargestellt wurde, Pierre Bourdieus Ausführungen zum Begriff des Habitus, der nicht nur zwischen kollektiven und individuellen Denk- und Handlungsschemata vermittelt, sondern auch zwischen dem Aspekt der Handlung und jener der materiellräumlichen, insbesondere der architektonischen Strukturen der Lebenswelt (Bourdieu 1974: 125 ff). Die gesuchte Einheit bzw. Ganzheit („Substanzialität“) und Unmittelbarkeit der Architektur und ihrer Erfahrung, deren Erzeugung als ein Anliegen von Herzog & de Meuron vorgestellt wurde, könnte ihre Erfüllung in den wechselseitigen Bestätigungen stilisierter, performativer und wiederholter Handlung finden, die zwischen den materiellen Strukturen der Architektur und den habituellen Schemata vermitteln. Es ist der Begriff des Stils, der für eine solche Einheit von „Handlung“ und Architektur schon Ende des 19. Jahrhunderts stand, als Synonym für umfassende Lebensgestaltung – und zwar „vom Sofakissen bis zur Stadtplanung“ (Hermann Muthesius) mit totalisierender und kommunitaristischer Tendenz. Die Einheit von Architekturstil (im Sinne einer ästhetischen Oberflächenwirkung) und Lebensstil betont auch Gernot Böhme. Atmosphären, der Titel für das, was mehr oder weniger unmittelbar und unbewusst auf uns einwirkt, wenn wir ein Gebäude betreten, gehören immer zu einer bestimmten Lebensform. Folgt man Böhme, dann hat selbst die unmittelbarste, sinnlichste Materialwirkung eine strenge soziale Codierung: sie wird immer entsprechend einem umfassenden Konzept von Lebensstil aufgefasst und evaluiert (Böhme 1995) – eine Einsicht, die insbesondere bei Architekturen mit primär markt- und konsumorientierter Ausrichtung erfolgreich praktiziert wird. Stellvertretend für viele Beispiele sei hier die von Philippe Starck und John Hitchcox gegründete Firma YOO genannt, die in destination cities weltweit Apartments im Luxussektor bereitstellt, deren hervorstechendste Merkmale ein auf atmosphärisches Styling zugeschnittenes Design sowie ein gutes Marketing sind. Die Ästhetik von Architektur und Design wird atmosphärisch vermittelt und ist marktorientiert auf einige wenige Typen von Lebensstil zugeschnitten.6 6 Kunden haben jeweils die Auswahl zwischen vier Stilen: „klassisch“, was Starck mit Zigarren, Jaguar und Tweed-Anzügen assoziiert, eine architektonische Entsprechung wird in dunklen Holzfußböden, Ledermöbeln und viel Marmor gefunden. Weiters „culture“ (ein Mix aus Neonlicht und Barock), „minimal“ (klare Linien, Edelstahl) und „Natur“ (blasse Farben, robuste Textilien). S. www.yooarehere.com (Dez. 2005). 10 YOO: Tribeca Apartments, East Melbourne (s. www.youarehere.com) Verständlicher Weise sind es vor allem die Architekturen für den Konsum, die in besonderer Weise versuchen, den von Semper angesprochenen „Karnevarlskerzendunst“ zu erzeugen, oder anders gesagt, einen „emotional angeregten“ Zustand herzustellen (Mikunda 2002). So kann man auch Herzog & de Meurons Prada Store in Tokyo in diesem Sinn interpretieren. Stellte Martin Steinmann 1988 noch fest, dass sich die Architektur von Herzog & de Meuron „den aussergewöhnlichen Bildern, die zum Ausweis des postmodernen Bewusstseins geworden sind“, verweigert (1988: 14), so steht der Prada Store unverkennbar in der Tradition von John Paxtons Crystal Palace, dessen gläserne Außenhülle als Schatulle der innen angehäuften Reichtümer wirkt. Gleichzeitig gibt das Gebäude dem Konsumenten ein starkes Bild mit auf den Weg – das Bild eines Diamanten –, das Markenidentität und Lebensstil als Ikone versinnbildlicht. Die angesprochene Einheit von Lebensstil und Unmittelbar-Sinnlichem wird durch ein Set von Strategien erreicht: Herzog & de Meuron haben weitgehend auf Formen virtueller „Interaktion“ verzichtet, zugunsten einer taktilen, atmosphärischen Erfahrung. Aus geschosshohen Projektionsflächen im Projektstadium wurden geradezu ängstlich kleine. Im Vordergrund steht die sinnliche Landschaft, mit der sich die Kleidung und Accessoires von Prada, die Architektur, die Regale, Möbel, Leuchtkörper vermischen: Es gibt Lack, Pelz, gegossenes Fiberglas, Leder, mit Fiberglas überzogenes Kunstharz, poröse Eiche, perforierte Nirosta-Platten, Baumwolle, Schaumstoff, Nylon. Nicht nur der Mix aus hyper-künstlich und hyper-natürlich, sondern die Koexistenz von fest und lose, warm und kalt, glatt und rau, haarig und abweisend, weich und hart tragen zu einer Art von Auflösungserscheinung der architektonischen Strukturen bei. Dazu kommt eine für Kommerzarchitektur typische Auflösung des Raums: Das Haus ist als ein Ein-Raum-Haus konzipiert, nur die Spitze des Kristalls (Technikgeschoss) ist nicht zugänglich. Sonst ist das Konzept spürbar gemacht: Aussparungen der Decken neben den horizontalen Röhren schaffen mehrgeschossige Bezüge und einen um die vertikalen Kerne und horizontalen Röhren fließenden Raum. Den Innenraum unterteilen drei schmale, an den Ecken abgerundete vertikale Kerne, die sich stellenweise zu Regalen ausweiten. Weiter gibt es drei horizontale, im Schnitt rhombenförmige Röhren, die den 11 Bau von Fassade zu Fassade durchdringen (Umkleideräume und erweiterte Regale). Jedes dieser Elemente funktioniert immer auch als strukturelles Element, Herzog & de Meuron bezeichnen den Bau als ihren ersten, bei dem Struktur, Raum und Fassade eine Einheit bilden. Alles in allem sind die Elemente so platziert, dass die Konsumenten nicht zwischen den einzelnen Ebenen unterscheiden können, sondern einen kontinuierlichen Raum wahrnehmen. Verstärkt wird der Effekt des Enthobenseins oder der Verzauberung noch durch die Wirkung der Glaspaneele, denn die verschiedenen Geometrien generieren eine Unzahl von Reflexen, die den Besucher mit ständig wechselnden Bildern beliefern, sowie den Einblick von außen abwechselnd gestatten und verweigern. In Summe sind es traditionelle Mittel neu interpretiert, um eine quasisakrale Stimmung zu erzeugen: illuisionistische Effekte, dramatische Raumerweiterungen, Durchblicke und Lichtwirkungen. Neben der dichten räumlich-atmosphärischen Wirkung kommt es zu einer gezielten Verschmelzung von Marke und Architektur: das trademark der Marke Prada ist der erfinderische Einsatz von dekontextualisierten Materialien und technologisch innovativen Stoffen. Architektur wird hier zu einer Markenlandschaft, die neben intensiven Erlebnissen, die eine wiederholte Einschreibung eines bestimmten Verhaltensstils erzeugen möchten, ein symbolhaftes Bild der Firmenphilosophie bietet, um Markenpräsenz zu erhalten – die zeichenhafte, kristalline Form soll sich genauso einprägen wie die Marke Prada. Einerseits scheint mir mit diesem auf Markenidentität und atmosphärisch-räumliche Einheit zugespitzten Entwurf die „organische Einheit“ bzw. der innere Zusammenhang, für den der Stilbegriff auch steht, wieder eingeholt zu sein. Der durch Architektur und Marketing eingeschriebene Lebensstil bildet einen kollektiven, auf durch ritualisierte Handlungsschemata erzeugte Einschreibungen von Identität beruhenden Verständnishorizont, innerhalb dessen die Architektur Teil eines synästhetischen Gesamterlebnisses wird. Dass sie jedoch nicht gänzlich im performativen Ensemble des Konsums aufgeht, ist der Bewusstheit und Konsequenz ihrer Gestaltung zu verdanken. Die Wahl ihrer symbolischen Form – ein Kristall oder Diamant – ist ebenso deutlich bzw. archetypisch wie die der elementaren Hausform beimHausLeymen. 12 HdM: Prada Store Tokyo, 2003 Pedro Pablo Arroyo Albo und Johanna Truestedt Georg Simmel sieht den Diamanten als die beste Form des Schmucks an, und den Schmuck selbst als eine Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit zu erweitern oder steigern. Er schreibt von der „Radioaktivität des Menschen“, vom buchstäblichen Strahlen des Schmuckes, das sinnliche Aufmerksamkeit erregt und das Strahlen des Menschen verstärkt. „Der Diamant ist der zweckmäßigste Schmuck, denn er ist sozusagen selbst körperlos, seine Wirkung besteht nur in den Strahlen.“ (Simmel 1986) In ihrer überdeutlichen Symbolkraft – Kristall, Juwel, Schmuck mit all ihren Konnotationen von Luxus, Feier und Fest – wird die immersive, auf Verankerung von Verhaltensstilen angelegte Erlebnisatmosphäre wieder in Distanz gebracht. Der Benutzer wird, wie durch einen zusätzlichen Kommentar auf das im Augenblick Geschehende, in die Position des Betrachters gesetzt. Die Wahl des Kristalls zeigt den Versuch an, der Architektur einen Rest Eigenständigkeit im Erlebnis des Konsums zu erhalten, bzw. in der Inszenierung des Konsums ein Stück Selbst-Inszenierung mit hineinspielen zu lassen. 13 Literatur: Bayer, Joseph (1919), „Moderne Bautypen“ (1886). In: Ders., Baustudien und Baubilder, Schriften zur Kunst, ed. Robert Stiassny. Jena: 280–288. Berlage, Hendrik Petrus (1908), Grundlagen und Entwicklung der Architektur: Vier Vorträge gehalten im Kunstmuseum zu Zürich. Rotterdam und Berlin. Blumenberg, Hans (1960), „Die Metaphorik der ‚nackten’ Wahrheit“. In: Paradigmen zu einer Metaphorologie. Archiv für Begriffsgeschichte 6/6: 7–142. Böhme, Gernot (1995), Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik. Frankfurt a.M. Bourdieu, Pierre (1974), Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt a.M. Buchanan, Peter (1991), „Swiss Essentialists“. In: Architectural Review 1127: 13–19. Butler, Judith (1990), „Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist Theory“ (1988). In: Sue-Ellen Case (ed.), Performing Feminism. Feminist Critical Theory and Theatre. Baltimore und London: 270–282. Chance, Julia (2001), „The Face of Jacques Herzog”. Architectural Design 71/6: 48–53. Fischer-Lichte, Erika (2001), Ästhetische Erfahrung. Das Semiotische und das Performative. Tübingen. Fausch, Deborah u.a. (ed) (1994), Architecture: In Fashion. New York. Fischer-Lichte, Erika (2004), Ästhetitk des Performativen. Frankfurt a.M. Frampton, Kenneth (1995), „In der (De)-Natur der Werkstoffe: Bemerkungen zum Stand der Dinge“. Daidalos 56: 12. Frei, Hans (1996), „Neuerdings Einfachheit“. In: Karin Gimmi und Max Bill (ed.), Minimal Tradition. Baden: 113–131. Fried, Michael (1995), „Art and Objecthood“. In: Gregory Battcock (ed.), Minimal Art. A Critical Anthology. Berkeley und Los Angeles: 116–147. Goffman, Erwing (1959), The Presentation of Self in Everyday Life. New York. Gumbrecht, Hans Ulrich (2001), „Produktion von Präsenz, durchsetzt mit Absenz“. In: Josef Früchtl und Jörg Zimmermann (ed.): Ästhetik der Inszenierung. Frankfurt a.M: 63– 76. Herzog, Jacques (1982), „Das spezifische Gewicht der Architektur“. archithese 2: 39–42. Herzog, Jacques (1993), „A conversation with Jacques Herzog“. In: Jeffrey Kipnis (ed.), Herzog and de Meuron 1983–1993. Madrid. Herzog, Jacques und Pierre de Meuron (1996), „Passionate Infidelity”. In: Gerard Mack (ed.): Herzog & de Meuron 1989–1991. Basel. Hoffmann, Detlef (2000), „Authentische Erinnerungsorte“. In: Hans-Rudolf Meier und Marion Wohlleben (ed.), Bauten und Orte als Träger von Erinnerung. Die Erinnerungsdebatte und die Denkmalpflege. Zürich: 31–46. Kinney, Leila W (1999), „Fashion and Fabrication in Modern Architecture“. In: JSAH 58/3: 472–481. Loos, Adolf (1987), „Architektur“. In: Ders., Trotzdem. 1900–1930. Wien: 90–104. Mikunda, Christian (2002), Marketing spüren. Willkommen am Dritten Ort. Frankfurt a.M. und Wien. Niehues-Pröbsting, Heinrich (2001), „Kleiderprobleme“. In: Gérart Raulet und Burghart Schmidt (ed.), Vom Parergon zum Labyrinth. Wien, Köln und Weimar: 133–150. Oechslin, Werner (1994), Stilhülse und Kern. Zürich. 14 Platon (1961), Sämtliche Werke, in der Übersetzung von Friedrich Schleiermacher. Hamburg. Reichlin, Bruno (1988), „Objekthaft“. In: Herzog & de Meuron, Architektur Denkform, ed. Architekturmuseum Basel. Basel: 20–27. Schulze, Holger (2000), Das aleatorische Spiel. München. Semper, Gottfried (1977), Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder praktische Ästhetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde. Erster Band: Die textile Kunst. Nachdr. der Ausg. Frankfurt a.M. 1860. Mittenwald. Shusterman, Richard (2001), „Tatort: Kunst als Dramatisieren“. In: Josef Früchtl und Jörg Zimmermann (ed.), Ästhetik der Inszenierung. Frankfurt a,M: 126–143. Simmel, Georg (1986), „Psychologie des Schmucks“ (1908). In: Heinz-Jürgen Dahme und Otthein Rammstedt (ed.), Schriften zur Soziologie. Eine Auswahl. Frankfurt a.M: 159– 166. Steinmann, Martin (1988), „Hinter dem Bild: nichts“. In: Herzog & de Meuron, Architektur Denkform, ed. Architekturmuseum Basel. Basel: 14–19. Ursprung, Philip (2002), „Herzog & de Meuron ausstellen”. In: Ders. (ed.), Herzog & de Meuron. Naturgeschichte. Montreal: 13–40. Wang, Wilfried (1992), Herzog & de Meuron. Basel. Wigley, Mark (1995), White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture. Cambridge. Zumthor, Peter (1998), „Eine Anschauung der Dinge“. In: Ders., Architektur Denken. Baden: 8–26.