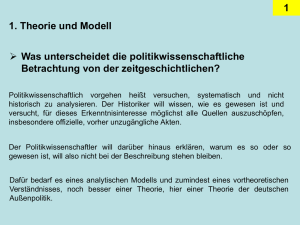der Publikation - Hanns-Seidel
Werbung
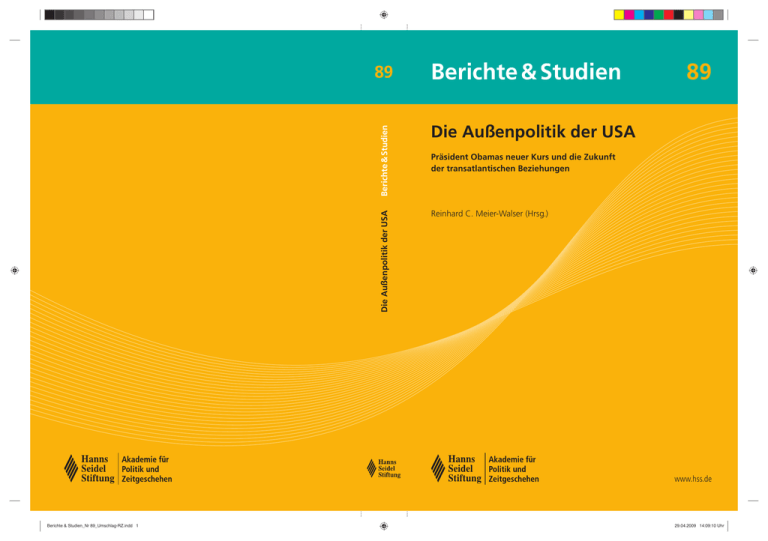
Berichte & Studien Berichte & Studien Die Außenpolitik der USA Die Außenpolitik der USA 89 Reinhard C. Meier-Walser (Hrsg.) 89 Präsident Obamas neuer Kurs und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen www.hss.de Berichte & Studien_Nr 89_Umschlag-RZ.indd 1 29.04.2009 14:09:10 Uhr Berichte & Studien 89 Die Außenpolitik der USA Präsident Obamas neuer Kurs und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen Reinhard C. Meier-Walser (Hrsg.) ISBN 978-3-88795-344-7 ©2009 Hanns-Seidel-Stiftung, München www.hss.de Vorsitzender: Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair, Staatsminister a.D. Hauptgeschäftsführer: Dr. Peter Witterauf Redaktion: Dr. Reinhard C. Meier-Walser (Chefredakteur, v.i.S.d.P.) Barbara Fürbeth M.A. (Redaktionsleiterin) Verena Hausner (Stv. Redaktionsleiterin) Susanne Berke, Dipl.-Bibl. (Redakteurin) Claudia Magg-Frank, Dipl.sc.pol.Univ. (Redakteurin) Marion Steib (Redaktionsassistentin) Druck: Fuchs Druck GmbH, Miesbach Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Redaktion reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Inhaltsverzeichnis Hans Zehetmair Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg Zum Geleit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Reinhard C. Meier-Walser Kurskorrekturen US-amerikanischer Außenpolitik nach dem Wechsel von George Bush zu Barack Obama – Eine Einleitung . . . . . . . . . . . . . 10 I. Kontinuität und Wandel US-amerikanischer Außenpolitik Stefan Fröhlich Whither USA – Taumelt der „sanfte Hegemon“? . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Georg Schild Ready to Lead Once More? Die Zukunft des amerikanischen Führungsanspruchs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Klaus Dieter Schwarz Ein neuer globaler Multilateralismus der USA nach dem Ende der Bush-Ära? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Werner Link Amerikanische Außenpolitik im Konzert der Mächte statt hegemonial-imperialer Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Christian Hacke Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume für die Außenpolitik von Präsident Obama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Johannes Urban Leader of a New America – Außenpolitik im Wahlkampf von Barack Obama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Patrick Keller Hegemonialstrategie: Zur Kontinuität amerikanischer Außenpolitik seit Ende des Kalten Krieges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Martin Reichinger Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration – eine Bilanz im Zeichen des allianzinternen Sicherheitsdilemmas . 121 Ulf Gartzke Die Obama-Administration: Ouvertüre zu einem neuen Amerika? . . . 138 4 Inhaltsverzeichnis II. Neue internationale Herausforderungen für die USA und Europa James W. Davis Washingtons Krieg gegen den Terror – Lehren aus den Fehlern der Bush-Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Johannes Varwick USA, Mulilateralismus und internationale Organisationen – Das Spannungsfeld der Mandatierung internationaler Zwangsgewalt . 161 Svenja Sinjen Raketenabwehr für die NATO – Warum die Europäer Obama ermuntern sollten, Bushs Weg zu Ende zu gehen . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Carlo Masala No change at all – Die NATO-Politik der Obama-Administration . . . . 186 Klaus Naumann Sicherheit ohne die USA? Die NATO in der Perzeption Europas . . . . 197 Lothar Rühl Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Gottfried-Karl Kindermann Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik im ostasiatisch-pazifischen Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Alexander Wolf US-Militärinterventionen im Ausland – Renaissance der PowellDoktrin? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Jens van Scherpenberg Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems . . . . . . . . . 262 Ralph Rotte/Christoph Schwarz Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? Die USA und Europa angesichts der neuen globalen Sicherheitsrisiken und der Notwendigkeit einer Grand Strategy . . . . . . . . . . . . . 282 Inhaltsverzeichnis 5 III. Perspektiven transatlantischer Beziehungen Tilman Mayer Die Rolle von Ideen, Normen und Interessen in der transatlantischen Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Helga Haftendorn Strukturelle Probleme im transatlantischen Beziehungsgefüge . . . . . 308 Thomas Jäger Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen eurotransatlantischen Strategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 Christian Schmidt Die deutsch-amerikanische Sicherheitspartnerschaft . . . . . . . . . . . . . 334 Alice Neuhäuser Wie „special“ ist die „special relationship“ zwischen Washington und London? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet Frankreichs neue NATO-Politik: Hebel für eine Neuausrichtung des Bündnisses? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Reinhard Wolf Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen . . . 375 Beate Neuss Asymmetrische Interdependenz: Warum brauchen Europa und die USA einander? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Andreas Falke Klimaschutz- und Handelspolitik – neue transatlantische Konstellationen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Edwina S. Campbell Obama‘s „Eisenhower Moment“: American Strategic Choices and the Transatlantic Defense Relationship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 Stephan Bierling Europa und die USA – die strategische Partnerschaft des 21. Jahrhundert? Ein Gespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Vorwort Barack Obama, der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, sieht sich seit seinem Amtsantritt im Januar 2009 mit einer ganzen Fülle gewaltiger Herausforderungen konfrontiert: Während im Inneren der drastische Abschwung der amerikanischen Wirtschaft mit weitreichenden Folgen für das gesamte sozio-ökonomische System gewaltiger Anstrengungen bedarf, um erfolgreich und nachhaltig bewältigt werden zu können, sehen sich die USA auch im internationalen Umfeld einer Situation gegenüber, die alles andere als komfortabel ist. Neben den aktuellen Problemen der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise stehen hier vor allem die längerfristigen sicherheitspolitischen Fragestellungen im Vordergrund: Die USA führen gleichzeitig Krieg im Irak und in Afghanistan und sie sind ein Primärziel des weltweiten fundamentalistischen Terrorismus. Daneben sind sie mit der drohenden „Talibanisierung“ des Atomwaffenstaates Pakistan konfrontiert. Der Iran steht möglicherweise kurz davor, die nukleare Schwelle zu überschreiten. Die Beziehungen zu Moskau sind in einem kritischen Zustand. Die Krisenherde der Weltpolitik werden immer zahlreicher und die USA als Noch-Weltmacht Nr. 1 sehen sich mehr und mehr von aufstrebenden Mächten der sog. „zweiten Welt“ (Parag Khanna), wie etwa China, Indien, Brasilien, Mexiko, Indonesien und andere Schwellenländer genannt werden, herausgefordert. Wie reagieren die USA auf diese Veränderungen, Herausforderungen und Risiken? Welche außenpolitischen Kurskorrekturen nimmt der neue US-Präsident vor, der im Wahlkampf einen grundlegenden politischen Wandel („Change“) in allen Feldern, also auch den Außenbeziehungen, verheißen hatte? Aus europäischer Perspektive und insbesondere aus der Sicht der Bundesrepublik Deutschland, für die die Schutzmacht USA seit jeher der wichtigste internationale Sicherheitspartner war, sind die außenpolitische Strategie und Richtung Washingtons von primärer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat die Akademie der Hanns-Seidel-Stiftung, die die amerikanische Außenpolitik und die Entwicklung der transatlantischen Beziehungen traditionell als einen der Schwerpunkte ihrer Projektarbeit kontinuierlich verfolgt und analysiert, führende Vertreter der sogenannten „Strategic Community“ eingeladen, um die Frage des neuen außenpolitischen Kurses Washingtons seit dem Amtsantritt Präsident Obamas aus verschiedenen Perspektiven und unter Berücksichtigung des breiten Spektrums damit zusammenhängender relevanter Aspekte für die transatlantischen Beziehungen zu untersuchen. Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair Staatsminister a.D. Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung Geleitwort Die historisch erwachsene freundschaftliche Beziehung zwischen Deutschland und den USA sind, wie in jeder Partnerschaft, nicht immer frei gewesen von Divergenzen und Dissonanzen. Dennoch war und ist die Grundlage unserer engen Zusammenarbeit nie entfallen, da diese auf gemeinsamen Werten und Interessen in zahllosen Bereichen politischen Handelns wurzelt. Es liegt nun gleichermaßen an Amerikanern wie auch an uns Europäern, das transatlantische Verhältnis mit neuem Schwung auszugestalten. Nach der Wahl Barack Obamas zum Präsidenten der Vereinigten Staaten wird wohl zur Begegnung der zahlreichen Herausforderungen mehr Verlässlichkeit, Kontinuität und „commitment“ von Nöten sein, als ein Versprechen vom „change“ vermuten lässt. Zweifelsohne kann man schon heute einige inhaltliche wie atmosphärische Veränderungen beobachten. Obama hat wiederkehrend sein Bekenntnis zu den transatlantischen Beziehungen sowie zum Multilateralismus betont. Dies bedeutet in der Konsequenz aber auch, dass der Wunsch nach mehr gemeinsamen Handeln auch mehr Mitarbeit der einzelnen Partner erfordern kann, also auch von uns Deutschen. Welche Zielsetzungen und Richtlinien sollen demzufolge das transatlantische Verhältnis bestimmen und leiten? Birgt Obamas außenpolitischer Kurs die Absicht in sich, Außenpolitik unter einer anderen Prämisse zu betreiben und wieder verstärkt auf diplomatische Bemühungen und multilaterale Kooperation zu setzen? Die Herausforderungen und außenpolitischen Probleme im ersten Jahr von Obamas Präsidentschaft sind riesig. Ein multilaterales Staatensystem mit unübersichtlichen transnationalen Akteursstrukturen generiert zahlreiche sicherheitspolitische Herausforderungen. Asymmetrische Konflikte durch den transnationalen Terrorismus, der globale Klimawandel, Ressourcenfragen oder die Proliferation von Massenvernichtungswaffen bedrohen alle freien Völker. Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise und die Auswirkungen der ökonomischen Globalisierung erfordern eine ordnungspolitische Antwort, die nur im Rahmen multilateraler Organisationen gegeben werden kann, in denen die transatlantische Gemeinschaft ihr besonderes Gewicht und Verantwortung einbringen muss. Gerade vor diesem Hintergrund setzt sich der Eindruck durch, dass die USA stärker auf die internationale Zusammenarbeit angewiesen sind, als das bisher der Fall gewesen ist. 8 Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg So ist es nur folgerichtig, wenn man die Bedeutung internationaler Regime und der reformbedürftigen Vereinten Nationen hervorhebt. Gleichwohl bleibt eine der Kooperation verpflichtete transatlantische Allianz als unbedingter Stabilitätsanker bestehen, die weit über ihre geographische Lage hinaus positiv auf die internationale Sicherheitsarchitektur wirken kann. Nur um solches bewirken zu können, muss auf beiden Seiten des Atlantiks die Stärkung der bewährten Gemeinschaft betrieben werden. Barack Obama teilt offenbar diese Einsicht und legte bereits während seiner Kampagne ein klares Bekenntnis ab, die starke Partnerschaft der USA mit Europa wiederherzustellen. In sicherheitspolitischer Hinsicht wird man dazu sicherlich der NATO entsprechende Perspektiven geben müssen, aber auch die Vereinten Nationen müssten unter diesem Aspekt durch konstruktive Initiative und Unterstützung der USA reformiert werden. Manches dabei erscheint nur realistisch unter einer starken Position der USA. Erfolg ist jedoch nur bei Einbeziehung aller verantwortungsbewussten und maßgeblichen Akteure zu erwarten, hier sind v.a. die rasant aufstrebenden Schwellenländer Indien und China zu nennen, die vorrangig bei den weltweiten finanz- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen eine gewichtige Rolle spielen. Man muss sich unbedingt vor Augen führen, dass es ein Irrweg wäre, bewährte Formen westlicher Zusammenarbeit aufzugeben. Vor dem Hintergrund gemeinsamer Interessen beim Klimaschutz, der Energiesicherheit und Ressourcenversorgung, bei der Frage, wie man das iranische Atomprogramm am effektivsten eindämmen kann, oder schließlich beim Afghanistaneinsatz ist das Formulieren gemeinsamer Ziele essenziell. Neben aller Euphorie und Sympathie für Präsident Obama scheint es mithin angebracht, Amerikas außenpolitische Ziele genauer zu analysieren. Die Obama-Administration wird nicht müde, die Welt von der Gegensätzlichkeit der konfrontativen und härtestilisierenden Politik des Amtsvorgängers George W. Bush zu überzeugen. Die in Aussicht gestellte Schließung des Gefangenenlagers Guantánamo, die Dialogbereitschaft gegenüber sog. „Schurken“-Staaten oder die klimapolitischen Ziele werden als Aspekte des vielbemühten Wandels ausgegeben. Das nach dem verheerenden Irak-Krieg bemühte multilaterale Vorgehen scheint ein Vorgehen der amerikanischen Außenpolitik darzustellen, das vorrangig auf Dialog und Kommunikation setzt und viele Akteure im Handeln einbezieht. Der wiederentdeckte Multilaterlismus der USA macht sich aber auch unweigerlich im transatlantischen Verhältnis bemerkbar. Es ist absehbar, dass die Rolle der europäischen Verbündeten und somit auch Deutschlands eine größere und damit lastenreichere wird. Zum Geleit 9 In Europa sollte man sich darüber im Klaren sein, dass auch ein Präsident Obama an die erste Stelle seines außenpolitischen Handelns die amerikanischen Interessen stellt. Inwieweit eine erste Kostprobe dieser Einschätzung die neue Afghanistanstrategie der Obama-Administration gelten kann, die wohl auch die Europäer stärker in die Pflicht nehmen wird, wird sich zeigen. Die „Obamania“ ist bisher in der breiten Wahrnehmung nicht verflogen. Präsident Obamas bisherigen Erlasse zeigen, dass der vielfach betonte Bruch mit der Politik der Vorgängerregierung sehr viel stärker in der Innenpolitik wirkt als in der Außenpolitik. Diese noch aus dem Wahlkampf herwirkende Abgrenzung ist von großem symbolischem Wert: einerseits natürlich für viele Amerikaner, die auf eine rasche Überwindung der tiefen Spaltung des Landes hoffen, daneben aber auch für den Rest der Welt, insbesondere für muslimische Staaten. Bekanntlich besteht Politik auch zu einem nicht unerheblichen Teil aus Zeichen und Symbolik. Eine entsprechende größere symbolische Distanzierung von George W. Bush ist in Teilen auch zu konstatieren. Ohne jede Frage ist es aus dringlichen sicherheitspolitischen, wirtschaftsund finanzpolitischen Gründen erforderlich, sich intensiv, freundschaftlich und in gegenseitigem Respekt der Erneuerung des transatlantischen Projekts zu widmen. Für die deutsche Regierung ergibt sich daraus die Verantwortung, durch entschiedenes und verantwortungsvolles Handeln die neue transatlantische Partnerschaft entscheidend mitzugestalten. Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, MdB Bundesminister für Wirtschaft und Technologie Kurskorrekturen US-amerikanischer Außenpolitik nach dem Wechsel von George Bush zu Barack Obama Eine Einleitung Reinhard C. Meier-Walser „Starker Rückhalt für Obama“, titelte die „Neue Zürcher Zeitung“ am 29. April 2009, dem 100. Tag des 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten im Amt. Obwohl damit in erster Linie die Zustimmung zu Barack Obamas wirtschaftspolitischem Reformkurs in breiten Kreisen der US-amerikanischen Bevölkerung gemeint war, kann diese Schlagzeile pauschal auch für die Position der europäischen Bündnispartner der USA gelten, die insbesondere die ersten außenpolitischen Weichenstellungen der neuen politischen Führung in Washington sehr aufmerksam und in der hoffnungsvollen Erwartung einer substanziellen Verbesserung transatlantischer Beziehungen verfolgt hatten. Das auf gemeinsamen Interessen und Werten basierende Partnerschaftsund Freundschaftsverhältnis zwischen den USA und Europa, institutionell verankert vor allem in der 1949 gegründeten Nordatlantischen Allianz, in deren Kernartikel 5 sich die Mitgliedsstaaten gegenseitigen Beistand im Falle eines Angriffes von außen zusichern, hatte im Laufe der Irakkrise der Jahre 2002/2003 eine schwere Phase der Belastung zu durchstehen. Obwohl sich nach dem Abtreten von Bundeskanzler Gerhard Schröder und Frankreichs Präsident Jacques Chirac – der beiden europäischen Hauptantagonisten George Bushs in der Irakkrise – von der politischen Bühne die transatlantischen Beziehungen atmosphärisch wieder spürbar verbesserten, konnten die tiefen Risse, die damals entstanden waren, auch während der letzten Amtsjahre von Präsident Bush nicht mehr vollständig gekittet werden. Nicht zuletzt aus diesem Grunde wurde der Präsidentschaftswahlkampf in den USA während des Jahres 2008 in Europa mit außergewöhnlich großem Interesse verfolgt, wobei in der breiten Berichterstattung der Medien ab dem Zeitpunkt der Nominierung sowohl des Republikanischen als auch des Demokratischen Präsidentschaftskandidaten vor allem die Frage im Vordergrund stand, mit welchen außen- und bündnispolitischen Konsequenzen die Europäer im Falle eines Wahlsieges Barack Obamas bzw. John McCains zu rechnen hätten. Kurskorrekturen US-amerikanischer Außenpolitik 11 Im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2008, insbesondere nach der Wahlentscheidung am 4. November und der überraschend zügig darauf folgenden Zusammenstellung des außen- und sicherheitspolitischen Teams der neuen Administration, formten sich die Perzeptionen, Perspektiven und Szenarien, die seriöse europäische Experten amerikanischer Außenpolitik entwickelten, allmählich zu einem Vorstellungsbild der Außenpolitik der USA unter dem neuen Präsidenten Obama, der am 20. Januar 2009 den Amtseid leisten würde. Dieses Bild lässt sich in einer Kombination folgender sechs Punkte zumindest vage zusammenfassen: 1. Aufgrund der schwersten wirtschaftlichen Krise seit der Großen Depression, in der die USA sich um die Jahreswende 2008/2009 befänden, gelte das politische Hauptaugenmerk des neuen US-Präsidenten in erster Linie einem wirtschaftspolitischen Kurswechsel, zumal dies auch vom amerikanischen Volk, das Obama mit großer Mehrheit das Vertrauen ausgesprochen hatte, erwartet werde. 2. Ungeachtet dieser generellen Priorität zur Lösung der gewaltigen Wirtschaftskrise und zur Lösung der damit zusammenhängenden sozialen Probleme im Inneren erfordere die prekäre internationale Situation auch rasche außen- und sicherheitspolitische Entscheidungen der neuen politischen Elite in Washington. Die USA, so der Tenor der Analysen, führten nicht nur im Irak und in Afghanistan gleichzeitig zwei zermürbende Kriege; sie seien daneben mit der drohenden „Talibanisierung“ des bereits nuklear bewaffneten Pakistans, mit der als Bedrohung der internationalen Sicherheit empfundenen Perspektive des bevorstehenden Überschreitens der nuklearen Schwelle Irans sowie mit einer im Zuge der Georgien-Krise einhergegangenen Verschärfung des ohnehin gespannten Verhältnisses zu Moskau konfrontiert. Neben diesen konkreten und aktuellen internationalen Herausforderungen Washingtons befänden sich die USA ferner in einem seit dem 11. September 2001 andauernden globalen Kampf gegen den fundamentalistischen Terrorismus. Von grundlegender und längerfristiger Natur sei insbesondere der Transformationsprozess globaler Machtpotenziale und -kategorien, in dessen Zuge Staaten der sogenannten „Zweiten Welt“, wie Parag Khanna und andere Analytiker weltpolitischer Entwicklungen aufstrebende Schwellenländer mit wertvollen Bodenschätzen und hohen Wachstumsraten bezeichnen, die „Noch-Weltmacht-Nr.1“ in den Aktionsfeldern der Weltpolitik und Weltwirtschaft herausforderten. 3. Das außenpolitische Team Barack Obamas – darunter Vizepräsident Joe Biden, der langjährige Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des USSenates, Außenministerin Hillary Clinton, der bereits in der Bush-Administration amtierende Verteidigungsminister Robert Gates, der Nationale Sicherheitsberater General James Jones und die mit Kabinettsrang ausge- 12 Reinhard C. Meier-Walser stattete UNO-Botschafterin Susan Rice – verkörpere eine kluge Kombination unterschiedlicher außen- und sicherheitspolitischer Mittel, Stile und Formen der Zielverfolgung, ganz im Sinne der von Obama verfochtenen „Smart Power-Strategie“, die alle verschiedenen Instrumente amerikanischer Macht nutze und ins Gleichgewicht bringe: Militär und Diplomatie, Geheimdienste und Rechtsstaatlichkeit, ökonomische Kosten-Nutzen-Relationen und moralische Werte. 4. Da außen- und sicherheitspolitische Grundsatzentscheidungen Washingtons in der Regel von einem breiten Konsens der politischen Eliten getragen würden, sei eine 180-Grad-Kehrtwendung in zentralen internationalen Fragen der USA nach dem Ende der Ära Bush nicht generell zu erwarten. Eine solide, von der Mehrheit der Bevölkerung wie des Kongresses gestützte Verankerung seiner Außen- und Sicherheitspolitik werde Barack Obama auch deshalb anstreben, weil sein primäres außenpolitisches Ziel, die Erneuerung bzw. Wiederherstellung der amerikanischen Führungsrolle in der Welt, gerade angesichts der gegenwärtigen Kumulation der schweren inneren Krise der USA und der diversen internationalen Herausforderungen der Vereinigten Staaten äußerst ambitioniert sei. 5. Ein deutlicher Unterschied zur Außenpolitik der Bush-Regierung sei von Obama allerdings in einer tendenziellen Abkehr vom Unilateralismus und Hinwendung zu Multilateralismus zu erwarten. Dies werde zum einen Washingtons Haltung gegenüber internationalen Einrichtungen (z.B. UNO) und Regimen (z.B. Kyoto-Protokoll), zum anderen die Haltung der USA gegenüber ihren internationalen Partnern (z.B. den europäischen NATO-Staaten) prägen. Der zu erwartende neue „instrumentelle“, nicht „prinzipielle“, Multilateralismus der Obama-Regierung1 bedeute für die europäischen Partner der USA einerseits mehr Mitsprache, Einbindung und Konsultation, gleichzeitig aber auch, dass Obama die Europäer stärker als bisher in die Verantwortung zur Bewältigung gemeinsamer weltpolitischer Herausforderungen nehmen werde.2 6. Im Sinne einer konsequenten Umsetzung der erwähnten „Smart Power-Strategie“ zur effektiveren Verfolgung außen- und sicherheitspolitischer Ziele der USA sei auch zu erwarten, dass Barack Obama systematisch versuchen werde, Schwachstellen und Defizite des außenpolitischen Kurses seines Amtsvorgängers systematisch zu beseitigen. Dazu gehöre, wie James Davis detailliert zeigt, vor allem Washingtons „Krieg gegen den 1 2 Vgl. dazu insbesondere die Beiträge von Klaus-Dieter Schwarz und Johannes Varwick in diesem Band. Auf diese mögliche Ambivalenz der transatlantischen Beziehungen unter dem Vorzeichen eines neuen Multilateralismus Washingtons unter Präsident Obama hat insbesondere Peter Rudolf in Schriftenreihen der Stiftung Wissenschaft und Politik frühzeitig hingewiesen. Kurskorrekturen US-amerikanischer Außenpolitik 13 Terror – Lehren aus den Fehlern der Bush-Administration“, nicht zuletzt die Lösung des rechtlichen Problems des Gefangenenlagers Guantanamo. Das vage Bild der neuen US-amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Barack Obama, das die synoptische Zusammenschau dieser sechs Punkte ergibt, entstand – wie erwähnt – im Vorfeld der Vereidigung des 44. Präsidenten am 20. Januar 2009. Seither sind 100 Tage vergangen, die es ermöglichen, dieses vor Monaten entwickelte, vage und zwangsläufig spekulative Bild durch eine erste vorläufige Bilanz zu ersetzen. Gleichzeitig soll aber wieder ein diesmal durch die Beobachtung und Analyse der von Präsident Obama bereits in den ersten drei Monaten seines Wirkens im Weißen Haus vorgenommenen wichtigen außenpolitischen Weichenstellungen genährter Blick in die Zukunft US-amerikanischer Außenpolitik und der transatlantischen Beziehungen geworfen werden, zumal die perspektivische Betrachtung und Auseinandersetzung mit US-amerikanischer Außenpolitik für die Konzeption und Gestaltung sowohl der einzelstaatlichen Außenpolitiken innerhalb Europas als auch für die Gemeinsame Europäische Außen- und Sicherheitspolitik selbst von enormer Bedeutung ist – dies zumal in Zeiten gewaltiger internationaler (sicherheitspolitischer, wirtschaftspolitischer, energieversorgungspolitischer etc.) Herausforderungen, die eine gemeinsame Strategie der USA und Europas erfordern, um erfolgreich bewältigt werden zu können. In diesem Sinne hat die Hanns-Seidel-Stiftung einschlägig ausgewiesene Vertreter der transatlantischen „Strategic Community“ eingeladen, an diesem perspektivisch angelegten Band mitzuwirken. Zu den Autorinnen und Autoren gehören sowohl arrivierte Forscherpersönlichkeiten, die die Außenpolitik der USA und die transatlantischen Beziehungen bereits zum Teil seit Jahrzehnten verfolgen, als auch junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die durch neue Forschungsstrategien und -ansätze sowie durch spezifische Analysen und Interpretationen von Teilaspekten des hier im Mittelpunkt stehenden Sujets die diesbezügliche Diskussion wertvoll bereichern. Stimmen der Politik (Bundesminister Karl-Theodor zu Guttenberg, Staatssekretär Christian Schmidt, Staatssekretär a.D. Lothar Rühl) sind ebenso vertreten wie Expertisen militärischer Fachleute (General Klaus Naumann, Edwina Campbell), wodurch eine multiperspektivische, mehrdimensionale und interdisziplinäre Betrachtung gewährleistet werden soll, die dem komplexen Gegenstand der amerikanischen Außenpolitik und der transatlantischen Beziehungen angemessen ist. Die meisten der im vorliegenden Sammelband vertretenen Autorinnen und Autoren trafen sich nach dem Sieg Barack Obamas in den jüngsten Präsidentschaftswahlen in verschiedenen einschlägigen Expertenveranstaltungen der Hanns-Seidel-Stiftung in Wildbad Kreuth, München und 14 Reinhard C. Meier-Walser Berlin mit dem Herausgeber des Bandes und der Leiterin des Lektorates der Akademie, um die thematische Fokussierung der Beiträge zu erörtern, die Schwerpunkte der Analysen abzustimmen und Redundanzen zu vermeiden. Im Rahmen dieser wertvollen und nützlichen Vorbesprechungen wurde auch vereinbart, dass die Manuskripte Ende Januar 2009, also kurz nach der Übernahme der Amtsgeschäfte durch die Regierung Obama, eingereicht werden sollten. Whither USA – Taumelt der „sanfte Hegemon“? Stefan Fröhlich Der 44. Präsident der USA übernimmt das wohl wichtigste politische Amt in der Welt in einer Phase, da die USA wie eine Weltmacht im Niedergang wirken. Politisch und militärisch, aber auch moralisch sind die USA im Begriff, ihre Führungsrolle zu verspielen. In Europa und weiten Teilen der Welt sehen viele angesichts der andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise und des enormen Haushaltsdefizits, zweier erdrückender Kriege im Irak und Afghanistan, vor allem aber aufgrund des weltweiten Imageverlusts in Folge der Anti-Terror-Politik George Bushs das Land im Abstieg begriffen. VN-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach von der „neuen Wirklichkeit“ und neuen Zentren der Macht und der Führung wie China, Russland, Brasilien und Indien, oder auch Regionalblöcken wie der EU, die an politischem und wirtschaftlichem Einfluss hinzugewinnen und so die Führungsposition der Supermacht USA in Frage stellen. 1. Die Debatte um die Zukunft der amerikanischen Supermacht Selbst in Washington mehren sich die Stimmen der Skeptiker, die nicht nur das nahezu zwei Jahrzehnte dominierende amerikanische Kapitalismusmodell mit seinem Dreisatz aus billigem Geld, freien Märkten und gigantischen Gewinnmargen am Ende sehen, sondern generell auf die Machtverschiebungen in den internationalen Beziehungen und das Ende des „unipolaren Momentes“ (Charles Krauthammer) verweisen. Fareed Zakaria, Chefredakteur von Newsweek, sieht die Welt auf ein – mit Ausnahme der militärischen Dimension – „postamerikanisches Zeitalter“ zusteuern, in dem sich der politische, finanzielle, soziale wie kulturelle Einfluss auf verschiedene Zentren und Akteure verteile.1 Ähnlich argumentieren Pharag Khanna, Leiter der Global Governance Initiative der New American Foundation, dessen Buch „The Second World“ ein Bild von der künftigen Weltpolitik zeichnet, in dem es drei Supermächte oder Imperien geben wird – neben den schwächer werdenden USA das unaufhaltsam aufsteigende China und, man höre und staune, die Europäische Union –, und Charles Kupchan, Azar Gat oder John Ikenberry und Thomas Wright von der Princeton University, die Amerikas künftige 1 Zakaria, Fareed: The Future of American Power: How America can survive the Rise of the Rest, in: Foreign Affairs 3/2008, S.18-43. 16 Stefan Fröhlich Stärke und Weltrolle allenfalls in einem gleichberechtigten Konzert mit Europa und Japan gegenüber den aufstrebenden BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) garantiert sehen.2 Der Tenor aller Bände ungeachtet von Finanz- und Wirtschaftskrise lautet übersetzt in etwa so: Die reale Schwäche der Weltmacht offenbart sich bereits seit längerem. Je mehr die USA sich verschulden und dafür anlegen müssen, das eigene Wirtschaftssystem zu stabilisieren, desto schwerer fällt es Washington, die selbst gewählte Rolle der Weltordnungsmacht auszuüben. Die Aushöhlung von Amerikas Vormachtstellung durch die genannten Aufsteiger beschleunigt sich vor allem in den Bereichen Politik und Wirtschaft, aber auch in der Kultur. Alles in allem wird eingeräumt, dass die USA zwar eine bedeutende, ja vielleicht die wichtigste Macht im Weltgefüge bleiben werden, die amerikanische Vorherrschaft aber vorbei sei. Multipolarität oder Nicht-Polarität („non-polarity“) lauten die Stichworte, gleichgültig wie sich Washington auch verhält. Durch eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik in der Vergangenheit, die Kriege in Afghanistan und im Irak, die die amerikanischen Truppen an die Grenzen der Belastbarkeit geführt haben, sei nicht nur der Ruf der USA in der Welt nachhaltig beschädigt, sondern seien auch immense humanitäre, finanzielle und diplomatische Kosten verursacht worden.3 Neben den USA werden daher die zuvor genannten Machtzentren künftig um geopolitischen Einfluss ringen, dabei werden insbesondere China und die EU dank ihrer politischen wie ökonomischen Anziehungskraft sukzessive Nachbarstaaten in ihren Einflussbereich ziehen. Für die USA hingegen bedeutet künftig jeder Vorstoß in diese Einflusssphären eine Schwächung ihrer Position, da ihre traditionelle Rolle als Ordnungsmacht dort nicht länger akzeptiert wird. Vielmehr muss Washington sich im wertfreien Wettbewerb der globalen Ordnungsmodelle neu positionieren und dabei vor allem auf strategische Allianzen mit den neuen einflussreichen Mächten setzen.4 Solchen Untergangsprophezeiungen stehen Analysen gegenüber, die darin ein Wiederholungsmuster gerade in Krisenjahren des Landes sehen 2 3 4 Parag, Khanna: The Second World. World Empires and Influence in the new Global World Order, New York 2008; Ders.: Waving Goodbye to Hegemony, in: The New York Times, 27.1.2008, www.newamerica.net/publications/articles/2008/waving_goodbye_hegemony_6604; Kupchan, Charles: The end of the American era, New York 2003; Gat, Azar: The Return of Authoritarian Great Powers, in: Foreign Affairs 4/2008, S.59-69; Ikenberry, John/Wright, Thomas: Rising Powers and Global Institutions, New York: The Century Foundation, 2.6.2008, www.tcf.org/publications/internationalaffairs/ikenberry.pdf Haas, Richard: The Age of Nonpolarity. What will follow U.S. Dominance, in: Foreign Affairs 3/2008, S.44-56. So auch Hachigian, Nina/Sutphen, Mona: Strategic Collaboration: How the United States can Thrive as other powers rise, in: The Washington Quarterly 4/2008, S.43-57. Whither USA – Taumelt der „sanfte Hegemon“? 17 und darauf verweisen, dass solche Szenarien sich bislang nie bewahrheitet hätten – zuletzt war dies Ende der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts der Fall, als Paul Kennedy in seinem Buch über den „Aufstieg und Fall großer Mächte“ vor dem Hintergrund des „Zwillingsdefizits“ in der Reagan-Ära und dem wirtschaftlichen Aufschwung Japans das Ende der US-Vorherrschaft prophezeite. Die Abgesänge beruhen demnach allzu sehr auf einem singulären Ereignis, dem Irakkrieg, der Ablehnung der Politik George Bushs und einem tiefen Missverständnis der Grundlagen, auf denen die unverändert robuste Machtposition der USA beruht.5 Tatsächlich verkennt die Euphorie über den im Zuge von Obamas Amtsantritt erwarteten außenpolitischen Wandel bzw. die geforderte Abkehr von der Politik Bushs vier entscheidende Punkte: Erstens unterscheidet sich Obamas politische Agenda in vielerlei Hinsicht weit weniger stark von der seines Vorgängers, als man in Europa bisweilen wahrhaben will. Zweitens sind die stereotypen Vorwürfe vom amerikanischen Unilateralismus und den fundamentalen außenpolitischen Differenzen im transatlantischen Verhältnis insofern überzogen, als beides sich bereits für die Clinton-Jahre nachweisen lässt;6 wenn überhaupt, ist es zutreffender, von einer Verschärfung des unilateralen Reflexes unter der Regierung Bush zu sprechen, welcher mit der Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001, insbesondere mit dem Präemptivschlag im Irak, sicherlich seinen vorläufigen Höhepunkt erfuhr. Drittens nahm Washington schon zu Beginn der zweiten Amtszeit Bushs den Dialog mit der Union wieder auf; immerhin besuchte Bush als erster Präsident die EU-Kommission in Brüssel.7 Viertens sind die Europäer seither zunehmend stärker in das internationale Krisenmanagement einbezogen worden: Mit dem Iran verhandelt die EU-Troika Frankreich, Großbritannien und Deutschland auch im Namen der USA. Während der Georgien-Krise war es zuletzt die französische Präsidentschaft, die mit Russland ein Abkommen zur Beendigung des Krieges schloss, während Washington auffällig im Hintergrund blieb. Beim EU-US-Gipfel in Washington 2007 verständigten sich beide Seiten auf einen Prozess der Vertiefung des transatlantischen Wirtschaftsraumes. Und als die Finanzkrise ausbrach, war nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa entscheidend, sondern auch die EU gewissermaßen der Schrittmacher, als auf beiden Seiten die finanziellen Rettungspakte geschnürt wurden. Am Ende folgte Washington Großbritannien und der Union, als man sich gar zu einer notwendigen Teilverstaatlichung der Kreditwirtschaft entschloss. 5 6 7 Lieber, Robert: Falling Upwards: Declinism. The Box set, in: World Affairs 2008, www.worldaffairsjournal.org/2008%20-%20Summer/full-Lieber.html Leffler, Melvyn: Bush’s Foreign Policy, in: Foreign Policy H 5/2004, S.22-28. Gordon, Philipp: The End of the Bush Revolution, in: Foreign Affairs 4/2006, S.75-86. 18 Stefan Fröhlich Ist Europas Wiederaufstieg das Ergebnis des gewachsenen Führungs- bzw. Mitgestaltungsanspruchs der EU oder die Konsequenz aus dem relativen Machtniedergang der USA? Ist der weltweit empfundene Niedergang real oder lediglich Ausdruck einer vorübergehenden Bescheidenheit in Washington angesichts der europäischen und neuen autokratischen Herausforderer sowie des weltweiten Imageverlustes des Landes? Wo stehen die USA zu Beginn der Amtszeit Obamas tatsächlich? Es ist unbestritten, dass das krisenbelastete Amerika aus Kapazitäts- wie Legitimationsgründen noch lange brauchen wird, um nach Irak zu seiner alten Führungsstärke zurückzufinden; schon deshalb wird es unter dem neuen Präsidenten zwangsläufig zu einer Zurücknahme des eigenen globalen Engagements kommen, was für Europäer wiederum bedeutet, dass die Forderungen nach einer „gerechteren“ Lastenteilung (höhere Verteidigungsausgaben) und mehr Einsatz seitens der EU (Irak und Afghanistan) lauter werden, als diesen lieb sein dürfte – daran lassen die Äußerungen Obamas jedenfalls keinen Zweifel.8 Es sind im Wesentlichen wiederum vier Entwicklungen, die zu diesem Punkt geführt haben: Erstens haben die Kriege im Irak und in Afghanistan unterstrichen, dass die militärische Suprematie der USA sich nicht automatisch in politische Erfolge übersetzen lässt. Zweitens suggeriert insbesondere der Aufstieg Chinas ein absehbares Ende Amerikas als führende Wirtschaftsmacht. Drittens nährt die globale Finanz- und Wirtschaftskrise die These von der mangelnden Nachhaltigkeit des amerikanischen Modells. Viertens schließlich erfordern die Realitäten der neuen Machtverhältnisse und die Zwänge der globalen Vernetzung auch von Amerika eine größere Anpassungsfähigkeit und eine Rückkehr zum Programm des „liberalen Internationalismus“ – jener traditionellen Verbindung von Diplomatie und militärischer Stärke, wie sie kennzeichnend war für die Außenpolitik in der Clinton-Ära.9 Dennoch wird Washington sich unter Obama nicht aus der Weltpolitik verabschieden. Auch zu seinem Selbstverständnis wird gehören, dass amerikanische Präsidenten zugleich die „Führer der freien Welt“ sind; dies zeigte sich bereits in seinen Wahlkampfäußerungen, wonach die USA der Garant der internationalen Stabilität und die unentbehrliche Ordnungsmacht seien. Abgesehen von diesem Selbstverständnis sind es zwei Dinge, die die USA wohl auch in Zukunft ihre Führungsrolle in einer sicherlich multipolarer werdenden Welt werden ausüben lassen: Amerikas eben aus diesem Selbstverständnis erwachsender Führungs- und Gestaltungswille, gepaart mit dem unerschütterlichen Glauben an die Selbstheilungskräfte 8 9 Fröhlich, Stefan: Außenpolitik unter Obama – pragmatischer Multilateralismus und transatlantische Annäherungen, in: Integration 1/2009, S.353-366. Deudney, Daniel/Ikenberry, John: The Myth of the Autocratic Revival. Why Liberal Democracy will prevail, in: Foreign Affairs 1/2009, www.foreignaffairs. org/current/ Whither USA – Taumelt der „sanfte Hegemon“? 19 des Landes, und sein überragendes Machtpotenzial. Zusätzlich gestärkt wird diese Stellung durch die vergleichsweise günstige demographische Entwicklung des Landes sowie seine großen Rohstoffvorkommen und landwirtschaftlich nutzbaren Flächen; aufgrund der Migration, deren undokumentierter Teil zwar mittlerweile erhebliche Probleme bereitet, und wegen der hohen Geburtenrate verfügen die USA im Vergleich zu den meisten potenziellen Konkurrenten über eine junge Bevölkerung.10 2. Amerikas Führungs- und Gestaltungswille Auch unter der neuen Administration wird Amerika an der Grundüberzeugung festhalten, wonach das Land aufgrund seiner überragenden Machtposition die internationale Ordnung gestalten kann und wonach die Gestaltung der inneren wie äußeren Ordnung im Sinne von Karl Deutsch zentrale Aufgabe aller Staatlichkeit ist. Und da dieser Gestaltungswille wesentlich von den religiösen Fundamenten und Werten (Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Toleranz, Respekt, Solidarität, Ziel- und Ergebnisorientiertheit) seiner Gesellschaft mitgetragen wird und weil diese Werte wiederum als quasi natürlicher Wunsch aller Zivilgesellschaften vorausgesetzt werden, werden die USA sich auch künftig mit Nachdruck für deren Bewahrung und Strahlkraft einsetzen. Bei allem „missionarischem Internationalismus“11 wird die neue Administration diesen Einsatz jedoch nicht zu einem generellen normativen Konflikt zwischen dem demokratischen Amerika auf der einen und undemokratischen Regimen, die die Sicherheit des Landes bedrohen, auf der anderen Seite hochstilisieren. Der Aufstieg des transnationalen radikalen Islamismus hat zwar das Paradigma säkularer internationaler Beziehungen erschüttert und stellt eine zentrale Herausforderung für den Westen insgesamt dar. Ebenso ist deutlich, dass der Universalitätsanspruch liberaler Demokratie durch die Betonung fremder kultureller Eigenheiten und vor allem Russlands und Chinas Autoritarismus zunehmend in Frage gestellt wird und Washington sich daher auch aus diesem Grund von der Idee der Erzwingung westlicher Ordnungsmodelle verabschieden muss. Andererseits wird sich Amerika gegen die vor allem in Asien erhobenen Vorwürfe wehren, wonach die zwölf Prozent der im Westen lebenden Weltbevölkerung unter der Führung Washingtons über die Zukunft der restlichen 88 Prozent entscheiden dürften. In den USA geht das Gespenst 10 11 Kreft, Heinrich: Die USA im Abstieg? It’s Still the Indispensable Nation, Stupid!, in: Die Politische Meinung 1/2009, S.23-27; Givens, Terry: Immigration and Immigrant Integration: Context and Comparison, in: Changing Identities and Evolving Values. Is there still a Transatlantic Community?, hrsg. von Esther Brimmer, Center for Transatlantic Relations, Washington D.C, 2006, S.65-72. Keller, Patrick: Die Smart-Power-Präsidentschaft. Missionarischer Internationalismus oder kraftloser Moralismus?, in: Internationale Politik 1/2009, S.98-101. 20 Stefan Fröhlich eines neuen Systemkampfs zwar schon seit geraumer Zeit um. Bei diesem Kampf, so kein Geringerer als der neokonservative Politikwissenschaftler Robert Kagan, ging es weniger um die machtpolitische Herausforderung Washingtons (und des Westens im Allgemeinen) durch die neuen Aufsteiger, sondern vielmehr um einen Kampf der Ideen. Länder wie Russland und China seien danach nicht einfach nur autoritär, sie glaubten vielmehr, dass dieser Autoritarismus zusammen mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg zunehmend zu einem Modell werde, von dem zumal vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise bereits eine beträchtliche Sogwirkung in der Welt ausgeht. Washington aber wird auch künftig, bei allem Reformbedarf des amerikanischen Kapitalismus-Modell im Detail, an die Überlegenheit dieses Systems glauben und Linksliberale wie Liberal-Konservative sind sich einig in der Forderung, dass die Außenpolitik des Landes letztlich weiterhin auf der Annahme basieren müsse, dass eben nur der Liberalismus den Weg in die Moderne weist. Ganz unabhängig vom wirtschaftlichen Erfolg der Aufsteiger in den vergangenen Jahren wird bei der Systemdiskussion tatsächlich verkannt, dass dieser vor allem jener Offenheit des globalen Systems (Freihandel) geschuldet ist, für die Washington steht. Die Hilfen, der Schutz und die Entscheidungen der vom Westen geschaffenen Institutionen, westliche Technologie und die durch die Verlegung der Industrieproduktion entstandenen Arbeitsplätze waren es, von denen Asien profitierte – zunächst Japan, dann die Tigerstaaten und nun auch China und Indien. Darüber hinaus ist der Westen der größte Abnehmer der dort hergestellten Waren. Was aber langfristig vor allem zählt: Wirtschaftlich erfolgreich wird in Zukunft nur derjenige sein, der über Rohstoffe oder über gute Ideen verfügt und nicht nur über billige Arbeitskräfte oder angelerntes Knowhow. In beiden Bereichen aber gehören China und Indien noch nicht zur Weltspitze, vielmehr halten Europa und vor allem Amerika bei Forschung und Entwicklung als Voraussetzung für kreative Wissensgesellschaften den entscheidenden Vorsprung – nicht zuletzt eine Frage des Systems. Der unerschütterliche Glaube Washingtons an das eigene System zeigt sich auch mit Blick auf die (außen)politische Dimension der Debatte. Isolationistische Reflexe sind auch künftig nicht zu erwarten, ebenso wenig werden die USA unter der neuen Administration zu einer „Status quo“-Macht. Neben der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus und die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen als zentralem Thema (Obama hat im Wahlkampf deutlich gemacht, dass die innere wie äußere Sicherheit für ihn unverändert hoch auf der politischen Agenda rangieren) räumt Washington den Herausforderungen durch schwache und scheiternde Staaten als Ursache von Instabilität, extreme Armut, Klimawandel und Energieknappheit den gleichen Stellenwert ein und sieht deshalb amerikanische Sicherheit und Wohlstand untrennbar mit der Si- Whither USA – Taumelt der „sanfte Hegemon“? 21 cherheit und dem Wohlergehen in anderen Staaten verbunden.12 Aus dieser Verbundenheit heraus ergibt sich für die USA die Notwendigkeit der Partnerschaft und der Führung durch das eigene Beispiel im Sinne der Jeffersonschen Tradition in der amerikanischen Außenpolitik. Mit anderen Worten: Obama wird sich der Welt vorerst weit weniger moralistisch und idealistisch präsentieren als sein Vorgänger. In den vergangenen Monaten hat er wiederholt betont, dass er einen „außenpolitischen Realismus“ jeder „ideologisierten Außenpolitik“ vorziehe.13 Dennoch steht auch die neue Administration in einer außenpolitischen Tradition, in der Idealismus und Realismus, Moral und Macht bzw. Interessen miteinander verschmelzen. Obama wird die USA daher in die Rolle des liberalen und „wohlwollenden Hegemons“ zurückführen wollen, wie sie den Entwurf amerikanischer Weltpolitik nach 1945 prägte. Danach können die USA aufgrund ihrer Ressourcen zwar die eigenen Interessen unilateral verfolgen, sind sich aber andererseits ihrer besonderen globalen Verantwortung für die Stabilität des internationalen Systems bewusst und beschränken daher den Einsatz ihrer militärischen Macht nicht auf den Schutz der amerikanischen Bevölkerung und vitaler Interessen in Fällen tatsächlich oder unmittelbar bevorstehender Angriffe. Dementsprechend will Obama bis 2012 die amerikanische Auslandshilfe pro Jahr auf 50 Mrd. US-Dollar verdoppeln, gleichzeitig aber auch die Verteidigungsausgaben und die Personalstärke der Streitkräfte (um 90.000) erhöhen – nicht zuletzt zur effektiveren Bekämpfung von Aufständen bzw. Umsturzversuchen in „schwachen“, „scheiternden“ oder „gescheiterten“ Staaten sowie zur Unterstützung bzw. zum Wiederaufbau von Streitkräften in den betroffenen Ländern („post-conflict-management“).14 Insofern könnte die Idee des Einsatzes militärischer Macht auch im Falle humanitärer Katastrophen und im Dienste „gemeinsamer Sicherheit“, möglichst im Rahmen internationaler Institutionen, aber auch mit Unterstützung anderer Staaten in flexiblen „Koalitionen von Handlungswilligen“, wenn der VNSicherheitsrat sich als handlungsunfähig erweist, zum zentralen Eckpunkt einer künftigen Obama-Doktrin werden.15 In der Überzeugung, dass Demokratie die einzig legitime Regierungsform darstellt, wird Washington auch künftig demokratische Entwicklungen in aller Welt unterstützen – weniger im Sinne einer Politik des regime change mit vorwiegend militärischen Mitteln, aber eben doch im Sinne dessen, was die neue Außenministerin Hillary Clinton als „smart power“ bezeichnet: der flexiblen 12 13 14 15 Rudolf, Peter: Amerikas neuer globaler Führungsanspruch, in: SWP-Aktuell, Berlin 2008. Zakaria, Farred: Obama Abroad, in: Newsweek 28.7.2008, S.22-25. Obama, Barack: The American Moment; Defense. BarackObama.com.August 2008, http://www.barackobama.com/issues/defense/; Ders.: Renewing American Leadership, in: Foreign Affairs, July/August 2007, S.7. Fullilove, Michael: Hope or Glory? The Presidential Election and US Foreign Policy, Brooking Institution: Policy Paper, 9.10.2008, Washington D.C., S.6f. 22 Stefan Fröhlich Kombination aus militärischer Macht, ökonomischem Druck, Diplomatie und moralischer Autorität. Ist die nationale Sicherheit Amerikas aber bedroht, so sind Unilateralismus und selbst Präemptivschläge möglich, sollte die internationale Staatengemeinschaft zu geschlossenem Handeln nicht in der Lage sein.16 3. Amerikas Machtressourcen Entscheidend genährt wird Amerikas Gestaltungswille, sieht man einmal von den hier nicht weiter thematisierten historischen und sozio-kulturellen Voraussetzungen ab, von seinen überragenden Machtressourcen. Dass diese relativ in der Welt abnehmen, ist unstrittig; ähnliche Phasen durchlief Washington allerdings auch Anfang der siebziger und Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Der Anteil der US-Volkswirtschaft mit einem Volumen von knapp 14 Billionen Dollar beträgt aber ungeachtet dessen noch immer knapp 28 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes – ein Wert, den in etwa die EU als Ganzes aufweist, aufgrund der nach wie vor fehlenden politischen Einigung aber nicht annähernd in ein vergleichbares globales Gewicht übersetzen kann.17 Eine höhere Beschäftigungsquote wie durchschnittliche Produktivität haben in den vergangenen zehn Jahren dazu beigetragen, dass die US-Wirtschaft mit durchschnittlich über drei Prozent ein um etwa ein Prozent höheres Wachstum erzielte als die Europäer oder Japaner und dass sich die Kluft zwischen beiden Seiten auch hinsichtlich der durchschnittlichen Kaufkraft weiter zugunsten der USA vergrößert hat – nicht zuletzt auch das Ergebnis einer weit flexibleren Wirtschaftspolitik, bestehend aus einem moderaten Keynesianismus, einer undogmatischen Geldpolitik, geringerer Regulierung der Arbeitsmärkte und niedrigeren Steuersätzen. Im gleichen Zeitraum wies die US-Wirtschaft mit einer Arbeitslosenquote von knapp fünf Prozent im Durchschnitt deutlich bessere Kennzahlen aus als die EU. Knapp ein Drittel der weltweiten Direktinvestitionen fließt in die USA, nicht zuletzt weil die Rahmenbedingungen im Land in den Augen von Investoren noch immer als die weltweit günstigsten bewertet werden und weil man seine Wirtschaft für anpassungsfähiger und innovativer als jede andere hält. Finanzdisponenten verschieben ihr Kapital selbst in der momentanen Krise nach wie vor eher in die USA, in der Erwartung, dass es dort höher oder sicherer verzinst wird als im Euroraum – ein Beweis dafür, dass das internationale Währungs- und Finanzsystem noch immer maßgeblich von Washington bestimmt wird und der Dollar unverändert von seiner traditionellen Rolle als Leitwährung profitiert. Schließlich bewirkten die Wirtschaftskraft und die augenscheinliche Überlegen16 17 Obama: The Audacity of Hope, S.308f. Zakaria, Fareed: The Future of American Power. How American can survive the rise of the rest, in: Foreign Affairs 3/2008, S.18-43, S.27f. Whither USA – Taumelt der „sanfte Hegemon“? 23 heit des amerikanischen Wirtschaftsmodells in den vergangenen Jahren auch, dass Washington mit seinen ordnungspolitischen Vorstellungen die Agenda der zentralen internationalen Wirtschafts- und Finanzorganisationen WTO und IWF dominierte. Dass diese Dominanz vor dem Hintergrund der aktuellen Krise künftig weniger durchschlagend sein wird, ist zwar unbestritten. Dennoch kann man davon ausgehen, dass Washington die Weltwirtschaft weiterhin entscheidend prägt; seine fragile Hegemonialposition besteht ja gerade darin, dass es zwar von Kapitalimporten abhängig ist, der Rest der Welt im Gegenzug aber darauf angewiesen ist, dass Amerika ausländisches Kapital attrahiert und zu weltwirtschaftlicher Nachfrage verarbeitet. Viel entscheidender aber dürfte auch künftig ein anderer Faktor sein: Um seine Zukunfts- und Innovationsfähigkeit zu sichern, geben die Amerikaner mehr für Forschung und Entwicklung aus als jedes andere Land der Welt und sichern sich so ihren weltweiten Wettbewerbsvorsprung. Die USA investieren knapp 2,6 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in die Hochschulbildung im Vergleich zu 1,2 Prozent in Europa und 1,1 in Japan. Der Grund für Wachstum, Innovation und Produktivitätsfortschritt liegt vor allem in den Investitionen in Schlüsselbereiche wie der Nano- oder Biotechnologie, wie sie durch die enge Verzahnung von Wissenschaft, Privatwirtschaft und Politik ermöglicht werden. Je nach Studie finden sich sieben bis acht von zehn bzw. 70 Prozent der besten 50 Universitäten in der Welt in den USA.18 Mehr als drei Viertel der vorderen Ränge unter den weltweit führenden Forschungsinstituten werden schließlich von amerikanischen eingenommen. Auch wenn also die aktuelle Rezession für die USA tiefer ausfallen sollte als für Europa und die anderen Herausforderer, so dürfte Amerika am Ende auch aus dieser Krise gestärkt hervorgehen. Vor allem aber wäre es voreilig, damit das Ende der amerikanischen Vorherrschaft zu prophezeien. Dies zeigt vor allem ein direkter Vergleich mit den Herausforderern. Richtig ist, dass es sich heute auch die USA nicht mehr leisten können, Chinas ökonomischen Aufstieg bzw. die eigene Abhängigkeit gegenüber dem mittlerweile größten Gläubiger (Pekings Anteil an US-Staatsanleihen beträgt knapp 600 Milliarden Dollar) zu unterschätzen; das amerikanische Zahlungsbilanzdefizit steuert auf fast eine Billion Dollar zu, wofür vor allem die Schieflage im Handel mit China verantwortlich ist. Nicht nur beeindrucken die Wachstumsgeschwindigkeit von jährlich durchschnittlich acht bis zehn Prozent und die zunehmenden Verlagerungstendenzen. Die mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt von ca. 3,3 Billionen Dollar mittlerweile drittgrößte Volkswirtschaft der Welt (gemessen nach Kaufkraftparitäten liegt China gar an zweiter Stelle) verfügt außerdem über Devisenreserven von rund einer Billion Dollar und zieht neben den USA 18 Ebd., S.31f. 24 Stefan Fröhlich mit etwa 60 Milliarden Dollar weltweit die mit Abstand höchsten ausländischen Direktinvestitionen an.19 Auch handelt es sich im Falle Chinas heute durchaus um eine vergleichsweise geschlossene Volkswirtschaft mit einem relativ geordneten Finanz- und Devisensystem, welches den Kapazitätsausbau der Industrie und der Infrastruktur (insbesondere in den Küstengebieten), begünstigt durch niedrige Produktionskosten und hohe Flexibilität des „Humankapitals“, über die vergangenen Jahre mit atemberaubender Geschwindigkeit vorangetrieben hat. Insofern deutet vieles darauf hin, dass Chinaoptimisten mit Blick auf die weitere positive Entwicklung des Landes Recht behalten könnten; dies bestätigt nicht zuletzt die dynamische Entwicklung der Privatwirtschaft. Auf der anderen Seite aber trübt die Globalisierungsangst im Westen zum Teil den nüchternen Blick auf die tatsächlichen Kräfteverhältnisse. Während die USA mit fünf Prozent der Weltbevölkerung für etwa 28 Prozent des Weltbruttoinlandsprodukts stehen, kommt China mit einem Fünftel der Weltbevölkerung auf gerade einmal fünf Prozent (Indien mit einem ähnlichen Bevölkerungsanteil auf zwei Prozent).20 Mit anderen Worten: China zählt heute zweifelsohne zu den Handelsriesen, muss aus wirtschaftlicher Sicht aber nach wie vor als Entwicklungsland eingestuft werden. Hinzu kommt, dass das Land vor einer Reihe von gravierenden Problemen steht – so u.a. der ständigen Gefahr einer Überhitzung der Wirtschaft, dem zunehmenden Haushaltsdefizit, der disparaten Entwicklung seiner Regionen, einem großen sozialen und Einkommensgefälle (fast jeder Zweite der 1,3 Milliarden Chinesen erwirtschaftet weniger als zwei Dollar täglich, weshalb das Land gemessen am Pro-Kopf-Einkommen im weltweiten Vergleich lediglich auf Platz 132 liegt),21 der mangelnden Ausbildung seiner Landbevölkerung, die noch immer 45 Prozent der arbeitenden Chinesen ausmacht, gigantischen Umweltproblemen, faulen Bankkrediten in Höhe von weit mehr als 30 Prozent des BIP, deren Bewältigung China noch auf lange Sicht davon abhalten wird, in Bezug auf seine Wirtschaftsleistung zu den USA und der EU aufzuschließen. Als mittlerweile zweitgrößter Energiekonsument nach den USA ist es zudem trotz seiner großen Kohle-, Öl- und Gasvorkommen dringend auf Importe angewiesen, weshalb es weltweit Exklusivabkommen mit Paria-Staaten abschließt und dabei auch keine Konflikte mit Nachbarländern scheut. 19 20 21 UNCTAD: World Investment Report 2008. Country Fact Sheet China, http:// www.unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir08_fs_cn_en.pdf; Joseph Quinlan: The Rise of China: A brief review of the implications on the transatlantic partnership. German Marshall Fund of the United States, GMF Paper Series, Washington 2006, http://www.gmfus.org/publications/index.cfm Vgl. Weltbank: Quick References Tables, http://web.worldbank.org/WEBSITE/ EXTERNAL/DATASTATISTICS/O”contentMDK:20399244~menu~pagePK:641 33150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html Gross National Income per Capita 2007. Atlas method and PPP, http://www. siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNIPC.pdf Whither USA – Taumelt der „sanfte Hegemon“? 25 Nicht zuletzt aus diesem Grund ist China vor allem an innerer und äußerer Stabilität interessiert. In der Außenpolitik spricht das Land immer häufiger von dem neuen außenpolitischen Konzept der „harmonischen Welt“. In ihr stellt China zwar der Macht der USA und dem Ideal von Demokratie und universellen Menschenrechten das Konzept einer vielfältigen, multipolaren Welt gegenüber, in der jeder Staat seinen eigenen Entwicklungspfad beschreitet und in der es keine Einmischung in innere Angelegenheiten gibt, in der man jedoch vorerst die globale Führungsrolle der USA auch nicht durch einen ordnungspolitischen Konkurrenzkampf heraufordern will; ein solcher würde das Land auch aus Sicht Pekings materiell überfordern und den ökonomischen Aufstieg gefährden. Eben diesen politischen Willen hat zweifellos Moskau und stützt sich dabei natürlich nach wie vor auf seinen Rang als neben den USA stärkste Nuklearmacht. Russland ist jedoch aufgrund der weit schwächeren ökonomischen Ausgangslage schlicht überfordert, die USA ernsthaft herauszufordern. Zwar meldet das Land seit längerem den Anspruch einer globalen (Ordnungs)macht an; die Fähigkeit hierzu bemisst sich jedoch allenfalls an seinem Störpotenzial in seiner Peripherie, der Vetomacht im UN-Sicherheitsrat (Nahost, Iran, Nordkorea) und seinen Energiereserven, die zunehmend zu einem politischen Hebel im Umgang mit seinen Nachbarn und gegenüber der EU geworden sind. Ökonomisch jedoch ist die Basis des Landes, vor allem aufgrund der geringen Diversifizierung seiner Industriestrukturen, selbst nach Einschätzung russischer Experten gerade einmal auf dem Stand eines Schwellenlandes mit mittelmäßigem Entwicklungsniveau, dessen Ressourcen zwar enorm sind, dessen Mittel zu deren Förderung und Vermarktung jedoch begrenzt sind.22 Nimmt man die dramatische demographische Entwicklung hinzu und bedenkt man, dass eine politische Reimperialisierung Russlands angesichts der Abwendung der nunmehr unabhängigen Staaten unrealistisch erscheint, so ist eine globale Führungsrolle, die Washington ernsthaft herausfordern könnte, mittel- bis langfristig kaum vorstellbar. Dies gilt noch viel stärker mit Blick auf die unverändert überragende militärische Überlegenheit der USA. Ganz unabhängig davon, dass die Grenzen dieser Dominanz auch den USA in den vergangenen Jahren schmerzlich vor Augen geführt wurden, sollte der Abschreckungs- wie der psychologische Effekt dieser Dominanz dennoch nicht unterschätzt werden. Zunächst gilt, dass kein anderes Land auch nur annähernd an die militärischen Fähigkeiten der USA heranreicht. Kein anderes Land ist in der Lage, seine militärische Macht global einzusetzen; mit einem weltumspannenden Netz an Militärbasen und ihrer auf allen Weltmeeren präsenten Flugzeugträgerflotte können die USA ohne Zeitverlust rasch auf 22 Fröhlich, Stefan: Die EU als globaler Akteur, Wiesbaden 2008, S.199-216. 26 Stefan Fröhlich etwaige Krisen in der Welt reagieren und militärische Macht projizieren.23 Die amerikanischen Streitkräfte sind die am besten ausgebildeten und ausgerüsteten in der Welt; für ihre technologische Überlegenheit prägte das Pentagon bereits zur Millenniumswende den Begriff von der „fullspectrum-dominance“.24 Schließlich entspricht der Verteidigungshaushalt der USA mit über einer halben Billion US-Dollar rund der Hälfte der weltweiten Verteidigungsausgaben.25 Damit sind die amerikanischen Ausgaben in etwa doppelt so hoch wie die der EU-27 und sechsmal größer als die Chinas, des derzeit einzigen potenziellen Rivalen neben der EU – legt man die geschätzten Zahlen des chinesischen Verteidigungshaushalts zugrunde, die die offiziellen in etwa um das Dreifache überschreiten; nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts gibt Peking derzeit gerade ein Zehntel dessen für die Verteidigung aus, was die USA ausgeben. Zwar hat die EU den Ausbau der GASP/ESVP in den letzten Jahren institutionell vorangetrieben, bezüglich ihrer Fähigkeiten aber klafft weiterhin eine große Lücke zu den USA. Chinas Militärpotenzial wiederum hat mittlerweile zwar für die Region ein derart bedrohliches Ausmaß angenommen, dass einzig die Präsenz der amerikanischen Streitkräfte, gestützt auf die Verbündeten Japan, Südkorea und Taiwan, einer künftigen Machtausdehnung des Landes in Asien vorzubeugen vermag. Andererseits legt es Peking nicht darauf an, etwa durch die Entwicklung eines eigenen Flugzeugträgerverbandes die militärstrategische Dominanz der USA in der asiatisch-pazifischen Region herauszufordern und damit gar eine Konfrontation mit der globalen Militärmacht der USA zu provozieren. Ähnliches gilt bei allen Provokationen im Übrigen für Moskau. So bleibt die überragende Militärmacht der USA wohl auch weiterhin „nicht die Ursache amerikanischer Stärke, aber ihre Konsequenz“.26 Und wo immer diese in die Waagschale geworfen wird, ob in regionalen Konflikten oder in Friedensverhandlungsprozessen wie im Nahen Osten, lässt deren politisch-psychologische Wirkung als Drohund Rückversicherungspotenzial die Konfliktparteien die Führungsrolle Washingtons letztlich akzeptieren. Gestützt auf diese Ressourcen wird Washington wohl auch künftig seine überragende Militärpräsenz vor allem zur Sicherung der freien Ölzufuhr und stabiler Verhältnisse insbesondere im Greater Middle East, aber auch in der 23 24 25 26 Fröhlich, Stefan: Die USA – die einzig verbliebene Supermacht?, in: Macht und Mächte in einer multipolaren Welt, hrsg. von Michael Piazolo, Wiesbaden 2006, S.53-78. US Department of Defense: Joint Vision 2020 Emphasizes full-spectrum dominance, http://www.dfefenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=45289 Stockholm International Peace Research Institute: Military Expenditure Database: http://www.milexdata.sipri.org, 2008 Kreft: Die USA im Abstieg?, S.24. Whither USA – Taumelt der „sanfte Hegemon“? 27 pazifischen Region nicht aufgeben; allein die neuen Verteilungskämpfe um die weltweit verfügbaren Energieressourcen werden zur Sicherung der Netzwerke und Transportwege internationale Überwachungssysteme, womöglich auch in Form multinationaler schneller Eingreiftruppen, dringend notwendig machen. Washington wird aber dabei versuchen, sich erstens diesen Regionen mit seinen ordnungspolitischen Vorstellungen nicht weiter als nötig aufzudrängen, und es wird zweitens alles unternehmen, um die sich daraus ergebenden enormen finanziellen Belastungen durch Lastenteilung zu senken. Das Instrument für diese Strategie sieht man beispielsweise im Greater Middle East in der Schaffung einer regionalen kollektiven Sicherheitsarchitektur, in der neben den Staaten der Region und den Europäern auch China, Indien und evtl. Russland einen Teil der Kosten übernehmen und wenn möglich auch militärisch präsent sein sollen. Mit anderen Worten: „Entamerikanisierung“ bei gleichzeitiger Regionalisierung lauten die Mittel, mit denen Washington seine Militärpräsenz sukzessive auf ein Mindestmaß reduzieren und seine Akzeptanz als „wohlwollender Hegemon“ wiederherstellen will; dabei sollen alle Staaten der Region, Syrien und Iran inbegriffen, einbezogen werden. 4. Ausblick An Amerikas Grundüberzeugung, wonach es aufgrund seiner überragenden Machtposition und seines Selbstverständnisses die internationale Ordnung gestalten kann, wird sich auch künftig nichts ändern. Die USA werden auch künftig selektiv und unter Abwägung ihrer ordnungspolitischen Ziele und Interessen über den Einsatz ihrer überragenden Mittel in der Welt und mögliche Bündnispartner im Sinne „flexibler Koalitionen“ entscheiden. Trotz Wirtschafts- und Finanzkrise und enormer politischer Herausforderungen haben sie dazu unverändert die besten Voraussetzungen, wenn sie sich vor allem auf die strukturellen Elemente und Vorteile ihrer „soft power“ besinnen: Von ihrer Größe und den materiellen Ressourcen über das Humankapital und die Dominanz in den Bereichen der Spitzentechnologien bis hin zur amerikanischen Massenkultur, der ungebrochenen Anziehungskraft ihrer Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie der liberalen politischen und ökonomischen Traditionen sind die Vereinigten Staaten prädestiniert, eine weltweite Führungsrolle einzunehmen – nicht im Sinne der Bush-Administration, sondern orientiert am Bild des „wohlwollenden Hegemon“, der sich auf die traditionell liberale und multilaterale Konzeption amerikanischer Außenpolitik besinnt, erkennt, dass die Sicherheit des Landes untrennbar mit dem Wohlergehen anderer Staaten verbunden ist, und die neuen Aufsteiger in enger Abstimmung mit den europäischen Bündnispartnern stärker einbindet. So oder so aber gilt: Der Hegemon ist angeschlagen und hat relativ an Führungskraft eingebüßt, taumeln aber tut er deshalb noch nicht. Amerika wird das künftige Weltgeschehen weiterhin entscheidend (mit)bestimmen. Ready to Lead Once More? Die Zukunft des amerikanischen Führungsanspruchs Georg Schild „What is required of us now is a new era of responsibility – a recognition ... that we have duties to ourselves, our nation and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly.“ Barack Obama In seiner Rede zur Amtsübernahme am 20. Januar 2009 hat der amerikanische Präsident Barack Obama noch einmal einen amerikanischen Führungsanspruch in der internationalen Politik bekräftigt: „We are ready to lead once more.“ Dieser Anspruch fügt sich nahtlos in die außenpolitische Tradition der Vereinigten Staaten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Doch während dieser amerikanische Anspruch in den Jahren des Kalten Krieges in Westeuropa auf grundlegende Zustimmung stieß, wurde er seit dem Ende des Ost-West-Konflikts zunehmend kritisch hinterfragt. Während des Irakkrieges von 2003 kam es sogar zu einer offenen Kritik europäischer Regierungen an einem primär militärisch verstandenen und unilateral durchgesetzten amerikanischen Vormachtanspruch. Der Obama-Administration wird es nur gelingen, einen Führungsanspruch durchzusetzen, wenn sie Lösungen internationaler Krisen jenseits von reiner Militärmacht (hard power) entwickelt. Frühere Vorstellungen einer kulturellen Attraktivität des Landes (soft power) müssen wieder belebt und die Ausrichtung der Politik in der Armutsbekämpfungs-, Menschenrechts- und Umweltschutzfrage geändert werden. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton hat für eine solche Politik, die inhaltlich jedoch noch nicht genau definiert ist, bereits den Begriff „smart power“ geprägt. Ein Erfolg dieser Bemühungen erscheint zu Beginn der Amtszeit Obamas angesichts der Größe und Komplexität der internationalen Probleme und der Schwierigkeiten der heimischen Wirtschaft keineswegs garantiert. Erste Maßnahmen der Administration machen jedoch deutlich, dass eine grundlegende Richtungsänderung gegenüber der Außenpolitik der Bush-Administration geplant ist – manche Beobachter sprechen von einem „Epochenwandel“ und einer „Erneuerung der transatlantischen Partnerschaft“ –, so dass der Präsident zumindest in Europa zunächst mit breiter Zustimmung wird rechnen können.1 1 Lobe, Jim: Clinton Stresses „Cooperative Engagement“, „Smart Power“, in: IPS News Agency, ipsnews.net, 20.1.2009; Rüb, Matthias in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 14.1.2009, S.5; Frankenberger, Klaus-Dieter: Neuanfang über den Atlantik hinweg, in: FAZ, 9.2.2009, S.1. Ready to Lead Once More? 29 1. Der amerikanische Führungsanspruch im Kalten Krieg Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges erklärte der amerikanische Präsident John F. Kennedy in seiner Ansprache zur Amtseinführung am 20. Januar 1961, dass die Vereinigten Staaten alle Lasten tragen würden, die zur Unterstützung der Verbündeten und zur Durchsetzung der Freiheit notwendig seien: „We shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe to assure the survival and the success of liberty.“ Dieses öffentlich vorgetragene Verteidigungsversprechen bildete den Kern des US-amerikanischen Führungsanspruchs über die westlich-demokratische Staatengemeinschaft in den Jahren des Kalten Krieges. Ohne die glaubwürdige Zusage einer amerikanischen Unterstützung im Falle einer sowjetischen Aggression wäre Westeuropa der übermächtigen Roten Armee weitgehend schutzlos ausgeliefert gewesen. Doch bereits während des Kalten Krieges kamen Zweifel daran auf, ob die USA die Lasten dieses Beistandsversprechens dauerhaft würden tragen können. Seit Mitte der sechziger Jahre waren die USA in einen langwierigen Krieg in Indochina verstrickt, bei dem es um die Durchsetzung eines amerikanischen Beistandsversprechens für die Regierung Süd Vietnams ging. Als deutlich wurde, welch enorme Ressourcen der Vietnamkrieg verschlang, versuchte Präsident Richard Nixon den Krieg zu beenden und finanzielle Lasten der Rüstungsanstrengungen auch auf europäische, besonders deutsche Schultern zu verlagern. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe Amerika die Staaten Westeuropas wirtschaftlich wieder aufgebaut, so Nixon in einer Fernsehansprache am 15. August 1971, „now that the other nations are economically strong, the time has come for them to bear their share of the burden of defending freedom around the world.”2 Präsident Ronald Reagan beschwor in den achtziger Jahren wieder einen amerikanischen Führungsanspruch, indem er noch einmal deutlich auf die ideologische Konfrontation mit der UdSSR als dem Reich des Bösen („the focus of evil in the modern world”) hinwies. Dieser Führungsanspruch wurde von den Europäern jedoch als weniger überzeugend angesehen als Kennedys zwanzig Jahre zuvor. Insbesondere die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Westeuropa und die Pläne zur Errichtung eines Raketenschirms zur Abwehr von Interkontinentalraketen hätten die Sicherheit Amerikas von der Europas in bedenklichem Maße abgekoppelt. Ein Führungsanspruch der USA erschien den Europäern in den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges aus einer Reihe von Gründen obsolet. Die rasch wachsende Europäische Union wollte selbst politische und wirtschaftliche Ordnungsaufgaben übernehmen. Darüber hinaus untergruben die USA ihren eigenen Führungsanspruch in den neunziger 2 Zit. nach Perlstein, Rick: Nixonland: The Rise of a President and the Fracturing of America, New York 2008, S.602f. 30 Georg Schild Jahren durch eine schnelle Abfolge unterschiedlicher Sicherheitskonzeptionen. Unter Präsident George H.W. Bush vertrat Washington einen multilateralen Ansatz. Das Konzept einer „neuen Weltordnung” wurde jedoch jenseits des ersten Irakkrieges, der als Koalitionskrieg geführt wurde, nie exakt definiert. Bushs Nachfolger Bill Clinton wollte sich nach Jahrzehnten der vermeintlichen Dominanz der Außen- und Sicherheitspolitik wieder der Wirtschafts- und Sozialpolitik, der Schaffung eines Krankenversicherungssystems und der Verbesserung der maroden Infrastruktur des Landes widmen. Außenpolitische Kontroversen lenkten seiner Meinung nach nur von seinen eigentlichen Interessen ab. Im Konflikt auf dem Balkan wollte sich Clinton lange Zeit nicht engagieren; den Völkermord in Ruanda ignorierte er bewusst, um keine Interventionszwänge zu schaffen. Im Wahlkampf des Jahres 2000 kritisierten republikanische Politiker, dass es Clinton nicht gelungen sei, eine Außenpolitik zu formulieren, die den Interessen Amerikas angemessen war. Clintons Nachfolger Präsident George W. Bush fand nach dem 11. September 2001 im Kampf gegen den internationalen Terrorismus ein neues außen- und sicherheitspolitisches Ziel. Gestützt auf sein überlegenes militärisches Arsenal würde das Land keine Bedrohungen durch andere Staaten oder terroristische Vereinigungen hinnehmen. Potenziellen Aggressoren, die sich um den Besitz von Massenvernichtungswaffen bemühen, werde gemäß der Bush-Doktrin des „preemptiven” Vorgehens bereits entgegengetreten werden, bevor es zu einer konkreten Gefährdung Amerikas komme. Im Vorwort des National Security Strategy Berichts vom September 2002 erklärte Bush die Verteidigung der Nation gegen äußere Feinde zur wichtigsten Pflicht der Bundesregierung: „In an age where the enemies of civilization openly and actively seek the world’s most destructive technologies, the United States cannot remain idle while dangers gather.” Und weiter: „History will judge harshly those who saw this coming danger but failed to act. In the new world we have entered, the only path to peace and security is the path of action.” Das Instrumentarium, dessen sich der Präsident dabei bedienen wollte, schloss den Einsatz von militärischen Mitteln bewusst ein: „To defeat this threat we must make use of every tool in our arsenal – military power, better homeland defenses, law enforcement, intelligence, and vigorous efforts to cut off terrorist financing.” Präsident Bush und seine ideologischen Mitstreiter proklamierten eine Identität von amerikanischer Sicherheit und internationaler Freiheit und einen unbedingten amerikanischen Führungsanspruch im Kampf gegen die Feinde der Freiheit.3 Der Irakkrieg von 2003 war die Umsetzung dieses amerikanischen Anspruchs, Gefahren unilateral zu definieren und alleine zu ihrer Beseitigung einschreiten zu dürfen. Gleichzeitig beruhte der Irakkrieg auf der Vorstel3 The National Security Strategy of the United States, Washington D.C. 2002. Ready to Lead Once More? 31 lung einer absoluten militärischen Überlegenheit der Vereinigten Staaten, für die der Publizist Charles Krauthammer den Begriff der „unipolar power“ geprägt hat.4 Das Vermächtnis des Irakkrieges wird die zukünftige Außenpolitik Präsident Obamas in mehrfacher Hinsicht belasten: – Der Irakkrieg und zunehmend auch die Besatzung Afghanistans werden auf absehbare Zeit amerikanische Kräfte im Mittleren Osten binden. Die Obama-Administration hat gar keine andere Wahl, als den Konflikt weiter zu führen. Ein Zusammenbrechen der politischen Strukturen in Afghanistan und im Irak und ein weiteres Erstarken dortiger radikal-fundamentalistischer Kräfte nach einem amerikanischen Abzug hätten unabsehbare negative Auswirkungen. Die Opfer, die Amerika bisher im Irak gebracht hat, wären vergebens gewesen. Ein internationaler Führungsanspruch der USA könnte nach einem Verlust des Irak nicht länger aufrecht erhalten werden, weil die Glaubwürdigkeit Washingtons grundsätzlich infrage gestellt wäre. Der amerikanische Verteidigungsminister Robert M. Gates wies zu Beginn des Jahres 2009 in der außenpolitischen Zeitschrift Foreign Affairs auf diesen außenpolitischen Zwang hin: „To be blunt, to fail – or to be seen to fail – in either Iraq or Afghanistan would be a disastrous blow to U.S. credibility, both among friends and allies and among potenzial adversaries.”5 Diese Begründung für den Verbleib im Irak ähnelt der für die Weiterführung des Vietnamkrieges nach 1968. – Die unzutreffende Begründung des Irakkrieges und die Folgen des Krieges, die Schaffung eines Gefängnisses auf Kuba mit dem erklärten Ziel, den Inhaftierten die Schutzbestimmungen der amerikanischen Verfassung vorzuenthalten, sowie Übergriffe auf Gefangene im Abu Ghraib-Gefängnis in Bagdad haben den moralischen Führungsanspruch Amerikas nachhaltig infrage gestellt. Besonders in den arabischen Ländern galten die USA zuletzt nicht mehr als ehrlicher Makler zwischen verfeindeten Parteien, sondern als Gegner der Moslems. – Der Irakkrieg hat die amerikanische Politik in den letzten Jahren so sehr dominiert, dass die Bush-Administration kein einziges anderes außenpolitisches (oder innenpolitisches) Problem gelöst hat. Noch immer stehen sich die Staaten Indien und Pakistan sowie Nord- und Süd-Korea hoch gerüstet gegenüber. Der Nahostkonflikt ist ebenso ungelöst wie die Frage, wie auf die Entwicklung einer iranischen Atombombe zu reagieren sei. Auf den russischen Einmarsch in Georgien während der Olympischen Sommerspiele im Jahre 2008 und den Start 4 Krauthammer, Charles: ABM, Kyoto, and the New American Unilateralism, in: The Weekly Standard Magazine, 4.6.2001. Gates, Robert M.: A Balanced Strategy: Reprogramming the Pentagon for a New Age, in: Foreign Affairs 1/2009, S.28. 5 32 Georg Schild einer nord-koreanischen Langstreckenrakete im April 2009 haben die USA nur mit zurückhaltenden Verlautbarungen reagiert. Die Vereinigten Staaten sind nicht länger die „unipolare Macht”, als die sie sich vor 2003 gefühlt haben: „America’s military and ideological commitments grew and grew, far beyond its capacity to carry them out,” so der Publizist Peter Beinart, „and now the bubble has popped.”6 – Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Herbst 2008 erkennbar geworden ist, wurde zu Beginn des Jahres 2009 auch als Bedrohung der internationalen Sicherheit wahrgenommen. Der amerikanische Vizepräsident Joseph Biden erklärte am 7. Februar 2009 vor der Münchener Sicherheitskonferenz: „We are all confronting a serious threat to our economic security that could spread instability and erode the progress we‘ve made in improving the lives of our citizens.”7 Amerika wurde in einem Ausmaß von der Krise betroffen, dass von einer wirtschaftlichen Führungsrolle des Landes nicht mehr gesprochen werden konnte. Mehr noch: Die Wirtschaftskrise ging von den USA aus. Die Obama-Administration wird der Realität ins Auge sehen müssen, dass Amerika nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, um die Krise selbst zu bewältigen. Die USA sind auf Unterstützung von reichen Staaten wie China und den ölexportierenden Ländern angewiesen. Das wird dauerhafte Auswirkungen haben. Amerika wird sich bei diesen Ländern in einem in Friedenszeiten einmaligen Ausmaß verschulden. Der Zusammenbruch der Finanzmärkte stellt schließlich all das infrage, wofür Amerika in der Vergangenheit stand: die Freiheit, die sich aus uneingeschränkter wirtschaftlicher Entfaltung ergibt. Der ehemalige amerikanische Finanzminister Roger Altman schrieb in der Zeitschrift Foreign Affairs, dass in der Krise 2008/9 das amerikanische Modell der freien Marktwirtschaft selbst in Mitleidenschaft gezogen worden sei. „The United States‘ global power, as well as the appeal of U.S.-style democracy, is eroding.”8 2. Smart Power Wenn die Obama-Administration in dieser schwierigen Situation wieder eine amerikanische Führungsrolle proklamiert, so muss sie in allen oben genannten Punkten neue Antworten vorlegen. Neben dieser inhaltlichen 6 7 8 Beinart, Peter: The Solvency Doctrine: To Restore American Power, Obama Needs a Foreign Policy That Recognizes Its Limits, in: Time, 2.2.2009, S.30. Biden, Joseph: Speech at 45th Munich Security Conference, 7.2.2009, www. securityconference.de Altman, Roger: The Great Crash, 2008: A Geopolitical Setback for the West, in: Foreign Affairs 1/2009, S.3. Ready to Lead Once More? 33 Neubestimmung der Politik wird es von Bedeutung sein, wie Obama die politischen Beziehungen zwischen seinem Land und den Verbündeten grundsätzlich gestalten will. In einem ersten Schritt wird er sich von den offensichtlichen Schwachstellen der Politik Bushs befreien müssen: Das Gefangenenlager Guantánamo wird geschlossen werden müssen und folterähnliche Verhörmethoden wie das simulierte Ertränken (waterboarding) werden verboten.9 Die amerikanische Diplomatie muss sich von der Androhung militärischer Gewalt als Mittel der Politik in Richtung Vermittlung unterschiedlicher Vorstellungen entwickeln. In ihrer Nominierungsanhörung erklärte Außenministerin Hillary Clinton: „Diplomacy will be the vanguard of [the new administration‘s] foreign policy.” Militärmacht solle nur als letztes Mittel eingesetzt werden. „One need only look to North Korea, Iran, the Middle East, and the Balkans to appreciate the absolute necessity of toughminded intelligent diplomacy – and the failures that result when that kind of diplomatic effort is absent.”10 Zu erwarten, dass Obama schnell die außenpolitischen Probleme Amerikas lösen werde, hieße den Gestaltungsspielraum der Politik zu überschätzen. Die Vereinigten Staaten können den Irak nicht kurzfristig verlassen und das Land seinem Schicksal überlassen. In ihrer Anhörung vor dem Senat erklärte Hillary Clinton, dass die USA den Irakkrieg „verantwortlich” beenden werden. Sie wiederholte nicht das Wahlkampfversprechen, die Truppen innerhalb von 16 Monaten vollständig abzuziehen. Verteidigungsminister Gates geht davon aus, dass es auf Jahre hinaus („for years to come”) amerikanische Militärberater im Irak geben wird. In Afghanistan soll das US-Truppenkontigent, das gegen Ende des Jahres 2008 etwa 34.000 Mann umfasste, im Verlauf des Jahres 2009 um mindestens zwei Brigaden (7.000 Mann) – evtl. sogar um weitere 30.000 Mann – erhöht werden.11 Auch andere Konfliktherde werden nicht kurzfristig befriedet werden können. Mit der Ernennung George Mitchells, eines ehemaligen Senators und erfolgreichen Vermittlers im Nordirland-Konflikt, zum Sondergesandten für den Nahen Osten sowie des früheren UN-Botschafters Richard Holbrooke zum Gesandten für Afghanistan und Pakistan hat der Präsident deutlich gemacht, wie wichtig ihm Lösungen dieser Konflikte sind. Die erste Aufgabe beider Unterhändler wird es sein, die Konfliktregionen zu bereisen und für Vertrauen in Amerika als Konfliktschlichter zu werben. 9 10 11 FAZ, 23.1.2009. Lobe: Clinton Stresses „Cooperative Engagement“. Ebd.; Gates: A Balanced Strategy, S.29; Cooper, Helene: Fearing Another Quagmire in Afghanistan, in: New York Times, 25.1.2009. 34 Georg Schild Ähnliches gilt für Obamas Bereitschaft zum Meinungsaustausch mit dem Iran. Washington erklärt sich zu Gesprächen ohne Vorbedingungen bereit. Gleichzeitig ist die Obama-Administration jedoch der Überzeugung, dass Nuklearwaffen in den Händen Irans nicht zu tolerieren sind. Wie der Iran von seinen Nuklearplänen abgebracht werden kann, ist derzeit noch völlig unklar.12 Am wenigsten Spielraum hat Obama im Bereich der Wirtschafts- und Finanzkrise. Es wäre ein Fehler, die Krise nur als kurzfristiges Ereignis aufzufassen. Sie hat das strukturelle Problem der amerikanischen Verschuldung, die sich gegenwärtig auf etwa sechs Billionen Dollar beläuft und pro Jahr um eine weitere Billion Dollar zunimmt, deutlich gemacht. Zum regulären Verteidigungshaushalt in Höhe von etwa 500 Mrd. Dollar pro Jahr kommen derzeit jährliche Ausgaben für die Kriege im Irak und Afghanistan in Höhe von 100 Mrd. Dollar. Die USA führen im Irak einen Krieg, den sie sich nicht leisten können. Unbekannt sind derzeit noch die Kosten, die durch das Bankenrettungs- und Wirtschaftsstimulationsprogramm auf die USA zukommen werden. Es wird aber mit weiteren 1.000 Milliarden Dollar zu rechnen sein. Das Land ist zur Deckung der Staatsschulden und zum Ausgleich der negativen Handelsbilanz in Höhe von geschätzten 700 Mrd. Dollar allein für das Jahr 2008 auf einen stetigen Kapitalimport angewiesen, der auf Dauer die amerikanische außenpolitische Handlungsfähigkeit lähmen wird.13 3. Ein neues Verhältnis zu den Verbündeten Wenn Präsident Kennedys Amtszeit der Höhepunkt des amerikanischen Führungsanspruchs in den Jahren des Kalten Krieges war, so lohnt ein Hinweis auf das Strukturprinzip dieses Anspruchs. Es war kein Führungsanspruch per se, sondern ihm lag die Schaffung einer liberalen internationalen Ordnung zugrunde, in der die USA besondere Aufgaben übernahmen und damit die Rolle des primus inter pares ausübten. „In the postwar era the United States did not just fight a global war against Soviet Communism. It also built a liberal international order. This order was not just the by-product of the pursuit of containment. It sprang from ideas and a 12 13 „We are willing to talk to Iran, and offer a very clear choice”, so US Vizepräsident Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2009. „Continue down your current course and there will be pressure and isolation; abandon your illicit nuclear program and support for terrorism and there will be meaningful incentives.” Goodman, Peter S.: Printing Money – and Its Price, in: New York Times, 28.12.2008; Der Spiegel 7/2009, S.77. Ready to Lead Once More? 35 logic of order that are deeply rooted in the American experience”, so der Politikwissenschaftler G. John Ikenberry.14 In einer Zeit, in der Bedrohungen nicht primär militärischer Art sind und Amerika wirtschaftlich und finanziell bedrängt erscheint, kann die zukünftige Führungsrolle Amerikas nur diplomatischer Art sein. „Amerika kann die dringendsten Probleme der Welt nicht alleine lösen, und die Welt kann sie nicht ohne Amerika lösen”, so Hillary Clinton im Januar 2009 bei ihrer Anhörung vor dem US-Senat. Vizepräsident Biden beschrieb Anfang Februar drei Prinzipien für die zukünftige Gestaltung der amerikanischen Beziehungen zu den Verbündeten: Erstens, „we will work in partnership whenever we can, alone only when we must.” Kein einzelner Staat, gleichgültig wie mächtig er sei, könne Bedrohungen dauerhaft alleine widerstehen, so Biden. Die USA glauben, dass internationale Allianzen und Organisationen Amerikas Macht nicht verringerten, sondern helfen würden, kollektive Sicherheit durchzusetzen. Aber die Abkommen, die Amerika unterzeichnet, müssen glaubwürdig und effektiv sein. Das bedeutet, dass die Regeln, die sich eine Gemeinschaft gibt, (notfalls mit Waffengewalt!) durchgesetzt werden müssen. Die USA werden auf die Verbündeten zugehen, aber nicht nur, um ihnen Angebote zu machen, sondern auch, um sie zu fragen, was sie zur Lösung eines konkreten Konfliktes beitragen können. Bidens zweites Prinzip für die zukünftige Zusammenarbeit mit anderen Staaten lautete, dass sich die USA vom Prinzip des „preemptiven” Vorgehens verabschieden werden. Drittens werde sich Amerika keinen Gesprächen verschließen, die ohne Vorbedingungen geführt werden („America will extend a hand to those who unclench their fists.”). In einer Reihe wichtiger Ansprachen hat auch Präsident Obama deutlich gemacht, dass sich die Vereinigten Staaten an die Spitze einer Bewegung setzen werden, die die Werte des demokratisch-freiheitlichen Westens durchsetzen will. In seiner Rede in Berlin am 24. Juli 2008 erinnerte er an Amerikas Unterstützung für die Freiheit West-Berlins und Europas im Kalten Krieg. Dann wies er auf die gemeinsame Verantwortung Amerikas und Europas für die Welt hin: „As we speak, cars in Boston and factories in Beijing are melting the ice caps in the Artic, shrinking coastlines in the Atlantic, and bringing drought to farms from Kansas to Kenya.” Die Welt ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht sicherer, als sie es früher war. Aber Amerika ist sich nun bewusst, dass Probleme nur gemeinsam mit anderen Staaten gelöst werden können: „In this new world, such dangerous currents have swept along faster than our efforts to contain them. That is why we cannot afford to be divided. No one nation, no matter 14 Ikenberry, G. John: Liberal Order Building, in: To Lead the World: American Strategy After the Bush Doctrine, hrsg. von Melvyn P. Leffler und Jeffrey W. Legro, New York 2008, S.85. 36 Georg Schild how large or powerful, can defeat such challenges alone.” Dieser Aspekt, dass Amerikaner und Europäer alle wichtigen Probleme nur gemeinsam meistern können, zieht sich durch die Berliner Ansprache: „In Europe, the view that America is part of what has gone wrong in our world, rather than a force to help make it right, has become all too common. In America, there are voices that deride and deny the importance of Europe‘s role in our security and our future. Both views miss the truth – that Europeans today are bearing new burdens and taking more responsibility in critical parts of the world, and that just as American bases built in the last century still help to defend the security of this continent, so does our country still sacrifice greatly for freedom around the globe.” Obama ging auf die Europäer zu, um sie in einen Konfliktlösungskontext einzubinden, in dem die USA eine führende, aber keine hegemoniale Rolle spielen werden. 4. Die Zukunft des amerikanischen Führungsanspruchs In den Jahren des Kalten Krieges erschien ein Führungsanspruch der USA als der wirtschaftlich und militärisch potentesten Macht des Westens geradezu logisch. Die gegenwärtigen Probleme von der Terrorgefahr über den Umweltschutz bis hin zur Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkrise, die im Herbst 2008 begonnen hat, lassen die USA hingegen nicht als die logische Führungsmacht erscheinen. Wenn die Obama-Administration dennoch eine führende Rolle Amerikas in diesen Fragen anstrebt, wird sie sich strikten Menschenrechts- und Umweltschutzauflagen unterwerfen müssen. Dass sich der Präsident von Gewaltanwendung, einem Kennzeichen der Außenpolitik Bushs, abgewendet hat, ist ein guter erster Schritt: „Power alone can not protect us“, so der neue Präsident in seiner Rede zur Amtseinführung. Machtmittel seien viel effektiver, wenn sie nur nach reiflicher Überlegung eingesetzt würden, „power grows through its prudent use“. In der gleichen Rede sprach er von einer „neuen Ära der Verantwortlichkeit” für die USA, für die das Land gerüstet sei: „What is required of us now is a new era of responsibility – a recognition ... that we have duties to ourselves, our nation and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly.” Präsident Bush hatte politische Führung mit Unilateralismus gleichgesetzt. Diesen Anspruch können die USA nicht länger aufrechterhalten, weil die Europäer und andere Nationen sich Washingtons Führungsanspruch nicht dauerhaft unterwerfen würden. „[B]eing big and rich and well-armed does not make you a leader”, so das US-Nachrichtenmagazin Time im April 2009. „Followers make you [a leader], and the loyalty of followers has to be earned.” Unter Obama werden die USA ihre Führungsrolle neu definieren. Washington akzeptiert, dass andere Staaten wie China und Staatengruppen wie die Europäische Union mit Amerika auf gleicher Ready to Lead Once More? 37 Augenhöhe verhandeln wollen. Die USA sind dazu bereit, auf die Verbündeten zuzugehen. Amerika stärkt bewusst internationale Organisationen wie die NATO, den Internationalen Währungsfonds und befürwortet den Umbau der G-8 zur G-20 Gruppe. Damit steht der Politik ein differenziertes Instrumentarium zur Lösung unterschiedlicher Krisen zur Verfügung.15 Obamas erste Bewährungsprobe war seine Reise nach Europa Anfang April 2009 zum G-20-Gipfel in London, zu den Feierlichkeiten anlässlich des 60. Geburtstags der NATO und zum EU-Gipfel nach Prag. Während die europäische Öffentlichkeit und die Medien Obama als Star feierten und von „Aufbruchsstimmung“, „Seelenmassage für die Europäer“ und einem „Fest“ sprachen, fragten amerikanische Zeitungen, ob Obama eine außenpolitische Strategie besitze und ob er sie gegen Widerstände der Verbündeten durchsetzen könne. Für den CBS-Kommentator Michael Barone ist Obama bei seiner Europareise in der „Realität angekommen“. Für David Sanger von der New York Times vertrat der Präsident vor allem eine „antiBush Doktrin“. Alle Themen, die die Außen- und Sicherheitspolitik Bushs seit dem 11. September 2001 bestimmt hatten, spielten nun keine Rolle mehr. Obama sprach nicht mehr von „preemption“ – dem Anspruch Amerikas, potenziellen Gegnern bereits frühzeitig militärisch entgegenzutreten – und nicht von der Mission, die Welt von der Tyrannei zu befreien. Fast erscheint es, dass Obama die internationalen Beziehungen wieder auf die Lage vor dem 11. September zurückführen wolle. Obama hörte seinen Gesprächspartnern zu und nahm ihre Wünsche ernst. In den Londoner Gesprächen zur Finanzkrise forderte er größere finanzielle Anstrengungen europäischer Staaten zur Bewältigung der Krise, aber er machte auch Zugeständnisse an die deutsche und französische Regierung, die Kontrolle von Banken und international agierenden Fondsgesellschaften zu stärken. Auf dem NATO-Gipfel in Baden-Baden, Straßburg und Kehl erklärte der Präsident, dass es kein altes und kein neues Europa gebe, sondern nur ein vereintes Europa. Bevor er auf seiner letzten Station Ankara einen „neuen Dialog“ mit dem Islam versprach und sich für eine Aufnahme der Türkei in die EU aussprach, rief Obama beim EU-Gipfel in Prag zu einer Welt ohne Atomwaffen auf: „Als Atommacht – als die einzige Atommacht, die schon eine Atomwaffe eingesetzt hat – haben die Vereinigten Staaten eine moralische Verantwortung zum Handeln.” Mit dieser Ankündigung gelang Obama nicht nur, die Vision einer Welt ohne Furcht vor nuklearer Verwüstung zu formulieren. Der Präsident zeigte gleichzeitig einen Weg auf, wie auf die nuklearen Ambitionen von Staaten wie Iran und Nord-Korea reagiert werden könne. Amerika nahm für sich nicht länger ein Recht auf nuklearen Waffenbesitz in Anspruch, das es gleichzeitig anderen Staaten verweigerte. Obama setzte damit alle europäischen Regierungen unter Zugzwang. Die Nuklearmächte England und Frankreich müssen erklären, wie sie sich zu dieser Vision stellen. Sind auch sie bereit, ihr Nuklearpotenzial aufzugeben? Länder ohne eigene Atomwaffen wie Deutschland sind 15 Elliot, Michael: The Moment, in: Time, 13.4.2009, S.7. 38 Georg Schild aufgefordert, in Gesprächen mit der Regierung in Teheran nachdrücklich auf ein Ende des iranischen Atomwaffenprogramms zu drängen. Wie in einem Brennglas zeigt sich in der Frage der vollständigen atomaren Abrüstung der neue außenpolitische Ansatz Amerikas, auch weiterhin die Agenda zu bestimmen. Wir können mit dem Bestreben, Atomwaffen zu eliminieren, nicht allein erfolgreich sein, so Obama, „aber wir können es anführen”.16 16 Schwarz, Karl-Peter: Seelenmassage für die Europäer, in: FAZ, 6.4.2009; Cooper, Helene: On World Stage, Obama Issues an Overture, in: New York Times, 3.4.2009; Sanger, David E.: Hints of Obama’s Strategy in a Telling 8 Days, in: New York Times, 8.4.2009; Rede Obamas in Prag, zitiert nach FAZ, 6.4.2009. Obamas nukleare Abrüstungsinitiative kam nicht völlig überraschend. In einem Beitrag für die Zeitschrift Foreign Affairs hatte er bereits vor zwei Jahren angekündigt, der atomaren Bedrohung begegnen zu wollen. Siehe hierzu Obama, Barack: Renewing American Leadership, in: Foreign Affairs 4/2007, S.8. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA nach dem Ende der Bush-Ära? Klaus-Dieter Schwarz Einleitung Die Welt hatte ein Problem mit der Ära des George W. Bush.1 Das Problem heißt Unilateralismus. Gleich zu Anfang seiner Präsidentschaft verabschiedeten sich die USA aus einer Reihe von größtenteils selbst eingeleiteten, geplanten oder bereits gültigen internationalen Abkommen: beispielsweise vom Statut des Internationalen Strafgerichtshofes zur Ahndung von Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vom Kyoto-Protokoll zum Klimaschutz, dem Verifikationsvertrag zur Biowaffenkonvention etc. bis hin zur einseitigen Kündigung des ABM-Vertrages, des beiderseitigen Verzichts auf Raketenabwehr. Diese Befreiung der amerikanischen Supermacht von lästigen Fesseln des Multilateralismus wurde von einem ihrer einflussreichsten journalistischen Wegbereiter, Charles Krauthammer, als „neuer Unilateralismus” gepriesen: Endlich „haben wir eine Regierung, die bereit und willens ist, die amerikanische Handlungsfreiheit und das Primat amerikanischer Interessen durchzusetzen.”2 Solchem Hochmut folgten das Abenteuer und Debakel des Irakkrieges, das der stellvertretende Außenminister unter Clinton und heutige Präsident der angesehenen Brookings Institution Strobe Talbott so kommentiert: „Die Entscheidung der Bush-Administration für den Einmarsch in den Irak, unter Missachtung des UN-Sicherheitsrates und gegen den Widerstand vieler US-Verbündeter, markiert den Höhepunkt des amerikanischen Unilateralismus – und den Tiefpunkt des weltweiten Ansehens der USA.”3 Dieser Unilateralismus verschärfte den strukturellen Konflikt in den transatlantischen Beziehungen. Die Europäer, vor allem die Regierungen Deutschlands und Frankreichs, stellten die amerikanische Definitionsmacht über die Gestaltung der Weltordnung rundweg infrage. Sie sind auf1 2 3 Vgl. Rudolf, Peter: Imperiale Illusionen. Amerikanische Außenpolitik unter Präsident George W. Bush, Baden-Baden 2007; Müller, Harald: Amerika schlägt zurück. Die Weltordnung nach dem 11. September, Frankfurt am Main 2003. Krauthammer, Charles in: Washington Post, 8.6.2001, A29. Talbott, Strobe: Amerikas neue Agenda, in: Internationale Politik, Juli/August 2008, S.50. 40 Klaus-Dieter Schwarz grund ihrer historischen Erfahrung mit der europäischen Integration und dem Aufbau des Friedens auf ihrem Kontinent zutiefst davon überzeugt, dass sich internationale Ordnung nicht durch Entscheidung des mächtigsten Staates diktieren lässt, sondern nur durch Übereinkunft der Staatengemeinschaft geschaffen werden kann. Ihren Standpunkt brachten sie in deutlicher Distanzierung von der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA von 2002, in der die Elemente einer unverhüllten Pax Americana formuliert sind, in einer Europäischen Sicherheitsstrategie zu Papier, worin sie sich auf Grundsätze eines prinzipiellen Multilateralismus festlegten: „In einer Welt globaler Bedrohungen, globaler Märkte und globaler Medien hängen unsere Sicherheit und unser Wohlstand immer mehr von einem wirksamen multilateralen System ab. Dabei ist es unser Ziel, eine stärkere Weltgemeinschaft, gut funktionierende internationale Institutionen und eine geregelte Weltordnung zu schaffen.”4 Acht Jahre Bush haben allerdings gezeigt, dass der Multilateralismus der EU wenig ausrichten kann, wenn die USA europäische Initiativen nicht unterstützen wie im Fall des Kyoto-Protokolls und Internationalen Strafgerichtshofes oder im Dauerkonflikt in Nahost und im Nuklearstreit mit Iran. Dies mindert jedoch nicht die Richtigkeit multilateraler Politik; ganz im Gegenteil, denn die Misserfolge des amerikanischen Unilateralismus geben ihr neues Gewicht. Der überzeugende Wahlsieg Obamas – ein Gegner des Irakkrieges von Anfang an – bestätigt, dass die europäische Kritik an der Außenpolitik der Bush-Administration gerechtfertigt war. Selten hat man so sehr das Ende einer Präsidentschaft herbeigesehnt und so viel von einem grundlegenden Politikwechsel in Washington erwartet – vermutlich zu viel, denn die Bedingungen, unter denen Obama sein Amt übernommen hat, sind ausgesprochen schwierig. Vor allem dessen erste Amtszeit dürfte geprägt sein von innenpolitischer Orientierung, vom Primat der wirtschaftlichen Erneuerung. Dies schließt indes die Wiederbelebung des multilateralen Engagements in der Außenpolitik nicht aus, vielmehr ein, folgt man den angekündigten Vorhaben des Präsidenten. Was ist gemeint, wenn aus amerikanischer Sicht von multilateraler Politik die Rede ist? Anders als die Europäer vertreten die USA bisher einen instrumentellen und selektiven Multilateralismus als Führungsmittel ihrer Weltmachtpolitik. Für diesen Zweck haben sie internationale Institutionen gegründet, Verträge und Bündnispartnerschaften geschlossen, welche die Zusammenarbeit regelten und die amerikanische Hegemonie durch 4 Zit. aus: Ein sicheres Europa in einer besseren Welt. Europäische Sicherheitsstrategie, Brüssel 12/2003, S.9. Zu den Kriterien eines prinzipiellen Multilateralismus zählen des Weiteren fairer Interessenausgleich zwischen großen und kleinen Partnern, Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen und Skepsis gegenüber militärischer Macht bzw. Ablehnung unilateraler Gewaltanwendung. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 41 Zustimmung der Partner legitimierten. Dieses Arrangement funktionierte gut, besonders in der Zeit des Kalten Krieges, schloss aber auch damals unilaterales Handeln und Widerstand gegen internationale Einbindung auf Kosten nationaler Souveränität keineswegs aus; dies erst recht nicht, nachdem der sowjetische Weltmachtrivale als Gegenpol im internationalen System entfallen und die USA aus der Bündnisdisziplin entlassen waren. Die wiedergewonnene Handlungsfreiheit schlug sich nieder in dem Leitmotiv: „Together where we can, on our own where we must”, wie Präsident Clinton die Außenpolitik seiner Administration kennzeichnete. Sein Nachfolger kehrte die Reihenfolge um: Allein wo wir können, gemeinsam wo wir müssen. Was übrigblieb, hatte mit Multilateralismus nichts mehr zu tun, denn der verlangt nun einmal, dass auch die Führungsmacht die einvernehmlich vereinbarten Spielregeln des Multilateralismus befolgt. Zwar hat sich Präsident Bush in seiner zweiten Amtszeit bemüht, den Ansehensverlust der USA durch verbindlicheren Stil und multilaterale Zugeständnisse rückgängig zu machen, doch dies ist kaum zur Kenntnis genommen worden. Zu nachhaltig war die internationale Distanz zu seiner Politik, der Welt den amerikanischen Willen aufzuherrschen („either with us or against us”). Es liegt auf der Hand, dass die Debatte über amerikanische Außenpolitik auch in der politischen Wissenschaft zu intensiver Beschäftigung mit dem Problem des Multilateralismus geführt hat, die zu begrifflicher Klärung beiträgt, ungeachtet unterschiedlicher praktischer Anwendung des multilateralen Ansatzes in der amerikanischen und europäischen Außenpolitik.5 Demzufolge beinhaltet der Begriff dreierlei: erstens eine „Koordination von Beziehungen zwischen drei oder mehr Staaten auf der Grundlage von Regeln oder Prinzipien.” Damit unterscheidet sich Multilateralismus von bilateraler Zusammenarbeit und unilateraler bzw. imperialer Politik. Zweitens beruht multilaterales Handeln auf „verallgemeinerten Verhaltensprinzipien” im Unterschied zur Kooperation auf der Basis von Adhoc-Koalitionen oder schlichter Machtpolitik. Und drittens impliziert der Begriff immer eine gewisse Einschränkung der politischen Handlungsfreiheit und damit auch der nationalen Souveränität durch Verträge und internationale Organisationen.6 5 6 Vgl. hierzu Van Oudenaren, John: What is „Multilateral“? An abused term in the international relations debate, in: Policy Review 2/3/2003. Vgl. Ikenberry, G. John: Is American Multilateralism in Decline?, in: Perspectives on Politics 9/2003, S.534; Medick-Krakau, Monika u.a.: Die Außenpolitik der USA, in: Einführung in die Internationale Politik, hrsg. von Manfred Knapp und Gert Krell, München u.a., 4.Aufl., 2004, S.98. 42 Klaus-Dieter Schwarz Aus dieser idealtypischen Sicht handelt es sich also um eine bestimmte Methode und Praxis der internationalen Ordnungsgestaltung, die nicht auf Vorherrschaft im internationalen System beruht, sondern auf gemeinsamen Werten und Interessen, gemeinsamen Rechten und Pflichten. In der Praxis hat sich dieser Multilateralismus in der transatlantischen Sicherheitsgemeinschaft seit Ende des Zweiten Weltkrieges verwirklicht und bewährt. Er ermöglichte Mitwirkung an der Regelung der regionalen und globalen Probleme und erzeugte Konsens nicht nur zwischen den Staaten, sondern auch in den Gesellschaften. Multilaterale Politik wurde dabei weniger idealistisch als realpolitisch begründet, denn sie diente amerikanischen Interessen, indem sie die Interessen anderer mitbediente. Und sie ist heutzutage die angemessene Antwort auf die Kraft und Konsequenzen der Globalisierung. Deshalb betont Präsident Obama die Mission der USA, „globale Führung bereitzustellen, die in dem Verständnis verankert ist, dass die Welt eine gemeinsame Sicherheit und eine gemeinsame Menschlichkeit teilt.”7 Dabei gibt es ein Problem: Die USA besitzen heute nicht mehr die Macht, um die Welt nach ihren Vorstellungen zu formen, wie es ihrem moralischen Sendungsbewusstsein entspricht.8 Der Grund liegt weniger im Mangel an materiellen Ressourcen, obschon es den in der gegenwärtigen Krise natürlich gibt, sondern in der Diffusion der Macht in den internationalen Beziehungen, welche die Kontrollfähigkeit auch großer Mächte über das internationale Geschehen drastisch vermindert. Dies zeigt sich beispielhaft in der Tatsache, dass die USA zwar überwältigende militärische Macht besitzen, aber asymmetrische Kriege wie im Irak und in Afghanistan nicht gewinnen können. Obendrein schwächt der Aufstieg neuer Mächte die zentrale Stellung der USA in der Welt, die das Ende des Kalten Krieges ihnen beschert hat. Im Folgenden wird das Thema in drei Teilen behandelt, zunächst mit Blick auf das außenpolitische Programm der Obama-Administration und die Frage, welche Hinweise sich daraus ergeben auf das Neue im Multilateralismus der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Dies wird näher untersucht auf zwei Handlungsfeldern, die in der aktuellen Debatte eine zentrale Rolle spielen, nämlich wirksames Krisenmanagement im Nahen und Mittleren Osten und neue Weltordnungspolitik im Umgang mit aufsteigenden Mächten und Machtgruppierungen. Es versteht sich von selbst, dass es sich im zweiten und dritten Teil lediglich um Perspektiven 7 8 Siehe Barack Obamas programmatische Schrift: Renewing American Leadership, in: Foreign Affairs 4/2007, S.2-16. Bezeichnet als „American exceptionalism“, von den Pilgervätern überliefertes Bewusstsein der Einzigartigkeit der „Neuen Welt“ und ihrer Vorbildlichkeit für die alte Welt der religiösen Intoleranz und autokratischen Machtpolitik. Dieser missionarische Impuls hat unmittelbaren Einfluss auf die US-Außenpolitik und wirkt sowohl in multilaterale wie auch in unilaterale Richtung. George W. Bush begriff ihn nicht als Verpflichtung, sondern als Vollmacht für seinen aggressiven Unilateralismus. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 43 handelt, deren Realitätsgehalt sich noch erweisen muss. Vorab lässt sich aber die am Beginn einer neuen Präsidentschaft oft gestellte Frage nach Kontinuität oder Wandel bereits wenige Wochen nach Amtsantritt beantworten: Die Obama-Regierung markiert einen Neuanfang in der Außenund Sicherheitspolitik wie selten ein Regierungswechsel zuvor. 1. Kreation der Obama-Ära Die USA befinden sich gegenwärtig in einer Krise „von historischen Dimensionen“, wie Obama wenige Tage nach der Wahl erklärt hat. Ohne Frage wird seine Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise seine Präsidentschaft von Anfang an definieren. Aber er bezog sich nicht nur auf diese Krise, denn „die Herausforderungen der nationalen Sicherheit, vor denen wir stehen, sind genau so schwer und so dringlich wie unsere Wirtschaftskrise.“9 Gemeint ist das außenpolitische Erbe: zwei unbeendete Kriege, politisch überforderte Streitkräfte, ein kriegsmüdes und polarisiertes Amerika, vor allem ein schwerbeschädigter Ruf Amerikas – der Nachlass einer gescheiterten Präsidentschaft, die es darauf angelegt hatte, die alleinige Weltmachtrolle der USA gegen den Trend der Globalisierung und Multipolarität zu verteidigen. Der Irakkrieg, der aus Sicht der neokonservativen Ideologen diese Entwicklung aufhalten sollte,10 hat sie letzten Endes beschleunigt. Die USA stehen somit an einem Wendepunkt, der sie zwingt, sich auf die Realität einer post-amerikanischen Welt einzustellen. Eine jüngst bekannt gewordene Studie des US-Geheimdienstes bestätigt die Verminderung der amerikanischen Machtstellung in der Welt: das Entstehen einer multipolaren Welt, in der wirtschaftliche, politische und militärische Macht auf viele globale Akteure im internationalen System verteilt ist, freilich nicht gleichmäßig, sondern asymmetrisch: „Das internationale System, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg entstand, wird 2025 fast nicht mehr wiederzuerkennen sein.“ Ursache dafür sei „das Wachstum der Schwellenländer, eine globalisierte Wirtschaft, ein historischer Transfer von Reichtum von West nach Ost und der wachsende Einfluss von nichtstaatlichen Akteuren.” Und für die USA prophezeit die Studie: „Obwohl die Vereinigten Staaten wahrscheinlich der mächtigste einzelne Akteur bleiben, wird ihre relative Stärke – sogar auf militärischem Gebiet – sinken und ihr Einfluss schwächer werden.”11 9 10 11 Barack Obama zit. bei Pitzke, Marc: Außenministerin Clinton soll Amerikas Image aufpolieren, in: Spiegel Online, 1.12.2008. Dazu grundlegend Keller, Patrick: Neokonservatismus und amerikanische Außenpolitik. Ideen, Krieg und Strategie von Ronald Reagan bis George W. Bush, Paderborn 2008. Executive Summery of the US National Intelligence Council‘s, Global Trends Report 2025, in: Internationale Politik 1/2009, Dokumentation. 44 Klaus-Dieter Schwarz Nun ist die tektonische Verschiebung der Machtverhältnisse in der Welt seit Ende des bipolaren Zeitalters kein Geheimnis mehr. Offen ist, wie schnell dieser Prozess fortschreitet. Im Aufstieg der neuen Mächte, allen voran der Riesenreiche China und Indien, ist auch mit Rückschlägen zu rechnen. Sie werden von der gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise nicht weniger hart betroffen und sind dagegen schlechter gerüstet als die USA oder Teile Europas. Zudem ist die erstaunliche Fähigkeit der USA zur Selbsterneuerung und Kurskorrektur nicht zu unterschätzen. Dies abermals zu beweisen, ist erklärtes Programm der Obama-Regierung. Die amerikanische Präsidialdemokratie räumt dem Präsidenten die Vorherrschaft in der Außenpolitik ein. Folglich hängt die Qualität der Außenpolitik wesentlich von der Qualität des Präsidenten ab. Gewiss gibt es Bedingungen, die auch Präsidenten nicht ändern können, wie die Umverteilung der Macht in der Welt, die von vornherein erwarten lässt, dass Präsident Obama die Zusammenarbeit mit Partnern suchen wird. Auch er wird zuerst amerikanische Interessen vertreten – was denn sonst. Aber sein bisheriges Auftreten lässt erkennen, dass er enge Partnerschaft mit anderen für den besten Weg hält, diesen Interessen zu dienen. Eben daraus entsteht Multilateralismus. Kein anderer unter den Präsidentschaftskandidaten verkörpert diese Erwartung besser als der gewählte Präsident. Ein Wahlsieg seines Kontrahenten wäre zweifellos im In- und Ausland als Verlängerung der alten Politik empfunden worden. Präsident Obama verfügt über geringe außenpolitische Erfahrung – so wurde ihm im Wahlkampf vorgehalten. Das muss kein Nachteil sein. Dafür bringt er die Erfahrungen seiner außergewöhnlichen Lebensgeschichte mit, die beispielhaft zum Prozess der Globalisierung passen, dessen Geschöpf er selber ist. In Hawaii von einer weißen US-Amerikanerin und einem schwarzen Vater aus Kenia geboren, in Indonesien und Hawaii aufgewachsen und an amerikanischen Elite-Universitäten ausgebildet, hat er gelernt, die Welt aus nicht national begrenzter Sicht zu betrachten, Unterschiede zu verstehen und zwischen ihnen Brücken zu bauen. Als Erwachsener hat er nur ein Jahrzehnt in der geteilten Welt des Kalten Krieges und der ideologischen Gegensätze verbracht, die viel längere Zeit in einer Welt wachsender Zusammenhänge zwischen Staaten, Völkern und Regionen. Er spricht von „gemeinsamer Menschlichkeit”, bezeichnet sich als „Weltbürger”12 und kann mit dem integrativen und dialogischen Stil seiner brillanten Rhetorik die Menschen jeder Hautfarbe begeistern. Gewiss steht auch er in der Tradition des amerikanischen Idealismus, aber er ist viel mehr Realist als sein ideologisch verblendeter Vorgänger, dennoch einer, der die Verhältnisse nicht hinnimmt, wie sie sind, sondern Mut macht, sie zu verändern: „Yes, we can.” 12 Vgl. dessen Berlin-Rede vom 24.7.2008. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 45 Obamas Wahlkampfaussagen über Außenpolitik sind erstaunlich vage geblieben, abgesehen von seiner Forderung des Rückzugs aus dem Irak, den die Bush-Regierung am Ende selber noch mit Bagdad vereinbart hat. Dieses Problem ist somit geregelt, wird ihn aber noch beschäftigen. Ansonsten enthielt seine Botschaft kaum Konkretes über Ziele oder Konzept der Außenund Sicherheitspolitik unter seiner Führung. Er versprach, was amerikanische Selbstverständlichkeit ist, die Wiederherstellung und Erneuerung der amerikanischen Führungsrolle in der Weltpolitik: „The American moment is not over”. Und: „We must lead the world, by deed and by example.”13 Das kann nur bedeuten, dass er die Vereinigten Staaten als Vorreiter einer post-hegemonialen Weltordnung betrachtet, denn nur solch eine Rolle und Ordnung können ihnen wieder globale Legitimität verschaffen. Klarer sind Obamas Vorstellungen über die Mittel seiner Außenpolitik. Er will die internationale Zusammenarbeit stärken und Institutionen reformieren. Er benutzt selten das Wort Multilateralismus, da der Begriff in der amerikanischen Debatte ideologisch belastet ist; er spricht von Partnerschaft. Aber ihm ist bewusst, dass die USA ihre Sonderstellung („Exzeptionalität”) in der Welt verloren haben: „Niemand profitiert mehr als wir von der Beachtung der internationalen ‚rules of the road‘.”14 Dem widerspricht nicht Amerikas Recht zur Selbstverteidigung: „Ich werde nicht zögern, Streitkräfte einzusetzen, unilateral falls notwendig, um die Amerikaner zu schützen oder vitale Interessen, wenn wir angegriffen oder unmittelbar bedroht werden.”15 Auch nimmt er die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft ernst, im Fall von humanitären Katastrophen und Völkermord mit militärischer Gewalt einzuschreiten („responsibility to protect”). Ansonsten will er die Überbetonung militärischer Macht im Repertoire der Außenpolitik seines Vorgängers zurückstufen. In der IrakDebatte gab er zu verstehen: „Ich will nicht nur den Krieg beenden, sondern das Denken, das uns in diesen Krieg hineingeführt hat.”16 Er ist auch bereit, sich mit Führern nicht wohlgesinnter Regierungen ohne Vorbedingungen zu treffen, wenn es der Sache und dem Frieden dient. „Wiederbelebung der Diplomatie” ist ihm wichtiger als militärische Stärke.17 Sie ist ihm auch wichtiger als das Leitmotiv wilsonischer Missionspolitik als Handlungsanweisung für die Verbreitung der Demokratie. 13 14 15 16 17 Zit. Obama: Renewing American Leadership. Fortsetzung des Zitats: „We can‘t win converts to those rules if we act as if they apply to everyone but us. When the World‘s sole superpower willingly restrains its power and abides by internationally agreed-upon standards of conduct, it sends a message that these are rules worth following.“ Zit. aus Obama, Barack: The Audacity of Hope. Thoughts on Reclaiming The American Dream, New York 2006, Vintage Book Edition 2008, S.365f. Zit. Obama: Renewing American Leadership. Zit. aus Fullilove, Michael: Hope or Glory? The Presidential Election and U.S. Foreign Policy, Brookings Policy Paper 9/2008, S.8f. Zit. Obama: Renewing American Leadership. 46 Klaus-Dieter Schwarz Weiteren Aufschluss über Stil und Richtung seiner Außenpolitik gibt die Regierungsbildung, die Obama in Rekordzeit und mit viel Überlegung vorgenommen hat. Mit Joe Biden stellte er sich einen Senator als Vizepräsidenten an die Seite, der sich in der internationalen Politik auskennt. Auch sein Sicherheitsberater James Jones bringt als ehemaliger NatoOberbefehlshaber und Kommandeur der Isaf-Truppe in Afghanistan umfassende internationale Erfahrung mit ins Amt. Er soll dafür sorgen, dass künftig ein ganzheitlicher Ansatz in der Sicherheitspolitik zur Geltung kommt, auch dafür, dass die in Washington berüchtigten bürokratischen Rivalitäten eingedämmt und die interministerielle Zusammenarbeit verbessert werden.18 Denn künftig, wie Obama bei der Vorstellung seines Sicherheitskabinetts betonte, müssten die USA „eine neue Strategie verfolgen, die gekonnt alle Instrumente amerikanischer Macht nutzt und ins Gleichgewicht bringt: Militär und Diplomatie, Geheimdienste und Rechtsstaatlichkeit, Wirtschaft und moralisches Vorbild.” Sein Team repräsentiere „all diese Elemente der Macht Amerikas”19 – ein Gesamtkonzept also, das auf ressortübergreifender Sicherheitspolitik und „kluger/ schlauer Machtausübung” („smart power”) beruht.20 Organisation und Besetzung der Regierung entsprechen dem neuen Konzept. So sollen die Haushaltsmittel für das State Department deutlich erhöht, die Ressourcen für Krisenprävention und Wiederaufbau dort gebündelt und erweitert werden. Auch die Streitkräfte werden mehr Personal erhalten und dafür Rüstungsprogramme gekürzt. Neben der einstigen Rivalin Hillary Clinton, die Obama – typisch für ihn – nicht etwa außer Acht lässt, sondern als Außenministerin gewinnt, erhält seine engste Weggefährtin und außenpolitische Beraterin, Susan Rice, als neue UNBotschafterin Kabinettsrang. Sie soll amerikanische Außenpolitik wieder stärker über die Weltorganisation zur Wirkung bringen, beispielsweise in der Iranfrage, Darfur etc.; sie ist Expertin für Afrika und gilt als Befürworterin von humanitären Interventionen. Mit der Bestätigung von Robert Gates als Verteidigungsminister erfüllt Obama sein Versprechen parteiübergreifender Zusammenarbeit, womit er zugleich ein Zeichen für Kontinuität in der Militärführung setzt. Insgesamt ein hochkarätiges Team 18 19 20 Jones bereitet eine Weisung für den NSC vor, die seine Kompetenzen über die klassischen Themen der Außen- und Sicherheitspolitik ausdehnt auf die Finanzen, Wirtschaft, Energiesicherheit und Umwelt. Der neue NSC soll den Präsidenten konzeptionell und strategisch beraten und nicht in das operative Tagesgeschäft eingreifen. Barack Obama zit. aus: Süddeutsche Zeitung, 2.12.2008, S.1. Hillary Clinton in: Statement of Senator Hillary Rodham Clinton Nominee for Secretary of State, Senate Foreign Relations Committee, 13.1.2009, S.4. Der Begriff ist offensichtlich übernommen aus der jüngsten Veröffentlichung des renommierten Politologen Nye, Joseph S.: The Powers to lead, Oxford 2008. Darin definiert er „smart power“ als Verbindung aus „hard and soft power“, die auf einen effektiveren Einsatz verfügbarer Machtressourcen zur Steigerung des nationalen Einflusses zielt. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 47 aus im Washingtoner Politikbetrieb erfahrenen Führungskräften, pragmatisch, zentristisch und unideologisch – so das allgemeine Urteil der Fachkundigen. Nur die Parteilinke der Demokraten war von der Personalauswahl weniger angetan. Die Benennungen und Ankündigungen signalisieren einen klaren Bruch mit der Außenpolitik unter George W. Bush – nicht weniger als den Beginn einer neuen Ära. Sie beginnt dort, wo die alte den größten Schaden hinterlassen hat und ein strategischer Scherbenhaufen aufzuarbeiten ist: im Nahen und Mittleren Osten. Darauf weisen sowohl die Berufung des Sicherheitsberaters hin, der in seiner Militärkarriere die Probleme in „Greater Middle East” gründlich kennengelernt hat und mit Nachdruck für eine umfassende Strategie eintritt, als auch die Erweiterung der außenpolitischen Mannschaft durch erfahrene Krisenexperten als Sondergesandte.21 Hier soll der Schwerpunkt liegen der „Wiederbelebung der amerikanischen Diplomatie”.22 2. Multilaterales Krisenmanagement Der israelisch-palästinensische Konflikt befand sich in den letzten Amtstagen von George W. Bush wieder einmal im Kriegszustand. Israels Regierung war nach Kündigung des Waffenstillstandes durch die Hamas entschlossen, die Raketenbedrohung aus Gaza mit Gewalt zu beenden. Solche Politik hat bisher nur die Zahl der Toten, Verletzten und Vertriebenen erhöht, die Aussicht auf Frieden jedoch nicht verbessert. Statt den Gazastreifen komplett abzuriegeln, die Hamas zu isolieren und in die Arme Irans zu treiben, hätte Israel diese Gruppe, die immerhin in einer international anerkannten Parlamentswahl die absolute Mehrheit der Stimmen errang, in den Dialog mit der palästinensischen Autonomiebehörde ebenso einbinden sollen, wie sie es mit dem militanten Flügel der Fatah getan und dadurch deren Terroraktivitäten überflüssig gemacht hat. Einen Vermittler zwischen beiden Seiten gab es nicht; jedenfalls wollte die Bush-Regierung während ihrer gesamten Amtszeit diese Rolle nicht übernehmen. Sie stand ohne Wenn und Aber auf Israels Seite. Auch das gehört neben dem zeitgleich stattfindenden Wahlkampf in Israel zur Vorgeschichte des Gazakrieges. 21 22 George J. Mitchell für Nahost, Ex-Senator und erfolgreicher Vermittler im nordirischen Friedensprozess; Dennis Ross für Iran, unter Clinton und Bush Nahost-Gesandter; Richard Holbrooke für Afghanistan, Pakistan und Indien, ehem. Botschafter in Deutschland und Balkanvermittler. Vgl. hierzu Haass, Richard N./Indyk, Martin: A New U.S. Strategy for the Middle East, in: Foreign Affairs 1/2009, S.41-58. 48 Klaus-Dieter Schwarz Israel ist es nicht gelungen, Hamas entscheidend zu schwächen. Beide Seiten haben einen einseitigen, jederzeit brüchigen Waffenstillstand erklärt. Ihn dauerhaft zu befestigen, wird die erste Aufgabe des „Sondergesandten für den Nahost-Frieden“ George Mitchell sein. Mehr wird er zunächst nicht ausrichten können. Denn klar ist, dass dieser Konflikt nicht isoliert zu lösen ist, sondern von allen wichtigen Akteuren in der Region bearbeitet werden muss. Deshalb sollen die Friedensgespräche zwischen Syrien und Israel fortgesetzt und in direkte Verhandlungen überführt werden, die bisher via türkischer Vermittlung informell stattgefunden haben. Auch eine Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen mit Syrien ist beabsichtigt. Selbst ein Dialog mit der Hamas ist denkbar. Sie kann jedenfalls aus den Friedensbemühungen nicht ausgeschlossen werden. Ob eine Aussöhnung zwischen Fatah und Hamas zustande kommt, um eine legitime palästinensische Führung zu bilden, die den Friedensprozess mit Israel wieder aufnehmen und mittelfristig die angestrebte Zweistaatenlösung verwirklichen kann, bleibt abzuwarten. Vor allem muss Israel mit Nachdruck von der Notwendigkeit glaubwürdiger Verhandlungen mit den Palästinensern überzeugt werden, einschließlich der Beendigung des Ausbaus jüdischer Siedlungen in Westjordanland. Dies dürfte nach dem Wahlsieg der rechten Kräfte in Israel schwieriger geworden sein, denn auf der Agenda einer Regierungskoalition aus Likud, Rechtspopulisten und Ultra-Orthodoxen unter Premierminister Netanjahu hat die Zweistaatenlösung keinen Platz. Daran ändert auch der Beitritt der heftig geschrumpften Arbeitspartei von Verteidigungsminister Barak zum Rechts-Bündnis wenig, die sich weiter dafür einsetzt. Andererseits kann es sich keine Regierung Israels leisten, sich einem energischen amerikanischen Engagement für den Friedensprozess zu widersetzen. Präsident Obama ist, unterstützt von einer merklich kritischeren Haltung seiner Wähler gegenüber Israel nach dem Gazakrieg,23 dazu entschlossen, allerdings nicht direkt, sondern auf dem Umweg über die Normalisierung der Beziehungen zu Syrien und die Entspannung des Konflikts mit Iran. Das wird Zeit brauchen, doch gelingt dieser Ansatz, könnte es sogar leichter sein, einer rechten Regierung mit linkem Juniorpartner die notwendigen schwierigen Kompromisse einer Zweistaatenlösung abzuringen als einer ohne Gegengewicht zu den Ultra-Rechten. Es gibt dazu außer Fortsetzung des Dauerkonflikts keine Alternative. Deshalb muss sich auch Europa mit einer aktiven Nahost-Politik stärker engagieren. Iran, der große Unsicherheitsfaktor und Gegenspieler der USA in der Region, ist die größte außenpolitische Herausforderung für die Obama-Regierung. Das Land ist der einflussreichste Nachbar des Irak. Mischt es sich in dessen innere Angelegenheiten ein, sind alle Abzugspläne infrage gestellt. 23 Vgl. Pew Research Center for the People & the Press. Modest Backing For Israel in Gaza Crisis vom 13.1.2009. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 49 Diese Gefahr, die der Grund für die amerikanische Truppenaufstockung Anfang 2007 gewesen war, hat sich verringert, da die Provinzwahlen Ende Januar 2009 die Machtverhältnisse im Land von den konfessionellen Parteien deutlich zu den nationalistischen und zentralstaatlich orientierten Kräften verschoben haben. Bestätigt sich dieser Trend in den Parlamentswahlen Ende des Jahres und gelingt es, die Spannungen zwischen Zentralisten und Föderalisten, vor allem die Auseinandersetzungen mit den Kurden unter Kontrolle zu halten, dann dürften der von Obama angeordnete Abzug der meisten Kampftruppen bis August 2010 und der Verbleib einer beträchtlichen Militärpräsenz bis Ende 2011 zu verantworten sein. Dies verschafft Zeit, um mit den Nachbarstaaten ein Abkommen über die territoriale Integrität des Irak zu erreichen, und verbessert die Ausgangsposition Obamas für den Versuch, mit Iran ins Gespräch zu kommen. Die bisherige Konfrontationspolitik Washingtons im Umgang mit Iran war erfolglos. Sanktionen, militärische Drohungen und Vermittlungen der EU im Atomstreit haben Teheran nicht zum Einlenken bewegen können. Vielmehr wurde das Anreicherungsprogramm beschleunigt und der iranische Widerstand gegen den Friedensprozess in Nahost verstärkt. Obama will einen diplomatischen Neuanfang, der auf die Vorbedingung einer Aussetzung der Urananreicherung verzichtet und das Atomprogramm einzuhegen versucht: Iran im Besitz der Atomwaffe sei „nicht akzeptabel”.24 Die Frage stellt sich, wie Teheran zur Aufgabe dieser Option oder gar dieses Ziels bewegt werden könnte oder was zu tun wäre, sollte das scheitern. Man wird es probieren müssen – einerseits mit wirtschaftlichen Kooperationsangeboten und Einbindung in eine regionale Sicherheitsarchitektur und andererseits mit verschärften internationalen Sanktionen. Obamas Neujahrsbotschaft an „das Volk und die Führer der Islamischen Republik Iran” ist ein erster mutiger Versuch, die seit drei Jahrzehnten andauernde gegenseitige Dämonisierung zu überwinden und Verhandlungsbereitschaft über „die gesamte Bandbreite der vor uns liegenden Fragen” anzubieten.25 So eine Offerte und solch ein Sinneswandel der amerikanischen Iranpolitik war vor wenigen Monaten noch undenkbar. Schließlich Afghanistan und Pakistan: Die neue Administration betrachtet beide Länder als „zentrale Front im Kampf gegen den Terrorismus”.26 Der Präsident ist überzeugt, man habe sich vom Krieg im Irak von der Bekämpfung des radikalen Islamismus ablenken lassen und auch die Rückkehr und neue Schlagkraft der Taliban und Al Qaida weitgehend ignoriert. „Wir haben ein klares und fokussiertes Ziel: Al Qaida in Pakistan 24 25 26 So Außenministerin Hillary Clinton bei ihrer Anhörung im Senat am 13.1.2009, zit. aus: Süddeutsche Zeitung, 15.1.2009, S.7. Zit. aus: Videotaped Remarks by The President in Celebration of Nowruz, March 20, 2009, www.Whitehouse.gov Zit. Hillary Clinton bei ihrer Anhörung im Senat am 13.1.2009, ebd. 50 Klaus-Dieter Schwarz und Afghanisten zu zerschlagen, aufzulösen und zu besiegen.”27 Das soll erreicht werden mit einer neuen „umfassenden Strategie”, in der „hard and soft power” gleichermaßen zum Einsatz kommen. Zusätzlich zu der bereits im Februar angeordneten Verstärkung der 38.000 in Afghanistan stationierten US-Soldaten um 17.000 werden weitere 4.000 Ausbilder der Eliteeinheit Airborn Division entsandt, um das Training afghanischer Sicherheitskräfte, das bisher von dafür meist unerfahrenen Nationalgardisten durchgeführt wurde, zu beschleunigen und so die Voraussetzung für einen künftigen Abzug der US-Truppen zu schaffen. Einen Zeitplan für die Beendigung des Militäreinsatzes gibt es jedoch nicht. Der Sondergesandte für Afghanistan und Pakistan, Richard Holbrooke, rechnet damit, dass der Krieg in Afghanistan der längste sein werde, den die USA jemals hätten führen müssen – länger noch als in Vietnam, der 14 Jahre lang gedauert hat.28 Militärische Stärke allein kann den Krieg in Afghanistan nicht beenden. Deshalb will sich die Regierung Obama nach dem Vorbild der im Irak erfolgreich angewandten Taktik im Umgang mit Militanten verstärkt um eine Verständigung mit den Taliban bemühen. Nach Einschätzung des US-Geheimdienstes beteiligen sich zwei Drittel der Aufständischen nicht aus ideologischen Gründen am Kampf gegen die Besatzung, sondern wegen örtlicher Missstände und wirtschaftlicher Not.29 Folglich sollen Stammesführer und jene Taliban, die nicht zum harten Kern der Al Qaida gehören, durch Verbesserung ihrer Lebensumstände dazu gebracht werden, sich von den Extremisten zu trennen. Auch die Regierung in Kabul hat sich um Gespräche mit der Taliban-Führung bemüht, bisher ohne Erfolg trotz Angebot einer Regierungsbeteiligung. Die Aussicht auf sinnvolle Verhandlungen mit den Aufständischen dürfte sich daher vorerst auf die lokale Ebene beschränken. Ebenfalls neu ist der übergreifende regionale Ansatz. Afghanistan und Pakistan werden nicht mehr gesondert betrachtet, sondern als ein Kriegsschauplatz. Westliche Bodentruppen sollen jedoch nicht in Pakistan eingreifen, um die von dort geführten Angriffe der Taliban zu bekämpfen. Dies bleibt Aufgabe der pakistanischen Streitkräfte und Regierung, die in den nächsten fünf Jahren eine US-Finanzhilfe von 7,5 Milliarden Dollar – eine Verdreifachung der bisherigen Mittel – zur Stabilisierung der Grenzgebiete zu Afghanistan erhalten soll. Nicht nur sie hat ein massives Problem mit vermehrten Terroranschlägen im eigenen Land, auch Iran mit den Drogen, die aus Afghanistan ins Land kommen. Die übrigen Nach27 28 29 Text of President Barack Obama´s remarks in: International Herald Tribune, 27.3.2009. Vgl. Holbrooke, Richard: The Next President. Mastering a Daunting Agenda, in: Foreign Affairs 5/2008, S.2-24. Diese Aussage ist mit Vorsicht zu betrachten, da die Geheimdienste wenig über die Machtstrukturen in Afghanistan wissen. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 51 barn teilen das Interesse an Stabilität in der Region. Um dieses zu befördern und die neue Afghanistan-Strategie zu testen, hat auf Anregung der USA unter Schirmherrschaft der UN eine Afghanistan-Konferenz in Den Haag Ende März 2009 stattgefunden, an der sämtliche Anrainer, Truppensteller, die Großmächte und wichtigsten internationalen Organisationen teilnahmen, auch ein Vertreter Teherans. Der Test gilt als gelungen. Wie man sieht: Alle Konflikte im Krisenbogen zwischen Kairo und Kabul hängen eng miteinander zusammen. Sie können daher auch nur unter Behandlung ihrer Verwobenheit geregelt werden. Dazu bedarf es nachdrücklicher diplomatischer Anstrengungen, integrierter Strategien und multilateraler Zusammenarbeit, um Synergien zum Beispiel aus dem Truppenrückzug im Irak und einer Entspannung der Beziehungen mit Iran zu erzeugen und im israelisch-arabischen Friedensprozess zu nutzen. Dazu gehört auch, die Friedensbemühungen mit regionalen Sicherheitsabkommen zu untermauern. Eine solche Politik der Krisenbewältigung unterscheidet sich grundlegend von der Sicherheitspolitik der Bush-Administration, die sämtliche Konflikte im Nahen und Mittleren Osten unter den intellektuell und politisch fragwürdigen Gesichtspunkt der TerrorismusBekämpfung gestellt und dabei die Hauptquelle des islamistischen Terrorismus aus den Augen verloren hat. Denn diese würde versiegen, wenn der Nahostkonflikt endlich gelöst und eine haltbare regionale Sicherheitsstruktur geschaffen wird. Obama scheint diesen Konflikt als gefährlich und daher vordringliche Aufgabe zu begreifen. Eine schnelle Lösung ist allerdings nicht zu erwarten. Aber vielleicht schafft er es als begnadeter Kommunikator, die Konfliktparteien zum Reden und zu ernsthaften Verhandeln zu bringen. 3. Multilaterale Multipolarität Die Machtverschiebungen im internationalen System schwächen zwangsläufig die relative Weltmacht der USA und damit die westliche Dominanz insgesamt. Präsident Obama kommt nicht umhin, sich mit den Konsequenzen dieser säkularen Entwicklung intensiv zu beschäftigen – nicht etwa, weil er Konkurrenz zur amerikanischen Führungsrolle zu befürchten hätte. Denn keine der neuen Großmächte verfügt gegenwärtig über die Machtfülle und vor allem den politischen Willen zur Gestaltung der internationalen Beziehungen wie die USA, geschweige denn zur Gegenmachtbildung im Sinne der Mechanik der Balance of Power. Solche Ambitionen gab es nicht einmal, als der unbeliebte George W. Bush die Vereinigten Staaten regierte, allenfalls Bestrebungen, den Unilateralismus seiner Politik in die Schranken zu weisen. Allerdings bringt die Machtverschiebung das Verlangen der neuen Mächte und Machtgruppierungen nach mehr Mitbestimmung mit sich. Unumgänglich wird daher eine Multilateralisierung der Multipolarität. 52 Klaus-Dieter Schwarz China wird zweifellos die neue Weltmacht des 21. Jahrhunderts und die USA als die Nummer eins ablösen. Schon heute hat Washington keine Wahl, das Reich der Mitte als Schwergewicht im Konzert der Großmächte zu akzeptieren, ist es doch bereits größter Gläubiger der USA und wichtigster Importlieferant des US-Marktes. Die Bush-Administration verfolgte in der Chinapolitik einen Mittelweg zwischen „enlargement“ und „containment“, der einerseits China in das bestehende internationale System integrieren und andererseits durch Gleichgewichtspolitik im pazifischen Raum ausbalancieren sollte. Obama wird den Akzent mehr auf „engagement“ setzen in der Erwartung, dass China durch stärkere Einbindung in multilaterale Strukturen vermehrt den Ausgleich sucht und auch die Widersprüche zwischen rapider wirtschaftlicher Entwicklung und beharrlicher Parteiherrschaft mildert: „Wir werden mit China wetteifern auf einigen Gebieten und auf anderen zusammenarbeiten.“30 Die wirtschaftliche Konkurrenz wird angesichts der chinesischen Exportoffensive und des hohen Leistungsbilanzdefizits deutlich als Herausforderung empfunden. Andererseits macht Chinas Premier sich „Sorgen” um seine in US-Dollar geparkten Währungsreserven. China ist ebenso wie Russland seit Ende des Ost-West-Konflikts für eine multipolare Weltordnung eingetreten. Gleichwohl toleriert es die stabilisierende US-Präsenz in der Region, weil es zur Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft eine stabile internationale Umwelt benötigt. Die chinesische Führung weiß, dass Konfrontation den eigenen Interessen nicht dient. Sie unterstützt daher die USA im Kampf gegen den Terrorismus und bei der Eindämmung des Atomprogramms Nordkoreas. Der Konflikt mit Taiwan ist entspannt, die Beziehungen mit Russland und Indien haben sich deutlich verbessert. China hat auch seine Vorbehalte gegenüber multilateralen Formen regionaler Zusammenarbeit überwunden (Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, ASEAN Regional Forum). Pekings außenpolitisches Konzept einer „Harmonischen Welt” unterstreicht, dass sich in der chinesischen Diplomatie eine Hinwendung zum Multilateralismus vollzogen hat.31 Dies trifft sich mit der Absicht Obamas, einen „effektiveren Rahmen in Asien” zu schaffen, der über bilaterale Verträge und die Sechs-Parteien-Gespräche über Nordkorea hinausgeht.32 Bereits Präsident Clinton ist für eine stärker institutionalisierte Pazifische Gemeinschaft nach europäischem Vorbild eingetreten, aber damals noch auf höfliche Zurückhaltung gestoßen. Man wird sehen, ob die Zeit reif dafür ist. 30 31 32 Zit. Obama: Renewing American Leadership. Vgl. Bräuner, Oliver/Wacker, Gudrun/Zhon, Jiajing: Die „Harmonische Welt“ und Chinas Rolle im internationalen System, in: SWP-Zeitschriftenschau 2008/ZS 02, 2008. Zit. Obama: Renewing American Leadership. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 53 Auch Russland hat seinen Platz in der Weltordnung noch nicht gefunden. Es erhebt den Anspruch, eine Rolle als Großmacht auf Augenhöhe mit den USA und der EU zu spielen, der zwar dem wirtschaftlichen Gewicht des Landes nicht entspricht, doch ernst zu nehmen ist, wenn man mit Moskau ein verträgliches Verhältnis haben will. Obama betrachtet Russland weder als Gegner noch als engen Partner, aber er sieht die Bedeutung Russlands in all den Fragen, die sich seiner Außenpolitik stellen: Iran und das Nuklearprogramm, Stabilität im Irak, Erfolg in Afghanistan, Sicherheit Europas etc. Vor allem hat er sich vorgenommen, die von seinem Vorgänger für überflüssig gehaltene Rüstungskontrollpolitik wieder zu beleben. Dies stößt auf Moskaus Interesse. Obama hat angekündigt, den Ende 2009 auslaufenden Vertrag über die Begrenzung strategischer Atomwaffen (START I) zu verlängern und damit das mit der Sowjetunion vereinbarte Inspektionsregime fortzusetzen. Er will im Senat die Ratifizierung des Teststoppvertrages durchbringen, die Entwicklung neuer Atomsprengköpfe einstellen, ein weltweites Verbot der Produktion von Spaltmaterial für Atomwaffen erreichen und die Zahl der Atomsprengköpfe um 80 Prozent auf beiden Seiten abrüsten – das ist nicht weniger als eine radikale Wende in der amerikanischen Nuklearpolitik, die sich seit Ende des Kalten Krieges kaum verändert hat.33 In diesem Kontext sollen auch die umstrittenen Pläne zum Aufbau eines Raketenabwehrsystems in Polen und in Tschechien überprüft und vom Verhalten Irans zum amerikanischen Gesprächsangebot abhängig gemacht werden.34 Dies gibt Russland Anreiz, schärfere Sanktionen mitzutragen, falls Teheran nicht einlenkt. Der Kreml hat bereits die angedrohte Stationierung von Kurzstreckenraketen in Kaliningrad ausgesetzt. Es kommt also neuer Schwung in das durch fragwürdige Rüstungsprojekte und fortgesetzte Osterweiterung der NATO belastete amerikanisch-russische Verhältnis. Dies stärkt auch die Sicherheit Europas, denn diese beruht auf Sicherheit mit und nicht gegen Russland. „Amerika hat keinen besseren Partner als Europa”, bekannte Obama in seiner Berlin-Rede. Die EU-Außenminister begrüßten seine Wahl mit einem umfassenden Kooperationsangebot: „Die Weltordnung hat sich verändert. Die Europäer wollen darin ihre Rolle an der Seite der Amerikaner spielen.”35 Folglich geht es um eine veränderte transatlantische Beziehung – eine, die nicht vom Wunsch nach Wiederherstellung, sondern von dem der Neugestaltung bestimmt ist, die sowohl den neuen globa33 34 35 Vgl. Arms Control Today 2008 Presidential Q&A: President-elect Barack Obama, Arms Control Association, 2008. Vgl. ebd. Obamas Aussage, dass er das Abwehrsystem nicht ohne Zustimmung der Bündnispartner und erwiesene Einsatzreife stationieren werde. EU will eng mit Obama zusammenarbeiten, zit. aus: Spiegel Online, 15.11.2008. 54 Klaus-Dieter Schwarz len Ordnungsproblemen als auch der schleichenden Machtverschiebung vom Atlantik zum Pazifik Rechnung trägt. Inzwischen hat sich die EU zu einem selbstständigen Akteur in der entstehenden multipolaren Welt entwickelt und in der Debatte über Weltfinanzreform, Klimaschutz, vernetzte Sicherheitspolitik sowie durch entschlossenes Handeln im Georgienkonflikt gezeigt, dass sie zur Gestaltung der Weltordnung eine Menge beitragen kann. Gleichwohl bleiben die USA für Europa wichtig, denn nur in Partnerschaft mit der amerikanischen Außenpolitik kann die europäische Außenpolitik globale Bedeutung gewinnen. Umgekehrt ist der europäische Beitrag notwendig, damit die USA eine konstruktive Rolle in der Welt spielen können. „Amerikaner und Europäer müssen und können sich wechselseitig ergänzen und gemeinsam Verantwortung tragen”, heißt es in dem Strategiepapier der EU-Außenminister. Dies verlangt allerdings substanzielle und regelmäßige Konsultationen, gemeinsame Entscheidungsfindung und gerechte Lastenteilung: „no taxation without representation”. Kann die NATO wieder der Ort werden, an dem die transatlantischen Partner ihre strategischen Vorstellungen konsultieren und koordinieren? An diesem Verständnis der Allianz als politisches Bündnis hat es in den vergangenen Jahren beiderseits gefehlt. Die USA nutzten sie zur Mitsprache in Angelegenheiten europäischer Sicherheit und als „Werkzeugkasten” für ihre Globalpolitik. Die Europäer konzentrierten sich auf den Ausbau der EU und Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die zivile und militärische Mittel miteinander verknüpft. Die NATO hat dagegen als Anbieter von Sicherheit nur militärische Stärke und organisatorische Fähigkeiten aufzuweisen. Dennoch kann sie wieder eine lebendige Organisation der transatlantischen Bündnispartnerschaft werden. In diese Richtung zielt ein gemeinsames Papier der Bundeskanzlerin Merkel und des französischen Präsidenten Sarkozy.36 Sie fordern für den bevorstehenden NATO-Gipfel, der im April 2009 von beiden Ländern gemeinsam ausgerichtet wird, eine Grundsatzdebatte über Sinn und Zweck des Bündnisses. Der politische Charakter der NATO müsse wieder in den Vordergrund treten. „Dies bedeutet: gemeinsames Analysieren, Entscheiden und Umsetzen. Einseitige Schritte würden dem Geist dieser Partnerschaft widersprechen.” Das sind klare Worte gegen amerikanische Alleingänge, offenkundig bezogen auf die Bush-Ära. Beide Politiker sind nicht der Meinung, die NATO benötige eine neue Strategie, sondern schlagen vor, das strategische Konzept der Allianz von 1999 „zu überarbeiten”. Die Beistandsverpflichtung sei der „Wesenskern” des Bündnisses, womit sie Bestrebungen, die NATO in eine globale Sicherheitsagentur zu verwan36 Merkel, Angela/Sarkozy, Nicolas: Wir Europäer müssen mit einer Stimme sprechen, in: Süddeutsche Zeitung, 4.2.2009. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 55 deln, eine Absage erteilen. Vielmehr komme es darauf an, die Kombination von zivilen und militärischen Mitteln stärker zu betonen – sie sei das „Markenzeichen der europäischen Sicherheitspolitik”. Folglich müssen NATO und EU enger zusammenwirken, doch dies ist das bisher ungelöste Problem. Vor allem muss zunächst der EU-Reformvertrag von Lissabon in Kraft treten, der u.a. die institutionellen Voraussetzungen schafft für eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die endlich ihren Namen verdient. Obama misst Konsultationen sowohl zu Hause als auch mit engen Verbündeten große Bedeutung bei. Seine Regierung wird daher die NATO wieder als Ort der politischen Debatte nutzen. Auch ihr „smart power“-Konzept kommt der vernetzten Sicherheitspolitik der Europäer entgegen. Die europäische Fokussierung der Allianz auf den „Wesenskern“ der Abschreckung und kollektiven Verteidigung dürfte ihr allerdings als zu eng erscheinen, weil zu reaktiv, statisch und stationär. In diesem Punkt zeichnen sich Differenzen ab, die bei der Beratung über das künftige strategische Konzept der NATO zur Diskussion stehen werden. Es geht einmal mehr um die umstrittene Frage „Globalisierung“ des Bündnisses durch Ausweitung von NATO-Partnerschaften unterhalb der Mitgliedschaft, die es bereits gibt zum Beispiel mit Australien, Japan etc., und durch proaktives Handeln zwecks Eindämmung von Bedrohungen jenseits des Bündnisgebietes.37 Damit ist die Debatte über den künftigen Zuschnitt des Bündnisses eröffnet. Die USA werden in dieser Frage von den Europäern mehr Anpassung an die neuen Herausforderungen und mehr Effizienz erwarten. Und so leicht wie in der Ära Bush werden sie sich dem nicht entziehen können. Schließlich: Multilateralismus im Zeitalter beschleunigter Interdependenz und entstehender Multipolarität funktioniert schlecht ohne wirksame Institutionen. Die wichtigsten wurden vor sechzig Jahren von den USA geschaffen. Sie sind überholt und ineffektiv: Der UN-Sicherheitsrat mit seinen fünf Vetomächten bildet das Kräftegewicht nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ab, erfüllt seine Zuständigkeit – „Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit” – nur unzulänglich und ist reformresistent; der Internationale Währungsfonds (IWF) konnte das Entstehen der Weltfinanzkrise zwar frühzeitig erkennen, aber nichts dagegen unternehmen; die Doha-Runde der Welthandelsorganisation (WTO) befindet sich im achten Verhandlungsjahr und tritt ergebnislos auf der Stelle, weil sie sich nicht auf den Abbau von Agrarsubventionen und Industriezöllen einigen kann. Solche Ineffizienz der globalen Organisationen untergräbt die Legitimität internationaler Ordnung. 37 In diese Richtung zielen Aussagen des Sicherheitsberaters Jones auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2009, vgl. Süddeutsche Zeitung, 9.2.2009, S.6. 56 Klaus-Dieter Schwarz Obama hat Reformen der internationalen Organisationen und deren Anpassung an die heutigen Machtverhältnisse angekündigt. Das bedeutet für die westlichen Staaten, dass ihre Überrepräsentierung in vielen Institutionen nicht mehr vertretbar ist. Es sei notwendig, „aufstrebenden Mächten wie Brasilien, Indien, Nigeria und Südafrika einen Anteil bei der Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung zu geben. Dafür benötigen die Vereinten Nationen weitreichende Reformen.”38 Diese Absicht ist zwar recht und billig, aber die Folge mangelnder Bereitschaft zum Interessenausgleich zwischen etablierten und aufsteigenden Mächten wird eher sein, dass die Regionen mit zunehmendem Selbstbewusstsein ihre eigenen Sicherheitsinstitutionen aufbauen wie in der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit oder der Afrikanischen Union bzw. dort, wo sie fehlen, wie in der Golfregion. Selbst ein reformierter UN-Sicherheitsrat könnte die Krisen- und Konfliktpotenziale im Nahen und Mittleren Osten nicht wirksam behandeln. Für solche Probleme sind flexible Koalitionen besser geeignet: Kontaktgruppen, Quartetts, die EU-3, P5 plus 139 etc. Auch für die neue Mächtekonzertierung im multipolaren System gibt es bereits ein Forum, das gute Dienste in Wirtschaftsfragen geleistet hat: die Gruppe der führenden Industrieländer (G 7 plus Russland), die indes wie der UNSicherheitsrat die politische Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts nicht mehr widerspiegelt. Die Zusammenkunft der G 20 im November 2008 war aus der Not der globalen Finanzkrise geboren, könnte aber Ausgangspunkt für regelmäßige Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in erweiterten Formaten (G 13 plus x) werden, um den zunehmenden Regulierungsbedarf in der Weltpolitik untereinander abzustimmen. Kurz: Weltordnungspolitik (Global Governance) in der interdependenten und multipolaren Welt findet offenkundig in einer Kombination aus globalem, interregionalem und modularem Multilateralismus statt. Obamas Administration steht somit vor dem Problem, die Rolle der USA an eine Weltordnung anpassen zu müssen, die Washington nicht mehr kontrollieren kann. Das ist neu für Amerika, denn bisher war es gewohnt, sich entweder anderthalb Jahrhunderte zu isolieren oder die Welt zu dominieren. Das künftige internationale System wird komplexer sein als alle anderen, mit denen sich die amerikanische Diplomatie bisher auseinanderzusetzen hatte. Es erinnert an eine vergleichbare europäische Konstellation im 18. und 19. Jahrhundert, an das europäische System des Gleichgewichts, das funktionierte, solange die fünf Mächte Konsens untereinander finden konnten. Als sie keinen mehr fanden, nämlich 1914 und 1939, führte es zur Katastrophe, in die sie zweimal die USA hineinzogen. Deshalb hat Amerikanern die Vorstellung, eine Weltordnung auf einer Art Gleichgewicht aufzubauen, nie sonderlich gefallen. Doch damals 38 39 Zit. Obama: Renewing American Leadership. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates plus Deutschland, die mit Iran über dessen Atomprogramm verhandeln. Ein neuer globaler Multilateralismus der USA 57 war die Interdependenz in den Beziehungen der großen Mächte untereinander noch zu schwach für einen Zusammenhalt und Krisenmanagement bietenden Multilateralismus. Heute ist dieser in integrierten Staatenverbindungen, internationalen Organisationen und Verträgen, aber auch in locker gefügten Institutionen, flexiblen Gruppen und NichtregierungsOrganisationen (NGOs) verfügbar. Auch andere Großmächte, teilweise mit extrem unterschiedlichen Kulturen wie Indien und China, stehen vor dem gleichen Problem, sich in eine neue Weltordnung einzufügen und dafür das Instrumentarium des Multilateralismus zu nutzen. Dies erfordert von den USA eine Abkehr von hegemonialen Tendenzen bisheriger Weltmachtpolitik und von ihren Partnern Übernahme von mehr internationaler Verantwortung. Die Schlussfolgerung hat die Qualität einer Binsenwahrheit und Aussicht, als gängige Floskel Karriere zu machen: „Amerika kann die Probleme nicht ohne die Welt lösen, und die Welt kann die Probleme nicht ohne die USA lösen.”40 Ausblick „Wir müssen Amerika erneuern“, hat Präsident Barack Obama seiner Nation in der Antrittsrede am 20. Januar zugerufen. Und weil Umwälzungen in den Vereinigten Staaten stets globale Folgen haben, gilt dieser Aufruf der ganzen Welt: „Wir sind bereit, die Führung einmal mehr zu übernehmen“ – diesmal nicht mehr als Hegemon, sondern als primus inter pares. Die wichtigsten Bausteine einer erneuerten Weltordnung sind die Staaten Nordamerikas und Europas, weil sie sich in den entscheidenden Fragen als kooperativer erwiesen haben als andere Regionen. Daraus folgt zweierlei. Zum einen liegen ihre wesentlichen Interessen im Nahen und Mittleren Osten so eng beieinander, dass ihre Zusammenarbeit bei der Stabilisierung und Entwicklung dieses Teils der Welt sich nahezu von selbst versteht. Die Region ist für die Sicherheit beider Kontinente so zentral, dass dort nicht nur gemeinsames Krisenmanagement vonnöten ist, sondern sich auch neue Formen eines innovativen Multilateralismus zur Reform der Region empfehlen. Zum anderen ist ihre Partnerschaft gefordert bei der Aufgabe, die aufstrebenden Mächte in eine Weltordnung zu integrieren, die sie nur dann unterstützen, wenn sie an der Regelung der regionalen und globalen Probleme dieser Welt auch gleichberechtigt teilhaben. Das bedeutet aber, dass der Westen sich allmählich von seiner 500-jährigen Dominanz der Welt verabschieden und anderen Zivilisationen mehr Einfluss gewähren muss. Präsident Obama wird eine neue und globale multilaterale Außen- und Sicherheitspolitik betreiben. Nicht nur, weil es seiner persönlichen Über40 Hillary Clinton bei ihrer Vorstellung als Außenministerin, zit. in: Süddeutsche Zeitung, 2.12.2008, S.1; dieselbe Aussage in ihrem Statement im Auswärtigen Ausschuss des Senats, 13.1.2009. 58 Klaus-Dieter Schwarz zeugung entspricht, sondern weil die USA unilateral nur noch wenig (wenn überhaupt) erreichen können. Deshalb wird sich die amerikanische Haltung zum Multilateralismus der europäischen angleichen, das heißt: Multilateralismus wird nicht mehr verstanden nur als Mittel, sondern als Ziel der Außenpolitik. Dabei handelt es sich aber um einen fordernden Multilateralismus, der auf Resultate größeren Wert legt als auf Prozesse und Kompromisse auf kleinem gemeinsamen Nenner, die für die europäische Art des Multilateralismus charakteristisch sind. Daraus können sich transatlantische Frustrationen ergeben, wenn die Europäer auf das neue Arrangement – mehr amerikanische Kooperation und mehr europäisches Engagement im Gegenzug – so vielstimmig reagieren wie üblich, anstatt auf die Herausforderungen der Globalisierung kraftvolle Antworten zu geben, die nur die Union liefern kann. Dem steht auf amerikanischer Seite ein Problem gegenüber, das die Europäer im integrierten Staatenverbund aufgelöst und geregelt haben: die Spannung zwischen demokratischer Kontrolle der Außenpolitik und Einschränkung nationaler Souveränität durch Einbindung in multilaterale Strukturen. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass die USA diese Erfahrung dichter und vertiefter internationaler Kooperation bisher kaum kennen, sondern ergibt sich aus ihrem politischen System der verschränkten Gewalten, in dem der Kongress Teil der Regierung („the other brunch of government“) ist und in der Außenpolitik eine eigenständige Rolle spielt. Der Kongress begreift Einbindung in multilaterale Politik und Verfahren als Stärkung der Exekutive und Schwächung seiner Kontrollfunktion, weshalb er quasi automatisch gegensteuert und befugt ist, die Administration zur Korrektur ihrer Außenpolitik zu bewegen. Der Präsident wird also an zwei Fronten für die Unterstützung seiner neuen Außenpolitik werben müssen: bei den internationalen Partnern und im Kongress, vor allem im Senat, der internationalen Vereinbarungen mit Zweidrittelmehrheit zustimmen muss und daher ein kohärentes, multilateral ausgerichtetes Regierungshandeln in der Weltpolitik erschwert. Zwar verfügen dort die Demokraten über eine starke Mehrheit, aber darauf kann er sich nicht verlassen, vielmehr auf seine Überzeugungskraft und den überparteilichen Ansatz. Schließlich kommt es in Krisenzeiten auf politische Führerschaft an, auf eine Leitfigur wie Präsident Barack Obama, der in Amerika und weltweit bei Abermillionen Zustimmung sammelt für eine „neue Ära der Verantwortlichkeit“. Er verspricht Wandel und fordert Engagement und Mitverantwortung: Das ist sein Führungskonzept, mit dem er in der Innen- und Außenpolitik ans Werk geht. Er setzt als Charismatiker und Pragmatiker neue Standards für gutes Regieren und effektives multilaterales Handeln im Zeichen einer relativen Schwächung amerikanischer Macht in der Welt. Er begreift die Krise als Chance, sein Versprechen einzulösen. Man darf gespannt sein auf die Resultate. Amerikanische Außenpolitik im Konzert der Mächte statt hegemonial-imperialer Politik Werner Link 1. Vorbemerkungen Die Einschätzung, ob Kontinuität oder Wandel die Außenpolitik des neuen amerikanischen Präsidenten Obama charakterisieren wird, ist schwierig, weil einer Prognose zu Beginn seiner Amtszeit zwar viele aussagekräftige Worte, aber wenige politische Entscheidungen und Taten zugrunde gelegt werden können und weil die enorme emotionale Euphorie, die sich mit der spektakulären Amtseinführung des begnadeten Charismatikers in den USA und weltweit ausgebreitet hat, einer rationalen Analyse tendenziell entgegensteht. Unbestreitbar war im Wahlkampf Obamas Schlüsselwort „change“. Es bezog sich auch auf die Außenpolitik, obwohl sie nur eine marginale Rolle spielte. In der Schlussphase wurden die Finanzkrise und deren Auswirkungen zum alles dominierenden Thema. Nach dem Wahlsieg und in der Übergangsphase, als Obama sein außenpolitisches Team präsentierte, mehrten sich die Stimmen, die – erleichtert oder besorgt – für die Außenpolitik eher Kontinuität als Wandel prognostizierten. Dass der gewählte Präsident entschied, Bushs Verteidigungsminister im Amt zu belassen und den ehemaligen Mitarbeiter von Außenministerin Rice, General James Jones, zu seinem Sicherheitsberater zu machen, wurde als Kontinuitätssignal interpretiert. Es war dann Robert Gates selbst, der alsbald öffentlich eine „message of continuity“ verkündigte und zur Begründung ausführte, „that a change in administration does not alter our fundamental interests“.1 Bedingen also – allgemein formuliert – gleichbleibende fundamentale Interessen die Kontinuität der Außenpolitik, und zwar auch dann, wenn sich die Machtrelationen im internationalen System und im Staat ändern? Und wird demzufolge – ungeachtet der internationalen machtpolitischen Veränderungen, die in jüngster Zeit manifest geworden sind – in der amerikanischen Außenpolitik unter Obama mehr „continuity“ als „change“ obwalten? Oder deutet vielmehr Obamas Inaugurationsrede, die ein großes Programm der Erneuerung enthält und sich deutlich von der Politik der Administration Bush abkehrt (siehe unten), darauf hin, dass Wandel statt Kontinuität zu erwarten ist? 1 Rede auf der Sicherheitskonferenz in Bahrein am 13.12.2008, zitiert nach International Herald Tribune (IHT), 13.12.2008. 60 Werner Link Bevor man vorschnell auf diese Frage bejahend oder verneinend antwortet, sollte man bedenken, dass vielleicht beide Begriffe fälschlich als dichotomisches Gegensatzpaar verstanden werden und dass sie ganz gewiss ohne eine Operationalisierung für die empirische Analyse unbrauchbar sind. Der große österreichisch-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Harvard-Professor Alexander Gerschenkron hat in seinem wegweisenden Aufsatz „On the Concept of Continuity in History“2 in diesem Sinne argumentiert und dabei im Rekurs auf Kant und Schopenhauer verdeutlicht, dass Kontinuität „gradueller Wandel” ist und umgekehrt. Er hat daran anschließend verschiedene begriffliche Varianten von Kontinuität unterschieden, die sich zur Beschreibung der empirischen Realität eignen. Die erste Variante ist m.E. die wichtigste. Sie begreift Kontinuität als „Richtungskonstanz”. Umgekehrt ist dann Wandel als Richtungsänderung zu definieren. Mit Hilfe dieser begrifflichen Unterscheidung wird im Folgenden diskutiert, ob sich die amerikanische Außenpolitik unter Obama – ungeachtet einiger Modifikationen im Einzelnen – in die Richtung bewegen wird, in die sie von Bush sen. bis Bush jun. entwickelt worden ist (siehe die Skizze unter Punkt 2), oder ob und gegebenenfalls warum eine Richtungsänderung zu erwarten ist und welche alternativen Richtungen unter den neuen machtpolitischen Bedingungen als realistisch und realisierbar gelten können (siehe dazu die Punkte 3 bis 5). Abschließend wird skizzenhaft eine grundsätzliche Richtungsalternative zur hegemonialen und imperialen Ausrichtung der amerikanischen Außenpolitik vorgestellt, und es wird erörtert, ob es für diese Alternative im außenpolitischen Programm Obamas Ansätze gibt.3 2. Die hegemonial-imperiale Richtung der amerikanischen Außenpolitik In welche Hauptrichtung orientierte sich die amerikanische Außenpolitik nach der Bipolarität bis heute? Nach dem Wegfall der Sowjetunion wurde die neue internationale Machtverteilung in den USA als unipolar wahrgenommen („the unipolar moment“), obwohl, objektiv betrachtet, eher eine Kombination aus militärischer Quasi-Unipolarität und politi- 2 3 Siehe Gerschenkron, Alexander: On the Concept of Continuity in History, in: Proceedings of the American Philosophical Society 3/1962, S.195-209. Die Begriffe Hegemonie und Imperium werden gemäß dem empirisch gesättigten Standardwerk von Heinrich Triepel (Die Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten, 2. Neudruck der Ausgabe von 1943, Aalen 1974) verwendet. Hegemonie liegt demnach „in der Mitte zwischen der untersten und der obersten Stufe der Machtskala“, „zwischen der Stufe des bloßen Einflusses und der der Herrschaft“. Führung ist „bestimmender Einfluss“, keine Herrschaft. „Führung ist der ‚Gegenpol‘ zur Herrschaft“ und bedarf der Anerkennung/Akzeptanz der Geführten. Sie ist „leadership, not dictation“ (S.40f.). Amerikanische Außenpolitik im Konzert der Mächte 61 scher Multipolarität zu konstatieren war.4 Dass die USA die herausragende globale Macht in der Spitzengruppe der großen Mächte waren, war jedoch unbestreitbar. Daraus resultierte ihr weltweiter Führungsanspruch. So feierte Präsident Bush sen. in seinem Bericht zur Lage der Nation vom 28. Januar 1992 die Veränderungen in der Welt mit folgenden Worten: Der Kommunismus sei gestorben; Amerika habe durch die Gnade Gottes den Kalten Krieg gewonnen. „Eine einstmals in zwei bewaffnete Lager geteilte Welt erkenne heute eine einzige und überragende Macht an – die Vereinigten Staaten von Amerika.“ Die USA seien von der „Führungsmacht des Westens“ zur „Führungsmacht der Welt“ geworden; sie seien die „unbestrittene Führungsmacht dieses Zeitalters“. Bushs Nachfolger hat dieses Selbstverständnis wiederholt und mit gewissen Abwandlungen zum Ausdruck gebracht. Die USA seien, so Präsident Clinton, „die herausragende Weltmacht“ (National Security Strategy of Engagement and Enlargement, Juli 1994); die „amerikanische Führungsrolle“ sei „unerlässlich“, „weil zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand außer uns dasselbe für die Förderung von Frieden, Freiheit und Demokratie leisten“ könne (Rede vom 5. August 1996); eine „weltweite Führungsrolle“ müsse von dieser „unerlässlichen Nation“ ausgeübt werden (Bericht zur Lage der Nation, 4. Februar 1997). Daraus ergab sich – wohl gemerkt schon unter Präsident Clinton – für die Außenpolitik der USA folgende Maxime: „Unilateral (zu handeln), wenn unsere direkten nationalen Interessen am stärksten betroffen sind; in Allianz und Partnerschaft, wenn unsere Interessen von anderen geteilt werden; und multilateral, wenn unsere Interessen allgemeiner Art sind und die Probleme am besten von der internationalen Gemeinschaft angegangen werden“ (National Security Strategy, 1994). Die skizzierte hegemoniale Ausrichtung, die – wie an anderer Stelle gezeigt wurde5 – auch die praktische Außenpolitik der USA in den neunziger Jahren bestimmte, wurde nach dem 11. September 2001 von Präsident Bush jun. mit der National Security Strategy von 2002 in imperiale Richtung übersteigert, zu einem „Hegemonialismus mit imperialen Implikationen“6. Die USA machten sich unter dem Einfluss der Neo-Konservativen auf den „Weg zum Imperium“ (James Kurth), und dieser Weg war – wie bei ähnlichen historischen Entwicklungen – „mit hegemonialen Steinen gepflastert“ (Heinrich Triepel). Unter diesem Aspekt betrach4 5 6 Siehe dazu und zum Folgenden ausführlicher Link, Werner: Die Neuordnung der Weltpolitik, München, 3. erw. Aufl., 2001, S.127-135. Unter anderem in dem „Jahrbuch Internationale Politik“, zweijährlich herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Rudolf, Peter: Imperiale Illusionen, Baden-Baden 2007, S.188. 62 Werner Link tet, handelte es sich also nicht um eine Richtungsänderung, sondern um ein Weiterschreiten. Indes, indem die Bush-Doktrin das seit dem Westfälischen Frieden gültige Ordnungsprinzip der Souveränität zur Disposition der Großmacht USA stellte und somit „the end of Westphalia“7 signalisierte, entstand eine grundsätzlich neue Ordnungsperspektive, die alles andere als Richtungskontinuität beinhaltete. John G. Ikenberry hat die entsprechende „neoimperial grand strategy“ als eine Kombination aus sieben Elementen beschrieben:8 – – – – – – – fundamentale Verpflichtung und Entschlossenheit, die Unipolarität zu erhalten und den Aufstieg von Rivalen zu verhindern, statt Abschreckung Eliminierung transnationaler Terroristen und „outlaw states“-, präventive Offensive statt Verteidigung, unilaterale Entscheidung darüber, wer die Souveränität verwirkt hat, und entsprechendes Handeln, Abwertung internationaler Regeln, Verträge und Sicherheitspartnerschaften, „Coalitions of the willing“ und nur selektive Nutzung von Allianzen, Bereitschaft, Risiken der Destabilisierung als Preis für eine Neuordnung in Kauf zu nehmen. Als weiteres Element ist meines Erachtens noch die Anwendung des Prinzips „divide et impera“ hinzuzufügen. Diese neoimperiale Strategie unterscheidet sich – wie Ikenberry gezeigt hat – grundsätzlich von den beiden traditionellen konkurrierenden Strategien der USA, von der „realistischen“ und der „liberalen“, obwohl sie einige ihrer Elemente in sich aufnimmt. Im „imperialen Syndrom“9 erlangen die Traditionen des amerikanischen Exzeptionalismus und des Missionarismus eine neue Bedeutung. James Kurth sieht in historischer Perspektive die neoimperiale Politik Bushs sogar als vierten und vorerst letzten Akt in dem imperialen Drama der USA, „in the long march of the American Empire, from its origins on the eastern shore of the North American continent to the outer reaches of the great globe itself“.10 Wird es nun unter Obama zu einer Richtungsänderung kommen? Wie sehen die Voraussetzungen dafür aus? 7 8 9 10 Kissinger, Henry: Preemption and the end of Westphalia, in: New Perspectives Quarterly 4/2002, S.31-36. Ikenberry, G. John: America‘s Imperial Ambition, in: Foreign Affairs 5/2002, S.44-62. Maier, Charles S.: America Among Empires?, in: German Historical Institute Bulletin 41/ 2007, S.21-31. Kurth, James: Confronting the Unipolar Moment: The American Empire and Islamic Terrorism, in: Current History 659/2002, S.403-408, hier S.408. Amerikanische Außenpolitik im Konzert der Mächte 63 3. Machtpolitische Veränderungen und Entmythologisierung Die Anwendung der neoimperialen Strategie durch die Regierung Bush hat in der internationalen Politik die von den Neo-Realisten vorausgesagte Gegentendenz zur „Zähmung“ und Balancierung der amerikanischen Macht gestärkt. In den USA sind unter dem Eindruck des Irak-Desasters im Wahljahr die „myths of empire“11 zunehmend erodiert. Mit dieser „Entmythologisierung“, die von Obama kräftig unterstützt wurde und wird, ist der Boden für eine außenpolitische Richtungsänderung bereitet worden. Vor allem aber haben die dramatische Finanz- und Wirtschaftskrise und deren Auswirkungen die Einsicht in die objektiven machtpolitischen Veränderungen gefördert, die der Fortsetzung der neoimperialen Politik ihre Basis entziehen. Der demokratische Kongressabgeordnete Barney Frank, Vorsitzender des Financial Services Committee, konstatiert bereits im September 2008 in einem Hintergrundgespräch (was später Finanzminister Paulson und Notenbankchef Bernanke in den Hearings öffentlich erläuterten): „... let‘s be realistic: We‘re no longer the dominant world power.“12 Zwei Monate später, im November 2008, hieß es in dem Bericht des National Intelligence Council „Global Trends 2025: A Transformed World“, dass die USA zwar der wichtigste globale Akteur bleiben, aber ihr Einfluss auf politischem, wirtschaftlichem und militärischem Gebiet in der multipolaren Welt abnehmen werde. (In der Studie von 2004 war noch vorausgesagt worden, dass die USA ihre Vormachtstellung weiter ausbauen würden.)13 Und Anfang 2009 veröffentlichte der U.S. Joint Forces Command seine geopolitische Einschätzung „Joint Operating Environment 2008“, in der die Herausforderung für die USA darin gesehen wird, dass sie „more like other nations“ würden – „first among equals“. Andere Großmächte würden zwar die USA nicht besiegen können, aber häufiger willens sein, „to say no to Washington“14. In der wissenschaftlichen Literatur ist ebenfalls die Meinung vorherrschend, dass in der neuen Welt „America is only one of several great powers“15. Die Gegenstimmen stammen verständlicher Weise meistens aus dem neo-konservativen Lager.16 Aber sicherlich ist die Einschätzung richtig, dass es – wie Jens van Scherpenberg in diesem Band urteilt – nach der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise eine Rückkehr zum status quo 11 12 13 14 15 16 Snyder, Jack: Imperial Temptations, in: The National Interest 71/2003, S.29ff. Siehe Cohen, Roger: The fleecing of America, in: IHT, 21.9.2008. Zitiert nach Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 22.11.2008. Siehe Bandow, Doug: First Among Equals, in: The National Interest, 12.1.2009. Gray, John: A shattering moment in America‘s fall from power, in: Observer, 28.9.2008. Vgl. u.a. Kagan, Robert: Still No.1, in: Washington Post, 30.10.2008. Eine einfühlsame Darstellung des Neokonservatismus bietet Keller, Patrick: Neokonservatismus und Amerikanische Außenpolitik, Paderborn 2008. Auch andere Autoren – wie z.B. William Wohlforth – halten an ihrer Dominanzthese fest. 64 Werner Link ante, zu den alten Kräfteverhältnissen und zu der ihnen entsprechenden Politik, nicht geben wird. Mit guten Gründen lässt sich argumentieren, dass schon vor der Krise neue Machtzentren entstanden sind und die Weltordnung multipolar geworden ist – vor allem im geo-ökonomischen Bereich.17 Die Krise hat die Machtverschiebungen nur manifest werden lassen. Mehr noch: Die Illusion von der Unipolarität und die daraus resultierenden „imperial temptations“ (Jack Snyder) haben jene Politik von „Kanonen und Butter“ der Regierung Bush und der Federal Reserve Bank begründet, die das Ausmaß der Finanzkrise verursacht hat (siehe van Scherpenberg). Die neoimperiale Politik ist nicht nur militärisch, sondern auch ökonomisch und mithin gesamtpolitisch gescheitert. Das ist die Ausgangssituation bei Obamas Regierungsantritt. 4. Rückkehr zur gemäßigten Hegemonialpolitik? Obamas Wahlkampfversprechen, die Nation „in eine neue Richtung zu lenken“18, bezog sich auf die Finanz- und Wirtschaftspolitik, auf die Überwindung der ökonomischen Krise. Aber bekanntlich hängen Wirtschaftsund Außenpolitik eng miteinander zusammen – im Zeitalter der Globalisierung noch enger als auch schon früher. Wenn man den wiederholt vorgenommenen Vergleich mit der großen Finanz- und Wirtschaftskrise von 1929 und die Jahre danach sowie den Wechsel von dem Republikaner Hoover zu dem Demokraten Roosevelt betrachtet, so wird oft übersehen, dass Präsident Roosevelt gleichzeitig mit dem New Deal eine außenpolitische Richtungsänderung vornahm (Anerkennung der Sowjetunion und Einschwenken auf die Status-quo-Politik als Antwort auf die Expansionspolitik Japans und auf die revisionistische Politik des Dritten Reiches). Eine Kombination von wirtschaftspolitischer und geopolitischer Richtungsänderung unter Obama wäre also keineswegs ohne Beispiel. Nimmt man Ikenberrys Begriffsoperationalisierung als eine Art „checklist“, so sprechen die bisherigen Erklärungen und ersten Amtshandlungen Obamas19 nicht für eine Fortsetzung der neoimperialen Politik Bushs. Einige der von Ikenberry aufgelisteten Elemente finden sich zwar auch in Obamas Programm: die „Revitalisation“ des Militärs (u.a. durch weitere 65.000 Armeesoldaten und 27.000 Marines) und die Zusicherung: „I will 17 18 19 Siehe Subacchi, Paola: New power centres and new power brokers, in: International Affairs 3/2008, S.485-498. Schon 2002 schrieb Emmanuel Todd einen „Nachruf“ auf die „Weltmacht USA“; vgl. auch Kupchan, Charles: The End of the American Era, New York 2002. Zitiert nach FASZ, 18.1.2009. Die folgenden Zitate sind dem Grundsatz-Artikel „Renewing American Leadership“entnommen, in: Foreign Affairs 4/2007, und der Inauguralrede vom 20.1.2009 (zitiert nach dem Abdruck in: IHT, 20.1.2009 und der Übersetzung in: FAZ, 22.1.2009). Amerikanische Außenpolitik im Konzert der Mächte 65 not hesitate to use force, unilaterally if necessary, to protect the American people or our vital interests whenever we are attacked or imminently threatened.“ Indes, beide Elemente waren auch in Präsident Clintons National Security Strategy enthalten als Elemente hegemonialer Politik (siehe oben). Auf einen Nenner gebracht, kann das außenpolitische Programm Obamas als Versuch charakterisiert werden, die imperiale Übersteigerung der Bush Ära zu beenden und zu der traditionellen hegemonialen Politik (wie sie oben beschrieben wurde) zurückzukehren und sie in abgewandelter Form fortzusetzen: „To renew American leadership in the world“, „ready to lead once more“: Der Führungsanspruch ist verbunden mit der Bereitschaft zur Kooperation („We need effective collaboration on pressing global issues among all the major powers.“), Stärkung bestehender Allianzen (wie der NATO), Bildung neuer Allianzen und Partnerschaften in anderen vitalen Regionen sowie in der Umwelt- und Klimaschutzpolitik, aktiven Kooperation mit Russland (einschließlich der nuklearen Rüstungsbeschränkungen) und kompetitiven Kooperation mit China („a relationship that broadens cooperation while strengthening our ability to compete“). Obama erklärte, „a new vision of leadership in the twenty-first century (...) draws from the past but is not bound by outdated thinking. The Bush administration responded to the unconventional attacks of 9/11 with conventional thinking of the past, largely viewing problems as statebased and principally amenable to military solutions“. Trotz dieser klaren Abgrenzung behält Obama Bushs Definition vom „Krieg“ gegen die Terroristen bei: „Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred“, und sie werde in diesem Krieg siegen – in Kooperation mit ihren Partnern. Obamas Führungskonzeption ist – insgesamt betrachtet – mit der Bereitschaft verbunden, auf andere Staaten, auf deren Interessen und Meinungen einzugehen, den offenen Dialog mit den Verbündeten und sogar mit den Gegnern zu führen. Obama zeigt auch Bemühungen, regionale Konflikte zu regulieren (siehe dazu unten) und mit der muslimischen Welt partnerschaftliche Beziehungen zu entwickeln. Gemeinsame oder wechselseitige Interessen und gegenseitiger Respekt! „America cannot meet the threats of this century alone, and the world cannot meet them without America. We can neither retreat from the world nor try to bully it into submission. We must lead the world, by deed and example.“ Dazu gehört die Wiederbeachtung des Folterverbots und der rechtstaatlichen Grundsätze. Mit der Entscheidung über die Schließung des Guantanamo-Gefängnisses und die Neuordnung der Gerichtsverfahren wurde, die Ernsthaftigkeit des Wandels signalisierend, die Amtsarbeit eröffnet. Kluge Macht ist das Schlagwort der neuen Strategie, das die Verbindung harter und weicher 66 Werner Link Macht anzeigen und unilaterale militärische Machtausübung als unklug erscheinen lassen soll. „Our power alone cannot protect us, nor does it entitle us to do as we please.“ Aber natürlich ist auch die Diplomatie, die Obama bevorzugt, eine machtgestützte Diplomatie, eine „tough-minded diplomacy, backed by the whole range of instruments of American power – political, economic and military“. Zur Begründung des amerikanischen Führungsanspruchs greift Obama – auch hier ganz in der hegemonialen Tradition – auf die liberale Variante des Exzeptionalismus und universellen Missionarismus der USA zurück. Wie ein roter Faden zieht sich diese Begründung durch Obamas außenpolitische Statements. In dem Grundsatz-Aufsatz von 2007 hieß es, dass „the security and well-being of each and every American depends on the security and well-being of those who live beyond our borders. The mission of the United States is to provide global leadership grounded in the understanding that the world shares a common security and a common humanity.“ Und in der Inaugurationsrede vom 20. Januar 2009 werden die erhabenen Ideen der amerikanischen Gründungsväter und die „gottgegebenen Versprechen“ (Gleichheit, Freiheit und Glücksstreben) beschworen. „Diese Ideale erhellen noch immer die Welt.“ Alle Völker und Regierungen sollten wissen, „dass Amerika ein Freund jeder Nation und jedes Mannes, jeder Frau und jedes Kindes ist, die eine friedliche und würdevolle Zukunft suchen, und dass wir wieder zur Führung bereit stehen.“ So geht die Entmythologisierung der neoimperialen Politik einher mit der Wiederbelebung des ur-amerikanischen Mythos von der Stadt auf dem Berge, die in die Welt leuchtet, die Menschheit beglückt und die Völker zu Demokratie und Frieden führt – der amerikanische Mythos als ideologische Begründung des globalen Führungsanspruchs. Kritiker wie Ted Galen Carpenter (Vizepräsident des konservativen CatoInstituts und Autor des Buches „Smart Power“) haben die Befürchtung geäußert, dass ein derartiger Missionarismus, wenn er in operationale Politik umgesetzt würde, „exzessive und potenziell gefährliche humanitäre Kreuzzüge“ zur Folge hätte. Das sei nicht die Art außenpolitischen Wandels, die das amerikanische Volk wünsche oder nötig habe. Mehr noch: Obamas Behauptung von der Unteilbarkeit der Schicksale aller Völker und Menschen und dem humanitären Sendungsauftrag der USA ähnele im Kern der These Bushs, der in seiner zweiten Inaugurationsrede sagte: „The survival of liberty in our land increasingly depends on the success of liberty in other lands.“ Carpenters rhetorische Frage zu Obamas kosmopolitischem Konzept, das logischer Weise zu ausufernden Interventionen treibe, lautet: „Worse than Bush?“20 20 Das ist auch die Überschrift seines Artikels in: The National Interest, 7.11.2008. Amerikanische Außenpolitik im Konzert der Mächte 67 Sieht man von solchen ideologiebezogenen provokanten Einwänden ab, so stützt die Interpretation der außenpolitischen Statements des neuen Präsidenten die obige These, dass die Richtungsänderung weg von der neoimperialen Politik Bush und zurück zu einer gemäßigten hegemonialen Politik (ähnlich wie in den neunziger Jahren) intendiert ist – wofür auch die Tatsache spricht, dass Hillary Clinton Obamas Außenministerin geworden ist und viele Clinton-Leute in wichtige Positionen gelangt sind. Und das heißt, dass die Richtungsänderung zugleich den Versuch darstellt, an die ältere Richtung anzuknüpfen – „ready to lead once more“, also eine neuerliche Hegemonialpolitik, verbunden mit einer (für eine gemäßigte Hegemonie erforderlichen) Selbstbändigung der Macht („restraint“). Ist dieser Versuch erfolgversprechend? Der neuerliche globale Führungsanspruch dürfte in der Praxis auf mehrere neue einschränkende Bedingungen stoßen – auf das Fehlen der notwendigen Mittel und auf den Mangel an Akzeptanz. Beides hängt mit der Veränderung der internationalen Machtverteilung zusammen. In der multipolaren globalisierten Welt sind die Einflussmöglichkeiten jedes Akteurs wechselseitig beschränkt. Ein bestimmender Einfluss eines Einzelnen (= Hegemonie) ist damit praktisch ausgeschlossen. Für die USA gilt dies umso mehr, als sie als größter Schuldnerstaat auf den Kapitalzufluss aus anderen Staaten angewiesen sind. Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise wird sich diese Abhängigkeit noch erhöhen. In einer hegemonialen Beziehung muss aber die Führungsmacht in der Lage sein, Gegenleistungen für Gefolgschaft zu erbringen. Dass die USA nach 1948 Westeuropa und der westlichen Welt günstige Bedingungen für Wohlstand und Sicherheit (u.a. durch Marshall-Plan und NATO sowie insgesamt durch das internationale ökonomische und politische Regelwerk, das von den USA initiiert und getragen wurde) boten, war die Grundlage der westlichen US-Hegemonie in dieser Ära. Diese hegemonialen Mittel sind heute, über die pure militärische Macht hinaus, nicht mehr verfügbar (das System von Bretton Woods ist schon längst – nämlich 1971 – zusammengebrochen). Die kollektiven Güter können von dem ehemaligen Hegemon nicht mehr zur Verfügung gestellt werden; sie können nur noch im Zusammenwirken der großen Mächte erzeugt werden – unter Einbeziehung aufsteigender Mächte. Falls „remaking America“ praktisch „remaking American hegemony“ bedeuten sollte, ist diese Absicht angesichts der angedeuteten Machtverschiebungen eine Illusion. Denn Hegemonie setzt – wie Heinrich Triepel überzeugend gezeigt hat – die Akzeptanz der Führung voraus, und diese Bedingung ist nicht mehr gegeben. Der Irak-Krieg war der Wendepunkt. Jetzt, vor und nach Obamas Inaugurationsrede, haben so gut wie alle Staaten der Spitzengruppe zu verstehen gegeben, dass die USA einsehen 68 Werner Link müssten, dass sie nicht mehr die dominante Supermacht sind.21 Und wie oben gezeigt wurde, ist diese Einsicht bei den amerikanischen politischen Eliten und auch bei Obama selbst inzwischen vorhanden. Als Präsident Bush sen. Anfang der neunziger Jahre meinte, nun würden die USA als einzige Führungsmacht der Welt anerkannt, war diese Akzeptanzbehauptung bereits fraglich. Inzwischen ist sie nachweisbar falsch. 5. Amerika im Konzert der Mächte Im Vergleich zur neoimperialen Politik der Regierung Bush ist also die Politik zur Erneuerung der amerikanischen Hegemonie (renewing American leadership) eine Richtungsänderung, die allerdings aus den genannten Gründen nur ein geringe Realisierungschance hat. Folglich stellt sich die zweiteilige Frage, (1) ob eine grundsätzlich neue Richtungsorientierung denkbar ist und wie sie begrifflich beschrieben werden kann, und (2) ob entsprechende Ansätze in Obamas außenpolitischem Programm erkennbar sind. (1) In einer multipolaren Welt ist zwar globale Führung durch eine einzige Großmacht systemwidrig, nicht jedoch eine gemeinsame Führung durch die Staaten der Spitzengruppe.22 Sie beschränken und balancieren sich gegenseitig und sie kooperieren ad hoc im Falle gemeinsamer oder ähnlicher Interessen – kooperative Balance und selektive Kollektivhegemonie. Dieser typische Zusammenhang wird mit dem Begriff „Konzert der Mächte“ erfasst. Typisch ist, dass je nach aktuellem Problemfall – wie bei musikalischen Konzerten – eine variierende Orchestrierung bzw. unterschiedliche Besetzung gewählt wird. Ein herausragendes Beispiel ist die informelle Führungsgruppe der Sieben (G 7), die dann zur Gruppe der Acht (G 8) erweitert wurde und der inzwischen durch die Einbeziehung der aufsteigenden Mächte und Schwellenländer die Gruppe der Zwanzig (G 20) zur Seite gestellt wurde. Weitere Beispiele informeller Führungsgruppen sind die sogenannten Kontaktgruppen für die Behandlung spezieller Probleme (Bosnien- und Kosovo-Kontaktgruppe), das Nahost-Quartett und die Fünfer Gruppe zur Regelung des Nordkorea-Konflikts. Das UN-System bietet sogar einen formalisierten Rahmen für eine konzertierte Politik der großen Mächte: Die ursprünglich vorgesehene Führungsgruppe der „four policemen“ wurde in der UN-Charta schließlich zu einer herausgehobenen Gruppe der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates (P 5), denen sieben und später zehn nicht-ständige Mitglieder als 21 22 Vgl. Burns, John F.: Obama promises the world a renewed America, in: IHT, 21.1.2009. Siehe Triepel: Die Hegemonie, S.213. Amerikanische Außenpolitik im Konzert der Mächte 69 Vertreter der anderen Staaten beigegeben wurden. Die Kerngruppe nimmt informell von Fall zu Fall eine Erweiterung vor (wie zum Beispiel bei der Behandlung des Iran-Konflikts, als durch die Hinzuziehung Deutschlands die Gruppe P 5 + 1 entstand). Die P 5 können kollektive Führung (= Kollektivhegemonie) ausüben, wenn sie übereinstimmen und die hinreichende Akzeptanz der nicht-ständigen Mitglieder (mindestens vier Staaten müssen zustimmen) vorhanden ist. Die Ratio des Veto-Rechts der P 5 besteht darin, dass auf diese Weise die balance of power zwischen den Großmächten erhalten und die Legalisierung der Hegemonie einer Großmacht verhindert werden soll. Diese Bestimmungen begünstigen also ein Konzert der Mächte, ohne es freilich zu schaffen oder zu garantieren. Die notwendige Voraussetzung ist, dass kein antagonistischer Konflikt (wie der Ost-West-Konflikt) zwischen den Großmächten besteht, was gegenwärtig der Fall ist. Die hinreichende Bedingung ist, dass die Großmächte aufgrund ihrer Interessenlage den UN-Rahmen nutzen wollen. Selbstverständlich sind auch in einem Mächte-Konzert Konkurrenz und Machtkampf nicht eliminiert. Charakteristisch ist jedoch die Tendenz, eine Regulierung der machtpolitischen und ökonomischen Konkurrenz zu erreichen – im Sinne eines kooperativen Wettbewerbs. Und was die Regelung und Lösung der Konflikte anbelangt, so ist eine „integrative Konfliktregulierung“ (statt einer regressiven oder konfrontativen)23 in einem Konzert der Mächte systemadäquat und förderlich für den Systemerhalt. Die Orientierung an der kooperativen balance of power hemmt die Tendenz einer Großmacht, die Regulierung regionaler oder lokaler Konflikte dazu zu benutzen, ihre Macht in Relation zu anderen Großmächten auszubauen. Die Selbstbeschränkung ist auf diese Weise systemisch induziert und nicht bloß eine Frage des guten Willens. (2) In dem außenpolitischen Programm Obamas gibt es – trotz des rhetorischen Anspruchs der Erneuerung der amerikanischen globalen Führung – Ansätze, die einen „allmählichen Wandel“ hin zur Einfügung Amerikas in das Konzert der Mächte einleiten könnten, um es pro-aktiv mitzugestalten. Die oben zitierten Kooperationsaussagen („effektive Zusammenarbeit mit allen Hauptmächten“ u.a.m.) geben unter den obwaltenden Bedingungen der Gegenwart und nahen Zukunft ja nur dann einen vernünftigen Sinn, wenn „renewing global American leadership“ Mitführung im Konzert der Mächte meint, wenn diese Formel keinen alleinigen Führungsanspruch enthält und mithin die Abkehr von dem früheren amerikanischen Selbstverständnis, die „einzige und überragende Macht“ zu sein, impliziert. Das wird freilich – mit Rücksicht auf den zitierten ur23 Zu diesen Begriffen und der Konflikttheorie, die ich im Anschluss an Kurt Singer entwickelt habe, siehe Roloff, Ralf: Die Konflikttheorie des Neorealismus, in: Sozialwissenschaftliche Konflikttheorien, hrsg. von Thorsten Bonacker, Opladen 2002, S.99-119. 70 Werner Link amerikanischen Mythos – nicht direkt ausgesprochen. Umso mehr müsste es durch die praktische Politik unter Beweis gestellt werden – mit Russland bei der Rüstungskontrollpolitik, bei der NATO-Osterweiterung, bei dem Raketenabwehrsystem, mit China durch konkrete Schritte des Engagements (statt Eindämmung). Auch die Anerkennung der eigenständigen und gleichberechtigten Rolle der Europäischen Union durch Taten (nicht nur durch Worte) und die Transformation der Atlantischen Allianz in eine balancierte europäisch-nordamerikanische Beziehung gehören dazu. Der wichtigste Test wird sein, wie die USA bei der Regulierung der aktuellen und künftigen Großmächtekonflikte operieren werden. Was die Regulierung regionaler und lokaler Konflikte anbelangt, so sind die Ankündigungen und ersten Schritte einer Richtungsänderung gegenüber den lateinamerikanischen Staaten (in der Kuba- und in der BolivienPolitik), im Mittleren und Nahen Osten und in der Afghanistan-Region bisher ein Konglomerat von alter und neuer Politik. Das ist am deutlichsten bei der projektierten Politik gegenüber Afghanistan und Pakistan sichtbar: Die Verstärkung der amerikanischen Truppen im Kampf gegen Al Qaida und die Taliban und die Erhöhung des Drucks auf Pakistan gehen einher mit Überlegungen, eine Regelung im regionalen Kontext unter Einbeziehung aller Nachbarstaaten Afghanistans und aller politischen Kräfte in Afghanistan (einschließlich der gemäßigten Teile der Taliban) im Sinne einer integrativen Konfliktregulierung anzustreben. Bezüglich des Iran-Konflikts wären direkte Verhandlungen, wenn sie – wie angekündigt – den Iran als bedeutende regionale Macht anerkennen würden und wenn sie mit Verhandlungen über eine stabile regionale Ordnung verbunden wären, ein bemerkenswerter Richtungswechsel. Das gilt analog für die Mitwirkung bei der Regulierung des Israel-Palästina-Konflikts im regionalen Rahmen (einschließlich der Beteiligung Syriens und des Iran), wenn nicht, wie bisher, nur die Sicherheitsinteressen Israels als legitim anerkannt werden und das Problem des regionalen atomaren Monopols Israels nicht weiterhin ausgeklammert bleibt. In der Vergangenheit, insbesondere in der bipolaren Ära des Ost-West-Konflikts, war es evident, dass regionale Konflikte die Beziehungen zwischen den Großmächten beeinflussen und umgekehrt. Falls die USA sich wirklich als Mitführungsmacht im Konzert der Mächte verstehen, wäre eine unilaterale regionale Ordnungspolitik, wie sie unter Präsident Bush versucht wurde und gescheitert ist, inadäquat. Sie wäre konfliktträchtig und destabilisierend nicht nur für die jeweilige Region, sondern auch für das Gesamtsystem. Die regionalen Konfliktregulierungen müssen in das Konzert der Mächte eingebettet werden, um erfolgreich zu sein, und umgekehrt dürfte ein funktionierendes Mächte-Konzert die integrative Regulierung regionaler Konflikte begünstigen. Wenn das „neue Denken“ in praktische Politik umgesetzt wird, wird sich auch an Hand der Regionalpolitik zeigen, ob die neue amerikanische Regierung zur hegemonialen Politik zurückkehrt und sie Amerikanische Außenpolitik im Konzert der Mächte 71 weiter verfolgt oder ob sie sich an dem Konzept der Mitführung im Konzert der Mächte orientiert. Die grundsätzliche Richtungsalternative wird in der inneramerikanischen Diskussion vornehmlich von neo-realistischen Politikwissenschaftlern unterstützt. Sie firmiert unter dem Stichwort „off-shore balancing“24. Auch alt-konservative Autoren – wie beispielsweise Doug Bandow (ehemals Special Assistent bei Präsident Reagan) – plädieren:25 „Washington should act as an offshore balancer to prevent domination of Eurasia by a hostile hegemon. But the United States should not attempt to coercively manage regional relations.“ Das Konzept des Mächte-Konzerts erfährt in der ordnungspolitischen Diskussion, teils explizit, teils implizit, verschiedene Ausprägungen26 – als Konzert der „Großen Drei“ (den Machtzentren USA, EU und China), als das Mächte-Konzert aus USA, China, Russland, EU und Japan oder als das Zusammenspiel der P 5, der G 8 und/oder der G 20. Meistens folgt die Befürwortung des Konzepts des Mächte-Konzerts aus der Einsicht in die multipolare Struktur des internationalen Systems der Gegenwart und der näheren Zukunft. Aber auch wenn man – wie Richard N. Haass (der in der neuen Administration eine nicht unwichtige Funktion übernehmen wird) – nicht eine multipolare, sondern eine „nonpolare“ Welt diagnostiziert oder prognostiziert, in der „multilateralism a la carte“ herrscht, kommt man zu dem Schluss, dass sich jetzt, nach dem Ende der amerikanischen Dominanz und der Unipolarität, eine „core group of governments and others committed to cooperative multilateralism“ bilden wird oder bilden sollte, was Haass „concerted nonpolarity“ nennt.27 Bei dieser konzeptionellen Konstruktion würde sich also die neue amerikanische Außenpolitik ebenfalls in Richtung auf Mitwirkung und Mitführung in einem internationalen Konzert entwickeln. 24 25 26 27 Layne, Christopher: The Peace of Illusions, Ithaca 2006; Ders.: From Preponderance to Off-shore Balancing, in: International Security 22/1997, S.86-124; Ders.: It‘s Over, Over There, in: International Politics 45/2008, S.325-347; Walt, Stephen M.: Taming American Power, New York u.a. 2005. Offshore balancing heißt soviel wie kontrollierender Einfluss aus der Ferne, Nutzung regionaler Allianzen und Sicherheitspartnerschaften (mit reduzierter Militärpräsenz), direktes militärisches Eingreifen nur dann, wenn vitale amerikanische Interessen bedroht und regionale Mächte nicht in der Lage sind, die regionale balance of power zu gewährleisten. Siehe Bandow: First Among Equals. Vgl. Buechel, Anne/Rytz, Henriette: Die USA und der Aufstieg neuer Mächte, SWP-Zeitschriftenschau, 3.10.2008. Haass, Richard N.: The Age of Nonpolarity: What will follow U.S.Dominance, in: Foreign Affairs 3/2008, S.44-56. 72 Werner Link Ob diese oder eine ähnliche Richtungsänderung von der neuen Regierung tatsächlich gewollt, praktisch (gegen inneramerikanische Widerstände) tatkräftig verfolgt und trotz zu erwartender internationaler Beschränkungen erfolgreich sein wird, kann nur die Zukunft erweisen – im Prozess des „graduellen Wandels“. Man wird also abwarten müssen, welche realen Konsequenzen Obamas Feststellung und Aufforderung haben werden: „The world has changed – and we must change with it.“ Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume für die Außenpolitik von Präsident Obama Christian Hacke 1. Die Determinanten Präsident Obama hat eine Fülle von Problemen von Präsident Bush geerbt, die weitaus schwieriger sind als die meisten, die seine Vorgänger bewältigen mussten. Der Krieg gegen den Terror, insbesondere die beiden Kriege im Irak und in Afghanistan, und die Weltwirtschaftskrise, die im Zuge der amerikanischen Banken- und Finanzkrise immer weiter um sich greift, verlangen ein komplexes Management und kluge Kriegsführung. Doch die Rolle der USA als Weltordnungsmacht ist nun auch unter ökonomisch-finanziellen Vorzeichen in Frage gestellt. Weder können die USA die Welt stabilisieren noch könnte der derzeitige innen- und wirtschaftspolitische Zustand als vorbildlich bezeichnet werden. Nein, derzeit erscheinen die USA weniger als Hoffnung, sondern vielmehr als Belastung für Welt, Wirtschaft und Weltwirtschaft. Was kann und was wird Präsident Obama tun? Wird er die USA außen- und innenpolitisch rundum erneuern können? Sind die Fehler und Versäumnisse der Regierung Bush reparabel? War die Ära Bush lediglich ein Ausrutscher in der Erfolgsgeschichte der USA oder hat Bush die Struktur der USA derart negativ verändert, so dass Niedergang unvermeidlich ist? Salopp ausgedrückt: Hinterlässt Präsident Bush lediglich einige Dellen am amerikanischen Straßenkreuzer auf den Pfaden der Weltpolitik oder ist der Lack ab? Hat Bush einen Totalschaden verursacht oder ist noch Reparatur möglich? Können andere Mächte von Amerikas Schwäche profitieren oder wächst das Gefühl weltweit, dass die neuen Krisen nur gemeinsam bewältigt werden können? Doch eine zentrale Veränderung fällt ins Auge: Waren die USA bis zur Präsidentschaft von G.W. Bush der zentrale Problemlöser der internationalen Politik, so mutierten sie im Zuge des Irak-Krieges und der Weltwirtschaftskrise zum Problemfall Nr.1. 74 Christian Hacke Diese völlige Umkehrung bekannter und verlässlicher innen- und außenpolitischer Determinanten ist ein schweres Erbe, denn es begrenzt auf ungewohnte Weise die Handlungsspielräume für Obamas politische Ambitionen. Oder erscheint diese Sicht einseitig? Schon vor Barack Obama waren amerikanische Präsidenten mit schier überwältigenden Problemen konfrontiert: Unter Abraham Lincoln zerbrach die Einheit der Union in einem fürchterlichen Bürgerkrieg, den es zu gewinnen und die Einheit wiederherzustellen galt. F. D. Roosevelt war mit einer schweren wirtschaftlichen Depression konfrontiert und Präsident H.S. Truman mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges sowie der weltweiten Bedrohung des Kommunismus. So ist es kein Zufall, dass gerade diese Präsidenten Barack Obama zum Vorbild dienen, denn sie meisterten diese Herausforderungen mit Pragmatismus, Willenstärke, Optimismus und mit typisch angelsächsischer Einstellung – mit „grace under pressure“. 2. Die Antriebsfaktoren Schon im Wahlkampf wurde deutlich, dass Barack Obama entsprechende Führungsqualitäten entwickeln könnte. Nicht zuletzt deshalb wurde er zum Präsidenten gewählt, weil die Amerikaner gerade ihm Charakterstärke, Entschlossenheit, Besonnenheit und Klugheit zutrauen, um das Land rundum zu erneuern. Dabei ist unübersehbar, dass er sich vor allem an Präsident Abraham Lincoln orientiert. Nicht nur die Aufgaben, auch die Lebenswege verweisen auf Parallelen: Beide stammen aus Illinois aus einfachen Verhältnissen, kümmerten sich schon vor ihrer politischen Karriere als Anwalt um die sozial Benachteiligten, wirkten in der Landespolitik und gingen dann als Senatoren nach Washington. Kein Wunder, dass Obama im Winter 2007 in Springfield, dem Geburtsort von Lincoln, seine Kandidatur für das Präsidentenamt erklärte. Obama ehrt Lincoln nicht nur, weil dieser erste Schritte auf dem langen Weg der Afroamerikaner zur vollen Gleichberechtigung suchte, die ihren krönenden Ausdruck in Barack Obamas Inauguration als dem ersten schwarzen Präsidenten gefunden hat, sondern Obama sieht in Abraham Lincoln vor allem die Verkörperung von Einheit und Stärke der Nation. Hätte Lincoln die Sezession der Südstaaten zugelassen, wären die USA nicht zur Weltmacht aufgestiegen. Heute muss Obama den ökonomischen Niedergang stoppen und Amerikas Ansehen als Weltordungsmacht wiederherstellen. Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 75 Doch bewundert Obama in Lincoln auch den gewieften Taktiker. Wie Obama, so erschien auch Lincoln als politischer Neuling in Washington. Aber geschickt band er seinen ärgsten Konkurrenten William H. Seward in die Kabinettsdisziplin ein und ernannte ihn zum Außenminister. Genauso geschickt taktiert Barack Obama mit Hillary Clinton. Doch ob es Obama ebenso wie Lincoln gelingen wird, dass aus Widersachern Freunde werden, werden erst die kommenden Jahre zeigen. Obama und Clinton sind beide disziplinierte Politiker, wissen um die Sach- und Koalitionszwänge und teilen einen nüchternen analytischen Blick auf die Weltprobleme. Aber ob daraus eine Außenpolitik aus einem Guss entstehen wird, bleibt abzuwarten. Personalpolitisch zeichnet sich jedoch schon ab, dass viel Personal aus der Präsidentschaft von Bill Clinton erneut außenpolitische Schaltstellen besetzt hat. Vermutlich hätte Clinton als Präsidentin eine ähnlich liberal-konservative Mannschaft zusammengestellt, wie es Obama getan hat. Die außenpolitischen Differenzen über den Irakkrieg, den Clinton befürwortete und Obama von Anfang an ablehnte, sind beigelegt. Beide plädieren heute für einen geordneten Abzug amerikanischer Soldaten aus dem Irak, für direkte Regierungsgespräche mit Iran, für einen neuen Anlauf im Kampf gegen den Terror, insbesondere in Afghanistan und in Pakistan, sowie für neue Friedensinitiativen im Nahen Osten. Beide messen dem Klimaschutz und der Energiesicherheit großes Gewicht bei und der Auftakt von Hillary Clintons Reisediplomatie nach Asien verweist auf neue Akzentuierungen: Nicht mehr der Blick über den Atlantik nach Europa, sondern der Blick über den Pazifik nach Asien, nach Japan, China und Indonesien erscheint beiden als vorrangig. Dazu teilen sie das Gespür für die neuen globalen Herausforderungen wie Klimawandel, Abrüstung und Terrorbekämpfung. Wo liegen nun die Hauptantriebsfaktoren für Obamas Außenpolitik? Zunächst will er Amerikas Stärke wiederherstellen. Präsident Obama sieht die USA alles andere als im Niedergang. Im Gegenteil, er ist vielmehr vom dem Glauben beseelt, dass ein „postamerikanisches“ Zeitalter verhindert werden muss – nicht nur weil ein amerikanisches Zeitalter dem Eigeninteresse angemessen erscheint, sondern weil Obama glaubt, dass der größte Teil der Welt sich nach amerikanischer Führung sehnt. Denn nur die Wiederherstellung von Amerika als stärkster Demokratie kann verhindern, dass andere, insbesondere demokratiefeindliche autokratische Großmächte in Regionen und Machthohlräume eindringen, die mangels amerikanischer Stärke nun anti-demokratisch aufgefüllt würden. Nicht nur interessen-, sondern auch werteorientiert würde sich die weltpoliti- 76 Christian Hacke sche Machtbalance bei fortgesetzter Schwäche der USA zum Nachteil der Demokratien auf der Welt verschieben. Es geht für Obama also nicht nur um nüchterne Machtkalkulationen, sondern Amerikas Führung in der Welt soll Freiheit und Wertepluralismus sichern. Im Gegensatz zum manichäischen Weltbild und des religiös aufgeladenen Sendungsbewusstseins seines Vorgängers betont Präsident Obama bei seinen ersten außenpolitischen Schritten Verständnis für andere Länder, Kulturen und Interessen und den Willen zu politischem Neubeginn – vor allem gegenüber Gegnern und Rivalen. Diese neue außenpolitische Bescheidenheit zeigte Obama, als er sich an die muslimische Welt wandte: „Meine Aufgabe ist es zu unterstreichen, dass die Vereinigten Staaten ein essenzielles Interesse am Wohlergehen der islamischen Welt haben … Ich habe Muslime in meiner Familie. Ich habe in einem muslimischen Land gelebt und wir dürfen nicht eine Religion vergröbern, weil in ihrem Namen Gewalt verübt worden ist.“ Obama sprach sogar von notwendigen Opfern für eine dauerhafte Lösung zwischen Israel und Palästina, was im Klartext bedeutet, dass auch Verbündete wie Israel zu einer entsprechenden Mäßigung ihrer Außenpolitik aufgefordert werden. Barack Obama deutet damit auch Rückkehr zu einer objektiveren Makler- und Vermittlerrolle für die USA im Nahostkonflikt an: „Ich glaube, dass die Israelis zu Opfern bereit sein werden, wenn die Zeit gekommen ist und die andere Seite ernsthafte Partnerschaft zeigt.“ Doch nicht nur Appelle an die Friedensfähigkeit der Freunde, sondern ein neuer Ton gegenüber den Gegnern freiheitlicher Lebensweise werden erkennbar, wenn Obama z.B. Unterschiede zwischen den Terrororganisationen Al Qaida und Taliban betont: Ersteren sagt er einen kompromisslosen Kampf an, den Taliban dagegen signalisiert er Verhandlungsbereitschaft und setzt auf ihre gemäßigten Kräfte. Barack Obama entwickelt also ein weitaus differenzierteres Weltbild als sein Vorgänger, greift zu unorthodoxen Methoden und scheut auch nicht die Risiken einer erstaunlich öffentlichen Diplomatie, wie seine Initiativen gegenüber Russland und Iran andeuten. Statt auf simplifizierender Freund-Feind-Kategorisierung setzt Obama auf Gemeinsamkeit, national und international, postuliert ein kreatives Miteinander und setzt dabei neue Akzente: In Afghanistan und Pakistan weitet er zwar den Krieg zunächst entschlossen aus, wird aber auch diplomatisch aktiv. Im Irak sucht er dagegen den versprochenen und möglichst schnellen Rückzug. Der iranischen Führung reicht er die Hand und sucht einen diplomatischen Neuanfang. Seine Emissionäre und seine Außenmi- Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 77 nisterin suchen auch im Nahen Osten einen Neuanfang, vor allem eine Wiederbelebung des Friedensprozesses zwischen Palästinensern und Israelis. Gegenüber den rivalisierenden Großmächten Russland und China sucht Obama schwelende Konflikte einzudämmen und neue Zusammenarbeit zu initiieren. Obamas außenpolitische Initiativen scheinen sich zu überschlagen, doch ist vorerst nicht leicht auszumachen, wohin die Reise gehen wird. Doch bei allen Aktionen wird ein neuer, geschmeidiger und ausgleichender Stil sichtbar. Obama ist offensichtlich bemüht, die martialische, um nicht zu sagen arrogante Attitüde der Außenpolitik seines Vorgängers baldmöglichst vergessen zu machen. Doch „foreign policy begins at home”. Das bedeutet, dass als allererste Voraussetzung für Erfolg und Leistungsfähigkeit „Nation Building“ im eigenen Lande vonnöten ist. Das kann noch Jahre dauern, denn der Präsident muss das Verhältnis von Markt und Staat völlig neu justieren. Die schlimmste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise ist dabei eine ungeheure Last. Ein Blick auf die ersten wirtschaftspolitischen Initiativen zeigen Obama als einen Mann der Mitte, der den Staat zwar nicht allmächtig machen will, aber neue Aufgaben an den Staat ziehen will, damit dieser seine Kernaufgaben besser erfüllen, die Infrastruktur verbessern und vor allem das Bildungs- und Sozialsystem gründlich reformieren kann. Dabei ist ihm die Opposition der Republikaner gewiss, aber Obama scheint zu einer Wirtschaftspolitik der Mitte entschlossen: Sein Wirtschaftsberater Larry Summers war schon für den marktliberalen Kurs von Präsident Clinton mitverantwortlich. Paul Volcker besiegte als Notenbankpräsident in den 80er-Jahren die Inflation. Finanzminister Timothy Geithner wirkte schon vor dem Regierungswechsel für Freihandel. Doch ist die Wirtschaftsphilosophie von Präsident Obama das eine, die ökonomische Realität das andere. Der Abschwung trifft die USA derzeit mit ungeheurer Wucht, die amerikanische Wirtschaft befindet sich praktisch im freien Fall. Der Absatz der Autokonzerne hat sich halbiert, jede Woche fallen Zehntausende von Arbeitsplätzen weg. Der Streit um die angemessene Wirtschaftspolitik hat also erst begonnen, wie die Auseinandersetzung zwischen Republikanern und Demokraten zeigt. Obamas Drei-Billionen-Haushaltsplan ist umstritten. Vor allem seine geplante Einführung eines Emissionshandels zur Bekämpfung des Klimawandels, sein Programm zur Gesundheits- und Bildungsreform und sein Plädoyer für mehr grüne Energie bleiben umstritten. Ob es Obama überhaupt gelingen kann, seine Ideen zu verwirklichen, entscheidet sich erst in den kommenden Monaten. Wenn ja, bekommt seine Präsidentschaft, auch die Außenpolitik, die nötige Dynamik und 78 Christian Hacke ihr angemessenes finanzielles Fundament. Sollte Obama jedoch mit seinen Plänen scheitern, könnte die Rezession sehr schnell zu einer globalen Depression ausufern – mit katastrophalen Folgen nicht nur für Amerika, sondern für die ganze Welt. Doch es wird noch Jahre dauern, bis das Schlimmste überstanden ist, denn die USA haben über ihre Verhältnisse gelebt: „Wir waren in den letzten Jahren faul, arrogant, gleichgültig in unserem strategischen Denken. Wir dachten, wir müssten niemanden überzeugen, da die Leute ja ohnehin keine Alternative hätten. Wir haben die Welt globalisiert, ohne gleichzeitig die amerikanische Gesellschaft zu globalisieren. Das lässt sich an dem wachsenden Misstrauen der Amerikaner bei Themen wie Handel oder Zuwanderung ablesen, bei ihrer Haltung zu allem Fremden. Das viel offenere Amerika hatte eine ungleich bessere Ausgangslage.”1 Kein Wunder, dass Obama keine Wunder verspricht, sondern seine Landsleute auf harte Zeiten einschwört. Noch nie seit 1933 musste ein Präsident sein Amt unter so schwierigen ökonomischen Bedingungen antreten. Roosevelts New Deal wird deshalb zu Recht als Vergleich bemüht, um das ganze Ausmaß der Misere anzudeuten. Doch ob das gewaltige Konjunkturpaket von 820 Milliarden Dollar erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Selten war der Ausspruch, „foreign policy begins at home“, so treffend wie heute: Um außenpolitisch handlungs- und wirkungsfähig zu werden, muss Obama Staat, Gesellschaft und Wirtschaft drastisch reformieren, um nationale Einheit und Stärke wiederzugewinnen. Ironischerweise wäre Barack Obama ohne die katastrophale Politik von George W. Bush nie Präsident geworden. Ohne die überwältigende Ablehnung Bushs hätte sich der Enthusiasmus für Obama nicht entfalten können. Beides bedingt sich, doch lässt sich Bushs Versagen nicht einfach zum Vorteil für Präsident Obama umsetzen. Was bedeutet das für Obamas Außenpolitik? In Obamas Sicht sollen die USA wieder durch zivilisatorische Attraktivität überzeugen. Dazu bedürfen Wirtschaft und Technologie einer forcierten Modernisierung, während gleichzeitig die militärische Stärke beibehalten werden soll. Obama steht nicht nur für soft power, das wäre naiv. Er will soft und hard power neu kombinieren, beides gehört für ihn zusammen. „Smart power“ heißt die neue Zauberformel, von Außenministerin Clinton in die Debatte eingeführt. Was bedeutet kluge Machtpolitik nun im Einzelnen? 1 Zakaria, Fareed: Wir müssen uns mehr in der Welt umsehen, in: Süddeutsche Zeitung, 3.11.2008. Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 79 3. Das Verhältnis zu Russland Obamas machtpolitisches Augenmerk gilt zuerst dem Aufstieg der autoritären Mächte Russland und China, die nicht nur für die USA, sondern auch für alle freiheitlichen Demokratien eine große Herausforderung darstellen. In Zeiten der eigenen Schwäche und gemeinsamer wirtschaftspolitischer Schwierigkeiten wird das Trennende aber weitgehend verschwiegen, so z.B. dass die aufsteigenden autoritären Mächte Russland und China durchaus eines Tages die freiheitlichen Demokratien und allen voran die westlich-demokratische Führungsmacht USA bedrohen könnten oder dass die energiepolitischen Abhängigkeiten gegenüber Russland oder die energiepolitisch wenig rücksichtsvollen Vorstöße Chinas den westlichen Handlungsspielraum gefährden könnten. Stattdessen tritt die Regierung Obama in der Welt derzeit mit Samthandschuhen und gewinnendem Lächeln auf, durch eigene Schwäche dazu gezwungen. Natürlich müssen die USA ihre eigenen machtpolitischen Anstrengungen verdoppeln, Platzvorteile der Rivalen vereiteln, sie vielmehr in eigene Strategien einbinden und vor allem Koalitionen gegen die USA verhindern. Folglich wird Präsident Obama Amerikas Koalitionsfähigkeiten, also den Fächer seiner diplomatischen Fähigkeiten, erweitern. Die Beziehungen zu Russland haben sich gerade im Zuge des Georgienkrieges drastisch verschlechtert. Weil die Regierung Bush den georgischen Präsidenten nicht vor einem unverantwortlichen militärischen Angriff abhalten konnte, eröffneten sich Russland unfreiwillig neue, langersehnte Möglichkeiten auf dem Kaukasus, die nur einen entsprechenden Anlass benötigten. Die USA wurden durch Leichtsinn und Fehlkalkulation eines Verbündeten in diesen Konflikt mit hineingezogen, dadurch geopolitisch geschwächt, ja sogar gedemütigt. Kein Wunder, dass die Falken in Washington auf Wiedergutmachung, ja auf Rache sinnen. Aber nichts wäre törichter, als der Verführung nach Konfrontation mit den Russen nachzugeben. Umgekehrt scheint die Regierung Obama stärker in Rechnung zu stellen, dass sich Russland durch eine Vielzahl von amerikanischen Entscheidungen, durch das Drängen auf Unabhängigkeit des Kosovo, durch Unterstützung der Ukrainischen Revolution, durch die Entscheidung für Raketenabwehrsysteme in Polen und Tschechien und durch weitgesteckte Erweiterungsrunden der NATO bedrängt, bedroht und gedemütigt fühlt. Jegliches Triumphgefühl gegenüber dem Kreml zu vermeiden, das war schon die kluge Devise von Präsident Bush sen., die nach 1990 in Washington zu oft missachtet wurde. Mehr Sensibilität für die russischen Phobien und Interessen wäre bisweilen angebracht gewesen. Aber grundsätzlich bleibt das autoritäre Russland eine nicht zu unterschätzende Bedrohung für den freiheitlichen Westen, nicht zuletzt wegen seiner neuen energiepolitischen Stärke. 80 Christian Hacke Obama wird deshalb den Kreml daran erinnern, dass der Westen keine Rückkehr zu imperialer Attitüde hinnehmen wird. Doch für solche Warnungen stehen die Zeichen angesichts eigener Schwäche und prekärer Abhängigkeiten schlecht. Vielmehr muss Obama weit umsichtiger und vorsichtiger als seine Vorgänger handeln. Im Übrigen sitzen im Kreml nicht mehr die Gerontologen früherer Jahre, sondern seit Putin herrscht dort eine machtbewusste autokratische Elite, die mit überraschender Raffinesse den nationalen Vorteil und die Wiederherstellung des Weltmachtstatus anstrebt. In diesem Sinne hat Obama Russland klugerweise angeboten, auf die geplante Raketenabwehr gegen den Iran in Mitteleuropa eventuell zu verzichten. Bushs Pläne der Raketenabwehr passen nicht in Obamas Diplomatie der Kooperation mit Moskau, denn er benötigt Russlands Mithilfe auf vielen Feldern: Ohne Russlands Zustimmung wird eine Reform internationaler Organisationen wie der G8 oder der UNO kaum möglich. Das Nichtweiterverbreitungsabkommen von Atomwaffen hat nur Zukunft, wenn Washington und Moskau gemeinsam daran arbeiten. Abrüstung und eine gemeinsame globale Sicherheitsarchitektur, bessere Zusammenarbeit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus in Afghanistan und der Verzicht auf eine weitere Osterweiterung der NATO könnten die amerikanisch-russische Kooperation verstärken.2 Russland ist sich dabei seiner neuen Macht bewusst: Die mit Russland verbündeten GUS-Republiken stoppten den Nachschubweg nach Afghanistan, indem sie die Nutzung von Luftbasen für die USA untersagten. Nun öffnet Russland wieder den Eisenbahnweg für nichtmilitärischen Nachschub an den Hindukusch. Russland bringt aber auch umgekehrt eigene Interessen ins Spiel und macht Druck in Washington: Kosovo, Ukraine, Georgien, NATO – all diese Kritikpunkte werden vor dem Hintergrund der neuen russischen energiepolitischen Stärke selbstbewusster denn je vorgetragen. Daraus ergibt sich, dass für die Regierung Obama eine Politik der Eindämmung Russlands heute kontraproduktiv, unpopulär und vor allem erfolglos wäre. Wie lange der sich ankündigende Honigmond in den Beziehungen zwischen Washington und Moskau andauern wird, hängt allerdings von der weiteren Entwicklung ab. 4. Die Beziehung der USA zu Europa und Deutschland Gerade unter Verbündeten macht der Ton die Musik und unter Obamas Vorgänger herrschte nicht selten ein rauer Ton. Die neo-imperiale Attitüde 2 Vgl. hierzu Rahr, Alexander: Absage an den Kalten Krieg, in: FAZ, 15.2.2009. Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 81 der Regierung Bush, die zur transatlantischen Entfremdung beitrug, gehört dank Obamas neuem und offenem Stil der Vergangenheit an. Gerade beim Europabesuch des amerikanischen Präsidenten im April 2009 wurde eine bislang unbekannte und beeindruckende Bescheidenheit sichtbar. Damit gewinnt er Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurück, die vielleicht mit einer Währung von den Verbündeten zurückgezahlt wird, die die USA besonders gut gebrauchen kann: Gefolgschaft, ohne die sich Führung nicht realisieren lässt.3 Unter diesem Aspekt werden in Europa auch die amerikanisch-russischen Beziehungen mit Argusaugen beobachtet. Auch hier deutet Obama glaubwürdig Kooperationsbereitschaft an, wohlwissend, dass der Versuch einer Eindämmung Russlands in Deutschland und in Westeuropa mehrheitlich keine Unterstützung finden würde. Eindämmung würde jetzt nur einen Keil zwischen die Bündnispartner treiben und Obamas Hoffnung auf eine Wiederbelebung der atlantischen Beziehungen zunichte machen, solange nicht Moskau die Zusammenarbeit mit dem Westen aufgibt und kein System des Machtgleichgewichts im Stil des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung einer weit ausgreifenden russischen Interessenssphäre in Osteuropa zu etablieren sucht. Doch das ist nicht ausgemacht. Im Gaskonflikt mit der Ukraine ging es um mehr als angemessene Preise, es ging auch um den Versuch, den Westen zu spalten und die eigene russische Einflusssphäre auszudehnen. Im Übrigen zeigt Russlands militärische Entschlossenheit im Georgienkonflikt, dass es den strategischen Vorteil zu nutzen und auszuweiten weiß. Doch erst bei den anstehenden Fragen wie bei der Stabilisierung Afghanistans, bei den Überlegungen zu einem neuen START-Vertrag, bei den Plänen zur weiteren Reduzierung nuklearer Arsenale und bei der Problematik der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen wird sich zeigen, wie stabil das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland sich entwickeln wird. Die Regierung Obama scheint sich darüber im Klaren zu sein, dass eine neue Russlandstrategie vonnöten ist, die sowohl die Interessen der Europäer berücksichtigt als auch die der Weltmacht USA. Vor diesem Hintergrund wird Obama in den transatlantischen Beziehungen neue Akzente setzen, um die Zerwürfnisse zu beseitigen, Gemeinsamkeiten wieder zu entdecken und Amerikas Ansehen wiederherzustellen. Die transatlantischen Gipfeltreffen in London, Straßburg/Kehl und Prag Anfang April 2009 brachten überwiegend positive Ergebnisse: In London einigten sich die G-20 Staaten auf Eckpunkte einer neuen Weltfinanzordnung, in Kehl auf die Ausarbeitung einer neuen NATO-Strategie, und in Prag überraschte vor allem Präsident Obama mit seiner Vision einer nuklearfreien Welt. 3 Vgl. Kornelius, Stefan: Die neue Bescheidenheit, in: Süddeutsche Zeitung, 6.4.2009. 82 Christian Hacke Vor allem war es das Verdienst Obamas, dass nach dem Veto der Türkei doch noch der Däne Rassmussen zum neuen NATO-Generalsekretär gewählt werden konnte. Besonders beeindruckte aber Obamas freimütiges Schuldeingeständnis, dass die Finanzkrise in den USA begonnen habe und auch deshalb die USA diese Krise zu Ende führen werden. Auch Obamas Ankündigung einer neuen Afghanistan-Strategie überzeugte: Er will nicht nur zusätzliche 21.000 Soldaten an den Hindukusch entsenden, sondern auch den zivilen Wiederaufbau stärken und die Nachbarstaaten bei der Lösung miteinbeziehen. Bundeskanzlerin Merkel interpretiert dies als Übernahme des europäischen Konzepts der vernetzten Sicherheit, kommt aber selbst unter Erwartungsdruck, denn der amerikanische Präsident hat keinen Zweifel aufkommen lassen, dass die europäischen Verbündeten gut daran täten, ihre militärischen und zivilen Beiträge deutlich aufzustocken. Eine neue Lastenteilung erscheint angesagt: Im Fall Afghanistan und Irak sowie mit Blick auf die Herausforderungen in Pakistan und Iran wird Präsident Obama neue Leistungen der Verbündeten einfordern, insbesondere stärkeres militärisches Engagement. Sowohl die zukünftige Außenministerin Hillary Clinton wie auch der alte und neue Verteidigungsminister Gates werden dabei keine einfachen Gesprächspartner sein. Umgekehrt erwarten die Europäer von Washington mehr amerikanische Leistungen beim Klima- und Umweltschutz. Der Erwartungsdruck im atlantischen Verhältnis ist also wechselseitig. Obamas Äußerungen mit Blick auf den Kampf gegen den Terrorismus, insbesondere in Afghanistan, Pakistan und Iran, lassen darauf schließen, dass er geschmeidiger und kooperativer als sein Vorgänger handeln wird. Aber das Ziel bleibt das Gleiche wie unter seinem Vorgänger: Auch Obama will den Krieg gegen den Terror gewinnen, vor allem in Afghanistan, wenn auch unter stärkerer Einbeziehung der Antiterrorbekämpfung auf dem Boden der instabilen Atommacht Pakistan. Hier deutet sich sogar eine Ausweitung des Krieges an und auch deshalb werden mehr Forderungen an die Europäer gestellt, denn die USA können die enormen Kosten und Lasten nicht mehr allein weiter schultern. Sie fordern mehr Leistungsbereitschaft von den Verbündeten. Jetzt wird es für die Europäer schwerer, diese Wünsche abzublocken, wie es ihnen in Zeiten der undiplomatischen Rustikalität unter Präsident Bush gelang. Obama wird zusammen mit Clinton und Gates nachdrücklicher und überzeugender darlegen, dass heute im Kampf gegen den Terror die gesamte freie Welt mehr Engagement wird zeigen müssen. Im Zuge der neuen vernetzten Sicherheit müssen die USA sicherlich manche nicht-militärischen Fähigkeiten lernen, aber die Regierung Obama wird umgekehrt deutlich ma- Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 83 chen, dass ohne gesteigerte militärische Leistungsbereitschaft alle zivilen Anstrengungen unsicher bleiben. Afghanistan und die Rolle der NATO werden auch in den kommenden Jahren zu Meinungsverschiedenheiten führen. Der Weg zurück in die alte transatlantische Vertrautheit erscheint deshalb unwahrscheinlich. Dazu haben sich auch die transatlantischen Machtverhältnisse zu stark verändert. Amerika ist schwächer, seine Führung ist umstrittener und Europa ist trotz aller internen Widrigkeiten stärker geworden und wirkt vor allem in der Welt vorbildlicher und attraktiver als die USA. Nicht Restaurierung, sondern konstruktive Neugestaltung mit mehr Verständnis für die Interessen auf der anderen Seite des Atlantiks ist daher auf beiden Seiten gefragt, wobei die alten Europäer z.B. mit ihrer Ablehnung des Irakkrieges sich durchaus in Übereinstimmung mit Obama befinden. Mit Blick auf die nicht-militärischen Herausforderungen hat Europa an Gewicht und Ansehen in den USA gewonnen, nicht zuletzt bei Obama. Hier können die Europäer der neuen Administration auf Augenhöhe begegnen. Vielleicht wird ja ein neuer Mix in der transatlantischen Interessenverflechtung möglich: Mehr hard power muss aus Europa kommen und mehr soft power müsste in Washington entwickelt werden. Sollte Deutschland sein Engagement im Kampf gegen den Terror entsprechend aufstocken, so könnte Deutschlands Einfluss in Washington weiter wachsen: Frau Merkels Gemeinschaftsdiplomatie, ihr umsichtiges und zugleich entschlossenes Vorgehen in London und Kehl im April 2009 und vor allem ihre Schrittmacherrolle bei den neuen globalen Fragen haben Barack Obama beeindruckt. 5. Die Beziehungen zu China Im konfrontativen Weltbild der Bush-Administration machte die Volksrepublik China eine erstaunliche Ausnahme, denn die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und der VR China erreichten eine bislang kaum gekannte Breite und Tiefe. Der Antrittsbesuch von Außenministerin Clinton in der Volksrepublik stand ganz im Zeichen dieser positiven Kontinuität, zumal umstrittene Fragen wie Taiwan, Tibet und Menschenrechte weitgehend ausgeklammert wurden. Dementsprechend wurde die zurückhaltende Position von Frau Clinton zur Frage der Menschenrechte von Nichtregierungsorganisationen in den USA kritisiert, hatte man doch gerade auch im linken Flügel der Demokraten von einer Außenministerin Clinton ein stärkeres menschenrechtliches Engagement erwartet. Schon in ihrer Funktion als First Lady hatte sie auf dem Frauenkongress der Vereinten Nationen 1995 in Peking die Menschenrechtslage scharf kritisiert und zudem Präsident 84 Christian Hacke Bush empfohlen, aus Protest gegen die chinesische Tibetpolitik nicht an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Peking teilzunehmen. Doch wird die Regierung Obama das Thema Menschenrechte nicht völlig in den Hintergrund rücken. Nach Clintons Besuch in Peking veröffentlichte das State Department den jährlichen Länderbericht zur Lage der Menschenrechte, in dem China scharf kritisiert wurde. Auch hatte Vizepräsident Joe Biden sich in den 90er-Jahren intensiv und kritisch mit Fragen des chinesischen Waffenschmuggels und mit der Menschrechtsfrage beschäftigt. Gerade er hatte die Einrichtung von Radio Free Asia und der Voice of America in tibetanischer Sprache gefordert. Im Zentrum der Beziehungen steht heute aber die Bewältigung der Weltwirtschaftskrise, die, so die Außenministerin, von beiden Ländern nur gemeinsam bewältigt werden kann, denn man sitze im gleichen Boot. Ob die USA und die VR China eine tragfähige Gemeinsamkeit entwickeln werden und sich noch intensiver in Wirtschaftsfragen austauschen, bleibt abzuwarten. Da China Währungsreserven von annähernd zwei Billionen US-Dollar besitzt und einen erheblichen Teil davon in Form von USStaatsanleihen angelegt hat, müssen die USA zunächst das Vertrauen der chinesischen Regierung durch Bereitschaft zur Kooperation stärken. Die USA sind heute stärker denn je bei der Finanzierung des enormen Haushaltsdefizits auf die Hilfe Chinas angewiesen. Da überrascht es nicht, dass der neue Finanzminister Timothy Geithner mit seiner Bemerkung über eine Manipulierung der Wechselkurse durch Peking für heftige Empörung in China gesorgt hat. Vor allem liegen die klimapolitischen Vorstellungen zwischen Peking und Washington nach wie vor weit auseinander. Sie sollen deshalb mit Blick auf den im Dezember 2009 in Kopenhagen stattfindenden Klimagipfel der Vereinten Nationen bilateral intensiviert werden. Doch zeigt sich bislang die VR China nicht bereit, sich auf dem Kopenhagener Gipfel zu einer quantifizierbaren Reduktion von Klimagasen zu verpflichten. Vielmehr fordert Peking dass die Entwicklungsländer ihre Emissionen auf einer freiwilligen Basis verringern. Außerdem fordert Peking mehr finanzielle Unterstützung sowie verstärkten Technologietransfer von den Industrienationen zu den Entwicklungsländern. Auch hier droht Ungemach. Deshalb ermahnte Clinton China nun in neuer Bescheidenheit, nicht die gleichen Fehler wie die USA bei der Produktion von Treibhausgasen zu begehen. Stattdessen betonte Clinton drei zentrale Bereiche der Kooperation: Beide Staaten sollen dank ihrer herausragenden Rolle in der Weltwirtschaft darauf hinwirken, eine Wende bei der Finanz- und Wirtschaftskrise herbeizuführen. Zum Zweiten müssen sie als Verursacher von 40% aller CO2- Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 85 Emissionen stärker zusammenarbeiten, um das Wachstum ihrer Volkswirtschaften auf eine Grundlage nachhaltiger, erneuerbarer und sauberer Energien zu stellen. Und drittens wollen die USA mit China noch mehr gemeinsame Sicherheitsinteressen ausloten. Clinton verwies in diesem Zusammenhang auf die positive Rolle Pekings bei den Sechs-Parteien-Gesprächen im Atomstreit mit Nordkorea, auf Chinas UN-Blauhelmmissionen und auf die vereinbarte sicherheitspolitische Zusammenarbeit. Diese neuen Schwerpunkte lösen ohne Zweifel den Kampf gegen den internationalen Terrorismus als wichtigstes Thema der Zusammenarbeit ab. Das hat auch organisatorische Folgen: Jetzt werden die Beziehungen wieder unter die Federführung des State Department gestellt und nicht mehr dem Finanzministerium und dem Schatzamt überlassen. Was smart power im Sinne der Außenministerin mit Blick auf China in Zukunft bedeuten wird, bleibt vorher unklar. Zunächst hat sich durch ihren Besuch die Großwetterlage im sino-amerikanischen Verhältnis weiter verbessert, aber grundsätzliche, strukturelle Rivalitäten bleiben nach wie vor virulent. Die enge wirtschaftliche Verflechtung und die neue finanzpolitische Abhängigkeit der USA von China erfordert viel Fingerspitzengefühl. Weil in China und Asien wirtschaftliche Dynamik dominiert, wird sich der weltpolitische Blick von Präsident Obama weiter nach Asien verlagern. Dass China im Rahmen der G-20 auch im Rahmen der Weltwirtschaft mehr Verantwortung übernehmen sollte, wird wohl in Washington klar erkannt. Die „Ein-China“-Politik bleibt wohl gültig, darf aber Taiwans Eigenbestimmung nicht verletzen. Doch wird Obama Chinas aggressive Geopolitik zur Sicherung von Energieressourcen, besonders in Afrika, vermutlich nicht länger hinnehmen. Hier können sich neue Konflikte anbahnen, solange Peking seine Unterstützung repressiver Regime wie in Sudan und Zimbabwe fortsetzt. Doch solange die USA innen- und außenpolitisch schwächeln, sind sie machtpolitisch gezwungen, auf Zeit zu spielen, die Rivalen zu beruhigen und die Bündnispartner stärker zu umwerben 6. Die Beziehungen zu Japan Das Beispiel Japan zeigt, dass die USA in Asien durchaus zu interessanten Neuakzentuierungen fähig sind. Dass Hillary Clinton auf ihrer ersten Auslandsreise durch vier asiatische Staaten zuerst Japan besuchte, hat eine nicht zu unterschätzende Bedeutung, wie auch die Tatsache, dass Präsident Obama den japanischen Premierminister als ersten ausländischen Regierungschef empfing. Das war noch unter Präsident Bush anders. Jetzt 86 Christian Hacke misst die Regierung Obama Japan allergrößte Bedeutung bei: „Das Bündnis zwischen den Vereinigten Staaten und Japan ist ein Eckpfeiler unserer Außenpolitik. Die bilaterale Zusammenarbeit bei der Lösung der zahlreichen Probleme, die nicht nur Asien, sondern die ganze Welt betreffen, genießt innerhalb der Regierung Obama hohe Priorität.“ Japans Hilfe bei der Überwindung der globalen Rezession, bei der Stabilisierung der Sicherheitslage im Irak und in Afghanistan, beim Umgang mit Nordkoreas Nuklearprogramm und nicht zuletzt mit Blick auf Chinas machtpolitische Ambitionen wie auch Chinas problematischer Klimapolitik, ist für die USA unverzichtbar. Clinton betonte die Rolle Japans in der Bekämpfung der Weltwirtschaftskrise, die eine koordinierte globale Antwort der beiden größten Volkswirtschaften der Welt erfordere. Auch lobte Clinton Japans Beitrag beim Wiederaufbau in Afghanistan und betonte vor allem, dass seit einem halben Jahrhundert Japan Washingtons engster Verbündeter in Asien gewesen sei. Vor dem Hintergrund, dass Tokio sich immer wieder darüber beklagte, dass die Regierung Bush Japan die kalte Schulter gezeigt habe, signalisiert der Besuch von Außenministerin Clinton einen positiven Kurswechsel. Sie hat schon jetzt das Bündnis mit Japan verstärkt und zugleich die japanische Führung durch besondere Bevorzugung im Rahmen von Obamas Asienpolitik beruhigt. So soll die Stationierung amerikanischer Truppen in Japan Gesetzeskraft erlangen. Damit wird der amerikanisch-japanische Verteidigungspakt nicht nur symbolisch gestärkt. Zur Zeit des Kalten Krieges waren die beiden ehemaligen Erzfeinde der USA, Japan und Deutschland, zu den wichtigsten Bündnispartnern im weltpolitischen Kalkül der USA aufgestiegen. Es hat nicht nur strukturelle Gründe, wenn heute die Regierung Obama dieses Vertrauen und diesen exklusiven Rang offensichtlich nur noch für Tokio bereit hält. Japans Politik, seine geschmeidige Diplomatie und seine Treue gegenüber den USA auch in schwierigen Zeiten haben ein Übriges getan, um diese Rangebene zu bekräftigen. In London war auf dem G-20 Gipfel der japanische Premierminister Aso von Obamas Bescheidenheit und Offenheit mit Blick auf die Rolle der USA in der Weltwirtschaftskrise so beeindruckt, dass er als eigentlicher Gastgeber der nächsten G-20 Runde sich dem amerikanischen Wunsch sofort anschloss, den kommenden G-20 Gipfel in den USA stattfinden zu lassen Auch der Besuch der Außenministerin im Februar 2009 beim traditionellen Verbündeten Südkorea diente der Verbesserung der wechselvollen Beziehungen zwischen Seoul und Washington. Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 87 Im Zeichen der neuen Kooperationsbereitschaft signalisierte die Außenministerin auch dem verfeindeten Nordkorea Kooperationsbereitschaft, – falls das kommunistische Land sein Atomprogramm aufgäbe. Nordkorea müsse sein Atomwaffenprogramm vollständig und überprüfbar abschaffen. Dazu mahnte sie Nordkorea, es verkalkuliere sich erheblich, wenn es glaube, durch Drohungen und Manövrieren einen Keil zwischen die USA und Südkorea treiben zu können. Umgekehrt versprach Clinton Nordkorea im Falle einer Rückkehr an den Sechs-Mächte-Verhandlungstisch und einer verifizierbaren nuklearen Abrüstung eine Menge Hilfe. Kluge Machtpolitik wird also erkennbar, wenn die Regierung Obama Festigkeit bei einem nordkoreanischen Willenstest signalisiert, sollten beispielsweise nordkoreanische Raketen abgeschossen werden, die erstmals Alaska und Hawaii erreichen könnten. 7. Der neue Schwerpunkt Asien Mit dem Besuch in Indonesien setzte die Außenministerin ein besonders markantes Zeichen. Der größte muslimische Staat der Welt mit einer weit entwickelten Demokratie wird in Washington nun als Leuchtturm gesehen, um gute Beziehungen der USA zur islamischen Welt zu verdeutlichen. Wir suchen umfassende Partnerschaft mit Indonesien, erklärte Clinton. Entsprechende Sonderbeziehungen mit Indonesien als Vorbild für gelungene Integration von Religion, Demokratie und Weltwirtschaft könnten Signalwirkung entwickeln. Asien wird unverkennbar zum neuen Schwerpunkt der amerikanischen Außenpolitik. Asiens wirtschaftliche Dynamik, Amerikas strategische Interessen, die Suche nach demokratischen Partnern, die Rivalität mit aufsteigenden Mächten wie China, aber auch neue globale Fragen wie Umweltschutz, Energie und der Kampf gegen den Terror bilden die vitalen Berührungspunkte zwischen den USA und dieser Weltregion. 8. Der Kampf gegen den Terror Der Kampf gegen den Terror bleibt das zentrale Erbe der Regierung Bush. Noch herrscht offensichtlich Ratlosigkeit in Washington. Es fehlt bislang an einer kohärenten Anti-Terror-Strategie, besonders mit Blick auf Afghanistan und Pakistan. Bislang beschränkt sich die Regierung Obama auf massive Aufstockung amerikanischer Truppen in Afghanistan. Im Sommer 2009 soll durch weitere 20.000 GIs die dramatische Lage vor Ort verbessert werden. Weitere 13.000 US-Soldaten sollen folgen. Obama lässt also keine Zweifel aufkommen, dass er den Krieg gegen den Terror in Afghanistan gewinnen will, doch das Kriegsziel scheint sich zu verändern. 88 Christian Hacke Wollte G.W. Bush noch Demokratie verwirklichen, so erkennt man heute in Washington, dass das Ziel weitaus bescheidener gesteckt werden muss. Vereitlung von Terror und ein Minimum von Ordnung und Gerechtigkeit erscheinen wohl ausreichend, um dann eines Tages den Rückzug anzutreten. Der Vergleich mit der amerikanischen Vietnam-Politik drängt sich zusehends auf: Statt Vietnamisierung wird nun eine Afghanisierung der Kriegsführung und Ordungspolitik langfristig in Washington ins Auge gefasst. Aber das Schicksal Südvietnams erinnert auch daran, dass weder massive Truppenaufstockung noch übereilter Rückzug zu einer befriedigenden Lösung führen. In diesem Sinne werden sich die USA mit 55.000 Mann unter Anspannung aller eigenen Mittel nicht mehr damit zufrieden geben, dass die Bündnispartner lediglich einige hundert Mann mehr bereitstellen wollen. Zudem hat Obama durch Bombenangriffe auf Pakistan den Krieg ausgeweitet und weitere Vorkehrungen für den Fall getroffen, dass in Pakistan die islamistischen Terroristen weiter an Einfluss gewinnen und vielleicht eines Tages sogar in Islamabad die Zentralgewalt übernehmen sollten. Das alles deutet nicht auf Wandel, sondern verspricht Fortsetzung und Intensivierung des Kampfes gegen den Terror, wie er von den Europäern nicht erwartet worden ist. Nicht mehr der Irak, der nach wie vor Amerikas Kräfte über Gebühr bindet, sondern das überraschend schnelle Vordringen der Taliban und anderer umstürzlerischer Kräfte in Afghanistan und Pakistan erfordert nun den ganzen Einsatz, den die neue Regierung in Washington bereit zu tragen ist. Eine islamistische Atommacht Pakistan und Afghanistan unter der Führung der Taliban wäre nicht nur für die Region eine unannehmbare Perspektive. Wie reagieren die Europäer? Alle wollen an ihrem Afghanistan-Engagement festhalten. Das ist die gute Nachricht. Aber sind die Europäer bereit, Obamas Ruf nach mehr Engagement zu folgen? Sein Slogan „Yes, we can“ findet in Europa mit Blick auf ein verstärktes Engagement nur wenig Echo: Frankreich will 500, Italien 800 und Deutschland 600 Soldaten mehr bereitstellen. Von den anderen hört man noch weniger. Berlin will den ohnehin bei der Bevölkerung und Politikern ungeliebten Einsatz höchstens um 1.000 Mann auf insgesamt 4.500 Mann aufstocken und am liebsten jegliche Kriegsverwicklung vermeiden. Aber nach Obamas überzeugenden Lektionen über Partnerschaft und Bündnispflichten stehen die Europäer unter Erwartungsdruck, sie befinden sich wider Erwarten in einer Glaubwürdigkeitsfalle und müssen überzeugend handeln. Der Krieg gegen den Terror wird so schnell nicht auf neue Grundlagen und effektivere Bekämpfungsmöglichkeiten umgestellt werden. Die Probleme in Afghanistan, im Irak und in Pakistan bleiben langfristig kaum lösbar. Zu lange wurde zu viel falsch gemacht. Weil Sinn, Zielsetzung und Stra- Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 89 tegie nebulös bleiben und in keinem Verhältnis zu den laufenden Kosten stehen, werden auch die Verbündeten störrisch und die Gegner gefährlich bleiben. Osama bin-Laden ist nach acht Jahren Krieg noch in Freiheit. Der Terrorismus bleibt eine Plage, mit der die Welt noch lange leben muss. Und der Krieg in Afghanistan wird nicht durch die Entsendung weiterer NATO-Truppen gelöst. Afghanistan wie auch der Irak brauchen eine politische Lösung. Und eine politische Lösung könnte die Mitwirkung Irans erfordern. Das hat Präsident Obama klar erkannt. Aber Afganistan könnte zu seinem Vietnam werden, wenn er ohne ausreichende Hilfe der Verbündeten dort scheitern würde. 9. Die Beziehungen zum Iran Seit 1979 unterhalten Washington und Teheran keine diplomatischen Beziehungen mehr, vielmehr avancierte der Iran nach dem Sturz des Schahs und unter dem Gottesregime der Ajatollahs zum Staatsfeind Nummer eins in Washington. Die antiisraelischen Verbalexzesse und das iranische Nuklearprogramm haben ein Übriges getan, um die Beziehungen zu verschärfen. Auch Präsident Obama hält daran fest, dass Teheran nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen dürfe. Allerdings äußerte Präsident Obama grundsätzliche Dialogbereitschaft, einschließlich Gesprächen über das iranische Atomprogramm. Deshalb erscheint eine Wiederannäherung der beiden Staaten grundsätzlich möglich, bleibt aber schwierig. Andererseits gibt es eine Kongruenz von beiderseitigen Interessen, die von Präsident Obama offensichtlich stärker berücksichtigt werden soll. Beide Staaten sind an Stabilität in Afghanistan, Pakistan sowie im Irak interessiert. Iran wie die USA schreckt die Perspektive einer Talibanisierung der Atomwaffenmacht Pakistan. Vor allem setzt sich in Washington unter der Führung von Präsident Obama die Erkenntnis durch, dass die Konflikte um den Irak, Afghanistan wie auch der Nahostkonflikt nicht ohne, sondern nur mit Iran gemeinsam gelöst werden können. Dies gilt auch für die nukleare Proliferation. Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, dass Obama den Iran dazu auffordert, die Faust zu lösen und die amerikanische Hand anzunehmen. Doch scheinen beide Seiten vorerst abzuwarten. Jeder erwartet vom anderen den ersten Schritt. War ein antiamerikanischer Kurs in Teheran zur Zeit von George W. Bush populär, so wird dieser seit dem Amtsantritt von Obama schwieriger. Auch wird eine Annäherung von Washington und Teheran in Israel aufmerksam und nicht unkritisch beobachtet. Auch die sunnitischen Staaten der arabischen Welt reagieren mit Skepsis auf die Annäherung zwischen Washington und Teheran. 90 Christian Hacke Vieles spricht dafür, dass Präsident Obama das Problem Iran nicht isoliert behandelt, sondern im Kontext der Nahostregion: Der Iran ist dabei, die Schwelle zur Atommacht zu überschreiten. Der israelisch-palästinensische Friedensprozess ist völlig zusammengebrochen, in den Palästinensergebieten, vor allem im Gaza, dominieren zunehmend militante islamistische Gruppen. Bushs jahrelanges Versagen und seine Ziellosigkeit haben die Rolle der USA insgesamt im Nahen Osten geschwächt, sodass Obama rasch, aber umsichtig handeln muss. Selbst wenn er es wollte, kann der amerikanische Präsident aber auch dort keine Wunder vollbringen. Deshalb bleibt die Zukunft des Nahen Ostens ein Pulverfass. Der Iran wird über kurz oder lang Atommacht, denn es gibt keinen völkerrechtlichen Anspruch und keine nicht-militärischen Mittel, das Land daran zu hindern. Deshalb wird eine Diplomatie der Öffnung schwer zu verwirklichen sein, solange die USA nicht im Grundsatz Irans zivile Nuklearambitionen respektieren. Obama wird deshalb vermutlich einen umfassenderen Ansatz für Verhandlungen mit dem Iran suchen, der nicht nur das iranische Nuklearprogramm, sondern auch Möglichkeiten für gemeinsame Interessen mit einbeziehen wird. Die neuen energiepolitischen Prioritäten könnten auch hier bilateral im gegenseitigen Interesse positiv wirken. Doch vorerst bleiben die Beziehungen konfliktgeladen, denn Iran bemüht sich zunehmend darum, seinen Einfluss weltpolitisch auszudehnen, nicht zuletzt in Lateinamerika. So bezeichnete Verteidigungsminister Gates die Bemühungen Irans dort als subversive Aktivitäten, die Amerika in Sorge versetzen. Vor allem bemühe sich der Iran in Kuba, Bolivien, Nicaragua und Ecuador um verstärkten Einfluss. Als Türöffner für Teheran in Lateinamerika wirkt der venezuelanische Präsident Hugo Chavez, der in den vergangenen Jahren systematisch die Beziehungen zu Iran zu einer strategischen Partnerschaft ausgebaut hat. Es ist kein Zufall, dass Chavez und der iranische Präsident Ahmadinedschad sich gegenseitig als geliebte Brüder bezeichnen und gemeinsam Amerikas Einfluss in Lateinamerika zu unterminieren suchen. Teheran setzt dabei offenbar auf Venezuela, das es als Drehscheibe für Exporte iranischer Produkte ausbaut. Israel hatte schon 2007 gemahnt, dass Venezuela im Gegenzug Uran für Irans Atomprogramm besorge oder gar schon geliefert habe. Auch Brasilien, das wirtschaftlich wichtigste Land Südamerikas, wird zum wichtigen Handelspartner des Iran, der zum größten Abnehmer brasilianischer Produkte im Mittleren Osten geworden ist. 10. Die Beziehungen zu Lateinamerika Durch die Politik von G.W. Bush hat Washington in Lateinamerika einen atemberaubenden Ansehensverlust erlitten. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass Präsident Obama die Beziehungen der USA zu Latein- Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 91 amerika wieder zu stärken versucht und dabei Brasilien eine entscheidende Rolle zukommen soll. Nicht nur die Eindämmung des Einflusses autoritärer und energiepolitisch starker Regime ist im Interesse der USA, sondern andere gemeinsame Herausforderungen müssen gemeistert werden. Mit Mexiko sucht die Regierung die wuchernde Drogenkriminalität einzudämmen und seit dem panamerikanischen Gipfel in Trinidad im April 2009 wollen die USA verstärkt mit ihren Partnern in Lateinamerika Waffen- und Drogenhandel unterbinden. Die Macht der Drogengangs soll untergraben werden. Doch dominiert im Interessengeflecht die Wirtschaft. So ist Lateinamerika nach wie vor handelspolitisch für die USA weitaus wichtiger als China. Das Geschäftsvolumen liegt mit über 500 Milliarden Dollar um ein Mehrfaches über jenem mit China. Unter Krisenaspekten signalisiert Präsident Obama Neuansätze in der Kubapolitik, die vermutlich aber erst nach Ablösung der Castrobrüder Wirklichkeit wird. Die größte Herausforderung bilden jedoch die lateinamerikanischen Drogenkartelle, die zur größten Bedrohung in der organisierten Kriminalität geworden sind. Mexikanische Gangs haben in mindestens 230 amerikanischen Städten bereits Ableger eingerichtet, weshalb die Beziehungen zu Mexiko sich dieses Problems ganz besonders widmen werden. 11. Festigung der Partnerschaften Nach Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten bleiben die transatlantischen Beziehungen wichtig, verlieren allerdings ihre alte exklusive Bedeutung wie zur Zeit des Kalten Krieges. Aber auf alle Partner geht Präsident Obama schneller, offensiver und geschmeidiger als sein Vorgänger zu. Der Grund ist klar: Beim Klimawandel, bei der Terrorismusbekämpfung, aber vor allem in Afghanistan, im Irak und beim Atom-Streit mit dem Iran sind die USA auf Partner angewiesen. Konsequenterweise wird Obama nicht nur mehr regionale, sondern mehr globale Mitverantwortung von Freunden und Partnern einfordern. Präsident Obama entfaltet dafür alle Varianten von Diplomatie: Mehr ökonomische Mittel sollen bereitgestellt werden, die Auslandshilfe soll aufgestockt und die Gemeinschaftsdiplomatie soll in den entsprechenden Institutionen effektiver werden. Auch für Obama bleiben die amerikanischen Interessen vorrangig, aber er zeigt dabei ein bemerkenswertes Gespür für die nationalen Interessen und Sensibilitäten der anderen Völker und Nationen. Während für seinen Vorgänger Dialogbereitschaft im Kern nur Forderungen beinhaltete, verhandelt Obama kooperativer und konsensbereiter. 92 Christian Hacke Vor allem tut er viel, um zu vermeiden, dass sein Führungsstil nicht mit Unilateralismus verwechselt wird, vielmehr signalisiert er: Die USA wollen künftig möglichst gemeinschaftlich Probleme lösen, aber diese nicht mehr unilateral auslösen. 12. Auf dem Weg zu einer neuen „Obama-Dokrin“? Mit der Formel vom „Konstruktiven Internationalismus“ könnte man die ersten Umrisse der neuen Außenpolitik der USA umschreiben. Vielleicht entwickelt sich daraus eines Tages eine „Obama-Doktrin“? Wie seine Vorgänger Truman, Eisenhower, Nixon, Carter und Bush, so könnte auch Präsident Obama geneigt sein, seine außenpolitischen Ideen und Ambitionen im grand design einer Doktrin vorzustellen. Dabei fällt auf, dass die heutigen außenpolitischen Herausforderungen durchaus mit denen von Präsident Nixon zu Beginn der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts verglichen werden können: Wie Obama angesichts massiver wirtschaftspolitischer Schwäche der USA und militärischer Überdehnung im Krieg gegen den Terror mehr Leistungen von den Verbündeten einfordert, so mahnte auch Präsident Nixon wegen der überwältigenden Kosten des Vietnam Krieges mehr Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung von den Partnern an, um die Kosten und Verpflichtungen der USA zu verringern. Wird Präsident Obama eine vergleichbare Doktrin entwickeln? Es ist nicht auszuschließen, ja sie deutet sich schon an, wenn er gerade von den Verbündeten im Rahmen der NATO mehr Engagement fordert, denn er will Al Quaida „zersprengen, unschädlich machen und letztlich zerstören“. Auch mit Blick auf die weltpolitischen Vorstellungen zeigen sich Parallelen: Präsident Nixon revolutionierte die internationale Politik, weil er die starre ideologische bipolare Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion durch eine Ära der pragmatischen und interessenorientierten Multipolarität abzulösen suchte. Im Zuge seiner Entspannungspolitik gegenüber der Sowjetunion und der Volksrepublik China entwarf Richard Nixon die Vision eines pentagonalen Weltsystems, in dem die USA sozusagen als primus inter pares einerseits das Bündnisdreieck mit Japan und Westeuropa und andererseits das Rivalitätsdreieck mit der Sowjetunion und der VR China dominieren würden. Nicht Konfrontation, sondern eine interessenorientierte Gleichgewichtspolitik sollte dominieren. Richard Nixon wäre vermutlich zu einem der erfolgreichsten außenpolitischen Präsidenten geworden, hätte er sich nicht selbst mit der Watergate Affäre politisch ruiniert. Die ersten Umrisse von Obamas Außenpolitik deuten darauf hin, dass er analog zur Nixon-Doktrin ein multipolares Gleichgewichtssystem favo- Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 93 risiert, in dem allerdings die USA die Schlüsselrolle spielen sollen. Die USA als dominanter Balancer, als Spinne im Netz, sollen weiter die Fäden der Weltpolitik ziehen, Allianzen schmieden und feindliche Gegenkoalitionen abwehren, um die Welt in einer amerika-freundlichen Balance zu halten: Auch Obama schwebt wie Nixon eine pentagonale Welt vor, die an das Gleichgewichtssystem des 19. Jahrhunderts erinnert, in dem autoritäre Regime mit demokratisch-imperialen Mächten um Vorteil und Ausgleich rangen. Im 21. Jahrhundert dagegen sollen die USA unter Führung von Präsident Obama das Kooperationsdreieck zwischen USA, Europäischer Union, Japan und befreundeten asiatischen Mächten auszubalancieren suchen, während sie im Kräftedreieck USA-Russland-VR China stärker auf eigenen Vorteil bedacht sind. 13. Zusammenfassung Wie stehen die Chancen für außenpolitischen Erfolg, haben sich doch die Kräfteverhältnisse massiv zu Ungunsten der USA verändert. Barack Obama glaubt nach wie vor wie die Mehrheit seiner Landsleute, dass der Anspruch auf die amerikanische Vormachtstellung gültig bleiben muss und dass alle entsprechenden Anstrengungen notwendig bleiben. Dabei erscheint Obamas Weltsicht nicht frei von Widersprüchen: Auf der einen Seite erkennt er die neuen globalen Herausforderungen und den überwältigenden Trend zur Multipolarität, der durch Amerikas Fehler und Schwächen beschleunigt wird, an, andererseits scheint er entschlossen, mit Unterstützung der Partner Amerikas überragende Weltmachtrolle wiederherstellen zu wollen. Bleiben also Unipolarität und imperiale Dominanz oder die Rolle des sanften Hegemons für Präsident Obama als Vorbild für die Rolle der USA erstrebenswert? Kann und soll Präsident Obama auch wieder für den Westen sprechen und handeln? Diese Frage ist gerade in den transatlantischen Beziehungen umstrittener denn je. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Staatspräsident Sarkozy demonstrieren ein neues europäisches Selbstbewusstsein, das amerikanische Führungsansprüche auf vielfältige Weise herausfordert: Amerikanische Vorschläge zur Bewältigung der Weltwirtschaftskrise, Obamas Wunsch nach mehr militärischen Leistungen der Europäer oder nach Ausweitung der NATO werden kühl zurückgewiesen oder diplomatisch überhört. Dazu werden die eigenen europäischen Leistungen selbstbewusster denn je eingebracht und entsprechende Reformvorschläge à la carte Europe vorgelegt. Der alte Kontinent präsentiert sich den USA heute in vielfacher Weise auf Augenhöhe, weil er in entscheidenden Krisen nicht-militärischer 94 Christian Hacke Art zukunftsweisend gehandelt hat, aber die USA versagt haben. Das gilt mit Blick auf manche Aspekte im Kampf gegen den Terror, für die Finanzund Wirtschaftskrise und vor allem für die Klima- und Energieproblematik, die von den USA weitgehend verschlafen wurde. Die Europäer sind vorbildlich bei kooperativen, ausgleichenden und zivilisatorischen Aspekten der Weltpolitik, wenn die Dinge sich aber konfrontativ entwickeln und militärische Entschlossenheit zwingend wird, dann verblasst Europas Stärke und Einheit. Das gilt auch für die Grenzbereiche, wo Sicherheit überwiegend kooperativ, aber im Krisenfall auch strategisch abgestützt werden muss, wie bei Fragen der Energiesicherheit. Könnte es dann angesichts der wachsenden Energieknappheit zur Wiederauflage von sogenannten great games des 19. Jahrhunderts kommen? Russlands neues energiepolitisches Selbstbewusstsein und die Abhängigkeit der westlichen Industrienationen von Russlands Energiequellen bilden kein gemeinsames Ruhekissen, sondern wirken sehr beunruhigend. Der Westen erscheint auf vielfältige Weise geschwächt, gespalten, in gewisser Weise auch ratlos angesichts der rasanten ökonomischen Talfahrt und angesichts energiepolitischer Abhängigkeiten. Umso größer ist die Hoffnung, dass eine neue amerikanische Führung die machtpolitische Balance der autoritären Mächte wieder zugunsten des Westens verändern wird. Hier zeigt sich das gemeinsame Anliegen der freiheitlichen Demokratien. Nicht nur die USA, auch die Verbündeten sind gefordert. Die Überforderungskrise, von Präsident Bush ausgelöst, ist schon lange keine rein amerikanische Krise mehr. Sie ist eine westliche und kann deshalb nicht nur von Präsident Obama, sondern muss gemeinsam geschultert werden. Nicht nur die USA müssen sich verändern, wenn sie andere bewegen wollen, auch die Verbündeten, insbesondere die Europäer und nicht zuletzt die Deutschen müssen sich verändern, müssen mehr internationale Mitverantwortung auch in risikoreichen Regionen schultern, wenn sie Obamas berechtigte Forderung nach change mittragen und mitgestalten wollen. Gerade die Europäer müssen endlich aufwachen und begreifen, dass sich die Welt und die transatlantischen Beziehungen dramatisch verändert haben, und nicht nur zugunsten des Westens. Wenn sie dies nicht tun, wird auch Obama wieder vorbehaltlos die Devise ausgeben: gemeinsam, wenn möglich, und alleine, wenn nötig. Vor allem im Zuge der sich vertiefenden weltwirtschaftlichen Krise und angesichts der dramatischen ökonomischen Schwäche der USA gibt es keine Alternative zu Kooperation, sonst droht allen eine Ära des Protektionismus mit dramatischen Folgen. Auch deshalb darf Obama mit seinen außenpolitischen Ambitionen von den Partnern und Freunden nicht alleingelassen werden. Determinanten, Antriebsfaktoren und Spielräume 95 Die Europäer müssen sich wieder stärker atlantisch ausrichten, nicht nur Krisen wittern und auf Distanz zu den USA gehen, sondern Chancen suchen und freundschaftlich handeln. Die Europäer müssen wieder erkennen, dass es im weltpolitischen Ringen zu Beginn des 21. Jahrhunderts keine Alternative zu einem internationalen Ordnungsmodell gibt, in dem die USA nicht nur eine gestärkte, sondern die weltpolitisch führende und von den Partnern unterstützte Rolle spielen. Doch ist diese Sicht vielleicht zu optimistisch, denn im Enthusiasmus für Obamas change liegt schon der Keim für zukünftige, fast vorprogrammierte Enttäuschung, zumindest für Ernüchterung. Bush hat schwere Fehler begangen, aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht alles von ihm falsch war. Darüber hinaus hat er außenpolitische Tatsachen geschaffen, die Obama nicht negieren kann. Die Grundlagen für den Kampf gegen den Terror bleiben größtenteils unverrückbar. Der Krieg gegen die Taliban und gegen Al Qaida wurde in Afghanistan richtig begonnen. Umgekehrt dürfen die Fehler und Versäumnisse der Europäer der vergangenen Jahre nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden. Was immer auch im Zuge des Neuanfangs der Außenpolitik von Präsident Obama apostrophiert wird, es sind alte Probleme und neue unerwartete Geschehnisse und Krisen selbst, die die Agenda bestimmen werden. Der Kampf gegen den Terror umspannt die Weltpolitik noch auf unbestimmte Zeit, doch ein Unglück kommt selten allein: Gesteigerter Energieverbrauch und eine erhöhte Abhängigkeit der Industriestaaten von Öl und Gas verstärken die schon existierende Unsicherheit. Der einstmals starke und geeinte freiheitliche Westen erscheint deshalb heute in schlechterer Verfassung, während viele autoritäre Staaten, nicht zuletzt wegen ihrer immensen Öl- und Gasvorkommen und ihrer neuen Wirtschaftskraft und Einflussmöglichkeiten, an Macht gewonnen haben. Die Ziele wie auch die Probleme amerikanischer Außenpolitik bleiben, aber die Mittel werden von der Regierung Obama klüger ausgewählt und die Diplomatie wird geschmeidiger werden. Nach der Lösung der immensen Probleme könnte unter Präsident Obama bald mehr Kontinuität als derzeit angenommen, aber auch mehr stilistischer Wandel erkennbar werden. Seine Führungsqualitäten könnten dann zu einer Renaissance amerikanischer Stärke und Werte in der Welt führen. Das wäre im Interesse der freien Welt, würde autoritäre Regime zu mehr Vorsicht und Rücksichtnahme zwingen und den armen und unterdrückten Völkern Hoffnung machen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg mit vielen Unwägbarkeiten. Leader of a New America – Außenpolitik im Wahlkampf von Barack Obama Johannes Urban 24. Juli 2008. Massen von Menschen strömen von den Bahnhöfen Berlins in Richtung Tiergarten. Viele haben ihre Digital-Kameras dabei, manche auch Fahnen – deutsche, US-amerikanische oder türkische. Das Ganze hat etwas von WM-Fanmeile. Aber: Trotz Bierausschank und Rock-Vorgruppe bleibt die Stimmung ernst. Es geht nicht um Fußball, sondern die Zukunft der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Menge wartet geduldig auf das Erscheinen von Barack Obama, einem US-Senator, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden will. Er ist noch nicht von seiner Partei nominiert; trotzdem wendet er sich am Ort der großen Rede seines Vorbilds John F. Kennedy, die legendären Worte Ernst Reuters während der Berlin-Blockade zitierend, „als Bürger dieser Welt“ an ein weltweites Publikum. Obamas Botschaft ist, dass in diesen Zeiten alle Menschen und Staaten guten Willens zusammenstehen müssten. Er verspricht eine bessere Welt, partnerschaftlich geführt von einem neuen Amerika. 1. Warum Obama? Fast genau sechs Monate nach seiner Rede an der Siegessäule bezog ein mit deutlichem Vorsprung gewählter Präsident Obama das Weiße Haus. Sein Wahlsieg markierte in mehrerlei Hinsicht eine historische Zäsur.1 Die meisten Beobachter führten ihn auf die globale Finanz- und Wirtschaftskrise zurück, die in den USA ihren Ausgang nahm. In der Tat spricht vieles für diese Einschätzung. Und doch sind Zweifel angebracht. Die Kampagne Barack Obamas unterschied sich in Vielem von der Bill Clintons, der 1992 mit dem Motto „It’s the economy, stupid“ die Macht errang. Wer den Wahlsieg Obamas allein auf dessen – nicht schrecklich detailliertes – Programm zur Lösung der Finanz- und Wirtschaftskrise zurückführt, greift zu kurz. Gleiches gilt für alle, die auf eine zweifellos beeindruckende Mobilisierung neuer Wähler mit Hilfe des Internets hinweisen. Das Internet 1 Selten wurde von einem Kandidaten so viel erwartet wie von Barack Obama. In dieser Hinsicht steht Obama schon jetzt in einer Reihe mit Franklin D. Roosevelt und John F. Kennedy. Für eine übersichtliche Darstellung früherer Präsidentschaftswahlen siehe Gerste, Ronald D.: Duell ums Weiße Haus: Amerikanische Präsidentschaftswahlen von George Washington bis 2008, Paderborn 2008. Leader of a New America 97 spielte ein zentrale, aber instrumentelle Rolle. Und auch wer mit Max Weber das Charisma des Kandidaten Obama als entscheidend ansieht, bleibt eine Analyse schuldig, woher dieses Charisma rührte. Gerade die Frage nach den Quellen der Faszination für Barack Obama ist jedoch hilfreich, um zu verstehen, warum sich Millionen von US-Amerikanern an dessen Online-Wahlkampf beteiligten. Es wird nicht lange dauern, bis Studien die Motive dieser Menschen detaillierter nachzeichnen als die üblichen „exit polls“. Sie werden vermutlich auf viele Variationen des von Obama bemühten Leitmotivs der „Hoffnung“ durch „Wandel“ zu sprechen kommen. Eine nicht geringe Rolle wird dabei einer Dimension zugeschrieben werden, die – vielleicht auch weil sie als Domäne beider Rivalen Obamas galt – gemeinhin nicht als entscheidend für dessen Wahlsieg angesehen wird: Außen- und Sicherheitspolitik. Obamas Rede vor der Siegessäule, die vom politischen Gegner als „celebrity event“ abgetan wurde, steht symbolisch für den in dieser Konsequenz präzedenzlosen Versuch eines Spitzenkandidaten, seine Wahlbürger dadurch für sich zu gewinnen, dass er für eine neue Rolle der USA in der Welt wirbt und dabei die Hoffnungen des Auslands auf sich zieht. Nicht umsonst titulierte das Nachrichtenmagazin „SPIEGEL“ Obama später als „Weltpräsidenten“.2 2. Wofür steht Obama? In welchem Maße und in welcher Weise das Themenfeld Außen- und Sicherheitspolitik den Wahlkampf Barack Obamas prägte, ist dennoch nicht das Thema dieses Beitrags. Es geht mir darum nachzuzeichnen, wie sich die Außen- und Sicherheitspolitik Barack Obamas auf dem langen Weg zur Macht entwickelte. Ziel des Beitrags ist es, ein außen- und sicherheitspolitisches Profil des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu gewinnen. Ein solches Profil lässt im Idealfall Schlussfolgerungen für die Außen- und Sicherheitspolitik der Vereinigten Staaten in den kommenden vier Jahren zu. Nun mag mancher einwenden, ein solches Unterfangen sei löblich, aber wenig aussichtsreich. In der Tat ist es mit der Prognosekraft der Politikwissenschaft nicht anders als mit der aller anderen Sozialwissenschaften: Letztlich handelt es sich immer um – hoffentlich – möglichst faktenbasierte Spekulation. Was Prognosen in den internationalen Beziehungen angeht, hat Helga Haftendorn mit dem Bild der Kristallkugel die Möglichkeiten und Grenzen des Prognostizierens anschaulich umschrieben.3 2 3 Der Spiegel titelte „Der Weltpräsident. Was er will – was er (nicht) kann“, Ausgabe 46/2008, S.122-138. Haftendorn, Helga: Die Sehnsucht nach der Kristallkugel. Über Leistungsfähigkeit und Versagen der Theorie der internationalen Politik, in: Internationale Politik 8/1996, S.3-8. 98 Johannes Urban Noch schwieriger gestaltet sich der Fall Obama. Erstens: Der Kandidat war aufgefordert, sich zu einer äußerst umfassenden, vielschichtigen und komplexen außen- und sicherheitspolitischen Agenda zu äußern: Internationaler Terrorismus, der Krieg im Irak, Proliferation im Iran und in Nordkorea, eine wachsende Abhängigkeit von Öl-Staaten und der neuen Wirtschaftsmacht China, Klimawandel, internationale Finanzmärkte etc. Zweitens: Obama verstand es meisterhaft, sich in dieser Gemengelage möglichst wenig festzulegen und die Klaviatur der Interpretierbarkeit politischer Äußerungen zielgruppengewandt zu bedienen. Medien und frustrierte Gegner sprachen nicht umsonst vom „Teflon“-Kandidaten – kein gutes Omen für eine prägnante politikwissenschaftliche Charakterisierung. Ein noch grundsätzlicherer Einwand könnte lauten, dass der Versuch, politische Positionen aus dem abzuleiten, was vor einer Wahl gesagt wurde, eigentlich nur naiven Menschen in den Sinn kommen kann. Kenner des Regierungssystems könnten überdies auf die Kontinuität außenpolitischer Doktrinen im Handeln der Vereinigten Staaten hinweisen; Kenner der Demokratischen Partei auf die Diskrepanz zwischen dem (außen-)politischen Denken Obamas und dem Demokratischen Establishment, das Obama – allen voran Hillary Clinton – an Schlüsselpositionen in die Regierungsbildung eingebunden hat. Und schließlich könnte, wer die Strukturen und Abläufe des diplomatischen Betriebs kennt, auf die Beharrungskräfte von Bürokratien verweisen. Es braucht also einige methodische Vorbemerkungen: Die versuchte vorsichtige Prognose stützt sich nicht auf eine Einordnung in theoretische Raster, sondern eine Darstellung der außenpolitischen Überzeugungen Obamas und seiner Vertrauten, soweit sie im Wahlkampf sichtbar wurden. Um den aufgezeigten methodischen Problemen Rechnung zu tragen, fließen in die Auswertung nicht nur die Rhetorik des Kandidaten, sondern auch die Eigendarstellung in Wahlwerbespots sowie relevante Positionspapiere ein. Dabei beschränkt sich die Darstellung auf Positionen in den vom Kandidaten selbst als zentral definierten Themenfeldern. Welche dieser Positionen es in die politische Praxis schaffen, könnte auf dieser Basis in der Tat nur spekuliert werden; deshalb stellt der Beitrag der zuvor gewonnenen Einschätzung in einer Art „Realitätstest“ relevante Entscheidungen der Obama-Administration in ihren ersten Wochen gegenüber. 3. Auf dem Weg zur Kandidatur Die außenpolitische Verortung Obamas ist auch deshalb schwierig, weil der für einen US-Präsidenten recht junge Mann keinen typischen Werdegang hinter sich hat, der eine klassische Einordnung (zum Beispiel als Isolationisten oder Internationalisten, Realisten oder Idealisten) nahelegen Leader of a New America 99 würde. Unter den 44 Präsidenten der USA zählt Barack Hussein Obama zu den eher unwahrscheinlichen Kandidaten. Das Amt wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. Es wurde ihm auch nicht durch führende Kreise seiner Partei angetragen. Es war das rhetorische Talent des jungen Senators aus Illinois, das ihm auf die nationale Bühne half. Auf dem weiten Weg zur Präsidentschaftskandidatur spielten außen- und sicherheitspolitische Themen dabei schon sehr früh eine große Rolle. Als erste bedeutende Rede Obamas gilt seine beißende Kritik am Kriegskurs von Präsident George W. Bush auf einer Anti-Kriegs-Rallye im Chicago Federal Plaza am 2. Oktober 2002. Er sei nicht grundsätzlich gegen Krieg, so damals Obama. Er sei gegen „dumme Kriege“ von „Armlehnenstuhlund Wochenendkriegern“, die sich keine Gedanken machen würden über die verlorenen Leben und das durch Krieg verursachte Leid. Wenn Bush kämpfen wolle, dann dort wo der wahre Feind stehe, in Afghanistan.4 Obama, junges Mitglied im State Senate von Illinois, war damals nicht Hauptredner der Veranstaltung. Er stand – noch – im Schatten von Teilnehmern wie Reverend Jesse Jackson. Die Kombination deutlicher AntiKriegs-Rhetorik mit einem Bekenntnis zum Kampf gegen Terroristen in Afghanistan stieß jedoch schon damals auf äußerst positive, wenn auch lokal begrenzte Resonanz. Landesweite Aufmerksamkeit erhielt Obama erst mit seiner Rede in Boston am 27. Juli 2004 auf dem NominierungsParteitag der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen. Während der damalige Kandidat John Kerry eher blass blieb, beeindruckte Obama mit seiner Bewerbungsrede für den US-Senat. Auch in dieser Rede ging es um den Irak-Krieg. Die Vereinigten Staaten hatten seither einen schnellen Einmarsch, den Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung und den Beginn eines religiösen Bürgerkriegs erlebt. Obama erzählte von der Begegnung mit einem Kriegsfreiwilligen, der sein Land und seine Werte im Irak verteidigen wolle. Er dankte dem Freiwilligen für seinen Einsatz, stellte aber die Frage, ob die Verantwortlichen sich umgekehrt ihrer Verantwortung bewusst seien und sich genug für die Soldaten einsetzen würden. Wieder sprach er das Leid der betroffenen Soldaten und ihrer Familien an. Und wieder verwies er auf die „eigentlichen Feinde“ der USA, die verfolgt und besiegt werden müssten. Obama berührte in dieser Rede eine Vielzahl weiterer Themen, verband das erwartete Lob für den Präsidentschaftskandidaten mit Werbung für die eigene Person. Wie in späteren Reden diente seine Biographie als Folie für die Projektion amerikanischer Ideale. Seine Fähigkeit, diese Ideale 4 Barack Obama‘s speeches 2002 to 2006, in: The Guardian, 20.1.2009, http:// www.guardian.co.uk/world/2009/jan/20/barack-obama-inauguration-speeches-1, Stand: 3.2.2009. 100 Johannes Urban glaubwürdig zu verkörpern und seine klare Botschaft zum Irak-Krieg wurden landesweit wahrgenommen und diskutiert. Wenig später war Obama US-Senator für den Bundesstaat Illinois. Seine Kandidatur für das Amt des US-Präsidenten verkündete Obama am 10. Februar 2007 in Springfield, Illinois. Noch stärker als zuvor appellierte Obama an ein neues Wir-Gefühl und forderte eine umfassende Anstrengung auf allen Politikfeldern, um die USA wieder auf Kurs zu bringen. Das Politikfeld, auf das Obama mit den meisten Details einging, war die Außenund Sicherheitspolitik. Er forderte seine Landsleute dazu auf, den Terroristen mit allem entgegenzutreten, was die USA aufbieten könnten. Der Sieg gegen Amerikas Feinde werde aber nur durch den Wiederaufbau der Allianzen Amerikas und den Export der amerikanischen Ideale möglich sein. Auch in der Begründung seiner Kandidatur sprach Obama leidenschaftlich über den Krieg im Irak. All die außen- und sicherheitspolitischen Ziele Amerikas seien nicht zu erreichen, wenn nicht der Krieg im Irak zu Ende gebracht würde. Er habe von Anfang an gesagt, dass der Krieg ein tragischer Fehler sei. Er und alle anderen trauerten mit den Familien der Gefallenen. Nun aber sei es Zeit, die Soldaten nach Hause zu bringen. Es sei Zeit anzuerkennen, dass keine noch so große Zahl menschlicher Leben den Konflikt lösen könne, der diesem Bürgerkrieg „eines anderen Volks“ zugrunde liege. Deshalb müsse damit begonnen werden, die Soldaten abzuziehen und so die Parteien im Irak unter Druck zu setzen. Die Veteranen, die nach Hause kämen, müssten die Fürsorge erhalten, die sie bräuchten und verdienten. Außerdem müsse das Militär wieder aufgebaut werden. Schon am Startpunkt seiner Kampagne trat Barack Obama mit dem Anspruch an, nicht nur auf einzelnen Politikfeldern graduelle Veränderungen durchzusetzen, sondern schlicht das politische Ruder des Landes herumzureißen. In der Außen- und Sicherheitspolitik griff Obama die amtierende Administration aus mehreren Stoßrichtungen an. Schon in diesen frühen Äußerungen kam ein stark idealistisches Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik zum Tragen, allerdings nicht die pazifistische Variante, sondern ein muskulöser Idealismus, der moralische Ansprüche mit Entschlossenheit zur auch militärischen Durchsetzung dieser Ideale verband. 4. Vorwahlkampf Den politisch-ideologischen Überbau seiner Außen- und Sicherheitspolitik erläuterte Obama standesgemäß in der Zeitschrift „Foreign Affairs“.5 5 Obama, Barack: Renewing American Leadership, in: Foreign Affairs 4/2007, http://www.foreignaffairs.org/20070701faessay86401/barack-obama/renewing-american-leadership.html, Stand: 4.2.2009. Leader of a New America 101 In dem Beitrag „Renewing American Leadership“ berief sich Obama auf die großen demokratischen Vorbilder Franklin D. Roosevelt, Harry Truman und John F. Kennedy. Sie hätten es verstanden, die Amerikaner zu schützen und zugleich Chancen für die nachfolgende Generation zu schaffen. Er skizzierte eine zunehmend gefährliche Welt, die eine neue Vision und neue Führungskraft brauche. Amerika könne sich weder zurückziehen, noch versuchen den Rest zu zwingen, sich unterzuordnen. Damit die USA wieder führen könnten, müssten sie den Krieg im Irak beenden und ihre Allianzen erneuern. Als wichtigste Handlungsfelder seiner Außen- und Sicherheitspolitik definierte Obama (in dieser Reihenfolge) den Friedensprozess im Nahen Osten, den Umbau der US-Streitkräfte, die Eindämmung der Verbreitung von Nuklearwaffen (gemeinsam mit Russland), den Kampf gegen den „Globalen Terrorismus“, die Wiederherstellung partnerschaftlicher Beziehungen mit Bündnispartnern in Asien und Europa sowie schließlich den Aufbau gerechter, sicherer und demokratischer Staaten in der Welt. Bei einer derart breiten Themenpalette erscheint es in der Tat notwendig, genauer hinzusehen, welche Themen Obama im Laufe des Wahlkampfs mit welchem Gewicht versah. In der „Aufwärmphase“ des Vorwahlkampfs konnte Barack Obama noch relativ selbstbestimmt „seine“ Themen setzen – darunter oft seine Haltung zum Krieg im Irak, mit der er vor allem junge und bisher politisch wenig aktive Wähler ansprechen konnte. Der überraschende Erfolg Obamas in den ersten Vorwahlentscheidungen führte jedoch rasch zu einer Kopf-an-Kopf-Auseinandersetzung mit der eigentlich gesetzten Spitzenkandidatin der Demokratischen Partei, Hillary Clinton. Zwar hatte sie für die Kriegsresolution, die George W. Bush zur Invasion im Irak ermächtigte, gestimmt – was Obamas Position im besten Licht erscheinen ließ. Allerdings zählte Hillary Clinton auch zu den am besten vorbereiteten Kandidaten mit intimer Kenntnis zahlloser Politikfelder, darunter auch der Außen- und Sicherheitspolitik. In diesem ungleichen Zweikampf setzte Obama von Beginn an auf Emotion. Er deklinierte sein Leitmotiv „Hope“ und „Change“ durch alle Politikfelder, von der Gesundheitsvorsorge über die Macht der Lobbyisten in Washington bis hin zur Außen- und Sicherheitspolitik. In Reden, Fernsehdebatten und Wahlwerbespots kristallisierte sich immer deutlicher der Anspruch Obamas heraus, Führer eines „Neuen Amerika“ zu sein. Diese Botschaft bezog sich mindestens so sehr auf die Außenwahrnehmung wie auf eine grundlegende Reform der Sozial-, Gesundheits-, Steuer- und Wirtschaftspolitik der USA. Schon in einem der ersten Werbespots, der im Rennen um Iowa – traditionell der erste Primary-Staat – gezeigt wurde, versprach Obama, das Ansehen und die Rolle der Vereinigten Staaten 102 Johannes Urban in der Welt wiederherzustellen.6 Dieses Ziel stellte Obama auch ins Zentrum seiner Siegesrede, als er den Staat gewonnen und überraschend die Drittplatzierte Hillary Clinton deklassiert hatte.7 Die großen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts – Terrorismus, die Proliferation von Massenvernichtungswaffen, der Klimawandel, Armut und Krankheit könnten nur gemeinsam bewältigt werden. Obama versprach ein Präsident zu sein, der den Krieg im Irak beenden und die Soldaten nach Hause bringen werde. Dieser Botschaft blieb Obama im gesamten Vorwahlkampf treu; er modifizierte sie jedoch jeweils abgestimmt auf lokale Besonderheiten des zur Entscheidung anstehenden Staates oder ging auf aktuelle Ereignisse ein. Im konservativen Arizona sprach Obama ausführlich über seine Bereitschaft, militärisch gegen die Feinde der USA vorzugehen.8 Er würde nicht zögern zuzuschlagen, wenn es notwendig sei, um die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihrer Bürger zu verteidigen. Zur Sicherheit gehöre aber auch, das US-Militär weise einzusetzen, nicht für einen unweisen Krieg im Irak. Er werde dafür arbeiten, dass die Vereinigten Staaten das stärkste Militär auf der Erde hätten. Dazu bräuchte es notwendige Mittel wie geeignete Panzerungen, gutes Training und angemessene Einsatzzeiten. Obama äußerte sich auch zur – im grenznahen Arizona umstrittenen – Einwanderungspolitik. Er legte ein klares Bekenntnis zur Einbürgerung illegaler Einwanderer ab, von denen viele in den USA Wurzeln geschlagen und ihre Kinder als Amerikaner aufgezogen hätten. Nicht immer glückte Obama das zielgruppenspezifische Feinjustieren der Botschaft. Im von Arbeitsplatzverlusten geplagten „Rust Belt“ der USA verurteilte Obama die Konkurrenz durch Billiglöhne in den Staaten des NAFTA-Agreements und Asiens. Er ging damit auf Konfrontationskurs zu Hillary Clinton, die das Abkommen und die darauffolgende Intensivierung des grenzüberschreitenden Handels in den Staaten Nordamerikas als Erfolg der Wirtschaftspolitik der Clinton-Administration für sich in Anspruch nahm. Obama setzte dagegen auf die Angst der Arbeiter in der verarbeitenden Industrie in Staaten wie Ohio, Illinois und Michigan – Stammland der Gewerkschaften und mit vielen Elektorenstimmen ausgestattet. Die Debatte kochte dabei so hoch, dass Obama sich offenbar veranlasst sah, der Regierung Kanadas zu versichern, es stünde kein Politikwechsel zu befürchten. Ein Kanadischer Fernsehsender berichtete über das Treffen des Obama-Beraters Austaan Golsbee mit Konsularbeamten in Chicago. Wenig später tauchte ein Vermerk des zuvor seitens der Obama6 7 8 Obama for America: What if?, www.youtube.com/watch?v=TaU3fjVAFbE, Stand: 25.2.2009. Barack Obama auf seiner Siegesfeier in Des Miones, Iowa, http://www.youtube.com/watch?v=cNZaq-YKCnE, Stand: 25.2.2009. Barack Obama bei einer Wahlkampfveranstaltung in Phoenix, Arizona, http:// www.youtube.com/watch?v=WGK838HRCxc, Stand: 25.2.2009. Leader of a New America 103 Kampagne dementierten Gesprächs auf.9 Darin beruhigte der Berater, die Anti-Handels-Rhetorik solle „im Kontext“ und eher als politische Position denn als Ankündigung künftiger Entscheidungen gesehen werden. Trotz solcher Pannen setzte sich Barack Obama am Ende gegen Hillary Clinton durch. Er schlug die lange als natürliche Kandidatin der Demokraten geltende ehemalige First Lady aus dem Rennen, obwohl diese vor allem auf wirtschaftspolitischem Gebiet als erfahren galt und auf Millionen Arbeitsplätze verwies, die in der Amtszeit ihres Mannes geschaffen worden waren. Den Vorwurf, er sei zu jung und unerfahren, konterte Obama wieder und wieder mit dem Argument, er habe im Gegensatz zu fast allen anderen Kandidaten das Fiasko im Irak vorhergesehen. Auch sein staatsmännisch-entschlossenes Auftreten beeindruckte Journalisten, Multiplikatoren und Wähler. Durch alle Auftritte und Äußerungen des Kandidaten im Vorwahlkampf zog sich ein missionarischer Eifer, sein Land zu verändern – im Inneren wie im Verhältnis nach außen. Als Obama am 3. Juni 2008 uneinholbar vor Hillary Clinton lag und sich der Nominierung sicher war, beschrieb er seine Vision eines „Neuen Amerika“ in eindringlichen, für europäische Ohren messianisch anmutenden Worten: „America, this is our moment ... I am absolutely certain that, generations from now, we will be able to look back and tell our children that this was the moment when we began to provide care for the sick and good jobs to the jobless ... this was the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal ... this was the moment when we ended a war, and secured our nation, and restored our image as the last, best hope on Earth. This was the moment, this was the time when we came together to remake this great nation ...“10 5. Barack Obama gegen John McCain Mit der Nominierung Obamas durch die Democratic National Convention in Denver am 27. August 2008 standen sich nunmehr zwei außergewöhnliche Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten gegenüber: Auf Seiten der Demokraten ein junger, farbiger US-Senator mit unüberhörbarem Sendungsbewusstsein; auf republikanischer Seite der ehemalige Kriegsheld und als langjähriger Senator außen- und sicherheitspolitisch versierte John McCain. Der Kontrast zwischen diesen Persönlichkeiten hätte kaum größer ausfallen können. Ihre Positionen unterschieden sich ebenfalls deutlich, auch in der 9 10 Helman, Scot/Milligan, Susan: Obama faces heat over aide‘s NAFTA remarks to Canadians, in: The Boston Globe, 4.3.2008. Barack Obama auf seiner Siegesfeier in St. Paul, Minnesota, http://www.foxnews.com/politics/elections/2008/06/03/transcript-obama-democratic-nomination-victory-speech/, Stand: 10.2.2009. 104 Johannes Urban Außen- und Sicherheitspolitik sowie den unmittelbar mit ihr verknüpften Feldern der internationalen Umwelt-, Wirtschafts- und Finanzpolitik.11 Dabei gab zunächst McCain die Agenda vor, der bei seinen Auftritten – zum Leidwesen seiner Berater – anfangs fast ausschließlich über die Außen- und Sicherheitspolitik sprach. Er trat vehement für eine muskulöse Politik amerikanischer Stärke ein. Er wolle eine intensive Einbindung der Bündnispartner Amerikas im Sinne des „Burden Sharings“, nicht aber um jeden Preis. Ein Abzug aus dem Irak unter negativen Vorzeichen kam für McCain nicht in Frage. Der Krieg sei ein entscheidender Schauplatz in der Auseinandersetzung mit den „gewalttätigen islamistischen Extremisten“. Als Ideengeber für den „Surge“ – die Aufstockung um 20.000 Soldaten im Frühjahr 2007 –, sah McCain sich darin bestätigt, dass die USA mit einer Kombination aus militärischer Stärke und besserer Zusammenarbeit mit den Stämmen im Irak gewinnen könnten. Auch Obama bezeichnete in der Auseinandersetzung mit McCain den Kampf gegen islamistische Terroristen als wichtigste Herausforderung. Für ihn war der Krieg im Irak jedoch eine Ablenkung vom Hauptschauplatz: Afghanistan und Pakistan. Obama forderte, jede Verlängerung des Engagements im Irak mit einem Zeitplan für den Abzug zu verknüpfen. Ziel müsse eine rasche „Irakisierung“ des Konflikts und eine Umschichtung von Ressourcen in die Grenzregion von Afghanistan und Pakistan sein. Dabei erwarte er von den Verbündeten in Europa deutlich mehr Unterstützung. Ein fundamentaler Unterschied offenbarte sich in der Frage des richtigen Umgangs mit dem Iran: Obama sprach sich für Gespräche mit den Führern solcher Staaten aus, die von der Bush-Administration als „Schurkenstaaten“ bezeichnet worden waren – und zwar ohne Vorbedingungen. McCain lehnte das entschieden ab. Einig waren sich beide Kandidaten dagegen darin, dass sie Ansehen und Handlungsfähigkeit der USA durch eine Wiederbelebung der zentralen Bündnisse in Europa und Asien wiederherstellen wollten. Beide formulierten deutliche Erwartungen gegenüber Europa, wobei McCain sich öffentlich zurückhaltender zeigte als Obama. Der kündigte an, mit einer Art „GoodwillTour“ um den Globus massiv um Unterstützung und bessere Beziehungen zu werben. Sein fulminanter Auftritt vor der Siegessäule und die Gespräche in Berlin, Paris und London wurden bestimmt nicht ohne Hintergedanken als Auftakt dieser ersten außenpolitischen Initiative inszeniert. 11 Die Analyse fokussiert im Folgenden auf die offiziellen Wahlprogramme beider Kandidaten. McCain stellte sein Programm in Form persönlicher Stellungnahmen („John McCain believes …“) vor; Obama dagegen warb mit einem umfassenden Regierungsprogramm („Blueprint for Change“), das als PDFDokument zum Download bereitgestellt ist, www.barackobama.com/pdf/ObamaBlueprintForChange.pdf, Stand: 14.2.2009. Leader of a New America 105 Nur vordergründig einig zeigten sich die Kandidaten in der internationalen Energie- und Umweltpolitik. Beide betonten, die westlichen Staaten bräuchten eine neue, gemeinsame Energiepolitik. McCain und Obama setzten sich für die Unabhängigkeit der USA von Rohölimporten aus dem Nahen Osten und Venezuela ein. Der Weg zum Ziel wurde indes höchst unterschiedlich skizziert. McCain sprach sich dafür aus, bei sämtlichen Energieträgern die heimische Produktion zu fördern. Er unterstützte die Entwicklung alternativer Energien und Treibstoffe, setzte aber vor allem auf die Aufhebung von Beschränkungen der Ölförderung in Naturschutzgebieten sowie den Bau von 45 neuen Atomkraftwerken bis 2030. Obama und die Demokraten im US-Kongress wollten hingegen 150 Milliarden Dollar in private Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien investieren und so fünf Millionen Arbeitsplätze schaffen. 2010 sollten zehn Prozent des Energiebedarfs der USA durch „Renewables“ gedeckt werden, 2025 bereits 25 Prozent – so der Plan Obamas. Sein Konzept sah außerdem steuerliche Anreize für den Kauf von Elektroautos sowie eine Energie-Effizienz-Initiative vor, die durch Wärmedämmung von Gebäuden und die Einführung des Emmissionshandels zugleich helfen sollte, ehrgeizige Klimaschutzziele zu erreichen. 80 Prozent Reduktion bis 2050 – so die Vorgabe der Obama-Kampagne, die allerdings kein Referenzjahr angab. McCain dagegen wollte eine Reduktion um 66 Prozent bis 2050, unterlegt mit Zwischenzielen, die sich auf verschiedene Referenzjahre bezogen. Einigkeit bestand beim internationalen Emissionshandel. Beide Kandidaten sahen darin ein taugliches Mittel, um – erleichtert durch Kredite und Steuervergünstigungen –, Investitionen zu stimulieren. Mit die größten Unterschiede – neben der Frage des Krisenmanagements im Irak und Iran – zeigten sich in der internationalen Wirtschafts- und Finanzpolitik. McCain hatte hierzu anfangs gar keine Position. Er schien sich der Dimension der heraufziehenden Krise nicht bewusst. So erklärte er noch Mitte September 2008, die Grundlagen der US-Wirtschaft seien stark und gesund. Als kurz darauf das internationale Finanzsystem zu kollabieren drohte, erklärte er seine Aussagen damit, sie seien auf die Produktivität und Kreativität der amerikanischen Arbeiter bezogen gewesen. Und als die Verabschiedung des 700-Milliarden Dollar Rettungspakets an republikanischen Repräsentanten zu scheitern drohte, gelang es McCain nicht, eine Einigung zu vermitteln. Anschließend prangerte McCain umso drastischer die „Gier und Korruption der Banker“ an, forderte eine weitere Leitzinssenkung, Steuererleichterungen für Benzin- und Nahrungsmittelkäufe, eine Reduzierung des Haushaltsdefizits durch Kürzungen bei Sozial- und Gesundheitsprogrammen, Maßnahmen zur Stützung des Dollar-Kurses sowie direkte und indirekte Hilfen für Kleinunternehmen. Zugleich bekannte sich McCain unmissverständlich zum Freihandel und zur Globalisierung. Sein nach einigen abfälligen Äußerungen über 106 Johannes Urban pleitegegangene Häuslebauer vorgestellter „American Homeownership Resurgence Plan“ sah Finanzhilfen für Hausbesitzer vor, die 200.000 bis 400.000 Familien vor dem Verlust ihres Hauses bewahren sollten. Durch Stabilisierung der Immobilienpreise und Garantien für Hausbesitzer müsse die Krise an der Wurzel gepackt werden, so McCain. Auch Obama stieß ins Horn der Manager-Kritik, schloss dabei aber die politischen Verantwortlichen ausdrücklich mit ein: „Gier und Verantwortungslosigkeit in Washington und der Wall Street“ seien für die Krise verantwortlich. Zu den Schuldigen zählten gleichermaßen Lobbyisten und die Bush-Administration wegen eines Übermaßes an Deregulierung. Wie McCain forderte er Hilfen nicht nur für Banken, sondern auch in Not geratene Hausbesitzer. Der größte Unterschied zeigte sich bei den Ansichten, welche Konsequenzen für die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Finanzmarkts gezogen werden sollten. McCain hielt primär individuelles Fehlverhalten für die Ursache der Immobilienblase. Obama sah systemische Fehlanreize am Werk. Um die Ursachen der Finanzkrise zu bekämpfen, kündigte Obama deshalb eine strengere Regulierung von Finanzdienstleistungen an. Die Vorschläge zielten unter anderem auf die Kreditkartenindustrie. Und auch in der Handelspolitik deutete Obama – nun aber vorsichtiger als während des Vorwahlkampfs – eine härtere Gangart zum Schutz heimischer Arbeitnehmer vor Billigkonkurrenz an. Nicht nur in der Sache, auch im politischen Stil offenbarten beide Kandidaten erhebliche Unterschiede. Obama präsentierte sich entschlossen, aber konsensorientiert, als offen für unterschiedliche Argumente und Perspektiven. McCain pflegte den Ruf des „Maverick“, des nicht zu bändigenden und nicht zu unterschätzenden Machers. Selbst in der Abgrenzung zum unbeliebten Amtsinhaber George W. Bush entwickelte er dadurch Ähnlichkeiten zu dessen Führungsstil. Wieder und wieder wiederholte McCain den Slogan, er sehe in Vladimir Putins’ Augen nicht die gute Seele eines verlässlichen Partners, sondern nur drei Buchstaben: K.G.B. Im Ossetien-Krieg bezog McCain umgehend Position zugunsten Georgiens und drohte Russland mit Konsequenzen. Obama äußerte sich nuancierter, forderte ein rasches Ende der Kampfhandlungen und eine rasche Wiederherstellung der georgischen Souveränität. Besonders deutlich wurden diese Unterschiede in den drei TV-Duellen. Doch so sehr John McCain auch die Bereitschaft Obamas, das Land in so schweren Zeiten zu führen, in Frage stellte: Am Ende gewann Barack Obama den Wettkampf um die Präsidentschaft. Noch in der Siegesnacht kündigte er an, seine Pläne für eine umfassende Reform der Vereinigten Staaten zu verwirklichen und bat alle Amerikaner, dabei mitzuhelfen. In seiner Inaugurationsrede am 20. Januar 2009 wandte sich Obama mit seinem Anliegen an die ganze Welt: Leader of a New America 107 „And so, to all other peoples and governments who are watching today, from the grandest capitals to the small village where my father was born: know that America is a friend of each nation and every man, woman and child who seeks a future of peace and dignity, and we are ready to lead once more.“12 6. Schlussfolgerungen für die Außenpolitik der Vereinigten Staaten Welche Schlüsse können nun aus Obamas Rhetorik und der Genese seiner außen- und sicherheitspolitischen Überzeugungen gezogen werden? Umfang und Frequenz seiner Äußerungen zur Notwendigkeit einer Erneuerung der Vereinigten Staaten und ihrer Rolle in der Welt lassen nur eine Einordnung in die Schublade des idealistischen Internationalisten zu. Trotz aller Abgrenzung von Hillary Clinton in der Irak-Politik spricht vieles für eine Rückbesinnung auf die Außenpolitik der Clinton-Administration. Dies gilt insbesondere für das Bemühen um funktionierende Bündnissysteme in Asien und Europa. Hier ist – trotz Beharrungskräfte im State Department und dem US-Kongress – eine deutlich kooperativere Gangart als in den Bush-Jahren zu erwarten. Obamas persönliche Überzeugungen und die von ihm vorgefundenen Rahmenbedingungen legen jedoch auch inhaltliche Neuerungen nahe: Während Bill Clinton und seine Administration konsequent auf eine Ausweitung des internationalen Handels und eine Beschleunigung der Globalisierung setzten, nahm Obama in seiner Kampagne eine deutlich kritischere Position zum Freihandel ein. Die Clinton-Administration trieb die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte voran; Obama dürfte – wenn er sich gegen die „Clintonistas“ in seinem Team durchzusetzen vermag – das Gegenteil versuchen, wenn auch in einer Weise, die der Vormachtstellung angloamerikanischer Finanzinstitute keinen Abbruch tut. Clinton ließ dem Militär – trotz einiger Budget-Kürzungen – nach diversen Kontroversen relativ freie Hand; von Obama (der wie Clinton einen Republikaner als Verteidigungsminister nominierte) ist ein deutliches Umsteuern in der Sicherheits- und Rüstungspolitik zu erwarteten. Obama wird vehement auf eine Modernisierung nicht nur des strategischen Denkens, sondern auch von Strukturen und Beschaffungsverfahren dringen. Bill Clinton ging, auch wegen Vorwürfen, er würde damit von seinen Affären ablenken wollen, letztlich nicht konsequent mit Militärschlägen 12 Vgl. Transcript of Barack Obama’s Inaugural Address, in: New York Times Online, 20.1.2009, http://www.nytimes.com/2009/01/20/us/politics/20textobama.html?_r=1&pagewanted=print, Stand: 25.2.2009. 108 Johannes Urban gegen islamistische Terroristen in Afghanistan vor. Obama dagegen kündigte an, die militärischen und zivilen Bemühungen in Afghanistan zu verstärken, um Al-Qaida in die Knie zu zwingen. Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der internationalen Umweltpolitik. Bill Clinton verweigerte letztlich die Unterschrift unter das KyotoProtokoll. Obama scheint tatsächlich von der Notwendigkeit überzeugt, mehr gegen die Erderwärmung zu tun. Es war eine der Überraschungen des Präsidentschaftswahlkampfs 2008, dass Republikaner wie Demokraten für ökologische Reformen und Technologien warben. Auch wenn die aktuelle Wirtschaftskrise allzu große Zugeständnisse verhindern dürfte: es tut sich was. 7. Reality check – die ersten Entscheidungen im Amt Halten diese Schlussfolgerungen dem Vergleich mit der Realität erster Entscheidungen stand? Die Berufung vieler „Clintonistas“ auf Top-Positionen in der Außen- und Sicherheitspolitik spricht deutlich für die erwartete internationalistische Grundströmung. Dass dabei einige der eher idealistischen Berater Obamas aus der Wissenschaft auf der Strecke blieben, legt jedoch eine deutlich gemäßigtere idealistische Ausrichtung des Regierungshandelns nahe, als sie der Kandidat Obama angekündigt hat.13 Ein gemischtes Bild offenbaren auch die ersten inhaltlichen Entscheidungen. Schon am ersten Tag seiner Amtszeit kündigte Obama die Schließung des Gefangenenlagers in Guantanamo an. Damit setzte Obama ein Wahlversprechen um. Mit der gewählten Frist von einem Jahr trug er zugleich Sicherheitsbedenken der Geheimdienste sowie rechtlichen, diplomatischen und praktischen Schwierigkeiten Rechnung. Pragmatisch zeigte sich Obama auch in der Irak-Frage. Sein Versprechen eines raschen Abzugs der Truppen hielt er prinzipiell ein, indem er nur einen Monat nach Amtsantritt einen Abzugsplan vorlegte – und das auf der Militärbasis, auf der George W. Bush verkündet hatte, nur nach einem absoluten Sieg abziehen zu wollen. Der Abzug soll Obamas Plan nach aber in Stufen und wesentlich langsamer erfolgen als ursprünglich angekündigt, nämlich bis 2011.14 Das entspricht im Wesentlichen den Vorstellungen der alten Administration, die Obama freilich während seines Wahlkampfs vor sich hergetrieben hatte, bis sie sich zu dieser Absichtserklärung durchgerungen hatte. Pragmatisch zeigte sich Obama schließlich auch in der Han13 14 Viele ehemalige Berater zeigen sich schon jetzt enttäuscht, vgl. Foreign Policy Magazine: „The Obama Orphans“, http://thecable.foreignpolicy.com/ posts/2009/01/12/the_obama_orphans, Stand: 1.3.2009. Vgl. Baker, Peter: With Pledges to Troops and Iraqis, Obama Details Pullout, in: New York Times, 28.2.2009. Leader of a New America 109 delspolitik. Auf Druck der G8-Partner votierte Obama gegen eine „Buy American“-Klausel im Konjunkturpaket des US-Repräsentantenhauses. Was die Regulierung der Finanzmärkte angeht, kündigte Obama getreu seiner im Wahlkampf geäußerten Überzeugungen deutliche Verschärfungen an, die jedoch später von Beamten der Administration zumindest teilweise wieder in Frage gestellt wurden. Diese Ambivalenz setzte sich im Auftreten der US-Delegation auf dem G20-Gipfel in London Anfang April fort. Auch die Außen- und Sicherheitspolitik der Obama-Administration scheint um einen Ausgleich von nationalen und partikularen Interessen, internationalen Erwartungen mit persönlichen Überzeugungen bemüht. Wer erwartet hat, Obama werde relativ schnell zur Tagesordnung übergehen und Wahlaussagen Schnee von gestern sein lassen, hat sich getäuscht. Obama ist offenbar durchaus von persönlichen Überzeugungen geprägt und – das legen seine ersten Entscheidungen nahe – versucht diese auch im Rahmen des Möglichen in die Praxis umzusetzen. Obama versteht sich tatsächlich als Führer eines neuen Amerika und will seine Chance nutzen. Mit seiner Grußbotschaft an das Iranische Volk und dem zu Hause stark kritisierten „Hand Shake“ mit dem venezolanischen Potentanten Chavez hat Obama deutliche Zeichen gesetzt. Welchen Nutzen solche Signale für die außen- und sicherheitspolitischen Positionen der USA bringen, ist bis dato jedoch noch nicht abzusehen. Unabhängig von Erfolg oder Misserfolg von Obamas neuer Außenpolitik bestätigt sich: Selbst im Kontext komplexester Rahmenbedingungen und schrumpfender Handlungsspielräume hängt der Kurs, den Staaten und Gesellschaften einschlagen, maßgeblich von den sie anführenden Persönlichkeiten ab. Außenpolitik ist nicht determiniert, auch nicht in einer globalisierten Welt. Oder wie es Daniel Byman und Kenneth Pollack im Frühling des Jahres 2001 in einem bemerkenswerten Aufsatz formulierten: „Giants still walk the earth“15. Welche Statur Barack Obama am Ende dieser Präsidentschaft einnehmen wird, bleibt freilich abzuwarten. 15 Byman, Daniel L./Pollack, Kenneth: Let Us Now Praise Great Men. Bringing the Statesman Back In, in: International Security 1/2001, S.107-146, hier S.145. Hegemonialstrategie: Zur Kontinuität amerikanischer Außenpolitik seit Ende des Kalten Krieges Patrick Keller 1. Einleitung Nicht nur in Amerika, sondern weltweit verbinden sich mit der Präsidentschaft Obamas große Hoffnungen auf einen Politikwechsel.1 Die Schlüsselbegriffe des Wahlkampfs, Hope und Change, mögen als unbestimmte Phrasen belächelt worden sein, aber sie haben einen Nerv getroffen, indem sie eine grundsätzliche Abkehr von der Politik des zuletzt wenig geachteten Präsidenten George W. Bush suggerierten. Gerade in Fragen der Außenpolitik ist die Erwartungshaltung der Anhänger Obamas recht eindeutig definiert: Er soll Amerika aus der Rolle des einsamen, gewalttätigen Riesen befreien, sein Ansehen in der Welt wiederherstellen. Dazu soll er die Kriege im Irak und in Afghanistan beenden, das Gefangenenlager auf Guantánamo schließen und amerikanisches Entgegenkommen bei der Suche nach einer internationalen Lösung zur Bekämpfung des globalen Klimawandels beweisen. Im Kern geht es darum, von einer Politik des Unilateralismus zu einer Politik des Multilateralismus zurückzukehren – Amerika soll sich wieder stärker auf seine soft power besinnen, der Diplomatie und der internationalen Zusammenarbeit den Vorzug vor der militärischen hard power geben.2 Wie alle außenpolitischen Erwartungen und Empfehlungen basieren auch diese auf einer bestimmten Wahrnehmung der internationalen Lage. Jeder Staatsmann braucht ein Bild von der Welt, um in der Welt handeln zu können. Der gegenwärtige Konsens, zumindest im liberalen Lager Obamas, zeichnet ein Bild von einer sich verändernden Welt, die durch den Machtverlust der USA und den Machtgewinn Chinas und anderer Akteure (z.B. Brasilien, Russland und Indien, manchmal wird auch Europa genannt) charakterisiert wird. Auf eine in den politischen Feuilletons 1 2 Keller, Patrick: Hegemonie ist eine Strategie, in: Außenpolitik und Staatsräson. Festschrift für Christian Hacke zum 65.Geburtstag, hrsg. von Volker Kronenberg, Jana Puglierin und Patrick Keller, Baden-Baden 2008, S.204-211. Zur Begrifflichkeit siehe Nye, Joseph S. Jr.: Soft Power. The Means of Success in World Politics, New York 2004. Hegemonialstrategie: Zur Kontinuität amerikanischer Außenpolitik 111 derzeit sehr beliebte Formel gebracht: Die unipolare Weltordnung, so es sie denn je gegeben hat, weicht einem multipolaren System. Geschwächt durch die Fehler der Bush-Regierung und die Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise verlieren die Vereinigten Staaten die Option hegemonialer Politik. Die Rückkehr eines Konzerts der Mächte – der historischen default position – bedeutet das Ende der amerikanischen Sonderrolle. Die USA schrumpfen wieder zu einem „normal country in a normal time“3, wie Jeane Kirkpatrick kurz nach Ende des Kalten Krieges schrieb. Es gibt jedoch guten Grund, daran zu zweifeln, dass der relative Verlust amerikanischer Macht so rasant stattfinden wird, wie es Propheten des Abstiegs wie Fareed Zakaria und Parag Khanna weissagen.4 Denn schon Paul Kennedy und David Calleo unterschätzten nicht nur die Erneuerungskraft Amerikas, seine strukturellen Vorteile auf allen machtpolitisch relevanten Gebieten, sondern auch die Instabilität der potenziellen Herausforderer.5 Und selbst wenn man von einem – sehr langfristigen und relativen – Machtverlust der USA ausgeht, sagt dies noch nichts darüber aus, wie diese Entwicklung am besten zu verzögern bzw. politisch zu gestalten ist. Eben weil all diese Zukunftsfragen mit solch großer Ungewissheit behaftet sind, kommt der Interpretation der jüngeren Vergangenheit amerikanischer Außenpolitik so große Bedeutung zu. Wer die Deutungshoheit über die amerikanische Rolle in der Welt seit 1989/90 erlangt, wird Gegenwart und Zukunft der amerikanischen Außenpolitik maßgeblich gestalten können. Typisch für diese mit politischen Absichten verfassten Analysen ist ein „Drei-Varianten-Modell“: Die außenpolitischen Konzeptionen der drei Präsidenten Bush Senior, Clinton und Bush Junior werden als grundlegend verschieden einander gegenübergestellt. Bush Sr. verkörpert dabei die Denkschule des Realismus, Clinton den liberalen Internationalismus und Bush Jr. den Neokonservatismus. Die Bewertung erfolgt dann gemäß 3 4 5 Kirkpatrick, Jeane: A Normal Country in a Normal Time, in: National Interest 21/1990, S.40-44. Vgl. Zakaria, Fareed: The Post-American World, New York 2008; Khanna, Parag: The Second World. Empires and Influence in the New Global Order, New York 2008. Vgl. Kennedy, Paul: The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, New York 1987; Calleo, David P.: Beyond American Hegemony. The Future of the Western Alliance, New York 1987; für eine kluge Widerlegung der Thesen vom US-Niedergang vgl. Lieber, Robert J.: The American Era. Power and Strategy for the 21st Century, New York 2005; Kreft, Heinrich: Die USA im Abstieg?, in: Die Politische Meinung 470/2009, S.23-27. 112 Patrick Keller der persönlichen Zugehörigkeit zu diesen Schulen – Zbigniew Brzezinski sieht einen dramatischen Verfall außenpolitischer Kompetenz, für Charles Krauthammer verhält es sich genau umgekehrt.6 Im Einzelnen ist eine solche Unterscheidung der Präsidenten berechtigt und nützlich, aber sie verstellt den Blick auf die überzeitlichen Kontinuitätslinien amerikanischer Politik, die auch nach dem Kalten Krieg bestehen blieben und die letztlich von größerer Erklärungskraft für vergangene Leistungen und Fehler sowie für die zukünftige Gestaltung amerikanischer Außenpolitik sind. Die wichtigste Kontinuitätslinie besteht darin, dass alle drei Präsidenten zuvörderst bestrebt waren, die globale Übermacht der USA zu festigen und auszubauen. Um die Tragweite dieser Tatsache zu erfassen, gilt es zunächst, das Konzept der unipolaren Weltordnung zu diskutieren, das der amerikanischen Außenpolitik seit Ende des Kalten Krieges zugrunde liegt. In einem zweiten Schritt lässt sich dann an Hand ihrer jeweiligen außenpolitischen Leitideen zeigen, dass die Regierungen Bush, Clinton und Bush sich in den Zielen, aber auch in den Mitteln ihrer Außenpolitik viel ähnlicher waren, als gemeinhin zugestanden wird. Auf der Basis dieser Analyse lässt sich dann in einem dritten Schritt überlegen, inwieweit sich die Regierung Obama von dieser Kontinuitätslinie fortbewegen will und kann. 2. Eine unipolare Welt? Als der Publizist Charles Krauthammer 1990 den „Unipolar Moment“7 ausrief, verkündete er zunächst nur das Offensichtliche: Nach der Implosion der Sowjetunion waren die USA die einzige Supermacht; aus dem bipolaren System des Kalten Krieges wurde ein unipolares. In den internationalen Beziehungen gibt es jedoch selten Fälle von simpler Mathematik, so dass seitdem ein Forschungs- und Meinungsstreit über die vermeintliche Unipolarität besteht. So befand Samuel Huntington, dass es sich nun um eine „uni-multipolar world“8 handele, in der die USA zwar die einzige Supermacht waren, aber in verschiedenen geographischen Regionen sowie bestimmten internationalen Problemkreisen auf die freiwillige Kooperation anderer großer Mächte angewiesen blieben. 6 7 8 Vgl. Brzezinski, Zbigniew: Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American Superpower, New York 2007; Krauthammer, Charles: The Neoconservative Convergence, in: Commentary 1/2005, S.16-19. Krauthammer, Charles: The Unipolar Moment, in: Foreign Affairs 1/1990-91, S.23-33. Vgl. Huntington, Samuel P.: The Lonely Superpower, in: Foreign Affairs 2/1999, S.35-49, bes. S.36; Huntington entwickelt diesen Gedanken zuerst in Ders.: America’s Changing Strategic Interests, in: Survival 1/1991, S.3-17. Hegemonialstrategie: Zur Kontinuität amerikanischer Außenpolitik 113 Viele Forscher haben dieses Modell übernommen und verfeinert.9 Das bekannteste Beispiel ist Joseph Nyes dreidimensionales Schachbrett,10, wonach auf der ersten Ebene, welche die Verteilung militärischer Macht widerspiegelt, das System unipolaren Charakter hat, so groß ist die Überlegenheit der USA. Auf der zweiten Ebene, welche die Verteilung ökonomischer Macht beschreibt, sind die USA zwar ebenfalls der stärkste Akteur, allerdings gibt es einige ernstzunehmende Konkurrenten (China, Europa, Japan), die eine multipolare Ordnung erzeugen. Die dritte Ebene umfasst die nichtstaatlichen Akteure und den Bereich der soft power: „On this board, power is widely dispersed and it makes no sense to speak of unipolarity, multipolarity, or hegemony.“11 Viele Beobachter schließen sich diesen Einschränkungen an oder gehen sogar noch darüber hinaus, weil ihre impliziten Kriterien für Unipolarität in letzter Konsequenz eine annähernd allmächtige Stellung der unipolaren Macht fordern – eine Voraussetzung, die auch die USA nicht erfüllen können.12 Versteht man Polarität aber als strukturbestimmendes Merkmal des internationalen Systems im Sinne des Begründers der neorealistischen Theorie, Kenneth Waltz, ist die Voraussetzung für einen „Pol“ anders zu definieren. Polare (Super-)Mächte sind solche, die im Vergleich zu den konkurrierenden Staaten im System in einer Vielzahl von Kriterien – wie Bevölkerungsstärke, Zugang zu Ressourcen, ökonomische, technologische und militärische Stärke, politische Stabilität – einen signifikanten Vorteil haben.13 So gesehen sind die USA tatsächlich in einer eigenen Liga: „Only the United States currently excels in military power and preparedness, economic and technological capacity, size of population and territory, resource endowment, political stability, and ‘soft power’ attributes such as ideology. All other would-be great powers are limited or lopsided in one critical way or another.“14 9 10 11 12 13 14 Vgl. z.B. Betts, Richard K.: Wealth, Power, and Instability. East Asia and the United States after the Cold War, in: International Security 3/1993, S.34-77; Joffe, Josef: Bismarck or Britain? Toward an American Grand Strategy after Bipolarity, in: International Security 4/1995, S.94-117. Vgl. Nye, Joseph S. Jr.: The Paradox of American Power. Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford 2002, S.39f. Ebd., S.39. Vgl. Brooks, Stephen G./Wohlforth, William C.: American Primacy in Perspective, in: Foreign Affairs 4/2002, S.20-33. Vgl. Waltz, Kenneth N.: The Emerging Structure of International Politics, in: International Security 2/1993, S.44-79, S.50; allerdings kann auch diese Definition eine gewisse Unschärfe nicht vermeiden, das Problem der Messbarkeit von Macht – und somit ihrer Vergleichbarkeit – bleibt bestehen. Mastanduno, Michael: Preserving the Unipolar Moment. Realist Theories and U.S. Grand Strategy After the Cold War, in: Unipolar Politics. Realism and State Strategies After the Cold War, hrsg. von Ethan B. Kapstein und Michael Mastanduno, New York 1999, S.138-181, bes. S.141. 114 Patrick Keller Freilich ist es tückisch, den Neorealismus zur Begründung der Unipolarität heranzuziehen, widerspricht diese Struktur des internationalen Systems doch den Grundannahmen der balance of power – dementsprechend diskutiert Waltz in seiner Theoriebildung auch nur Bi- und Multipolarität.15 Die Annahme der meisten Neorealisten, dass die Unipolarität nur von kurzer Dauer sein kann, verstärkt den Dissens unter den politisch Verantwortlichen, wie diese Zeitspanne verlängert werden könne. Denn Unipolarität bedeutet – wenn vielleicht auch nicht Hegemonie16 – so doch zumindest strukturelle macht- und sicherheitspolitische Vorteile für die USA, die es zu wahren gilt. Ob dies nun besser durch Einbindung in multilaterale Zusammenhänge oder durch eine selbstbewusst-unilaterale Interpretation von Führungsstärke gelingt und ob es eine Rolle spielt, wie wohlwollend und gemeinnützig diese Führungsrolle wahrgenommen wird, sind keine Fragen der strategischen Zielsetzung, sondern der politischen Taktik. Sie kommt besonders plakativ in den außenpolitischen Doktrinen der Präsidenten zum Ausdruck. 3. Die Bush-Senior-Doktrin George H.W. Bush war denkbar ungeeignet, um eine „Neue Weltordnung“ konzeptionell zu entwickeln und kraftvoll zu begründen. UN-Botschafter unter Nixon, oberster Verbindungsmann nach China und CIA-Direktor unter Ford sowie acht Jahre Dienst als Vizepräsident unter Reagan: Bush absolvierte die idealtypische Kalter-Krieg-Karriere. Seine diplomatische Umsicht beförderte die Abwicklung des Ostblocks und die deutsche Wiedervereinigung ebenso, wie sie es den USA ermöglichte, an der Spitze einer breiten internationalen Koalition Saddam Hussein in die Schranken zu verweisen. Aber Bushs aus diesen Ereignissen abgeleiteter Entwurf einer „Neuen Weltordnung“ war eben kein „vision thing“17, sondern blieb inhaltsleer. „Out of these troubled times“, sagte Bush mit Blick auf den sich abzeichnenden Irakkrieg, „a new world order can emerge: a new era – freer from the threat of terror, stronger in the pursuit of justice, and more secure in the quest for peace. ... Today that new world is struggling to be born, a world quite different from the one we’ve known. A world where the 15 16 17 Zu einer hervorragenden deutschsprachigen Einführung in den Neorealismus siehe Masala, Carlo: Kenneth N. Waltz. Einführung in seine Theorie und Auseinandersetzung mit seinen Kritikern, Baden-Baden 2005. Zur Frage der Hegemonie (und – im Unterschied etwa zur primacy – der Bedingung der Akzeptanz) siehe Triepel, Heinrich: Die Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten, Stuttgart 1938. George H. W. Bush zitiert in: Safire, William: Bush the Underdog, in: New York Times, 19.5.1988. Hegemonialstrategie: Zur Kontinuität amerikanischer Außenpolitik 115 rule of law supplants the rule of the jungle.“18 Und warum bricht nun die friedvolle Zeit der Herrschaft des Völkerrechts an? Weil die zerfallende Sowjetunion in der Irak-Frage im Rahmen der UN mit den USA kooperierte: „Clearly, no longer can a dictator count on East-West confrontation to stymie concerted United Nations action against aggression. A new partnership of nations has begun.“19 Es war das erste Mal, dass USA und Sowjetunion gemeinsam für eine den Kampfeinsatz legitimierende UN-Resolution stimmten. Dass aus diesem speziellen Fall jedoch keine neue Weltordnung abgeleitet werden konnte, sollte die Zukunft zeigen. Trotzdem wäre es verfehlt, Bushs wenig konkreten Entwurf als legalistischmoralische Träumerei abzutun. Denn Bush strebt keineswegs eine Neuordnung der Welt an, sondern zementiert in seiner Doktrin den Status quo: Die USA sind die einzige Weltordnungsmacht, ihrem Willen muss sich auch die Sowjetunion unterordnen – wenn auch gesichtswahrend, im Forum der Vereinten Nationen, die aber wiederum von den USA dominiert werden. Entscheidend ist, dass sich Bush multilateraler Politik bedient, dabei aber stets auf die Führungsrolle der USA pocht und eben nicht nach einer Weiterentwicklung der internationalen „rule of law“ verlangt, an deren Ende eine Unterwerfung der USA unter Mehrheitsentscheidungen der UN stehen würde. Bushs „Neue Weltordnung“ ist als rhetorische Camouflage amerikanischen Machtanspruchs zu verstehen, wie insbesondere die fast zeitgleich im Pentagon erarbeitete Defense Planning Guidance (DPG) zeigt.20 In diesem geheimen Strategiepapier entwickelte der Stellvertretende Verteidigungsminister Paul Wolfowitz Leitgedanken für die amerikanische Außenpolitik nach dem Kalten Krieg. Zentrale Bedeutung hatte das Ziel, den Zustand der Unipolarität zu erhalten; das Entstehen einer rivalisierenden Supermacht, ob in Europa, Asien oder anderswo, müsse verhindert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten die USA gegebenenfalls auch unilateral vorgehen oder sich auf ad-hoc-Koalitionen stützen. In den euphorischen Jahren unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges waren diese Überlegungen aber zu unpopulär, um öffentlich verteidigt zu werden – selbst Verteidigungsminister Cheney distanzierte sich von der DPG, obwohl er sie eigentlich unterstützte. Im Rückblick zeigt sich jedoch, dass 18 19 20 Bush, George H. W.: Address Before a Joint Session of Congress on the Persian Gulf Crisis and the Federal Budget Deficit, 11. September (!) 1990, http:// bushlibrary.tamu.edu/research/papers/1990/90091101.html Ebd. Vgl. Tyler, Patrick E.: U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop, in: New York Times, 8.3.1992; Ders.: Pentagon Drops Goal of Blocking New Superpowers, in: New York Times, 24.5.1992; zu einer gelungenen deutschsprachigen Analyse der DPG siehe Menzel, Ulrich: Paradoxien der neuen Weltordnung. Politische Essays, Frankfurt a.M. 2004, S.132-138. 116 Patrick Keller schon Anfang der 1990er-Jahre strategische Überlegungen das sicherheitspolitische Establishment prägten, die auf eine konfrontative Wahrung amerikanischer Hegemonie hinausliefen. 4. Die Clinton-Doktrin Auch Bill Clintons Präsidentschaft – die heutzutage gerade auf europäischer Seite gerne für ihren liberalen Internationalismus gerühmt wird – war von diesem Ziel geprägt, wie seine Nationale Sicherheitsstrategie zeigt. Sie entstand 1993 im Bemühen, dem sprunghaften, ereignisgetriebenen Charakter der Außenpolitik Clintons eine konzeptionelle Richtung zu geben, und fand ihren ersten und schlüssigsten Ausdruck in einer Rede des Nationalen Sicherheitsberaters Anthony Lake unter dem Titel „From Containment to Enlargement“21. Darin kommt Lake nach einer Analyse der weltpolitischen Situation nach Ende des Kalten Krieges zu dem Ergebnis, dass der logische Nachfolger einer Strategie der Eindämmung eine Strategie der Erweiterung sein müsse. Während im Kalten Krieg der Kommunismus eingedämmt wurde, gelte es nun, die marktwirtschaftliche Demokratie – die Zahl und den Einfluss der „free-market democracies“ (FMD)22 – auszuweiten. Das soll in vier eng miteinander verzahnten Schritten geschehen. Erstens soll die Gemeinschaft der bestehenden FMD gestärkt werden. Zweitens sollen die neu entstehenden FMD, beispielsweise in Mittel- und Osteuropa, in diese Gemeinschaft integriert werden – das ist das eigentliche Enlargement. Drittens sollen „backlash states“23 wie z.B. der Irak, die (noch) keine FMD sind und den Prozess der Ausbreitung von Marktwirtschaft und Demokratie zu untergraben versuchen, eingehegt und zugleich mit Anreizen zum systemischen Wandel umworben werden. Viertens nennt Lake eine „humanitarian agenda“24, wonach die USA moralisch verpflichtet seien, Hilfe bei humanitären Katastrophen zu leisten. Dies sei aber auch als langfristige Investition zu verstehen, um beispielsweise Entwicklungsländer auf dem Pfad zur marktwirtschaftlichen Demokratie voranzubringen. 21 22 23 24 Lake, Anthony: From Containment to Enlargement, in: U.S. Department of State Dispatch, 27.9.1993, S.658-664; Ders.: The White House, A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, Washington D.C. 1994; vgl. ferner Keller, Patrick: Von der Eindämmung zur Erweiterung. Bill Clinton und die Neuorientierung der amerikanischen Außenpolitik, Bonn 2008. Die „free-market democracies“ sind bei Lake ein feststehender Terminus; nie stehen Marktwirtschaft oder Demokratie für sich, sie sind stets untrennbar verbunden. Lake: From Containment to Enlargement, S.661. Ebd., S.660. Hegemonialstrategie: Zur Kontinuität amerikanischer Außenpolitik 117 Diese Überlegungen sind nicht so beliebig, wie Clinton oft vorgeworfen wurde,25 sondern geben durchaus klare Orientierung in konkreten Streitfragen, wie etwa Clintons Politik der NATO-Erweiterung oder seine Durchsetzung des nordamerikanischen Freihandelsabkommens NAFTA zeigen. Insgesamt offenbaren sie jedoch – im Einklang mit Clintons innenpolitischem Programm – eine stark wirtschaftliche Orientierung. So spottete selbst Clintons Außenminister, Warren Christopher, Enlargement sei „a trade policy masquerading as foreign policy“26. In der Tat gehen institutionelle Vernetzung und die Durchsetzung amerikanischer Interessen Hand in Hand. Besonders deutlich macht diese ökonomische Komponente die eng mit Enlargement verflochtene Strategie der Einflussnahme auf die großen entstehenden Märkte, die von Jeffrey Garten, dem Leiter des unter Clinton gegründeten National Economic Council, erdacht und implementiert wurde.27 Allein schon die Arbeit dieses „economic war room“28 zeigt, dass Clintons Außenpolitik wesentlich aggressiver war, als die idyllische Vision einer Welt der friedvollen „free-market democracies“ glauben macht. Vielmehr verfeinert Clinton Bushs Hegemonialanspruch, indem er ihn auf die liberalen Institutionen fokussiert und sich als „Champion der Globalisierung“29 positioniert. Clinton schloss eine nie zuvor erreichte Zahl von über 270 Handelsabkommen ab,30 darunter Vereinbarungen zum GATT, zur Gründung von WTO und NAFTA sowie zur Revitalisierung der APEC. Es war das Ziel dieser Politik der ökonomischen Erweiterung, die USA im Zentrum überlappender Institutionen zu etablieren und ihnen – so wie die Nabe die Speichen kontrolliert – die globale Führungsrolle als „steerer of the steerers“31 zu sichern. 25 26 27 28 29 30 31 Vgl. z.B. Safire, William: Bill’s Big Picture. The En-En Document Reveals Clinton’s, Ahem, Policy, in: Pittsburgh Post-Gazette, 26.8.1994. Christopher zitiert in McCormick, John M.: Clinton and Foreign Policy. Some Legacies for a New Century, in: The Postmodern Presidency. Bill Clinton’s Legacy in U.S. Politics, hrsg. von Steven E. Schier, Pittsburgh 2000, S.60-83, S.64. Vgl. Garten, Jeffrey E.: The Big Ten. The Big Emerging Markets and How They Will Change Our Lives, New York 1997. Ebd. Hacke, Christian: Der Terrorangriff vom 11. September und seine Folgen für die amerikanische Außenpolitik, in: Problemkreise der Angewandten Kulturwissenschaft. Konflikt, Trauma, Neubeginn, hrsg. von Caroline Y. Robertsonvon Trotha, Karlsruhe 2004, S.47-55, S.52. Vgl. Clinton, Bill: Remarks on United States Foreign Policy in San Francisco, 26.2.1999, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index. php?pid=57170&st=&st1= Bergsten, C. Fred: The Primacy of Economics, in: Foreign Policy 87/1992, S.324, S.20. 118 Patrick Keller 5. Die Bush-Junior-Doktrin George W. Bush beanspruchte diese Führungsrolle besonders unverstellt, indem er auf die Terrorangriffe vom 11. September 2001 mit einem Wandel von der Ökonomisierung zur Militarisierung amerikanischer Außenpolitik reagierte. Ungeachtet dieser Verschiebung in den Mitteln blieb das Ziel, die unipolare Rolle Amerikas zu erhalten, unverändert. Bushs Doktrin, in mehreren Reden und schließlich in der National Security Strategy 2002 formuliert, macht dies deutlich. So erklärt er, als Ergebnis des Kalten Krieges gebe es nunmehr nur noch „a single sustainable model for national success: freedom, democracy, and free enterprise“32, das auf universellen Freiheitsrechten basiere, die von den USA verkörpert und weltweit verteidigt würden: „The United States will use this moment of opportunity to extend the benefits of freedom across the globe. We will actively work to bring the hope of development, free markets, and free trade to every corner of the world. The events of September 11, 2001, taught us that weak states, like Afghanistan, can pose as great a danger to our national interests as strong states. Poverty does not make poor people into terrorists and murderers. Yet poverty, weak institutions, and corruption can make weak states vulnerable to terrorist networks and drug cartels within their borders.“33 Unverblümter lässt sich der expansive Charakter der Strategie nicht beschreiben – Verbreitung der Demokratie, um die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Der Nexus zwischen Terrornetzwerken, Massenvernichtungswaffen und failed sowie rogue states veränderte die amerikanische Bedrohungsperzeption nach dem 11. September und trug so dazu bei, dass die USA ihre Führungsrolle aggressiver wahrnahmen, etwa indem sie die Notwendigkeit präemptiver (eigentlich: präventiver) Kriegsführung erklärten. Denn der neuen Bedrohungen ließ sich nicht mit dem Mittel der Abschreckung Herr werden – mutual assured destruction bringt keinen Selbstmordattentäter ins Grübeln. Zugleich widerspricht Präemption aber der klassischen Interpretation des Völkerrechts – indem sich die USA nicht von der UN einbinden ließen, übten sie im vermeintlich präemptiven Krieg gegen den Irak ihre Vormachtstellung im internationalen System besonders unver- 32 33 The White House, The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf Ebd. Hegemonialstrategie: Zur Kontinuität amerikanischer Außenpolitik 119 hohlen aus.34 Paradoxerweise hat diese Ausübung ihrer Macht die USA allerdings geschwächt – nicht nur, weil die Lage im Irak und in Afghanistan sich als so problematisch herausgestellt hat, sondern auch, weil zunehmend andere Staaten die balancierende Distanz zur Supermacht suchen. Bestätigt sehen sich jene Realisten, die den unipolaren Moment nur durch machtpolitische Zurückhaltung für verlängerbar halten.35 6. Fazit: Hegemonie als Konsens Tritt man einen Schritt von diesen tagespolitischen Entwicklungen zurück, offenbart sich ein eindeutiges Bild. Alle Präsidenten in der Zeit nach dem Kalten Krieg haben versucht, die einzigartige Machtstellung der USA zu erhalten und sogar auszubauen. Bush Sr. legte dafür den Grundstein, indem er den Status quo zum Maß der Dinge erhob und in der Verbindung von amerikanischer Stärke und „pseudo-multilateralism“36 die sicherheitspolitische Richtschnur vorgab. Seine Nachfolger verließen diese Bahnen nicht, sondern setzten nur unterschiedliche Schwerpunkte: Clinton betonte die ökonomisch-institutionelle Dominanz der USA, Bush Jr. die militärische. Die außenpolitische Debatte in den USA lässt sich daher auf zwei Fragen reduzieren. Die eine lautet: Welche Taktik ist besonders erfolgreich darin, die amerikanische Hegemonie zu stärken? Über die Antwort streitet das Establishment, aber kaum jemand im politischen Zentrum spricht die zweite Frage an,37 die sich, einem verdrängten Gedanken gleich, über die erste wölbt: Dient der Kampf um die Erhaltung der Unipolarität den amerikanischen Interessen – oder ist er ein aussichtsloses Unterfangen, das mehr Kosten verursacht, als es Vorteile verspricht? Entgegen mancherlei überzogener Erwartung – beziehungsweise Befürchtung – befindet sich auch Obama hier fest im Mainstream der amerikanischen Außenpolitik, denn auch er zielt auf den Erhalt der amerikanischen Hegemonie ab. Innerhalb der linken „Graswurzel-Bewegung“, die Obama erst die Nominierung seiner Partei ermöglicht hat, sind daher viele enttäuscht über Obamas sehr zentristische Personalentscheidungen. Außenministerin Hillary Clinton ist stets als pragmatischer Falke aufgetreten, Sicherheitsberater Jim Jones war als SACEUR dafür bekannt, das Einstim34 35 36 37 Gaddis, John Lewis: Surprise, Security, and the American Experience, Cambridge 2004 zeigt überzeugend, dass Prämption/Prävention eine lange Tradition in der amerikanischen Militärstrategie hat, also keineswegs von einer „Bush Revolution“ (Ivo Daalder/James Lindsay) gesprochen werden kann. Vgl. Layne, Christopher: The Peace of Illusions. American Grand Strategy from 1940 to the Present, Ithaca 2006; Mearsheimer, John J.: The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001. Krauthammer: The Unipolar Moment, S.25. Vgl. Lind, Michael: Beyond American Hegemony, in: The National Interest, Mai/Juni 2007, S.9-15. 120 Patrick Keller migkeitsprinzip der NATO zu verdammen, und der Republikaner Robert Gates war schon unter George W. Bush Verteidigungsminister. Obamas Sicherheitspolitikern wird selbst von Richard Cheney bescheinigt, „a pretty good team“38 zu sein – nicht eben ein Zeichen für tiefgreifenden strategischen Wandel. Zumal Hillary Clinton in ihrem Bestätigungsverfahren vor dem Senat auch schon deutliche Pflöcke eingeschlagen hat: Die Diplomatie müsse wieder Vorrang vor militärischen Lösungen erhalten, aber Amerikas hard power bleibe unverzichtbar in einer Welt, die auf amerikanische Führungsstärke angewiesen sei.39 Clinton lässt damit ein Leitmotiv Madeleine Albrights anklingen, die Amerika die „unverzichtbare Nation“ genannt hat.40 In der Tat muss die auch in Europa oft unverhohlen geäußerte Schadenfreude über den amerikanischen Niedergang und die heraufziehende Multipolarität befremden. Denn bislang war der Westen – der Liberalismus, die Freie Welt – nur dann stark, wenn auch Amerika stark war. Können wir Europäer uns ernsthaft eine Welt wünschen, in der autokratische Regime wie China und Russland tatsächlich auf Augenhöhe mit Washington verhandeln und entsprechend ungehemmt ihre Einflusssphären abstecken? Wie lässt sich das mit unseren Werten vereinbaren? Wie mit unseren Interessen, etwa mit Blick auf den freien Welthandel oder die Sicherung des freien Zugangs zu strategischen Ressourcen? So mag sich zwar herausgestellt haben, dass die USA nicht alle Weltprobleme allein lösen können. Aber es steht auch fest, dass ohne die USA und eine funktionierende transatlantische Partnerschaft erst recht keine der drängenden Herausforderungen – vom internationalen Terrorismus bis zum Klimawandel – gemeistert werden kann. Daher sollten wir mit Obama zumindest diese eine Hoffnung wagen, dass Amerika auch in der Krise wieder einmal seine Befähigung zur Erneuerung zeigt und seine Rolle als Weltordnungsmacht kraftvoll annimmt. 38 39 40 Cheney zitiert in: Hayes, Stephen F.: Cheney. The Exit Interview, in: Weekly Standard, 19.1.2009. Vgl. Hillary Clinton’s Confirmation Hearing Statement, 13.1.2009, http:// www.cfr.org/publication/18214/hillary_clintons_confirmation_hearing_statement.html, Stand: 26.1.2009. Vgl. Nordlinger, Jay: Albright Then, Albright Now, in: National Review, 28.6.1999. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration Eine Bilanz im Zeichen des allianzinternen Sicherheitsdilemmas Martin Reichinger 1. Zum Stand des transatlantischen „burden sharing“ „America will do more, but America will ask for more from our partners.”1 In der ambivalenten Ankündigung des US-Vizepräsidenten spiegelten sich im Februar 2009 Elemente sowohl der Kontinuität als auch des Wandels amerikanischer Außenpolitik. Die neue US-Regierung unter Präsident Barack Obama stellte ihren europäischen Bündnispartnern einerseits den angemessenen Führungs- und Partnerschaftsstil als Anerkennung für bekundete Bündnisloyalitäten und erbrachte Bündnisleistungen in Aussicht, den jene während der achtjährigen Regierungszeit George W. Bushs vergeblich eingefordert hatten. Hinter dem Angebot aus Washington ließ sich folgerichtig das Interesse an einem neuen transatlantischen Übereinkommen vermuten,2 an einer Neuinterpretation des „intra-alliance bargain“3, bei dem sich das Engagement des Hegemons gleichwohl an der Gefolgschaftsbereitschaft der Partnerstaaten und an der Erfüllung USamerikanischer Forderungen orientieren würde. Andererseits stand die Ankündigung Bidens – zumal im 60. Jahr der Nordatlantischen Allianz – ganz bewusst in der Tradition der transatlantischen „burden sharing“Debatte, die politisch seit mehr als vierzig Jahren geführt wird4 und die vor dem Hintergrund der Frage eines europäischen Pfeilers in der NATO seit rund fünfzehn Jahren die politikwissenschaftliche Forschung zu 1 2 3 4 Biden, Joseph R.: Speech at the 45th Munich Security Conference, München, 7.2.2009, www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2009=& menu_konferenzen=&id=238&sprache=en&, Stand: 18.2.2009. Vgl. Frankenberger, Klaus-Dieter: Neuanfang über den Atlantik hinweg, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 9.2.2009, S.1. Vgl. Olson, Mancur/Zeckhauser, Richard: An Economic Theory of Alliances, in: Review of Economics and Statistics 3/1966, S.266-279. Vgl. Kennedy, John F.: Address at Independence Hall, Philadelphia, 4.7.1962, www.jfklibrary.org/Historical+Resources/Archives/Reference+Desk/Speeches/ JFK/003POF03IndependenceHall07041962.htm, Stand: 21.2.2009. 122 Martin Reichinger „NATO-framework“ und „EU-autonomy“ färbt.5 Die Praxis der neokonservativen Bush-Regierung, über den „Transmissionsriemen“6 der Allianz eine verstärkte militärische Lastenteilung innerhalb wie außerhalb der NATO – notfalls auch gegen den Widerstand der europäischen Bündnispartner – zu organisieren, hatte die Kernproblematik dieses transatlantischen „burden sharing“ über den europäischen Kontinent hinaus in den Mittleren Osten und bis nach Zentralasien verlagert. Im Folgenden wird gezeigt, dass die Natur des „intra-alliance bargain“ unter US-Präsident Bush Jr. dabei politischer denn je geworden ist, nicht nur mit Blick auf die neuen Risiken, Lasten und Kosten weltweiter Stabilitätsprojektion, sondern auch mit Blick auf die hohen wechselseitigen Abhängigkeiten der Bündnispartner angesichts der „unharmonisch“7 verlaufenden Globalisierung und der Erwartungsunsicherheiten in einer „Welt ohne Weltordnung“8, deren asymmetrische Gefahrenlagen9 durch den „war on terror“ der Bush-Regierung erheblich verschärft worden sind. Tragfähigkeit und Fortbestand der transatlantischen Partnerschaft scheinen während der Bush-Jahre immer stärker von der permanenten Austarierung von Tendenzen US-amerikanischer Kontrolle und EU-europäischer Eigenständigkeit abhängig geworden zu sein: Tendenzen, hinter denen letztlich die „Zwillingskräfte“10 von Hegemonie und Gleichgewicht wirken. Die von der US-Regierung vorangetriebene Transformation der NATO,11 die großen Erweiterungsrunden des Bündnisses 1999 und 2004, aber auch die institutionelle und kapazitative Weiterentwicklung der jungen Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) haben die Machtverhältnisse im Bündnis dabei so weit verändert, dass die Forderung nach einem globaleren, komplexeren und robusteren Aufgabenspek5 6 7 8 9 10 11 Vgl. Dembinski, Matthias: Die Beziehungen zwischen NATO und EU von „Berlin“ zu „Berlin plus“: Konzepte und Konfliktlinien, in: Die Beziehungen zwischen NATO und EU. Partnerschaft, Konkurrenz, Rivalität?, hrsg. von Johannes Varwick, Opladen 2005, S.61-80, hier S.61. Haftendorn, Helga: Das Atlantische Bündnis als Transmissionsriemen atlantischer Politik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 38-39/2005, S.8-15. Henry Kissinger auf der Konferenz „Transatlantic Relations. Challenges – Responsibilities: A Common Future“, ausgerichtet vom „Frankfurter Allgemeine Forum“, Berlin, 4.7.2008, am Tag der Eröffnung der neuen US-Botschaft am Brandenburger Tor, zitiert nach Frankenberger, Klaus-Dieter: Im Herzen Berlins, in: FAZ, 5.7.2008, S.1f., 8. Stürmer, Michael: Welt ohne Weltordnung, Hamburg 2006. Vgl. Münkler, Herfried: Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie, Weilerswist 2006. Bierling, Stephan: Schwierige Partner. Differenzen zwischen Washington und Paris als Problem deutscher Sicherheitspolitik, in: Europa und die USA. Transatlantische Beziehungen im Spannungsfeld von Regionalisierung und Globalisierung, hrsg. von Susanne Luther und Reinhard C. Meier-Walser, München 2002, S.222-232, hier S.223. Riecke, Henning (Hrsg.): Die Transformation der NATO. Die Zukunft der euroatlantischen Sicherheitskooperation, Baden-Baden 2007. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration 123 trum der NATO12 angesichts einer fehlenden Gesamtstrategie der Bündnispartner sowohl über die verteidigungspolitische Ausrichtung als auch über Art und Umfang der weltweiten NATO-Einsätze die Organisation des „burden sharing“ heute zu einer ernstzunehmenden Herausforderung für den Zusammenhalt in der Allianz macht. Beide gegenwärtigen Formen euro-atlantischer Arbeitsteilung – die institutionalisierte Strategische Partnerschaft zwischen EU und NATO („Berlin Plus“) und die von der Bush-Regierung eingesetzten „coalitions of the willing“ aus NATO-Mitgliedern und Drittstaaten – haben die transatlantische Sicherheitsarchitektur vordergründig auf die Entlastung des amerikanischen Hauptverbündeten kalibriert. Andererseits aber erwächst aus beiden Modellen die Chance zu einer verstärkten europäischen Einflussnahme auf die US-Außen- und Sicherheitspolitik. Führungsanspruch und Entlastungswunsch stehen dabei unter dem Eindruck einer Dilemmasituation, die in der neorealistischen Theorieschule der internationalen Politik unter dem Begriff des allianzinternen Sicherheitsdilemmas13 firmiert und die die gestiegene Verwundbarkeit der staatlichen Akteure in einem zunehmend multipolaren internationalen System zum Ausdruck bringt. 2. Das allianzinterne Sicherheitsdilemma Im allianzinternen Sicherheitsdilemma wirken die Furcht, vom Bündnispartner verlassen zu werden („abandonment„), und zugleich die Furcht, vom Bündnispartner in einen fremden Konflikt verwickelt zu werden („entrapment“), handlungsleitend.14 Versuche, das Risiko von „abandonment“ bzw. „entrapment“ zu reduzieren, bedingen dabei häufig, jedoch nicht immer, den Anstieg des jeweils anderen Risikos:15 Hegt ein staatlicher Akteur die Befürchtung, von seinem Allianzpartner verlassen zu werden, kann er zwar durch Intensivierung des eigenen Engagements seinen Wert für den Partner innerhalb oder außerhalb der Allianz erhöhen. Er läuft dann allerdings Gefahr, in Konflikte des Allianzpartners, an den er sich nun stärker gebunden hat, verwickelt zu werden. Hegt ein Akteur hingegen die Befürchtung, von seinem Allianzpartner in einen fremden Konflikt hineingezogen zu werden, und reduziert daraufhin sein Engagement, so steigt das Risiko, dass Letzterer abtrünnig wird oder im Gegenzug sein Engagement gegenüber dem ersten Akteur verringert. Die staatliche 12 13 14 15 Jones, James L.: Taking stock of NATO operations, video interview with the Supreme Allied Commander Europe, Brüssel, 16.11.2006, www.nato.int/docu/ speech/2006/s061116a.htm, Stand: 22.2.2009. Vgl. Snyder, Glenn H.: The Security Dilemma in Alliance Politics, in: World Politics 36/1984, S.461-495. Vgl. Siedschlag, Alexander: Neorealismus, Neoliberalismus und postinternationale Politik, Opladen 1997, S.137ff. Vgl. Snyder, Glenn H.: Alliance Politics, Ithaca u.a. 2007 [1997], S.307. 124 Martin Reichinger Strategiewahl ergibt sich folglich als das Ergebnis eines „trade-off“16 zwischen den Kosten und Risiken von „entrapment“ und „abandonment“,17 wobei ein Staat stets die Konsequenzen seines Handelns sowohl in Bezug auf seine Bündnispartner („alliance game“) als auch in Bezug auf den oder die Gegner seines Bündnisses („adversary game“) bedenken muss. Die Strategiewahl hängt überdies von einer Reihe von Determinanten der allianzinternen Verhandlungsmacht („intra-alliance bargaining power“) ab, zu denen insbesondere die relativen Abhängigkeiten der Allianzpartner untereinander zählen, wie auch der Grad der Interessenparallelität der Partner, die Pfadabhängigkeiten des eigenen und des Verhaltens der Partner in der jüngsten Vergangenheit sowie die Detaillierung der Bündnisverpflichtung, die wiederum Einfluss auf den allianzinternen Beistand hat.18 Virulent wird das allianzinterne Sicherheitsdilemma beim Verlust des gemeinsamen Gegners bzw. der kollektiven Bedrohungsperzeption und insbesondere im multipolaren System.19 Es lassen sich sämtliche Formen eines internationalen „alignment“, d.h. Koalitionen, Bündnisse oder auch nur wechselseitige Beistandserwartungen, unter der Schablone des allianzinternen Sicherheitsdilemmas betrachten.20 3. Führungsanspruch trotz Gefolgschaftsverweigerung – die Irak-Krise im Zeichen des allianzinternen Sicherheitsdilemmas In der Irak-Krise 2002/2003 wurde die NATO von der Bush-Administration marginalisiert. Ein rigider Unilateralismus, die Entwicklung neuer Formen des „alignment“ zur Herstellung weitgehender Unabhängigkeit von den Entscheidungsmechanismen des Bündnisses und die Rekrutierung allianzexterner Koalitionspartner gestatteten der einzig verbliebenen Supermacht dabei die Abfederung des allianzinternen Sicherheitsdilemmas per Reduzierung insbesondere des „abandonment“-Risikos. Der Widerruf einzelner Bündnispartner nämlich fiel nun weniger ins Gewicht, während die Möglichkeiten zur Kontrolle der Partner stiegen. Aus Sicht der US-Regierung waren Risikoerwägungen dieser Art insofern berechtigt, als langjährige Bündnispartner angesichts der vom Irak (vermeintlich) ausgehenden Proliferationsgefahr sowie angesichts des (konstruierten) Konnexes zwischen der säkularen Diktatur Saddam Husseins und dem 16 17 18 19 20 Snyder, Glenn H.: Alliance Theory: A Neorealist First Cut, in: Journal of International Affairs 1/1990, S.103-123, hier S.113. Vgl. Snyder: The Security Dilemma in Alliance Politics, S.467. Vgl. Synder: Alliance Politics, S.166ff; Ders.: The Security Dilemma in Alliance Politics, S.471ff. Vgl. Snyder: The Security Dilemma in Alliance Politics, S.485. Vgl. Snyder, Glenn H.: Alliances, balance and stability, in: International Organization 1/1991, S.121-142, hier S.123. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration 125 religiös-fundamentalistischen Terrornetzwerk Osama bin Ladens offenbar regungslos verharrten und damit nicht nur die nationale Sicherheit der USA gefährdeten, sondern auch die geostrategischen und energiepolitischen Interessen21 konterkarierten, die die Neokonservativen als Teil ihrer ideologisch aufgeladenen Weltordnungspolitik im Mittleren Osten mit militärischen Machtmitteln durchsetzen wollten. Gerade das Konzept der Ad-hoc-Koalition sollte sich in der Hochphase der Irak-Krise Anfang 2003 als Mittel der Wahl erweisen, um die geneigten europäischen Gefolgschaftsstaaten, allen voran Großbritannien unter Premierminister Blair, effektiver zu kontrollieren, während sich bestehende Machtasymmetrien konservieren und über bilaterale Koalitionsverpflichtungen neue Abhängigkeiten schaffen ließen. Vor dem Hintergrund der parallelen energiepolitischen Interessen22 und der asymmetrischen Abhängigkeiten in der anglo-amerikanischen „special relationship“ musste die britische Regierung daher ein „abandonment“, d.h. den völligen Alleingang der USA, schlimmstenfalls eine Form von „Neoisolationismus“23, stärker fürchten als die Verwicklung in einen (möglicherweise langwierigen) Krieg. Blair musste sein Engagement gegenüber Washington erhöhen, wollte er dieses Risiko minimieren.24 In der Tat optierte London für eine Strategie des „bandwagoning“25, lehnte sich an die Politik der Supermacht an und begründete so eine bis in die Gegenwart andauernde „entrapment“-Situation. Am 16. Februar 2003 war im Ausschuss für Verteidigungsplanung der NATO auf massiven Druck der USA entschieden worden, für den Fall eines irakischen Angriffs auf die Türkei militärische Planungen zum Schutz des Bündnispartners einzuleiten. Im Sinne der Allianztheorie hatten die französische Regierung unter Staatspräsident Chirac und die rot-grüne Bundesregierung Gerhard Schröders ihr „commitment“ reduzieren müssen,26 21 22 23 24 25 26 Vgl. Rice, Condoleezza: Campaign 2000: Promoting the National Interest, in: Foreign Affairs 1/2000, S.45-62. Vgl. Hill, Christopher: Putting the world to rights: Tony Blair‘s foreign policy mission, in: The Blair Effect 2001-5, hrsg. von Anthony Seldon und Dennis Kavanagh, Cambridge u.a. 2005, S.384-409, hier S.392. Siedschlag, Alexander: Eine realistische Theorie europäischer Sicherheitspolitik, in: Die neuen deutsch-amerikanischen Beziehungen: Nationale Befindlichkeiten zwischen supranationalen Visionen und internationalen Realitäten, hrsg. von Winand Gellner und Martin Reichinger, Baden-Baden 2007, S.163-171, hier S.165. Vgl. Snyder: The Security Dilemma in Alliance Politics, S.475. Wolf, Klaus Dieter: „Excuse me, I am not convinced.“ Von der Bipolarität zur Unipolarität? Der Mythos vom zweiten amerikanischen Jahrhundert, in: Weltpolitik heute. Grundlagen und Perspektiven, hrsg. von Volker Rittberger, Baden-Baden 2004, S.53-84, hier S.81. Grundlegend: Walt, Stephen M.: The Origins of Alliances, Ithaca u.a. 1987, S.19ff. Vgl. Snyder: The Security Dilemma in Alliance Politics, S.469. 126 Martin Reichinger wollten sie das offenbar akute „entrapment“-Risiko verringern und die Verwicklung27 in einen zweifellos völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vermeiden. Die Vielzahl ihrer bereits im Januar eingeleiteten, EU-europäisch gelagerten sicherheits- und verteidigungspolitischen Initiativen vor dem Hintergrund der laufenden Arbeiten des Europäischen Verfassungskonvents28 und insbesondere die unnachgiebige Position beider Staaten im UN-Sicherheitsrat waren dabei als eine Strategie des „soft balancing“29 zu werten, und im Grunde als Versuch, ein „kooperatives Gleichgewicht“30 zu den USA zu etablieren. Jedenfalls musste der deutsch-französische Schulterschluss die politische Führung am Potomac von der Richtigkeit ihrer Strategie der Differenzierung der Allianz überzeugen, so dass nun der Versuch unternommen wurde, die europäischen Partner aktiv zu bipolarisieren31 („divide et impera“) und die perzipierte „Gegenallianz“ zu stören.32 Diese problematische Kombination aus Führungsanspruch bei Zurücknahme einst hegemonial induzierter Kooperation könnte insofern als amerikanische Kausalkomponente für die Gefolgschaftsverweigerung zahlreicher europäischer Staats- und Regierungschefs in der Irak-Krise zu werten sein. 4. Führungsanspruch trotz Entlastungswunsch – das transatlantische „burden sharing“ im Zeichen des allianzinternen Sicherheitsdilemmas Transformation und Erweiterung der NATO boten der Bush-Administration die Möglichkeit, das allianzinterne „abandonment“-Risiko zu minimieren. Gleichzeitig forcierte Bush bereits in seiner ersten Amtszeit den Rückzug der US-Truppen vom Balkan und verringerte damit im Sinne 27 28 29 30 31 32 Vgl. Overhaus, Marco: In Search of a Post-Hegemonic Order: Germany, NATO and the European Security and Defence Policy, in: German Politics 4/2004, S.551-568, hier S.558. Vgl. Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela: Frankreichs Europapolitik, Wiesbaden 2004, S.245. Rudolf, Peter: Von Clinton zu Bush: Amerikanische Außenpolitik und transatlantische Beziehungen, in: Supermacht im Wandel. Die USA von Clinton zu Bush, hrsg. von Hans-Jürgen Puhle, Söhnke Schreyer und Jürgen Wilzewski, Frankfurt/M. 2004, S.263-292, hier S.285. Link, Werner: Integration, Kooperation und das „Gleichgewicht“ in Europa, in: Europa und die USA. Transatlantische Beziehungen im Spannungsfeld von Regionalisierung und Globalisierung, hrsg. von Susanne Luther und Reinhard C. Meier-Walser, München 2002, S.61-70, hier S.63. Vgl. das vielzitierte Diktum Donald Rumsfelds: „Wenn Sie Europa meinen, dann denken Sie an Deutschland und Frankreich. Ich nicht. Ich denke, das ist das ‚alte Europa‘„, zitiert nach Bannas, Günter/Leithäuser, Johannes/Rüb, Matthias: Empörung in Berlin und Paris über Washington, in: FAZ, 24.1.2003, S.2. Dazu grundlegend: Morgenthau, Hans J.: Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York 1960 [1948], S.179f. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration 127 der neorealistischen Allianztheorie das eigene „entrapment“-Risiko. Aus Sicht der Europäer jedoch erhöhten beide Strategien der US-Regierung die Wahrscheinlichkeit für ein amerikanisches „abandonment“, denn – konsequent weitergedacht – die USA konnten auf diese Weise künftig unabhängig von gewachsenen Bündnisstrukturen wechselnde Koalitionen für weltweite Anti-Terror-Einsätze zusammenschirren und dabei dem „alten“ Kontinent nonchalant den Rücken kehren. 4.1 Die Strategische Partnerschaft auf dem Balkan Angesichts der Realität gewordenen „ever lurking European worries about a U.S. retreat to the American ‚fortress‘„33 sowie angesichts der Versuche der Bush-Regierung, die europäischen Bündnispartner insbesondere in Afghanistan in einem global konzipierten „Anti-Terror-Krieg“ sekundierend einzusetzen, scheint in Europa das Mittel der Wahl zur Reduzierung sowohl des „abandonment“- als auch des „entrapment“-Risikos in der Weiterentwicklung autonomer sicherheits- und verteidigungspolitischer Strukturen und Fähigkeiten zu liegen. Die ESVP nämlich dient in diesem Sinne sowohl als Instrument zur Kompensation des amerikanischen Rückzugs wie auch zur Emanzipation gegenüber dem amerikanischen „Ruf zu den Waffen“. Zwar hatten die europäischen Staats- und Regierungschefs frühzeitig sowohl die Übernahme der NATO-Operation „Allied Harmony“ in Mazedonien als auch der Stabilization Force (SFOR) in Bosnien-Herzegowina gefordert. Erst das globale Anti-Terror-Engagement der NATO jedoch und damit das dauerhaft absehbare „disengagement“ der USA in Europa zwangen die europäischen Regierungen zur Erarbeitung einer konkreten Ersatzrolle für die NATO auf dem Balkan und zu handfesten Fähigkeitsverbesserungen. In diesem Zusammenhang steht vor allem das Headline Goal 2010 vom Mai 2004, dessen Kern neben der Einrichtung einer Europäischen Verteidigungsagentur und der Bereitstellung einer Transportmaschine zur interkontinentalen Truppenverlegung (Airbus A 400M) im Konzept der Battlegroups besteht. Obgleich George W. Bush im Wahlkampf 2000 offen ankündigte, das eigene „commitment“ beim „peace-keeping“ auf dem Balkan reduzieren und im Gegenzug die europäischen Verbündeten zu höheren Truppenleistungen animieren zu 33 Snyder: The Security Dilemma in Alliance Politics, S.487; dergleichen Mearsheimer, John J.: The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001, S.386f. Auch die Pläne der Bush-Administration zur Stationierung einer amerikanischen Radaranlage in Tschechien und einer Batterie amerikanischer Abfangraketen in Polen standen vielmehr im Zeichen der Sicherheit des US-amerikanischen als des europäischen Territoriums; die geplanten Komponenten nämlich wären auf Flugkörper gerichtet, die sich über Europa im Zenit ihrer Flugbahn befänden (vgl. Link, Werner: Europa ist kein Juniorpartner, in: FAZ, 14.7.2008, S.7). 128 Martin Reichinger wollen,34 forderte die US-Regierung später doch niemals explizit ein höheres Engagement der Europäer speziell im ESVP-Rahmen. Dies erklärt denn auch das Zögern Washingtons bei der Lockerung allianzinterner Kontrollen und der Abgabe von Führungsverantwortung, als es im Vorfeld der EU-Militärmission „Concordia“ darum ging, das Kernelement der sogenannten Strategischen Partnerschaft zwischen NATO und EU – die Berlin-Plus-Vereinbarung des Washingtoner Gipfels von 1999 – dauerhaft zu fixieren und der EU erstmals den praktischen Rückgriff auf Fähigkeiten und Mittel der NATO zu gestatten. Bereits im Februar 2001 hatte US-Verteidigungsminister Rumsfeld festgestellt, dass „actions that could reduce NATO’s effectiveness by confusing duplication or perturbing the transatlantic link would not be positive”.35 Offensichtlich war insbesondere das Pentagon nur im Angesicht eines in seiner Wahrnehmung Existenz bedrohenden transnationalen Terrorismus sowie vor dem Hintergrund des heraufziehenden Irak-Kriegs dazu bereit, Militäreinsätze der EU – und waren sie noch so klein – zu akzeptieren. Die sicherheitspolitischen Gehversuche der Europäer auf dem Balkan ab März 2003 verschärften für die US-Regierung zweifellos das Dilemma zwischen Führungsanspruch und Entlastungswunsch. Hatte die US-Sicherheitsgarantie den Europäern jahrzehntelang Möglichkeiten des „free-riding“ eröffnet, so lag es im Interesse der Bush-Regierung, jetzt, da die Partner wohlhabender, selbstbewusster und sicherheitspolitisch leistungsfähiger geworden waren, die Kosten der Herstellung des öffentlichen Guts „Sicherheit“ auf sämtliche Profiteure zu verlagern. Hier lässt sich eine sinnhafte Verbindung zwischen der Theorie der hegemonialen Stabilität36 und der Vorstellung einer euro-atlantischen Arbeits- und Lastenteilung herstellen: Ist der Hegemon nicht mehr im Stande, hegemoniale Stabilität aufrechtzuerhalten, neigt er zum „burden sharing“ und fordert die Trittbrettfahrer auf, sich an der Erbringung der notwendigen Leistung zu 34 35 36 Vgl. Bush, George W.: The Second Gore-Bush Presidential Debate, Wake Forest University, 11.10.2000, www.debates.org/pages/trans2000b.html, Stand: 22.2.2009. Rumsfeld, Donald H.: Speech at the 37th Munich Security Conference, München, 3.2.2001, www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2001=& menu_konferenzen_archiv=&menu_konferenzen=&sprache=de&id=31&, Stand: 21.2.2009. Vgl. Keohane, Robert O.: After Hegemony. Cooperation and Discord in World Political Economy, Princeton 1984, S.31-46; ferner Gilpin, Robert G.: Global Political Economy. Understanding the International Economic Order, Princeton 2001, S.93-97. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration 129 beteiligen37 – ohne jedoch seinen Führungsanspruch aufgeben zu wollen bzw. aufgeben zu können, denn die US-Regierung musste angesichts des Zerwürfnisses über den Irak-Krieg der Tatsache Rechnung tragen, dass die von ihr angestrebte Kostenverlagerung durch militärische Koalitionen oder eine internationale Vorsorge-, Stabilisierungs- und Krisennachsorgepolitik der Partner nicht zwangsläufig im Interesse ihrer Alliierten lag. Zwar verschoben die auch für die Zukunft zu erwartenden europäischen Unzuverlässigkeiten die Präferenzordnung der Bush-Administration von der Vorstellung eines transatlantischen „burden sharing“ – wie es von der Republikanischen Partei noch in der Zeit der Regierung Clinton und im Präsidentschaftswahlkampf 2000 vertreten worden war – in Richtung einer sicherheitspolitischen Führung der europäischen Partner. Die daraus resultierenden allianzinternen Problematiken zwangen die US-Regierung jedoch dazu, ihre Sicherheitspolitik mit der ihrer wichtigsten Partner abzustimmen, wollte Washington verhindern, dass es diese überforderte und im zunehmend multipolaren System möglicherweise ganz verlieren würde. In diesem Lichte also war die in den EU-Militärmissionen „Concordia“ in Mazedonien bzw. „Althea“ in Bosnien-Herzegowina erfolgte Abgabe von Führungsverantwortung beim „peace-keeping“ zu sehen, und im Übrigen auch die Abgabe von Führungsverantwortung bei der Leitung zahlreicher Provinz-Wiederaufbauteams (PRT) in Afghanistan oder der dortigen Einsatzleitung kleinerer Anti-Terror-Operationen. Die Problematik der Berlin-Plus-Dauervereinbarung im Vorfeld des ersten Balkan-Einsatzes der ESVP hat dabei im Vergleich zum Afghanistan-Einsatz gezeigt, dass es der Bush-Regierung sichtlich leichter fiel, das „leadership“ in ihrem bilateralen Koalitionensystem zu teilen, als mit einer Europäischen Union, die selbst ein „many-headed leadership“38 besitzt. 4.2 Die flexiblen Koalitionen in Afghanistan In der Irak-Krise war deutlich geworden, dass eine konservative Institution wie eine Allianz, die auf die Bewahrung eines Konsenses über Mittel und Ziele ausgerichtet ist, an Wirkungskraft verliert, je weiter sich ein möglicher Einsatz von eben diesem Grundkonsens – im Fall der NATO 37 38 Vgl. Menzel, Ulrich: Imperium oder Hegemonie. Die Renaissance alter Weltordnungskonzepte?, Handreichung zum gleichnamigen Vortrag auf der Tagung „Ordnung in der internationalen Politik“ der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung e.V. in Zusammenarbeit mit der Professur für Politische Theorie und Ideengeschichte und dem Arbeitskreis Internationale Politik der Universität Passau, Passau, 6./7.6.2008, S.21, wwwpublic.tu-bs.de:8080/~umenzel/inhalt/vortraege/Vortrag_Imperium_oder_ Hegemonie.pdf, Stand: 23.2.2009. Thompson, Wayne C.: European-American co-operation through NATO and the European Union, in: Redefining Transatlantic Security Relations: The Challenge of Change, hrsg. von Dieter Mahncke, Wyn Rees und Wayne C. Thompson, Manchester 2004, S.93-131, hier S.104. 130 Martin Reichinger der kollektiven Verteidigung – entfernt. Im Jahr 2003 war das Bündnis nicht einmal mehr politisch einsatzfähig. Ohne den politischen Konsens im Bündnis aber beraubt sich der Hegemon seiner Möglichkeiten zur sicherheitspolitischen Entlastung. Mehr noch: Eine Gemeinsame Beschlussfassung über die Strategie der Allianz auf politischer Ebene ist stets ein Instrument zur Vorsorge gegen das „abandonment“-Risiko. Bundeskanzlerin Angela Merkel etwa forderte wenige Tage nach der US-Präsidentschaftswahl 2008 mit Blick auf den NATO-Jubiläumsgipfel im April 2009 die Erarbeitung eines neuen Strategischen Konzepts für das Bündnis.39 Gerade mit Blick auf Afghanistan nämlich schien die Fixierung der Allianz durch eine einheitliche, allgemeinverbindliche Strategie von der republikanischen US-Regierung nicht gewollt gewesen zu sein. Im Gegenteil: Spätestens seit dem 11. September hatte die Bush-Regierung einen Transformationsprozess forciert, der konkret auf dem Prager NATO-Gipfel im November 2002 begann und an dessen Ende die Allianz als Instrument zur Koalitionenbildung und Kapazitätssteigerung bei der weltweiten Verteidigung US-amerikanischer Interessen stehen sollte.40 Dabei wurden die Überdehnung von Einsatzmandaten und die Ausweitung des Einsatzgebietes bewusst in Kauf genommen, womit sich in den vergangenen Jahren die Frage der Bündnissolidarität auf eine destruktive Aufrechnung der jeweiligen Truppenkontingente und eine „irrelevante Diskussion über zivile oder militärische Prioritäten“41 reduziert hat. In der Tat, die Chronologie des westlichen Krisenmanagements in Afghanistan demonstriert beispielhaft die Verwicklungsgefahr, der die Bündnispartner innerhalb der NATO heute ausgesetzt sind. Rückschläge im Kampf gegen die religiösen Extremisten und die dramatische Verschlechterung der Sicherheitslage seit spätestens 2006 haben den Einbezug der europäischen Partner dabei über Laufzeit immer dringlicher werden lassen, bis zu einem Punkt, an dem heute jeder einzelne Soldat gebraucht wird: Hatte der amerikanische Hegemon im Herbst 2001 bei seinem militärischen Alleingang trotz der Deklaration des Bündnisfalls jedweden militärischen Beistand zunächst abgelehnt, so stand das Jahr 2002 im Zeichen der allmählichen Zunahme der Zahl der unterstützenden Nationen und deren allmählicher Verwicklung, zunächst im Rahmen der multinationalen Anti-Terror-Koalition „Operation Enduring Freedom“ (OEF), bald jedoch auch im Rahmen einer UN-mandatierten Schutztruppe, der International Security Assistance Force (ISAF), die im Frühjahr 2002 in einer Stärke von knapp 5.000 Soldaten antrat und in der heute weit über 56.000 Militär39 40 41 Vgl. Löwenstein, Stephan: Merkel für neues Konzept der NATO, in: FAZ, 12.11.2008, S.5. Vgl. Theiler, Olaf: NATO: Sicherheitspolitische Aufgabenfelder und Missionen, in: Handbuch zur europäischen Sicherheit, hrsg. von Franz Kernic und Gunther Hauser, Frankfurt/M. u.a. 2006, S.203-222, hier S.214. Rühl, Lothar: Neue Strategie mit alten Mitteln, in: FAZ, 20.2.2009, S.12. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration 131 personen aus 41 Nationen dienen.42 Da in der Spätphase der Irak-Krise Anfang 2003 deutlich geworden war, dass die Bildung einer Ad-hoc-Koalition aus NATO-Mitgliedern nur aufgrund der etablierten und bewährten Allianzstrukturen funktionierte, die dazu angewandte unilaterale Außenpolitik jedoch „abandonment“-Reaktionen der übrigen NATO-Partner provozierte, kann die Übernahme der ISAF durch die NATO im August 2003 durchaus als im Zusammenhang mit den „lessons learned in Iraq“ gesehen werden. Abgesehen davon war zwischen Euphrat und Tigris nun ein zweiter Kriegsschauplatz eröffnet worden, der die primäre Aufmerksamkeit und Truppenpräsenz der USA erforderlich machte. Der „Bruch des Westens“43 über den Irak hatte offenbar einen katalytischen Effekt auf das westliche Engagement am Hindukusch, denn über den Transmissonsriemen der NATO war die ISAF fortan einer noch stärkeren US-amerikanischen Einflussnahme ausgesetzt, die vor allem dem Ziel diente, die sicherheitspolitischen Lasten in Afghanistan auf möglichst viele Schultern zu verlagern. Das Folgejahr 2004 steht daher für die zahlenmäßige Zunahme von Bündnispartnern und Drittstaaten in der ISAF sowie für den US-gesteuerten Versuch des NATO-Generalsekretärs Jaap de Hoop Scheffer, die Mandate von OEF und ISAF zu verschmelzen.44 Insbesondere der NATOGipfel in Istanbul im Juni des Jahres war dabei von der auf beiden Ufern des Atlantiks gewonnenen Erkenntnis geprägt, dass die neuen Bedrohungen der internationalen Sicherheit weder von Europa noch von den USA alleine bewältigt werden könnten und beide Seiten verlässliche Partner benötigten.45 Auf dieser Grundlage wurden 2004 denn auch die Weichen für die geographische Expansion der ISAF gestellt, die im Jahr 2005 tatsächlich stattfand und im Rahmen derer das Einsatzgebiet der Schutztruppe zunächst aus der Hauptstadt Kabul heraus und anschließend über den Norden und Westen des Landes bis hinein in den schwer umkämpften Süden und Osten ausgeweitet wurde. Das von den Amerikanern entwickelte Modell der Provincial Reconstruction Teams (PRT) erwies sich in diesem Zusammenhang als adäquat für die flächendeckende Versorgung des Landes mit dem Gut „Sicherheit“, insbesondere aber für die internationale Lastenteilung und den flexiblen Einsatz und die Rotation der Bündnispartner.46 Im Jahr 2006, als die Gewaltintensität am Hindukusch das Niveau im Irak längst überschritten hatte und die Rückschläge im Süden Afghanistans begannen, den bis dahin relativ ruhigen Norden des 42 43 44 45 46 Vgl. NATO: ISAF Troops Placemat, Stand: 13.2.2009; www.nato.int/isaf/docu/ epub/pdf/isaf_placemat.pdf, Stand: 21.2.2009. Vgl. Daalder, Ivo H.: The End of Atlanticism, in: Survival 2/2003, S.147-166. Vgl. Monaco, Annalisa: Beyond Kabul: Big words, small cautious steps, in: NATO Notes 1/2004, S.1. Vgl. Meier-Walser, Reinhard C.: Die Transformation der NATO. Zukunftsrelevanz, Entwicklungsperspektiven und Reformstrategien, Aktuelle Analysen 34/2004, S.10f. Vgl. Schmunk, Michael: Die deutschen Provincial Reconstruction Teams. Ein neues Instrument zum Nation-Building, SWP-Studie S 33/2005, S.11f. 132 Martin Reichinger Landes zu destabilisieren,47 wurde die ursprünglich vorgesehene Komplementarität zwischen der den afghanischen Wiederaufbau flankierenden ISAF, d.h. der für das „peace-keeping“ zuständigen NATO, und der AntiTerror-Mission OEF de facto aufgegeben. Die disponiblen Kräfte werden seither auch im Anti-Terror-Kampf eingesetzt. Im Afghanistan Compact des Jahres 2006 sowie auf dem Gipfel von Riga ersuchte die NATO offiziell auch bei anderen internationalen Organisationen um Beistand,48 da beim zivil-militärischen Krisenmanagement umso mehr Kompensationsbedarf bestand und das Modell des „Afghan ownership“ bis dahin unzureichende Ergebnisse geliefert hatte. Während nun also sowohl die OEF als auch die ISAF in die Bekämpfung von Al Qaida-Terroristen und (Neo-)Taliban verwickelt waren, wurden die europäischen Bündnispartner im Jahr 2007 – als noch rund 158.000 US-Soldaten im Irak stationiert waren – zusätzlich über ihr europäisches Integrationsprojekt zur Unterstützung des zivilen Wiederaufbaus herangezogen. Für diesen Schritt steht der Beginn der Polizeimission „EUPOL Afghanistan“ im Juni 2007. In 2008 schließlich bestand das „burden sharing“ in Afghanistan darin, dass die USA als „lead nation“ der OEF den hochintensiven Anti-Terror-Kampf im afghanischpakistanischen Grenzgebiet führten und die NATO unter amerikanischer Führung vor allem im Süden und Osten des Landes für Anti-Terror-Missionen zur Verfügung stand, während sie beim „peace-keeping“, präziser: beim „peace-enforcement“, vor allem von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union in ganz Afghanistan politisch, zivil und polizeilich unterstützt wurde. In der Tat besorgniserregend ist dabei die Tatsache, dass Al Qaida und die Taliban-Kader indes auch auf dem Staatsgebiet der benachbarten Atommacht Pakistan (wieder) Fuß gefasst haben.49 Ausgehend von den nationalen Interessen aller NATO-Mitgliedstaaten an einem politisch und gesellschaftlich stabilen Afghanistan und ausgehend von der Überzeugung der alliierten Staats- und Regierungschefs, dass bei einem Scheitern in oder einem Rückzug der Allianz aus der HindukuschRegion das Land nicht nur in das prä-moderne Regime der Taliban zurückfallen, sondern es überdies wieder zum primären Ausbildungshort des weltweit operierenden islamistischen Terrorismus würde, können die wechselseitigen Abhängigkeiten dies- und jenseits des Atlantiks heute als überaus hoch betrachtet werden. Hoch sind diese sicherheitspolitischen Interdependenzen insbesondere auch deshalb, weil zur kollektiven Verteidigung gegen den transnationalen Terrorismus und zur Befriedung aktueller Krisenherde der Einsatz von militärischen und zivilen Instrumenten 47 48 49 Vgl. Jung, Franz Josef: „Wiederaufbau ist die richtige Strategie für Afghanistan“, Stand: 30.10.2006, www.bundesregierung.de/nn_1500/Content/DE/ Interview/2006/10/2006-10-30-interview-jung-faz.html, Stand: 21.2.2009. Vgl. North Atlantic Council: Riga Summit Declaration, Riga, 29.11.2006, paragraph 6, www.nato.int/docu/pr/ 2006/p06-150e.htm, Stand: 21.2.2009. Vgl. Rubin, Barnett: Letzte Ausfahrt Quetta, in: Rheinischer Merkur 5/2007, S.6. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration 133 gleichermaßen notwendig ist. Die jeweiligen Dependenzen sind dabei asymmetrisch. In dem Maße nämlich, wie das auf die Anwendung von militärischer „hard power“ spezialisierte Amerika zunehmend die ausgewiesenen „soft-power“-Fähigkeiten der Europäer benötigt, bleiben Europas Staaten mit ihrer „Zivilmacht“ auch weiterhin auf die militärische Schlagkraft der USA angewiesen. 5. Sharing the burden – sharing the lead? Während der Bush-Jahre haben auch die Europäer das „allianzinterne Sicherheitsdilemma“ entschärft. Durch die sukzessive Ausprägung ihrer sicherheits- und verteidigungspolitischen Identität bzw. durch die operative Implementierung der ESVP gelang ihnen dabei nicht nur die Reduktion des „entrapment“-Risikos – heute nämlich sind sie in der Lage, für militärische Leistungen auf dem Balkan oder in Afghanistan eine höhere Einflussnahme auf politische Führungsentscheidungen und strategische Weichenstellungen innerhalb der NATO einzufordern. Vielmehr war es möglich, das Risiko des „abandonment“ zu verringern, denn in dem Maße, wie die US-Regierung den Charakter der NATO vom rigiden Allianz- auf das weitaus flexiblere Koalitionsmodell getrimmt und ihr traditionelles Aufgabenspektrum um Fragen der Terrorismusbekämpfung oder Energiesicherheit50 erweitert hat, ist die Wichtigkeit der europäischen Beiträge für den US-amerikanischen Verbündeten relativ gestiegen. Abgesehen davon bringen sich die Europäer mit ihrer Sicherheits- und Verteidigungspolitik – die insbesondere mit den Regelungen des Vertrags von Lissabon zur Verstärkten Zusammenarbeit51 und zur Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit52 eine Effizienzsteigerung im Sinne der differenzierten Integration erfahren wird – in die Lage, den eigenen Kontinent ohne Inanspruchnahme US-amerikanischer Unterstützung, d.h. unabhängig von dem zu konstatierenden hegemonialen „abandonment“-Verhalten zu verteidigen. Beide Entwicklungen erhöhen wiederum die Wahr50 51 52 Vgl. Varwick, Johannes: Die militärische Sicherung von Energie. Kann sich die NATO neue strategische Aufgabenfelder erschließen?, in: Internationale Politik 3/2008, S.50-55. Vgl. Art.VI-326-334, Konsolidierte Fassungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (EUV/AEUV), in: ABl. EU, Nr.2008/C115/01, 9.5.2008; 189-192; Vertragstext abrufbar unter: http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download. action?fileName=FXAC 08115DEC_002.pdf&eubphfUid=575507&catalogNbr =FX-AC-08-115-EN-C, Stand: 21.2.2009. Vgl. Art.I-42 Abs.6 i.V.m. Art.I-46 und Protokoll Nr.10 EUV/AEUV; in: ABl. EU, Nr.2008/C115/01, 9.5.2008; 39-41, 275-277; Vertragstext abrufbar unter: http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=FXAC 08115DEC_002.pdf&eubphfUid=575507&catalogNbr=FX-AC-08-115-EN-C, Stand: 21.2.2009. 134 Martin Reichinger scheinlichkeit zum „abandonment“ seitens der Europäer, deren ESVP sich zwar in kleinen Schritten entwickelt, deren verteidigungspolitische Abhängigkeit von den Amerikanern aber an dem Tag dramatisch sinkt, an dem sie in der Lage sind, ihre Sicherheit selbst zu gewährleisten.53 Zwei Dekaden sind vergangen, seit sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Sinnfrage für die NATO als Instrument staatlicher Sicherheitspolitik gestellt hatte. Diese Sinnfrage ist heute der Führungsfrage gewichen, die in den Modellen der transatlantischen Arbeitsteilung in Form der „Strategischen Partnerschaft“ und der „flexiblen Koalitionen“54 unterschiedliche Antworten findet. Die Sollbruchstellen der allenthalben beschworenen euro-atlantischen Partnerschaft55 liegen dabei einerseits im US-amerikanischen Desinteresse an der NATO – sei es in Form des bekannten Multilateralismus à la carte oder eines neuen Isolationismus56 –, andererseits in einem auf sicherheitspolitische Autonomie zielenden Konkurrenzverhalten auf EU-europäischer Ebene. Am Ende der Ära Bush jedenfalls ist festzustellen, dass das Interesse der USA an der NATO in ihrer ursprünglichen Form und Besetzung kontinuierlich gesunken57 und der über Jahrzehnte gepflegte partnerschaftliche Umgang der Bündnispartner wenn nicht abhandengekommen, so doch einem weitaus pragmatischeren, erfolgsorientierteren Verständnis von Allianzpolitik gewichen ist.58 Die Notwendigkeit zur Flexibilisierung der Zusammenarbeit erwuchs dabei in den vergangenen Jahren auch aus der Multipolarisierung des internationalen Systems,59 mit der eine relative Abnahme der (Super-)Macht60 und damit ein absoluter Rückgang von Einfluss und Unabhängigkeit einhergingen. Fest steht, dass die sicherheitspolitischen Herauforderungen heute für alle Akteure immer ähnlicher werden. Daraus resultiert eine graduelle 53 54 55 56 57 58 59 60 Vgl. Haftendorn, Helga: Das Atlantische Bündnis in der Krise, in: Jahrbuch für internationale Sicherheitspolitik 2002, Bd.2, hrsg. von Erich Reiter, Hamburg u.a. 2002, S.75-86, hier S.81. Vgl. den Beitrag von Carlo Masala in diesem Band. Vgl. Walt, Stephen M.: The Ties That Fray: Why Europe and America are Approaching a Parting of the Ways, in: The National Interest 54/1993, S.3-11. Vgl. Wilhelm, Andreas: Konstruktion eines „Empire“ durch „moralischen“ Realismus?, in: Empire, hrsg. von Eberhard Sandschneider, Baden-Baden 2007, S.127-136, hier S.135. Vgl. Masala, Carlo: Möglichkeiten einer Neuorientierung deutscher Außenund Sicherheitspolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 43/2008, S.22-27, hier S.23. Vgl. Kornelius, Stefan: USA fordern Kampfeinsatz der Bundeswehr, in: Süddeutsche Zeitung, 1.2.2008, S.2. Vgl. Haass, Richard N.: Abschied vom Hegemon, in: Rheinischer Merkur 34/2008, S.7. Vgl. Zakaria, Fareed: The Future of American Power, in: Foreign Affairs 3/2008, S.18-43. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration 135 Angleichung der Bedrohungsperzeptionen und sicherheitspolitischen Interessen, wie sie den jüngsten Strategiepapieren Großbritanniens61, Frankreichs62 und der Bundesrepublik Deutschlands63 zu entnehmen sind: Sowohl die beiden Weißbücher aus Paris und Berlin als auch die (erste) Nationale Sicherheitsstrategie aus London setzen dabei einen Schwerpunkt auf die Terrorismusbekämpfung, stehen robusten Militäreinsätzen der NATO „out of area“ offen gegenüber und betonen die Wichtigkeit zivil-militärischer Wiederaufbaumaßnahmen, deren Notwendigkeit auch von der US-Regierung spätestens in der zweiten Amtszeit George W. Bushs gesehen wurde.64 Mit der „National Security Strategy“ vom März 2006 nährte Washington in Europa dabei insgesamt die Hoffnung auf eine künftig stärkere multilaterale Zusammenarbeit,65 auch, da es die Option eines Präventivkriegs – wenn nicht vollständig ausschloss – so doch einschränkte.66 Damit scheinen sich die Sicherheitspolitiken der Partner ein Stück weit angeglichen zu haben – ein Befund, der im Sinne der neorealistischen Allianztheorie67 den Thesen zum Zerfall der NATO nach dem Ende des Ost-West-Konflikts68 widerspricht. Mehr noch: Gerade aufgrund der in der Multipolarität erhöhten Bündnisoptionen scheint das noch während der Irak-Krise hoch umstrittene US-Konzept des „coalition building“ heute von allen NATO-Partnern akzeptiert zu werden – und zwar so lange, wie die Koalitionenbildung aus der NATO heraus erfolgt. Die Tatsache, dass der neue US-Präsident wenige Wochen nach Amtsantritt – wie zu erwarten stand – mit unmissverständlichen Forderungen auf seine Bündnispartner zukam,69 sollte dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass die USA trotz der beschriebenen „entrapment“-Situation in Afghanistan 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Vgl. Cabinet Office: The National Security Strategy of the United Kingdom: Security in an interdependent world, März 2008, http://interactive.cabinetoffice. gov.uk/documents/security/national_security_strategy.pdf, Stand: 21.2.2009. Vgl. Ministère de la Défense: Défense et Sécurité nationale. Le Livre Blanc, Vol.1, Part.I, Juni 2008, www. defense.gouv.fr/content/download/120276/1053255/ version/1/file/LB_tome1_partie1%5B1%5D.pdf, Stand: 21.2.2009. Vgl. Bundesministerium der Verteidigung: Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Rolle der Bundeswehr, Berlin 2006. Vgl. Ackermann, Alice: The United States‘ Perspective on Conflict Prevention, in: Transatlantic Discord. Combatting Terrorism and Proliferation, Preventing Crises, hrsg. von Franz Eder, Gerhard Mangott und Martin Senn, Baden-Baden 2007, S.237-248. Vgl. The White House, The National Security Strategy of the United States of America, März 2006, S.14-17, www.whitehouse.gov/ nsc/nss/2006/, Stand: 10.11.2007. Vgl. ebd., S.18. Vgl. Snyder: The Security Dilemma in Alliance Politics, S.494. Vgl. Layne, Christopher: Rethinking American Grand Strategy: Hegemony or Balance of Power in the Twenty-First Century?, in: World Policy Journal 15/1998, S.8-28. Vgl. Gebauer, Matthias/Schmitz, Gregor Peter: Obama setzt Nato-Partner unter Zugzwang, in: Spiegel Online, 19.2.2009, www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,608586,00.html, Stand: 21.2.2009. 136 Martin Reichinger noch immer die Hauptlast der kostenintensiven militärischen Sicherheitsleistungen tragen und allem Anschein nach auch in den kommenden Jahren verstärkt tragen werden.70 Während die US-Regierung die NATO mehr denn je aus militärischen Gründen wertzuschätzen gelernt hat, steht für viele Europäer dabei zunehmend der politische Zweck der Allianz als Instrument zur Einflussnahme auf den Hegemon im Vordergrund. Speziell Frankreich unternimmt hier gegenwärtig den Versuch, die funktionale Beschränkung des Bündnisses über den Ausbau einer EU-europäischen Sicherheits- und Verteidigungskomponente zu forcieren und bietet sich mit seiner Rückkehr in die integrierte Militärstruktur der Allianz71 zugleich als schlagkräftiger Partner im Koalitionensystem der US-Regierung an. Großbritannien, das wie Frankreich internationale Institutionen traditionell als Amplifikator nationaler Politikpositionen einsetzt, wirkt über eine weithin bilateral gehaltene Gefolgschaftstreue entgegen und prädestiniert sich so zur Führung von Teilkoalitionen in Afghanistan und im EU-Rahmen. Allein Deutschland ist zur Vermittlung gezwungen, denn es kann weder in der NATO noch in der EU seine Interessen ohne die Unterstützung der Partner umsetzen. Gleichwohl erwächst aus dieser Vermittlerrolle heute die Chance, Einfluss auf die Interessenkonvergenz der EU-Kernstaaten zu nehmen und mehrheits- und konsensfähige Positionen zu entwickeln. Der Anreiz für die von den USA gewünschte Organisation von Gefolgschaftsbereitschaft auf EU-Ebene läge dabei in der gestalterischen Einflussnahme auf die internationalen Beziehungen im 21. Jahrhundert.72 Die strategische Komponente eines solch „fordernden Multilateralismus“73 freilich bestünde in der Erhöhung des EU-europäischen Gewichts in der Weltpolitik. Die ESVP nämlich kommt heute bereits dort zum Einsatz, wo die USA nicht intervenieren wollen, nicht mehr intervenieren müssen oder nicht mehr intervenieren können, da ihre Kapazitäten nach den Jahren der Bush-Regierung schlicht erschöpft sind. Sowohl die Substitution der Allianz durch die EU-geführten Operationen „Concordia“ und „Althea“ auf dem Balkan als auch die zunehmende Verwendung der NATO zum Anti-Terror-Kampf in Afghanistan belegen, dass der Primat der NATO jedenfalls beim „peace-keeping“ zu schwinden begonnen hat. Dies wiegt insofern schwer, als gerade der Fall Afghanistan beweist, dass „limited wars of intervention and robust PSOs are in- 70 71 72 73 Vgl. Rüb, Matthias: Washington entsendet weitere 17.000 Soldaten nach Afghanistan, in: FAZ, 19.2.2009, S.6. Vgl. den Beitrag von Gisela Müller-Brandeck-Bocquet in diesem Band. Vgl. Masala: Möglichkeiten einer Neuorientierung, S.27. Hellmann, Gunther: Fordernder Multilateralismus, in: FAZ, 4.2.2009, S.7. Führungsanspruch und Entlastungswunsch der Bush-Administration 137 creasingly the currency of modern international security”.74 In der Tat scheint die EU in ihrem diversifizierten Profil gegenüber vielen Bedrohungen heute glaubwürdiger zu sein als die NATO, deren Hauptrolle bei der Verteidigung jedoch aufgrund der noch immer lückenhaften Fähigkeiten der Europäer nicht in Frage gestellt wird. Die EU braucht die NATO umso mehr, je schwächer ihre Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist. Die Stärke der NATO aber hängt von der hegemonialen Kraft und der Leistungsbereitschaft der USA ab, die sich wiederum als Ergebnis einer Kosten-Nutzen-Erwägung aus faktisch notwendigen europäischen Bündnisleistungen und europäischen Ansprüchen auf Mitsprache und langfristige Gewinnpartizipation ergibt. Im flexiblen Koalitionensystem der USRegierung dominieren diese Interdependenzen. Dass die Supermacht eine effektive Entlastung bei der Herstellung von Sicherheit künftig mit der Einschränkung ihres Führungsanspruchs wird erkaufen müssen, stünde insoweit in der außenpolitischen Bilanz der Bush-Administration. 74 Lindley-French, Julian: In the shade of Locarno? Why European defence is failing, in: International Affairs 4/2002, S.789-811, hier S.804. Die Obama-Administration: Ouvertüre zu einem neuen Amerika? Ulf Gartzke 1. Ein glatter Regierungswechsel Washington, DC – Anfang Februar 2009: Es sind erst knapp zwei Wochen vergangen, seit Barack Obama in einer historischen Zeremonie auf den Stufen des Kapitol als erster „African American“ zum 44. Präsidenten der USA vereidigt wurde. Bereits in seiner Amtsantrittsrede vor rund 1,2 Millionen begeisterten Anhängern auf der Washingtoner Mall machte der frischgebackene Präsident seine Landsleute mit ernster Miene auf harte Zeiten gefasst: „Unsere Nation befindet sich im Krieg gegen ein weitreichendes Netzwerk von Gewalt und Hass. Unsere Wirtschaft ist stark geschwächt; eine Konsequenz der Gier und Unverantwortlichkeit einiger Personen, aber auch unseres gemeinsamen Versagens, harte Entscheidungen zu treffen und unsere Nation auf ein neues Zeitalter vorzubereiten. Unser Gesundheitssystem ist zu teuer, unsere Schulen versagen zu oft und jeder Tag liefert neue Belege dafür, dass die Art und Weise, wie wir Energie nutzen, unsere Gegner stärkt und unseren Planeten bedroht.“ Diese Liste an drängenden Herausforderungen, denen die USA und ihr neuer Präsident gegenüberstehen, findet schon auf internationaler Ebene weitere Ergänzungen: den Nahost-Konflikt, das iranische Nuklearprogramm, die zukünftige Ausgestaltung der Beziehungen zu China und Russland, der eskalierende Konflikt zwischen Pakistan und Indien, die Lage in Nordkorea, das Risiko internationaler Nuklear-Proliferation, der in den letzten Jahren in Lateinamerika verstärkt zu beobachtende Linkspopulismus (Hugo Chavez & Co.) usw. Die Vielzahl und Multidimensionalität der aktuellen Sicherheitsprobleme machen den jüngsten Amtsantritt Barack Obamas fraglos zu dem schwierigsten in der amerikanischen Geschichte seit Abraham Lincolns Vereidigung 1861. Nicht zuletzt aus diesem Grund verbinden daher auch Millionen von Obama-Anhängern im In- und Ausland geradezu messianische Hoffnungen und Erwartungen mit dem charismatischen früheren „Junior Senator“ aus Illinois. Die Obama-Administration: Ouvertüre zu einem neuen Amerika? 139 Und in der Tat: Bislang lief für Barack Obama und sein Team vieles nach Plan. Vor allem während der „transition phase“ – d.h. der 78 Tage dauernden Übergangszeit zwischen Obamas Wahlsieg am 4. November 2008 und dem offiziellen Amtsantritt am 20. Januar 2009 – konnte der 47-jährige „President-elect“ mit der schnellen und zielstrebigen Zusammenstellung seiner Regierungsmannschaft viele Vorschusslorbeeren sammeln. Selbst langjährige politische Beobachter Amerikas waren sich zunächst schnell darüber einig, dass die „Obama Transition“ der disziplinierteste und professionellste Regierungswechsel sei, den Washington jemals erlebt habe. Nach dem Amtsantritt wandelte sich jedoch das Bild. Zwar hatte die „Blagogate“-Affäre um das Verschachern von Obamas Senatssitz in Chicago und der durch Korruptionsvorwürfe bedingte Rückzug Bill Richardsons als designierter US-Handelsminister Obamas „transition phase“ nur marginal berührt, doch die jüngst enthüllten Steuerskandale prominenter Vertreter seiner Administration – insbesondere der Rückzug des Super-Lobbyisten und Obama-Intimus Tom Daschle – haben das coole Saubermann-Image des neuen Präsidenten merklich getrübt. 2. Die Obama-Administration: jung, divers, urban und technologisch orientiert Zum jetzigen Zeitpunkt – dieser Beitrag wurde, wie bereits eingangs erwähnt, Anfang Februar 2009 erstellt – ist es noch zu früh, die Obama Administration einer personellen und inhaltlichen Detailanalyse zu unterziehen. Dafür sind erst zu wenige Puzzle-Teile bekannt. Zwar stehen fast alle Personalentscheidungen auf der ersten Ebene – d.h. Kabinettsminister und Leiter wichtiger US-Regierungsbehörden sowie Obamas neuer Parallel-Stab an politischen Sonderberatern im Weißen Haus mit Zuständigkeiten für wichtige Themengebiete wie z.B. Klimaschutz- und Energiepolitik – bereits fest. Doch letztlich werden auch Personalien auf der zweiten, dritten und sogar vierten Hierarchieebene erheblichen Einfluss auf Inhalt und Implementierung der politischen Agenda des neuen Präsidenten ausüben. Bedenkt man darüber hinaus, dass weitere rund 1.100 politische Beamte vom Senat bestätigt werden müssen, wird deutlich, dass noch mehrere Monate vergehen werden, bevor die neue Regierungsmannschaft ein vollständiges Ganzes ergeben wird. Gleichwohl lassen die bereits deutlich erkennbaren Konturen der ObamaAdministration Rückschlüsse auf das künftige Gesamtbild zu. Die Kontraste zur Ära Bush können auf den ersten Blick deutlicher kaum ausfallen. Zunächst einmal steht an der Spitze Amerikas nun ein 47 Jahre alter „African American“ aus dem urbanen Chicago anstelle eines 62-jährigen Weißen aus dem konservativen Texas. Weiterhin ist die Obama-Administration im Durchschnitt deutlich jünger, deutlich diverser (was die Präsenz 140 Ulf Gartzke von Frauen und Minderheiten anlangt) sowie deutlich urbaner und mehr technologisch orientiert als das Vorgänger-Team von George W. Bush. Während sich viele Mitarbeiter von Barack Obama in ihren 30ern oder sogar erst 20ern befinden – Jon Favreau ist als Chef-Redenschreiber des US-Präsidenten gerade mal 27 Jahre alt –, wurde die Bush-Administration im direkten Vergleich dazu klar von älteren Jahrgängen dominiert. Und während der 43. Präsident der USA viele seiner engsten Berater aus dem christlich-konservativen ländlichen Süden Amerikas (Texas und weitere Staaten des sog. „Bible Belt“) rekrutierte, so sind es bei Obama nunmehr vor allem die kosmopolitischen Eliten der amerikanischen Ost- und Westküste (v.a. New York und Kalifornien) sowie natürlich aus Chicago, die wichtige Positionen in der Regierung übernehmen. Selbst die Besetzung der heiß begehrten Praktikumsplätze in Washington wird sich angesichts des Machtwechsels spätestens ab dem Sommer deutlich ändern. Kamen unter Präsident Bush noch bevorzugt Studenten aus christlich-konservativen Kaderschmieden (Regent oder Liberty Universities in Virginia etc.) zum Zuge, so werden nun viele der Obama-Praktikanten an den traditionellen US-Eliteuniversitäten (Harvard, Stanford etc.) studieren. 3. Wichtige Mitglieder der Obama-Administration im Überblick 3.1 Stabschef Rahm Emanuel Die erste wichtige Personalie der „transition phase“ war die Berufung von Rahm Emanuel zum Stabschef des künftigen Präsidenten. Der 49-jährige Kongressabgeordnete (2003-2009) aus dem Heimatstaat von Barack Obama gilt als Teil der „Chicago Mafia“ – dem unmittelbaren politischen Umfeld von Barack Obama in Chicago – und pflegt mit einer Reihe weiterer Mitglieder, darunter Obamas Top-Wahlkampfstratege und wichtigster politischer Berater David Axelrod, bereits seit Jahren enge persönliche Freundschaften. Zusammen mit Senator Charles Schumer aus New York gilt Rahm Emanuel zudem als Architekt des historischen Wahlsiegs der Demokraten im Herbst 2006, bei dem die Republikaner vor dem Hintergrund von diversen Korruptions- und Sexskandalen in ihren Reihen ihre bestehenden Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses einbüßten. Emanuel ist nicht zuletzt wegen seines aggressiven Politik-Stils (Spitzname „Rahmbo“) vor allem bei den unter Madame Speaker Nancy Pelosi bereits seit mehreren Jahren arg gebeutelten Republikanern im Repräsentantenhaus nicht wohl gelitten. So sahen führende republikanische Politiker die Berufung von Emanuel zum Stabschef als wichtiges Indiz dafür, dass der neu gewählte Präsident es mit seinem Wahlkampfversprechen, einen neuen, weniger konfrontativen Ton nach Washington zu bringen, nicht wirklich ernst meine, sondern vielmehr seine politische Agenda ohne Rücksicht auf die Opposition in möglichst kurzer Zeit durchsetzen wolle. Die Obama-Administration: Ouvertüre zu einem neuen Amerika? 141 Letztlich wird sich Rahm Emanuel jedoch vor allem mit seinen Parteifreunden auf dem Capitol Hill (insbesondere mit den früheren Kollegen im Repräsentantenhaus) herumschlagen müssen. Sowohl House Speaker Nancy Pelosi als auch Senate Majority Leader Harry Reid haben bereits klar gemacht, dass sie sich nicht einfach als verlängerter Arm des Präsidenten sehen und bei der Umsetzung von Barack Obamas politischer Agenda sowie der Bewältigung der Wirtschaftskrise eine gewichtige Mitsprache beanspruchen. Dies könnte die Ouvertüre zu einem nicht unerheblichen politischen Konflikt innerhalb der Demokraten werden, vor allem dann, wenn Nancy Pelosi & Co. der Versuchung nicht widerstehen können, im Kongress eine dezidiert linke Politikagenda (z.B. im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik, der Steuer- und Budgetpolitik etc.) zu verfolgen und sich damit unweigerlich auf Konfrontationskurs mit dem neuen Präsidenten begeben. 3.2 Außenministerin Hillary Clinton und Vizepräsident Joe Biden Die Berufung von Hillary Clinton zur neuen US-Außenministerin war zunächst sehr umstritten. Was hatte Barack Obama dazu bewogen, seine schärfste innerparteiliche Konkurrentin auf einen so wichtigen Kabinettsposten zu berufen? Überdies eine Berufung, verbunden mit dem Risiko, dass Ex-Präsident Bill Clinton über seine Frau indirekt in die Geschicke der Obama-Administration eingreifen könnte. Die Einbindung von Hillary Clinton orientiert sich an dem historischen Vorbild Abraham Lincolns mit seinem berühmten „Team of Rivals“-Konzept, demzufolge nur die fähigsten Personen mit der Führung des Landes zu betrauen sind, ungeachtet aller politischen Rivalitäten. Deshalb auch die Einbindung von Hillary Clinton in die Obama-Administration, welche überdies die Unterstützung an der demokratischen Basis, wie beabsichtigt, steigern konnte. Parallel wird jedem Einfluss ihres Mannes deutlich vorgebaut. So wurden z.B. die lange Zeit undurchsichtigen millionenschweren Fundraising-Aktivitäten von Bill Clintons Privatstiftung erst auf Druck des Obama-Teams offengelegt, als Bedingung für den Einzug Hillary Clintons ins State Department. Das Bestreben der Obama-Administration, den Einfluss der Clintons zu begrenzen, führte in der Vergangenheit bereits zu ihrer Ablehnung als Vize-Präsidentschaftskandidatin. Ein solcher Schritt hätte Obamas Wahlkampfslogan „Change We Can Believe In“ untergraben können, wenn plötzlich die „alte“ First Lady nach acht Jahren zur neuen Nummer Zwei in Amerika aufgestiegen wäre. Eine solche Kontinuität war nicht gewünscht. Hillary Clinton ist in außen- und sicherheitspolitischen Fragen dem pragmatisch-moderaten Lager innerhalb der Demokratischen Partei zuzurechnen. So hatte sie trotz des hohen Drucks durch die pazifistische Parteibasis 142 Ulf Gartzke während des gesamten Vorwahlkampfs nie ihre Unterstützung für Präsident George W. Bushs umstrittene „Iraq War Resolution“ vom Oktober 2002 revidiert und lehnte ebenso einen überstürzten Irak-Rückzug rundweg ab. In ihrer neuen Position im State Department will Hillary Clinton nun vor allem die Kooperation mit Washingtons Alliierten verstärken und gleichzeitig die Reputation Amerikas in der Welt wiederherstellen. Umfragen belegen deutlich, dass die USA nach acht Jahren George W. Bush bei großen Teilen der Bevölkerung Europas und in fast allen islamischen Staaten ein sehr schlechtes Ansehen besitzen. Die Ursachen hierfür sind bekannt und reichen vom Krieg im Irak über Guantanamo und Abu Ghraib bis hin zu Washingtons Ablehnung des Kyoto-Protokolls. Die von Präsident Bush in seiner zweiten Amtszeit ab Januar 2005 unter Führung von Condoleezza Rice gestartete Charmeoffensive in Richtung der (europäischen) Alliierten konnte in diesem Zusammenhang lediglich das Image Amerikas auf Ebene der politischen Eliten verbessern. Das Thema „Public Diplomacy“ bleibt mit Blick auf die breite Bevölkerung deshalb auch weiterhin eine der wichtigsten Herausforderungen und Prioritäten amerikanischer Außenpolitik. Zur Beilegung der Krise um das iranische Nuklearprogramm befürwortet Clinton die Aufnahme direkter Verhandlungen mit Teheran und will darüber hinaus die Beziehungen zu Syrien reaktivieren. Hillary Clinton stellt insgesamt sicherlich eine exzellente Wahl für den wichtigen Posten als US-Außenministerin dar. Sie verfügt bereits heute über internationale Anerkennung und genießt in vielen Hauptstädten der Welt einen sehr guten Ruf. Auch innerhalb des State Department kann Clinton auf die volle Unterstützung ihres Hauses zählen. So wurde sie bereits an ihrem ersten Arbeitstag von rund 1.000 jubelnden Mitarbeitern des Außenministeriums wie ein Rockstar empfangen. Gleichwohl wird sich Hillary Clinton innerhalb der Obama-Administration in außen- und sicherheitspolitischen Fragen behaupten müssen. So könnte sich die Ernennung der zwei neuen US-Sonderbeauftragten Richard Holbrooke (für Afghanistan und Pakistan) sowie George Mitchell (für arabisch-israelische Angelegenheiten) für Clinton als problematisch erweisen. Schließlich wurden diese zwei erfahrenen außenpolitischen Schwergewichte der Demokraten in der Vergangenheit bereits selbst als potenzielle Außenminister gehandelt und könnten daher versucht sein, unter Umgehung der Außenministerin direkt Einfluss auf die Politikgestaltung im Weißen Haus und den Ministerien zu nehmen. Insbesondere Richard Holbrooke, den gewieften Taktiker und knallharten Verhandlungsführer, sollte die ehemalige First Lady im Auge behalten. So vermochte Clinten angeblich erst in letzter Minute und nach persönlicher Intervention bei Barack Obama zu verhindern, dass Holbrooke ein eigenes Büro im Weißen Haus zugewiesen wurde. Die räumliche Nähe des 67-Jährigen zum Präsidenten hätte sonst die Position der US-Außenministerin von vornherein untergraben. Die Obama-Administration: Ouvertüre zu einem neuen Amerika? 143 Dennoch ließ es sich Holbrooke nicht nehmen, bei der offiziellen Vorstellung der beiden neuen Sonderbeauftragten im State Department vor versammelter Regierungsspitze – d.h. inklusive Präsident Obama und Vize Biden – die US-Außenministerin lediglich als seine „unmittelbare Chefin“ zu bezeichnen. Probleme scheinen vorprogrammiert zu sein. Es ist in diesem Zusammenhang interessant anzumerken, dass Holbrooke US-Medienberichten zufolge neben Afghanistan und Pakistan ursprünglich auch noch für Indien als „Special Representative“ verantwortlich sein sollte. Doch die bevölkerungsreichste Demokratie der Welt (und eine der dynamischsten Wirtschaftsregionen) wollte sich nicht in die gleiche Schublade wie die beiden „failing states“ Afghanistan und Pakistan schieben lassen. Nach energischen Protesten der indischen Regierung hinter den Kulissen ist Holbrooke nunmehr lediglich für Afghanistan und Pakistan zuständig. Die aufstrebende Großmacht Indien, mit der die Bush-Administration in den letzten Jahren eine „wirtschaftlich-strategische Partnerschaft“ aufgebaut hat, spielt bereits in einer anderen Liga. Für den außenpolitischen Wahlkampf-Beraterstab war die Berufung Clintons eine frustrierende Enttäuschung. Gehen doch jetzt viele wichtige Schlüsselpositionen im State Department an alte Clinton-Vertraute, während Obama-nahe Politik-Experten aus Thinktanks, Wissenschaft und Wirtschaft beim Kampf um interessante Jobs das Nachsehen haben. Bereits wenige Tage nach Barack Obamas Wahlsieg wurden die außenpolitischen Beraterstäbe komplett aufgelöst und die betreffenden Personen lapidar gebeten, bei Interesse an einer Tätigkeit innerhalb der neuen Administration ihren Lebenslauf – wie alle anderen Amerikaner auch – auf der Transition-Website www.change.gov einzureichen. Weiterhin wurde ihnen ein enger Maulkorb verpasst: keine Kontakte zu den Medien und keine Kontakte mit ausländischen Politikern und Diplomaten. Angesichts der Tatsache, dass hier Hunderte von hoch qualifizierten Personen über einen Zeitraum von zwei Jahren erhebliche Zeit und Energie in den harten US-Wahlkampf von Barack Obama investiert haben, zumeist neben ihren „normalen“ beruflichen Verpflichtungen, und dabei auch Anfeindungen des Clinton-Teams erdulden mussten, ist die Enttäuschung oftmals riesig. Hier hatten sich viele einen gänzlichst anderen „Change“ versprochen! Abseits all dieser Fragen wird Hillary Clinton zweifelsohne das einflussreichste Mitglied der Obama-Administration werden, ihre politische Statur und ihr weit verzweigtes persönliches Netzwerk kann neben dem Präsidenten keiner aufwiegen. Die formale Nummer Zwei, Vizepräsident Joe Biden, ist kein vergleichbar zentraler Akteur, und dies trotz seiner nahezu gebetsmühlenartig wiederholten Beteuerungen, in alle wichtigen Entscheidungen des Präsidenten involviert zu sein. Bislang hat es viel- 144 Ulf Gartzke mehr den Anschein, dass Biden weder bei wichtigen Personalfragen noch bei inhaltlichen Entscheidungen der Obama-Administration eine signifikante Rolle spielen konnte. Joe Biden bietet folglich einen klaren Bruch zu dem brillanten „Strippenzieher“ und ultimativen Washington-Insider Dick Cheney, den Biden mehrmals als „gefährlichsten“ Vizepräsidenten in der Geschichte der USA bezeichnet hatte. Ungeachtet der Frage, wie man zu Bidens Kritik an seinem Vorgänger steht, war Cheney zweifelsohne der einflussreichste Vizepräsident in der Geschichte der USA. 3.3 Nationaler Sicherheitsberater Jim Jones und Verteidigungsminister Robert Gates Barack Obamas Nationaler Sicherheitsberater ist wohl der einzige hochrangige Mitarbeiter des neuen Präsidenten, der diesen Regierungsposten auch im Falle eines Wahlsiegs von John McCain hätte bekommen können. Den ehemaligen Kommandanten des US-Marinekorps sowie früheren NATO-Oberbefehlshaber in Europa und Afghanistan verbindet eine langjährige Freundschaft mit dem 72-jährigen republikanischen Präsidentschaftskandidaten des Jahres 2008. Doch trotz seiner persönlichen Beziehung zu McCain entschied sich Jones – der über alle Parteigrenzen hinweg für seine Integrität und Professionalität geschätzt wird – schon während der heißen Wahlkampfphase, Barack Obama als sicherheitspolitischer Berater im Hintergrund zur Verfügung zu stehen. Jones gilt als ein Kenner Europas und entschiedener Befürworter der NATO. Er weiß insbesondere um die Bedeutung der europäischen Alliierten bei der Bewältigung der schwierigen Situation in Afghanistan. Auch kennt er die erheblichen innenpolitischen Probleme vieler europäischer Regierungen, die mit einer massiven Ablehnung des aktuellen NATO-Engagements in Afghanistan unter ihrer eigenen Bevölkerung zu kämpfen haben. Ein weiteres Thema, bei dem Jones über erhebliche Expertise verfügt, ist der Bereich Energiepolitik bzw. Energiesicherheit. So war Jones bis zu seinem Wechsel in die Obama-Administration Präsident des „Institute for 21st Century Energy“ bei der US-Handelskammer. Traditionell kommt dem Nationalen Sicherheitsberater und seinem Mitarbeiterstab im National Security Council innerhalb der US-Administration eine wichtige Koordinierungsfunktion zu, insbesondere für die Abstimmung zwischen Weißem Haus, Pentagon und State Department. Die Rolle und Bedeutung des National Security Advisor ist vor allem davon abhängig, dass er/sie das volle Vertrauen des Präsidenten besitzt. Nur so kann er seiner Position im relativen Kräfteverhältnis zu den anderen relevanten Akteuren (vor allem der Außen- und Verteidigungsminister sowie ggf. der Vizepräsident) Gewicht verleihen. Doch selbst ein enges Vertrauensverhältnis zum Präsidenten ist noch keine automatische Erfolgsgaran- Die Obama-Administration: Ouvertüre zu einem neuen Amerika? 145 tie für einen einflussreichen Sicherheitsberater. So sah sich Condoleezza Rice in ihrer Zeit als George W. Bushs erste Nationale Sicherheitsberaterin (2001-2005) weitgehend marginalisiert. Die Planungen für den Irakkrieg wurden beispielsweise maßgeblich von Pentagon-Chef Donald Rumsfeld und Vizepräsident Cheney vorangetrieben. Selbst der populäre damalige Außenminister und Realpolitik-Anhänger Colin Powell zog im internen Machtkampf mit ihnen den Kürzeren. Zum Schluss blieb sowohl Powell als auch Rice nichts anderes übrig, als den Administrationskurs wohl oder übel mitzutragen. Bushs letzter Sicherheitsberater Stephen Hadley war noch schwächer und vermochte während der zweiten Amtszeit von George W. Bush – diesmal dominiert von Verteidigungsminister Robert Gates und Außenministerin Condoleezza Rice – keine eigenen Akzente zu setzen. Alle Anzeichen deuten bislang darauf hin, dass Jim Jones ein tendenziell stärkerer Sicherheitsberater sein wird. Er besitzt umfangreiche militärische Erfahrung, genießt Vertrauen über alle Parteigrenzen hinweg, und mit Robert Gates steht ihm ein Verteidigungsminister auf Abruf gegenüber. Denn auch wenn Barack Obama den bisherigen Pentagon-Chef überreden konnte, vorläufig im Amt zu bleiben, wird dieses Arrangement jedoch spätestens nach Jahresfrist enden. In der Zwischenzeit ist die Beibehaltung von Robert Gates jedoch ein geschickter, stabilisierender Schachzug, der es Obama ermöglicht, jeden Bruch in der US-Verteidigungspolitik zu vermeiden und die geplanten Anpassungen in der amerikanischen Militärstrategie im Irak sowie vor allem in Afghanistan schrittweise und reibungslos vorzunehmen. Gleichzeitig konnte Barack Obama mit dem Festhalten an Gates sein Wahlkampversprechen einlösen, ebenfalls prominente Republikaner in seine neue Administration einzubinden. Robert Gates selbst hatte ursprünglich geplant, seinen Posten am 20. Januar 2009 zu räumen, blieb aber auf Bitten des „President-elect“ im Amt; nicht zuletzt auch aus der Überzeugung, dass Kontinuität an der Pentagon-Spitze zu einer Zeit, in der sich Amerika an mehreren Kriegsschauplätzen engagiert, von großer Bedeutung sei. Wenngleich Gates vorläufig Verteidigungsminister bleibt, werden aber fast alle anderen politischen Beamten der Bush-Administration im Pentagon in den kommenden Wochen und Monaten ihren Hut nehmen müssen. Diesem Kompromiss musste Gates zustimmen. Im Gegenzug wurde ihm von Barack Obama zugesichert, dass während seiner Amtszeit sein geplanter Nachfolger nicht im Pentagon arbeiten würde (z.B. als stellvertretender US-Verteidigungsminister). Verständlicherweise wollte Gates verhindern, dass sein designierter Nachfolger noch während seiner restlichen Amtszeit im Pentagon die Kommando- und Hierarchieebenen durcheinander bringen und sich als de facto Verteidigungsminister etablieren könnte. Just aus diesem Grund wird Richard Danzig, der bereits Barack Obama im Wahlkampf als sicherheitspolitischer Chefberater zur Seite stand, erst nach dem Abgang von Gates ins Pentagon wechseln – direkt an die Spitze. 146 Ulf Gartzke Einigermaßen unbehelligt von diesen Entscheidungen dürfte sich die weitere Entwicklung des US-Verteidigungshaushaltes gestalten. Unter Präsident George W. Bush stiegen die Militärausgaben nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 – nicht zuletzt wegen der sehr teuren Interventionen in Afghanistan und im Irak – rapide an und erreichten zuletzt, inklusive aller Neben- und Nachtragshaushalte, die gigantische Summe von rund 700 Milliarden Dollar pro Jahr. Bereits während des US-Präsidentschaftswahlkampfs wurde eifrig darüber spekuliert, ob nach einem möglichen Wahlsieg von Barack Obama mit einer drastischen Verringerung des Verteidigungshaushaltes zu rechnen sei – nicht nur, um die häufig von Demokraten kritisierte „Militarisierung der US-Außenpolitik“ unter George W. Bush rückgängig zu machen, sondern auch, um die frei werdenden finanziellen Ressourcen für eine expansive Gesundheits- und Sozialpolitik zu verwenden (das altbekannte „Kanonen vs. Butter“ Dilemma). Pentagon-Beobachter gehen indes davon aus, dass zumindest in den kommenden zwei Jahren mit keinen signifikanten Veränderungen im Kernhaushalt des US-Verteidigungsministeriums – d.h. ohne die Kosten laufender Militäroperationen in Afghanistan, Irak etc. – zu rechnen sei. Dies betrifft vor allem die unter der Bush-Administration angelaufenen bzw. geplanten Beschaffungsprogramme für neue Waffen- und Trägersysteme. Obschon das Defense Business Board, ein externes Beratergremium des Pentagon, President-elect Barack Obama bereits im November 2008 angesichts der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise empfohlen hatte, eine Reihe teurer Rüstungsinvestitionen neu zu überdenken und ggf. zu streichen. „Business as usual is no longer an option”, so der Tenor des Briefings. Doch drastische Kürzungen sind in nächster Zeit trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht zu erwarten. Zum einen ist die US-Rüstungslobby sehr einflussreich und kann insbesondere auf dem Capitol Hill auf die Unterstützung mächtiger Senatoren und Kongressabgeordneten beider Parteien zählen. Zum anderen hat Barack Obama gerade Bill Lynn, bislang Chef-Lobbyist beim Rüstungskonzern Raytheon, zum stellvertretenden Verteidigungsminister nominiert. Diese Personalentscheidung Obamas – die eine Ausnahmegenehmigung des Präsidenten für die neuen, strikten Ethik-Richtlinien der Administration erforderte – stieß denn auch im Kongress umgehend auf Kritik. Bislang weisen die Weichen im Pentagon in die bekannte Richtung und weniger nach „Change We Can Believe In”. Bleibt abzuwarten, wie lange angesichts der ökonomischen Krise eine Fortsetzung noch möglich sein wird. In diesem Zusammenhang steht aber bereits heute fest, dass für Barack Obama ein großer Terroranschlag à la 11. September während seiner Amtszeit politisch fatal wäre. Zumal dann, wenn in der amerikanischen Öffentlichkeit der Eindruck entstünde, Obama habe die Sicherheitsinteressen des Lan- Die Obama-Administration: Ouvertüre zu einem neuen Amerika? 147 des aus ökonomischen und ideologischen Gründen grob vernachlässigt (z.B. durch massive Kürzungen im Budget von Pentagon und Homeland Security, durch eine defensivere Anti-Terror Politik etc.). Man mag zur Bush-Administration stehen wie man will: Viele Dinge liefen falsch bzw. nicht so wie vorgesehen. Doch wird der 43. Präsident für sich immer beanspruchen können, mit seiner Regierung einen zweiten Terroranschlag auf amerikanischem Boden für mehr als sieben Jahre verhindert zu haben. Darin wird wohl das bleibende historische Vermächtnis von George W. Bush bestehen. 3.4 Abschließende Bemerkungen Vorliegender Beitrag fokussiert sich auf die außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungsträger und Berater der Obama-Administration, welche die öffentliche Wahrnehmung maßgeblich beeinflussen werden. Wenngleich die Obama-Administration insgesamt gesehen (inklusive des Präsidenten) jünger und diverser ist als die Bush-Administration, gilt für fast alle im vorliegenden Artikel analysierten Personen, dass sie zumeist weißer Hautfarbe und (mitunter deutlich) über 60 Jahre alt sind (Rahm Emmanuel ist 49 Jahre alt). Offenkundig wurde angesichts der großen Herausforderungen ein Generationswechsel in diesen Bereichen noch einmal vertagt. Schon vor der Amtseinführung von Barack Obama stand fest, dass die Bewältigung der größten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression von 1929 seine wichtigste innen- und außenpolitische Herausforderung darstellen wird. Schließlich basieren die außen- und sicherheitspolitischen Kapazitäten eines Landes letztlich auf der Stärke und Dynamik der jeweiligen Volkswirtschaft. Genauso wie z.B. Chinas rasanter wirtschaftlicher Aufstieg zwangsläufig strategisch-militärische Konsequenzen zeitigt (bislang primär in Asien, zukünftig aber auch vermehrt auf globaler Ebene), würde eine dauerhafte Schwächung der amerikanischen Wirtschaft unweigerlich den außen- und sicherheitspolitischen Spielraum Washingtons erheblich einengen. Es sollte Deutschland in diesem Zusammenhang zu denken geben, dass wir 2008 von China als drittgrößte Industrienation der Welt abgelöst wurden. Wenngleich die Berechnungsmethoden und die Zahlenakrobatik der chinesischen Regierung immer mit Fragezeichen zu versehen sind, ist der generelle Trend eines Aufstiegs Asiens und eines (zumindest relativen) Abstiegs Europas nicht von der Hand zu weisen. Selbst die USA sind nicht völlig von den Konsequenzen des auf die westlichen Industrieländer zukommenden „demographischen Winters“ isoliert, wenngleich eine generell höhere Geburtenrate und eine effektivere Einwanderungspolitik Amerika im Vergleich zum „Alten Kontinent“ Europa erhebliche strukturelle Vorteile verschafft. Barack Obama hatte mit seiner 148 Ulf Gartzke Administration ohne Zweifel einen starken Start. Doch Amerika befindet sich im Zustand einer gefährlichen wirtschaftlich-militärischen Überdehnung und muss dringend die Balance zwischen seiner inneren Leistungsfähigkeit und seinen außen- und sicherheitspolitischen Ansprüchen wiederherstellen. An dieser gewaltigen historischen Herausforderung werden sich Präsident Barack Obama und seine Administration letztlich messen lassen müssen. Barack Obama und seine Mitstreiter werden die Vereinigten Staaten nicht neu erfinden, aber ihr Gesicht gravierend verändern. Washingtons Krieg gegen den Terror – Lehren aus den Fehlern der Bush-Administration James W. Davis Der „Krieg gegen den Terrorismus“ – ersonnen als Antwort auf die Anschläge von New York und Washington am 11. September 2001 – war zweifellos das wichtigste außen- und sicherheitspolitische Vermächtnis der Bush-Administration. Nach sieben Jahren – einem Zeitraum also, der das amerikanische Engagement in beiden Weltkriegen des vergangenen Jahrhunderts übersteigt – und nach Kriegsausgaben in Höhe von rund 864 Milliarden US-Dollar,1 verließ George W. Bush sein Amt. Derweil verteidigten 145.000 Soldaten einen hart erkämpften, aber fragilen Sieg über die Aufständischen im Irak, die sich im Zuge der amerikanischen Invasion formiert hatten; weitere 30.000 Mann der US-Truppen bekämpften gemeinsam mit rund 40-50.000 Soldaten der NATO sowie anderer alliierter Staaten wiedererstarkende Taliban in Afghanistan und eine sich neu organisierende Al Qaida im westlichen Pakistan. Doch anstatt zu einer voranschreitenden Demokratisierung im Nahen Osten zu führen, hat der „Krieg gegen den Terror“ autoritären Regimen die Gelegenheit gegeben, unter dem Mantel des Anti-Terror-Kampfes nicht-islamistische, reformorientierte Oppositionsbewegungen zu unterdrücken, während Al Qaida und seine Verbündeten reformistische Führer der islamischen Welt systematisch getötet haben. Und trotz, oder vielleicht gerade wegen, der Präsenz von 200.000 US-Soldaten an seiner Grenze und amerikanischen Kriegsschiffen vor der Küste, strebte im Iran ein fundamentalistisches Regime weiterhin trotzig nach Atomwaffen und unterstützte die Hisbollah im südlichen Libanon mit Geld und Waffen. Ähnlich düster erschien auch die Situation im israelisch-palästinensischen Konflikt. Nachdem Bush den Konflikt für die längste Zeit seiner Administration auf ein Abstellgleis verfrachtet hatte, verließ er sein Amt zu einem Zeitpunkt, da die Spuren des israelischen Luftangriffs auf Gaza kaum beseitigt waren. Zugleich war der Gazastreifen fest in der Hand der Hamas – einer Organisation, die vom amerikanischen Außenministerium als terroristisch eingestuft wird. Fortschritte im Friedensprozess hin zur vielfach beschworenen „Zwei-Staaten-Lösung“ waren während der Amts1 Balasco, Amy: The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror Operations Since 9/11, Washington, DC, Congressional Research Service, 15.10.2008. 150 James W. Davis zeit George W. Bushs nicht zu erkennen.2 Auch die Beziehungen zwischen den USA und ihren traditionellen Alliierten (vor allem in Westeuropa) waren in den vergangenen Jahren erheblich angespannt, während der amerikanische Einfluss in wichtigen internationalen Organisationen dramatisch sank. Insgesamt hat die amerikanische Reputation in der Welt durch den „Krieg gegen den Terror“ einen historischen Tiefstand erreicht: Viele sahen in diesem Krieg nichts anderes als einen Krieg gegen den Islam oder einen Mosaikstein einer umfassenden imperialistischen Agenda. Wieder andere kritisierten den Krieg als einen Angriff auf traditionelle amerikanische Werte, insbesondere die Rechtstaatlichkeit.3 Und für beide Seiten exemplifizierte das Militärgefängnis in Guantanamo geradezu den moralischen Verfall Amerikas. Wenn man jedoch argumentiert, dass der „Krieg gegen den Terror“ sowohl menschlich als auch finanziell verlustreich und für das amerikanische Prestige schädlich war, impliziert dies nicht notwendigerweise, dass er auch ein völliger Misserfolg war. Zur Verteidigung der Bush-Politik sollte man anerkennen, dass kaum ein Sicherheitsexperte im September 2001 geglaubt hat, dass die Vereinigten Staaten in den kommenden sieben oder acht Jahren nicht erneut Ziel eines Terroranschlags werden würden. Doch es ist trotz der strapazierten Beziehungen während des Irakkriegs gelungen, die internationale Kooperation in der Geheimdienstarbeit sowie beim Gesetzesvollzug zu vertiefen und wichtige Erfolge im Antiterrorkampf zu ermöglichen: Im August 2006 etwa konnte dank der engen Zusammenarbeit zwischen pakistanischen, britischen und amerikanischen Sicherheitsbehörden ein Komplott islamistischer Terroristen vereitelt werden, die geplant hatten, zehn Flugzeuge während des Flugs von Großbritannien in die USA zu sprengen. Auch die Aufdeckung der Pläne für ein Bombenattentat auf den Frankfurter Flughafen im September 2007 wurde durch die intensive Kooperation zwischen amerikanischen und deutschen Geheimdienstkräften ermöglicht. Angesichts der globalen Natur der terroristischen Bedrohung reicht ein enger Fokus auf „Homeland Defense“ jedoch nicht aus. Zum einen hat es in der Zeit seit dem 11. September 2001 weltweit mehr islamistische Attentate gegeben als in der Dekade zuvor – darunter die Anschläge auf London (2005) und Madrid (2004). Zum anderen hat auch die Tötung mehrerer Al Qaida-Anführer nichts daran geändert, dass sich Osama bin Laden weiterhin auf freiem Fuß befindet. Zudem überrascht die Terror2 3 Die Auseinandersetzungen zwischen Fatah und Hamas haben allerdings auch deutlich gemacht, dass ein Friedensschluss zwischen Israel und Palästinensern erst möglich sein wird, wenn es zu einer Aussöhnung der Palästinenser untereinander kommt. Vgl. die jährlichen Berichte des Pew Global Attitudes Project, Pew Research Center, Washington, DC. Washingtons Krieg gegen den Terror 151 organisation geradezu mit der Fähigkeit, sich immer wieder an das sich ändernde strategische Umfeld anzupassen, so dass Experten mittlerweile argumentieren, Al Qaida ähnele heute eher einer sozialen Bewegung als einer zentral kontrollierten terroristischen Vereinigung.4 Wie erfolgreich war also der Antiterrorkampf? Der frühere Verteidigungsminister Donald Rumsfeld brachte diese Frage in einem Memo an hochrangige Mitarbeiter auf den Punkt, indem er folgenden Maßstab vorschlug: „Are we capturing, killing or deterring and dissuading more terrorists every day than the madrassas and the radical clerics are recruiting, training and deploying against us?“5 Rumsfelds Frage ist ebenso wichtig wie ironisch, denn sie zeigt die gravierendste Schwäche des – maßgeblich von ihm selbst mitentwickelten – Antiterrorkriegs auf: Die Bush-Administration ist gescheitert, weil sie nicht verstanden hat, dass das Ziel des Antiterrorkriegs nicht allein darin bestehen kann, eine bestimmte Zahl von Terroristen festzunehmen oder zu töten oder die Kontrolle über ein bestimmtes Gebiet herzustellen, auch wenn kaum bestritten werden kann, dass solche taktischen Maßnahmen nützlich sind. Der Schlüssel zu einem langfristigen Erfolg in der Auseinandersetzung mit dem islamischen Terror liegt darin, den Kampf um Ideen zu gewinnen. Oder, wie es ein enger Berater von Präsident Obama ausdrückte: „[The Bush Administration] misdiagnosed the most important origins of the problem, put too much faith in military force and tough talk, needlessly alienated friends and allies, and neglected the important ideological aspects of the struggle.“6 1. Die Gefahr der Vereinfachung In ihrem Bemühen, die Anziehungskraft des radikalen Islam zu verstehen, hat die Bush-Administration vielfach den Fehler begangen, sich auf grob vereinfachte, oft monokausale Erklärungen zu verlassen. Solch simplifizierende Analysen haben wiederum zu kruden Strategien geführt, die sich, nicht zuletzt wegen ihrer Beschränkung auf militärische Instrumente nationaler Machtausübung, häufig als kontraproduktiv erwiesen haben. Ein besonders augenscheinliches Beispiel für solch eine vereinfachte Betrachtungsweise liefert die von der Bush-Regierung wiederholt vorge4 5 6 Vgl. Leheny, David: Terrorism, Social Movements and International Security: How Al Qaeda Affects Southeast Asia, in: Japanese Journal of Political Science 6/2005, S.87-109; Sageman, Marc: Understanding Terror Networks, Phildelphia 2004; Sageman, Marc: Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twentyfirst Century, Philadelphia 2008; Hoffman, Bruce: The Myth of Grassroots Terrorism. Why Osama bin Laden Still Matters, in: Foreign Affairs, Mai/Juni 2008. Moniz, David/Squitieri, Tom: Defense Memo: A Grim Outlook, in: USA Today, 22.10.2003. Gordon, Philip H.: Winning the Right War, in: Survival 49/2007, S.14-46. 152 James W. Davis tragene Behauptung, dass die Terroristen uns angriffen, da sie die Freiheit verabscheuten. Als dieses Argument erstmals kurz nach den Anschlägen vom 11. September vorgebracht wurde, konnte man noch entschuldigend einwenden, dass die Aussagen der besonderen Stresssituation geschuldet waren und der Präsident noch nicht die Gelegenheit gehabt hatte, die Ereignisse mit seinen Beratern zu besprechen. Fünf Jahre später konnte diese Entschuldigung jedoch nicht mehr gelten. Bush wiederholte seine These dennoch und ignorierte damit eine Vielzahl exzellenter Studien und ausgewogener Analysen, die in der Zwischenzeit auch von staatlichen Institutionen produziert worden waren: „Iraq is not the reason the terrorists are at war against us. They are at war against us because they hate everything America stands for – and we stand for freedom. We stand for people to worship freely. One of the great things about America is, you‘re equally American if you‘re a Jew, a Muslim, a Christian, an agnostic or an atheist. What a powerful statement to the world about the compassion of the American people that you‘re free to choose the religion you want in our country. They can‘t stand the thought that people can go into the public square in America and express their differences with government. They can‘t stand the thought that the people get to decide the future of our country by voting. Freedom bothers them because their ideology is the opposite of liberty, it is the opposite of freedom. And they don‘t like it because we know they know we stand in their way of their ambitions in the Middle East, their ambitions to spread their hateful ideology as a caliphate from Spain to Indonesia.”7 Bereits an anderer Stelle wurde darauf hingewiesen, dass diese Aussage zutiefst widersprüchlich ist.8 Denn einerseits wird behauptet, dass Terroristen motiviert seien durch ihren Hass auf die Freiheit; andererseits heißt es, dass der Mangel an Freiheit die Menschen im Nahen Osten dazu veranlasse, die Terroristen zu unterstützen. Doch beklagenswert ist nicht allein dieser Widerspruch, sondern vor allem die kontraproduktive Strategie, die aus der Verbindung solch simplifizierter, oberflächlicher Betrachtungsweisen resultierte. Denn wenn Politiker davon überzeugt sind, dass Terroristen uns für das hassen, was wir sind und nicht für das, was wir tun, dann machen sie sich wahrscheinlich wenige Gedanken darüber, welche Auswirkungen ihre Strategien im Kampf gegen den Terror für diejenigen Gemeinschaften und Gesellschaften haben, aus denen die Terroristen stammen. Und wenn fehlende Demokratie die Ursache des Terrors ist – ist dann nicht Demokratie die Antwort? 7 8 President Bush Discusses Global War on Terror, Wardman Park Marriott Hotel, Washington DC, 29.9.2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060929-3.html Gordon: Winning the Right War, S.19. Washingtons Krieg gegen den Terror 153 In gewisser Hinsicht hatte Bush natürlich Recht, als er erklärte, der Irak sei nicht der Grund, warum sich die Terroristen mit uns im Krieg befänden. Aber natürlich verfehlt diese Aussage den Kern des Problems. Die überwiegende Mehrheit der Forschung zu den Ursachen des Terrorismus verweist auf ein komplexes Netz aus individuellen Gruppen- und Gesellschaftsdynamiken. Subjektive Klagen über historisches Unrecht, fehlenden Respekt und erlittene Demütigungen geben diesen Dynamiken immer wieder neue Nahrung. Für den „Krieg gegen den Terror“ war der Irakkrieg insofern kontraproduktiv, als er nicht nur die weit verbreitete Feindseligkeit gegenüber den USA anstachelte, sondern auch dem unter radikalen Islamisten im Nahen und Mittleren Osten verbreiteten Argument Auftrieb gab, wonach Amerika einen Krieg gegen den Islam führe. Darüber hinaus hat das wenig fundierte Demokratieverständnis, das Demokratie schlicht mit Wahlen gleichsetzt, aber die Notwendigkeit etablierter, repräsentativer politischer Parteien außer Acht lässt, im Irak zu einem äußerst fragilen Resultat geführt, das gegenüber der konfessionellen Gewalt schon bald nicht mehr standhalten konnte und beinahe in einen totalen Bürgerkrieg ausgeartet wäre.9 Dabei kann natürlich kein Zweifel daran bestehen, dass die Förderung der Demokratie ein erstrebenswertes Ziel ist – nicht zuletzt, weil stabile Demokratien langfristig notwendig sind, um der Herausforderung durch den islamischen Terrorismus zu begegnen. Doch während wir in fest verankerten Demokratien jene Aspekte verwirklicht sehen, die wir auch in der islamischen Welt und in den internationalen Beziehungen insgesamt fördern wollen, müssen wir beachten, dass schwach institutionalisierte Demokratien sowohl in ihrem Inneren, als auch im Verhältnis zu anderen Staaten dazu neigen, ihre politischen Ziele gewaltsam zu verfolgen. Staaten, die erst am Anfang ihrer Demokratisierung stehen, sind besonders anfällig für kriegerische Auseinandersetzungen. Eine wichtige Studie, die Daten aus den vergangenen zwei Jahrhunderten untersucht hat, belegt: Länder, die Wahlen durchgeführt haben, ohne über die notwendigen Institutionen zur friedlichen Austragung des politischen Wettbewerbs zu verfügen, sind viermal so anfällig, in Kriege verstrickt zu werden. So ist etwa Jugoslawien 1991 in einem Bürgerkrieg versunken, sechs Monate nach entscheidenden Wahlen; die gewählten Regierungen Pakistans und Indiens standen sich 1999 im Kargil-Krieg gegenüber; und Kriege zwischen Armenien und Aserbaidschan, Peru und Ecuador, Russland und Tschetschenien sowie Äthiopien und Eritrea folgten ebenfalls demokratischen Experimenten in den 1990ern. Zu tödlichen Gewaltausbrüchen kam es auch in Burundi nach den international mandatierten Wahlen im Jahr 1993 sowie in Ost9 National Intelligence Estimate. Prospects for Iraq‘s Stability: A Challenging Road Ahead, Washington, DC, National Intelligence Council, Januar 2007; Katzman, Kenneth: Iraq: Politics, Elections, Benchmarks, Washington, DC, Congressional Research Service, November 2008. 154 James W. Davis timor nach dem Unabhängigkeitsreferendum 1999.10 Wiederum ist die Frage aber offenkundig, nicht, ob man überhaupt Demokratie fördern soll, sondern, wie man es in einer verantwortungsvollen und erfolgversprechenden Weise tun kann. Eine Anti-Terror-Strategie, die diese Komplexität nicht zur Kenntnis nimmt, wird kaum die gewünschten Erfolge produzieren, sondern stattdessen womöglich sogar zu jenen Ergebnissen führen, die wir eigentlich vermeiden wollen. Welche Gefahren eine vereinfachende Analyse mit sich bringt, zeigte sich jedoch nicht nur in den fehlerhaften Erklärungen der Ursachen des Terrorismus. Auch die von der Bush-Administration vorgetragene Einschätzung der Auswirkungen des Terrors wurde der Komplexität der Zusammenhänge nicht gerecht. Als etwa im Sommer 2006 die Hisbollah aus dem südlichen Libanon israelische Streitkräfte angriff und dabei zwei israelische Soldaten verschleppte und acht weitere tötete, bezeichnete George W. Bush den Konflikt als eine weitere Front im globalen Antiterror-Kampf, obwohl die Hisbollah eine radikalisierte Gruppierung innerhalb des schiitischen Islam darstellt und ganz andere Ziele verfolgt als die vom Wahabismus inspirierte sunnitische Al Qaida.11 Doch die Mängel dieser Rhetorik beschränken sich nicht allein auf die schwachen analytischen Grundlagen, sondern sie verschließen auch den Blick dafür, dass Differenzen und Risse innerhalb des Islam eine Gelegenheit darstellen könnten, die politischen Ambitionen der Radikalen zu bekämpfen, den regionalen Machtansprüchen einiger Akteure entgegenzuarbeiten und gezielt Gruppen gegeneinander auszuspielen. Noch schwerer wiegt zudem, dass diese Rhetorik – und das damit einhergehende Zusammenwerfen schiitischer und sunnitischer Gruppen in ein vermeintlich monolithisches Ganzes – den Eindruck verstärken, dass die USA und ihre Verbündeten tatsächlich den Islam als solches als Feind betrachten. Dies wiederum motiviert diejenigen Gruppen, die eigentlich untereinander um Einfluss in der islamischen Welt konkurrieren würden, nun stattdessen taktische Allianzen gegen den gemeinsamen Gegner – die USA, ihre Alliierten und deren weltweite Interessen – einzugehen. Neben dieser fehlenden Sensibilität für Differenzen innerhalb des Islam zeigte sich die Bush-Regierung selbst auf den höchsten Ebenen erschrekkend ignorant gegenüber wichtigen ethnischen und nationalen Rivalitäten in denjenigen Regionen der Welt, die für die Rekrutierung radikaler Islamisten besonders wichtig waren. Auch die Auswirkungen des „Krieges gegen den Terror“ auf die regionalen Machtverhältnisse wurden von der amerikanischen Administration häufig nur unzureichend bedacht: Ob10 11 Mansfield, Edward D./Snyder, Jack L.: Electing to Fight. Why Emerging Democracies go to War, Cambridge 2005. President Discusses Foreign Policy During Visit to State Department, 14.8.2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/08/20060814-3.html Washingtons Krieg gegen den Terror 155 wohl es recht vorhersehbar war, erkannte man erst spät, dass der Iran der regionale Hauptnutznießer einer jeden Strategie sein würde, die darauf abzielt, sowohl Saddam Hussein (Irans arabischen Gegenspieler) als auch die Taliban (einen zentralen ideologischen Gegner) zu zerstören. Und in Afghanistan schien die Bush-Administration nicht zu realisieren, dass die pakistanische Unterstützung der Taliban Teil einer größeren Strategie des Geheimdiensts (ISI) war und darauf abzielte, den paschtunischen Nationalismus und damit einhergehende Machtambitionen zu bekämpfen, um die eigenen Truppen in Kaschmir konzentrieren zu können. Der Verweis auf diese innerislamischen Unterschiede und auf die Risse innerhalb jener Regionen, die gemeinhin mit dem „Krieg gegen den Terror“ in Verbindung gebracht werden, erinnert uns einmal mehr daran, dass eine Strategie zur Terrorismusbekämpfung nicht unabhängig von einer umfassenderen außenpolitischen Agenda entwickelt werden kann, welche sich sensibel mit den geopolitischen Realitäten auseinandersetzt. Doch anstatt den „Krieg gegen den Terror“ in einen größeren geopolitischen Rahmen einzuordnen, hat die Bush-Administration gerade die Außenpolitik selbst diesem Krieg untergeordnet. Das Ergebnis war eine Deformation des politischen Prozesses und des politischen Gefüges, eine Schieflage bei den Investitionen ohnehin knapper menschlicher und materieller Ressourcen, ein mangelhaftes Verständnis und ein unzureichender Einsatz des gesamten Instrumentariums zur Verfügung stehender nationaler Machtmittel und ein grundsätzliches Versagen bei der Definition eines umfassenden politischen Ziels, das der US-Politik vorangestellt werden könnte. 2. Vernachlässigung nicht-militärischer Instrumente So war der „Krieg gegen den Terror“ gleichzeitig zu weit und zu eng. Zu weit war er insofern, als die Bush-Administration eine Vielzahl von außenpolitischen Entscheidungen mit dem Antiterror-Kampf vermischt hat – den Sieg gegen die Taliban in Afghanistan, die Bekämpfung des iranischen Atomprogramms sowie des iranischen Machtstrebens in der Region, die Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts, die Förderung von Entwicklung und Demokratie usw. Zu eng gefasst war der Krieg, weil die Nützlichkeit militärischer Instrumente gegenüber anderen Instrumenten der nationalen Machtausübung überschätzt wurde, mit negativen Folgen für die Innen- und Außenpolitik. Diese Betonung der militärischen Instrumente war jedoch von Beginn an sichtbar; die strategischen Grundzüge wurden bereits im September 2002 in der Nationalen Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Darin wird insbesondere die Antizipation und Verhinderung terroristischer Attacken gefordert 156 James W. Davis oder, wie es Präsident Bush in einer Reihe von Reden immer wieder formuliert hat: „We will confront them overseas so that we do not have to confront them here at home.“12 Angesichts der von der Bush-Administration frühzeitig geäußerten Abneigung gegenüber „Nation-Building“ mag es dementsprechend kaum überraschen, dass sich in diesem Dokument wenig finden lässt über die Notwendigkeit, Kapazitäten und staatliche Strukturen in schwachen Staaten oder Post-Konflikt-Situationen zu stärken. Stattdessen hat man sich intensiv mit einer möglichen Verbindung zwischen „rogue states“ und Massenvernichtungswaffen beschäftigt. Am offenkundigsten werden die Möglichkeiten und Grenzen des militärischen Anti-Terror-Kampfes in Afghanistan. Zwar haben die amerikanischen und britischen Einheiten, unterstützt durch Kämpfer der Nordallianz, im Herbst 2001 mit großem Erfolg die Trainingscamps von Al Qaida zerstört und die Taliban vertrieben.13 Doch in den darauffolgenden Jahren ist es Al Qaida und den Taliban besser gelungen, sich im sogenannten „Stammesgebiet unter Bundesverwaltung“ (FATA) im westlichen Pakistan neu zu organisieren, während die internationale Gemeinschaft bekanntermaßen weniger erfolgreich darin war, einen gut funktionierenden afghanischen Staat aufzubauen. Einer Studie der Brookings Institution zufolge ist Afghanistan heute der zweitschwächste Staat der Welt, die Gesamtsituation in Afghanistan wird schlechter eingeschätzt als die im Irak. Darüber hinaus gilt das Land am Hindukusch der gleichen Studie zufolge als das weltweit unsicherste. Auch in Bezug auf das staatliche Sozialwesen beurteilt Brookings die Lage in Afghanistan als katastrophal. Aufgrund der hohen Kindersterblichkeit, dem mangelhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen sowie einer nur geringen Zahl von Primarschulabsolventen schneidet Afghanistan auch in dieser Kategorie schlechter ab als jedes andere Land der Welt.14 Auch wenn die Rhetorik eine andere war, hat die Bush-Regierung doch zu keinem Zeitpunkt annähernd ausreichende Mittel bereitgestellt, um einen funktionierenden Staat aufzubauen. Afghanistan hat pro Kopf wesentlich weniger Hilfe erhalten als andere Post-Konflikt-Staaten wie Bosnien, Kosovo oder Haiti. Nach Einschätzung eines afghanischen Experten war die Differenz gravierend: „Aid per capita to Afghans in the first two years after the fall 12 13 14 President Bush, George W.: Remarks at Oak Ridge National Laboratory, 12.7.2004, http://www.cfr.org/publication/7178/remarks_at_oak_ridge_national_laboratory.html Für Analysen der US-Strategie in Afghanistan siehe Andres, Richard B./Wills, Craig/Griffith, Thomas Jr.: Winning with Allies: The Strategic Value of the Afghan Model, in: International Security 30/2005, S.124-160; Biddle, Stephen D.: Allies, Airpower, and Modern Warfare: The Afghan Model in Afghanistan and Iraq, in: International Security 30/2005, S.161-176. Brookings Institution, Index of State Weakness in the Developing World, http://www.brookings.edu/reports/2008/~/media/Files/rc/reports/2008/02_ weak_states_index/02_weak_states_index_basket_scores_pullout.pdf Washingtons Krieg gegen den Terror 157 of the Taliban was around a tenth of that given to Bosnians following the end of the Balkan civil war in the mid-1990s.“15 In der afghanischen Bevölkerung wächst gleichzeitig der Unmut darüber, dass es der Regierung Präsident Karzais weder gelungen ist, die eigene Autorität, noch den öffentlichen Dienst über das ganze Land hinweg auszudehnen und für eine spürbare Verbesserung der Lebensumstände zu sorgen.16 Infolge dessen kam es zu einem Wiedererstarken von Taliban und Al Qaida – nicht weil diese militärisch besonders mächtig sind, sondern weil die afghanische Regierung weiterhin zu schwach ist, um ihnen Einhalt zu gebieten.17 Die Vernachlässigung nicht-militärischer Machtinstrumente bei den amerikanischen Auslandsoperationen spiegelt zudem ein innenpolitisch-bürokratisches Ungleichgewicht wider: Nach den Anschlägen vom 11. September ist das Budget des Verteidigungsministeriums effektiv um rund 60% gestiegen und belief sich für das Jahr 2008 auf mehr als 500 Milliarden Dollar. Und obwohl auch das Budget des Außenministeriums nach dem 11. September gestiegen ist – die Einschnitte, die seit dem Ende des Kalten Krieges gemacht worden waren, wurden zurückgenommen und weitere Mittel bereitgestellt – bleiben die Ressourcen und das verfügbare Personal für eine „Soft Power“-Politik in beklagenswertem Maße unzureichend. So blieb etwa die Zahl der amerikanischen Diplomaten mehr oder weniger konstant, selbst nachdem Außenministerin Rice erklärt hatte, dass mehr außenpolitische Missionen notwendig seien, um die gesteckten Ziele der „transformativen Diplomatie“ erreichen zu können.18 Doch während die US-Behörde für Internationale Entwicklung zu Zeiten des Vietnamkriegs noch 15.000 Mitarbeiter beschäftigte, sind es heute nur noch 3.000. Das Schicksal der wichtigsten amerikanischen Einrichtung für „Public Diplomacy“ ist noch dramatischer: Die United States Information Agency, die einmal über ein Budget in Höhe von einer Milliarde Dollar verfügte, mehrere 10.000 Mitarbeiter (darunter viele Nicht-Amerikaner) beschäftigte und Informations- und Kulturzentren auf der ganzen Welt unterhielt, wurde 1999 „abgewickelt“. Nach den Anschlägen auf New York und Washington gab es deshalb keine staatliche Institution, die allein zuständig gewesen wäre, den Kampf um Ideen aufzunehmen – mit dem Ergebnis, dass sich schließlich keine Behörde zuständig fühlte. 15 16 17 18 Wadhams, Caroline P./Lawrence J. Korb: The Forgotton Front, Washington, DC 2007, S.29. Jones, James L./Pickering, Thomas R.: Afghanistan Study Group Report, Washington, DC Januar 2008, S.17. Strategic Advisors Group: Saving Afghanistan: An Appeal and Plan for Urgent Action, Washington, DC März 2008. „Transformational Diplomacy“, Remarks of Secretary of State Condoleezza Rice at Georgetown University, 18.1.2006, http://www.state.gov/secretary/ rm/2006/59306.htm 158 James W. Davis Die Notwendigkeit einer besseren Zusammenarbeit mit zivilen Akteuren und einer effizienteren öffentlichen Diplomatie im Kampf um Ideen hat auch Verteidigungsminister Robert Gates erkannt. Er plädierte unlängst für eine drastische Ausweitung der „civilian elements of the United States´ national security apparatus“19. 3. Implikationen für die neue Administration Welche Folgerungen sich aus der vorangegangenen Analyse für die Obama-Administration ergeben, sind offensichtlich und, wie ich glaube, vom Präsidenten und seinen Beratern weithin verstanden. Erstens: Der „Krieg gegen den Terror“ muss einer umfassenden außenpolitischen Agenda untergeordnet werden, einer Agenda, die nicht allein definiert, was Amerika verhindern will, sondern die ebenso eine Reihe positiver Ziele umfasst und das Potenzial hat, auch in der islamischen Welt Anziehungskraft zu entfalten. Die Vereinigten Staaten und ihre Alliierten müssen eine Zukunftsvision aufzeigen, welche all jene anspricht, die den gewaltsamen Extremismus ablehnen und gleichzeitig nach besseren Möglichkeiten streben, um selbstbestimmt zu leben. Aber, um es in den Worten Präsident Obamas zu sagen, das erfordert „more than lectures on democracy. We need to deepen our knowledge of the circumstances and beliefs that underpin extremism“20. Zweitens: Auch wenn militärische Instrumente und der Einsatz möglicherweise todbringender Gewalt weiterhin eine Rolle im Antiterrorkampf spielen werden, so müssen diese Mittel doch ergänzt und ausbalanciert werden durch nicht-militärische Instrumente, die auf einem komplexeren Verständnis der vielfältigen historischen, politischen und sozialen Ursachen des Terrorismus beruhen. Ein wirklich weit gespannter, alle staatlichen Institutionen umfassender Ansatz wird eine bessere Koordination zwischen den Ministerien sowie eine Anhebung der Budgets der zivilen Ministerien erfordern. Ein wirklich mutiger – wenngleich innenpolitisch riskanter – Schritt wäre zudem, die generelle Frage aufzuwerfen, ob unsere Außen- und Sicherheitsbürokratie überhaupt angemessen konzipiert ist, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Abgesehen von kleineren Korrekturen nach den Attacken vom 11. September ist die Bürokratie, die Präsident Obama von seinem Amtsvorgänger übernimmt, ein Apparat, der gestaltet worden ist, um den Anforderungen des Kalten Kriegs gerecht zu werden. Doch in einer Zeit, in der die Grenzen 19 20 Gates, Robert M.: A Balanced Strategy: Programming the Pentagon for a New Age, in: Foreign Affairs 88/2009. Obama, Barack: Renewing American Leadership, in: Foreign Affairs 86/2007, S.11. Washingtons Krieg gegen den Terror 159 zwischen zivilen und militärischen Missionen einerseits sowie zwischen innerer und äußerer Sicherheit andererseits immer mehr verschwimmen, ist die Bereitschaft, unkonventionell zu denken, eine zentrale Voraussetzung für institutionelle Innovation. Drittens: Washington benötigt eine nuanciertere Strategie, um mit den regionalen geopolitischen Komplexitäten im Antiterrorkampf zurechtzukommen. In seiner Zeit als Präsidentschaftskandidat schien Barack Obama dies verstanden zu haben, schrieb er doch in seinem Beitrag für Foreign Affairs: „I will encourage dialogue between Pakistan and India to work toward resolving their dispute over Kashmir and between Afghanistan and Pakistan to resolve their historic differences and develop the Pashtun border region. If Pakistan can look toward the east with greater confidence, it will be less likely to believe that its interests are best advanced through cooperation with the Taliban.”21 4. Implikationen für die transatlantischen Beziehungen Die weit verbreitete europäische Ablehnung der Bush-Doktrin (in welcher argumentiert wurde, die USA hätten das Recht, unilateral zu handeln, um terroristischen Angriffen zuvorzukommen) sowie die Entscheidung der USA, in den Irak einzumarschieren, haben die transatlantischen Beziehungen in die tiefste Krise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gestürzt. Vielfach wurde prophezeit, dass die Krise gar einen Wendepunkt darstelle, der die Natur der amerikanisch-europäischen Partnerschaft für immer verändern werde, nicht zuletzt weil Europa zukünftig in zentralen Fragen der internationalen Sicherheit nicht mehr automatisch auf die Führungsrolle der USA verweisen werde. Doch obwohl vieles für eine solche Lesart spricht, basieren solche Argumente doch auf einer gravierenden Schwäche: Sie überbewerten einerseits das Maß an Harmonie, das die transatlantischen Beziehungen während der vergangenen 50 Jahre vermeintlich geprägt hat. Und andererseits überbewerten sie auch den Bruch, der sich in den letzten Jahren aufgetan haben soll. Abseits der rhetorischen Exzesse eines Präsidenten Bush oder eines Kanzlers Schröder sind die Arbeitsbeziehungen zwischen Amerikanern und ihren europäischen Kollegen heute jedoch in vielerlei Hinsicht intensiver und produktiver als während des Kalten Krieges. Und es gibt keinen Anlass zu befürchten, dass sich diese Formen der engen Kooperation und Koordination unter einer neuen Administration verschlechtern werden. 21 Obama: Renewing American Leadership, S.10. 160 James W. Davis Wenn sich aber die Obama-Administration entscheiden sollte, in der zuvor skizzierten Art voranzuschreiten und den „Krieg gegen den Terror“ einer breiteren Strategie zur fundamentalen Transformation der Beziehungen zwischen dem Westen und den islamischen Gesellschaften unterzuordnen, dann wird eine enge Zusammenarbeit allein auf der Ebene der Arbeitsbeziehungen in Zukunft nicht mehr ausreichen. Europa und die USA müssen sich einig sein, sie müssen die gleichen positiven Signale aussenden und gemeinsam daran arbeiten, den Krieg der Ideen erfolgreich zu bewältigen. Denn wie sonst wollen wir andere davon überzeugen, dass unsere Zukunftsvision erstrebenswert ist, wenn wir untereinander vielstimmig weiter streiten? Zudem hat die gegenwärtige Finanzkrise allen Budgets erhebliche Zwänge auferlegt, so dass nur eine vertiefte Kooperation auf den höchsten Regierungsebenen dabei helfen kann, die knappen Mittel effektiv für einen umfassenden Ansatz einzusetzen. Der von der Bush-Administration geführte „Krieg gegen den Terror“ war geprägt von vielen Fehlern, aus denen sowohl Amerikaner als auch Europäer heute lernen müssen. In anderen Dingen lag die Regierung um George W. Bush jedoch richtig, etwa in der Überzeugung, dass der Kampf gegen den islamistischen Extremismus die Herausforderung für eine ganze Generation sein würde. Daraus folgt, dass Amerikaner und Europäer mit Ausdauer und Geduld an der Umsetzung einer verbesserten Strategie arbeiten müssen. Wenn sie dabei erfolgreich sind, werden sich mehr und mehr Muslime gegen die Extremisten in ihren eigenen Gesellschaften wenden und den Terror als ein legitimes Mittel des politischen Widerstands ablehnen. Erst dann werden wir die Antwort geben können, auf die Rumsfeld gewartet hat. USA, Multilateralismus und internationale Organisationen Das Spannungsfeld der Mandatierung internationaler Zwangsgewalt Johannes Varwick 1. Wandel als Programm – auch in der Außenpolitik? Barack Obama wurde mit dem Versprechen eines grundlegenden Wandels in allen Politikbereichen zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt. Im Bereich der Außenpolitik – der sicher nicht wahlentscheidend war – dürfte dieser Wandel jedoch insgesamt weniger radikal ausfallen, als dies diejenigen, die seinem Vorgänger „eine der schlechtesten außenpolitischen Leistungsbilanzen aller US-Präsidenten“1 bescheinigen, erwarten. Denn erstens war bereits in der zweiten Amtszeit von George W. Bush eine Veränderung des stark unilateralistisch geprägten Stils zu verzeichnen, der sich auch im Rückzug neokonservativer Schlüsselakteure wie Wolfowitz, Bolton oder Rumsfeld zeigte. Zweitens sind aufgrund der Zwänge des politischen Systems der USA radikale Veränderungen in der Außenpolitik unwahrscheinlich und drittens steht die neue außenpolitische Mannschaft Obamas mit Außenministerin Hillary Clinton, dem alten und neuen Verteidigungsminister Robert Gates und Sicherheitsberater James Jones an der Spitze nicht für einen vollkommen neuen Ansatz in der Außenpolitik. Anderseits sind die Herausforderungen, vor denen der neue Präsident im Bereich der Außenpolitik steht, enorm: Es handelt sich, wie es Richard Holbrooke formulierte, um „eine Respekt einflößende Agenda“.2 Ein Blick auf die angekündigte außenpolitische Prioritätenliste der neuen Administration lässt in der Substanz auf ein gehöriges Maß an Kontinuität schließen. 1 2 Amerikanische Außenpolitik unter Bush: Bilanz und Ausblick, CSS Analysen zur Sicherheitspolitik, Zürich 2008. Als eine der wenigen Beispiele für eine insgesamt positive außenpolitische Bilanz der Bush-Zeit siehe Gaddis, John Lewis: Das Ende der Tyrannei, in: Internationale Politik 1/2009, S.70-82. Hoolbroke, Richard: The Next President. Mastering a Daunting Agenda, in: Foreign Affairs, September/Oktober 2008. Alle englischsprachigen Aussagen im gesamten Beitrag sind vom Verfasser aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Textes ins Deutsche übersetzt worden. 162 Johannes Varwick Barack Obama3 selbst nennt als sicherheitspolitische Herausforderungen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, globalen Terrorismus, Schurkenstaaten (rogue states), schwache Staaten (weak states) sowie aufstrebende Staaten, die die internationale liberale Ordnung herausfordern. Er bewegt sich damit hinsichtlich der Problemwahrnehmung durchaus in Tradition der Sicherheitsstrategien der Bush-Administration. Wichtigste inhaltliche Veränderung ist, dass das Thema Klimaveränderung und globale Erderwärmung als gleichwertige sicherheitspolitische Herausforderung zu den genannten Gefahren gesehen wird und in diesem Bereich erhebliches amerikanisches Umsteuern angekündigt wird. Obama erklärte zudem bei zahlreichen Gelegenheiten, dass er die amerikanische Führungsrolle erneuern, internationale Organisationen reformieren sowie die amerikanischen Allianzen und Partnerschaften stärken wolle.4 In jedem Fall lässt sich Obama einer außenpolitischen Schule zurechnen, die in den USA den Garanten der internationalen Stabilität sieht und in der die USA die Rolle eines „sanften“ oder „wohlmeinenden Hegemons“ einnehmen müssten.5 Der Versuchung, nach den Lasten des Irak-Krieges nach innen zu schauen, müssten die USA dezidiert widerstehen. Der „amerikanische Moment“ sei nicht vorbei, müsse aber neu begriffen werden.6 Unabhängig von der Einschätzung, wie viel Wandel es im Zuge der neuen Administration im Bereich der Außenpolitik geben wird, steht Obama für einen Aufbruch, der auch die Außenpolitik berühren wird. Ob daraus ein neues Verhältnis der USA zu internationalen Organisationen und zum Multilateralismus abgeleitet werden kann, soll im Folgenden analysiert werden. Hinsichtlich der Frage der Legitimierung militärischer Gewalt wird festgehalten, dass das allgemeine Gewaltverbot und die Regelungen zur friedlichen Streitbeilegung sowie das in der völkerrechtlichen Idealwelt bestehende Gewaltlegitimierungsmonopol des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zwar in der politischen Praxis permanent unter Druck sind, jedoch weder normativ noch politikpraktisch eine bessere Alternative in Sicht ist. Gleichwohl ist multilaterale Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen oft mühsam, ineffektiv und zeitraubend. Einerseits ist bei bestimmten Problemkonstellationen unstrittig, dass nur ein multilateraler Ansatz erfolgversprechend sein kann. Anderseits sind 3 4 5 6 Als programmatischen Beitrag vor seiner Wahl zum Präsidenten Obama, Barack: Renewing American Leadership, in: Foreign Affairs, Juli/August 2007, S.2-16. Die Aussagen im Wahlprogramm und in verschiedenen programmatischen Reden im Internet, http://origin.barackobama.com/issues/foreign_policy, Stand: 5.12.2008. Vgl. Rudolf, Peter: Amerikas neuer globaler Führungsanspruch, in: SWP-Aktuell 77/2008; Krause, Joachim: Liberaler Imperialismus und imperialer Liberalismus als Erklärungsansätze amerikanischer Außenpolitik, in: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik 1/2008, S.68-95. Obama: Renewing American Leadership. USA, Mulilateralismus und internationale Organisationen 163 andere Problemkonstellationen offensichtlich multilateral nicht immer effektiv zu bearbeiten. Hier ist zu erwarten, dass die neue amerikanische Administration jenseits von „wishful thinking“ eine nüchterne Bestandsaufnahme vornimmt und die VN nicht überfordert oder gar von ihr Leistungen verlangt, die sie nicht erbringen kann. Sicherheitspolitischer Multilateralismus ist zudem kein Wert an sich, sondern nur dann sinnvoll, wenn damit im Sinne eines effektiven Multilateralismus Beiträge zur Problemlösung geleistet werden. Ein „VN-Legalismus“ ist also ebenso wenig zu erwarten, wie sich die USA in allen Fällen von der Handlungsbereitschaft des VN-Sicherheitsrats abhängig machen werden. 2. Sichtweisen internationaler Organisationen Die Beurteilung der Frage, welche Chancen internationale Organisationen und ein multilateraler Politikstil haben und wie sich nationale Außenpolitiken dazu verhalten können und sollen, hängt auch von grundsätzlichen Einschätzungen über die Handlungsmöglichkeiten von internationalen Organisationen ab, die in Politik und Wissenschaft je nach normativem Standpunkt durchaus variieren. Zugespitzt formuliert ergibt sich eine dreifache funktionale Differenzierungsmöglichkeit. Die erste Sichtweise sieht in internationalen Organisationen vornehmlich „Instrumente staatlicher Diplomatie“, d.h. Staaten instrumentalisieren internationale Organisationen, um ihre eigenen Interessen mit deren Hilfe in einer anarchischen Umwelt durchzusetzen. Abmachungen sind wenig verlässlich, weil ein Partner sie je nach Interesse jederzeit brechen und das kooperative Verhalten der anderen Seite ausnutzen kann. Eine zweite Sichtweise interpretiert internationale Organisationen vornehmlich als „Arenen in der internationalen Politik“, die als diplomatische Dauereinrichtungen unterschiedliche Politikfelder auf spezifischen Kooperationsniveaus behandeln. Im Unterschied zu der instrumentellen Sichtweise werden die internationalen Organisationen eher als Rahmen denn als Mittel zum Erreichen bestimmter Ziele gesehen. Die dritte Sichtweise weist internationalen Organisationen eine eigenständige Qualität als „Akteur in der internationalen Politik“ zu, der zudem als ursächlicher Faktor in der Lage ist, die Grundmuster internationaler Politik im Sinne einer Minderung des anarchischen Grundzustands zu verändern. So ist es nicht verwunderlich, dass es in der Wissenschaft, aber auch in der Politik der Staaten sehr unterschiedliche Betrachtungsweisen hinsichtlich der Bedeutung internationaler Abkommen und völkerrechtlicher Regeln gibt. Die beiden Extrempositionen lassen sich wie folgt zuspitzen: Eine „legalistische Schule“ sieht in völkerrechtlichen Arrangements ein extrem hohes Gut, dem politische Erwägungen unterzuordnen sind. Wenn Staaten Verpflichtungen eingegangen sind, dann müssen sie sich auch an 164 Johannes Varwick diese halten, weil andernfalls eine Grundvoraussetzung internationaler Kooperation beschädigt wird. Es wird akzeptiert, dass durch völkerrechtliche Arrangements die staatliche Souveränität insofern beschnitten wird, als dass diese staatliches Verhalten determinieren. Eine „politikorientierte Schule“ stellt völkerrechtliche Arrangements stärker in einen politischen Kontext und betont, dass es letztlich politischen Entscheidungen der Regierungen vorbehalten bleiben soll und muss, ob sich diese an überstaatliche Regelungen halten oder nicht. Völkerrechtliche Regelungen sind ein Abwägungsfaktor unter vielen anderen und dürften demnach nicht den Anspruch erheben, maßgeblich handlungsleitend zu sein. Mit Blick auf die amerikanische Außenpolitik ist zudem darauf hinzuweisen, dass im politischen System der USA hohe Hürden für multilaterale Zusammenarbeit eingebaut sind. Gemäß der amerikanischen Verfassung ist für den Abschluss von multilateralen Verträgen und den Beitritt zu internationalen Organisationen neben der Zustimmung des Präsidenten die Ratifizierung des Vertragswerkes durch zwei Drittel der Mitglieder des Senats erforderlich. Außerdem ist meistens zur Umsetzung eines Vertrags die Verabschiedung eines speziellen Gesetzes durch beide Kammern des Kongresses nötig. Dies verbindet sich mit einer politischen Kultur, die völkerrechtliche Regelungen nicht als über dem nationalen Recht stehend begreift. 2.1 Multilateralismus in Theorie und Praxis Der Begriff Multilateralismus leidet an seiner Unschärfe und bringt zahlreiche Definitions- und Abgrenzungsprobleme mit sich. Nach einer formal-deskriptiven Definition bezeichnet Multilateralismus die Praxis der Koordination nationaler Politiken von drei oder mehr Staaten durch Adhoc-Vereinbarungen oder Institutionen. Damit ließe sich nahezu jede Form staatlicher Zusammenarbeit jenseits von Uni- und Bilateralismus als multilateral bezeichnen. Auf der anderen Seite stehen normativ gehaltvolle Konzepte, die Multilateralismus als Politikstil verstehen, bei dem die zwischenstaatlichen Beziehungen auf der Basis bestimmter allgemein akzeptierter Verhaltensregeln und Prinzipien ablaufen. Kennzeichnend ist in dieser Perspektive eine Kultur der Reziprozität, der gegenseitigen Verlässlichkeit und des prinzipiellen Verzichts auf unabgestimmtes Verhalten. Bei dem konzeptionellen Gegenmodell – dem Unitaleralismus – ginge es dann darum, dass einzelne Staaten sich vorbehalten, je nach eigener Interessenlage alleine und wenn notwendig auch gegen andere Staaten zu handeln. Unterhalb dieser prinzipiellen Unterscheidungen kann der Begriff weiter differenziert werden. Eine mögliche Eingrenzung wäre, als Definitionskriterium die tendenziell universale Ausrichtung bzw. das Bemühen USA, Mulilateralismus und internationale Organisationen 165 um funktionale oder geographische Ausweitung der Zusammenarbeit zu nehmen. Damit würden bestimmte Formen regionaler Kooperation oder thematisch enge, sachbezogene Zusammenarbeit als Untersuchungsgegenstand ausscheiden. Eine weitere Spezifizierung ergibt sich aus der Einbeziehung einer normativen Dimension wie etwa der Betonung einer regel- und normgeleiteten Qualität der Zusammenarbeit, die aus einem gemeinsamen Weltbild resultiert („epistemischer Multilateralismus“). Andere Unterscheidungskriterien beziehen sich auf die policy-Dimension der Zusammenarbeit (ökonomischer, sicherheitspolitischer, umweltpolitischer etc. Multilateralismus), die bestimmenden Akteure (staatlicher versus transnationaler Multilateralismus), den Verbindlichkeitsgrad der Zusammenarbeit, die Reichweite (offener versus geschlossener Multilateralismus) oder auch die Machtdimension in der Zusammenarbeit (hierarchischer versus egalitärer Multilateralismus). In der politischen Praxis neigen vor allem große und mächtige Staaten zu unilateralem Vorgehen, weil sie sich von einem unilateralen Handeln ihre eigene Interessenmaximierung versprechen. Selbst wenn solche mächtigen Staaten nach dem Prinzip „so viel Multilateralismus wie möglich, so viel Unilateralismus wie nötig“ verfahren würden (d.h. nur im Notfall unilateral handelten), würde in der Theorie eine wichtige Voraussetzung für internationale Kooperation zumindest beschädigt. Denn wer im Einzelfall auch allein und gegen den Willen seiner potenziellen Partner handelt, der kann sich kaum darüber wundern, wenn dann auch andere Staaten dies tun. Anders gewendet: Nur wer sich selbst den Normen der internationalen Kooperation unterwirft, der kann dies auch von anderen erwarten und einfordern. Ohne das Grundmuster der Interdependenz ist eine unilateralistische Politik allerdings wahrscheinlicher. Zu den Grundsätzen multilateraler Politik gehören das uneingeschränkte Verbot von Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele und die Erkenntnis, dass nationale Interessen durch Zusammenarbeit besser durchgesetzt werden können als in einem nationalstaatlichen Gegeneinander. Die Betonung gemeinsamer Interessen ist mithin entscheidend für eine multilaterale Politik. Es hängt also stark von den theoretischen Leitbildern in den betreffenden Staaten ab, ob eine unilaterale oder multilaterale Strategie als erfolgversprechend angesehen wird. Internationale Organisationen können nur dann eine wichtige Rolle in der internationalen Politik spielen, wenn ihre Mitgliedstaaten auf multilaterale Strategien zu Bewältigung der Probleme und Herausforderungen setzen, d.h. ein Erfolg ist äußerst voraussetzungsreich. In der realen Welt zeigt sich, dass diese Voraussetzungen nicht immer gegeben sind. 166 Johannes Varwick 2.2 Legitimierung internationaler Zwangsgewalt Eine zentrale Frage ist die Reform des gesamten Systems der VN-Friedenssicherung. Insbesondere der Krieg gegen den Irak im Frühjahr 2003 stellte einen fundamentalen Einschnitt in die etablierte Sicherheitsordnung dar. Die völkerrechtlichen Regelungen zur Einhegung des Krieges, wie sie in der VN-Charta festgeschrieben sind, seien gescheitert, und es sei an der Zeit, das Völkerrecht zu reformieren und den neuen Gegebenheiten anzupassen. Unter welchen Voraussetzungen und für welche Fälle militärische Interventionen erlaubt sein sollen, sind strittige Fragen, die mit der Debatte um die sogenannte „präemptive Sicherheitspolitik“ verbunden sind. In der Kombination von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen liege eine der zentralen sicherheitspolitischen Herausforderungen. Die der sicherheitspolitischen Strategie in der Zeit des Ost-West-Konflikts zugrunde liegende Philosophie der Abschreckung (deterrence) funktioniere unter den neuen Gegebenheiten nicht mehr. Im Einzelfall müsse von einer „Abschreckung durch Bestrafung“ (deterrence by punishment) zu einer „Abschreckung durch Verwehren“ (deterrence by denial) übergegangen werden. Denn werde militärische Gewaltanwendung prinzipiell als ultima ratio begriffen, könne der günstigste Augenblick verpasst werden, in dem beim Eingreifen in Konflikte mit vergleichsweise geringem Mittelaufwand – und möglicherweise schon mit einer glaubwürdigen Drohung – ein maximaler politischer Effekt erzielt werden könne. Die Selbstverteidigung nach Artikel 51 der VN-Charta ist zwar ein klassisches legitimes Recht der Staaten. Die zentrale Frage ist aber, was im Zeitalter von Terrorismus und Massenvernichtungswaffen als Selbstverteidigung gelten kann. Die Grenzen des Selbstverteidigungsrechts sind bereits seit längerem unscharf, spätestens seit dem 11. September 2001 ist aber deutlich geworden, dass existenzielle Bedrohungen für Staaten nicht dem klassischen Bild eines bewaffneten Überfalls von Staat A auf Staat B entsprechen müssen. Während militärische Prävention im Einzelfall als legitim gelten kann, stellen Präemptionskriege die internationale Ordnung vor fundamentale Herausforderungen. Denn es bleibt offen, wer über die Angemessenheit von solchen Militäreinsätzen entscheidet, auf welcher völkerrechtlichen Grundlage sie durchgeführt werden und wie sich dazu das allgemeine Gewaltverbot der VN-Charta verhält. Bedacht werden müssen aber ebenfalls die möglichen Folgen, wenn in jedem Fall auf die Sanktionierung von Gewaltanwendung durch den Sicherheitsrat bestanden wird. So sind durchaus Fälle vorstellbar, in denen er aufgrund von – nicht zwangsläufig rationalen – Vetodrohungen blockiert ist, aber dennoch unmittelbarer Handlungsbedarf besteht. Es sei etwa daran erinnert, dass ein militärisches Eingreifen im Kosovo 1999 nicht möglich gewesen wäre, wenn auf die klassische Legitimierung durch den VN-Sicherheitsrat bestanden worden wäre. Um es dann aber nicht nur der Willkür USA, Mulilateralismus und internationale Organisationen 167 oder der Interessensdefinition einzelner Staaten zu überlassen, was eine sicherheitsrelevante Bedrohung ist und was nicht, wird u.a. diskutiert, das Völkerrecht im Lichte der neuen Bedrohungen fortzuentwickeln. Denkbar wäre etwa, eine Debatte darüber zu führen, wo die Toleranzgrenze bei der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, der Unterstützung des internationalen Terrorismus oder aber auch der systematischen Verletzung von Menschenrechten liegt. Es müsste dann ein nachvollziehbarer Kriterienkatalog entwickelt werden, bei dem ein Eingreifen gerechtfertigt sein kann. Solche Definitionsversuche sind mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden, und es ist eher unwahrscheinlich, dass es gelingen wird. Die Alternative ist aber, den Status quo zu erhalten, der ebenfalls unbefriedigend ist. 2.3 Neuer versus alter Multilateralismus Entlang dieser argumentativen Konfliktlinien zeichnet sich in der Wissenschaft eine Dichotomie zwischen zwei Formen des Multilateralismus ab: der sogenannten klassischen und der neuen Form. Während das klassische Verständnis größtenteils dem europäischen Verständnis entspricht, zeichnet sich der „neue Multilateralismus“ durch eine lockerere Form von Ad-hoc-Koalitionen und eine größere Betonung einer Output-Legitimität aus. Die legalistischen und institutionalisierten Formen der eher klassischen multilateralen Koordinierung und Zusammenarbeit im Rahmen von zentralen internationalen Organisationen wurden insbesondere von der Bush-Regierung als umständlich und ineffektiv abgewertet. Die fundamentalen Veränderungen der internationalen Politik seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes und insbesondere seit den Terror-Anschlägen vom 11. September 2001 und der US-geführten Invasion des Irak vom März 2003 führten auch zu einer heftigen Debatte über die Bedeutung und den Nutzen des Multilateralismus. Mit der amerikanischen Sicherheitsstrategie aus dem Jahre 2002 hat sich die US-Regierung zwar zum Multilateralismus bekannt, jedoch auch deutlich gemacht, dass sie weder in der Lage noch willens sein würde, sich bei der Umsetzung ihrer nationalen Interessen – vor allem der Gewährleistung der Sicherheit der amerikanischen Bürger – auf internationale Organisationen zu verlassen. Wer nun der Auffassung ist, diesem amerikanischen Verständnis von Multilateralismus stünde ein einheitliches europäisches Verständnis gegenüber, dem muss entgegnet werden, dass – jedenfalls jenseits der allgemeinen Aussagen in der europäischen Sicherheitsstrategie – auch in Europa unterschiedliche Varianten des Denkens über Multilateralismus anzutref- 168 Johannes Varwick fen sind:7 So ist erstens eine „deutsche Denkschule“ auszumachen, für die Multilateralismus an sich als ein Gewinn gilt. Verhandlung und eine Strategie des langen Atems werden als die entscheidenden Parameter gesehen, um eine ordnungspolitische Alternative zur Macht- und Gewaltpolitik darzustellen. Zweitens ist eine „französische Denkschule“ anzutreffen, die Multilateralismus primär als Instrument einer politischen Multipolarität sieht, durch die ein Gegengewicht zu den USA hergestellt werden soll. Dabei wird die Konfrontation mit den USA einkalkuliert, sollte sich Washington nicht zu gleichberechtigter Kooperation mit Europa zusammenfinden. Drittens kann von einer „britischen Denkschule“ gesprochen werden, die einen Kompromiss zwischen beiden erstgenannten darstellt und eher pragmatisch orientiert ist. Das Hauptanliegen dieser Denkschule ist es, internationale Probleme effektiv und wenn möglich durch multilaterale Kooperation zu lösen. Dieses gehe aber nur in Kooperation und nicht in Konfrontation mit den USA. 3. Obamas Außenpolitik Internationale Organisationen stellen für die Politik der USA traditionell lediglich ein Mittel zum Zweck und kein Ziel an sich dar. Dies ist keine Entwicklung, die sich erst seit dem Jahre 2001 durchgesetzt hat. Obgleich die USA nach 1945 von der Vorstellung einer multilateralen Ordnung geleitet waren und nahezu alle wichtigen multilateralen Organisationen von den Vereinten Nationen über die Welthandelsorganisation, den Internationalen Währungsfonds bis hin zur Nordatlantikorganisation auf amerikanische Initiative zurückgingen, können die Erfahrungen der amerikanischen Regierungen mit internationalen Organisationen in den vergangenen Jahren sicher nicht durchweg als positiv beschrieben werden. Die mangelnde Effizienz, die damit häufig verbundene Einschränkung der amerikanischen Handlungsfreiheit sowie geringe Kostenersparnisse für die USA haben daher zu einer weniger positiven Perzeption von multilateralen Entscheidungsmechanismen beigetragen als in Europa.8 Zwar hatte die Regierung Clinton unter dem deutlichen Einfluss von Madeleine Albright eine Politik des so genannten durchsetzungsfähigen Multilateralismus („assertive multilateralism“) verfolgt, dies bedeutet jedoch nicht, 7 8 Vgl. Krause, Joachim: Multilateralismus in der Sicherheitspolitik – europäische und amerikanische Sichtweisen, in: Die Beziehungen zwischen NATO und EU, hrsg. von Johannes Varwick, Opladen 2005, S.219-238, bes. S.230. Irlenkaeuser, Jan: In order to form a more perfect union – Die amerikanische Politik zur Reform der Vereinten Nationen, in: Die Reform der Vereinten Nationen – Bilanz und Perspektiven, hrsg. von Johannes Varwick und Andreas Zimmermann, Berlin 2006, S.243-258. Zur amerikanischen VN-Politik siehe Braml, Josef: Amerikas UN-Reformdruck, in: Vereinte Nationen 4/2006, S.153159; Luck, Edward: Die USA und die Vereinten Nationen: Ein seltsames Paar wird sechzig, in: Vereinte Nationen 5/2005, S.201-206. USA, Mulilateralismus und internationale Organisationen 169 dass die Clinton-Administration unilaterale Maßnahmen grundsätzlich ausgeschlossen hätte. Schon in der Nationalen Sicherheitsstrategie der Clinton-Administration aus dem Jahre 1999 wird der unilaterale Einsatz der amerikanischen (Militär-) Macht nicht ausgeschlossen. Was bedeuten diese Überlegungen nun für die Frage nach dem künftigen Verhältnis der USA zu Multilateralismus und internationalen Organisationen? Zunächst bietet Obama eine Projektionsfläche für jeweils eigene Wünsche und Vorstellungen in Europa und andernorts, das außenpolitische Programm der neuen Administration wird sich aber weniger an externen Erwartungen ausrichten, sondern an den Faktoren orientieren, die Außenpolitik bestimmen. Diese lassen sich mit der Formel „3 I plus F plus E“ konzeptionalisieren. Es sind mithin in erster Linie Interessen (I), Institutionen (I), Ideen (I) und Fähigkeiten (F), die die außenpolitischen Handlungsmöglichkeiten und -optionen bestimmen. Zudem ist es eine alte Erfahrung, dass die Realität die Aussagen aus dem Wahlkampf schnell relativieren wird (E). So versprach etwa Franklin Roosevelt 1940, dass er keine amerikanischen Truppen in auswärtige Kriege schicken würde, Lyndon Johnsen erklärte 1964, keine Bodentruppen nach Vietnam zu entsenden, und George W. Bush trat im Jahr 2000 mit dem Versprechen an, dass seine Außenpolitik die USA niemals wieder in nation-building Prozesse verwickeln würde. Die Realität – oder besser gesagt: die sich jeweils schnell ändernde außenpolitische Problemagenda – hat solche Ankündigungen schnell zu Makulatur werden lassen. Insofern gilt das alte Bonmot des britischen Premierministers MacMillan, der bekanntlich auf die Frage, was ihn in seiner Amtszeit am meisten herausforderte, entgegnete: „Events, my dear, events!“ Anlässlich der Vorstellung seines außenpolitischen Teams am 1. Dezember 2008 erklärte Obama abermals die Grundzüge seiner Außenpolitik. In einer unsicheren Welt ist es nach den Worten des künftigen US-Präsidenten Zeit für einen pragmatischen Neuanfang. Um dabei Erfolg zu haben, bedürfe es einer neuen Strategie, die fachkundig alle Kräfte Amerikas vereine. Militärische, diplomatische und geheimdienstliche Kräfte der USA müssten integriert werden in eine gemeinsame Politik des guten Beispiels. „Wir werden unsere Fähigkeiten verbessern, um unsere Gegner zu bekämpfen und unsere Freunde zu stärken. Wir werden alte Allianzen erneuern und neue und andauernde Partnerschaften formen. Wir werden der Welt einmal mehr zeigen, dass Amerika ebenso unnachgiebig in der Verteidigung unseres Volkes ist, wie es fest der Wahrung unserer Interessen und Werte verpflichtet ist.“ Außenministerin Hillary Clinton sagte bei gleicher Gelegenheit, die USA benötigten mehr Partner und Verbündete und weniger Gegner. Angesichts der enormen Herausforderungen in der Welt müssten die USA künftig alle politischen Mittel nutzen, um Frieden und Freiheit zu sichern. „Amerika kann die Probleme nicht ohne die Welt 170 Johannes Varwick lösen, und die Welt kann die Probleme nicht ohne die USA lösen“, sagte Clinton. Militärische Macht allein sei nicht ausreichend, um die Ideale Amerikas zu sichern.9 Auch in ihrer Anhörung von dem Senat im Januar 2009 anlässlich ihrer Nominierung argumentierte Clinton, dass die USA das Potenzial der harten Macht der militärischen Stärke (hard power) mit jenem der weichen Macht der kulturell-politischen Anziehungskraft (soft power) verbinden müssen. Clinton bezeichnete diese Kombination als „smart power“ (kluge Macht), bei dem der Einsatz des vollen Arsenals an Mitteln – diplomatisch, ökonomisch, militärisch, politisch, rechtlich und kulturell – gefordert sei, um die Interessen der USA durchzusetzen. 10 Das außenpolitische Team Obamas lässt sich aber durchaus als „realpolitisches Demento des großen Wandels, den Obama vor der Wahl verkündigt hatte“,11 deuten. Der neue Verteidigungsminister Gates symbolisiert schon durch die Tatsache, dass er auch in der Bush-Administration in gleicher Funktion tätig war, Kontinuität im Bereich der Verteidigungspolitik, und auch der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber in Europa, James Jones, eignet sich als neuer nationaler Sicherheitsberater kaum für Experimente in der Sicherheitspolitik. Hillary Clinton als Außenministerin gehörte zwar zu den scharfen Kritikern der Bush-Außenpolitik, vertritt aber durchaus eine harte Linie bei der Wahrung und Durchsetzung amerikanischer Interessen. Auch Obama steht in einer außenpolitischen Tradition, in der sich „Ideale, Interessen, Moral und Macht untrennbar mischen“.12 Vermutlich bezieht sich der Aufbruch in der neuen US-Außenpolitik in erster Linie auf den Politikstil, der sich vorwiegend in der Betonung von Partnerschaften und Allianzen festmachen lässt. Um die amerikanische Führungsrolle in der Welt zu erneuern, so Obama, „beabsichtige ich die Allianzen, Partnerschaften und Institutionen zu erneuern, die notwendig sind, um gemeinsamen Bedrohungen zu begegnen und gemeinsame Sicherheit zu stärken. Notwendige Reformen dieser Allianzen und Institutionen sind aber nicht damit zu erreichen, indem man andere Staaten dazu nötigt, die Veränderungen nachzuvollziehen, die wir zuvor alleine ausgebrütet haben. Sie gelingen vielmehr nur dann, wenn wir andere überzeugen, dass sie ihren Anteil an effektiven Partnerschaften haben.“13 Auch in seiner Berliner Rede vom Juli 2008 erklärte Obama in sehr allgemeiner Form, dass es zur 9 10 11 12 13 Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung des außenpolitischen Teams am 1.12.2008 in Chicago, Abschrift der Redebeiträge, http://blogs.suntimes.com/ sweet/2008/12/obama_opening_remarks_at_sixth.html, Stand: 5.12.2008. Die Ausführungen Clintons im Senate Foreign Relations Committee am 13.1.2009, http://foreign.senate.gov/testimony/2009/ClintonTestimony090113a.pdf, Stand: 15.1.2009. Frankenberger, Klaus-Dieter: Obamas realpolitisches Dementi, in: FAZ, 5.12.2008, S.1. Rudolf: Amerikas neuer globaler Führungsanspruch, S.3. Obama: Renewing American Leadership. USA, Mulilateralismus und internationale Organisationen 171 Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen den Nationen keine Alternative gebe. „Es ist der Weg, der einzige Weg, um unsere gemeinsame Sicherheit und unsere gemeinsame Menschlichkeit voranzubringen.“14 Hintergrund dabei dürfte allerdings nicht das Bekenntnis zu einem prinzipiellen Multilateralismus sein, sondern vielmehr in den sich abzeichnenden Macht- und Strukturveränderungen des internationalen Systems begründet liegen. Denn der „unipolare Moment“ der USA ist in jedem Fall vorbei und die Führungsmacht USA steht vor der Herausforderung, die bestehende internationale Ordnung anzupassen. Dies gilt für eine Reform von Vereinten Nationen und NATO ebenso wir für die bessere Einbindung aufstrebender Mächte wie Brasilien, Indien, Nigeria oder Südafrika.15 Der Ansatz von Hillary Clinton kommt dabei in der erwähnten Nominierungsrede von dem Senat deutlich zum Ausdruck: „Wir sollten die Vereinten Nationen und andere internationale Institutionen nutzen, wann immer es angemessen und möglich ist. Demokraten wie Republikaner haben über Jahrzehnte verstanden, dass diese Institutionen – wenn sie gut funktionieren – unseren Einfluss vergrößern. Wenn sie aber nicht gut funktionieren, sollten wir mit befreundeten Staaten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass diese Institutionen unsere Werte reflektieren, die ihrer Gründung in erster Linie zugrunde lagen.“16 Für zwei wichtige internationale Organisationen, die Vereinten Nationen und die NATO, ergeben sich aus dem Regierungswechsel in den USA neue Chancen, allerdings sind auch hier keine grundlegend neuen Ansätze zu erwarten. Die Zeiten, in denen die Vereinten Nationen in Washington für irrelevant erklärt wurden, dürften mit Obama vorbei sein. Die Nominierung seiner engen außenpolitischen Beraterin, Susan Rice, als UNBotschafterin zeigt, dass den VN Bedeutung beigemessen wird. Allerdings hat Obama ebenfalls deutlich gemacht, dass die VN dringend reformiert werden müssen und eine Verpflichtung zu multilateralem Handeln geradezu mit einer Verpflichtung zur Reform verbunden werden muss. Dies war ebenfalls ein wichtiges Anliegen der Bush-Administration, und es bleibt abzuwarten, wie in Washington reagiert wird, wenn sich Reformen als nicht durchsetzbar erweisen sollten. Abzuwarten bleibt auch, ob dann stärker auf Formen des „neuen Multilateralismus“ – wie etwa G-20, Global Energy Forum oder ein in den USA immer wieder diskutiertes „Konzert der Demokratien“ als Gegenmodell zu den VN – ausgewichen werden wird. 14 15 16 Obama, Barack: A World that Stands as One, Rede am 24.7.2008 in Berlin, http://my.barackobama.com/page/community/post/obamaroadblog/gGxyd4, Stand: 5.12.2008. Als Beispiele für die kontrovers geführte Debatte um amerikanische Vorherrschaft als Gegenpole siehe Lieber, Robert: The Declinists are wrong again, in: Perspectives, 47/2008; Zakaria, Fareed: The Future of American Power, in: Foreign Affairs, Mai/Juni 2008. Clinton: Ausführungen im Senate Foreign Relations Committee. 172 Johannes Varwick Bezüglich der NATO hat Obama mehrfach erklärt, dass er die Allianz stärken wolle. In dem Wahlprogramm heißt es aber auch deutlich, dass die Verbündeten dazu gebracht werden sollen, mehr Truppen in kritischen Einsätzen wie Afghanistan zur Verfügung zu stellen, und auch der Entscheidungsprozess in der NATO gestrafft werden sollte. Bei der Streitfrage Erweiterung um Georgien und die Ukraine werden sich in der Substanz keine großen Unterscheide zur Bush-Politik ergeben. In beiden Fällen wird es aber den Partnern möglicherweise schwerer fallen, amerikanische Forderungen abzuwehren. Denn wenn die amerikanischen Interessen „geschmeidiger“ vorgetragen werden und dies mit einer Rhetorik des Mitentscheidens bzw. mit tatsächlichem Einfluss auf eine gemeinsame Strategie in wichtigen Fragen verbunden wird, dann werden die Partner ihre Beiträge erhöhen müssen. Insofern könnte sich der amerikanische Ruf nach Partnerschaften und Multilateralismus als besonders geschickte Variante der Debatte um Lasten- und Risikoteilung erweisen. 4. Bilanz Wie jeder Regierungswechsel, so bietet auch der Wechsel in den USA Chancen für eine neue Politikgestaltung. Aus europäischer und deutscher Sicht ist es zu begrüßen, dass in Washington eine Administration ins Amt kommt, die sich offener zu Partnerschaften und multilateraler Zusammenarbeit bekennt, als dies die Vorgängerregierung getan hat. Unabhängig davon muss die EU aber noch mehr tun, um die internationale Agenda effektiver zu gestalten. Der „Hohe Vertreter der EU für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik“ (GASP), Javier Solana, formulierte dies kürzlich auf einer Rede in Paris wie folgt: „Vor allem müssen wir daran arbeiten, die Agenda zu bestimmen und nicht nur zu reagieren. Es stimmt zwar, dass heutzutage kein internationales Problem ohne Mitwirkung der EU diskutiert wird. Aber Mitwirkung ist nicht zu verwechseln mit wirklicher Mitentscheidung. Wir verbringen nach wie vor zu viel Zeit damit, in Europa zu diskutieren, wer etwas sagen soll, anstatt selber zu sagen, was wir tun wollen.“17 Um diese „alte europäische Krankheit“ – die destruktive Vielstimmigkeit – zu heilen, ist es nicht zuletzt erforderlich, dass die Neuerungen des derzeit auf Eis liegenden Lissabon-Vertrags wie die Schaffung eines europäischen „Außenministers“ (der sich zwar nicht so nennen darf) und die Verbesserungen im Bereich der politischen Führungsfähigkeit der EU auch bald Realität werden. Wenn (!) Europa mit einer Stimme spricht und zu fairer Lasten- und Risikoteilung bereit ist, dann bestünden in einer ganzen Reihe von Fragen gute Chancen auf eine gemeinsame transatlantische Politik, und die „respekteinflößende Agen17 Solana, Javier: Speech by the European Union High Representative for Common Foreign and Security Policy at the Annual Conference of the Institute for Security Studies of the European Union, Paris, 30.10.2008. USA, Mulilateralismus und internationale Organisationen 173 da“ könnte sicher mit guten Chancen auf Problemlösungen bearbeitet werden. Dies würde sich auch positiv auf die Relevanz internationaler Organisationen auswirken. Im Ergebnis dürfte die künftige Außenpolitik der USA durch einen pragmatischen Multilateralismus à la Obama gekennzeichnet sein.18 Der Erwartung, dass sich die USA nun widerspruchslos in den Geleitzug einer vermeintlichen internationalen Gemeinschaft einreihen werden, ist jedoch vehement zu widersprechen. Dazu weicht das amerikanische Verständnis von Multilateralismus zu sehr vom europäischen Durchschnitt ab und versteht sich vornehmlich als ein Instrument amerikanischer Außenpolitik. Selbst liberale Internationalisten argumentieren, dass die USA zwar eine generelle Präferenz für Multilateralismus haben sollten, zeitweise aber ein Alleingang zu bevorzugen sei.19 Dies hat auch Obama unmissverständlich deutlich gemacht, etwa in der Frage, ob bei sicherheitspolitischen Fragen in jedem Fall ein Mandat des VN-Sicherheitsrats notwendig sei.20 Dies sieht auch seine Außenministerin so: „Wir werden mit diplomatischen Mitteln führen, denn dies ist der kluge Ansatz. Aber wir wissen ebenso, dass militärische Mittel manchmal notwendig sind, und wir werden auf sie als ein letztes Mittel zurückgreifen, um unsere Interessen und unser Volk zu schützen, wenn und wo sie gebraucht werden.“21 Vor Illusionen über die amerikanische Bereitschaft, sich von internationalen Organisationen oder multilateralen Verbünden Einschränkungen bei Fragen von wichtigen nationalen Interessen gefallen zu lassen, muss also ausdrücklich gewarnt werden. 18 19 20 21 Keller, Patrick: Obama’s foreign policy. What can NATO expect from the next U.S. President?, NATO Defense College Research Paper 43/2008. Vgl. Maull, Hanns W.: The Quest for Effective Multilateralism and the Future of Transatlantic Relations, in: Foreign Policy in Dialogue 25/2008, S.9-18, der in diesem Sinne einen den einflussreichsten Vertreter dieser Denkschule, Joseph S. Nye, zitiert. So erklärte Obama: Als Oberbefehlshaber der Streitkräfte würde ich nicht zögern, gegen jeden zuzuschlagen, der Amerikanern oder amerikanischen Interessen schadet, http://www.ontheissues.org/2008_CBC_Dems.htm, Stand: 5.12.2008. Ähnlich argumentiert er auch in dem zitierten Foreign Affairs Artikel. Clinton: Ausführungen im Senate Foreign Relations Committee. Raketenabwehr für die NATO Warum die Europäer Obama ermuntern sollten, Bushs Weg zu Ende zu gehen* Svenja Sinjen Nur wenige verteidigungspolitische Themen wurden in den vergangenen Jahren öffentlich so kontrovers diskutiert wie das Thema „Raketenabwehr“. Ausgelöst wurde die Debatte 2007 durch die Ankündigung des ehemaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush, das nationale Raketenabwehrsystem der USA durch weitere Komponenten in Osteuropa ausbauen zu wollen. Nach monatelangen, zum Teil heftigen Auseinandersetzungen zwischen den USA und Russland sowie innerhalb der NATO schien es eine zeitlang so, als ob zumindest die transatlantischen Partner ihre Differenzen beseitigt hätten und gar auf dem Weg zu einem gemeinsamen Raketenabwehrsystem seien. So arbeitet die NATO derzeit an einer Studie, die Optionen aufzeigen soll, wie sich die Europäer an den Plänen der USA beteiligen könnten, um das gesamte NATO-Territorium gegen einen Angriff mit ballistischen Raketen (BR) zu verteidigen.1 Eine endgültige Entscheidung für ein gemeinsames NATO-System wurde jedoch bis heute immer wieder hinausgezögert. Während diese Verzögerungen bereits nahelegten, dass man in der NATO offensichtlich doch noch keinen tragfähigen Konsens über den positiven Nutzen von Raketenabwehrsystemen erwirken konnte, steuert die Haltung der neuen US-Administration zu diesem Thema ihr übriges bei: Gegenwärtig ist auch für den Gipfel zum 60. Jahrestag der NATO keine Entscheidung zugunsten eines gemeinsamen Raketenabwehrsystem zu erwarten. Mehr noch, das Angebot Präsident Obamas an seinen russischen Amtskollegen, von dem Bau der Abwehrbasen in Osteuropa abzulassen, wenn Russland helfe, den Iran von der Herstellung von Langstreckenraketen abzuhalten,2 könnte das Raketenabwehrsystem der NATO ganz zu * 1 2 Die Autorin gibt ausschließlich ihre persönliche Auffassung und nicht die der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. wieder. Der Beitrag basiert in seinen Grundzügen auf den Ergebnissen des Artikels von Frühling, Stephan/Sinjen, Svenja: Raketenabwehr, NATO und die Verteidigung Europas, in: Analysen & Argumente 40/2007. Der Beitrag berücksichtigt die Ereignisse zu diesem Thema bis Anfang März 2009. Vgl. Baker, Peter: Obama Offered Deal to Russia in Secret Letter, in: The New York Times, 3.3.2009, http://www.nytimes.com/2009/03/03/washington/03prexy. html?partner=rss&emc=rss, Stand: 3.3.2009. Raketenabwehr für die NATO 175 Fall bringen. Eine dringend gebotene ganzheitliche – und damit effektive – verteidigungspolitische Strategie der NATO gegen die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen (MVW) und BR rückte damit in weite Ferne. Erneut muss daher die Frage der politischen Notwendigkeit für ein Raketenabwehrsystem zum Schutz des NATO-Territoriums diskutiert werden. 1. Hintergründe des US-Raketenabwehrprogramms Das gegenwärtige Raketenabwehrprogramm der USA ist das Ergebnis einer verteidigungspolitischen Neuausrichtung, die Präsident Bush bei seinem Amtsantritt eingeleitet hatte. Diese Neuausrichtung beinhaltete zunächst eine veränderte Bedrohungsperzeption, die neben dem Terrorismus v.a. die wachsende Gefahr durch MVW und BR in den Vordergrund rückte. Des Weiteren wurden neue Akzente im Rahmen der Bekämpfungsstrategie gegen diese Gefahren gesetzt, die u.a. auf eine Stärkung der Verteidigungskraft abzielten. 1.1 Gewandelte Bedrohungsperzeption Im Zentrum der Bedrohungsanalysen der Bush-Administration standen Nordkorea und Iran. Beide Länder arbeiten seit langem an Langstreckenraketen, deren Bedrohungspotenzial zweifelsfrei am höchsten ist, wenn sie mit MVW bestückt sind. Während es um den Stand des iranischen Nuklearprogramms nach wie vor Verwirrungen gibt, zündete Nordkorea bereits 2006 eine Atombombe. Unklar ist allerdings, ob das Land bereits Nuklearwaffen auf seine Raketen montieren kann. Aber selbst wenn Raketen keine MVW tragen, können sie eine erhebliche Bedrohung darstellen. Der Einschlag auch nur einer Rakete in einer amerikanischen Stadt hätte vermutlich schwerwiegende psychologische Auswirkungen auf die Gesellschaft der USA, deren Folgen für das internationale System kaum abzusehen wären. Nordkorea baut seit Jahren No Dong-Raketen, die mit 1.300 km Reichweite Japan erreichen können. Für wesentlich größere Reichweiten sind Raketen mit mehreren Stufen notwendig. 1998 testete es eine Taepo Dong I mit drei Stufen, die erfolgreich separierten (obwohl die dritte Stufe aus unbekannten Gründen versagte). Seit dem Test 1998 konzentriert sich Nordkorea auf die leistungsfähigere Taepo Dong II, deren Reichweite auf bis zu 10.000 km geschätzt wird. Ein Test im Juli 2006 schlug aufgrund von Problemen der ersten Stufe fehl. Da Nordkorea aber bereits acht Jahre zuvor mehrere Stufen erfolgreich separieren konnte, ist der technologische Stand seines ICBM-Programms (Interkontinentalraketen) derzeit weiter unklar. 176 Svenja Sinjen Die prominenteste Rakete Irans hingegen ist die Shahab III, die auf der No Dong basiert. Die Standardvariante mit 1.300 km Reichweite kann Israel erreichen. 2004 testete Iran zudem eine gestreckte Version mit wahrscheinlich 2.000 km Reichweite – genug, um Athen zu treffen. Der neue Kopf dieser Version hat darüber hinaus Ähnlichkeiten mit sowjetischen Designs für die Aufnahme von Nuklearwaffen. Unbestätigten deutschen und israelischen Berichten zufolge erhielt Iran zudem angeblich SS-N-6/ BM-25 aus Nordkorea mit einer Reichweite von 2.500 km. Noch ist aber nicht klar, ob Nordkorea diese Raketen überhaupt nachbaut. Teheran bekundete außerdem, an einer Shahab V mit noch größerer Reichweite zu arbeiten. Diese Rakete ist wahrscheinlich eine Version der nordkoreanischen Taepo Dong I. Nicht zuletzt aufgrund der engen Kooperation zwischen Iran und Nordkorea ist der Fortschritt des iranischen Programms ebenso schwer einzuschätzen. Der ehemalige Direktor der amerikanischen Missile Defense Agency Obering betonte in einem seiner letzten Interviews im Oktober 2008 jedoch, dass geheimdienstlichen Erkenntnissen zufolge davon auszugehen wäre, dass sowohl Nordkorea als auch Iran innerhalb der nächsten zwei Jahre über Langstreckenraketen verfügen könnten3, die in der Lage wären, u. a. die USA zu erreichen – und das trotz intensiver diplomatischer Gegenbemühungen. Natürlich unterliegen Programme zur Herstellung von Raketen und MVW in Ländern mit zweifelhaften Absichten größter Geheimhaltung und gezielter Verschleierung. Detaillierte Einschätzungen über den Stand von Rüstungsvorhaben sind somit immer mit einem erheblichen Maß an Unsicherheit behaftet, das zu überraschenden Ergebnissen führen kann: Völlig unerwartet testete Nordkorea 1998 z. B. eine Langstreckenrakete; Iran im selben Jahr eine Rakete mittlerer Reichweite. Weitere Fehleinschätzungen westlicher Geheimdienste betrafen die irakischen MVW-Programme vor dem Zweiten Golfkrieg 1990/91 und vor dem Dritten 2003. Im ersten Fall wurde der Stand des Nuklearprogramms weit unterschätzt. Hinzu kam, dass man trotz jahrelanger UNSCOM-Inspektionen erst 1995 das irakische Biowaffenprogramm entdeckte. Im zweiten Fall konnte man im Anschluss an die Kampfhandlungen die vermuteten MVW im Land nicht auffinden. An diesen Beispielen zeigt sich deutlich, dass der Stand militärischer Fähigkeiten sowohl unter- als auch überschätzt werden kann. Ebenso deutlich ist allerdings auch, dass von einer Fehleinschätzung, die das gegnerische Potenzial unterschätzt, eine größere Gefahr für die transatlantische Sicherheit ausgehen könnte, als umgekehrt. 3 Vgl. Rance, Michael: US Missile Defence. Interview with General Obering, Director of the MDA, in: The RUSI Journal 5/2008, S.60-65, hier S.61. Raketenabwehr für die NATO 177 Neben Nordkorea und Iran gibt es weitere Länder, deren Raketen schon allein durch die Möglichkeit von Unfällen oder unautorisierten Starts eine Gefahr für die USA und Europa darstellen. Sowohl Russland als auch China verfügen z.B. über Raketen sämtlicher Reichweiten sowie umfassende Bestände an MVW. Beide Länder unterhalten zudem substanzielle Programme zur Modernisierung ihrer nuklearen und konventionellen Raketenstreitkräfte. Obwohl die genauen politischen Absichten Nordkoreas und Irans letztlich im Verborgenen bleiben, sind ihre Feindseligkeiten gegenüber regionalen Akteuren wie Südkorea, Japan und Israel sowie westlichen Demokratien insgesamt, insbesondere den USA, kaum zu überhören. Die tatsächliche Gefahr, die von ihnen ausgeht, kann nur in Anlehnung an ihre politischen Ambitionen eingeschätzt werden. Aber auch über die Ziele und das Verhalten von Kim Jong Il und Ahmadinedschad (und ihren Führungszirkeln) können schlussendlich keine sicheren Vorhersagen gemacht werden – Gegenstand dieser Vorhersagen ist die menschliche Psyche. Es bleibt nur der Verweis auf die innenpolitische Struktur in ihren Ländern, die der Bevölkerung keine Sanktionsmechanismen zur Kontrolle der politischen Eliten gibt. Folglich stellt die Existenz von Raketen und MVW unter der Kontrolle dieser Länder eine potenzielle Gefahr für alle NATO-Mitglieder dar. 1.2 Stärkung der Verteidigungskraft In Anbetracht dieser Situation sah sich die Bush-Administration dringend veranlasst, die etablierten Bekämpfungsansätze der amerikanischen Verteidigungsstrategie zu modifizieren. Diese Dringlichkeit wird durch die globale ordnungspolitische Rolle der USA verschärft: Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs verfolgen die USA das Prinzip, ihre Interessen an der Peripherie – weit vor ihren Grenzen – zu verteidigen. Sowohl im Nahen Osten als auch in Ostasien haben sie dazu auch Verteidigungsgarantien gegenüber Staaten übernommen, die in direktem Konflikt mit Nordkorea und Iran stehen und bereits jetzt durch ihre Raketen getroffen werden können. Somit ist für die USA eine militärische Auseinandersetzung mit beiden Ländern eine realistische Gefahr – daran ändert auch die gegenwärtige Überdehnung ihres militärischen Engagements nichts. Die periodisch wiederkehrenden feindseligen Äußerungen von Nordkorea und Iran gegenüber den amerikanischen Verbündeten Israel, Südkorea und Japan untermauern diese Möglichkeit glaubwürdig. Gleiches Szenario könnte sich für die USA im Rahmen der Verteidigungsgarantien gegenüber ihren transatlantischen Verbündeten entwickeln, sollte sich z.B. der europäische Konflikt mit Iran verschärfen. 178 Svenja Sinjen Raketenabwehrsysteme – zum Schutz des eigenen Territoriums – nehmen in diesem Zusammenhang zwei bedeutende Funktionen in einer militärischen Bekämpfungsstrategie ein: Erstens stärken sie den Versuch, feindlich gesinnte Staaten von Erpressungsversuchen oder einer militärischen Auseinandersetzung abzuschrecken: Als aktive Verteidigung ergänzen sie den passiven ABC-Schutz (atomar, biologisch, chemisch) und weitere offensive Verteidigungsmaßnahmen und signalisieren dem Gegner, dass ein Angriff mit einer Rakete nicht zu dem gewünschten Erfolg führen kann (deterrence by denial). Diese mangelnden Erfolgsaussichten wären umso abschreckender, wenn der Angreifer nach einem Raketenabschuss gleichzeitig mit einem (nuklearen) Vergeltungsschlag rechnen müsste (deterrence by punishment). Erst eine Kombination aus Verteidigung und Vergeltung macht Abschreckung somit effektiv. Da aber jede Vergeltungsmaßnahme – insbesondere auf der Basis von Nuklearwaffen – auch in den USA mit erheblichen innenpolitischen Schwierigkeiten verbunden sein dürfte, kommt der Verteidigungskomponente im Konzept der Abschreckung eine besondere Bedeutung zu. Ohne Raketenabwehrsysteme bleibt die Verteidigung unvollständig und Abschreckung wenig glaubwürdig. Mit dem Aufbau eines Raketenabwehrsystems zum Schutz des eigenen Territoriums setzte die Bush-Administration die jahrzehntelang geltende – aber stets zweifelhafte – Doktrin der „gegenseitigen gesicherten Zerstörung“ (mutually assured destruction), die bewusst auf Raketenabwehr verzichtet hatte, außer Kraft und begann die amerikanische Verteidigungskraft zu stärken. Trotz aller militärischen Vorkehrungen können Abschreckungsbemühungen – auch gegenüber staatlichen Akteuren – dennoch scheitern: Abschreckung ist kein mechanischer Prozess, sondern setzt eine Vielzahl an Informationen über den Gegner voraus, die in der Realität nicht immer verfügbar sind. Zudem entscheidet letztlich der Gegner selbst, ob er abgeschreckt ist oder nicht. Die zweite Funktion von Raketenabwehrsystemen liegt damit in einer Art „Rückversicherung“ für den Fall, dass Abschreckung tatsächlich versagt. Sollten sich Nordkorea oder Iran im Konfliktfall entscheiden, einen Raketenangriff auf die USA zu unternehmen, könnte der Schaden durch ein Abwehrsystem erheblich reduziert bzw. vermieden werden. Die strategische Neuausrichtung der USA zielte aber nicht auf die Stärkung der amerikanischen Verteidigungskraft allein; sie sah darüber hinaus auch vor, die Verbündeten der USA bei der Aufstellung von Raketenabwehrsystemen zu unterstützen. Wären in einem Konfliktfall nur die USA mit einem effektiven Schutz für ihr Land ausgestattet, erhöhte dies zwar die Glaubwürdigkeit ihrer Verteidigungsgarantien gegenüber ihren Allianzpartnern; das Entstehen einer belastbaren Verteidigungskoalition mit diesen Partnern wäre aber wenig wahrscheinlich. Der Gegner könnte Raketenabwehr für die NATO 179 immer noch die amerikanischen Verbündeten ins Fadenkreuz seiner BR (Ballistischen Raketen) nehmen und sie damit erpressen oder von einem Militäreinsatz abschrecken. Somit kooperieren z.B. Japan und Israel mit den USA bei der Entwicklung und Produktion von Abfangraketen (SM-3 und Arrow II). Insgesamt könnte eine derartige Verteidigungsstrategie aufseiten aktueller und zukünftiger Konfliktgegner dazu führen, dass die Attraktivität von BR als Drohwaffe gegenüber den USA und ihren Verbündeten abnimmt (deterrence by dissuasion). Es ist davon auszugehen, dass gegenwärtig zahlreiche Staaten u.a. deshalb nach BR streben, weil aufseiten des amerikanischen Allianzsystems nach wie vor eine erhebliche Verteidigungslücke gegen diese Waffen besteht. Raketenabwehrsysteme unterstützen damit die internationalen Bemühungen, Staaten wie Nordkorea und Iran zur Abrüstung zu veranlassen. 2. Architektur des US-Raketenabwehrprogramms Dementsprechend veranlasste die Bush-Administration 2002 die Stationierung eines Raketenabwehrsystems zum Schutz des amerikanischen Territoriums. Dieses System unterliegt dabei der Maßgabe, eine gestaffelte Verteidigung gegen BR jeglicher Reichweite in allen Flugphasen zu bieten und basiert vorerst auf vier Typen von Abfangraketen: Patriot PAC-3, THAAD, SM-3 und Ground-Based Interceptor. – Patriot PAC-3 Abfangraketen sind relativ langsam, haben eine geringe Reichweite und operieren nur in der Atmosphäre. Sie werden im Wesentlichen zum Schutz von Punktzielen gegen Kurzstreckenraketen eingesetzt. – THAAD-Raketen sind im Vergleich zu Patriot leistungsstärker und fangen Raketen in der oberen Atmosphäre ab. Sie können dementsprechend auch Flächenziele gegen Mittelstreckenraketen wie die iranische Shahab III und u.U. weiter reichende Raketen verteidigen. ICBM sind allerdings zu schnell, um von THAAD-Raketen abgefangen zu werden. THAAD wird von den USA außerdem erst 2009/10 in den operativen Dienst gestellt. – SM-3-Abfangraketen werden von Aegis-Flugabwehrschiffen abgeschossen. Sie können Raketen nur oberhalb der Atmosphäre im Weltraum zerstören, so dass sie gegen Kurzstreckenraketen nutzlos sind. Ihnen kommt hauptsächlich der Schutz von Flächenzielen gegen Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von ca. 3.000 km zu. Obwohl es zukünftig auch möglich sein soll, Raketen größerer Reichweite mit 180 Svenja Sinjen ihnen abzufangen, können SM-3-Abfangraketen bisher wegen ihrer geringen Beschleunigung und ihres relativ kleinen Abfangkörpers ebenfalls keine ICBM zerstören. – Nur Ground-Based Interceptor-Abfangraketen (GBI) sind momentan leistungsstark genug und können ICBM im Weltraum abfangen. Abfangraketen aller Typen werden von den USA mit den übrigen Elementen ihres Raketenabwehrsystems wie Frühwarnsatelliten, boden- und seegestützten Radaren, Kommunikationsverbindungen und Kommandozentralen integriert. Dazu gehören auch Radaranlagen in Großbritannien (Fylindales) und Dänemark/Grönland (Thule). Bislang ist geplant, die Fähigkeit des Systems durch die Modernisierung der existierenden Systeme und das Hinzufügen neuer Komponenten stetig weiter zu verbessern. In Anbetracht des fortgeschrittenen nordkoreanischen ICBM-Programms begann die Bush-Administration ab 2004 zunächst mit der Stationierung von Abfangraketen gegen einen Angriff aus Asien. Gegenwärtig sind neben SM-3 Abfangraketen auf zahlreichen Aegis Flugabwehrschiffen 26 GBI in Alaska (Fort Greely) und vier in Kalifornien (Vandenburg AFB) stationiert. Diese GBI sind geographisch so platziert, dass sie Raketen aus Nordkorea effektiv abfangen können. Sie sind aber weniger geeignet, einen Angriff aus dem Nahen Osten abzuwehren: Die GBI-Basis in Alaska ist von der Flugbahn einer Rakete, die die amerikanische Ostküste aus Iran ansteuert, zu weit entfernt. Somit besteht – wenn überhaupt – nur ein kleines Abfangfenster. Ist das Fenster klein, müssen von vorneherein mehrere Abfangraketen als Salve gefeuert werden, in der Hoffnung, dass zumindest eine von ihnen die anfliegende ICBM zerstört. Dies führt zu einer rapiden Reduzierung des Arsenals an verfügbaren Abfangraketen. Ist das Abfangfenster einer Basis jedoch so groß, dass nach dem Fehlschlag einer einzelnen Abfangrakete noch eine weitere gestartet werden kann, sinkt die Zahl der benötigten Abfangraketen erheblich. Zudem bestehen gleich zwei Versuche, die feindliche Rakete abzuwehren. Dies gilt natürlich umso mehr, wenn Abfangbasen wie die in Alaska und Kalifornien zur Verteidigung gegen Raketen aus Asien gestaffelt werden (layered defence). Wollen sich die USA ebenso verlässlich wie effektiv gegen Raketen aus dem Nahen Osten schützen, müssen sie folglich eine GBI-Basis zwischen der amerikanischen Ostküste und dem Abschussgebiet der gegnerischen Raketen stationieren – d.h. in Europa. Diese Notwendigkeit erklärt primär die einstigen Verhandlungen zwischen der Bush-Administration und Polen sowie der Tschechischen Republik. Während in Polen bis dato zehn GBI aufgestellt werden sollen (bis ca. 2012/13), soll in der Tschechischen Raketenabwehr für die NATO 181 Republik eine Radaranlage entstehen. Dieses Radar soll durch zwei weitere Radaranlagen in Großbritannien und Grönland unterstützt werden. Beide Länder kooperieren diesbezüglich mit den USA bereits seit 2003 auf bilateraler Basis. 3. Anfängliche Raketenabwehrbemühungen in der NATO Neben diesem rein nationalen Programm der USA ist auch die NATO im Bereich der Raketenabwehr tätig. Das Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence (ALTBMD) Programm soll militärischen Kräften im Einsatz Schutz bieten und ist Ergebnis der Erfahrungen aus dem Zweiten Golfkrieg 1991. Damals setzte der Irak Kurzstreckenraketen gegen Israel und Saudi-Arabien ein, wobei auch amerikanische Soldaten getötet wurden. Machbarkeitsstudien zu ALTBMD befassten sich mit Raketen bis 3.000 km Reichweite. Auf dem Gipfel in Riga 2006 wurde die erste Stufe beschlossen, die allerdings keine eigenen Abfangraketen umfassen soll. Sie hat lediglich zum Ziel, die unterschiedlichen nationalen Systeme (Abfangraketen und Sensoren) der Länder, die an einem Einsatz teilnehmen, zu vernetzen, um sie als ein System befehligen und nutzen zu können. Initial Operational Capability ist für 2010 geplant. Während europäische NATOStaaten mit Patriot, MEADS und SAMP/T Komponenten zum Abfangen von Kurzstreckenraketen beitragen können, haben zur Zeit nur die USA mit SM 3 und in Kürze THAAD Systeme, die auch eine Verteidigung gegen Mittelstreckenraketen bieten können. Getrennt davon hatte die NATO bereits auf ihrem Prager Gipfel 2002 eine Machbarkeitsstudie zur Verteidigung des Bündnisgebietes – gegen das gesamte Raketenspektrum – in Auftrag gegeben. Die Studie unterlag dabei der Maßgabe, das Prinzip der Unteilbarkeit alliierter Sicherheit zu beachten. Das amerikanische Raketenabwehrprogramm wurde allerdings nicht in die Betrachtungen einbezogen. Im Juni 2006 wurden die NATO-Verteidigungsminister mit einem positiven Ergebnis konfrontiert: Ein territoriales Raketenabwehrsystem ist technisch machbar und mit relativ geringem Aufwand finanzierbar. Trotzdem die NATO seit Istanbul 2004 betont, dass die Proliferation von MVW und BR eine der Hauptbedrohungen für ihre Mitglieder darstellt, konnten sich die Verbündeten dann auf ihrem Gipfel in Riga nicht zum Aufbau eines NATO-Abwehrsystems entschließen. Dies schien zum einen daran zu liegen, dass sich nicht alle europäischen NATO-Mitglieder gleich stark durch BR bedroht fühlten; zum anderen schien es auch darin begründet zu sein, dass nicht alle Europäer in einem Raketenabwehrsystem einen sinnvollen Ansatz zur Bekämpfung von BR sahen. 182 Svenja Sinjen 4. Konsequenzen des US-Vorhabens für die NATO Die geplante GBI-Basis in Osteuropa könnte nicht nur die USA gegen Langstreckenraketen aus dem Nahen Osten schützen, sondern in gewissem Maße auch das europäische NATO-Territorium – quasi als Nebenprodukt. Dieser Schutz beträfe aber erstens lediglich Nordost- und Zentraleuropa und wäre zweitens weniger verlässlich und effektiv, als der, den die USA erhielten. Darüber hinaus begäben sich die europäischen NATOPartner drittens in eine direkte Abhängigkeit von den USA: – Der Südosten Europas und die Türkei liegen außerhalb des Schutzbereichs der GBI in Polen. Während z.B. Athen in der Reichweite von Mittelstreckenraketen liegt, die nur von SM-3 (auf Schiffen im Mittelmeer oder Schwarzen Meer) und von THAAD abgefangen werden können, befindet sich z.B. die Türkei auch im Bereich von Kurzstreckenraketen. Diese müssen durch Systeme wie Patriot PAC-3 oder THAAD abgefangen werden. Mit Blick auf die Verteidigung gegen Mittelstreckenraketen besteht auf europäischer Seite allerdings eine kritische Fähigkeitslücke. – Damit die GBI-Basis eine hohe Abfangwahrscheinlichkeit erzielte, müssten zur Verteidigung Europas sehr wahrscheinlich Salven gefeuert werden, die wie bereits erwähnt das Arsenal an verfügbaren Abfangraketen rapide reduzierten; bei etwa zehn Abfangraketen, die die USA für die Basis in Polen planen, eine problematische Aussicht. Zudem bestünde keine zweite Chance, eine auf Europa gerichtete Rakete abzufangen. Nur eine weitere Basis in Europa könnte dieses Problem lösen. Stationierte man z.B. neben den GBI in Polen weitere in Großbritannien, könnte die zweite Basis ihr Feuer zurückhalten, bis der Erfolg oder Misserfolg der ersten bestätigt wäre.4 – Die Bush-Administration gab stets unmissverständlich zu verstehen, dass sie eine rein nationale Kontrolle ihres Abwehrsystems anstrebten. So betonte die Missile Defense Agency regelmäßig, dass die Kontrolle über Systeme, die das Territorium der USA verteidigten, ausschließlich in amerikanischer Hand bliebe. Dieser Umstand ist allerdings keineswegs eine Neuerung der Bush-Administration, sondern ein generelles Prinzip amerikanischer Verteidigungspolitik. Selbst zu Zeiten des „Kalten Krieges“ war z.B. das amerikanisch-kanadisch integrierte Luftverteidigungskommando NORAD nicht der NATO assigniert. Damit 4 Ein GBI, den man aus Osteuropa auf eine Rakete aus dem Nahen Osten abschösse, könnte eine anfliegende Rakete relativ früh zerstören und wäre somit geeignet, auch Raketen, die auf Zentraleuropa gerichtet wären, abzufangen. Eine Abfangbasis in Großbritannien hätte hingegen ein größeres Abfangfenster für Raketen, die auf Nordwesteuropa oder die USA gerichtet wären. Raketenabwehr für die NATO 183 hätten die europäischen NATO-Mitglieder keinen Einfluss auf die Verteidigung ihres Kontinents gegen Langstreckenraketen – auch nicht in Krisenzeiten. Dies versetzte die Europäer in eine direkte Abhängigkeit von den USA, die durch die begrenzte Zahl an Abfangraketen in Polen noch problematischer werden könnte. 5. Optionen für ein umfassendes Raketenabwehrsystem der NATO Die bilateralen Verhandlungen zwischen den USA und den osteuropäischen Staaten veranlassten die übrigen Europäer dazu, eine intensive Debatte über die Motive der Befürworter territorialer Raketenabwehr zu führen. In diesem Zusammenhang gaben die NATO-Verteidigungsminister im Juni 2007 eine Ergänzung der Machbarkeitsstudie von 2006 in Auftrag, die die Auswirkungen des amerikanischen Raketenabwehrprogramms – v.a. der Basis in Osteuropa – für die NATO untersuchen sollte. Darüber hinaus konnten sich die Verbündeten im Herbst 2007 auf eine neue Bedrohungsanalyse einigen, in der nach Angaben von NATO-Offiziellen ein tragfähiger Konsens hinsichtlich der Raketenbedrohung für das Bündnisgebiet erkennbar wäre. Daran anschließend betonte der Gipfel in Bukarest 2008 nicht nur, dass Raketenabwehr ein bedeutender Teil eines breiten Ansatzes zur Bekämpfung gegen BR wäre, sondern beauftrage den NATORat auch, Optionen aufzuzeigen, wie die Teile Europas, die das amerikanische System nicht schützte, durch NATO-Anstrengungen abgedeckt werden könnten. Die Ergebnisse sollen auf dem Gipfel in Strassburg und Kehl im April 2009 vorgelegt werden. Damit sind die transatlantischen Partner beim Thema Raketenabwehr erheblich weiter vorangeschritten als gemeinhin in der öffentlich geführten politischen Debatte anerkannt wird. Der größte Fortschritt besteht darin, dass die NATO – v.a. die Europäer – scheinbar einen wesentlichen Punkt erkannt haben: Sofern das grundlegende Prinzip der Allianz – das Prinzip der Unteilbarkeit der Sicherheit – weiterhin Geltung haben soll, muss das ungeschützte NATO-Territorium zusätzlich gegen die wachsende Bedrohung durch BR gesichert werden. Das besagte Territorium sollte aber nicht nur grundsätzlich geschützt werden, sondern auch in einem vergleichbaren Maße wie die USA bisher planen, den amerikanischen Kontinent zu schützen. Zudem sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Europäer einen effektiven eigenen Beitrag zu ihrer Verteidigung leisten und sich ein angemessenes Maß an Einfluss bei den möglichen Raketenabwehroperationen zum Schutz ihres Territoriums sichern. Um diesen politischen und operationellen Anforderungen gerecht zu werden, böte sich ein kombiniertes US- /NATO-Raketenabwehrprogramm mit zwei Basen an. Zwei Basen – eine unter NATO-, die andere unter ameri- 184 Svenja Sinjen kanischer Flagge – verdeutlichten, dass die Verteidigung der USA unter amerikanischer Hoheit bliebe, während beide Seiten des Atlantiks die Verteidigung des Bündnisgebietes innerhalb der NATO gemeinsam betrieben und auch finanzierten. Zudem maximierten zwei Basen in Europa die Abfangwahrscheinlichkeit nicht nur für Raketen, die auf die USA, sondern auch für diejenigen, die auf Europa zielten. Obwohl diese Lösung zunächst vielleicht kostenintensiver erscheint, könnte sich die Zahl der insgesamt notwendigen Abfangraketen eventuell sogar reduzieren, wenn beide Basen als Teil eines Gesamtsystems operierten. Gleichzeitig müsste die NATO Raketenabwehrsysteme wie SM 3 und THAAD für die Verteidigung gegen Mittelstreckenraketen bereitstellen – ebenso wie GBI sind diese für die Verteidigung des Kontinents unerlässlich. Entschiede sich die NATO, eigene GBI zu stationieren, müsste das NATOProgramm gegenwärtig dennoch auf amerikanische Kommunikationsund Sensorsysteme wie z.B. Frühwarnsatelliten zurückgreifen. Zugleich müssten beide Basen im Ernstfall sowohl eng miteinander als auch mit dem US-Raketenabwehrkommando im Strategic Command zusammenarbeiten. Eine solche Problemstellung ist in der NATO jedoch nicht unbekannt. Eine Reihe von Kommandeuren tragen deshalb „Doppelhüte“, die zeigen, dass sie Teil der nationalen amerikanischen und Teil der NATOBefehlskette zugleich sind. So ist der NATO-Oberbefehlshaber SACEUR z.B. traditionell gleichzeitig der Kommandeur des amerikanischen Europakommandos EUCOM. In diesem Sinne sollte der Kommandeur der Raketenabwehreinheiten der NATO ein amerikanischer Offizier sein, der gleichzeitig durch SACEUR/Kommandeur EUCOM auch die amerikanische Basis befehligt. Einerseits hätte die NATO dann Zugang zu denjenigen amerikanischen Systemen, die dem Bündnis nicht assigniert sind. Zudem wäre eine integrierte Gefechtsführung gewährleistet. Andererseits hätte der NATO-Rat durch SACEUR und die NATO-Raketenabwehrbefehlskette die Oberhoheit über alle gemeinsamen Systeme der Allianz. Alles in allem könnten ca. 20 bodengestützte Abfangraketen, inklusive der amerikanischen zehn in Polen, in Verbindung mit THAAD und SM 3 einen Schutz gewährleisten, der mit dem für die USA vergleichbar wäre. Ein Angriff, der darauf zielte, ein derartiges Abwehrsystem zu durchbrechen, erforderte nicht nur substanzielle Investitionen auf Seiten des Aggressors, sondern erhöhte gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit einer nuklearen Vergeltung durch die NATO. Die Gesamtkosten für den NATOEtat eines solchen kombinierten Systems sollten zudem erheblich geringer als die 6-8 Milliarden Euro sein, die in der NATO-Machbarkeitsstudie veranschlagt wurden.5 5 Die USA veranschlagen die zehn Abfangraketen in Europa mit 1,6 Milliarden US-Dollar. Raketenabwehr für die NATO 185 6. Europäische Unterstützung für Obama gefordert Sollte die Obama-Administration die Raketenabwehrbasis in Osteuropa im Zuge der amerikanisch-russischen tatsächlich „opfern“, bräche ein wesentliches Element der US-Verteidigungsstrategie gegen MVW und BR weg. Da die USA bisher der Motor der Raketenabwehranstrengungen im Rahmen der NATO waren, ist davon auszugehen, dass auch das Bündnis insgesamt nicht in der Lage wäre, die bisherigen Fortschritte im Bereich seiner Strategieanpassung in ein wirkungsvolles Programm umzusetzen – nur unter erheblichen finanziellen Aufwendungen. Mit Blick auf den Gipfel zum 60-jährigen Bestehen der NATO, auf dem das tasking zur Erarbeitung für ein neues – den aktuellen Bedrohungen – angepasstes strategisches Konzept erfolgen soll, wäre diese Entwicklung ein fatales Signal der Verteidigungsunwilligkeit. Die NATO-Mitglieder haben sich nicht nur verpflichtet, sich gemeinsam zu verteidigen, sondern auch, die entsprechenden Fähigkeiten für eine effektive Verteidigung bereitzuhalten. Ein Raketenabwehrsystem zum Schutz des Bündnisgebiets könnte die bisherigen Anstrengungen der NATO zur Verbesserung des ABC-Schutzes und der offensiven Fähigkeiten im konventionellen Bereich, die seit Prag angestoßen wurden, sinnvoll optimieren. Dementsprechend sollte sich die NATO bei der gegenwärtigen Debatte nicht länger von der russischen Kritik vereinnahmen lassen. Die Geschichte hat gezeigt, dass Staaten mit erpresserischen und/ oder expansiven Zielen wie Nordkorea und Iran stets versucht haben, die Verwundbarkeit des Kontrahenten für ihre Zwecke auszunutzen. Eine Verteidigungslücke gegen Raketen auf Seiten der NATO lädt seine Gegner geradezu ein, sich diese Waffen zu beschaffen. Die transatlantischen Partner können sich gegen derartige Bestrebungen langfristig nur verteidigen, wenn sie den Technologiewettbewerb mit diesen Staaten dominieren und ihre Verteidigungslücken rechtzeitig immer wieder neu schließen. Die bekundeten russischen Interessen kann das geplante Raketenabwehrsystem kaum beeinflussen – dies ist unterdessen allseits anerkannt. Die Europäer sollten den neuen amerikanischen Präsidenten Obama geradezu ermuntern und unterstützen, den Weg von George W. Bush im Bereich der Raketenabwehr zu Ende zu gehen. Nur so können sie den Schutz ihres eigenen Kontinents gegen BR zu einem relativ geringen und effektiven Preis gewährleisten. No change at all – Die NATO-Politik der Obama-Administration Carlo Masala 1. Einleitung Nachdem der Jubiläumsgipfel der Allianz am 3./4. April 2009 in Straßburg und Kehl, an dem der neue amerikanische Präsident Barack Obama zum ersten Mal an einer Sitzung des Nord-Atlantik-Rates teilgenommen hat, vorbei ist, erscheint es legitim, eine erste vorläufige Bilanz hinsichtlich der Vorstellungen der gegenwärtigen US-Administration zur Zukunft der NATO und zur Rolle, die die USA in der NATO zukünftig einzunehmen gedenken, zu ziehen. Dies soll in dem vorliegenden Beitrag versucht werden. Die Ausgangsthese lautet dabei, dass – im Gegensatz zu anderen Politikbereichen (z.B. nukleare Abrüstung), in denen die US-Administration unter Präsident Barack Obama durchaus versucht, sich nicht nur von der Politik ihrer Vorgängerin zu distanzieren, sondern auch Neuansätze zu wagen – die NATO-Politik der USA von großer Kontinuität zu der Allianzpolitik der Bush-Administration gekennzeichnet ist. Dies erscheint auf den ersten Blick bemerkenswert. Denn gerade die neue US-Administration war ja unter dem Stichwort „change“ nicht nur in der Innenpolitik, sondern auch in der Außenpolitik angetreten. Wie lässt es sich somit erklären, dass die ersten Schritte der neuen Administration im Bereich der NATO-Politik doch eher von erstaunlicher Kontinuität als von angekündigtem Wandel gekennzeichnet sind? Betrachtet man einmal, wie Wandel und Kontinuität in der Theorie der internationalen Beziehungen erklärt bzw. nachvollzogen werden, so bieten sich zwei Ebenen der Analyse an, um die These von der Kontinuität amerikanischer NATO-Politik unter Präsident Obama zu erklären. Zunächst einmal kann die neorealistische Perspektive einen Beitrag dazu leisten, indem sie auf die strukturellen Rahmenbedingungen verweist, unter denen sich auch amerikanische Außenpolitik vollzieht. Da der Wechsel von Bush zu Obama nicht mit einem Wandel der Struktur des internationalen Systems einhergegangen ist, würde die neorealistische Erklärung lauten, dass die NATO-Politik der neuen US-Administration eher von Kontinuität als von Wandel geprägt sei. Ein zweiter Ansatz, der eher personaler Natur ist, würde darauf verweisen, dass die maßgeblichen Personen, die in der neuen US-Administration für die Allianzpolitik der USA zuständig sind (Hillary No change at all – Die NATO-Politik der Obama-Administration 187 Clinton, James Jones, Elizabeth Sherwood-Randall), für das Kontinuitätselement in der amerikanischen NATO-Politik unter Präsident Obama verantwortlich sind. Zwar haben die meisten von ihnen, mit Ausnahme von General James Jones, nicht unter Präsident Bush gearbeitet, jedoch ist man sich in der Forschung zur amerikanischen NATO-Politik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts relativ einig, dass die amerikanische NATO-Politik seit 1990 eine große Kontinuität aufweist, ungeachtet der Tatsache, ob ein Republikaner oder ein Demokrat im Oval Office residiert. Der vorliegende Beitrag versucht, im Sinne eines eklektischen Ansatzes beide Erklärungsstränge miteinander zu verbinden. Demzufolge ist die Tatsache, dass unter der Präsidentschaft Obamas bislang eine erstaunliche Kontinuität der NATO-Politik mit Blick auf die Vorgängeradministrationen zu beobachten ist, darauf zurückzuführen, dass sich an den strukturellen Rahmenbedingungen, unter denen die neue Administration agiert, nichts Grundlegendes geändert hat und das Personal, das gegenwärtig für NATO-Angelegenheiten verantwortlich ist, in ihren konzeptionellen Vorstellungen über die Zukunft der Allianz Kontinuität repräsentiert. Um dies aufzuzeigen, ist der vorliegende Beitrag wie folgt strukturiert. Zunächst einmal wird auf die strukturellen Rahmenbedingungen amerikanischer NATO-Politik eingegangen. Hierbei wird zwischen Konstanten und Veränderungen unterschieden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, welche Handlungsmöglichkeiten und Handlungseinschränkungen sich für die USA in der NATO durch diese Rahmenbedingungen ergeben. In einem weiteren Schritt wird dann, basierend auf zugänglichen Dokumenten, der Frage nachgegangen, welche konzeptionellen Vorstellungen die führenden Akteure in der neuen US-Administration mit Blick auf die Zukunft der Nordatlantischen Allianz verfolgen. Der Beitrag schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Aussagen des vorliegenden Beitrages nochmals zusammenfasst. 2. Strukturelle Bedingungen 2.1 Konstanten Amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik vollzieht sich nach wie vor in einem dezentralisierten anarchischen Selbsthilfesystem, in dem Staaten unter den Bedingungen eines Macht- und Sicherheitsdilemmas agieren und interagieren.1 Aus dieser Grundkonstellation resultiert ein kompetitiver Charakter in den zwischenstaatlichen Beziehungen. Da es an einer übergeordneten Instanz fehlt, die für Ordnung und Sicherheit im internationalen System Sorge tragen kann, stellen die Existenzerhaltung 1 Vgl. Herz, John H.: Weltpolitik im Atomzeitalter, Stuttgart 1961, S.130-131. 188 Carlo Masala und ggf. Existenzentfaltung für Staaten ein Problem ersten Ranges dar. In ihrer Beziehung zu anderen Staaten sind Staaten stets mit dem Problem der Macht konfrontiert bzw. ihr ausgesetzt, so dass zwischenstaatliche Kooperation zwar nicht unmöglich, aber schwierig ist, da eine übergeordnete Instanz fehlt, die den an der Kooperation beteiligten Staaten Erwartungssicherheit hinsichtlich der voraussichtlichen Kosten/Nutzen bietet bzw. einen Ausgleich zwischen Vor- und Nachteilen gewähren kann. In dieser Perspektive ist Außen- und Sicherheitspolitik immer Machtpolitik. 2.2 Veränderungen Während es mit Blick auf die Grundstruktur des internationalen Systems seit dem Westfälischen Frieden keine Veränderung gegeben hat, so hat das Ende des Ost-West-Konflikts eine entscheidende und einschneidende Veränderung mit Blick auf die Machtverteilung zwischen den Großmächten im internationalen System nach sich gezogen, die fälschlicherweise von einigen Wissenschaftlern2 und vor allem von der öffentlichen Meinung als Unipolarität charakterisiert wird. Denn ein genauer Blick auf die gegenwärtig zwischen den Großmächten existierende Machtverteilung offenbart, dass es sich bei dem momentanen internationalen System um ein multipolares System mit unipolarem sicherheitspolitischem Kern handelt,3 in dem die USA aufgrund ihrer militärischen Stärke eine besondere, jedoch nicht die herausragende Stellung einnehmen. 2.3 Konsequenzen Welches sind nunmehr die Konsequenzen, die aus der Grundstruktur des internationalen Systems für die Außen- und Sicherheitspolitik der USA resultieren? Im Folgenden werden drei Auswirkungen näher zu betrachten sein. Diese sind im Einzelnen a) der Aufstieg von Großmächten, b) die Schwächung multilateraler Institutionen und c) das Ende des politischen Westens. zu a) 2 3 Nicht erst seit dem russisch-georgischen Krieg vom Sommer 2008 ist die Tendenz zu beobachten, dass regionale Mächte mit zuneh- Wohlforth, William/Books, Stephen G.: International Relations Theory and the Case Against Unilateralism, in: Perspectives on Politics 3/2005, S.509-524. Vgl. ausführlicher dazu: Masala, Carlo: Den Blick nach Süden. Die NATO im Mittelmeerraum (1990-2003), Baden-Baden 2005, Kapitel II. No change at all – Die NATO-Politik der Obama-Administration 189 mendem Selbstbewusstsein und ordnungspolitischem Anspruch auf die Bühne der internationalen Politik zurückgekehrt sind. Insbesondere Russland und China machen aus ihrem Anspruch, regionale Ordnungsmächte zu sein, keinen Hehl und betreiben, teils offen, teils verdeckt, eine „strategy of denial“-Politik, die darauf abzielt, den militärischen, politischen und ökonomischen Einfluss der USA in ihren jeweiligen Regionen zurückzudrängen.4 Aber auch Brasilien und Indien entwickeln sich zu selbstbewussten regionalen Großmächten, die zunehmend die institutionellen Strukturen der in Zeiten des Ost-West-Konfliktes aufgebauten Weltordnung in Frage stellen.5 All diesen aufsteigenden Mächten ist gemein, dass sie (noch?) keine offene revisionistische Politik betreiben, die auf eine revolutionäre Umgestaltung der gegenwärtigen internationalen Ordnung abzielt. Jedoch gibt es bereits Anzeichen dafür, dass einige dieser aufstrebenden Staaten neben der machtpolitischen Konkurrenz zu den Vereinigten Staaten auch einen ordnungspolitischen Dissens im Bereich der Interpretation staatlicher Souveränität zu westlichen Staaten suchen. Die von europäischen Staaten sowie den USA in der letzten Dekade zusehends aufgeweichte Souveränitätsnorm, wonach interne Angelegenheiten eines Staates unter gewissen Umständen (Genozid, ethnische Vertreibungen) das Eingreifen anderer Staaten zur Pflicht machen (duty to protect),6 wird von diesen Staaten abgelehnt. Entgegen einer Aufweichung der Souveränitätsnorm betonen diese Staaten (insbesondere Russland und China) die fortdauernde Relevanz des Nichteinmischungsprinzips.7 Wie sich der Aufstieg neuer Großmächte in Zukunft konkret vollziehen wird, ob kooperativ oder konfrontativ, ist eine Frage, die aus der heutigen Sicht nicht beantwortet werden kann. Wohlgleich ist es jedoch bereits jetzt absehbar, dass das zukünftige internationale System ein multipolares sein wird, und die Frage, ob diese Multipolarität eine stabile oder instabile8 sein wird, hängt maßgeblich davon ab, ob die aufsteigenden Mächte die neue Ordnung als eine legitime, somit 4 5 6 7 8 Zu Russland siehe Toft, Monica Duffy: Russia‘s Recipe for Empire, http://www. foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=4462; zu China vgl. Christensen, Thomas: Fostering Stability or Creating a Monster? The Rise of China and U.S. Policy toward East Asia, in: International Security 1/2006, S.81-126. Vgl. Sewall, Sarah: A Strategy of Conservation: American Power and the International System, Harvard Kennedy School (Faculty Research Papers), Mai 2008 (RWP08-028), S.8. Vgl. Buchanan, Allen/Keohane, Robert O.: The Legitimacy of Global Governance Institutions, in: Ethics and International Affairs 4/2006, S.405-437. Vgl. Joint statement on a new world order in the 21st century issued by China and Russia on 04/07/2005, http://au.china-embassy.org/eng/xw/t202227.htm. Zur Unterscheidung zwischen stabiler und instabiler Multipolarität siehe Mearsheimer, John J.: The Tragedy of Great Power Politics, New York 2001, Kapitel 8. 190 Carlo Masala ihren Interessen dienlich, oder illegitime perzipieren werden. Sollte Letzteres der Fall sein, so ist eine Rückkehr zu einer globalen Politik der Konfrontation nicht auszuschließen. zu b) Es ist bereits angedeutet worden, dass die neuen aufstrebenden Großmächte die multilaterale Ordnung der Zeit des Ost-WestKonflikts zunehmend in Frage stellen. Doch auch seitens der Staaten, die maßgeblich am Aufbau dieser Ordnung beteiligt waren (allen voran die USA), ist diese multilaterale Ordnung zunehmendem Druck ausgesetzt. Denn seit dem Ende des Ost-West-Konflikts lehnen die USA zwar nicht den Multilateralismus als System der zwischenstaatlichen Beziehungen ab, torpedieren jedoch einen vertragsbasierten Multilateralismus, der ihre eigene Handlungsfreiheit (aus amerikanischer Perspektive) unnötig einschränkt.9 An die Stelle vertraglich basierter und damit handlungseinschränkend wirkender multilateraler Institutionen setzen die Vereinigten Staaten zunehmend auf informelle Gremien (wie z.B. die Proliferation Security Initiative), die aus ihrer Perspektive flexibler und effektiver sind und die die reale Machtverteilung zwischen den USA und den anderen an solchen Initiativen beteiligten Staaten widerspiegeln. Die zunehmende Abkehr der USA von tradierten Institutionen (insbesondere im sicherheitspolitischen Bereich) wirkt auch unmittelbar auf die NATO. Aus amerikanischer Sicht ist die Allianz ein zu vernachlässigendes Instrument ihrer politischen und militärischen Machtprojektion geworden, wenn sie nicht zur Durchsetzung amerikanischer Interessen genutzt werden kann. Da nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes Interessendivergenzen zwischen den USA und insbesondere den „alten europäischen“ NATO-Mitgliedern in nahezu allen politischen und militärischen Fragen vorherrschen,10 ist seitens der amerikanischen Administration, aber auch der außenpolitischen Eliten am Potomac11 ein zunehmendes Interesse an der Allianz zu konstatieren. An die Stelle von Politik in Desinteresse tritt zunehmend Politik außerhalb von Institutionen, in Direktoraten oder sogenannten Koalitionen der Willigen und Fähigen. Die Schwächung multilateraler Institutionen ist jedoch nicht nur auf der globalen Ebene zu konstatieren und nicht nur durch die USA verursacht, sondern vollzieht sich auch regional. Durch ihre 9 10 11 Vgl. Ikenberry, G. John: Is American Multilateralism in Decline?, in: Perspectives on Politics 3/2003, S.533-550. Vgl. Haftendorn, Helga: Das Ende der alten NATO, in: Internationale Politik 4/2002, S.49-54. So haben sich beide Kandidaten im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf bislang kaum zur Allianz und ihrer Bedeutung für die Außen- und Sicherheitspolitik der USA geäußert. No change at all – Die NATO-Politik der Obama-Administration 191 Erweiterung nach Osten bei gleichzeitig ausbleibender Vertiefung ist auch der europäische Handlungsrahmen der Bundesrepublik Deutschland in eine schwere Krise geraten, und zwar nicht nur hinsichtlich der institutionellen Weiterentwicklung der EU, sondern auch bezüglich ihrer Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Insbesondere die Fragen, wie die Beziehungen zu den USA und zu Russland zukünftig gestaltet werden sollen, spalten die Unionsmitglieder. Die meisten osteuropäischen Staaten würden eine Konzeption befürworten, in der Europa unter amerikanischer Hegemonie eine konfrontative Politik gegenüber der russischen Föderation betreibt, was von den meisten Gründungsmitgliedern der EU abgelehnt wird. Dieser konzeptionelle Dissens lähmt jedoch die konsequente Weiterentwicklung der GASP und vor allem der ESVP hin zu Instrumenten politischer und militärischer Machtprojektion der EU.12 zu c) 12 13 Die skizzierte Schwächung der beiden für transatlantische Außenund Sicherheitspolitik zentralen multilateralen Institutionen belegt auch die Tatsache – und das wird von den meisten führenden Politikern diesseits und jenseits des Atlantiks bis heute nicht wahrgenommen –, dass der Westen als politische Handlungseinheit nicht mehr existiert. Zwar werden die europäischen Staaten und die USA auch weiterhin durch ihre gemeinsame Geschichte und Kultur auf das Engste verbunden bleiben, daraus zu folgern, dass sie aber auch zukünftig eine stabile politische Handlungseinheit bilden werden, ist jedoch verfehlt.13 Nach dem Wegfall des gemeinsamen Feindes werden die USA und Europa nur noch auf einer Ad-hoc-Basis – wenn Interessenidentität vorherrscht – gemeinsam handeln. Wenn jedoch Interessendivergenzen zwischen den USA und den Europäern, aber auch unter den Europäern selbst handlungsbestimmend sein werden, wird die Außen- und Sicherheitspolitik im transatlantischen und europäischen Rahmen durch Koalitionen der Willigen und Fähigen dominiert sein, die sich teils der vorhandenen Institutionen bedienen werden. Wenn dies jedoch nicht möglich sein sollte, werden die Staaten auch außerhalb dieser handeln. Kietz, Daniela/Perthes, Volker (Hrsg.): Handlungsspielräume einer EU-Präsidentschaft. Eine Funktionsanalyse des deutschen Vorsitzes im ersten Halbjahr 2007, Berlin 2007. Anders als Angelo Bolaffi und auch Werner Link sehe ich auch nicht die Aufteilung in den amerikanischen und den europäischen Westen, da die Interessendivergenzen unter den Mitgliedstaaten der EU ebenso groß sind, wie die zwischen der EU und den USA. Vgl. Bolaffi, Angelo in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.5.2003. Allerdings würde ich in Anknüpfung an beide Autoren auch argumentieren, dass die Rekonstruktion des europäischen Westens eher wahrscheinlich ist als die des transatlantischen Westens. 192 Carlo Masala Nachdem Kontinuitäten und Veränderungen in der internationalen Politik kurz skizziert wurden, soll nun untersucht werden, wie sich diese auf die Allianz und insbesondere auf die amerikanische NATO-Politik auswirken. 3. Allianzen im neuen internationalen System Ein multipolares System mit unipolarem (sicherheitspolitischem) Kern hat unmittelbare Auswirkungen auf Allianzen, in denen die sicherheitspolitisch unipolare Macht Mitglied ist. Zunächst einmal muss festgehalten werden, dass die sicherheitspolitische Machtasymmetrie zwischen dem Unipol und den anderen Allianzmitgliedsstaaten dazu führt, dass der Unipol immer weniger auf Koordination und Abstimmung seiner Politik mit anderen Allianzmitgliedern angewiesen ist.14 Die überragende Machtfülle versetzt ihn in die Lage, seine Politik ohne die Unterstützung von Alliierten umzusetzen. Zugleich ist die überragende Macht nicht auf alle Allianzmitglieder bei der Verfolgung ihrer Ziele angewiesen. Er kann cherry-picking betreiben, um sich eine loyale Koalition zur Verfolgung seiner Ziele zusammenzustellen. Die existierenden Machtasymmetrien innerhalb einer solch konfigurierten Allianz stellen für die „schwächeren Staaten“ insofern ein Problem dar, als dass ihr Einfluss auf die Politik der überragenden Macht sinkt. Während zu Zeiten des Ost-West-Konfliktes die europäischen Staaten durchaus in der Lage waren, die Politik der USA in Teilen zu beeinflussen,15 schwinden die Möglichkeiten der Einflussnahme unter den Bedingungen sicherheitspolitischer Unipolarität. Dies bedeutet nicht, dass Allianzmitglieder keine Möglichkeit haben, sich dem Druck der unipolaren Macht zu entziehen oder sogar dagegen zu wirken, wie die deutsch-französischen Versuche zur Delegitimierung des Irak-Krieges 2002/2003 gezeigt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jedoch in der Lage sind, die stärkste Macht in der Allianz von ihrer Politik abzubringen, ist angesichts der vorhandenen Machtasymmetrien eher gering. Was sich in einer Allianz unter den Bedingungen sicherheitspolitischer Unipolarität verschärft, ist das von Glenn Snyder herausgearbeitete „entrapment“ und „abondonment“-Problem,16 wonach schwächere Staaten einer Allianz im Falle eines Konfliktes mit einem Allianzmitglied fürchten müssen, im Stich gelassen zu werden (abandonment), und die stärkste 14 15 16 Die folgenden Ausführungen stützen sich in wesentlichen Teilen auf Masala: Den Blick nach Süden, sowie Walt, Stephen M.: Alliances in a Unipolar World, in: World Politics 1/2009, S.86-120. Vgl. Risse-Kappen, Thomas: Cooperation among Democracies: The European Influence on U.S. Foreign Policy, Princeton 1995. Vgl. Snyder, Glenn: Alliances Politics, Ithaca 1997. No change at all – Die NATO-Politik der Obama-Administration 193 Allianzmacht zurückhaltend sein wird, sich in Konflikte verwickeln zu lassen (entrapment), die aus ihrer Sicht nicht von vitalem Interesse sind. Nachdem die strukturellen Auswirkungen des neuen internationalen Systems für die allianzinterne Kooperation skizziert wurden, soll in einem nächsten Schritt dargelegt werden, welche konkrete Politik seitens der Obama-Administration mit Blick auf die NATO verfolgt wird. 4. No change at all Die Allianz spielte im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eine nur untergeordnete Rolle. Nur mit Blick auf Afghanistan, einem zentralen Thema des außenpolitischen Teils der Obama-Kampagne, war beständig zu hören, dass „[t]he US has to put more resources and troops into Afghanistan, and NATO should do the same, while – to the greatest extent possible – lifting operational restrictions“.17 Bereits hier deutete sich Kontinuität zu der Haltung der Bush Jr.-Administration an. Auch diese hatte stets gefordert, dass die Europäer (und hier insbesondere die Deutschen) sich stärker in Afghanistan mit Kampftruppen engagieren sollten. Ansonsten war aber, abgesehen von Obamas Berliner Rede vom 24. Juli 2008, in der er die Deutschen ebenfalls zu mehr militärischem Engagement in Afghanistan aufforderte, die NATO kein Thema des US-amerikanischen Wahlkampfes. Dass die NATO nach dem Endes des Ost-West-Konfliktes nicht mehr im Zentrum des strategischen Interesses der Vereinigten Staaten stand, machte Obama in seiner Rede vor dem Chicagoer Council on Global Affairs am 23. April 2008 deutlich, als er ihre Bedeutung für die amerikanische Außenpolitik im 21. Jahrhundert dadurch relativierte, dass er ankündigte, „as we strengthen NATO, we should also seek to build new alliances and relationships in other regions important to our interests in the 21st century“.18 Kurz nach dem Amtsantritt der neuen Administration bot sich Vizepräsident Biden die Gelegenheit, die Vorstellungen der neuen Administration zur Zukunft der NATO auf der Münchner Sicherheitskonferez im Februar 2009 darzulegen. Wie Josef Bramel richtig schreibt, hätte diese Rede auch von der Vorgängerregierung formuliert werden können.19 Die Allianz, so Biden, müsse sich auf die neuen Gefährdungslagen im 21. Jahrhundert einstellen, die nicht mehr nur regionaler, sondern auch funktionaler 17 18 19 Rice, Susan: Each Side has to do more, Interview mit der Wochenzeitschrift „Der Spiegel“, http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,567066,00. html Remarks of Senator Barack Obama to the Chicago Council on Global Affairs, 23.4.2007, http://my.barackobama.com/page/content/fpccga/ Bramel, Josef: Im Westen nichts Neues?, in: APuZ 15-16/2009, S.15-21, hier S.17. 194 Carlo Masala Natur seien (Cyber-Attacks, Energiesicherheit etc.).20 Damit setzte Biden ebenfalls ein Zeichen der Kontinuität zur Vorgängerregierung, die bereits seit 2004 versucht, die NATO in diese Richtung zu drängen. Gleichzeitig bekräftige Biden in seiner Rede, dass die USA angesichts der vom Iran ausgehenden Bedrohung an dem Raketenabwehrschild in Polen und der Tschechischen Republik festzuhalten gedenken, was Präsident Obama in seiner Prager Rede vom 5. April 2009 nochmals bekräftigte.21 Angesichts der Tatsache, dass bereits die Bush-Administration mit ihren Raketenabwehrplänen einen Spaltpilz durch die Allianz getrieben hatte, ist auch in diesem Politikfeld seitens der neuen Administration am Potomac Kontinuität zu beobachten. Und auch im Vorfeld des NATO-Gipfels von Straßburg und Kehl im April 2009 wurde deutlich, dass die neue US-Administration in Kontinuität zu ihrer Vorgängerin steht. Der nationale Sicherheitsberater James Jones (ehemaliger SACEUR) verlangte im Vorfeld des NATO-Gipfels umfassende strukturelle Reformen für die Allianz, die diese – aus amerikanischer Sicht – in die Lage versetzen sollten, schneller, effektiver und effizienter auf zukünftige Herausforderungen zu reagieren. Worin diese Reformen genau bestehen sollen, ließ Jones offen. Man kann aber ahnen, was dem nationalen Sicherheitsberater vorschwebt. Bereits als SACEUR (somit als hoher General der Bush-Administration) schrieb Jones zusammen mit SACT-Admiral Giambastiani (Supreme Allied Commander Transformation) 2004 die „Strategic Vision“ , die u.a. verklausuliert die Abschaffung des Military Committees der NATO, des höchsten militärischen Beratungsgremiums für den Nord-Atlantik-Rat, forderte.22 Auch hinsichtlich anderer Politikbereiche zeichnet sich bereits jetzt eine große Kontinuität amerikanischer NATO-Politik ab, die von der Clintonüber die Bush Jr.- bis hin zur Obama-Administration reicht. Insbesondere die Frage der zukünftigen Ausrichtung der Allianz liefert dafür ein beredtes Beispiel. Wie die beiden Vorgängerinnen so ist auch die Obama-Administration bestrebt, die Allianz in ein global einsetzbares Bündnis zu transformieren, und sucht zu diesem Zwecke die enge Anbindung nicht-europäischer Staaten wie z.B. Japan, Australien und Süd-Korea an die Allianz. Eine global agierende NATO mit außereuropäischen Partnern soll möglicherweise zukünftig das Kernstück eines Projektes werden, 20 21 22 Vgl. Biden, Joseph R.: Speech at the 45th Munich Security Conference, http:// www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2009=&sprache=e n&id=238& Vgl. http://www.huffingtonpost.com/2009/04/05/obama-prague-speech-onnu_n_183219.html Vgl. hierzu Yost, David: Interview with General James L. Jones, Rom 2008, S.4. No change at all – Die NATO-Politik der Obama-Administration 195 das insbesondere der Leiterin des Planungsstabes des State Departments, Ann-Marie Slaughter, am Herzen liegt: die Schaffung einer Community of Democracies, deren Aufgabe es sein sollte, global massive Menschenrechtsverletzungen zu verhindern.23 Die NATO würde in dieser Konzeption der bewaffnete Arm der Community sein, die im Auftrage dieser Einsätze zum Schutz der Menschenrechte durchführen würde.24 Die hier angeführten Beispiele, und es ließen sich noch mehrere anfügen, zeigen deutlich, dass es mit Blick auf die in der neuen US-Administration für die NATO verantwortlichen Personen eine große Kontinuität im Denken über die Zukunft der NATO gibt. Diese Kontinuität reicht über die Bush-Administration hinaus zurück zur Clinton-Administration, in der die meisten heute mit NATO-Fragen befassten Akteure bereits hohe Positionen inne hatten. Aus dieser Perspektive ist trotz aller Ansätze zur Neuformulierung amerikanischer Außenpolitik, die sich in anderen Politikfeldern abzeichnen, die NATO-Politik der neuen amerikanischen Administration von beeindruckender Kontinuität zu ihren beiden Vorgängerinnen geprägt. 5. Fazit Der folgende Beitrag ist von der These ausgegangen, dass sich die NATOPolitik der Obama-Administration weniger durch „change“ als vielmehr durch Kontinuität auszeichnet. Bei der Frage, warum die NATO-Politik durch beachtliche Kontinuität zu der Politik der beiden Vorgänger-Administrationen gekennzeichnet ist, wurden zwei Argumente miteinander verknüpft. Zum einen lässt sich die Kontinuität aus der Struktur des internationalen Systems, insbesondere aus der militärischen Machtverteilung in diesem, erklären. Die dort noch existierende Unipolarität eröffnet den Vereinigten Staaten Handlungsspielräume und begrenzt ebendiese für die europäischen Allianzmitglieder. Doch der Verweis auf die militärische Machtverteilung alleine genügt nicht, um die konkrete NATO-Politik der Obama-Administration zu erklären. Denn der Blick auf die militärische Machtverteilung als alleinige Erklärungsvariable würde Agency ausschließen und einen Erklärungsdeterminismus erzeugen. Ebenso bedeutsam erscheint es, die handelnden 23 24 Vgl. Slaughter, Anne-Marie: America‘s Edge: Power in the Networked Century, in: Foreign Affairs 1/2009, http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/AmericasEdgeFA.txt. Vgl. Daalder, Ivo/Lindsay, James: Democracies of the World, Unite, in: The American Interest Online, http://www.the-american-interest.com/ai2/article. cfm?Id=220&MId=8 196 Carlo Masala Personen in dieser Administration und ihre Konzeptionen zur Zukunft der Allianz näher zu betrachten. Und hier lassen sich große Kontinuitätslinien zu beiden Vorgänger-Administrationen feststellen. In dem Zusammenspiel zwischen Strukturen und Akteuren muss man abschließend festhalten, dass von der neuen US-Administration weniger Wandel als vielmehr Kontinuität zu erwarten sein wird bzw. sich bereits jetzt abzeichnet. Dies bedeutet aber auch, dass man sich in Europa keinerlei Illusionen hingeben sollte, die darauf abzielen, zu einem neuen strategischen Konsensus innerhalb der Allianz zu gelangen. Zu unterschiedlich sind hier die Vorstellungen diesseits und jenseits des Atlantiks. Sicherheit ohne die USA? Die NATO in der Perzeption Europas Klaus Naumann 1. Einführung Europa hat fast sechzig Jahre Nutzen aus der amerikanischen Bereitschaft gezogen, Europa als Teil amerikanischer Sicherheit zu sehen und den Schutzschirm der „erweiterten“ nuklearen Abschreckung (Extended Deterrence) über Europa aufzuspannen. Im Kalten Krieg haben damit vor allem die USA Krieg in Europa gegenüber einer Angriff unter Einschluss eines nuklearen Erstschlages planenden Sowjetunion verhindert. Nach Ende des Kalten Krieges waren es erneut die USA, die den Frieden in Europa wiederherstellten, als sie sich entschlossen, im Rahmen der NATO die jugoslawischen Sezessionskriege zu beenden und durch den Doppelansatz Erweiterung der NATO und Partnerschaft für den Frieden eine friedliche Neuordnung des post-sowjetischen Europas zu ermöglichen. Als die USA nach dem 11. September 2001 den Krieg gegen den Terrorismus aufnahmen, zerbrach die „Pax Americana“ in Europa, und die schon am Ende des Kalten Krieges aufgeworfene Frage nach der Zukunft der NATO und nach einer Sicherheit Europas ohne die USA wurde wieder gestellt. Mit Amtsantritt der Regierung Obama mag sich die Frage erneut stellen, denn trotz der wahrscheinlichen Rückkehr der USA zu multilateraler Außen- und Sicherheitspolitik ist nicht ausgeschlossen, dass Präsident Obama wie G.W. Bush Europa für befriedet hält und seine Schwerpunkte im Nahen Osten und in Asien sieht. Die Frage, ob es Sicherheit für Europa ohne die USA geben kann, stellt sich daher auf beiden Seiten des Atlantiks. Eine Antwort verlangt zunächst die Lage Europas Anfang 2009 zu betrachten, dann zu bewerten, wie die Sicherheit Europas gewahrt werden kann, bevor man beurteilt, ob dies ohne die USA gelingen kann und welche Rolle dabei die NATO spielt. 2. Die Lage Die Welt war schon vor den aufwühlenden Entwicklungen seit Anfang August 2008, erst im Kaukasus, dann auf den weltweiten Finanzmärkten und 198 Klaus Naumann schließlich zum Jahresende in Nahost in einem Prozess anhaltenden Wandels, ausgelöst durch dramatische, Grenzen und Kontinente überschreitende, alle Lebensbereiche erfassende Veränderungen. Vieles verändert sich gleichzeitig und wirkt aufeinander ein. Es gibt nicht mehr die halbwegs stabile Weltordnung des Kalten Krieges, es sind viele der alten Konflikte ungelöst, man denke nur an das im August 2008 in Georgien zum Teil detonierte Pulverfass Kaukasus, an den Nahen Osten oder vor Europas Haustür den Balkan. Es wird viel von einer multipolaren Welt geredet, aber noch niemand hat erklärt, wie man in ihr Stabilität erreicht. Doch es gibt eine gute Nachricht: Ein großer Krieg in Europa, dem Schlachtfeld unzähliger Kriege seit 300 Jahren, ist so gut wie ausgeschlossen. Aber seit Oktober 2008 weiß die Welt, dass sich zusätzlich zu den akuten, immer regionalen Krisen globale Krisen mit der Geschwindigkeit von Tsunamis entwickeln können. In der Finanzkrise stand die Welt am Abgrund, und sie ist noch keineswegs in Sicherheit. Man weiß nun, wie rasch die Kontrolle verloren geht, dass aus einer Finanzkrise Staatskrisen, ja Demokratiekrisen werden können. Leider, das ist die schlechte, aber nicht überraschende Nachricht, könnte es in der Zukunft noch mehr Krisen dieser Dimension geben, denn der Welt stehen weitere globale und oft dramatische Veränderungen bevor. Um zu beantworten, ob Europa Sicherheit ohne die USA erreichen kann, sind zuerst die längerfristigen Entwicklungen zu betrachten, denn in den aktuellen Krisen kann man nur nutzen, was man zur Verfügung hat, also NATO und EU. Vier langfristige Krisen Vier langfristige Entwicklungen, die zu Krisen und Konflikten führen können, sind heute erkennbar: demographische Verschiebungen, Verknappung überlebenswichtiger Ressourcen, weitere industrielle Revolution und Klimawandel. Als erste dramatische, seit langem bekannte, aber politisch vernachlässigte Veränderung sind die weltweiten demographischen Umwälzungen zu nennen. Sie werden vor allem Europas Gesellschaften gewaltige Belastungen aussetzen. Europas Bevölkerung nimmt ab und wird älter. Sie dürfte um 2050 im Durchschnitt 50 Jahre alt sein, während die Bevölkerung Nordamerikas zunehmen und das heutige Durchschnittsalter von 37 Jahren bewahren wird. Russlands Bevölkerungsabnahme auf bis dahin möglicherweise weniger als 100 Millionen ist noch dramatischer, und sie kann sich durch die weitere Ausbreitung von Aids und Tbc sogar noch beschleunigen. Die heute noch rund sechs Millionen ethnischer Russen, Sicherheit ohne die USA? Die NATO in der Perzeption Europas 199 die das nahezu menschenleere, aber unglaublich rohstoffreiche Sibirien bevölkern, werden hilflos zusehen müssen, wie sich die heute rund vier Millionen illegalen chinesischen Immigranten weiter vermehren dürften. In Asien wird Indien schon bald das bevölkerungsreichste und zugleich das Land der Welt sein, das mehr Akademiker sein eigen nennen darf als jedes andere Land, aber eben auch die meisten Analphabeten. In China wird die Bevölkerung überaltern und mit den Spätfolgen der „Ein-KindPolitik“ ringen, während die Gesellschaft mit mehr als 150 Millionen Arbeitslosen, 200 Millionen gegenwärtig zum Teil gerade freigesetzten Wanderarbeitern, einer unglaublichen Umweltverschmutzung und einer rasant zunehmenden Urbanisierung fertig werden muss. Wachstum und Verjüngung der Gesellschaften werden wohl nur Afrika – und das trotz Krieg und Aids –, die arabische Welt und Südamerika erleben. Daraus könnten Migrationswellen entstehen, die vor allem Europa treffen dürften. Diese Entwicklungen sind nicht mehr umkehrbar. Sie werden weltweit, aber ganz besonders in Europa Spannungen auslösen, weil die Sozialsysteme nicht mehr finanzierbar sein werden und sich die meisten europäischen Länder Einwanderern werden öffnen müssen. Die zweite Entwicklung ist die Verknappung überlebenswichtiger Ressourcen. Blutige Konflikte um keineswegs überlebenswichtige, aber zur Gewinnmaximierung unentbehrliche Rohstoffe sieht man im Kongo, wo die Rivalität zwischen Tutsi und Hutu wohl nur das Mäntelchen ist, das seit Jahren dort über Coltan und Ähnlichem liegt. Die Konkurrenz um immer knapper werdende Rohstoffe, an der Spitze Wasser, Gas und Öl, wird immer härter werden und zu Konflikten führen, denn Europa, Indien und China brauchen zum Überleben gesicherte Energieimporte. Europa wird selbst dort, wo man klugerweise an Atomenergie festhält, seinen Energiebedarf nicht durch erneuerbare Energien decken können und würde, selbst wenn es die Verschwendung, Öl zu verbrennen, beendete, abhängiger sein als die USA, die durch neue Technologien und die Nutzung ungenutzter Potenziale durch Spielen mit dem Gas- und Ölhahn kaum erpressbar sein werden. Weltweit dürfte aber der Kampf um Wasser die Konfliktursache der Zukunft werden, denn schon heute decken 40% der Menschheit ihren Wasserbedarf aus ausländischen Quellen. Trend Nummer drei, die Notwendigkeit, als Folge weiterer technischer Revolutionierung der Fertigung arbeitsintensive Produktion und Dienstleistungen zunehmend an kostengünstigere Länder außerhalb der industrialisierten Welt abzugeben, wird zu weiteren Belastungen der Arbeitsmärkte und der Sozialsysteme einerseits und zu zunehmendem Wettbewerb um junge Hochqualifizierte andererseits führen. Europa, Nordamerika und Japan werden sich zum Preis erheblicher Veränderung industrieller Struktu- 200 Klaus Naumann ren und daraus folgenden steigenden Qualifikationsanforderungen an die Arbeitskräfte wohl bis auf Weiteres in den High Value Märkten behaupten können, und die ungleiche, Konflikte fördernde Verteilung des Reichtums auf dieser Welt dürfte sich auch nicht ändern, obwohl sich das BSP von Indien und China verdreifachen könnte. Trend Nummer vier sind Klimawandel und Umweltbelastung. Auch sie dürften zu Krisen und Konflikten führen. Ein Beispiel: Klimaveränderung dürfte mehr als ethnische oder religiöse Fragen zum Krieg in Darfur geführt haben, diese Tragödie ist vielleicht der erste Klimakrieg. Sollten die Prognosen zur Erderwärmung wahr werden, dann wird man noch mehr Konflikte dieser Art sehen. Dort, wo verseuchte Umwelt zu Wassermangel führt, wird man andere Konflikte sehen. Wie so oft werden in ihnen die Schwachen zu Terrorismus greifen, und die organisierte internationale Kriminalität, darunter auch Piraterie, wird blühen. Daneben wird es Konflikte zwischen Staaten geben – man denke nur an offene Fragen wie die zwischen Russland und Norwegen strittige Aufteilung des ölreichen Kontinentalschelfs vor Spitzbergen oder die Frage, wie neue Seewege in den möglicherweise eisfrei werdenden arktischen Meeren zu kontrollieren sind. Diese vier Entwicklungen werden die Gesellschaften im Inneren verändern, natürlich unterschiedlich stark, und sie werden nach Außen zu Konflikten führen, auch zu bewaffneten. Sie könnten sogar neue Formen von Regierungsorganisation erzwingen, weil die Probleme nicht mehr in den engen Grenzen von Ministerien, oft noch nicht einmal mehr auf nationalem Level zu lösen sein werden. Es wird also mehr internationale Zusammenarbeit nötig sein, obwohl die Neigung der Nationen wächst, zunächst einmal nationalstaatlich zu handeln, obwohl die Gestaltungsfähigkeit der Nationen schrumpft. Europa wird all diese Veränderungen unmittelbar miterleben, sogar stärker als jeder der anderen großen Akteure auf der Weltbühne wie die USA, Russland, China, Indien und Japan, denn es liegt näher als jeder von ihnen an der Schlüsselzone der Weltpolitik der näheren Zukunft, dem erweiterten Nahen Osten, der Zone, in der sich all die genannten Trends bündeln und von der Europa abhängiger ist als jeder andere Akteur der Weltpolitik. Konflikte in Europas Umfeld sind deshalb nahezu unvermeidlich. Sie könnten entstehen durch – – – Auseinandersetzungen über den Zugang zu und die Verfügung über existenzielle Ressourcen wie Wasser, Ernährung, Energie und Gesundheitsfürsorge, Migration auslösende Folgen des Klimawandels, diese neuen Konfliktursachen verschärfende traditionelle Konfliktgründe wie ungelöste territoriale Ansprüche, Zugehörigkeit zu frem- Sicherheit ohne die USA? Die NATO in der Perzeption Europas – 201 den Ethnien oder Stämmen, ungleiche Machtverteilung oder religiöse Spannungen und die zerfallende Macht von Staaten in einer Welt, in der nicht-staatliche Akteure zunehmend über alle Machtmittel verfügen können, aber keinerlei Kontrolle unterliegen. Neue aggressive und expansive Ideologien könnten jede dieser Konfliktursachen durch Agitation und Nutzung weltweiter Kommunikation verschärfen. Diese künftigen Konflikte werden oftmals durch ein Nebeneinander des Handelns staatlicher und nicht-staatlicher Akteure gekennzeichnet sein, wobei Letztere zunehmend über das volle Gewaltpotenzial der Staaten verfügen dürften. Das Gewaltmonopol der Staaten wird zerbrechen und die nicht-staatlichen Akteure werden ohne jede Bindung an Recht oder sittliche Norm handeln, während die Staaten in ihrer Abwehr an diese Normen gebunden bleiben müssen. Viele künftige Konflikte dürften innerstaatlich und lokal beginnen, einige könnten anfänglich herkömmliche Kriege sein, und fast alle werden als „war amongst the people“, als Krieg mitten unter den Menschen, geführt werden. Viele Konflikte werden schnell regionale, manchmal sogar globale Bedeutung erlangen. Die Bereitschaft der Regierungen, ja nahezu der Zwang, Konflikte vorbeugend weit außerhalb ihrer Region einzudämmen, könnte zunehmen, aber die Fähigkeit der Völker, solches Handeln zu verstehen und über relativ lange Zeiträume mitzutragen, dürfte abnehmen. Das 21. Jahrhundert wird ein unruhiges Jahrhundert werden, in dem es manchen Konflikt und neben dem bekannten Krieg zwischen Staaten auch neue Formen der Gewalt wie Cyberwar und den Kampf transnationaler Kräfte gegen Staaten geben wird. Es wird anfangs wohl eine Welt ohne Weltordnung sein, auch weil die Pax Americana in Europa an Bedeutung verloren hat, im Nahen Osten nicht so richtig greift, aber doch unersetzbar ist und nur im Pazifik der Stabilitätsfaktor schlechthin bleibt. Die Staatenwelt wird auf der Suche nach einer neuen Ordnung nur sehr langsam begreifen, dass kein Staat der Welt, auch nicht der Mächtigste, auf sich allein gestellt seine Menschen schützen kann. Alle wissen, dass weder militärische Mittel allein noch pazifistischer Verzicht auf sie Frieden sichern kann. Die Zukunft gehört den internationalen Organisationen, obwohl die Mächtigen dieser Welt sich schwer tun, dort Schwächeren Einfluss zu geben und Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Doch auch die Schwachen tun sich schwer, denn sie müssen Souveränität abgeben. Hinzu kommen zwei zusätzliche Gefahrenquellen: nukleare Proliferation und Cyber Operations. Die Welt wird bis 2050 eine Renaissance von Kern- 202 Klaus Naumann kraftwerken erleben, bis zu 1.400 neue Kernkraftwerke sollen ans Netz gehen, deren Nebenprodukt Atomwaffen sein können. Neue Anstöße zu deren Reduzierung sind dringend geboten. Sie haben aber nur eine Chance, wenn sie von den USA ausgehen. Eine andere neue Gefahr, die den Terrorismus und organisierte Kriminalität noch verstärkt, entsteht aus der zunehmenden Anwendbarkeit von Cyberwar durch Staaten und nicht-staatliche Akteure. Cyberwar macht einen Paradigmenwechsel der Strategie möglich, weg von der Vernichtung des Gegners und hin zur strategischen, möglicherweise präventiven Lähmung der Machtpotenziale. Die Entwicklung ist atemberaubend. Waren es 2000 noch vier Gbps, die zur Lähmung von Systemen anwendbar waren, so sind es heute, nur neun Jahre später, bereits 16 Gbps. Man sollte daher nicht nur den Cyberattack auf Estland 2007 gründlich auswerten, sondern auch bedenken, welche Möglichkeiten damit dem organisierten internationalen Verbrechen offenstehen, dessen wachsender „Umsatz“ von zwei bis drei Billiarden USD pro Jahr die Nutzung modernster Technik erlaubt. All diesen Konfliktursachen und -formen muss durch eine geeignete Sicherheitsarchitektur begegnet werden. Sie kann nur wirksam sein, wenn die in ihr verbundenen Staaten den Willen haben zu handeln und alle ihre Instrumente nutzen. Vor allem aber, und das ist das entscheidende Kriterium für die Beantwortung der Frage, ob Europa ohne die USA auskommen kann, verlangt Konfliktbewältigung der Zukunft globale Handlungsfähigkeit. 3. Die aktuellen Krisen Zusätzlich muss die Staatenwelt, so auch Deutschland, mit aktuellen Krisen und Konflikten fertig werden, denen man mit den vorhandenen Instrumenten begegnen muss. Diese sind ohne die USA unwirksam, deshalb gibt es kurz- und mittelfristig keine Sicherheit für Europa ohne die USA. Viele der heutigen Konflikte verlangen Handeln in Europa oder in seiner Peripherie, so die ungelösten Fragen auf dem Balkan und im Kaukasus oder die brennenden Fragen in Nahost. Die Anerkennung des Kosovo durch die USA und Teile der EU mag Russlands Entscheidung in der Georgien-Krise beeinflusst haben, ganz gewiss aber hat sie für Unruhe auf dem Balkan gesorgt, denn so mancher in dem künstlichen Konstrukt BosnienHerzegowina träumt nun von Unabhängigkeit, vor allem in der „Republicka Serbska“. Nicht wenige wären bereit, dafür erneut zu den Waffen zu greifen. Europa muss daher auf dem Balkan engagiert bleiben und muss Wege finden, über die Integration Serbiens in die EU zu dauerhaften Lösungen zu kommen. Sicherheit ohne die USA? Die NATO in der Perzeption Europas 203 Doch die dringlichste Frage ist die der Stabilität im Raum des erweiterten Nahen Ostens, der Schlüsselzone der Weltpolitik der näheren Zukunft. Keine der dort anstehenden Fragen darf in Isolation gesehen werden. Die vielleicht noch einfachste ist Irak, wo es zu gelingen scheint, so etwas wie eine zwar noch brüchige, doch zum Teil schon belastbare Stabilität herzustellen. Doch im Nahen Osten haben sich seit 2003 die Machtverhältnisse fundamental verändert. Zur Staatenwelt ist ein in seiner Vielschichtigkeit kaum erfassbarer Akteur hinzugetreten, und zwar der politische Islam, und das politische Zentrum ist der Golf mit den beiden rivalisierenden Mächten Saudi-Arabien und Iran geworden. Dort muss die Lösung der Probleme im Nahen Osten gesucht werden, nicht im politischen Sumpf Palästina. In der Region haben Vorschläge nur dann eine Chance, wenn die USA dahinterstehen. Das gilt vor allem für den Iran, weil Iran zum globalen Problem werden könnte. Es besteht noch immer eine – vielleicht die letzte – Chance, doch noch eine friedliche Lösung im Konflikt über das iranische Nuklearprogramm zu erreichen. Der Iran verfolgt ohne jeden Zweifel entgegen all seinen Behauptungen ein Atomwaffen-Programm. Atomwaffen zu besitzen ist keineswegs nur ein Ziel des amtierenden iranischen Präsidenten, es war das Ziel iranischer Führer seit dem Schah. Die anstehenden Wahlen dürften daran nichts ändern. Der Iran dürfte jetzt in der Lage sein, die Schwelle zum Bau einer Nuklearwaffe zu überschreiten. Die Anreicherung des bis dahin produzierten Reaktorbrennstoffs in waffenfähiges HEU (Highly Enriched Uranium) könnte beginnen. Von da an sind es nur noch Monate bis zum Besitz einer, wenn auch zunächst noch recht primitiven Atomwaffe. Die notwendigen Trägerraketen, die Israel und sogar die östlichsten Teile Europas erreichen können, besitzt Iran bereits. Die Alarmglocken schrillen deshalb in Israel, denn für Israel ist eben schon eine Bombe eine existenzielle Gefahr. Keine israelische Regierung wird angesichts der Vernichtungsdrohungen durch Präsident Ahmadineschad dieser Entwicklung tatenlos zusehen. Doch nur die USA könnten Israel von einseitigem Handeln abhalten. Das aber kann nur gelingen, wenn Russland und China ihr den Iran eher förderndes denn behinderndes Verhalten aufgeben, sich endlich voll hinter die Forderungen des UNSC stellen, die UN neue, verschärfte Sanktionen beschließt und diese dann auch von allen umgesetzt werden. Würden die USA dann ein neues Paket für den Iran aus Sicherheitsgarantien und wirtschaftlichen und politischen Anreizen und einem umfassenden Lösungsansatz für Nahost anbieten, dann bestünde die Chance einer gesichtswahrenden Lösung. Angesichts der jüngsten Gewalt im Gaza-Streifen ist das noch viel schwerer geworden, denn weder die Hamas noch ihre Geldgeber in Teheran scheinen Interesse an einer dauerhaften Konfliktlösung zu haben. Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah leben von Konflikt, und Hem- 204 Klaus Naumann mung, Menschen in ihrer Gewalt als Geisel zu nehmen, kennen sie nicht. Die Gutwilligen, die gegen Israel protestieren, machen sich unwissend zu Helfershelfern der radikalen Kräfte in der islamischen Welt, wie dies auch ein Teil der Medien tut, wenn sie Ängste vor einem Flächenbrand im Nahen Osten schüren. Diese Krise vor Europas Haustür belegt, dass nur die USA, nicht aber Europa eine Friedensregelung erreichen können. Sie ist dringlich, denn man sollte keine Illusionen haben: Israel wird nicht zusehen, bis der Iran eine Atomwaffe hat, mit der er seine Drohungen gegenüber Israel wahrmachen kann. Diese Krise hat eine globale Dimension: Gelingt es nicht, Iran an der Schwelle zur „virtuellen“ Atommacht einzufrieren, dann könnte die relativ stabile Welt des Atomwaffensperrvertrages mit fünf erklärten und drei unerklärten Atomwaffen-Staaten zu Ende gehen, denn die Folge des iranischen Griffs zur Bombe könnte die nukleare Bewaffnung von Staaten wie Saudi-Arabien, Syrien und Ägypten, vielleicht auch der Türkei sein. Das Ergebnis wäre eine höchst instabile Welt, in der die Folgen aus dem Bau von 1.400 neuen Kernkraftwerken bis 2050 nicht mehr zu kontrollieren wären und in der man auch den Einsatz von Nuklearwaffen durch einen der möglicherweise vielen neuen Nuklearwaffen-Staaten nicht mehr völlig ausschließen könnte. Das ist die weltpolitische Dimension der Iran-Krise, die zeigt, dass eine Lösung wichtiger ist als jedes Geschäft. Doch auch in Afghanistan darf nicht gewartet werden. Im Sommer stehen Wahlen an, das bedeutet Spannungen. Hunger und Gewalt sind heute der Alltag, auch im Norden. Die Menschen sind unzufrieden, denn nach sechs Jahren ist landesweit allenfalls punktuelle, aber keine deutliche Besserung der Lebensbedingungen eingetreten. Sie sehen zunehmend die Fremden als unerwünschte Besatzer. Die Taliban, von denen vermutlich weniger als zehn Prozent unbelehrbare Eiferer sind, haben Zulauf. Zudem gibt ihnen die Instabilität im benachbarten Pakistan einen idealen Ruheraum in den Stammesgebieten an der Grenze. Einfach mehr NATO-Soldaten bringt in dieser Lage keine Lösung. Das Problem ist ein politisches. Die Afghanen sehen in der ihnen übergestülpten fremden Ordnung einer „starken“ Zentralregierung nicht „ihre“ Lösung, und der bislang ungestörte Teufelskreis aus Drogenhandel, Waffenhandel und Korruption erzeugt Unsicherheit, schwächt die von Korruption nicht freie Zentralregierung, treibt das Land immer mehr in die Hände rivalisierender Warlords und gibt den Taliban das Geld, das sie zur Finanzierung ihrer Mitläufer brauchen. Die gültige Strategie muss deshalb aufbauend auf den bisherigen unbestreitbaren Erfolgen noch einmal überprüft und zu einer mit einer „counterinsurgency strategy“ verknüpften Aufbaustrategie gemacht werden. Deren Ziel wäre es, gemeinsam mit gemäßigten Kräften eine afghanische Ordnung zu suchen, die afghanischen Sicherheitsorgane, also Militär und Polizei, zu stärken und den kriminellen Teufelskreis aus Drogenhandel, Korruption und Bewaffnung der Warlords zu durchbrechen. Dann könnte das Sicherheit ohne die USA? Die NATO in der Perzeption Europas 205 sichere Umfeld entstehen, in dem die Sicherheit Schritt für Schritt und gleichzeitig der Wiederaufbau des Landes weiter vorangebracht wird. Es genügt daher nicht, über vernetzte Sicherheit zu reden. Man muss gemeinsam mit den Verbündeten handeln, auch wenn dies Risiken in sich birgt, denn in Afghanistan gibt es keine Teillösungen für den Süden oder den Norden. Afghanistan wird entweder als Ganzes gewonnen oder verloren, doch verloren darf es nicht werden, denn dann entstünde eine neue Brutstätte des Terrorismus. Im Übrigen ist Afghanistan längst ein regionales Problem geworden, dessen Lösung die Mitwirkung Pakistans, des Iran und Indiens verlangt. Europa ist hier gefordert, und es sei erinnert, dass es Deutschland war, das im Jahr 2002 gefordert hat, Afghanistan zur NATOOperation zu machen. Afghanistan kann noch ein Erfolg werden, ein „weiter so“ ist allerdings der sichere Weg ins Verderben, nicht in eine militärische, aber in eine politische Niederlage der westlichen Welt. Sie würde weit über die Region hinaus destabilisierend wirken. Gelänge es aber, Iran und Afghanistan einer Lösung zuzuführen und im Irak die gegenwärtige brüchige Ruhe zu wahren, dann könnte man eine Friedenslösung für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern gestalten. Dies ist durch den jüngsten Konflikt in Gaza unglaublich schwer geworden, denn Hamas hat mit der Macht der Bilder vergessen machen können, dass sie die Unruhestifter sind. Israel hat zwar seine Abschreckungskraft wiederhergestellt, aber die Fundamentalisten in der arabischen Welt sind wohl gestärkt worden. Jede Lösung verlangt amerikanische Führung und europäisches Engagement. Vor allem verlangt sie sofortiges Handeln, weil dafür wohl die gesamte Amtszeit des neuen Präsidenten gebraucht werden wird und weil Israel aus demographischen Gründen die Zeit unter den Fingern zerrinnt. Gelänge die Entschärfung der Iran-Krise, dann hätten die USA sich die neuen Regierungen Israels und Saudi-Arabiens verpflichtet. Damit dürfte auch Syrien verhandlungsbereit werden, weil es ohne den Iran den Ausgleich braucht und weil die Hisbollah ohne Iran so geschwächt wäre, dass Syrien im Libanon flexibel sein kann. Mit einer Iran-Lösung würde auch die Hamas ihre Sponsoren verlieren. Dann könnten die USA Druck auf Israel und Syrien ausüben und die Saudis bewegen, die Palästinenser zum Einlenken zu bringen. Gemeinsamer Druck Washingtons und Riads könnte zu ersten greifbaren Ergebnissen einer Zwei-Staaten-Lösung führen und daraus entstünde die Hoffnung auf Frieden zwischen Israel und dem neuen Staat Palästina. 206 Klaus Naumann Doch neben den brennenden Krisen sind die kurz- und mittelfristigen Entwicklungen in Asien und das Verhältnis zu Russland zu betrachten, wenn man beurteilen will, ob es Sicherheit für Europa ohne die USA geben kann. In Asien, dem einzigen Teil der Welt, in dem die Pax Americana unverändert der Garant relativer Stabilität ist, besteht kein kurzfristiger Handlungsbedarf. Im gefährlichsten Fall, Nord-Korea, gehen die Verhandlungen zunächst weiter, und in der Taiwan-Frage droht in nächster Zeit vermutlich kein Konflikt, da beide Seiten miteinander sprechen. China, das auch mittelfristig keine nennenswerte Fähigkeit zur Machtprojektion besitzt, will die USA in der Region engagiert halten, denn damit gewinnt Beijing den politischen Spielraum zur Bewältigung seiner inneren Probleme und die Chance, sein Wirtschaftswachstum fortzusetzen. Dazu braucht China freien Zugang zum amerikanischen Markt. China und die USA sind wirtschaftlich in einer symbiotischen Beziehung, darum kann es für China kurz- und mittelfristig nur den Weg der Kooperation geben. China braucht die USA im pazifischen Raum als Ordnungsmacht, nur dann kann es seine langfristigen Optionen entwickeln. Schwieriger ist das Verhältnis zu Russland. Es besteht keine Gefahr eines bewaffneten Konfliktes mit der NATO, dazu ist Russland militärisch zu schwach. Es besteht auch keine Gefahr für einzelne NATO-Staaten, solange die NATO geschlossen bleibt und sich eine glaubwürdige Fähigkeit zur kollektiven Verteidigung erhält. Das allerdings geht nur mit den USA, eine autonome europäische Verteidigung des EU-Gebietes ist weder kurznoch mittelfristig machbar. Das Problem mit Russland ist psychologischer Natur. Das Putin’sche Russland handelt aus einem Gefühl gedemütigten Stolzes. Russland möchte Nummer Zwei auf der Welt sein, und seine Regenten glauben aus einer Position der Stärke handeln zu können. Aber Russland ist eher schwach, denn – – – – es kann nur Waffen und Rohstoffe exportieren und Letztere auch nur dann über 2011 hinaus, wenn der sogenannte Westen bei der Modernisierung der Förder- und Transportanlagen hilft, es steht in einer nicht unbeträchtlichen, aber nicht zugegeben wirtschaftlichen Krise, die durch die fallende Ölpreise noch verschärft werden könnte, seine Militärreform ist gescheitert und es steht vor einer demographischen Katastrophe, die zu immer weniger Russen an den verwundbarsten Grenzen führen wird. Doch Moskau fühlt sich stark. Das erklärt die zum Teil tölpelhaften Aktionen seit Sommer 2008: die unverhältnismäßige Gewalt in Georgien und die Anerkennung der abtrünnigen Provinzen, die törichte Ankündigung Sicherheit ohne die USA? Die NATO in der Perzeption Europas 207 Medvedjews, neue Raketen im Oblast Kaliningrad am Tag der amerikanischen Wahl zu stationieren, und das erneute Spiel mit dem Gashahn im Januar 2009, das unschwer als Versuch zu erkennen war, die Ukraine von ihrer Hinwendung nach Westen abzuhalten und Europa zu zeigen, dass man von EU- wie NATO-Erweiterungen besser die Finger lässt. Eines der zentralen Probleme europäischer Sicherheit bleibt deshalb, das amerikanische „commitment“ glaubhaft zu erhalten und einen Weg partnerschaftlicher Kooperation mit Russland zu finden, ohne ihm ein „droit de regard“ einzuräumen. Europa kann hier eine hilfreiche Rolle spielen, nicht als Mittler, dafür ist es nicht mächtig genug und zu gespalten. Doch Europa könnte dem neuen US-Präsidenten verdeutlichen, dass man im Verhältnis zu Russland sehr viel Geduld braucht und man sich von der Erfahrung leiten lassen muss, dass man einem schwachen Gegner nicht von ihm subjektiv als Demütigung empfundene einseitige Entscheidungen zumuten darf, sondern mit ihm sprechen muss und ihm durch eine gemeinsame Vision eine helfende Hand geben sollte. Soweit die aktuellen Krisen. Man könnte nun die anhaltenden Kriege in Afrika und die Spannungen in Südamerika hinzufügen, doch die Frage ist ja, Sicherheit für Europa ohne die USA. In beiden Fällen, Afrika wie Lateinamerika, besteht keine direkte Gefahr für Europa, auch wenn die wirtschaftlichen Folgen dort anhaltender Konflikte schwerwiegend sein könnten. 4. Europäische Sicherheit ohne die USA? Europa ist politisch uneinig und in Fragen der Sicherheitspolitik zutiefst gespalten. Die EU, von vier Millionen Iren in eine tiefe Krise gestürzt, hat gegenüber allen anderen internationalen Organisationen einen großen Vorzug: Sie verfügt über alle Mittel der Politik und damit genau über die Bandbreite der Instrumente, die man für eine wirksame Sicherheitspolitik braucht. Aber sie leidet unter zwei gravierenden Schwächen: – – Es fehlt der politische Wille, notfalls rasch, entschlossen und hart zu handeln. Die militärischen Mittel der EU sind unzureichend. Sie reichen nicht einmal aus, das Gebiet der EU-Staaten vor den heute bestehenden Gefahren zu schützen, von nennenswerter Projektion militärischer Macht über Europa hinaus ganz zu schweigen. Das aber ist genau das, was Europa braucht, denn die mittel- bis langfristig drohenden Gefahren verlangen globale Handlungsfähigkeit, also nicht nur die Fähigkeit, das eigene Gebiet reaktiv zu schützen, sondern vor allem die Fähigkeit, aktiv den Gefahren dort zu begegnen, wo sie entstehen. 208 Klaus Naumann Allein, so die von niemandem ernsthaft bestrittene Folgerung, kann Europa Sicherheit nicht bewirken. Hoffnungen auf UN und OSZE zu setzen, ist weltfremd, und das im Kalten Krieg bewährte Verfahren, Sicherheit in starkem Maße an die USA „ outzusourcen“, ist nicht mehr möglich, nicht zuletzt, weil Amerikas Rolle in der Welt sich verändert hat. Die USA haben seit 2001 viel von ihrer einstigen Glaubwürdigkeit verloren, und sie sehen sich in einem langen Krieg gegen den globalen Terrorismus. Sie sind und bleiben entschlossen, ihn zu gewinnen. Europa bleibt daher bis auf Weiteres keine bessere Wahl, als Sicherheit in der NATO zu suchen. Doch dazu ist das Bündnis erheblich umzugestalten, und es muss sich durch intensive Zusammenarbeit mit der EU in die Lage versetzen, vernetzte Sicherheit zu gestalten. Unter diesem Dach könnte Europa langfristig eigene Fähigkeiten zu begrenzten Operationen außerhalb Europas entwickeln, sei es im Rahmen der NATO oder als eigenständige EU-Operation. Dem entsprechen übrigens die Verpflichtungen, die die EU-Staaten in der NATO und in der EU mit dem Prague Capability Commitment, den Headline Force Goals 2010 und dem European Capability Action Plan übernommen haben, aber allenfalls verbal erfüllen. Europa muss dazu auch seine Perzeption der NATO ändern. Die NATO muss zwar weiterhin der Garant kollektiver Verteidigung des Bündnisgebietes bleiben, doch sie darf sich damit nicht begnügen. Sie darf aber auch nicht globaler Akteur werden. Die NATO muss dem heute gebotenen erweiterten Sicherheitsbegriff entsprechend umgestaltet werden. Dazu braucht sie eine neue „Grand Strategy“, in der alle Instrumente der Krisenbewältigung, vor allem auch nicht-militärische, und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, insbesondere der EU, auf das Ziel der Verhinderung bewaffneter Konflikte ausgerichtet werden. Dieser Strategie entsprechend müssten dann die Mittel gestaltet werden. Ziel sollte dabei sein, das vorhandene Geld für die Streitkräfte so auszugeben, dass man die NATO-Staaten, deren Interessen und deren Menschen durch eine Kombination von aktiver und reaktiver Verteidigung schützen kann und dennoch in der Lage bleibt, wo geboten, im Rahmen von UN und NATO zur Abwehr von Gefahren auch außerhalb des NATO-Gebietes zu handeln. Dazu müssen die meisten europäischen Streitkräfte auf den Prüfstand, aber auch Rüstungsprojekte, die, im Kalten Krieg geboren, die Kassen von heute belasten und die notwendige Modernisierung in Schlüsselfähigkeiten wie Informationsüberlegenheit behindern. Die Europäer täten gut daran, gemeinsam mit den USA eine Reihe von Kernfähigkeiten, sogenannte „strategic enablers“, zu entwickeln, zu beschaffen und gemeinsam zu betreiben. Dazu gehören Satelliten für Aufklärung, Navigation und Kommunikation, unbemannte Aufklärungsflugzeuge mit globaler Reichweite, unbemannte Kampfflugzeuge, Raketenabwehr, elektronische Kampfführung und wirklich strategisch zu nennende Luft- und Seetransportkapazitäten. Hätte dann Europa eine leistungsfähige Rüstungsindustrie, was aber niemals heißen darf, europäisch Sicherheit ohne die USA? Die NATO in der Perzeption Europas 209 zu entwickeln, wenn man günstig „off the shelf“ kaufen kann, dann erschiene es möglich, bis ca. 2020 ohne erhebliche Mehrkosten europäische militärische Fähigkeiten zu schaffen, die Europa in die Lage versetzen würden, auch künftig gemeinsam mit seinen amerikanischen Verbündeten operieren zu können und in begrenztem Maße selbstständig auch außerhalb Europas unter Einsatz aller Mittel der Politik zu handeln. Würde Europa dann noch die eingeleiteten Schritte zum Aufbau einer europäischen Polizeitruppe, zum Aufbau europäischer Katastrophenhilfsdienste und zum Aufbau eines EU-Entwicklungshilfskorps tun, dann würde die EU zu einem Akteur mit begrenzten globalen Handlungsoptionen. Europa wäre damit immer noch nicht auf Augenhöhe mit den USA, aber es wäre ein so begehrter Partner, dass man dort nicht mehr entscheiden würde, ohne Europa vorher gefragt zu haben. Das sollte das Ziel Europas sein. Damit würde man auch aus amerikanischer Sicht das Richtige tun, denn ein stabiles, mit den USA fest verbundenes Europa erhöht die globale Handlungsfähigkeit der USA. 5. Fazit Es gibt bis auf Weiteres keine Sicherheit für Europa ohne die USA. Die NATO als Ausdruck der vertraglichen Verpflichtung der USA, zusammen mit den Europäern für gemeinsame Sicherheit im Raum zwischen Vancouver und Brest-Litowsk zu sorgen, muss bestehen bleiben und weiterentwickelt werden. Der NATO-Gipfel im April 2009 gibt Präsident Obama und den Verbündeten die Chance, eine grundlegende Reform der NATO einzuleiten. Dabei gilt es, Bewährtes wie kollektive Verteidigung und den Leim des Bündnisses, die faire Teilung von Risiken und Lasten, zu erhalten und Neues zu gestalten. Was gebraucht wird, ist die Vision eines Bündnisses der Staaten Europas und Nordamerikas, die von gleichen Werten und Überzeugungen ausgehend bereit sind, sich gemeinsam gegen alle Formen von Gefahr zu schützen, ohne irgendjemandem ihr Modell aufzwingen oder ihre Region ausweiten zu wollen, die Kooperation mit anderen Staaten und Regionen suchen und die gemeinsam und mit ihren Partnern daran arbeiten, die Zone gemeinsamen Schutzes von Finnland nach Alaska zur Grundlage für eine mit Russland zu gestaltende Zone gemeinsamer Sicherheit von Vancouver nach Wladiwostok zu machen. Dies wäre eine solide Basis für die umfassende Zusammenarbeit Europas und der USA bei der Bekämpfung der globalen Fragen unserer Zeit, dem Kampf gegen die Erderwärmung, dem Kampf gegen Hunger und Wassermangel und dem Kampf gegen Seuchen und Pandemien. Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges Lothar Rühl Russland ist auch seit dem Ende der Sowjetunion im Dezember 1991 der zentrale strategische Maßstab für die europäische Sicherheit und für den Nutzen der euro-atlantischen Allianz geblieben. Zwar ist die militärische Bedrohung des über die Mitte des Kontinents erweiterten atlantischen Europas aus dem Osten zurückgewichen, doch bleiben im europäischen Maßstab erhebliche, vor allem nukleare Angriffsfähigkeiten in Russland erhalten. Diese müssen sich nicht nach Westen richten. Aber sie können über die Meere und z.B. im Mittleren Osten wirken. Das reduzierte russische Militärpotenzial ist noch immer als Instrument der russischen Außenpolitik einsetzbar. Jelzin setzte es im Tschetschenienkrieg ab Dezember 1994 ein und warnte Europa vor einem „kalten Frieden“, den die Politik der NATO herbeizuführen drohe. Er tat dies in Budapest anlässlich der Unterzeichnung der KSZE-Beschlüsse über die Einrichtung der OSZE. Putin setzte es im zweiten Tschetschenienkrieg zu Beginn seiner Präsidentschaft und seither wieder 2008 gegen Georgien ein. Moskau hat die militärisch gestützte Machtpolitik nicht aufgegeben und verfolgt eine offensive Strategie nicht nur zur Krisenbeherrschung, sondern auch zur Kontrolle seiner geographischen Peripherie. Die russische Sicherheitsstrategie sagt dies auch in allen ihren Fassungen – von der ersten unter Jelzin an – deutlich aus. Die Wiederaufrüstung nach den Jahren der Wirren und der Schwächung hat 2000 unter Putin begonnen. Ihre Fortsetzung ist allerdings von der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung, besonders von den Investitionen in den brüchigen Produktionsapparat und in die unzureichende Infrastruktur wie in die mangelhaften Transportkapazitäten abhängig. Dies gilt auch für die Erdgas-/Erdöl-Infrastruktur im Hohen Norden und in Sibirien, die eine neue Großmachtbasis bieten soll und für die russische Außenpolitik genutzt wird, wie die Krisen zwischen Russland und der Ukraine oder Weißrussland seit 2005/06 gezeigt haben. Dabei steht Russlands Rolle und Zuverlässigkeit als Energiesicherheitspartner Europas, das insgesamt etwa 60 Prozent seines Bedarfs an Erdgas aus Russland oder über Russland deckt, in Frage.1 1 Die Zahlen schwanken seit 2007, als für 2007 noch 25-30% Erdgaseinfuhr aus Russland in die EU angegeben wurde, für Deutschland 35-37%, für osteuropäische Länder um die 60%; vgl. Meier-Walser, Reinhard C. (Hrsg.): Energieversorgung als sicherheitspolitische Herausforderung, Berichte & Studien 88/2007, S.109-110; vgl. für Zukunftsprojektion: BAKS Berlin, Seminar für Sicherheitspolitik 2008, Energiesicherheit 2050, hier S.19-23. Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 211 Seit dem Krisenjahr 2008 steht ein Fragezeichen hinter der gesamten weltwirtschaftlichen Entwicklung, nicht nur hinter der russischen Wirtschaft. Die künftige Korrelation der Kräfte zwischen Russland und Europa, China, Japan und Amerika ist derzeit unkalkulierbar, damit sind auch die strategischen Qualitäten der Akteure nicht bestimmbar. Eines aber ist sicher: Russland wird auch künftig eine kritische Größe, ein schwer berechenbarer Unsicherheitsfaktor und ein notwendiger Sicherheitspartner der USA, der nordatlantischen Allianz und der Europäischen Union bleiben. Dies gilt für die USA wie für Japan und China auch im Fernen Osten mit dem Problem Korea und der nordkoreanischen Nuklear- und Raketenrüstung, für die neuen Kernwaffenstaaten Indien und Pakistan, für Zentralasien und für den Mittleren Osten, an den die NATO über die Türkei grenzt. Das militärische Engagement der NATO mit den USA in Afghanistan ist im Norden auf Zentralasien und indirekt auf Russland abgestützt. Wenn künftig der Nachschubweg von Karatschi über den Kyberpass mit derzeit etwa 10.000 LKW-Ladungen am Tag für die US-/NATO-Truppen gesperrt oder unsicher werden sollte, würde die NATO in Afghanistan für ihre rückwärtigen Verbindungen einseitig von Russland abhängig, wie es das deutsche Kontingent im Norden schon zum Teil ist. Kooperation mit Russland und Verzicht auf unnötige politische Herausforderungen Moskaus durch die NATO-Partner sind also im eigenen Interesse geboten. Die Vetomacht Russlands als Ständiges Mitglied des Uno-Weltsicherheitsrates, die privilegierte Position als originärer Kernwaffenstaat im Rahmen des NPT, des internationalen Vertrags gegen die Weiterverbreitung nuklearer Rüstungen, die militärische Nuklearmacht Russlands und deren strategisches Waffenarsenal mit dem technischen Entwicklungspotenzial, schließlich der aus den fossilen Energiequellen strömenden wirtschaflichen Möglichkeiten werden Russland eine globale Macht sichern und als privilegierten Partner der atlantischen Führungsmacht Amerika erhalten. Dies wurde auch von Präsident Bush jun. im Frühjahr 2008 vor der Georgienkrise noch einmal bei dem Zusammentreffen mit Putin in Sotschi ausdrücklich bestätigt, wo im gemeinsamen Kommuniqué von „joint leadership“ oder „gemeinsamer Führung“ in Angelegenheiten globaler Sicherheit die Rede war.2 Selbst wenn man die gipfelübliche Rhetorik abzieht und von der quasitestamentarischen Willenskundgebung der beiden scheidenden Präsidenten (von denen der russische als Regierungschef an der Macht blieb) absieht, so bleibt doch der harte politische Kern übergeordneter gemeinsamer Sicherheitsinteressen, die Präsident Obama faktisch bestätigt hat: 2 Vgl. Kommuniqué vom 5.4.2009; die erklärte Absicht „gemeinsamer Führung“ wurde von den beiden Außenministern Lawrow und Rice vor der Presse in Sotschi explizit herausgehoben. 212 Lothar Rühl – der Begrenzung strategischer Eskalationsrisiken in internationalen Krisen, auch durch Abrüstung auf niedrigere Paritätsobergrenzen der strategischen Kernwaffen, – der Nichtweiterverbreitung nuklearer Rüstungen und nuklearfähiger Flugkörpersysteme, – der Bewahrung der operativen Überlegenheit ihrer Streitkräfte über die von Nuklearmächten zweiter und dritter Ordnung, – der Bekämpfung des internationalen Terrorismus, – der Eindämmung des Islamismus bei Erhaltung der politischen und territorialen Stabilität im weiteren Mittleren Osten als größtem internationalen Krisengebiet mit den größten Energiequellen, und – der Kontrolle der internationalen Seefahrt und des Luftverkehrs, im konkreten Fall zur Unterdrückung von Piraterie und für sicheres Geleit. Diese Themen wurden in Sotschi auch als gemeinsame Aufgaben von den beiden Außenministern hervorgehoben. Präsident Medwedjew wird, ganz unabhängig vom fortdauernden politischen Einfluss Putins als Regierungschef, an dieser politischen Agenda der Kooperation mit Washington trotz aller Gegensätze und aktuellen Konflikte im Ansatz nichts ändern, weil es sich um dauernde und wesentliche gemeinsame Interessen handelt, die zum beiderseitigen Vorteil zu wahren sind. Dies schließt Krisen im Verhältnis zu Washington und Konflikte mit den USA über andere politische Fragen wie in der Vergangenheit nicht aus. Die NATO-Osterweiterung und das Vorhaben strategischer Raketenabwehr der USA in Europa sind seit Jahren aktuelle Beispiele für solche Gegensätze. Doch die Grundlinie der Risikobegrenzung wird auch in internationalen Spannungslagen mit gegensätzlichen politischen Interessen beider ungleichen Mächte beibehalten werden wie in den Nahostkriegen und in den Balkankriegen. Deshalb wird auch die Administration Obama darauf achten, wie immer die kurz- bis mittelfristigen Prioritäten unter dem Druck der aktuellen Lage gesetzt werden mögen. Im Nahen Osten wird Russland nicht gebraucht, wohl aber im Mittleren Osten im Umgang mit dem iranischen Atomenergieprogramm und zur Sicherung des Erdöltransports in Krisenzeiten wie im irakisch-iranischen Krieg der 1980er Jahre. Diese Grunddaten werden auch die Politik der Obama-Präsidentschaft gegenüber Russland anleiten. Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 213 Der Augustkrieg des Jahres 2008 in Georgien nach dem Angriff der Georgier in Südossetien3 und die Dauerkrise im Verhältnis Russlands und der Ukraine über Preis, Mengen und Bedingungen der Zufuhr und Durchleitung von Erdgas aus Russland nach Westen seit Ende 2005 haben bestätigt, dass die Spannungen im Osten Europas und damit zwischen dem euro-atlantischen Bündnis und Russland andauern, dass jederzeit Konflikte aufbrechen oder neue entstehen können, weil der fundamentale Gegensatz und die Instabilitäten entlang der historischen Bruchlinien auf dem Kontinent fortbestehen. Weder die Ukraine noch Russland, weder Weißrussland noch die in NATO und EU aufgenommenen baltischen Staaten sind stabil, noch weniger die südkaukasischen oder die zentralasiatischen. Dies gilt natürlich auch für die internationale Vertragslage zur Kontrolle von Waffen, nuklearem und toxischem Material, der Nichtweiterverbreitung von wissenschaftlicher und waffentechnischer Expertise, zur Kontrolle der Laboratorien und Fabrikationsanlagen für nukleare, chemische und biologische Kampfmittel. Das Sicherheitsproblem der Proliferation von Massenvernichtungsmitteln besteht überall im Orient. Russland ist ein Teil davon. Insofern verbinden sich auch beide als Maßstäbe der euroatlantischen Sicherheit zu einer den westlichen Horizont füllenden Bedrohungsperspektive in der absehbaren Zukunft. Deshalb ist der Umgang mit Russland für die euro-atlantischen Staaten das zentrale Sicherheitskriterium weit über Europa hinaus. Die Kalkulierbarkeit der russischen Politik und die angemessene Berücksichtigung der tatsächlichen strategischen Bedürfnisse im Verhältnis zu Russland samt den Risiken für den Westen und den erkennbaren russischen Sicherheitsinteressen gegenüber dem NATO-Bündnisgebiet, das seit 1990 um bis zu 1.000 km nach Osten auf Russland zu ausgeweitet wurde, sind Elemente des euro-atlantischen Sicherheitskalküls. Damit sind der Einfluss und die Bedeutung Russlands für das nordatlantische Bündnis wie für die Europäische Union gekennzeichnet. Die verbliebenen nuklearfähigen Kurzstreckenraketen, die neuen 500km-weit reichenden „Iskander“-Raketen und die modernen Interkontinentalraketen variabler Reichweite „Topol-M“, die auch auf europäische Ziele eingestellt werden können, exemplifizieren das Problem im Bereich der Kernwaffen und die Möglichkeit für Russland, die Rüstungskontrollverträge zu umgehen. 3 Vgl. „Rights group assails foes in Georgia war“ über die georgische Kriegseröffnung durch „Angriff auf die Hauptstadt Südossetiens Tskhinvali am 7. August“; in: International Herald Tribune (IHT), 24./25.1.2009. Eine Sachverhaltsaufklärung durch eine unparteiische internationale Untersuchung steht noch aus, doch die westlichen Nachrichtendienste einschließlich des BND waren schon im Spätsommer 2008 davon überzeugt, dass Georgien angegriffen hatte. 214 1. Lothar Rühl Der historische Hintergrund und die Entwicklung seit 1991 1.1 Allianzgründung 1949 Die expansive Politik der Sowjetunion seit dem II. Weltkrieg, beginnend 1939 in Polen, kulminierend 1948 in der Tschechoslowakei und mit der Blockade West-Berlins im gemeinsam besetzten Deutschland war die Ursache der Allianzgründung im April 1949. Sie kam auf britische Initiative zwischen zehn Staaten Westeuropas und Nordamerika zustande. Das Engagement der USA und Kanadas für die gemeinsame Verteidigung und Sicherheit Westeuropas war in erster Linie gegen die sich militärisch konkretisierende und politisch aggressiv zugespitzte sowjetrussische Bedrohung gerichtet, obwohl der Washingtoner Vertrag im Unterschied zu früheren Bündnissen nicht gegen ein bestimmtes Land oder eine Staatengruppe geschlossen wurde, sondern allgemein gegen Bedrohungen der gemeinsamen Sicherheit. Seither blieb die Abwehr einer Bedrohung durch die Sowjetmacht im Osten Europas die Hauptaufgabe der NATO, die Konfrontation mit dem von Moskau geschaffenen „Ostblock“ im „Warschauer Pakt“ bis 1990 ihr Hauptzweck, mehrmals bestätigt durch die Interventionen der Sowjetarmee 1953 in der damaligen DDR, 1956 in Ungarn und 1968 in der damaligen Tschechoslowakei gegen demokratische Freiheiten. 1961 bedrohte Moskau in der Berlinkrise Westeuropa mit einem Großaufmarsch von etwa einer Million Soldaten in Ost-/Mitteleuropa. In der strategischen Richtung Ost wurde das nordatlantische Bündnis auch von Nordamerika her über den Nordatlantik von Island, dem dänischen Grönland und Norwegen an der Nordflanke, Portugal mit seinen Atlantikinseln im maritimen Zentrum, Dänemark an den Ostseeausgängen, Großbritannien als Rückgrat der Nordflanke und Westeuropas, Frankreich einschließlich des französischen Algerien in Nordafrika, Italien im Mittelmeer als zentrale Position mit der Flanke über die Adria zum Balkan und mit der Türkei als dem südöstlichen Eckpfeiler und Sperre gegenüber Sowjetrussland militärisch organisiert. Westdeutschland war als von den drei Westmächten besetztes Gebiet und strategisches Vorfeld Westeuropas von vornherein eingeschlossen, 1955 wurde die Bundesrepublik in die NATO aufgenommen. Das Ganze sollte der sowjetrussischen Expansionspolitik, so wie sie seit Ende der 1940er Jahre im Westen wahrgenommen wurde, den gesamten euro-atlantischen und mediterranen Raum, damit auch den Zugang zum Mittleren Osten und weiter zum Indischen Ozean, versperren. Geopolitisch und strategisch gesehen war die NATO bis zum Ende der Sowjetunion und des Warschauer Pakts 1991 ein interkontinental-maritimes Bündnis zur Sicherung des Nordatlantik und der europäischen Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 215 Gegenküste Nordamerikas in der Randlage Westeuropas auf der eurasischen Landmasse gegenüber der russischen Kontinentalmacht, ergänzend zur Sicherung des Mittelmeers und des Zugangs zur Golfregion mit den größten Erdölreserven der Welt. Darin liegt auch weiterhin die strategische Bedeutung der Türkei als NATO-Partner in ihrer Schlüsselstellung zwischen Europa und dem Orient, Russland und dem Mittelmeer, Balkan und Kaukasus als Schwarzmeerland mit der längsten Küste. Um die Golfregion sollte ab 1955 ein „Mittelost“-Verteidigungspakt, nach seinem Gründungsort „Bagdad-Pakt“ genannt, zwischen der Türkei, Irak, Iran und Pakistan die gedachte Front bis zum Indischen Subkontinent halten und so den Persischen Golf und den Indischen Ozean nach Norden abschirmen. Diese geschlossene Abwehrfront zwischen Mittelmeer und Pakistan als östliche Verlängerung des westlichen Bündnissystems kam nie zustande. Schon 1958 nach der Juli-Revolution in Bagdad mit dem blutigen Sturz der Monarchie schied der Irak aus dem westlichen Sicherheitssystem aus. Jordanien und Libanon wurden zwar durch militärische Interventionen Großbritanniens und der USA in ihrer westlichen Ausrichtung gestützt, konnten aber ebenso wenig in den „Mittelost-Pakt“ einbezogen werden wie Ägypten nach der Revolution von 1952. So blieb die orientalische Flanke der NATO östlich und südlich der Türkei nur vom Iran gedeckt, mit riskanten Lücken am Golf im Irak, im Süden der Arabischen Halbinsel im Jemen und am Horn von Afrika in Somalia, schließlich zwischen Iran und Pakistan in Afghanistan. Die Moskauer Außenpolitik versuchte ab Mitte der 1950er Jahre in diese und andere Lücken des amerikanisch-britischen „containment“ (der „Eindämmung“ sowjetrussischer Expansion) einzudringen, um den noch unvollkommenen Ring aufzubrechen. Sie hatte schon seit 1945 versucht, nordwestliche Gebietsteile des Iran abzuspalten, den Iran von Norden her zu beherrschen und armenisches Gebiet in der östlichen Türkei zu annektieren. Der Ost-West-Konflikt war im Orient eröffnet, bevor er in Europa aufbrach. Es war schon darum unvermeidlich, dass die Sowjetregierung die westliche Mittelost-Paktstrategie mit einer offensiven Politik um die NATO herum von Indien über den Irak und Syrien bis nach Afrika konterkarierte. Diese Entwicklung erneuerte zwischen 1945 und 1955 das Grundmuster der russischen Orientpolitik aus der Zarenzeit im 19. Jahrhundert entlang der historischen russischen Expansionsachsen in der strategischen Richtung Süd/Südost. Verbunden war damit der Druck auf die Türkei und Griechenland über den Balkan zu den Meerengen in das Mittelmeer und nach Afrika in der strategische Richtung Süd/Südwest. 216 Lothar Rühl Als Resultat dieser strategischen Konfrontation sahen sich die Sowjetunion und die Atlantische Allianz gegenseitig durch Umfassung und Einkreisung bedroht, eine wechselseitige, künstlich vereinfachte Wahrnehmung der komplexen politischen Realität, die den Ost-West-Konflikt zu globalisieren drohte, zumal im Washington der 1960er Jahre das kommunistische China als fester Bestandteil eines „sino-sowjetischen Blocks“ mit Nordkorea und Nordvietnam als Vorfelder und Moskau als Machtzentrum angesehen wurde. Dieses Kunstbild auf dem westlichen Horizont löste sich erst ab 1969 mit der Nixon-Präsidentschaft auf. Aber das euro-atlantische Bündnis war für die nächsten zwei Jahrzehnte über Europa hinaus auf den Orient fixiert. Ab Mitte der 1970er Jahre begannen die USA unter den Präsidenten Ford, Carter und Reagan die NATO-Partner auf militärische Mitwirkung an der Krisenbeherrschung und Verteidigung des Mittleren Ostens zu drängen, eine Forderung, die von den europäischen Alliierten abgelehnt wurde.4 Doch der Weg für „out of area“ in den Orient war für die alliierten Strategen vorgezeichnet, damit auch eine Ausweitung der Ost-West-Konfrontation, die den Horizont der NATO mit dem Feindbild Russland füllte wie umgekehrt den Horizont Russlands mit dem Feinbild Westen. Diese wechselseitigen Feindbilder haben sich nach einer zehnjährigen Zwischenzeit des gegenseitigen Abtastens in einer zwischen Annäherung und Abgrenzung schwankenden Politik beider Seiten erneuert. Die Aufnahme der früheren Zwangsverbündeten der Sowjetunion auf dem westlichen Vorfeld Russlands und der drei ehemaligen Sowjetrepubliken im Baltikum in das nordatlantische Bündnis haben diese Feindbilder verstärkt. Das Drängen Georgiens und der Ukraine in die NATO samt den Moskauer Reaktionen haben sie zum Grundmuster einer Dauerkrise zwischen Russland und dem atlantischen Bündnis hochstilisiert. Die politische Dialektik dieses Prozesses der expansiven Integration oder integrativen Expansion des „westlichen Bündnis- und Sicherheitssystems“ (Volker Rühe 1993 in seinem Plädoyer für die Aufnahme Polens, Ungarns und der Tschechoslowakei in die NATO) und der russische Versuch, das verlorengegangene westliche Vorfeld wenigstens militärpolitisch zu neutralisieren, die verbliebene geopolitische Peripherie mit Weißrussland, der Ukraine, der Moldau und dem Südkaukasus unter russischer Kontrolle zu konsolidieren, liegt offen zutage. Dieses strategisch-geopolitische Problem der europäischen Sicherheit für ihre Politik der NATO-Osterweiterung zu übersehen oder zu verdrängen, die Konsequenzen für das Verhältnis zu Russland und für die Stabilität jeder Abgrenzung wie einer offenen Flanke in diesem politisch umstrittenen Übergangsgebiet nicht zu erkennen 4 Vgl. Rühl, Lothar: Das Reich des Guten. Amerikas Machtpolitik und globale Strategie, Stuttgart 2005, S.292. Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 217 oder geringzuschätzen, ist auf der westlichen Seite die Hauptursache der fortbestehenden, sich immer wieder erneuernden Spannungen im Verhältnis zwischen Russland und der Allianz, zwischen Russland und dem atlantischen Europa, das nun bis an die Grenzen Weißrusslands und der Ukraine, im Baltikum direkt an Russlands Grenze, reicht. 1.2 Russland gegenüber der euro-atlantischen Nordflanke Der Aufwuchs der Hochseeflotte und der ozean-gängigen nuklearen Unterseestreitkräfte der UdSSR seit Ende der 1950er Jahre und deren wachsende Raketenangriffsfähigkeit mit Nuklearwaffen auch gegen Nordamerika seit den 1960er Jahren rückte den Nordatlantik neben Europa in die Frontstellung gegenüber Russland. Die euro-atlantische Nordflanke der NATO von der Ostsee bis zur Norwegensee wurde zur zweiten kritischen Bündnisfront neben Mitteleuropa. Über den Norden wirkte die direkte Bedrohung Nordamerikas durch sowjetische Raketen, auf der Gegenseite die drohende Einschließung der sowjetischen Nordmeerflotte mit der Angriffsdrohung amerikanischer Flugzeugträger mit Nuklearwaffen gegen die Basen dieser Flotte und der strategischen U-Boote. Diese strategische Situation war für Amerika und Europa neu. Sie wertete auch die Bedeutung Großbritanniens und Norwegens im Bündnis und global-strategisch auf. Dieser Einfluss der beiden nördlichen Seeflankenmächte Westeuropas in der Allianz ist bestehen geblieben, gegründet auf ihre besonders engen Beziehungen zu Amerika. Schweden und Finnland wiederum konnten sich ihre erklärte Neutralität nur angelehnt an die Nordostflanke der NATO in Norwegen leisten: Die „Nordische Balance“, ein politisches Konstrukt großer Zerbrechlichkeit, hatte nur einen Halt gegenüber der russischen Macht, den Rückhalt im Westen durch die NATO. Auch nach 1991 ist diese Sicherheitslage in Nordeuropa strategisch bestehen geblieben, obwohl die militärische Bedrohung aus dem Osten zurückgegangen ist und die russische Seemacht havariert hat. Die Ressourcenkonkurrenz im schmelzenden Eis der Arktis ist zwischen Russland, Norwegen, Dänemark mit Grönland, Kanada und USA vorgegeben. Ende Januar 2009 warnte NATO-Generalsekretär De Hoop Scheffer in Reykjavik vor neuen Spannungen zwischen den Verbündeten und Russland über die sich öffnenden Seewege im arktischen Meer zur Ausbeutung vermuteter unterseeischer Bodenschätze der Polarregion. Er sprach dabei von „militärischen Pressionen“, die zu erwarten seien, und von „neuen Herausforderungen für die NATO“.5 5 NATO warns of tensions as ice thaws in the Arctic, in: IHT, 30.1.2009. 218 Lothar Rühl Gerade in Nordeuropa ist das Gefahrenbewusstsein gegenüber Russland stark ausgeprägt, wobei sich ökologische und militärische Befürchtungen mit politischen um die Sicherheit der drei baltischen Staaten verbinden. Schon deshalb setzten sich Stockholm und Helsinki nach 1991 für die Aufnahme dieser drei Länder in NATO und EU ein: Das Baltikum sollte fester und geschützter Bestandteil des euro-atlantischen Bündnisgefüges werden, um der Region Stabilität zu geben und Russland von Ausfällen nach Westen abzuschrecken. Seit ihrer Aufnahme in das Bündnis und in die EU wirken die drei baltischen Länder gemeinsam mit Polen für eine Versteifung der westlichen Politik gegenüber Russland, wie sich z.B. seit 2006/07 im Gaskonflikt zwischen Moskau und Kiew, dann 2008 in der akuten Georgienkrise, und wieder in der Krise im Gaskonflikt zum Jahreswechsel 2008/09 gezeigt hat. Die Ursachen und die Verantwortung für den Verlauf lagen, nicht eindeutig geklärt, auf beiden Seiten. Die EU war, vor allem über Südosteuropa, davon in Mitleidenschaft gezogen, die Frage nach der Sicherheit der Energieversorgung Europas akut gegenüber Russland und der Ukraine gestellt. 1.3 Die offene Flanke des Bündnisses zum Orient An der Südflanke Europas wurde die Allianz über ihre euro-atlantische Spannweite hinaus bis in den Mittleren Osten erweitert, als 1952 neben dem eben von Amerika und Großbritannien aus dem Bürgerkrieg gegen die Kommunisten geretteten Griechenland auch die bis dahin offiziell neutrale Türkei in die NATO aufgenommen wurde, um die türkischen Meerengen zu kontrollieren, die Türkei zu schützen und Anatolien als Riegel gegen sowjetrussisches Vordringen in das Mittelmeer zu nutzen. US-Militärstützpunkte und Aufklärungstechnik in der Türkei haben seit den 1950er Jahren diesem Zweck gedient, amerikanische Mittelstreckenraketen mit Zielen in Südrussland wurden nach der Kubakrise von 1962 aus der Türkei abgezogen. Nuklearfähige Kampffliegerstaffeln der USA sind in der Türkei verblieben und können im Krisenfall verstärkt werden. Die türkische Luftwaffe hat Nuklearwaffen unter gemeinsamer Kontrolle mit den USA. Der Beitritt zur NATO und der diesem vorausgegangene Sicherheitspakt mit den USA war die historische Wende der modernen Türkei aus der Neutralität in die sicherheitspolitische Bindung an den Westen. Um die außenpolitische und im Innern der Türkei psychologische Bedeutung dieser Wende, aber auch deren strategischen Einschnitt zu verstehen, ist es nützlich, daran zu erinnern, dass im Ersten Weltkrieg 1915/16 auf dem Höhepunkt der russischen Kriegführung gegen die deutschen Mittelmächte und das Osmanische Reich, als eine russische Armee auf der Höhe der Karpathen vor Ungarn und eine zweite tief in Anatolien standen, London Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 219 und Paris dem verbündeten Zaren Nikolaus II. konzedierten, was alle europäischen Mächte seinen Vorgängern stets verweigert hatten: Konstantinopel mit der Halbinsel Izmet und dem Marmara-Meer in souveränem russischen Territorialbesitz samt der militärischen Kontrolle der Meerengen inklusive der Dardanellen, mit anderen Worten den freien Zugang zum Mittelmeer; dazu über Ostanatolien die Annäherung zu Lande an den Persischen Golf. Nur die bolschewistische Machtergreifung 1917 mit dem Ausscheiden Russlands aus dem Krieg durch den Separatrieden Lenins im Frühjahr 1918 ersparte Europa diese strategische Expansion der russischen Macht. Sowjetrussland wurde von den Alliierten als Feind betrachtet und isoliert, nachdem eine militärische Intervention der Westmächte in den russischen Bürgerkrieg gegen die Rote Armee gescheitert war. Als Stalin ab 1945 die historische Expansionstendenz des Zarenreichs wieder aufnahm und Bulgarien Teil des äußeren Imperiums wurde, waren die türkischen Meerengen wieder in Gefahr wie die türkische Ostgrenze am Kaukasus. Die westliche Paktstrategie über die NATO hinaus blieb allerdings in ihren Ansätzen stecken. Die angestrebte geschlossene Abwehrfront vom Mittelmeer bis nach Indien kam nicht zustande. Die NATO blieb im Osten und Süden der Türkei mit einer offenen Flanke nur von dem unsicheren amerikanischen Klienten Iran unter der Herrschaft des Schahs gedeckt. Seit dessen Sturz und dem Ende des Mittelostpakts mit dem Ausscheiden Irans suchte Washington unter fünf Präsidenten von 1979 bis 2008 einen strategischen Ersatz zur Deckung des Persischen Golfs und der Arabischen Halbinsel mit Hilfe der NATOPartner. Während des irakisch-iranischen Golfkriegs 1980-89 und in den beiden Golfkriegen der USA mit internationalen Koalitionen 1990/91 und 2003 gegen den Irak haben sich die Brüchigkeit der Mittelostflanke der westlichen Allianz und die andauernde Gefährdung der Energiequellen des Golfs bestätigt. Im ersten Fall mussten internationale Flottenverbände unter Beteiligung der Sowjetmarine die Öltanker und Containerschiffe durch den Golf eskortieren. In den beiden späteren Golfkriegen mussten starke amerikanische Expeditionskorps, die 7. US-Flotte und US-Luftstreitkräfte mit alliierten Hilfstruppen, eingreifen. 2003/04 lehnten Frankreich und Deutschland jede Beteiligung, auch nach dem Ende des Feldzugs zur Sicherheitspräsenz mit Truppen, und jede NATO-Verantwortung im Irak ab. Die Türkei verweigerte dem amerikanischen Verbündeten 2003 die Öffnung Südanatoliens für einen Aufmarsch zum Zweifrontenkrieg gegen den Irak und die Nutzung der Luftstützpunkte in Anatolien für Luftangriffe auf den Irak. 220 Lothar Rühl Nach den vergangenen Spannungen zwischen Ankara und Washington über Zypern, die Ägäis und Israel in den 1960er und 1970er Jahren legten die beiden Golfkriege der USA tiefgehende Differenzen zwischen den beiden Verbündeten bloß. Diese bestanden gegenüber Iran und Russland schon vor dem Ende der Sowjetunion. Ankara hatte sich 1987 geweigert, an der Modernisierung der taktischen Kernwaffen in der NATO teilzunehmen und dabei eine neue Sicherheitsdoktrin im Verhältnis zum russischen Nachbarn erklärt: Die Türkei würde nur eine rein defensive Politik betreiben und nicht an einer Eskalation von Krisen mitwirken. Die nukleare Option müsste als letztes Mittel verstanden werden.6 1.4 Der Zusammenbruch der russischen Position im Nahen/ Mittleren Osten und die Veränderung des Verhältnisses zwischen Russland und der Türkei Seit dem Ende der Sowjetunion und der Öffnung des Ostens sieht die türkische Politik ein weites Feld im Norden und Osten vor sich, auf dem zwar Konkurrenzen um Zugang und Einfluss stattfinden, vor allem mit Russland, auf dem aber die Sicherheit im Verhältnis zu Russland unter den 1991 veränderten geopolitisch-strategischen Gegebenheiten neu zu bestimmen ist. Diese Veränderung hat auch Moskau eine neue Chance zur Ausbreitung russischen Einflusses und zur Eindämmung des amerikanischen gegeben. Die vorsichtige Zurückhaltung der Türkei seit 1990/91 in den Kaukasuskonflikten und wieder in der Georgienkrise 2008 gegenüber Russland7 weist auf die Konsequenzen dieser neuen Situation im Schwarzmeer-Raum an der Südostflanke der NATO und im Übergang in den Orient. Schon in den beiden Golfkriegen 1990/91 und seit 2003 sah sich Washington mit seiner Politik im Mittleren Osten auch mit Moskau konfrontiert. Zwar konnten 1991 die Sowjetunion und 2003 Russland weder militärisch eingreifen noch politischen Einfluss auf die Entwicklung des Konflikts nehmen. Die Ohnmacht Moskaus war evident. Doch wirkten die russischen Versuche, Amerika in den Arm zu fallen, gegen die russischen Interessen, die Moskau sowohl im Irak und auf dessen Erdölfeldern 6 7 Unterrichtung des Verfassers im Dezember 1987 in Brüssel durch den offiziellen Vertreter des türkischen Generalstabs, dass die Türkei an der Ausführung des NPG-Beschlusses von Montebello 1983 über die Modernisierung der nuklearen Kurzstreckenwaffen der NATO in Europa nicht teilnehmen werde und dass die Regierung die Sicherheitsstrategie gegenüber der UdSSR in diesem Sinne verändert habe: keine neuen oder zusätzlichen Nuklearwaffen in der Türkei. Die türkische Regierung stimmte zwar allen Erklärungen und Beschlüssen des NATO-Rates in dieser Frage zu, nahm aber an politischen Demonstrationen der Solidarität anderer NATO-Partner in Tiflis nicht teil. Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 221 wie im Iran und in Syrien, aber auch allgemein bei den Arabern zu sichern suchte. Der Erfolg war bei großem Aufwand gering. Die gesamte, seit Mitte der 1950er Jahre von Syrien und vom Irak über das Horn von Afrika bis nach Ägypten und Ostafrika angelegte militärpolitische Position war zwischen 1970 und 1990 in sich zusammengebrochen. Damit war Russland praktisch aus der Nah-/Mittelost-Politik ausgeschieden. Es war kein entscheidender internationaler Faktor in diesem Raum gegenüber Amerika und der euroatlantischen Allianz mehr. Seither versucht Moskau jedoch, wieder Fuß zu fassen, sowohl im Irak als auch in arabischen Golfstaaten und im Iran, den es nuklear- und waffentechnisch unterstützt und politisch abschirmt. In der öffentlichen Perzeption aber erschien der russische Akteur im Osten Europas, obwohl geschwächt und territorial zurückgefallen, noch immer als die bedrohliche Gegenmacht. Schon zwischen 1991 und 2003 war Russland aber von den USA und den europäischen Alliierten aus dem internationalen Krisenmanagement zur Beendigung des Nahostkonflikts, zur Überwachung des Irak und aus der Sicherheitspolitik in Südosteuropa ausgeschlossen worden, obwohl 1995-99 ein russisches Kontingent in Bosnien an der Okkupation beteiligt war und Russland 1994 an den Friedensverhandlungen mit den USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, die von dieser internationalen „Dayton-Gruppe“ über Bosnien geführt wurden. Der Kosovo-Krieg der NATO beendete 1999 die aktive Kooperation Russlands mit der NATO in dem 1997 geschaffenen „NATO-/Russland-Rat“ in Brüssel. Moskau unterbrach die Beziehungen zur NATO und zog seine Vertreter ab. 1.5 Der politische Gegensatz zwischen Russland und der NATO Dieses Kapitel ist auch seither unvollendet geblieben. In den Jahren der Einleitung der ersten NATO-Osterweiterung in Mitteleuropa nach 1993 blieben die Verhandlungen zwischen den NATO-Partnern und Russland bis zur Vereinbarung der „Pariser Charta“ 1997, mit der die Kooperation im „NATO-/Russland-Rat“ festgelegt wurde, erfolglos. Die russischen Forderungen auf Mitsprache über die Aufnahme neuer Mitglieder in die NATO und bei NATO-Entscheidungen über Krisenbewältigung mit militärischen Mitteln, nach Anerkennung einer besonderen Verantwortung Russlands für die Sicherheit im Gebiet der „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ (d.h. der ehemaligen Sowjetunion ohne das Baltikum) und nach einer besonderen Beziehung Russlands zur NATO wurden abgelehnt. Die „Vier Nein“: kein russisches Vetorecht, kein russisches „droit de regard“, 222 Lothar Rühl keine Interessensphären, keine privilegierten Beziehungen8 bedeuteten, dass Russland nicht als Sicherheitspartner des Bündnisses anerkannt wurde, obwohl Präsident Clinton gerade eine „strategische Partnerschaft“ mit Russland als Ziel verkündet und bei einem Besuch in Moskau im Fernsehen sogar von einer möglichen Mitgliedschaft Russlands in der NATO in fernerer Zukunft gesprochen hatte. Darauf hatte er allerdings auch in Kiew der Ukraine Hoffnungen gemacht und die Unabhängigkeit einer lebensfähigen Ukraine zu einem „wichtigen“ amerikanischen Sicherheitsinteresse erklärt.9 Beides konnte nur in Übereinstimmung mit Moskau vereinbar werden. Die NATO-Politik gegenüber Moskau aber wurde seit Dezember 1993 unverändert im Kern von dem Programm der NATO-Erweiterung im Osten Europas bestimmt. Jelzin und Ministerpräsident Tschernomyrdin (seither russischer Botschafter in Kiew) zogen mehrere „rote Linien“ durch das osteuropäische Vorfeld Russlands, die die NATO nicht überschreiten sollte. Die erste verlief im Westen des Baltikum über Weißrussland und die Ukraine in den Westen der Slowakei und von dort nach Jugoslawien. Hinter ihr lagen auch Bulgarien, Rumänien und die Moldau. Die Situation Ungarns blieb undeutlich. Diese Beschränkung der NATO und der Souveränität der betroffenen Staaten wurde von den Alliierten abgelehnt. Eine spätere steckte eine neutralisierte Zone vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer ab. Auch dieser Vorschlag Moskaus wurde zurückgewiesen. Die NATO-Partner wollten sich aus guten Gründen nicht auf eine neue „Jalta“Linie festlegen lassen. Der tschechische Präsident Havel hatte vor einem „neuen Jalta“ gewarnt, der polnische Präsident Waleca vor einem „Sicherheitsvakuum“ in der Mitte Europas.10 Georgien oder andere Länder des Südkaukasus wurden weder von russischer noch von westlicher Seite erwähnt, bis der US-Verteidigungsminister Cohen kurz vor Ende der Clinton-Präsidentschaft im Jahre 2000 in Tiflis Georgien eine Aussicht auf NATO-Mitgliedschaft eröffnete. Im April 1999, während des Kosovokrieges, wurden Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei in die Allianz aufgenommen. Ungarn, Rumänien und Bulgarien leisteten der NATO auf verschiedene Weise indirekt Unterstützung für ihre Luftkriegsoperationen. Damit war eine strategischpolitische Interessensphäre der NATO in Südosteuropa vorgezeichnet, in 8 9 10 Vgl. dazu Rühl, Lothar: Die USA als Widerpart Russlands, in: Russland und der postsowjetische Raum, SWP Internationale Politik und Sicherheit Nr.54, hrsg. von Olga Alexandrova, Roland Götz und Uwe Halbach, Baden-Baden 2003, S.414. Rühl: Das Reich des Guten, S.162. Vgl. Rühl, Lothar: Deutschland als europäische Macht. Nationale Interessen und internationale Verantwortung, Bonn 1996, S.245. Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 223 der die NATO-Osterweiterung fortgesetzt wird. Damit wurde die historische „Orientalische Frage“, die ja zuerst den Balkan betraf, der im 19. Jahrhundert zum „Nahen Osten“ gerechnet wurde, vom westlichen Bündnis unter amerikanischer Führung auch von Europa her aufgegriffen. Die Öffnung des Ostens mit dem Ende der Sowjetunion hatte Ende 1991 nicht nur im Zentrum und im Norden Europas die geopolitische Grundstruktur des Kontinents verändert und eine neue geostrategische Lage geschaffen, sondern vor allem auch im Südosten und im Schwarzen Meer zwischen Balkan, Türkei und Kaukasus. Das geopolitische Resultat aller dieser Veränderungen zwischen 1991 und 2009 liegt in der nicht nur territorialen, sondern auch strategischen Zurückdrängung Russlands vom Baltikum bis zum Kaukasus mit dem Verlust der Seeherrschaft über die Ostsee und das Schwarze Meer und der westlichen Kontrolle über die Zugänge zu beiden. Würde im Zuge einer Aufnahme der Ukraine in die NATO auch die bis 1954 russische Krim mit dem Halbinselfortsatz von Kertsch vor dem Asow’schen Randmeer im Süden Russlands unter die direkte Kontrolle der NATO kommen, wäre Russland tatsächlich von Westen an seinen Flanken in Europa militärisch eingeschlossen und politisch ausgegrenzt – wie auch immer man in der atlantischen Allianz diese Situation nennen mag. Dies ist einer der Aspekte, unter denen Putin aus russischer Sicht den Zusammenbruch der Sowjetunion „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ genannt hat. In diesem kritischen Bereich bleibt darum ein tiefer Gegensatz zwischen Russland und der westlichen Allianz bestehen. Wahrscheinlich wird jede Regierung in Moskau versuchen, dies mit allen politischen Mitteln – ausschließlich Krieg gegen die NATO – zu verhindern und die Option auf eine politische Reintegration der Ukraine in die Russische Föderation für die Zukunft offen zu halten. Dieses Interesse Moskaus betrifft nicht nur die NATO, sondern auch die EU. Es erstreckt sich natürlich auch auf Weißrussland. 2. Die Weiterentwicklung der Probleme und das Thema Raketenabwehr in Europa Das Thema Raketenabwehr ist aus der gegenseitigen strategischen Bedrohungslage als Folge der Weiterentwicklung der Raketentechnik seit dem amerikanisch-sowjetischen Abkommen SALT-1 mit dem ABM-Vertrag von 1969 entstanden. Der Streit zwischen den beiden Vertragspartnern über den Nutzen und die Abänderungsmöglichkeiten seit den 1980er Jahren unter der Reagan-Präsidentschaft eskalierte schließlich nach den Verständigungsversuchen der Präsidenten Bush sen. und Clinton mit neuen Abkommen über die Reduzierung der strategischen Angriffssysteme und der Zahl der nuklearen Gefechtsköpfe. Präsident Bush jun. machte strategi- 224 Lothar Rühl sche Raketenabwehr nach 2001 zu einem zentralen Thema der Sicherheitspolitik der USA und kündigte den inzwischen strategisch und rüstungskontrolltechnisch obsolet gewordenen ABM-Vertrag, um freie Hand für den Aufbau einer strategischen Raketenabwehr in Nordamerika zu gewinnen. Damit wurde dieses Rüstungsvorhaben der USA auch zu einem transatlantischen Thema in der NATO, denn die Bush II-Administration fasste den Plan, Abwehrsysteme vorwärts in Mitteleuropa zu stationieren. Abgesehen von der Zweckbestimmung, Nordamerika abzuschirmen, und von der Tatsache, dass die zunächst verfügbaren Abfangsysteme nur bestimmte Teile Europas abdecken können, andere aber ungeschützt lassen werden, insbesondere im Süden und Südosten, dazu auch die Türkei, rückt das Vorhaben Europa wieder in eine zentrale Frontstellung in der strategischen Gegenüberstellung zwischen Amerika und Russland. Wie auch immer das neu entstehende Verhältnis politisch bezeichnet werden mag, handelt es sich objektiv nach den militärtechnischen und geographischen Maßstäben um eine Konfrontationsanlage. In Verbindung mit dem Plan des Nordatlantikrates, 2008 in Bukarest bestätigt, die Osterweiterung der NATO fortzusetzen und zunächst Georgien und der Ukraine eine Beitrittsperspektive zu öffnen, kann das Projekt US-Raketenabwehr in Mitteleuropa mit Abfangsystemen in Polen und einem modernen ABM-Radar in Tschechien aus Moskauer Sicht durchaus als eine strategisch-politische Herausforderung aufgefasst werden. Obwohl eine solche Raketenabwehr als Vorwärtsverteidigung Nordamerikas in Europa nicht gegenüber Russland, sondern gegen mögliche Angriffsdrohungen aus dem Mittleren Osten eingerichtet werden soll, sieht Russland seine eigene nukleare Abschreckungsfähigkeit gegenüber den USA mit Interkontinentalraketen potenziell gefährdet. Es ist richtig, dass auch bestimmte Raketenstellungen in Russland von Mitteleuropa aus zum Ziel für Raketenabwehr genommen werden könnten. Andererseits ist in Moskau öfters deutlich geworden, dass auch die russischen Militärs eine Raketendrohung aus dem Orient gegen Russland künftig für möglich halten. Darüberhinaus muss Russland für die Konsolidierung seiner qualitativ geschwächten strategischen Nuklearstreitkräfte auf einem modernen technischen Niveau, also auch mit Modernisierungspotenzial für die Zukunft, an einer quantitativen Parität mit den USA bei reduzierten Waffenzahlen interessiert sein. Ende 2009 läuft der Vertrag mit den USA über die Reduzierung dieser Waffen aus. Moskau hat dies in den vergangenen Jahren Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 225 auch deutlich werden lassen.11 Es gibt deshalb eine objektive Grundlage für strategische Zusammenarbeit zwischen den USA, der NATO in Europa und Russland. Washington hat unter den Präsidenten Clinton und Bush jun. Moskau immer wieder konkrete Vorschläge gemacht, zuletzt 2008. Russische Gegenvorschläge waren entweder ausweichend und ablenkend oder sachfremd. Die Moskauer Verweigerung blieb, jedenfalls bis zum Ende der Bush-II-Präsidentschaft, wie dies seit 2007 nicht anders zu erwarten gewesen war, unbeugsam und äußerlich unbeeinflusst von amerikanischen Zusicherungen und Offerten einer gemeinsamen Raketenabwehr. 3. Perspektiven 1. Zwar wird die russische Macht im Osten Europas nicht länger als feindlich angesprochen, jedenfalls nicht im eigentlichen Westeuropa der alten NATO, wohl aber wird sie weiterhin als europäisches und globales Sicherheitsrisiko, als gefährliches Gegenüber und unberechenbare politische Größe mit innerer Unsicherheit, nuklearer Rüstung, auf ihre Energiequellen gegründeter Machtpolitik und „neo-imperialen“ Ambitionen angesehen. Diese Perzeption, ob natürlich wegen der historischen Erfahrung mit Russland seit dem Zarenreich und einer autoritären Regierung des Landes aus dem Moskauer Kreml, die den Zustand Osteuropas nach dem Ende der Sowjetunion so weit wie es Russland möglich ist wieder zum russischen Vorteil zu verändern sucht, also wegen einer revisionistischen Politik Russlands oder gekünstelt aus politischen Gründen, die einen Vorwand für eine Abgrenzung von Russland und für die NATO-Osterweiterung geben sollen, bestimmt psychologisch noch immer das gestörte Verhältnis zu Russland. Die enttäuschten Erwartungen in ein „neues Russland“, das sich im Innern und in seinem Verhalten gegenüber seinen Nachbarn westlichen Vorstellungen annähern, an die westliche Linie in der internationalen Politik (so weit eine solche existiert) anpassen und schließlich auf die euro-atlantischen Positionen, wie sie in Washington und Brüssel festgelegt werden, einschwenken werde, haben das politische Ressentiment gegenüber Russland revitalisiert wie umgekehrt das russische gegenüber dem Westen. Ressentiment und Affekte aber sind keine Merkmale rationaler Politik. Dies gilt für beide Seiten. 11 Bisher (März 2009) in Moskau dazu keine regierungsamtlichen Erklärungen, sondern nur offiziöse Äußerungen aus Regierungskreisen. Der Generaldirektor der IAEA, El Baradei, hat in einem Namensartikel in der IHT vom 12.2.2009 die Größenordnung von 1.000 bis 500 Nukleargefechtsköpfen an strategischen Waffen als mögliche Konsensbasis zwischen Washington und Moskau genannt. 226 Lothar Rühl 2. Russland wird ein schwieriges und nur schwer berechenbares Gegenüber für Amerika und das atlantische Europa bleiben, zumal das Letztere im Osten mit antirussischen Gefühlen aufgeladene Völker in das Bündnis, teils auch in die EU, aufgenommen hat und nun in seiner Politik gegenüber Russland von diesen als Mitgliedern von innen unter Druck gesetzt wird (sogar öffentlich und demonstrativ wie in der Georgienkrise im Sommer 2008), wie dies insbesondere für eine Aufnahme der Ukraine und Georgiens in das Bündnis und mit der Forderung nach Einrichtung von NATO-Stützpunkten für alliierte Streitkräfte im Baltikum geschieht. Ob Russland mehr Gegner oder Partner der USA, der EU und der NATO sein wird, hängt unter solchen Umständen auch vom Verhalten und von den Zielen der westlichen Verbündeten ab. Aber in Moskau wird vor allem und letztlich nach den dort bestimmten russischen Interessen gegenüber der Allianz, den USA und in Europa gehandelt, gleichgültig ob diese realistisch definiert werden oder nicht. Beide Seiten können irren und strategische wie taktische Fehler machen, die aufeinander wirken und sich kumulieren können. Die Aussetzung des „NATO-/Russland-Rates“ durch die NATO-Partner in der Georgienkrise des Jahres 2008 war ein solcher taktischer und vor allem diplomatischer Fehler. Gerade dieses diplomatische Forum hätte in der Georgienkrise des Sommers und Herbstes 2008 für multilaterale Konsultationen nützlich sein können, vor allem für die europäischen NATO-Staaten im Verhältnis zu Moskau und zu Washington. 3. Auch nach ihrer Wendung über das euro-atlantische Bündnisgebiet hinaus vom Feld der alliierten kollektiven Verteidigung auf das weite internationale Feld der kollektiven Sicherheit und bei ihrem Sprung nach Afghanistan zur ausgreifenden Vorwärtsverteidigung weit von den äußeren Grenzen des Bündnisgebietes entfernt, haben die NATO-Partner ihre Politik der integrativen Expansion in Europa gegenüber Russland nicht aufgegeben. Vor allem die USA unter den Präsidentschaften Clinton und Bush jun. zwischen 1993 und 2009 haben Moskau unverändert als den östlichen Machtpol behandelt, dessen Schwächung genutzt werden sollte, um den westlichen zu stärken und die euro-atlantische Allianz als Fundament der europäischen Sicherheit aufzuwerten, um mit der NATO im Osten diese Sicherheit mit oder ohne, notfalls auch wieder gegen Russland zu organisieren. Russland ist der zentrale Maßstab der euro-atlantischen Sicherheit geblieben. Dies, obwohl längst die entstehenden Bedrohungen aus dem Orient, die Weiterverbreitung von nuklearen und anderen destabilisierenden Rüstungen, der Aufstieg Chinas zu einer global relevanten Großmacht, die grassierende Instabilität und ökonomisch-soziale Krise Afrikas, schließlich der Indische Subkontinent mit zwei neuen Kernwaffenstaaten, Südwestasien und dem benachbarten Mittleren Osten um den Persischen Golf, Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 227 als Unsicherheitsfaktoren in das Zentrum des politischen Krisenbogens der Welt gerückt sind. Zwar hat der Nordatlantikrat dies in seinen „Neuen Strategischen Konzepten“ 1991 und 1999 ausdrücklich anerkannt. Auch hat er auf dem Papier Konsequenzen gefordert. Doch die Aktivität blieb auf Moskau konzentriert: Russlands Einfluss auf breiter Front zu verdrängen, war das strategische Vorrangziel Washingtons trotz einzelner Annäherungsversuche in den vergangenen achtzehn Jahren und konzertierter Aktionen der diplomatischen Krisenbewältigung wie das „Nahost-Quartett“ für Palästina oder die Bemühungen um eine Beendigung der Urananreicherung im Iran. Außerdem stand die tatsächliche Politik der NATO seit Mitte der 1990er Jahre nicht nur auf dem Balkan, sondern auch im Kaukasus im Gegensatz zur deklaratorischen der Zusammenarbeit mit Russland. 1990 anlässlich der Wiedervereinigung Deutschlands in der NATO wurde Moskau offiziell zugesichert, dass keine Kernwaffen, keine schweren Waffen und keine nuklearfähigen Trägersysteme nach Osten vorverlegt würden.12 Später erklärten die Alliierten, dass dies nur für Deutschland gegolten hätte, nicht aber für die 1990 noch nicht vorhersehbare NATO-Erweiterung über Deutschland hinaus nach Osten. Inzwischen wurden oder werden Stützpunkte für die Stationierung von US-Luftkampfverbänden und Truppen in Ungarn, Bulgarien und Rumänien eingerichtet. Die Rüstungskontrollpolitik wurde von beiden Seiten den Konflikten über Raketenabwehr und über die NATO-Osterweiterung untergeordnet, damit praktisch ausgesetzt. Die Verantwortung Moskaus dafür ist ebenso evident wie die Washingtons und Brüssels. Doch die Notwendigkeiten und die Ansätze sind erhalten geblieben. 4. Der geopolitische Konflikt im Osten Europas um die Fortsetzung oder Einstellung der NATO-Osterweiterung kann durch beiderseitige Mäßigung beendet werden. Weder Georgien noch die Ukraine sind Staaten, deren Aufnahme in das nordatlantische Bündnis der Sicherheit der Verbündeten dienen könnte. Weder das Land im Südkaukasus mit zwar international anerkannten, aber in den Grenzbevölkerungen durch Sezession, also von innen her, unsicher gewordenen Grenzen noch das historisch und politisch in sich selber ungefestigte Übergangsland zwischen Russland und Mitteleuropa mit einem starken russischen und einem russischsprachigen Bevölkerungsanteil im Industriegebiet des Ostens und auf der Krim eignen sich als Grenzländer eines westlichen Verteidigungsbündnisses mit dem Anspruch, der europäischen Sicherheit zu dienen. Wie würden sie als Frontstaaten in einer politischen Konfrontation mit Russland wirken und wie könnten sie im Konflikt unterstützt und notfalls verteidigt werden? Wer wäre dazu in Europa oder Amerika bereit? Was aber 12 Rühl: Deutschland als europäische Macht, S.179. 228 Lothar Rühl sollte eine Ausweitung des Bündnisgebietes auf diese oder andere Länder im Osten Europas, die von der NATO im Notfall nicht verteidigt werden könnten, die aber immer für eine politische Provokation an den Grenzen Russlands gut wären? Wie sollte unter diesen Bedingungen „Stabilität“ in Europa in internationalen Krisen gewahrt und Kooperation mit Russland möglich bleiben? Die wirtschaftliche Abhängigkeit der Ukraine von Russland und die komplizierte Interdependenz zwischen Russland als Erdgasexporteur, der Ukraine als Durchgangsland mit einem Röhrennetz nach Westen und den europäischen Abnehmerländern, die in der neuerlichen Erdgaskrise zwischen Moskau und Kiew zum Jahreswechsel 2008/09 wieder offenkundig wurden,13 verlangen nach einer übergreifenden europäischen Kooperation. Eine „Energie-NATO“ könnte dieser nicht dienen. Es handelt sich nicht um einen Fall für das Bündnis. Die EU ist der geeignete Partner, wenn auch nicht unbedingt der geeignete politische Rahmen, schon wegen der ESVP und der Verbindung zur NATO. Energieversorgung und Handel im Osten Europas müssen frei von Bündnisgrenzen und militärischen Sicherheitssystemen bleiben, wenn der freie Fluss der Energieströme unbehindert und in politischen Krisen Spielraum für pragmatische Lösungen bleiben soll. Dies trifft auch auf Georgien und im Übrigen auf Aserbeidschan am Kaspischen Meer mit der Ölküste zu. Die NATO muss die Rohrleitungen durch Georgien nicht schützen, geschweige denn durch dort stationierte alliierte Streitkräfte abschirmen. Im Georgienkrieg des August 2008 haben die russischen Truppen sich auf Distanz zur Erdölinfrastruktur Georgiens gehalten und diese auch nicht aus der Luft angegriffen. Im Übrigen waren die Zerstörungen durch den russischen Gegenangriff, der im Westen als „unverhältnismäßig“ (Merkel) bezeichnet wurde und dies nach den Regeln des deutschen oder des britischen Polizeirechts auch war, sehr viel weniger umfangreich als in Tiflis behauptet und nicht größer als die vom georgischen Angriff in Südossetien angerichteten.14 5. In der Wahrnehmung Europas und des nordatlantischen Bündnisses besteht eine politische Kontinuität zwischen der Sowjetunion und Russland über alle Unterschiede hinweg. Russland wird aus nachvollziehbaren Gründen historisch betrachtet, aber das vorläufige Resultat der russischen Geschichte im Bruch von 1991 wird strategisch und geopolitisch wie psychologisch in den Folgen für das russische Bewusstsein und die Moskauer Politik oft nicht realistisch bewertet. Der Verlust des russischen Imperiums im Osten Europas und in Zentralasien hat die russische Macht 13 14 Dempsey, Judy: Can Ukraine leverage gas deal with Russia?, in: IHT, 22.1.2009. Information des Verfassers nach inoffizieller Bewertung durch militärische Experten in Berlin im Dezember 2008. Die Rolle Russlands als Faktor des transatlantischen Beziehungsgefüges 229 territorial und ökonomisch reduziert, den russischen Kernstaat nach 1991 für mehrere Jahre unter der Präsidentschaft Jelzins desorganisiert, die strategische Situation Russlands zum russischen Nachteil verändert wie die allgemeine Korrelation der Kräfte und das militärische Kräfteverhältnis zur Atlantischen Allianz und umso mehr zu Amerika. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat Russland keine militärische Überlegenheit nach Umfang und Ausrüstung der konventionellen Streitkräfte gegenüber den Westmächten mehr. 1991 verlor es das strategische Glacis, das politisch kontrollierte und militärisch besetzte Vorfeld, im Westen seiner Grenzen und damit sein „äußeres Imperium“ in Osteuropa. Russlands Grenzen sind im Westen und Süden etwa auf die des Großfürstentums Moskau Ende des 16. Jahrhunderts nach den Niederlagen Iwans des Schrecklichen im ersten Nordischen Krieg gegen Schweden und Polen-Litauen und im Süden gegen die Krimtataren zurückgefallen. Alle Eroberungen und territorialen Gewinne Peters des Großen, Katharinas der Großen im 18. und Nikolaus’ I. im 19. Jahrhundert sind verloren gegangen. Das NATO-Gebiet in Europa hat sich ab 1990 schrittweise um 800 bis 1.000 km nach Osten auf Russlands Grenzen zu erweitert. Wie soll es also weitergehen? Kann und soll das euroatlantische Bündnis zwischen Konfrontation und Kooperation mit Russland schwanken, zwischen Ausgrenzung oder „Einbindung“ Russlands, wie es in der ersten Hälfte der 1990er Jahre in Brüssel hieß, manövrieren? Oder soll eine feste Linie im Osten Europas gezogen werden, die als Grundlinie für Kooperation und gemeinsame Sicherheit dienen könnte, an die Moskau sich halten müsste wie Washington und Brüssel? Wenn „Stabilität“ das Ziel der westlichen Politik in Europa ist, wie soll es erreicht werden, wenn die NATO ihre Bündnisgrenze für gemeinsame Verteidigung von Land zu Land weiter nach Osten vorverlegt? Was kann man in Moskau unter einer „Stabilisierung der Westflanke Russlands“ durch die „Öffnung der NATO“ nach Osten, wie die NATO-Sprache in den späteren 1990er Jahren lautete, verstehen? Soll dies heißen, dass künftig die Politik der Ukraine oder Georgiens von Brüssel aus bestimmt und kontrolliert würde? Könnten sie in einer Krise oder in einem Streit mit Russland im Nordatlantikrat überstimmt oder zu einem nach westeuropäischen Maßstäben richtigen Verhalten gegenüber Russland in einem Streit gezwungen werden? Mit der proklamierten „souveränen“ Entscheidung jedes dieser Länder über seine Politik, auch über seinen Beitritt zum Bündnis, wäre dies wohl schwerlich vereinbar. Georgien hat 2008 das Problem exemplarisch vorgeführt, Washington und Brüssel haben zugesehen oder besser weggesehen. 230 Lothar Rühl Die NATO muss lernen mit Provokationen anderer Länder in Europa umzugehen, nicht nur mit russischen. Russland aber muss sich für Kooperation mäßigen. Wie realistisch diese Forderung und die Erwartung in ihre dauerhafte Erfüllung durch Moskau sind, kann nur ein Versuch lehren. Einem solchen auf Kompromiss zielenden Versuch muss Zeit gegeben werden. Russland ist ein Maßstab für Zeit wie China oder Indien. Es wird als eine europäische Großmacht mit einer kontinentalen eurasischen Dimension und reichen Bodenschätzen in Europa selber der zentrale Gegenmaßstab zum transatlantischen Amerika bleiben. Es wird seine Macht ausspielen, wie die Gelegenheiten sich ergeben und die Vorteile sich bieten. Seine Schwächen werden es behindern und zu Misserfolgen Moskaus beitragen. Politik kann nicht immer erfolgreich sein. Doch jeder Konflikt muss wie jeder Krieg einmal ein Ende haben, und 1990/91 lehrt, dass vermeintlich definitive Realitäten sich verändern oder auch plötzlich in einem Umbruch aufgehoben werden können. Für das euro-atlantische Bündnis und seine Regierungen, vor allem die in Washington, von der auch in Zukunft die Führung ausgehen wird, bedeutet dies, dass die Akteure auf Aktionismus und auf die Addition ihrer Ziele verzichten, stattdessen Prioritäten im Reich des Möglichen setzen müssen. Die Grenzen des Möglichen im Osten aber bestimmt die Existenz Russlands, auch für Amerika. Russland bleibt in Schwäche wie in künftig möglicher Stärke die Großmacht im Osten Europas, die man weder einfach in das euro-atlantische Bündnisgefüge oder eine europäische Sicherheitsorganisation wie die OSZE „einbinden“ noch ausgrenzen kann. Medwedjews ungeeignete Vorschläge im Jahre 2008 für ein europäisches Sicherheitssystem mit einer möglichen eurasischen Dimension bis nach China und Indien anstelle der NATO bedürfen mehr als nur einer Ablehnung. Hier liegt ein objektives Plandatum für die Politik der USA auch unter dem Präsidenten Obama und dessen Nachfolgern in der Zukunft. Die Zeit des amerikanischen Triumphalismus über Moskau à la Reagan „I won the Cold War“ ist mit dem Ende der Bush-II-Präsidentschaft Geschichte. Auch für die Atlantische Allianz und für das Verhältnis Europas zu den USA wie zu Russland ist ein Neuanfang unumgänglich, wenn europäische Interessen im atlantischen Verbund realistisch bestimmt und durch Politik im strategischen Sinne, d.h. kontinuierlich und langfristig, gewahrt und die überwiegend europäische Natur Russlands für gemeinsame Sicherheit und Wohlfahrt genutzt werden sollen. Dann könnte sich auch die Politik in Moskau ändern. Die Alternative, auf einen Regimewechsel in Russland zu warten, ist von höherem Risiko und ebenso großer Ungewissheit. Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik im ostasiatischpazifischen Raum Gottfried-Karl Kindermann 1. Machtexpansion und Prinzipien amerikanischer Politik im Raum des Pazifik In europäischen Perspektiven erscheinen die Vereinigten Staaten als primär atlantischer Staat. Und in der Tat, als solcher schlossen sich die dreizehn Gründerstaaten der USA 1787 an der Ostküste zusammen. Doch die gewaltige Dynamik der transkontinentalen Westexpansion bewirkte, dass die USA nach der Schlichtung eines Grenzstreits mit Großbritannien schon 69 Jahre später mit dem sog. Oregon Country 1846 ihr erstes Gebiet am Pazifik erwerben konnten. Nur zwei Jahre später provozierten USStreitkräfte einen Krieg gegen Mexiko, als dessen Folge die USA Kalifornien annektieren konnten. Der von US-Außenminister Seward betriebene Ankauf von Alaska und den Aleuten-Inseln von Russland 1867 für nur 7,2 Millionen US-Dollar erschien Kritikern zwar als „Seward‘s folly“. Wäre Alaska in russischem Besitz geblieben und stellt man sich die geostrategische Lage der USA vor, so lässt sich Seward‘s Weitblick durchaus bewundern. Trotz ihres Gewinns riesiger Territorien an der Westküste Nordamerikas bewirkte Amerikas Westexpansion anschließend den Vorstoß in den Pazifik. Noch im Jahr des Alaska-Ankaufs besetzte die Kriegsmarine der USA die strategisch wichtigen Midway-Inseln, im Zweiten Weltkrieg Schauplatz einer entscheidenden Seeschlacht. Zwanzig Jahre später annektierten die USA die Hawaii-Inseln im Zentralpazifik und ebenso die Philippinen – Letztere als Folge des von den USA wegen Kuba geführten Krieges mit Spanien. Somit waren die Vereinigten Staaten knapp vor Beginn des 20. Jahrhunderts auch zur Kolonialmacht in Südostasien geworden. Die Diplomatie der USA befasste sich mit pazifischen Räumen sogar bereits vor jeder Landnahme der USA an der Pazifikküste. So wandte sich die Monroe-Doktrin von 1821 nicht nur gegen jeden Versuch europäischer Mächte zur Wiedergewinnung verlorener Kolonien in der westlichen Hemisphäre, sondern konkret auch gegen Vorstöße Russlands an der Nordwestküste Nordamerikas mit dem Ziel, dort eine russische Einflusssphäre zu errichten. 232 Gottfried-Karl Kindermann Geostrategisch verfestigten die USA ihre Positionen an der Westküste des nordamerikanischen Kontinents einerseits durch den Bau von drei Atlantik und Pazifik verbindenden Eisenbahnen wie andererseits auch durch den Bau des 1914 eröffneten Panama-Kanals. An der Jahrhundertwende verkündeten die USA ein für das nächste Jahrhundert maßgebliches Leitinteresse in Ostasien. Es war das von Außenminister John Hay 1899 erstmals bekanntgegebene Prinzip der „open door policy”. Dieses wandte sich gegen Erwägungen europäischer Kolonialmächte, China in Interessensphären aufzuteilen. Stattdessen forderte diese Doktrin der Offenen Tür gleiche Chancen für alle am Chinahandel beteiligten Mächte und die Erhaltung der staatlichen und territorialen Integrität des Chinesischen Reiches, das allein im Jahr zuvor unverschuldet fünf chinesische Territorien an mit einander konkurrierende europäische Großmächte hatte abtreten müssen. Gerade auch in diesem Zusammenhang bildete die machtpolitische Entwicklung Japans, das zuvor als Folge seines siegreichen Krieges gegen China 1894/95 Taiwan und früher bereits die Ryukyu-Inseln annektiert hatte, eine definitive Sorge der amerikanischen Fernostdiplomatie. Es war insbesondere US-Präsident Theodore Roosevelt, der im russisch-japanischen Krieg 1904/05 den Friedensvertrag von Portsmouth New Hampshire vermittelte, um in Nordostasien ein gewisses Gleichgewicht zwischen diesen beiden Mächten zu erhalten. Kurz zuvor hatten Washington und Tokio ein Geheimabkommen geschlossen, in dem Japan die Sicherheit des amerikanischen Protektorats auf den Philippinen zusicherte, während die USA ihr Verständnis für Japans Interesse erklärten, seine Oberherrschaft über Korea zu errichten. Japans Kriegserklärung an das Deutsche Reich 1914 ermöglichte es den Japanern, die deutscherseits von Spanien im Westpazifik angekauften Marianen, Karolinen und Marshall-Inseln als Mandatsgebiete zu erhalten und damit zu einem Machtfaktor auch in diesem Teil des Pazifik zu werden. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg waren die USA bemüht, die Konstellation einer institutionalisierten Friedensordnung im Pazifik zu schaffen. Diesem Zweck dienten drei Pazifik-Konferenzen, die 1921/22 in Washington abgehalten wurden. Der erste, sog. Vier-Mächte-Vertrag beinhaltete die gegenseitige Anerkennung des insularen Besitzstandes der Signatarmächte im Pazifik und sah Schlichtungsmethoden im Falle von Streitigkeiten vor. Ein gleichzeitiger Fünf-Mächte-Vertrag beschloss, die Flottenstärken von Großkampfschiffen im Pazifik auf ein Verhältnis von 5 (USA) zu 5 (Großbritannien) zu 3 (Japan) und zu 1,75 jeweils für Frankreich und Italien festzulegen und die Verwendung bestimmter Kampfmittel zu verbieten. Obwohl Japans Regierung zustimmte, nahmen nationalistische Kreise mit tiefer Empörung zur Kenntnis, dass Japan als einziger exklusiv im Pazifik befindlicher Staat eine geringere Flottenstärke zugesprochen bekommen hatte als England und die USA. Der im November 1921 unterzeichnete Neun-Mächte-Vertrag entsprach aber voll und ganz den Prinzipien der amerikanischen open door Politik bezüglich Chinas. Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik 233 2. Der Kampf um die Vorherrschaft im Pazifik Doch war dieser diplomatische Triumph der USA nicht von langer Dauer. Denn ein Jahrzehnt später zerbricht Japan den Status quo durch die Eroberung der chinesischen Nordostprovinzen (Mandschurei), die es anschließend in das Satelliten-Kaiserreich Mandschukuo verwandelt. Die USA reagierten mit der sog. Stimson-Doktrin der Nichtanerkennung gewaltsamer Veränderungen des Status quo. Eine Erklärung des japanischen Außenministeriums, die sich scharf gegen jede Hilfeleistung dritter Staaten für China wandte, die dieses bei seinem Widerstand gegen Japans Hegemoniestreben unterstützen könne, bedeutete eine weitere Absage Japans an die open door Politik der USA. Auch kündigte Japan den Neun-Mächte-Vertrag zur Begrenzung der Flottenrüstung, wonach im pazifischen Raum eine Phase hektischer Rüstung insbesondere auf Seiten Japans und der USA begann. In China war es nach einem Jahrzehnt der Anarchie und chaotischer Bürgerkriege der von Sun Yat-sen gegründeten Kuomintang (Nationale Volkspartei) unter Chiang Kai-shek 1928 gelungen, eine, wenn auch prekäre, Wiedervereinigung Chinas zu bewirken und im Jahr zuvor den ersten Versuch einer Machtergreifung der chinesischen Kommunisten abzuwehren. Eine drastische Veränderung der Kräftekonstellation im Westpazifik ergab sich aus dem Beginn des achtjährigen japanischen Angriffskrieges gegen China im Juli 1937, der einerseits zur japanischen Eroberung Ostchinas führte und andererseits zu der von Frankreichs Vichy-Regierung 1940 gestatteten Besetzung Nord-Vietnams durch die Japaner. Im September gleichen Jahres entstand der Drei-Mächte-Pakt, durch den Deutschland und Italien Japan die Führungsrolle bei der Schaffung einer Neuordnung „Großostasiens“ zubilligten. Umgekehrt anerkannte Japan die „Führungsrolle“ Berlins und Roms bei der Schaffung einer Neuordnung Europas und die drei Mächte sagten einander Beistand für den Fall zu, dass eine dritte Macht gegen einen von ihnen in den Krieg eintreten sollten – womit die USA gemeint waren. Von den Amerikanern abgefangene Funksprüche deuteten auf Japans Absicht hin, die Kolonialherrschaft der „weißen“ Mächte in Südostasien zu brechen, um selbst zum Hegemon eines neuen „Großostasiens“ zu werden. Die USA reagierten einen Monat nach Beginn des deutsch-sowjetischen Krieges mit der Initiierung eines umfassenden Wirtschaftskrieges gegen Japan. Entgegen dem warnenden Rat seines Admiralstabes – dies werde Krieg bedeuten – hatte US-Präsident Franklin D. Roosevelt im Juli 1941 gegen Japan ein Erdölembargo verhängt, dem sich das Britische Empire und Niederländisch Indien anschlossen, und zusätzlich das Einfrieren aller japanischer Guthaben in den USA verfügt, wodurch Japan von 75 Prozent seiner Einfuhren außerhalb des sog. Yen-Blocks abgeschnitten 234 Gottfried-Karl Kindermann wurde. Da Japans Industrie und Streitkräfte jedoch von auswärtigen Erdölimporten abhängig waren, hatten sich verringernde Vorräte die Wirkung einer Zeitbombe. Das Szenario eines deutschen Sieges in Europa und eines japanischen in Asien ließ die außenpolitische Führung der USA zu der Überzeugung gelangen, die USA sollten aus Gründen ihrer Sicherheit und trotz des immer noch starken Isolationismus zum frühest möglichen Zeitpunkt in den Krieg eintreten. Angesichts einer immer schlechter werdenden Versorgungslage führten die monatelangen Verhandlungen zwischen Tokio und Washington zu keinem Ergebnis. Zwar hatte Japan in der letzten Verhandlungsrunde einen Verzicht auf einen Vorstoß nach Südostasien angeboten, doch die USA forderten einen kompensationslosen Rückzug Japans aus China, in dem Japan viereinhalb Jahre erfolgreich Krieg geführt hatte. Die Forderung entsprach zwar dem Grundprinzip der open door Doktrin. Doch keines der eingeweihten amerikanischen Regierungsmitglieder glaubte, dass Japans vom Militär geführte Regierung diese Forderung annehmen würde. Vierzehn Tage vor Kriegsbeginn informierte Washington alle amerikanischen Militärposten im Pazifik, es bestehe „höchste Kriegsgefahr“. Sollte es zu einem ersten Gefecht kommen, sei darauf zu achten, dass die Japaner den „ersten Schuss“ abfeuerten. Am 7. Dezember 1941 fielen japanische Bomben auf Pearl Harbor, wobei Japans Kriegserklärung – von den Amerikanern schon Stunden zuvor entschlüsselt – durch ein technisches Versagen der japanischen Botschaft in Washington erst anderthalb Stunden nach dem Angriff überreicht werden konnte. Nach dreieinhalb Jahren Krieg war Japan militärisch geschlagen. Doch Washingtons Kriegsziel, eine „bedingungslose Kapitulation Japans“, wurde nicht ganz erreicht, da die japanische Regierung – selbst nach dem Abwurf von zwei Atombomben – zunächst mit der Frage reagierte, was denn im Falle der Kapitulation mit dem Kaiserhaus geschehe. Die Kapitulation erfolgte dann nur bedingt, d.h. durch die vorherige Zusage der Alliierten, die Zukunft des Kaiserhauses werde „vom japanischen Volk“ abhängen. Im Bereich praktischer Politik hatte das Atomzeitalter somit in Ostasien in entsetzlichen Formen begonnen. 3. Die USA „verlieren“ China In der frühen Nachkriegszeit schien sich die internationale Kräftekonstellation im ostasiatischen-pazifischen Raum eindeutig und fast überwältigend zugunsten der USA zu entwickeln. Sie allein beherrschten durch ihre Besatzungsregime Japan – damals die einzige Industriemacht Asiens – und Süd-Korea. Sie besetzten Taiwan und hatten die Philippinen zurückerobern können. Ein Befehl des japanischen Kaisers hatte die problemlose Kapitulation von Millionen japanischer Soldaten bewirkt. Sorgen bereiteten Washington nur die Entwicklungen in China. Gegen den Widerstand sowohl Churchills als auch Stalins hatte Präsident Roosevelt Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik 235 anlässlich der Gründung der Vereinten Nationen für China einen permanenten Sitz mit Vetomacht im UN-Sicherheitsrat durchsetzen können. In China selbst war unmittelbar nach Kriegsende der Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Nationalisten in weiten Teilen des Landes mit voller Kraft entbrannt. Die Sowjetunion, die am Tag des Atombombenabwurfs auf Nagasaki und somit nur wenige Tage vor Japans Kapitulation in den Krieg gegen Japan eingetreten war, hatte Nordwestchina besetzt und rüstete die chinesischen Kommunisten mit riesigen, dort lagernden japanischen Waffenbeständen aus. Angesichts dieser Lage entsandte Präsident Truman seinen Generalstabschef George C. Marshall nach China. Er war beauftragt, zwischen den Bürgerkriegsparteien zu vermitteln, um eine politische und militärische Reintegration Chinas durch die Schaffung einer demokratischen Koalitionsregierung zwischen der autoritären Kuomintang und der totalitären Partei der chinesischen Kommunisten zu erreichen. An den Patriotismus beider Parteien appellierend, stellten die USA Aufbauhilfe für das vom Krieg zerstörte China nur für den Fall ihrer Einigung in dem von Washington gewünschten Sinne in Aussicht. Nach anfänglichen Scheinerfolgen musste sich Marshall das seinerseits nur den Chinesen angelastete Scheitern seiner Vermittlungsmission eingestehen. Diese war der erste Versuch der USA gewesen, Prozesse der politischen Systembildung in einem asiatischen Land im Sinne ihrer eigenen Vorstellungen und Prinzipien von außen her zu gestalten. In der amerikanischen Innenpolitik erregte die demagogische Frage: „Who has lost China?“ die Gemüter. Die Niederlage des mit Amerika in vielfacher Hinsicht eng verbundenen nationalchinesischen Systems und der Sieg der Kommunisten im volkreichsten Land der Erde 1949 lösten in den USA einen landesweit empfundenen Schock aus, der sich noch steigerte, als sich die neu gegründete Volksrepublik China im Februar 1950 mit der Sowjetunion verbündete. War doch dadurch ein von der Elbe bis zum Pazifik reichender Block an Moskau orientierter Staaten entstanden, der die internationale Kräftekonstellation zugunsten der Sowjetunion veränderte. Der mit einer Blitzkriegoffensive des Nordens gegen den Süden in Korea beginnende Krieg nötigte den USA eine Grundsatzentscheidung hinsichtlich ihrer Reaktion ab. Durchgesetzt hatte sich dabei nicht der von US-Außenminister Dean Acheson empfohlene Rückzug der USA auf Japan und eine Kette von Inseln im Pazifik, sondern die von George F. Kennan konzipierte und von Präsident Truman übernommene Eindämmungsstrategie. Das aber bedeutete in Korea, dem Angriffskrieg Nord-Koreas mit einer von den Vereinten Nationen sanktionierten militärischen Gegenmacht zu begegnen. Sich auf die Fehler der Beschwichtigungspolitik im Europa der dreißiger Jahre berufend, vertrat Truman als erster US-Präsident die sog. „Domino-Theorie“. Ihr zufolge glaubten amerikanische Entscheidungs- 236 Gottfried-Karl Kindermann träger, dass jeder passiv geduldete Akt der Aggression den Angreifer nicht beschwichtigen, sondern – im Gegenteil – zu weiteren Aggressionen ermutigen werde. Pekings Ende 1950 erfolgender Eintritt in den Koreakrieg konfrontierte Washington mit der Faktizität eines ersten Krieges zwischen den USA und einem kommunistischen China, hinter dem als Verbündeter und Waffenlieferant die Sowjetunion stand. Der Krieg endete 1953 mit einem Waffenstillstand, der bis zur Gegenwart die völkerrechtliche Basis der unbeendeten Teilung Koreas bildet und der den Status quo ante auf der koreanischen Halbinsel wieder herstellte. Ein erstes Mal hatten die USA einen Krieg ohne Sieg beenden müssen. 4. Die Konstellation der peripheren Eindämmung Auf die ab dem Koreakrieg perzipierte Gefahr einer Expansion der kommunistischen Mächte im ostasiatisch-pazifischen Raum reagierte die Truman-Regierung mit dem Aufbau einer zur Eindämmung bestimmten politisch-militärischen Abwehrfront. In diesem Sinne erließ Truman bereits zwei Tage nach Kriegsbeginn drei Weisungen. Sie betrafen den Einsatz von US-Streitkräften in Korea, die Abschirmung Taiwans durch die VII. US-Kriegsflotte und die massive materielle Unterstützung für Frankreichs Kolonialkrieg gegen die nationalkommunistischen Viet Minh in Vietnam und im restlichen Indochina. Intensiv vorangetriebene Verhandlungen führten 1951 zu einem milden Friedensvertrag und einem gleichzeitigen Sicherheitspakt mit Japan, und das im Januar 1950 von den USA preisgegebene nationalchinesische System auf Taiwan erhielt ab Mitte 1951 amerikanische Rüstungs-, Wirtschafts- und Beraterhilfe. In Südostasien betrachteten die USA das Königreich Thailand als primäres Bollwerk des Westens, weshalb es ab 1950 in wachsendem Maße amerikanische Rüstungs-, Berater- und Wirtschaftshilfe erhielt. Allein der Wert amerikanischer Militärhilfe für Thailand betrug im Zeitraum zwischen 1950 und 1972 elf Milliarden US-Dollar. Mit seinem vormaligen Protektorat, den ab 1946 selbstständig gewordenen Philippinen, schlossen die USA 1952 einen Verteidigungsvertrag. Nach Frankreichs schwerer Niederlage in seinem achtjährigen Kolonialkrieg in Indochina verfügte die sog. Genfer Indochinakonferenz von 1954 die Teilung Vietnams in einen kommunistischen Norden und einen pro-westlichen Süden. Kaum zwei Monate später initiierten die USA im September 1954 die Gründung des Südostasienpaktes (SEATO), dem nur drei asiatische Staaten (Thailand, Philippinen und Pakistan) angehörten. Pekings Reaktion bestand in einer im folgenden Monat beginnenden Militäroffensive gegen eine Reihe nationalchinesischer unmittelbar vor der Küste Festlandschinas gelegener Vorposteninseln. Noch im Verlauf dieser Kämpfe, bei denen die Nationalchinesen, von den USA nur materiell Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik 237 unterstützt, die strategisch wichtigsten Inselgruppen (Quemoy oder Kin Men und Matsu) behaupten konnten, schlossen die USA mit der Republik China auf Taiwan im Dezember 1954 einen bilateralen Verteidigungspakt. Ein solcher Pakt war zuvor nach Ende des Koreakrieges (1953) mit SüdKorea geschlossen worden. Insgesamt hatten die USA die Kräftekonstellation im Raum des Westpazifik dadurch verändert, dass sie in Reaktion auf das Bündnis Moskau-Peking und den Angriffskrieg in Korea auf der koreanischen Halbinsel zumindest den Status quo ante wieder herstellen, anschließend bilaterale Bündnisse mit Japan, Süd-Korea, Taiwan und den Philippinen sowie ein Militärabkommen mit Thailand schließen und ergänzend den Südostasienpakt begründen konnten. In die Gesamtkonstellation des westpazifischen Raumes hatten die USA somit ihre Politik der „peripheren Eindämmung Chinas“ eingeführt. Eine neuerliche Militäroffensive der VR China gegen die erwähnten nationalchinesischen Küsteninseln konnte von den Nationalchinesen 1958, wiederum von den USA nur materiell unterstützt, erfolgreich abgewehrt werden. 5. Das Scheitern in und an Vietnam Ein neuer Krisenherd von weltpolitischer Relevanz sollte sich jedoch in Vietnam entwickeln. Das Land war nach Frankreichs Niederlage 1954 in einen kommunistischen Norden und einen nichtkommunistischen Süden geteilt und insgesamt von französischer Kolonialherrschaft befreit worden. Ab dem Rückzug Frankreichs hatten die USA mit einer gezielten Unterstützung des südvietnamesischen Staatswesens begonnen. Insbesondere förderte Washington Aufbau, Ausrüstung und Ausbildung einer südvietnamesischen Armee. Ab Mitte der fünfziger Jahre regierte in Saigon der zum Präsidenten gewählte Ngo Dinh Diem, der die USA in den ersten Jahren seiner Regierung durch die Effizienz seiner Verwaltung und seine pro-westliche Orientierung beeindruckte. Doch bei Diem, der aus einer katholischen Mandarinenfamilie stammte, machten sich im Lauf der Zeit autokratische und nepotistische Züge seiner auch von religiöser Intoleranz und mangelnder Volksnähe gekennzeichneten Regierungspraxis bemerkbar. Als Diem Maßnahmen zur Unterdrückung der buddhistischen Bevölkerungsmehrheit ergriff, entzog ihm Kennedy seine Unterstützung und Diem wurde im November 1963 auf Betreiben einer Militärclique grausam ermordet. Im gleichen Jahr hatte die in Nord-Vietnam totalitär regierende kommunistische Lao Dong Partei unter der Führung Ho Chi Minhs beschlossen, ihre vorherige Neutralität im Konflikt zwischen Moskau und Peking aufzugeben, um nach dem Modell Mao Tse-tungs einen totalen „Partisanen-Volkskrieg“ mit dem Ziel der Eroberung ganz Vietnams zu führen. 238 Gottfried-Karl Kindermann Der Nachfolger Präsident Kennedys, der im gleichen Monat wie Präsident Diem ermordet worden war, war Präsident Lyndon B. Johnson, und seine Regierung sah sich mit bedrohlichen Infiltrationserfolgen der nationalkommunistischen Vietcong in Süd-Vietnam konfrontiert. Während eine Gruppe von Beratern Johnson eine Entflechtung der USA von Vietnam empfahl, betonten andere die Grundannahmen der „Domino-Theorie“. Der Partisanenkrieg sei in Griechenland, Malaysia und den Philippinen erfolgreich bekämpft worden, weshalb also nicht auch in Vietnam? Sollten die USA Vietnam preisgeben, würde das bei ihren Verbündeten einen unwiederbringlichen Vertrauensverlust bewirken und die Gegner zu neuen Aggressionen ermutigen. Anfang August 1964 kam es im Golf von Tonking zu einem ursächlich umstrittenen Seegefecht zwischen amerikanischen und nordvietnamesischen Seestreitkräften. Der US-Kongress verabschiedete daraufhin am 7. August 1964 mit großen Mehrheiten die sog. „Tonkin Gulf Resolution“, die dem US-Präsident als Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte die Vollmacht erteilte, in Südostasien ihm erforderlich scheinende Maßnahmen zu ergreifen, um etwaigen Feindseligkeiten gegen dortige US-Streitkräfte entgegenzutreten. In amerikanischer Darstellung erfolgten hiernach US-Bombenangriffe auf Nord-Vietnam. Als Folge ergab sich ein ständig gesteigerter Einsatz von US-Bodentruppen, um den Verbündeten Süd-Vietnam zu verteidigen. Doch in Süd-Vietnam waren dem Mord an Ngo Dinh Diem keine populärere Regierung, sondern rivalisierende Militärjuntas gefolgt. Die nach amerikanischen Modellen ausgebildeten Streitkräfte waren folglich auf einen Partisanenvolkskrieg nicht vorbereitet und Chinas Drohung, im Falle einer Invasion Nord-Vietnams, dem Präzedenzfall des Koreakrieges entsprechend, in Vietnam einzugreifen, verhinderte eine Bodenoffensive gegen den vietnamesischen Norden. Umgekehrt aber benutzten die Partisanen der Vietcong geheime Dschungelpfade im neutralen Kambodscha, um die Südvietnamesen in der Flanke anzugreifen. Angesichts ihrer wachsenden Schwierigkeiten versicherte Johnson den Südvietnamesen: „We will not be defeated. We will not grow tired. We will not withdraw, either openly or under the cloak of a meaningless agreement.” Wachsende US-Truppenstärken in Vietnam führten jedoch zu keiner Besserung der Kriegslage. Als es dem Vietcong im Zuge der sog. „TET-Offensive“ im Januar 1968 – wenn auch unter schwersten Verlusten – gelang, fast alle Provinzhauptstädte Süd-Vietnams kurzfristig zu erobern und selbst in Saigon einzudringen, begann sich in der USFührung die Überzeugung durchzusetzen, Süd-Vietnam könne auf Dauer nicht gehalten werden. Der unter Einsatz gewaltiger Mittel nicht nur im militärischen, sondern auch im wirtschaftlichen und politischen Sinne unternommene Versuch einer Verteidigung und gleichzeitigen Neustrukturierung Süd-Vietnams war gescheitert. Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik 239 6. Washingtons Détente mit der Volksrepublik China Der neue Präsident der USA, der am 20. Januar 1969 angelobte Kalifornier Richard M. Nixon, erstrebte durch eine Annäherung der USA an die VR China, das perzipierte außenpolitische over-commitment der USA durch eine neue Konstellation trans-pazifischer Entspannung entscheidend zu reduzieren. In Peking mit Mao Tse-tung und Chou En-lai geführte Gespräche Nixons und Kissingers brachten primär drei Ergebnisse: ein Ende des bilateralen Kalten Krieges im Pazifik, eine „Quasi-Allianz“ (Kissinger) beider Mächte gegen die Sowjetunion und eine Minderung des US-Engagements zugunsten Taiwans. Allerdings weigerte sich Mao, die von Nixon erbetene Vermittlerrolle zwischen den USA und Nord-Vietnam zu übernehmen. Nach mühsamsten Verhandlungen kam es im Januar 1973 dennoch zu einem Waffenstillstand in Vietnam, der real gesehen den Charakter einer verschleierten amerikanischen Kapitulation trug. Es war der erste Krieg, den die USA verloren, und ein zweiter Fall eines gescheiterten Versuchs eines von außen gesteuerten nation-building in Asien seitens der USA. Drei Monate später verließen die letzten amerikanischen Soldaten Vietnam. Eine Großoffensive der Vietcong vom April 1975 führte in Vietnam zum Sieg der Kommunisten, zu deren Racheakten gegen ihre Gegner und zur Wiedervereinigung Vietnams im Zeichen der vietnamesischen Kommunisten. Drei Jahre später nur eroberte Vietnam das benachbarte Kambodscha und vermochte es, als Hegemon aller Staaten Indochinas zu agieren. 7. Ambivalenzen und Konstellationen der amerikanischen Taiwanpolitik Um das neue Verhältnis zwischen den USA und China zu verfestigen, beschloss Nixons Nachfolger Jimmy Carter, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Peking zu erwirken. Zu diesem Zweck akzeptierte er kompensationslos drei Forderungen Pekings: Die USA sollten ihre diplomatischen Beziehungen zum nationalchinesischen System der Republik China auf Taiwan abbrechen und keine Staatlichkeit der Republik China auf Taiwan anerkennen; sie sollten zweitens ihren Bündnisvertrag mit Taiwan kündigen und drittens restliche US-Militäreinheiten von der Insel zurückziehen. Taiwans Präsident wurde nur wenige Stunden vor Carters Bekanntgabe dieser Maßnahmen hiervon verständigt. Doch in den USA erhob sich starke Kritik an Inhalt und Formen dieses Überraschungscoups. Entgegen dem Willen des Präsidenten verabschiedete der US-Kongress den heute noch geltenden und im April 1979 in Kraft getretenen „Taiwan Relations Act“. Dieser verpflichtet die USA, Taiwans Sicherung gegen militärische oder wirtschaftliche Offensiven als regionales Eigeninteresse der USA zu betrachten und Taiwan daher weiter- 240 Gottfried-Karl Kindermann hin Rüstungsgüter zu verkaufen. Dennoch hatte sich die US-Regierung ab dem Nixon-Chou En-lai Kommuniqué von Schanghai 1972 stets zum sog. „Ein China Prinzip“ bekannt. Trotz der Normalisierung der diplomatischen Beziehungen mit Peking, der eine Fülle wirtschaftlicher Vernetzungen folgte, blieb die mit manchen Widersprüchen behaftete Taiwanfrage ein ungelöster und spannungsträchtiger Problembereich in der Gesamtkonstellation amerikanischer Beziehungen zu China. Angesichts der maoistischen Machtergreifung in Kontinentalchina hatte Chinas zuvor amtierender Präsident Chiang Kai-shek 1949 einen Teil der politischen, kulturellen und technokratischen Elite Chinas mitsamt einem Teil der Streitkräfte nach Taiwan verlagert. Diese „zugereisten“ Festländer waren im Verlauf der Jahrzehnte gealtert und einheimische Taiwanesen hatten viele ihrer Positionen übernommen. Die Aufhebung des Kriegsrechts 1987 hatte sowohl das Verbot der Neubildung politischer Parteien als auch das Verbot von Reisen nach und Handel mit China außer Kraft gesetzt. In Gestalt der Demokratischen Fortschrittspartei entstand ein politisches Instrument des taiwanesischen Separatismus. 1988 wurde erstmals ein Taiwanese, Dr. Lee Teng-hui, Präsident Taiwans und Vorsitzender der Kuomintang (Nationalchinesische Volkspartei). Als Lee bei der ersten allgemeinen Volkswahl eines Präsidenten 1996 kandidierte, führten Seeund Luftstreitkräfte der VR China militärische Drohmanöver knapp vor den beiden Haupthäfen Taiwans durch, um vor der Wahl des Peking verhassten Lee zu warnen. US-Präsident Clinton entsandte daraufhin einen Kampfverband der US-Kriegsmarine einschließlich eines Flugzeugträgers in Gewässer nahe Taiwan und erließ mit Japans Ministerpräsident Hashimoto Ryotaro eine gemeinsame Erklärung über Sicherheitsinteressen beider Länder auch in Gebieten in der Nähe Japans (Taiwan). Die USA waren nicht gewillt, sich durch China aus dem Westpazifik vertreiben zu lassen. Trotz Pekings Einschüchterungsversuch wurde Lee Teng-hui mit großer Mehrheit gewählt. Sorgen, wenn auch unterschiedlicher Art, bereiteten in Washington wie auch in Peking, dass in den Jahren 2000 und 2004 bei Präsidentschaftswahlen auf Taiwan jeweils der Führer der separatistischen Fortschrittspartei Chen Shui-biän gewählt wurde. Obwohl Peking 2005 ein sog. „Anti-Sezessions-Gesetz“ mit einer Kriegsermächtigungsklausel gegen Taiwan erlassen und mehr als 1.000 gegen Taiwan gerichtete Mittelstreckenraketen in Stellung gebracht hatte, beharrte Chen Shui-biän auf dem Ziel einer Unabhängigkeitserklärung Taiwans von China. Da seiner Ansicht nach Taiwan de facto unabhängig und voll souverän sei, müsse mit der Präsidentschaftswahl 2008 eine Volksbefragung darüber verbunden werden, ob Taiwan als souveräner Staat und unter seinem Namen einen Antrag auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen stellen solle. Diese Politik aber wurde von Washington mit präzedenzloser Schärfe kritisiert. Chen Shui-bäns Haltung –so hieß es – bilde eine unnötige und unrealistische Provokation, deren mögliche Folgen nicht nur Taiwan selbst beträfen. Taiwan – so hieß es in Washington – sei in amerikanischer Sicht Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik 241 weder ein eigener Staat noch aber auch ein Teil der Volksrepublik China, sondern verkörpere ein noch unentschiedenes Problem. In der Tat hatte Japan in seinem Friedensvertrag von 1951 zwar auf Taiwan verzichtet, ohne jedoch anzugeben, zu wessen Gunsten der Verzicht erfolgt sei. Washington erteilte Taiwan den dringenden Rat, sich mit dem Status quo seiner unbestreitbaren de facto Unabhängigkeit zu begnügen und nicht den Status quo der bestehenden Dreieckskonstellation USA-Taiwan-China zu erschüttern. Anlässlich eines Treffens in Sydney im September 2007 hatten sich die Präsidenten der USA und Chinas, George W. Bush und Hu Jintao, betont kritisch zur separatistischen Politik Chen Shui-biäns geäußert. Doch zur Erleichterung sowohl Washingtons als auch Pekings vermochte die oppositionelle Kuomintang 2008 sowohl bei den Parlamentswahlen als auch bei der Präsidentenwahl Erdrutschsiege zu erzielen, während Chen Shui-biäns Volksbefragung nicht die erforderliche Mehrheit erzielte. Der im März 2008 neu gewählte Präsident Ma Ying-jeou, ein vormaliger Bürgermeister von Taipei, erklärte bei seinem Amtsantritt, während seiner Amtsperiode werde es weder eine Wiedervereinigung mit China geben noch auch eine Unabhängigkeitserklärung Taiwans. Taiwan wie auch China einigten sich auf eine Kompromissformel, nach der sich beide Seiten zwar zum Prinzip des „einen China“ bekennen, jedoch mit dem Recht der je eigenen Interpretation dieses Prinzips. In einem Glückwunschschreiben an Präsident Ma äußerte Barack Obama die Hoffnung, dass China auf die Neuentwicklungen in Taiwan konstruktiv reagieren werde. Seither wurden zwischen Taiwan und China mehrere Abkommen zur Förderung des Verkehrs zwischen beiden Seiten abgeschlossen. Die unmittelbare Krise wurde dadurch entschärft, doch liegt Taiwan langfristig gesehen weiterhin im Spannungsfeld zwischen Chinas Raketendrohung und der Schutzzusage der USA. 8. Problemstrukturen der nord-koreanischen Nuklearkrise Eine zweite Krisenzone in der Kräftekonstellation des Westpazifik betrifft das Verhältnis der USA und Süd-Koreas zu Nord-Korea und seiner Nuklearpolitik. Im Zusammenhang mit der Verletzung des internationalen Nonproliferationsabkommens wie auch wegen Nord-Koreas Verweigerung legitimer Kontrollen war es Anfang der neunziger Jahre zu schweren Spannungen zwischen den USA, Süd-Korea und der Internationalen Atomenergiebehörde einerseits und Nord-Korea andererseits gekommen. Es bestand der Verdacht, dass Nord-Korea dabei sei, waffenfähiges Plutonium und gleichzeitig fortgeschrittene Raketensysteme zu entwickeln. Zwischen Pjöngjang und Washington ausgetauschte Kriegsdrohungen hatten diese Spannungen gefährlich eskalieren lassen, als ein inoffizielles Gipfelgespräch zwischen US-Ex-Präsident Jimmy Carter und Kim Il Sung, dem Diktator Nord-Koreas, zu einer in Genf im Juli 1994 stattfindenden 242 Gottfried-Karl Kindermann amerikanisch-nord-koreanischen Konferenz führte. Hier wurde vereinbart, dass Nord-Korea seine gefährlicheren graphitmoderierten Reaktoren abrüsten und mit amerikanischer Hilfe durch Leichtwasserreaktoren ersetzen werde. Bis zu deren Fertigstellung würden die USA Nord-Korea jährlich 500.000 Tonnen Schweröl liefern. Bei Ende der Amtszeit Präsident Clintons schienen sich die bilateralen Beziehungen so weit gebessert zu haben, dass Clinton den Oberkommandierenden der nord-koreanischen Volksarmee, Marschall Jo Myong Rok, im Weißen Haus empfing und USAußenministerin Albright zu Begegnungen mit Nord-Koreas neuem Präsidenten Kim Jong Il nach Pjöngjang reiste. Zur zeitweiligen Entspannung hatte auch der seit 1998 amtierende süd-koreanische Präsident Kim Dae Jung beigetragen, dessen am Modell der Ostpolitik Willy Brandts orientierte „Sonnenscheinpolitik“ u.a. mit Erfolg bestrebt war, Nord-Koreas Beziehungen zum Süden durch großzügige materielle Vorleistungen aufzulockern, was auch in mancherlei Hinsicht gelang. Amerikas neuer Präsident George W. Bush teilte jedoch Kim Dae Jungs Optimismus nicht, sondern zählte Nord-Korea aufgrund seines rigoros totalitären Systems und seiner Rüstung im Nuklear- und Raketenbereich zu den „gefährlichsten Systemen dieser Erde“. Doch auch dank chinesischer Kooperation gelang es den USA ab August 2003, die Konstellation einer in Peking tagenden Dauerkonferenz von sechs Mächten (USA, Nord- und Süd-Korea, China, Japan und Russland) in Gang zu bringen. Damit bewirkte die amerikanische Diplomatie die Institutionalisierung und Internationalisierung des Dialogs mit Nord-Korea. Dessen ungeachtet feierte Nord-Korea mit Triumph seine erste nukleare Explosion am 9. Oktober 2006 wie auch eine Serie von Raketenerprobungen im Juli des gleichen Jahres. Mit seiner in Entwicklung befindlichen Taepodong-2-Rakete könnte Nord-Korea die Nordwestküste der USA erreichen. Eine der Sorgen Washingtons betrifft auch Möglichkeiten einer nord-koreanischen Weitergabe nuklearer Techniken an islamische Staaten des Mittleren Ostens. Nord-Koreas Nukleardiplomatie gleicht seit Jahren einem Nervenkrieg mit immer wieder gemachten und dann teilweise oder ganz zurückgenommenen Zusagen. Eine der letzten Korea betreffenden Maßnahmen der George W. Bush-Regierung war die Streichung Nord-Koreas von der Liste Terror unterstützender Staaten im Oktober 2008, wodurch sich für Nord-Korea wertvolle wirtschaftliche Zugänge öffneten. Noch im Wahlkampf stehend, hat Barack Obama ein künftiges Gipfeltreffen mit Nord-Koreas Diktator Kim Jong Il für nützlich erklärt, während Außenministerin Hillary Clinton einen von Nord-Korea schon lange begehrten Friedensvertrag mit den USA in Aussicht stellte. Doch Nord-Koreas Ende Januar 2009 proklamierte Kündigung seiner Verträge mit Süd-Korea und seine Ankündigung eines Satellitenstarts für Anfang April 2009, hinter dem westliche und japanische Beobachter aber die Erprobung einer militärischen Langstreckenrakete vom Typ Taepodong 2 (Reichweite bis Alaska) vermuten, lassen vielerseits Skepsis hinsichtlich einer baldigen Entspannung aufkommen. Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik 243 9. Zur Konstellation amerikanischer Ostasienpolitik bei Beginn der Obama-Präsidentschaft Zu Beginn der Präsidentschaft Barack Obamas ist die politische und geostrategische Konstellation des ostasiatisch-pazifischen Raumes weiterhin von einem weit gespannten Fächer bilateraler amerikanischer Bündnisse mit Staaten der Region geprägt, zu denen vorrangig Japan und Süd-Korea gehören, sodann die Philippinen, Thailand und Pakistan sowie – nur aufgrund der unilateralen Schutzzusage der USA – auch Taiwan. Nach Westen hin erweitert, gehört zu dieser Disposition amerikanischer Politik auch die kriegsbedingte Präsenz der USA in Afghanistan und ebenfalls Washingtons neu akzentuierte Annäherung an Indien. In westlicher Sicht sind die USA das Zentrum und der Sicherheitsgarant dieses pazifischen Beziehungsgeflechts. Dieser bündnispolitisch vernetzten Präsenz der USA in östlichen Randgebieten Ostasiens stehen westlich davon als „single players“ drei Mächte, nämlich China, Russland und Indien, gegenüber. China insbesondere sieht in dieser Konstellation eine strukturelle Fortsetzung der amerikanischen Politik einer peripheren Eindämmung Chinas, die jedoch im Gegensatz zum Kalten Krieg als solche nicht deklariert ist. Dass Außenministerin Hillary Clinton Ostasien zum Ziel ihrer ersten offiziellen Auslandsreise machte, betont, wie sie selbst auch sagte, das Gewicht, das die Obama-Regierung der Rolle Ostasiens in ihrer strategischen Planung beimisst. Japan, so erklärte Clinton in Tokio, sei der Eckpfeiler der amerikanischen Asienpolitik. Allerdings traf ihr Wunsch nach stärkerem japanischen Engagement im Kampf gegen den internationalen Terrorismus auf ein von den USA selbst verursachtes Hindernis. War doch den Japanern 1946 durch die damalige US-Besatzung eine von Letzterer konzipierte pazifistische Verfassung unter Drohungen gegen die Person des Kaisers oktroyiert worden. Der international präzedenzlose Artikel 9 dieser Verfassung untersagt Japan Mittel und also auch Aktionen zur militärischen Selbstverteidigung, wodurch es im Sicherheitsbereich vom Schutz der USA abhängig gemacht wurde. Zwar entstanden inzwischen japanische Selbstverteidigungsstreitkräfte in Gestalt einer zahlenmäßig kleinen und effizienten Berufsarmee, die jedoch zahlreichen strengen Beschränkungen unterliegt und die deshalb z.B. über keine Waffensysteme verfügt, mit denen sie auf Angriffe auswärtiger Mächte mit Gegenschlägen auf deren Territorium reagieren könnte. Artikel 96 dieser oktroyierten Verfassung bestimmt zudem, dass Änderungen der Verfassung einer zwei Drittel Mehrheit in beiden Häusern des Reichstages wie auch einer einfachen Mehrheit einer Volksabstimmung bedürfen. Somit unterliegt die einzige pro-westliche Industriemacht Asiens einer – wenn auch extern veranlassten – außergewöhnlichen Selbstbeschränkung ihrer sicherheitspolitischen Möglichkeiten. Zwar blieb Süd-Korea trotz vergangener Dissonanzen mit der Bush-Regierung hinsichtlich seiner zeitweilig praktizierten „Sonnenscheinpolitik“ Nord-Korea gegenüber ein verlässlicher 244 Gottfried-Karl Kindermann Verbündeter der USA. Doch konnte sich Nord-Korea im langjährigen Nuklearstreit mit den USA, ungeachtet mancher seiner Zugeständnisse, mit seinem Willen durchsetzen, Nuklear- und Raketenmacht zu werden. Dies zu verhindern ist Washington nicht gelungen. Doch wird die ObamaRegierung die durch die Diplomatie der George W. Bush-Ära begründete Institutionalisierung der Korea betreffenden Sechs-Mächte-Gespräche in Peking erhalten wollen. Den primären Bezugspunkt der amerikanischen Ostasienpolitik bildet seit Ende des Kalten Krieges zwischen Washington und Peking in den siebziger Jahren die Volksrepublik China. Ihr stehen die USA mit einer Mischung von Eindämmung (containment) und Einbindung (engagement) gegenüber, eine Ambivalenz, für die die zutreffende Bezeichnung „congagement“ gefunden wurde. In den dreißig Jahren seit Ende des selbstschädigenden maoistischen Dogmatismus und Fanatismus hat sich als Leitprinzip chinesischer Außenpolitik ein pragmatischer Nationalismus entwickelt. Stark geprägt von Chinas Geschichte hat dieser sich das Fernziel gesetzt, den USA militärisch und wirtschaftlich wie auch hinsichtlich des globalen Einflusses ebenbürtig zu werden. China ist Atommacht und verfügt über ein beträchtliches Raketenarsenal und ein eigenes Weltraumprogramm. Es ist heute bereits nach den USA und der EU eines der größten Produktionszentren und einer der größten Absatzmärkte sowohl der Weltwirtschaft als auch der USA. Seine steil steigenden, doch offiziell geschönten Militärausgaben wurden vom US-Verteidigungsministerium für 2007 auf maximal 139 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die konkrete Gestaltung seiner Rüstung ist – nach Sicht des Pentagon – eindeutig an der Möglichkeit eines Konflikts mit den USA im Raum des Westpazifik orientiert. Im Jahr 2007 war China der zweitgrößte Handelspartner der USA, jedoch bei einem amerikanischen Handelsdefizit in Höhe von 258 Milliarden USDollar allein für die ersten sieben Monate des Jahres 2008. China verfügt zur Zeit über die größten Hartwährungsreserven der Welt, wovon die Hälfte in US-Regierungsanleihen angelegt ist. Deutlicher als ihre Vorgängerin wendet sich die Obama-Regierung gegen perzipierte chinesische Manipulationen zur Wertminderung der chinesischen Währung (Renminbi), die der amerikanischen Wirtschaft schaden. Umgekehrt fühlt China seine Exporte von vernehmbar werdenden „buy American“-Forderungen in den USA bedroht. Doch die in den ersten Monaten der Obama-Regierung sowohl in Washington als auch in Peking prävalente Tendenz geht – ungeachtet mancher Spekulationen über das Kommen eines Wirtschaftskrieges – vorläufig dahin, die andere Seite eher als unvermeidlichen Partner eines versuchten Krisenmanagements zu betrachten denn als Gegner. Als Angriff auf die traditionelle Leitfunktion des US-Dollars wurde in den USA allerdings Chinas Vorschlag gesehen, anstelle des Dollars eine neue internationale Leitwährung unter der Aufsicht des Internationalen Währungs- Konstellationsanalysen der amerikanischen Außenpolitik 245 fonds zu schaffen. Zugleich bemühen sich die USA erneut um Chinas Partnerschaft in den Bereichen des Umweltschutzes und der Vermeidung schädlicher Formen der Energieproduktion. Zur gegenwärtigen Konstellation der amerikanischen Ostasienpolitik im weiteren Sinne gehört sehr wesentlich auch seine Annäherung an Indien, weitgehend bewirkt durch die nicht unumstrittene amerikanische Anerkennung der indischen Nuklearpolitik seit 2005, ungeachtet der Weigerung Indiens, dem Nichtweiterverbreitungsvertrag beizutreten. Indien, zahlenmäßig gesehen „die größte Demokratie der Welt“, hat sich seit dem Ende seiner vormaligen bürokratisch-sozialistischen Wirtschaftspolitik zu einer der führenden Wirtschafts- und Technologiemächte der gegenwärtigen Welt entwickeln können. Systemisch und machtpolitisch gilt es als potenzielle Alternative zum benachbarten kommunistischen China. Unvergessen ist in Indien der es demütigende Blitzkrieg im Himalaya, mit dem sich China 1962 in den Besitz aller wichtigen Grenzpässe entlang den historisch umstrittenen Grenzen zwischen China und Indien versetzte. Indien ist Grenznachbar Pakistans, dessen politische Instabilität den Amerikanern im Zusammenhang mit ihrem von Obama intensivierten Kampf gegen Afghanistans Taliban und al-Quaida Elemente in wachsendem Maße Sorgen bereitet. Insgesamt setzt sich auch zu Beginn der Obama-Präsidentschaft eine Konstellation der amerikanischen Politik im Pazifik fort, deren Kernelement in der Ambivalenz einer amerikanisch-chinesischen Beziehung besteht, die gleichzeitig von Interdependenz wie aber auch von Bedrohungsempfindungen beider Seiten gekennzeichnet ist. Der von Norden nach Süden laufende Fächer trans-pazifischer Sicherheitspartnerschaften der USA mit Staaten an der Peripherie Chinas – hier insbesondere mit Japan – sind essenziell an dem Verhältnis USA-VR China orientiert, obwohl dieser Kernaspekt nur selten deutlich artikuliert wird. Der Norden der Konstellation ist vom schwelenden Nuklearkonflikt mit Nord-Korea gekennzeichnet. Nord-Koreas trotz Warnungen und UN-Resolutionen Anfang April 2009 durchgeführter Abschuss einer mehrstufigen Langstreckenrakete wird als erprobende Provokation der neuen US-Regierung bewertet. Bezeichnenderweise wurden UN-Sanktionen von China und Russland verhindert. Im Zentrum des Westpazifik hat sich die seit 1949 bestehende Spannung hinsichtlich der Taiwanfrage durch den dortigen Sieg der Kuomintang merklich entspannt. Zum vormaligen Kriegsgegner Vietnam konnten seitens der USA ab 2006 normale Beziehungen und sogar Formen der militärischen Kooperation aufgebaut werden. Auch sind die USA zum Hauptabnehmer vietnamesischer Exporte geworden. Die China umgebende Kette amerikanischer Sicherheitspartnerschaften mit asiatischen Ländern endet im Westen mit der von China, vom Iran und von Russland mit Unbehagen betrachteten militanten Präsenz der USA in Afghanistan. 246 Gottfried-Karl Kindermann Ungeachtet dieses geostrategisch beeindruckend wirkenden Engagements der USA an der Peripherie der VR China gehen Beobachter davon aus, dass sich das allgemeine Kräfteverhältnis zwischen den USA und China partiell zugunsten des Letzteren verändert hat. US-Militärinterventionen im Ausland – Renaissance der Powell-Doktrin? Alexander Wolf 1. Einleitung Dieser Beitrag befasst sich mit der Fragestellung, wann und wie militärische Interventionen unter Präsident Obama zu erwarten sind. Anhand einer Darstellung der doktrinären Grundlagen amerikanischer Interventionspolitik der „Zwischenkriegsjahre“ (1990-2001)1 und der Amtszeit George W. Bushs (2001-2008), wird gezeigt werden, dass der „Smart Power”-Ansatz der Regierung Obama vielmehr Kontinuität verspricht als radikalen Wandel. Trotz einer liberal humanitären und somit prinzipiell interventionsfreundlichen Grundausrichtung wird Washington nur aufgrund vitaler amerikanischer Interessen und angesichts unmittelbar bevorstehender sicherheitspolitischer Bedrohungen den – notfalls auch unilateralen und präemptiven – Einsatz seiner Streitkräfte erwägen. In Verbindung mit dieser interessenbasierten Politik soll eine mögliche Renaissance der sogenannten Powell-Doktrin erörtert werden, welche sich in besonderem Maße als erfolgversprechende „Rahmendoktrin” militärischer Interventionspolitik anbietet. 2. Amerikanische Interventionsdoktrin in den Zwischenkriegsjahren (1990 - 2001) Die Politik der „Zwischenkriegsjahre“, die Zeitspanne zwischen dem Ende des Kalten Krieges und der bipolaren Ordnung der internationalen Politik und den Anschlägen des 11. September 2001 und dem Krieg gegen den Terror, wurde von zwei Präsidentschaften gestaltet, der von George W. Bush sen. (1989-1993) und von Bill Clinton (1993-2001). Beide Präsidenten sahen sich der Aufgabe gegenüber, festzulegen, wann und wozu der Einsatz amerikanischer Streitkräfte im postsowjetischen Zeitalter gerechtfertigt war. Diese Richtungsentscheidung stand dabei im größeren Kontext der Neujustierung der Außenpolitik der „einzig verbliebenen Weltmacht“. In 1 Für eine brillante Darstellung dieses Zeitabschnitts siehe ausführlich: Chollet, Derek/Goldgeier, James: America Between the Wars. From 11/9 to 9/11. The Misunderstood Years Between the Fall of the Berlin Wall and the Start of the War on Terror, New York 2008. 248 Alexander Wolf welche Richtung eine doktrinäre Anpassung zu erfolgen hatte, war vielfach umstritten und hing von den jeweiligen perzeptionsbedingten Erfahrungshintergründen sowie ideologisch-theoretischen Zukunftserwartungen der Beobachter ab.2 Einig war man sich nur, dass mit dem Ende des Ost-WestKonflikts ein handlungsleitendes Paradigma verloren gegangen war.3 2.1 Bush sen. und die Powell-Doktrin Präsident Bush sen., der realpolitisch denkende Staatsmann und Diplomat, betrachtete das Militär zweckrational als ein außenpolitisches Mittel unter mehreren, welches jedoch möglichst sparsam und vernünftig anzuwenden sei: „Using military force makes sense as a policy where the stakes warrant, where and when force can be effective, where no other policies are likely to prove effective, where its application can be limited in scope and time and where the potential benefits justify the potential costs and sacrifice. … But in every case involving the use of force, it will be essential to have a clear and achievable mission, a realistic plan for accomplishing the mission, and criteria no less realistic for withdrawing U.S. forces once the mission is complete. Only if we keep these principles in mind will the potential sacrifice be one that can be explained and justified.”4 Diese vernünftigen, von Bush geforderten Kriterien sind vielleicht am besten in der Powell-Doktrin zusammengefasst. Peter Rudolf hat richtig darauf hingewiesen, dass die Powell-Doktrin nicht als deckungsgleich mit der Weinberger-Doktrin gesehen werden darf.5 Denn während die WeinbergerDoktrin den Schwerpunkt auf die handlungsauslösenden „vitalen Interessen” des Staates legt, geht die Powell-Doktrin bereits von einer interessen2 3 4 5 Die Debatte über die Zukunftserwartungen für das postsowjetische Zeitalter bewegte sich – stark verkürzt – zwischen den Vorstellungen eines „Endes der Geschichte“, siehe Fukuyama, Francis: The End of History?, in: The National Interest Sommer/1989, S.3-18 und einer „Rückkehr in die Zukunft“ machtpolitischen Nationalstaatsdenkens, siehe Mearsheimer, John J.: Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War, in: International Security 1/1990, S.5-56. Vgl. Haass, Richard N.: Paradigm Lost, in: Foreign Affairs 1/1995, S.43-58. Präsident George Bush sen., Remarks at the United States Military Academy in West Point, New York, 5.1.1993, http://bushlibrary.tamu.edu/research/public_papers.php?id=5156&year=1993&month=01, Stand: 17.1.2009. Die Powell-Doktrin weist jedoch eine inhaltliche und konzeptionelle Nähe zu der Weinberger-Doktrin (Caspar Weinberger; Verteidigungsminister unter Ronald Reagan) auf, an deren Ausarbeitung Colin Powell ebenfalls beteiligt war, siehe Rudolf, Peter: Friedenserhaltung und Friedenserzwingung: Militärinterventionen in der Amerikanischen Außenpolitik, in: Weltmacht ohne Gegner. Amerikanische Außenpolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts, hrsg. von Peter Rudolf und Jürgen Wilzewski, Baden-Baden 2000, S.297-334, hier S.301. US-Militärinterventionen im Ausland 249 basierten Interventionsentscheidung aus und formuliert vielmehr einen operationalen Kriterienkatalog für die „richtige” Durchführung einer Militärintervention.6 Das Militär soll demnach einzig dann eingesetzt werden, wenn das nationale Interesse es erfordert (1), die Truppenstärke dem Auftrag entspricht (2), der Auftrag politisch und militärisch klar definiert ist (3), Größe, Zusammensetzung und Disposition der Truppe stetig überprüft werden (4), die amerikanische Bevölkerung und der Kongress das Unternehmen unterstützen (5) und eine klare Exitstrategie besteht (6).7 Die gemäß der Powell-Doktrin zu erfüllenden operationalen Kriterien sollten eine Hürde für den allzu leichtfertigen Einsatz des Militärs in schlecht durchdachten Szenarien darstellen und ein „mission creep”, also eine ungewollte Konflikteskalation verhindern helfen.8 Als Paradebeispiel einer militärischen Intervention gemäß Powell-Doktrin gilt allgemein die im Auftrag der Vereinten Nationen und von den USA geführte Operation Desert Storm zur Befreiung Kuweits im Jahr 1991.9 6 7 8 9 Zur Frage nach einem Kriterienkatalog für Militärinterventionen siehe auch: Meier-Walser, Reinhard C.: Wann soll der Westen in Krisen intervenieren? Globale Einsätze als mehrdimensionale Projekte, in: Neue Zürcher Zeitung, 20.11.2007. Vgl. Powell, Colin L.: U.S. Forces: Challenges Ahead, in: Foreign Affairs 5/19921993, S.32-45. Der klassische und für Colin Powell prägende Fall einer politisch unerwünschten Konfliktausweitung war der amerikanische Vietnamkrieg (1965-1972). Zu Mission Creep und der Problematik schneller Exit-Strategien siehe Record, Jeffrey: Exit Strategy Delusions, in: Parameter US Army War College Quarterly 4/2001-2002, S.21-27. Siehe Powell: U.S. Forces: Challenges Ahead; auch Rudolf: Friedenserhaltung und Friedenserzwingung, S.302. Gegen die herrschende Meinung kann auch die von Powell mitgeplante Operation Restore Hope (November 1993-März 1993) in Somalia als Beispiel gesehen werden, denn sie war in Zeit, Umfang und Zielsetzung gemäß der Maßgaben der Powell-Doktrin ausgestaltet. Das vorausgesetzte nationale Interesse war die aufgrund vieler Einzelfaktoren getroffene Entscheidung Präsident Bushs, in Somalia anstatt in Bosnien zu intervenieren. Die Gründe für das Nichteingreifen in Bosnien waren neben der von Powell befürchteten Eskalationsgefahr die Stabilisierung der fragilen demokratischen Regierung des russischen Präsidenten Jelzin, welche durch ein amerikanisches Eingreifen in das von Moskau weiterhin (zumindest theoretisch) beanspruchte Einflussgebiet geschwächt worden wäre. Da der gewählte Präsident Clinton und die Medien vehement ein Eingreifen in Bosnien forderten, sah es Bush somit als vitales Interesse an, diese Intervention zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern. „Unable to control the spin on each crisis and in response to the election of Bill Clinton, Bush and Powell concluded that if the United States was going to intervene in response to a humanitarian crisis, it would be in Somalia and not Bosnia.“; siehe hierzu Western, John: „Sources of Humanitarian Intervention. Beliefs, Information and Advocacy in the U.S. Decisions on Somalia and Bosnia“, in: International Security 4/2002, S.112-142, hier S.118. 250 Alexander Wolf 2.2 Clinton und die schwierige Neuorientierung Während in der Operation Desert Storm amerikanische Streitkräfte noch in einem klassischen zwischenstaatlichen Konflikt eingesetzt waren, der einen nationalstaatlichen Akteur abschrecken bzw. in diesem Fall bestrafen sollte, änderten sich Zielsetzung und Grundmuster amerikanischer Militärinterventionen unter Präsident Clinton deutlich. Interventionen waren nicht mehr ein realpolitisches Instrument zur Abschreckung eines hochgerüsteten Feindes, sondern wurden vielmehr als ein Mittel zur Durchsetzung politisch-ideologischer Zielsetzungen gesehen.10 Dieser Wandel wurde im zu Beginn der ersten Amtszeit Clintons formulierten Konzept des „assertive multilateralism” deutlich, dessen Zielsetzung die Verbreitung der Demokratie und Freiheit war, ein pragmatischer „Neo-Wilsonianismus”11. Dazu sollten die USA sich verstärkt des Mittels multilateraler UN-Friedensmissionen bedienen, um nicht alleinverantwortlich vorgehen zu müssen. Diese relative Orientierung am System kollektiver Sicherheit „war der Versuch, die interventionistische Orientierung eines liberalen Internationalismus in Einklang zu bringen mit der politischen Realität begrenzter Ressourcen und innenpolitischer Restriktionen.”12 Der verstärkte Einsatz amerikanischen Militärs zum allgemeinen Wohle der Menschheit und nicht aus vitalen nationalstaatlichen Interessen war jedoch nicht mehr vereinbar mit der Powell-Doktrin, welche für die liberale Regierung Clinton eine außenpolitische „Zwangsjacke” darzustellen schien. Doch Hans Morgenthau sollte Recht behalten – Interventionen „... must be deduced not from abstract principles which are incapable of controlling the actions of governments, but from the interests of the nations concerned and from their practice of foreign policy reflecting those interests”13. Angesichts der ausgebliebenen „Friedensdividende”, der Rezession und des Haushaltsdefizits zu Beginn der 1990er-Jahre schien das Interesse des republikanisch dominierten Kongress und der amerikanischen Bevölkerung mehrheitlich „a new nationalism, a new patriotism, a new foreign policy that puts America first and, not only first, but second and third as well”14 zu sein. Nach dem „Debakel von Mogadischu” im Oktober 1993, dem Tod und der teilweisen Schändung 18 amerikanischer Soldaten in der misslungenen 10 11 12 13 14 Siehe Rudolf: Friedenserhaltung und Friedenserzwingung, S.298. Siehe DeParle: The Man Inside Bill Clinton‘s Foreign Policy, in: The New York Times Magazine, 20.8.1995, S.32-39, S.46, S.55-57, hier S.35. Rudolf: Friedenserhaltung und Friedenserzwingung, S.303. Morgenthau, Hans J.: To Intervene or Not to Intervene, in: Foreign Affairs 3/1967, S.425-436, hier S.429. Buchanan, Patrick: America First – and Second, and Third, in: National Interest, Frühjahr 1990, S.79-82. US-Militärinterventionen im Ausland 251 Aktion, den Kriegsfürsten Aidid gefangen zu nehmen, um den Wiederaufbauprozess Somalias voranzutreiben, geriet das Konzept des „assertive multilateralism” in derartige Kritik von Öffentlichkeit und Kongress, dass die Clinton Administration von diesem relativ schnell abließ und sich mit der Strategy of Engagement and Enlargement eine neue außenpolitische Doktrin gab.15 Deren Kernpunkte zielten auf die Verbreitung demokratischer und marktwirtschaftlicher Systeme bei einer tendenziellen Abkehr vom Multilateralismus, eine neue Selektivität hinsichtlich des außenpolitischen Krisenmanagements und die effektive Nutzung positiver Globalisierungserscheinungen zur Wiederherstellung amerikanischer Wirtschaftskraft.16 Zusätzlich wurden mit der Presidential Decision Directive 25 (PDD 25) von Mai 1995 die Kriterien für eine amerikanische Beteiligung an multilateralen Friedensoperationen (friedensschaffende und friedensbewahrende) derart streng gesetzt, dass – wie Rudolf und Daalder richtig erkennen – in ihr unverkennbar die Weinberger-Powell-Doktrin wieder zum Ausdruck kommt.17 2.3 Außen- und innenpolitische Determinanten der Zwischenkriegsjahre Die amerikanischen Präsidenten der Zwischenkriegszeit vermochten es nicht, an das Beispiel der Operation Desert Storm anzuknüpfen. Aufgrund der fundamentalen sicherheitspolitischen Veränderungen, die mit dem Ende des Ost-West-Konflikts einhergingen, der informationstechnologischen Revolution, die eine an Einfluss gewinnende Zivilgesellschaft zunehmend politisieren konnte und einer fortschreitenden Fragmentierung traditioneller internationaler Machtstrukturen, waren sowohl George Bush sen. als auch Bill Clinton in der Durchsetzung ihrer präsidentiellen Prärogative in der Außenpolitik vielfach gehindert. Durch diese postsowjetische Diversität verschoben sich auch die ideologischen Grenzen der amerikanischen Innenpolitik und veränderte sich der politische Diskurs über amerikanische Interventionspolitik.18 „A generation was coming of age in the Congress who cared less about foreign affairs, elected by a generation of voters who cared less, and reported on by a media that paid less attention.”19 15 16 17 18 19 Siehe Delaney, Douglas E.: Cutting, Running, or Otherwise? The US Decision to withdraw from Somalia, in: Small Wars and Insurgencies 3/2004, S.28-46. Siehe Keller, Patrick: Von der Eindämmung zur Erweiterung: Bill Clinton und die Neuorientierung amerikanischer Außenpolitik, Bonn 2008, S.92-95. Siehe Rudolf: Friedenserhaltung und Friedenserzwingung, S.305-306 sowie ebd., Fn.29. Siehe Rosati, Jerel/Twing, Stephen: The Presidency and U.S. Foreign Policy after the Cold War, in: After the End. Making U.S. Foreign Policy in the PostCold War World, hrsg. von James M. Scott, Durham u.a. 1998, S.29-56. Halberstam, David: War in A Time of Peace. Bush, Clinton, and the Generals, New York u.a. 2001, S.75. 252 Alexander Wolf Militärische Interventionen waren zwischen der Beendigung des „idealistischen Experiments” in Somalia im Mai 1994 und den Terroranschlägen des 11. September 2001 regelmäßig Gegenstand innenpolitischer, überwiegend parteipolitisch aber auch institutionell motivierter Debatten zwischen dem Präsidenten und dem U.S. Kongress. Während die öffentliche Meinung und der U.S. Kongress (meist das Repräsentantenhaus) der überwiegenden Mehrzahl an Interventionen ablehnend gegenüberstand, muss jedoch auch konstatiert werden, dass der Kongress sich vielfach aus innenpolitischem und wahltaktischem Kalkül erst nach Interventionsentscheidungen öffentlich gegen diese stellte.20 Die Interventionsentscheidungen der Jahre 1994 bis 2001 müssen daher im Lichte der Strategy of Engagement and Enlargement und der PDD 25 gesehen werden, die eine strikte Interessenabgrenzung hinsichtlich der Interventionsziele vornahmen und den Kampfeinsatz amerikanischer Bodentruppen prinzipiell fast unmöglich machten. Diese Clinton-Doktrin „read more like a statement of when and why the United States would not intervene militarily than a delineation of when and why it would.”21 Die Folge war, dass Washington selbst in Fällen wie dem Genozid in Ruanda ein militärisches Engagement kategorisch ablehnte. Diese mangelnde Bereitschaft, amerikanische Bodentruppen in Konflikten einzusetzen, minderte jedoch auch die abschreckende Wirkung militärischer Drohgebärden der USA, wie die Fälle Bosnien 1995 oder Kosovo 1999 belegen. Kritiker haben aufgrund dieser Entwicklung zu Recht das späte Erreichen von Verhandlungslösungen auf Kosten ziviler Kriegs- und Völkermordopfer beklagt und größtenteils mit Luftschlägen durchgeführten Interventionen wie der Operation Allied Force 1999 keinen Präzedenzstatus zugerechnet.22 „The advent of the modern media and … a change in generational attitudes … in a country in which foreign policy hardly mattered”23, beeinflussten die amerikanische Interventionspolitik in den Zwischenkriegsjahren enorm und führten zu einer immer stärkeren Zurückhaltung der USA hinsichtlich des Einsatzes ihres Militärs. Dieses Muster änderte sich mit den Terroranschlägen des 11. September 2001 auf New York und Washington D.C., als die amerikanische Bevölkerung schmerzlich erfuhr, dass „Security is like oxygen: easy to take for granted until you begin to miss it …”24. 20 21 22 23 24 Siehe Rudolf: Friedenserhaltung und Friedenserzwingung, S.325, S.329-330. Jentleson, Bruce W.: American Foreign Policy. The Dynamics of Choice in the 21st Century, New York u.a. 2000, S.298. Siehe Daalder, Ivo M./O’Hanlon, Michael E.: „Unlearning the Lessons of Kosovo“, in: Foreign Policy, Herbst 1999, S.128-140. Halberstam: War in A Time of Peace, S.496. Nye, Joseph: Understanding International Conflict. An Introduction to Theory and History, New York u.a., 6.Aufl., 2007, S.205. US-Militärinterventionen im Ausland 253 3. Amerikanische Interventionsdoktrin in der Ära Bush jun. (2001-2008) In den Zwischenkriegsjahren hatte amerikanische Interventionspolitik – wie gezeigt wurde – mehrere Ziele. Das änderte sich mit den Terroranschlägen des 11. September 2001. Dieser „transformatorische Moment„25 hatte immense Auswirkungen auf das kollektive Bewusstsein der amerikanischen Nation. Zuletzt im amerikanischen Bürgerkrieg (1861-1865) wurden so viele U.S. Bürger an einem einzigen Tag getötet und seit dem Krieg von 1812 war die amerikanische Hauptstadt nicht mehr angegriffen worden. Der Angriff auf Pearl Harbor war ein rein militärischer gewesen.26 Die gezielte Tötung von Zivilpersonen erschütterte nicht nur das Gefühl territorialer Sicherheit, sie stellte auch eine Kampfansage an universelle, pluralistisch-demokratische Werte dar.27 Die Ereignisse des 11. September 2001 veränderten die amerikanische Interventionspolitik schlagartig und radikal. Die sogenannte Bush-Doktrin, die maßgeblich die Nationale Sicherheitsstrategie (NSS) der Vereinigten Staaten von 2002 prägte (oder auch verkörperte), setzte sich aus folgenden Elementen zusammen: Erstens stellt die Bekämpfung des internationalen Terrorismus das alles dominierende Ziel amerikanischer Außen- und Interventionspolitik dar. Zweitens ist dies kein kurzfristig zu erreichendes Ziel, sondern eine über Jahre zu sehende Aufgabe.28 Drittens ist es aufgrund der Natur der Bedrohung zwingend notwendig, das vollständige Machtpotenzial der Vereinigten Staaten zu aktivieren, was nur – und dies ist der zentrale Punkt der NSS von 2002 – bei Sicherstellung präemptiver Handlungsfreiheit gewährleistet ist. 29 25 26 27 28 29 Nicht namentlich genannter „senior official„; Zitat nachgewiesen in Rudolf, Peter: Imperiale Illusionen. Amerikanische Außenpolitik unter Präsident George W. Bush, Baden-Baden 2007, S.7. Siehe Jentleson, Bruce W.: American Foreign Policy. The Dynamics of Choice in the 21st Century, New York, 3.Aufl., 2007, S.359f. Siehe ausführlicher Mayer, Tilman: Patriotismus und Nationalbewusstsein in den USA seit dem 11. September, in: Politische Studien 406/2006, S.15-23. Der Krieg gegen den Terrorismus „… will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped and defeated.“; Präsident George Bush in: Address Before a Joint Session of the Congress on the United States Response to the Terrorist Attacks of September 11, 20.9.2001, http://www.presidency. ucsb.edu/ws/index.php?pid=64731&st=&st1=, Stand: 18.2.2009. „For much of the last century, America‘s defense relied on the cold war doctrines of deterrence and containment, in some cases, those strategies still apply, but new threats also require new thinking. Deterrence – the promise of massive retaliation agajust nations – means nothing against shadowy terrorist networks with no nation or citizens to defend. Containment is not possible when unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles or secretly provide them to terrorist allies. We cannot defend America and our friends by hoping for the best.“ Präsident George Bush, Commencement Address at the United States Military Academy in West Point, New York, 1.6.2002, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index. php?pid=62730&st=&st1=, Stand: 18.1.2009. 254 Alexander Wolf 3.1 Präemption und Unilateralismus: Die Prinzipien der Bush-Doktrin Es war die Überzeugung der Bush-Regierung, dass sich die amerikanische Nation nur dann wieder sicher fühlen könne, wenn der globale Terrorismus, aber auch die Gefahr nuklearer Anschläge von „Rogue states“ vollständig beseitigt werde. Präemptive Interventionen wurden dadurch legitimiert, dass „defending against terrorism and other emerging 21st century threats may well require that we take the war to the enemy. … The best, and in some cases the only defense, is a good offense.“30 Und „security will require all Americans … to be ready for preemtive action when necessary to defend our liberty and to defend our lives“31. Präemption, die antizipatorische Selbstverteidigung angesichts einer unmittelbar bevorstehenden bedrohlichen Handlung eines anderen Akteurs, war in Bezug auf terroristische Anschläge auch wenig umstritten. „Law enforcement, covert operations, and intelligence gathering have always sought to preempt terrorist attacks, and such preemptive activities are well-established in international law. … The debate in the United States has always been about whether the U.S. government is doing enough to stop terrorists preemptively, not whether it has to wait for them to attack before acting.”32 In Bezug auf „Rogue States” stellte der Kern der sogenannten „new doctrine called preemtion” aber eine gefährliche und radikale Änderung des außenpolitischen Kurses der Vereinigten Staaten dar.33 Denn die NSS von 2002 fordert einerseits ein präemptives Handlungsrecht für die USA, wenn drei Faktoren zusammenfallen: (1) ein „Rogue State” muss (2) Massenvernichtungswaffen besitzen oder versuchen, in deren Besitz zu gelangen und (3) internationale Terrorgruppierungen beherbergen oder unterstützen. Aufgrund der hegemonialen Stellung der USA im internationalen System erkennt Werner Link in der präemptiven/präventiven Selbstverteidigung zutreffenderweise ein neues ordnungspolitisches Element. „Das Prinzip der souveränen Gleichheit und Nebenordnung der Staaten, das das bisherige Staatensystem seit dem Westfälischen Frieden – trotz aller Relativierung – bestimmt hat und auch der UN-Ordnung ausdrücklich zu30 31 32 33 Verteidigungsminister Donald Rumsfeld: 21st Century Transformation of U.S. Armed Forces, National Defense University, Washington D.C., 31.1.2002, http://www.defenselink.mil/speeches/speech.aspx?speechid=183, Stand: 18.1.2009. Präsident George Bush: Commencement Address at the United States Military Academy in West Point, New York, 1.6.2002. Daalder, Ivo/Lindsay, James M./Steinberg, James B.: The Bush National Security Strategy: An Evaluation, The Brookings Institution, Policy Brief 109/2002, S.6. Siehe Daalder, Ivo/Lindsay, James M.: America Unbound. The Bush Revolution in Foreign Policy, Washington D.C. 2003, S.122. US-Militärinterventionen im Ausland 255 grunde liegt, soll durch ein System der Über- und Unterordnung abgelöst werden, in dem die USA (und sie allein) nach eigenem Ermessen entscheiden, ob Staaten ihre Souveränität verwirkt haben und eine amerikanische Militärintervention zum Regierungssturz und zur besatzungspolitischen Neuordnung statthaft ist.”34 Zwar waren in der Doktrin nur Nordkorea und der Irak namentlich erwähnt, die Kriterien hätten sich aber je Interpretation auf weitere Staaten anwenden lassen. Auch wenn man der Auslegung Daalders, Lindsays und Steinbergs folgt und keine spezifischen Kriterien für präemptive Handlungsfreiheit in der NSS 2002 erkennt35, so wird dennoch ein weiteres Problem deutlich, auf das Henry Kissinger hinwies: „It cannot be in either the American national interest or the world’s interest to develop principles that grant every nation an unfettered right of preemption against its own definition of threats to its security.”36 Bruce Jentleson fügt diesem Kritikpunkt noch die zwei weiteren Punkte hinzu: die Verletzung internationaler Gesetze und Normen sowie eine fragwürdige Effizienz präemptiver Interventionen.37 Ausschlaggebend für die Kritik an dem Prinzip der Präemption ist der Umstand, dass es auf ausführliche und gesicherte Erkenntnisse über den tatsächlichen Bedrohungsstand ankommt. Wird eine präemptive Handlung nicht durch das Vorhandensein einer unmittelbaren Bedrohung ex post legitimiert, so war die Handlung keine Präemption, sondern völkerrechtswidrige Prävention. Präemtion und Unilateralismus wurden jedoch erst mit der amerikanischen Invasion des Irak 2003 zu einem größeren internationalen Problem. Die amerikanische Intervention in Afghanistan 2001 war noch mithilfe einer von ihrer Legitimation überzeugten Koalition aus mehr als 170 Staaten geführt worden.38 Zwar wurde bereits zu diesem Zeitpunkt deutlich, dass die Mission die Koalition bestimme und nicht umgekehrt39, 34 35 36 37 38 39 Link, Werner: Hegemonie und Gleichgewicht der Macht, in: Sicherheit und Frieden zu Beginn des 21. Jahrhunderts, hrsg. von Mir A. Ferdowsi, München, 3. aktualisierte und erweiterte Aufl., 2004, S.43-60, hier S.59. Siehe Daalder/Lindsay/Steinberg: The Bush National Security Strategy, S.6. Kissinger, Henry: Preemption and the End of Westphalia, in: New Perspectives Quarterly 4/2002, http://www.digitalnpq.org/archive/2002_fall/kissinger. html, Stand: 23.2.2009. Internationales Recht wird durch die Missachtung des Art. 51 UN Charta (Selbstverteidigung nur, „if an armed act occurs“) verletzt. Die Effizienz sieht Jentleson deswegen gemindert, da Interventionen einer Unmenge an Informationen bedürfen sowie eine zuverlässige Planung voraussetzen, siehe Jentleson: American Foreign Policy, S.371. Siehe Ebd., S.365. Verteidigungsminister Donald Rumsfeld in Annual Report to the President and the Congress, 15.8.2002: „… wars are best fought by coalitions of the willing – but they should not be fought by committee. The mission must determine the coalition. The coalition must not determine the mission.“, S.30. 256 Alexander Wolf die Aussage Präsident Bushs, „Either you are with us, or you are with the terrorists”40, entwickelte aber erst während der konstruierten Rechtfertigung des Irakkriegs 2002/03 ihre volle Wirkungskraft und spaltete die transatlantische Gemeinschaft und ihre Institutionen in Befürworter und Gegner eines Regimesturzes. 3.2 „Mission accomplished: Unlearning the lessons of Mogadishu“ Der Krieg gegen den Terror war nicht alleine aufgrund des amerikanischen Sicherheitsbedürfnisses geführt worden, sondern ebenso aufgrund des Anspruchs, der Freiheit zu seinem Recht zu verhelfen.41 Denn ganz wie ihre ideologische Verwandtschaft der liberalen Humanitaristen ging es den neokonservativen Kreisen der Bush-Regierung um die Durchsetzung einer normativ höherwertigen Weltordnung, in der die USA ihrem Exeptionalismus entsprechen müssen.42 Nachdem die Taliban-Regierung und deren al-Qaida-Kämpfer mithilfe afghanischer Warlords vertrieben waren, spätestens als Präsident Bush auf der USS Abraham Lincoln landete und die Kampfhandlungen im Irak für abgeschlossen erklärte, offenbarte sich das Problem, dass scheinbar keine oder nur unzureichende Planungen für eine Besatzungszeit angestellt worden waren.43 Warnungen, wie die des Heereschefs General Eric Shinseki, dass mehrere hunderttausend Soldaten zur Stabilisierung und Sicherung 40 41 42 43 Präsident George Bush: Address Before a Joint Session of the Congress on the United States Response to the Terrorist Attacks of September 11, 20.9.2001. Stellvertretender Verteidigungsminister Paul Wolfowitz, Interview on NBC Meet the Press, 27.6.2003: „… the battle to secure the peace in Iraq is now the central battle in the global war on terror, and those sacrifices are going to make not just the Middle East more stable, but our country safer … We‘re pursuing and finding leaders of the old regime who will be held to account for their crimes. The transition from dictatorship to democracy will take time, but it is worth every effort. Our coalition will stay until our work is done. And then we will leave, and we will leave behind a free Iraq.“, http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=2909, Stand: 18.1.2009. Siehe Smith, Tony: Wilsonianism after Iraq, in: The Crisis of American Foreign Policy, hrsg. von G. John Ikenberry, Thomas J. Knock, Anne-Marie Slaughter u.a., Princeton 2008, S.53-88. Zu neokonservativer Politik siehe umfassend Keller, Patrick: Neokonservatismus und amerikanische Außenpolitik. Ideen, Krieg und Strategie von Ronald Reagan bis George W. Bush, Paderborn 2008. Vizepräsident Dick Cheney, Interview on NBC Meet the Press 14.9.2003: „My belief is we will, in fact, be greeted as liberators.“, http://www.msnbc.msn. com/id/3080244/, Stand: 18.1.2009; Stellvertretender Verteidigungsminister Paul Wolfowitz, Interview on NBC Meet the Press, 27.6.2003: „There‘s a basic point to make about planning that people need to understand. You can‘t write a plan for a military situation, and this is basically a military situation. That is like a railroad time table. There are too many things that you learn as you go.“ US-Militärinterventionen im Ausland 257 des besetzten Irak notwendig seien, wurden von Regierungsmitgliedern als Fehleinschätzungen öffentlich verworfen.44 Hier zeigte sich, dass die „Bush-Doktrin” Interventionen zwar aufgrund (neokonservativ ausgelegter) vitaler Interessen durchführte, im Gegensatz zur Powell-Doktrin aber keinerlei Exit-Strategie beinhaltete. Als sich an den Interventionsorten gewaltsame Aufstände gegen die amerikanischen Besatzungstruppen entwickelten und ein effektiver Wiederaufbauprozess damit verhindert war, wurde deutlich, dass die „Shock and Awe”-Taktik des amerikanischen Militärs zwar geeignet ist, einen militärischen Gegner durch schnelle und harte Luftschläge gleich zu Beginn der Kampfhandlungen zu lähmen und seiner Moral zu berauben, ein Management des besetzten Gebietes mit dieser Fähigkeit jedoch keinesfalls zu bewerkstelligen war. Denn für einen extern herbeigeführten Staatsaufbau ist laut Carlo Masala die Akzeptanz der Besatzungstruppen durch die Zivilbevölkerung, ein Umfeld „wohlgesonnener” Nachbarstaaten sowie ein nur temporärer Besatzungszustand und Souveränitätsverlust entscheidend.45 Solchen Punkten hatte die Bush-Regierung vor den Interventionen wenig Gewicht beigemessen, weswegen die unilateral-präemptive NSS von 2003 keinen Weg aus diesem Dilemma aufzeigte. Folglich musste die Bush-Regierung politische und operationale Antworten auf die prekären Sicherheitslagen in Afghanistan und im Irak finden. Mit der NSS von 2006 wurde der unilaterale, präemptive Charakter der amerikanischen Außenpolitik revidiert und verstärkt auf diplomatische und multilaterale Initiativen gesetzt, auch um die notwendige Unterstützung verbündeter Nationen zu erhalten. Das neokonservative Sendungsbewusstsein und die Ziele der Verbreitung von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten blieben jedoch weiterhin gültig. Ivo Daalder ist zuzustimmen, wenn er bemerkt, dass die NSS von 2006 sich demnach nicht mehr viel von der Strategy of Engagement and Enlargement der Clinton Regierung unterscheidet.46 Auf operationaler Ebene wurde 2007 unter der Federführung des heutigen Kommandeurs des Central Command General David Petraeus das erste 44 45 46 Stellvertretender Verteidigungsminister Paul Wolfowitz: „the notion that it will take several hundred thousand U.S. troops to provide stability in postSaddam Iraq, [is] wildly off the mark.“, Department of Defense Budget Priorities for Fiscal Year 2004, Hearing before the House Committee on the Budget, S.8, http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_house_ hearings&docid=f:85421.pdf, Stand: 23.2.2009. Siehe Masala, Carlo: Managing Protektorate: Die vergessene Dimension, in: Politische Studien 411/2007, S.49-55. Siehe Daalder, Ivo: Statement on the 2006 National Security Strategy, http:// www.brookings.edu/opinions/2006/0316diplomacy_daalder.aspx, Stand: 18.1.2009. 258 Alexander Wolf „counterinsurgency field manual„ seit dem Vietnamkrieg ausgearbeitet. Fick und Nagl fassen die Hauptaussagen folgend zusammen: „Focus on protecting civilians over killing the enemy. Assume greater risk. Use minimum, not maximum force.“47 Dass diese neuen Maßgaben, als eine fast totale und weiterhin umstrittene Neuformulierung amerikanischer Militärdoktrin, im Rahmen des „Surge”, der massiven Truppenverstärkung für die Stabilisierung der Sicherheitslage im Irak verantwortlich waren, ist ebenso zutreffend wie die Tatsache, dass die gleiche Taktik nicht unbedingt in Afghanistan zum Erfolg führen wird.48 4. „Smart-Power“: Inhaltliche Kontinuität bei Wandel des Stils? Im Wahlkampf vermittelte sich Beobachtern der Eindruck, dass Barack Obama „den Einsatz militärischer Macht … nicht auf den Schutz der amerikanischen Bevölkerung und vitaler Interessen in Fällen eines tatsächlichen oder unmittelbar bevorstehenden Angriffs beschränken [will]; über die Selbstverteidigung hinaus sollte der Einsatz militärischer Gewalt auch im Dienste ‚gemeinsamer Sicherheit‘ erwogen werden, die der globalen Stabilität zugrunde liege. Als Maxime für den Einsatz der Streitkräfte jenseits der Selbstverteidigung fordert er, dass in diesen Fällen alle Anstrengungen unternommen werden sollten, die Unterstützung und Teilnahme anderer Staaten zu gewinnen.“49 Washington hat mit den Interventionsfolgen in Afghanistan und dem Irak die Grenzen ihrer vormals grenzenlos scheinenden Macht erfahren und ist sich mittlerweile bewusst, dass „America cannot meet the threats of this century alone, but the world cannot meet them without America.”50 Das bedeutet jedoch keinesfalls, dass die USA ihre grundlegenden außenpolitischen Ziele verändern werden: Die Förderung von Sicherheit, Freiheit und Wohlstand für das amerikanische Volk als Selbstzweck sowie als 47 48 49 50 Fick, Nathanial C./Nagl, John A.: Counterinsurgency Field Manual. Afghanistan Edition, in: Foreign Policy Jan.-Feb./2009, S.42-47, hier S.43. Ebd., S.43-44. Rudolf, Peter: US-Außenpolitik und transatlantische Sicherheitsbeziehungen nach den Wahlen, SWP-Aktuell Juni/2008, S.2. Präsident Barack Obama Address to Joint Session of Congress, 24.2.2009, http:// www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-of-President-Barack-ObamaAddress-to-Joint-Session-of-Congress/, Stand: 25.2.2009; Auch Vizepräsident Joseph R. Biden in seiner Rede auf der 45. Münchner Sicherheitskonferenz, 7.2.2009: „America needs the world just as the world needs America.“, http:// www.securityconference.de/konferenzen/rede.php?menu_2009=&menu_kon ferenzen=&sprache=en&id=238&, Stand: 19.2.2009. US-Militärinterventionen im Ausland 259 Grundlage für eine gerechte und stabile internationale Ordnung51 werden auch in Zukunft die außenpolitische Agenda der Vereinigten Staaten bestimmen. Zur Durchsetzung dieser Ziele wird die Obama-Regierung verstärkt auf „Smart Power”, eine Mischung aus militärischer „Hard Power” und diplomatischer „Soft Power” setzen. Dieser Ansatz könnte sich zur Grundlage einer neuen Doktrin entwickeln und basiert auf den folgenden drei Prinzipien:52 − Erstens, bedingt Amerikas Ansehen in der Welt die Sicherheit und das Wohlergehen der USA, − zweitens, kann gegenwärtigen Herausforderungen nur mit fähigen und willigen Partnern begegnet werden und − drittens, können zivile Instrumente die Legitimität, Effektivität und Nachhaltigkeit amerikanischen Handelns steigern. Barack Obama steht vor unglaublichen innen- und außenpolitischen Herausforderungen. Dass er bezüglich militärischer Interventionen weiterhin auf einen konstanten „rally-round-the-flag” Effekt in der amerikanischen Öffentlichkeit hoffen kann, scheint äußerst unwahrscheinlich. Denn obwohl weiterhin ein relativ großes Interesse der Bevölkerung für außenpolitische Angelegenheiten, insbesondere für die Terrorismusbekämpfung besteht, sagen 71 Prozent aller Amerikaner, dass Präsident Obama sich auf innenpolitische Belange konzentrieren solle, im Gegensatz zu nur elf Prozent, die eine außenpolitische Orientierung befürworten.53 Will der Präsident nicht schon zu Beginn seiner Amtszeit seine innenpolitischen Ziele gefährden, so benötigt er weiterhin die Unterstützung der öffentlichen Meinung, vor allem aber ist er auf konstruktive Beziehungen zur demokratischen Kongressmehrheit angewiesen, die überwiegend eine Ausweitung diplomatischen Vorgehens anstatt militärischer Interventio51 52 53 Diese Ziele formuliert das als „Blaupause„ für die NSS der Regierung Obama geltende Papier „Strategic Leadership„: „Our core goals today are the same ones envisaged by our founding fathers: the resolute pursuit of security, liberty, and prosperity both for our own people and as the basis for a just and stable international order„, siehe Slaughter, Anne-Marie/Jentleson, Bruce W./ Daalder, Ivo H. u.a.: Strategic Leadership. Framework for a 21st Century National Security Strategy, Washington D.C. 2008. Siehe Armitage, Richard L./Nye, Joseph S.: Implementing Smart Power: Setting An Agenda for National Security Reform, http://foreign.senate.gov/testimony/2008/NyeTestimony080424a.pdf, S.3, Stand: 1.4.2009. Umfrage des Pew Research Center: On Obama‘s Desk: Economy, Jobs Trump All Other Policy Priorities, 22.1.2009, http://pewresearch.org/pubs/1087/economy-jobs-top-public-priorities-2009, Stand: 19.2.2009. 260 Alexander Wolf nen im Kampf gegen den Terror befürwortet.54 Für den Fall jedoch, dass Washington beispielsweise einen nuklear bewaffneten Iran oder eine weitere Destabilisierung und fundamentalislamische Radikalisierung des Nuklearwaffenstaates Pakistan nicht akzeptieren kann, können militärische Interventionen prinzipiell nicht ausgeschlossen werden. Ivo Daalder hat Recht, wenn er anmerkt, „some situations will require the threat or use of military force – and when they do, the use of force early is likely to be more effective and less costly than waiting until it is a last resort. Preemption, in other words, is here to stay.”55 In der Interventionspolitik Präsident Obamas wird eine Kontinuität sowohl zum liberalen Internationalismus der Clinton-Jahre als auch zur NSS von 2006 zu erwarten sein. Dies mag möglicherweise allzu idealistische Erwartungen vieler Unterstützer Barack Obamas diesseits und jenseits des Atlantiks enttäuschen.56 Diese militärische Zurückhaltung der USA muss, um gegenüber der Vielzahl an sicherheitspolitischen Herausforderungen Wirksamkeit entwickeln zu können, zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens muss das „Smart Power”-Konzept mit den Maßgaben der PowellDoktrin korreliert werden, um somit über die Interessenbindung und die Exitstrategie die Unterstützung der amerikanischen Öffentlichkeit und des Kongresses sicherzustellen sowie über die entsprechende materielle und operationale Ausgestaltung gleichzeitig die Erfolgschancen potenziell notwendiger Interventionen zu steigern. Und zweitens – dieser Punkt sollte mittlerweile selbstverständlich sein – müssen die Verbündeten der USA, insbesondere die im Afghanistaneinsatz beteiligten Staaten, ihre eigenen Anstrengungen vor allem im zivilen Bereich ausweiten, um durch ein gerechtes „burden sharing” Washington zu unterstützen. Das ist kein Gebot des Anstands und auch keine Steigerung des Multilateralismus zu einem „Zweck an sich”. Dieser Zwang zur Kooperation ist einzig der Tatsache geschuldet, dass es im 21. Jahrhundert keine nationalstaatliche, sondern nur noch eine gemeinsame, vernetzte Sicherheit aller Staaten geben kann. Der potenziell fatale Charakter mancher Sicherheitsrisiken des globalisierten Nuklearzeitalters erfordert jedoch auch eine Akzeptanz und rechtliche Verregelung des weiterhin umstrittenen Prinzips der Präemption. 54 55 56 In einer Umfrage des Pew Research Center von Februar 2009, ob eher militärische Operationen oder diplomatisches Vorgehen geeignet seien, terroristischen Gefahren vorzubeugen, sprachen sich 57 % der Demokraten für diplomatisches Vorgehen, 28 % für militärisches Vorgehen, 15 % für beide/keines aus; „Democrats favor increased diplomatic efforts over expanded military operations.“, siehe: Obama Faces Familiar Divisions Over Anti-Terror Policies, 18.2.2009, http://pewresearch.org/pubs/1125/terrorism-guantanamo-torturepolling, Stand: 19.2.2009. Daalder, Ivo (Hrsg.): Beyond Preemtion. Force and Legitimacy in a Changing World, Washington 2007, S.16. Siehe Brose, Christian: The Making of George W. Obama,in: Foreign Policy Jan.-Feb./2009, S.53-55. US-Militärinterventionen im Ausland 261 Richard Haass ist zuzustimmen, wenn er schreibt, dass die Fragen, „wann”, „wo” und „wie” militärisch zu intervenieren sei, immer auch zwangsläufig die Frage nach den amerikanischen Interessen weltweit berührt sei und somit auch die Frage, was die USA bereit sind, für deren Wahrung zu tun.57 Auf die Fragen, „wann”, „wo” und „wie” zu intervenieren sei, kann die Powell-Doktrin überzeugende Antworten bieten. Die Frage nach den handlungsauslösenden Interessen ist aber eine politische Frage, über die sich die jeweils betroffene Gesellschaft verständigen muss. Angesichts globaler sicherheitspolitischer Herausforderungen müssen jedoch globale Lösungen gefunden werden. 57 Siehe Haass, Richard N.: Intervention. The Use of American Military in the Post-Cold War World, Washington D.C., überarbeitete Aufl., 1999, S.2. Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems Jens van Scherpenberg „… some extraordinary reversals have happened. Washington is lecturing the world on the dangers of fiscal prudence. The IMF is begging Asia for money. And Mr Brown is prioritising European unity. These are strange times indeed.“ Alan Beattie, Financial Times1 1. Erschütterung alter Gewissheiten Was als Subprime-Krise in den USA begann und sich über eine Krise des globalen Finanzsystems zu einer Weltwirtschaftskrise fortentwickelte, die wenn nicht in ihrer Tiefe, so doch in ihrer globalen Reichweite die Krise von 1930 übertrifft, das entwickelt sich im Jahr 2009, dem dritten Krisenjahr, nicht nur zu einer Kredit- und Währungskrise ganzer Staaten fort. Die Krise wird auch die monetären Kräfteverhältnisse zwischen den großen Weltwirtschaftsmächten verändern. Letztlich ist zu fragen, ob die Stellung des US-Dollar als Welt-, Leit- und Reservewährung und damit als das neben der US-Militärmacht wichtigste hegemoniale Instrument einer von den USA geführten Weltordnung die gegenwärtige Krise überstehen wird. Noch 2007 schien es kaum vorstellbar, dass der Euro – trotz seiner Wechselkursstärke gegenüber dem Dollar – dessen Stellung als Weltreservewährung ernsthaft in Frage stellen könnte. Und auch 2009 scheint wenig für einen solchen Rollenwechsel zu sprechen. Das liegt allerdings weniger an der Unerschütterlichkeit des Vertrauens in den US-Dollar als an der Universalität der Krise und der hohen Dynamik ihrer Entfaltung, die es bislang nicht erlauben, klare Gewinner und Verlierer unter den großen Wirtschafts- und Währungsmächten auszumachen. Zwei Aspekte sind allerdings evident. Erstens lässt die Krise die Stärken wie Schwächen der einzelnen großen Währungen, namentlich des USDollar und des Euro, aber auch des britischen Pfund, des japanischen Yen und des chinesischen Renminbi besonders deutlich zutage treten. Und zweitens scheinen die politischen Führer der großen Wirtschaftsmächte 1 Beattie, Alan: The gap of twenty, in: Financial Times, 13.3.2009, www.FT.com, Stand: 17.3.2009. Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 263 sich der Risiken wie der Chancen einer tiefgreifenden Veränderung der internationalen wirtschaftlichen Kräfteverhältnisse bewusst zu sein: Sie setzen in ihren Konjunkturanreiz- und Subventionsprogrammen zunehmend auf Maßnahmen, die darauf berechnet sind, den eigenen Wirtschaftsstandort zu Lasten anderer gestärkt aus der Krise hervorgehen zu lassen. Der Wirtschaftsnationalismus im Sinne Gilpins,2 das Setzen auf den relativen Vorteil gegenüber den anderen, scheint in der Krise gegenüber dem Wirtschaftsliberalismus, der Kooperation zur allseitigen Schadensminimierung, die Oberhand zu gewinnen. Zwar wird von vielen Politikern eine verstärkte internationale Kooperation nicht nur bei der (Re-)Regulierung der Finanzmärkte, sondern auch in der Währungspolitik gefordert. Doch muss angesichts des in der Krise manifest werdenden Endes der hegemonialen institutionellen Ordnung erst eine neue Basis für internationale Kooperation gefunden werden. Ob dies in den Konferenzen auf IWF-Ebene und im Rahmen der G20 (die immer mehr den Platz der G7 als Verhandlungsort für globale Steuerungsversuche einnimmt) gelingt, muss sich zeigen. Sicher scheint allerdings jetzt schon zu sein, dass die bisherige Dollar-dominierte Weltwährungsordnung und der Internationale Währungsfonds als von den USA dank Sperrminorität von 17% und von den EU-Staaten dank ihrer üppigen Stimmenquote von 32% kontrollierte globale Leitinstitution der internationalen Finanzordnung kaum unversehrt aus der Krise hervorgehen werden. Als Grundlage aller Überlegungen dazu, wie die beiden führenden Weltwährungen Dollar und Euro aus der Krise herauskommen werden, sind zunächst die sehr unterschiedlichen Positionen darzustellen, von denen aus sie in die Krise eingetreten sind. Und angesichts der säkularen Bedeutung der gegenwärtigen Krise ist es angebracht, dabei etwas weiter auszuholen zu den großen währungspolitischen Brüchen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der darauffolgende Abschnitt beleuchtet die Situation von Dollar und Euro in der Krise, der abschließende Abschnitt gilt den Interessenlagen und daraus abzuleitenden Perspektiven für die transatlantische und internationale wirtschafts- und währungspolitische Koordination bei der Krisenbewältigung. 2. Die Ära der Dollardominanz Für die USA war die Stellung des Dollar als der dominanten Weltwährung seit der Errichtung des Währungsregimes von Bretton Woods im Jahr 1944, mit der die in der Weltwirtschaftskrise faktisch verloren gegangene Leitwährungsposition des Britischen Pfund auch formell auf den Dollar 2 Gilpin, Robert: The Political Economy of International Relations, Princeton 1987, S.31ff. 264 Jens van Scherpenberg überging, das wirtschaftliche Kernelement ihrer Hegemonie. Am 15. August 1971 jedoch kündigte die Regierung Nixon angesichts des zunehmenden Drucks im Ausland umlaufender Dollarforderungen die garantierte Goldparität von 35 Dollar, die Einlösungsgarantie des Dollar gegen Gold, und damit das Kernstück des Bretton Woods Regimes fester Wechselkurse auf. Die Welt-Leitwährung – und mit ihr alle anderen bislang an sie gebundenen Währungen – wurde zu einer „fiat currency“, einer Währung, deren Wert und damit Tauglichkeit als Wertaufbewahrungsmittel allein in der Kreditwürdigkeit des sie emittierenden Staates begründet liegt. Das Bretton Woods System fester Wechselkurse wurde im Februar 1973 durch ein Regime flexibler Wechselkurse abgelöst. Damit allerdings ging bekanntlich die Rolle des US-Dollar als dominanter internationaler Leit- und Reservewährung keineswegs zu Ende, im Gegenteil! Es ist einer der faszinierendsten Aspekte der Währungsgeschichte der letzten 50 Jahre, mit welcher Leichtigkeit der US-Dollar seine Dominanz auch über das Ende des Bretton Woods Regimes hinaus fortsetzen, ja von den Beschränkungen dieses Regimes befreit sogar ausbauen konnte. Sei es durch politische Koinzidenz oder als Ergebnis weitsichtiger politischer Planung:3 Die Vervierfachung des Ölpreises während der ersten Ölkrise vom Herbst 1973 bewirkte eine enorme Zunahme der internationalen Nachfrage nach Dollar als der Währung, in der Öl gehandelt wurde. Diese Nachfrage wurde vor allem durch die großen US-Banken als Kreditgeber befriedigt, die sich zu den führenden Finanzinstitutionen für das „Petrodollarrecycling“, die Rückführung der drastisch gestiegenen Dollarerlöse der Öl exportierenden Länder in die internationalen Kapitalmärkte, entwickelten. Der hohen, in wachsendem Maße über Dollarkredite befriedigten internationalen Nachfrage nach Dollar als Transaktions- wie als Anlagewährung kam nun entgegen, dass die US-Handelsbilanz 1971 und die gesamte Leistungsbilanz erstmals einen negativen Saldo aufwiesen, der für die Handelsbilanz seit 1976, für die Leistungsbilanz seit 1982 permanent geworden ist, mit stark zunehmender Tendenz.4 3 4 Die Ereignisse des Schlüsseljahres 1973 sind Gegenstand mannigfacher Publikationen von wissenschaftlichen Analysen bis hin zu Verschwörungstheorien, die sich vor allem um das informelle Zusammentreffen namhafter Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft der westlichen Industriestaaten in Saltsjöbaden in Schweden im Mai 1973 drehen. Vgl. dazu u.a. Engdahl, William: A Century of War. Anglo-American Oil Politics and the New World Order, revised edition, London 2004. Engdahl ist ein gutes Beispiel dafür, wie aufbauend auf einer großenteils soliden und instruktiven Faktenbasis durch Hinzufügen einiger unbewiesener Behauptungen und Andeutungen dem Lauf der Geschichte ein verschwörungstheoretischer Hintersinn angedichtet wird. Der Saldo der US-Leistungsbilanz erreichte nur 1991 noch einmal einen knapp positiven Wert, dank der Tributzahlungen Japans, Deutschlands, Kuwaits und anderer Golfstaaten im Zusammenhang mit dem Golfkrieg von 1991. Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 265 Die zweite Ölkrise von 1979/80 und die von dem 1979 ins Amt berufenen neuen Fed-Chef Paul Volcker5 implementierte Hochzinspolitik zur Inflationsbekämpfung gaben der internationalen Nachfrage nach Dollar zusätzlichen Auftrieb. Vor allem der Zufluss an privaten Direkt- und Portfolioinvestitionen in die USA stieg stark an. Die geld- und währungspolitische Koordination im Rahmen der G7, vor allem im Plaza-Abkommen von 1985 zur Absenkung des Dollarkurses und dem Louvre-Abkommen von 1987 zu dessen Stabilisierung, tat ein Übriges, die Kapitalzuflüsse in die USA zu sichern. In diesen beiden Abkommen konnten die USA noch einmal erfolgreich erheblichen Koordinationsdruck auf ihre wichtigsten Alliierten, die europäischen G7-Staaten mit Deutschland an der Spitze und vor allem Japan ausüben.6 Der daraus resultierende Überschuss der Kapitalbilanz7 erleichterte es der Regierung von Ronald Reagan (1981-1988), gleichzeitig die Steuern drastisch zu senken und die staatlichen Ausgaben vor allem für Verteidigung massiv anzuheben, sodass der Bundeshaushalt tief ins Minus geriet und es erstmals zu der Konstellation des „Twin Deficit“, des Zwillingsdefizits von Budget und Leistungsbilanz, kam, das auch die Regierungszeit von George W. Bush zwanzig Jahre später prägen sollte. In der Tat muss die Phase marktliberaler Reformen, die unter Reagan angestoßen wurde, als Auftakt der weltweiten Liberalisierung der Kapitalmärkte nach dem Ende des Kalten Krieges in den 90er-Jahren unter dem Leitmotiv der „Globalisierung“ gesehen werden. Die Abwicklung der Finanzkrise asiatischer Länder und Russlands 1997/98 unterstreicht diesen Prozess, festigte sie doch zunächst die globale Dominanz des US-Dollar und des amerikanischen Finanzmarktes. Nicht nur war er von der Krise weitgehend ungeschoren geblieben8 und bestätigte damit den Ruf der USA als des letzten wirklichen „sicheren Hafens“ in stürmischen Zeiten der Weltwirtschaft. Die Reaktion der asiatischen Länder, voran Chinas, auf die Krise – der Aufbau enormer vor allem in Dollar 5 6 7 8 Der mittlerweile über 80-jährige Paul Volcker ist derzeit wieder einer der wichtigsten Wirtschaftsberater von Barack Obama. Die in diesem Zusammenhang vor allem von Japan auf Verlangen der USA betriebene Niedrigzinspolitik trug wesentlich zur Aufblähung und zum anschließenden Platzen der japanischen „Bubble“ Anfang der 90er-Jahre bei. Dazu trugen auch die enormen offiziellen Kapitalexporte aus lateinamerikanischen Ländern infolge der ihnen auferlegten Sanierungsprogramme nach der Schuldenkrise von 1982 ebenso wie die Kapitalflucht aus diesen Ländern bei. Die Rettung des wegen Fehlspekulationen bei Zinsderivaten vom Zusammenbruch bedrohten amerikanischen Hedge Funds LTCM durch eine von der Fed kurzfristig am 23.9.1998 zusammengetrommelte Rettungsaktion von neun amerikanischen und fünf europäischen privaten Großbanken der westlichen Industrieländer, die 3,75 Mrd. $ als Eigenkapitalverstärkung bereitstellten, blieb hinsichtlich des US-Finanzmarktes bis zur Finanzkrise von 2007 die Ausnahme – und der Betrag des Stützungskredits mutet aus heutiger Sicht fast als „peanuts“ an. 266 Jens van Scherpenberg gehaltener Währungsreserven – erhöhte zunächst zusätzlich die Nachfrage nach rentablen Dollaranlagen. Diese wurde mit den steigenden Ölpreisen ab 2004 zusätzlich verstärkt durch die wachsenden Dollarüberschüsse der arabischen Öl exportierenden Staaten. Aus US-Sicht erschien diese Konstellation als ein Überangebot von in Dollar als der maßgeblichen Reservewährung gehaltenen globalen Ersparnissen – ein „global savings glut“, wie ihn der frühere Ökonomieprofessor der Princeton University und heutige Vorsitzende des Federal Reserve Board, Ben Bernanke, noch 2006 in einer Rede als Mitglied des Federal Reserve Board charakterisierte. Dieses ausländische Ersparnis-Überangebot suche zwangsläufig nach rentablen Investments in den USA und finanziere damit zugleich, quasi als Nebeneffekt, das Defizit der Leistungsbilanz. Sollten sich aus einem solchen Zustrom „asset bubbles“, also spekulative Übertreibungen bei bestimmten Vermögenswerten, ergeben, so sei es nicht Aufgabe der Zentralbank, diese Spekulationsblasen durch geldpolitische Maßnahmen zum Platzen zu bringen.9 Diese Sichtweise passte nicht nur nahtlos zur marktliberalen Wirtschaftspolitik der Regierung von George W. Bush.10 Sie reflektierte auch die Finanzmarktpraxis einer immer stärkeren spekulativen Überhöhung des Angebots neuer derivativer Finanzprodukte, mit dem amerikanische Finanzinstitutionen den globalisierten Kapitalmarkt bis 2007 dominierten – und dem Dollar so seine weltweite Attraktivität als Reservewährung sicherten. Die großen amerikanischen Geschäfts- und Investmentbanken entwickelten angesichts der durch den Kapitalzustrom in die USA niedrigen Zinsen auf Standardanlagen wie US-Treasuys immer neue Finanzprodukte mit höheren Erträgen (und Risiken), die in großem Stil an europäische Banken verkauft und im Folgenden von diesen imitiert wurden. Sie vermittelten den neuen Großakteuren der internationalen Finanzmärkte, den Staatsfonds Asiens und der Golfstaaten profitable Anlagemöglichkeiten, etwa in den großen Private Equity Funds. Und sie trugen auf diese Weise wesentlich bei zu dem enormen Liquiditätsschub, der Banken und Unternehmen in vielen aufstrebenden Staaten die zinsgünstige Verschuldung auf den internationalen Kapitalmärkten gestattete. In diesem Sinne waren sie die „masters of the universe“, wie sich die Investmentbanker selbst nur halb im Scherz nannten. 9 10 Bernanke, Ben: The Global Saving Glut and the U.S. Current Account Deficit, Rede gehalten vor der Virginia Association of Economics, Richmond, Virginia, am 10.3.2005, http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/, Stand: 17.3.2009. George W. Bush hat sich, was die Wirtschafts- und Finanzpolitik seiner Regierung anbetraf, explizit als Vollstrecker des Erbes von Reagan gesehen, ermächtigt durch die republikanische Mehrheit im Kongress, die Reagan versagt geblieben war. Vgl. dazu van Scherpenberg, Jens: Der geborgte Aufschwung. Die wirtschaftspolitische Bilanz der Regierung Bush 2001-2004, SWP-Studie S 40, Berlin 2004. Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 267 Die amerikanische Volkswirtschaft profitierte von der dominanten Stellung des Dollar doppelt: zum einen durch den Seigniorage-Effekt – den Zinsgewinn aus den vom Federal Reserve System in Umlauf gebrachten Dollarbeständen, die einem zinslosen Kredit der Abnehmer an die Fed und – soweit sie im Ausland umlaufen – an die amerikanische Volkswirtschaft entsprechen; zum anderen durch das sogenannte „exorbitant privilege“ der USA – ihre Fähigkeit, sich als die „Banker der Welt“ ständig durch Dollaremission kurzfristig zu geringsten Zinskosten im Ausland zu verschulden und zugleich ihrerseits mit ihren Dollar hochprofitable Investments im Ausland zu tätigen.11 Dass die Kapitalimporte, die das amerikanische Leistungsbilanzdefizit finanzierten, im Unterschied zu den 1990er-Jahren immer weniger durch einen Importüberschuss privaten Anlagekapitals, sondern zunehmend, seit 2006 schließlich zu über zwei Dritteln, durch Dollaranlagen ausländischer Zentralbanken finanziert wurden, erschütterte diese Sichtweise nicht. Dieses neue Arrangement gab allerdings Anlass zum Versuch, die darin zum Ausdruck kommende Interdependenz, ja Symbiose auf unmittelbar staatlicher Ebene vor allem zwischen der chinesischen Zentralbank als der größten Käuferin von US-Schatzanleihen und den USA zu analysieren. In einem vielzitierten Beitrag wurde dieses quasi-politische Arrangement, zu dem die einseitige Bindung des chinesischen Renminbi an den US-Dollar gehörte,12 als „Bretton Woods II“-System bezeichnet.13 Allerdings ist dies, wie zu zeigen sein wird, wenig passend, da das als „Bretton Woods II“ charakterisierte System eben nicht wie „Bretton Woods“ ein hegemoniales Regime bezeichnet, sondern eher eine delikate politökonomische gegenseitige Abhängigkeit zwischen China und den USA. Wie bereits 2005 von Nouriel Roubini, dem späteren „Dr. Doom“ der Fi11 12 13 Das zeigt sich unter anderem daran, dass der Saldo der Bilanz der Kapitaleinkommen bis 2007 noch immer knapp positiv war, obwohl die USA längst zum größten Schuldner der Welt geworden waren, mit einer Nettoverschuldung gegenüber dem Ausland von 2,5 Billionen Dollar. Siehe Bureau of Economic Analysis, International Investment Position at Yearend 2007, www.bea.gov. Die Dollarbindung des Renminbi wurde von China allerdings zum 1.7.2005 zugunsten der Bindung an einen Währungskorb aufgegeben. Dessen Zusammensetzung wurde – wie in den meisten anderen Staaten mit WährungskorbWechselkursbindungen (pegs) – nicht veröffentlicht. Es ist aber davon auszugehen, dass in dem betreffenden Korb, ähnlich wie für die Zusammensetzung der Währungsreserven Chinas geschätzt wird, der Dollar ein Gewicht von 70% hat, während die übrigen 30% überwiegend auf den Euro und in geringerem Maße (unter 10%) auf den japanischen Yen entfallen. Seit Chinas Übergang zu einer Korbbindung hat der Renminbi gegenüber dem Dollar um etwa 25% ausgewertet. Dooley, Michael P./Folkerts-Landau, David/Garber, Peter: An Essay on the Revived Bretton Woods System, NBER Working Paper 10332, March 2004, http://www.nber.org/papers/w9971 und http://www.frbsf.org/economics/ conferences/0502/w9971.pdf, Stand: 6.3.2009. 268 Jens van Scherpenberg nanzkrise, kritisch antizipiert wurde,14 zeigt sich diese nicht-hegemoniale gegenseitige Abhängigkeit nun deutlich in der Krise. 3. Der Aufstieg des Euro Die Errichtung der Europäischen Währungsunion mit dem Euro als einheitlicher Währung war nicht nur ein großer Schritt im europäischen Integrationsprozess. Sie war auch unmittelbare Folge der disruptiven Wirkungen auf den europäischen Integrationsprozess, die seit den 1970erJahren immer wieder von den Wechselkursschwankungen des Dollar gegenüber der Deutschen Mark als europäischer Leitwährung ausgegangen waren, Schwankungen, die ihre Ursache vor allem im „bening neglect“ der internationalen makroökonomischen Wirkungen der amerikanischen Wirtschaftspolitik hatten. Dem berüchtigten Spruch des Finanzministers von Richard Nixon, John Connally, aus dem Jahr 1971, dem Jahr der Aufkündigung der Goldparität des Dollar, an die Adresse der Europäer – „The dollar is our currency and your problem“ – sollte endlich der Boden entzogen werden. Noch bis zwei Jahre vor ihrem Inkrafttreten war die Europäische Währungsunion in den USA als ein hochgradig konfliktträchtiges, wenn nicht zum Scheitern verurteiltes Projekt gesehen worden,15 soweit sie überhaupt ernst genommen wurde.16 Und der Kursverfall des Euro gegenüber dem Dollar in den ersten Jahren nach seiner Einführung trug zunächst nicht dazu bei, diese Einschätzung zu korrigieren, auch wenn Fred Bergsten, der Direktor des Institute for International Economics in Washington, frühzeitig einen transalantischen „Zusammenprall der Titanen“ kommen sah.17 Mit der Stabilisierung des Eurokurses ab 2002 zeigte sich aber, dass der Euro zumindest auf dem internationalen Markt für längerfristige Anlei14 15 16 17 Roubini, Nouriel/Setser, Brad: Will the Bretton Woods 2 Regime Unravel Soon? The Risk of a Hard Landing in 2005-2006. Paper written for the Symposium on the „Revived Bretton Woods System: A New Paradigm for Asian Development?“, organized by the Federal Reserve Bank of San Francisco and UC, February 2005, http://www.frbsf.org/economics/conferences/0502/Roubini.pdf, Stand: 6.3.2009. Die „harte Landung“ kam zwei Jahr später, dafür umso härter. Vgl. Feldstein, Martin S.: EMU and International Conflict, in: Foreign Affairs 6/1997, S.60-73. Vgl. hierzu auch van Scherpenberg, Jens: Transatlantische Asymmetrien, in: Europa und die USA. Transatlantische Beziehungen im Spannungsfeld von Regionalisierung und Globalisierung, hrsg. von Reinhard C. Meier-Walser und Susanne Luther, München 2002, S.161-171, 167ff. Bergsten, C. Fred: America and Europe: Clash of the Titans?, in: Foreign Affairs 2/1999. Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 269 hen (Bonds) privater und öffentlicher Schuldner zu einer bedeutenden Alternative zum Dollar wurde. Fast 50% aller international aufgelegten Anleihen lauteten im Jahr 2007 auf Euro.18 In seiner Stellung als maßgebliche Reservewährung der Welt hat der USDollar bislang zwar nur geringe Einbußen hinnehmen müssen. Sein Anteil an den Weltwährungsreserven fiel von 1999, dem Jahr der Einführung des Euro, bis Mitte 2008 von 71% auf 63%, der Anteil des Euro stieg im selben Zeitraum von 18% auf 27%.19 Bei genauer Betrachtung der Daten zeigt sich jedoch auch hier, dass der Anstieg des Euro-Anteils an den Weltwährungsreserven zu Lasten des Dollar mit dem Jahr 2002, dem Jahr der Stabilisierung des Eurokurses, einsetzt und seitdem graduell fortschreitet. Diese neuere Entwicklung seit 2002 gab der wissenschaftlichen und politischen Debatte neuen Auftrieb, ob der Euro mit dem Dollar als Welt-Reservewährung gleichziehen oder ihn gar in dieser Rolle ablösen könne (wie der Dollar in den 1930er-Jahren das britische Pfund abgelöst hatte). Menzie Chinn und Jeffrey Frankel fassen in einem viel beachteten Aufsatz von 2008 noch einmal die wesentlichen ökonomischen Argumente für die Stellung einer nationalen Währung als globaler Reservewährung zusammen:20 1. Größe der betreffenden Volkswirtschaft, ihr BIP und ihr Anteil am Welthandel: Was das BIP und die Anteile am Welthandel angeht, herrscht in etwa Parität zwischen den USA und der Eurozone. Wichtiger aber dürfte sein, in welcher Währung der Welthandel abgewickelt wird, worauf Chinn und Frankel nicht eingehen. Und in dieser Hinsicht hat der Dollar einen 18 19 20 Vgl. European Central Bank, The International Role of the Euro, Frankfurt/M., July 2008, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/euro-international-role200807en. pdf. Die ECB unterscheidet hier zwischen einer „engen“ Betrachtung, die nur solche Anleihen einbezieht, die von einem Emittenten in einer anderen als der Heimatwährung aufgelegt wurden (hier ist das Verhältnis 32% Euro-, 43% Dollaranleihen), sowie einer „weiten“, die auch in der Heimatwährung aufgelegte, aber auf dem internationalen Kapitalmarkt zur Zeichnung angebotene Anleihen einbezieht (hier ist das Verhältnis 48% Euro-, 35% Dollaranleihen). Daten errechnet aus: International Monetary Funds, Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) Database, Stand 31.12.2008. Die Daten für 2008 beziehen sich auf den Stand zum 30.9.2008. In der COFER Database sind jedoch die Reserven Chinas und einiger anderer asiatischer Länder nicht nach einzelnen Währungen aufgeschlüsselt; ihr Anteil betrug zum 30.9.2008 immerhin 37% der gesamten Währungsreserven aller IWFMitglieder. Die Aufteilung der Währungsreserven auf die einzelnen Länder kann also nur aus den zuletzt 63% der Reserven errechnet werden, für die aufgeschlüsselte Angaben vorliegen. Als Schätzwert wird davon ausgegangen, dass auch die Währungsreserven Chinas und der anderen Länder, die keine Angaben zur Zusammensetzung ihrer Reserven machen, sich in etwa an dem Aufteilungsschlüssel für den Rest der Welt orientieren. Chinn, Menzie/Frankel, Jeffrey: Why the Euro Will Rival the Dollar, in: International Finance 1/2008, S.49-73, S.56ff. 270 Jens van Scherpenberg deutlichen Vorsprung.21 Dieser ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die großen asiatischen Handelsnationen den größten Teil ihres Handels in Dollar und nur einen sehr kleinen Teil – im einstelligen Prozentbereich – in Euro abwickeln. Zum anderen stützt die Fakturierung von Rohöl in Dollar dessen Dominanz als internationale Handelswährung. 2. Größe und Tiefe des Finanzmarkts: Angesichts der führenden Stellung des New Yorker Finanzmarktes und der großen Rolle des Londoner Finanzmarktes bei Dollar-basierten Finanztransaktionen sehen Chinn und Frankel hier einen klaren Vorsprung für die USA, zumindest so lange Großbritannien nicht der Eurozone beitritt. 3. Vertrauen in die Stabilität der Währung als Wertaufbewahrungsmittel: Dies ist für Chinn und Frankel trotz der guten Inflationsdaten der USA in den letzten Jahren ein Faktor, der gegen den Dollar spricht: „Even if the Federal Reserve never succumbs to the temptations or pressures to inflate away the US debt, the continuing US current account deficit is always a likely source of downward pressure on the dollar.“22 4. Netzwerkeffekte, also der Vorteil für den einzelnen Nutzer einer Ware, der daraus entsteht, dass viele andere diese ebenfalls nutzen, er sich also ihres dauerhaften Nutzens relativ sicher sein kann: Dieser Netzwerkeffekt gilt auch für Staaten als Halter von Währungsreserven. Damit diese ihren Zweck als – liquide – Reserve erfüllen, sollten sie auch von möglichst vielen anderen Staaten in nennenswertem Umfang als Reserve gehalten und damit nachgefragt werden. Dieser Effekt begünstigt derzeit noch eindeutig den Dollar. Von diesen Kriterien stellt vor allem der letztgenannte Netzwerkeffekt ein zugunsten des Dollar wirkendes retardierendes Element für einen möglichen strukturellen Umbruch im internationalen Währungssystem dar. Hinsichtlich der drei erstgenannten Kriterien hingegen sind bereits jetzt Entwicklungen zu Lasten der Dollardominanz erkennbar: Zu 1. Die Rolle einer globalen Wachstumslokomotive werden die USA voraussichtlich für die kommenden Jahre verlieren, auch wenn es noch offen ist, ob der Rückgang der Wirtschaftsleistung dort stärker ausfällt als in der Eurozone. Auch im Handel könnte die Rolle des Dollar in dem Maße abnehmen, wie die amerikanischen Importe einbrechen und die USA ihre Rolle als „consumer of last resort“ verlieren. Zudem verstärkte insbesondere China Ende 2008/Anfang 2009 erfolgreich seine Bemühungen, einen 21 22 Vgl. Kamps, Annette: The Euro as invoicing currency in international trade, in: European Central Bank Working Paper 665/2006. Siehe dazu auch den im Dezember 2009 erscheinenden Artikel von Carla Norloff: Key Currency Competition: The Euro versus the Dollar, in: Cooperation and Conflict 4/2009. Chinn/Frankel: Why the Euro Will Rival the Dollar, S.58. Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 271 wachsenden Teil seines Handels mit seinen ost-/südostasiatischen Handelspartnern in seiner eigenen Währung, dem Renminbi, abzuwickeln. Zusätzlich gewinnt der Renminbi an regionaler Attraktivität durch seine kontinuierliche leichte Aufwertung gegenüber dem Dollar seit Mitte 2005. Scheinbar unerschütterlich ist demgegenüber die Rolle des Dollar als Handelswährung im internationalen Ölhandel. Das liegt zum einen an der dominierenden Rolle der beiden großen Ölbörsen, der New York Mercantile Exchange (NYMEX) und der Londoner International Petroleum Exchange (IPE), beide von amerikanischen Banken und großen Ölfirmen kontrolliert. Über sie wird vor allem der umfangreiche, auf Rohöl und Mineralölprodukten basierende Termin- und Derivatehandel abgewickelt, selbstverständlich in Dollar. Dabei kommt ihnen der Netzwerkeffekt zugute, der es sehr schwierig macht, alternative, nicht dollarbasierte Handelsplätze für Rohöl zu etablieren. Ein iranischer Versuch einer eigenen Ölbörse, die nach langer Verzögerung im Frühjahr 2008 endlich ihre Geschäfte aufnahm, beschränkt sich bislang auf den lokalen Produktenhandel und wickelt noch nicht einmal den iranischen Rohölexport ab. Allerdings ist festzustellen, dass einige Rohölexporteure, darunter Russland und auch der Iran, dazu übergegangen sind, ihre längerfristigen Ölliefervereinbarungen angesichts der hohen Schwankungen des Dollarkurses auf Zahlung in anderen Währungen, den Euro oder auch den Renminbi, umzustellen.23 In einer viel beachteten Rede auf einem von der spanischen Regierung einberufenen Fachkongress zur künftigen internationalen Rolle des Euro sprach der damalige Leiter des Petroleum Market Analysis Dept. der OPEC, der Iraner Javad Yarjani, über die Wahl der Währung für die Fakturierung von Öl.24 Er nannte für den Übergang der OPEC auf die Fakturierungswährung Euro drei Kriterien: – – – Preisfestsetzung und Handel des norwegischen Brent-Öls, den Beitritt Großbritanniens zum Euro und den erfolgreichen Abschluss des (Ost-)Erweiterungsprozesses der EU. 23 Dass die von Saddam Hussein im Jahr 2000 mit Zustimmung der UNO und der USA beschlossene Umstellung der Fakturierung seiner begrenzten Ölexporte im Rahmen des von der UNO kontrollierten Oil for Food-Programms auf Euro eine wichtige Rolle bei der amerikanischen Entscheidung für den Irakkrieg von 2003 gespielt hätte, ist ein zwar weit verbreitetes, aber keineswegs fundiertes Internet-Gerücht. Yarjani, Javad: The Choice of Currency for the Denomination of the Oil Bill, Vortrag gehalten auf der Konferenz „The International Role of the Euro“, veranstaltet durch den spanischen Wirtschaftsminister im Rahmen der spanischen EU-Präsidentschaft am 14.4.2002 in Oviedo, Spanien. Das Dokument ist auf der OPEC-Website nicht mehr greifbar. Es ist im Internet aufrufbar, unter: http://www.kritische-wirtschaftswissenschaften.de/Material/YarjaniRole-of-the-Euro.txt, Stand: 17.3.2009. 24 272 Jens van Scherpenberg Von diesen Bedingungen ist allein die dritte bislang zweifelsfrei erfüllt – auch wenn die Osterweiterung gegenwärtig durch die krisenbedingten Verschuldungsprobleme mehrerer osteuropäischer EU-Mitglieder einer gewissen Belastung ausgesetzt ist. Gegen eine Erfüllung des erstgenannten Kriteriums sprechen vor allem die erwähnten Netzwerkeffekte der Abwicklung des Ölhandels in Dollar. Und ob die internationale Finanzkrise Großbritannien einem Euro-Beitritt näher bringt, ist nach wie vor sehr fraglich. Ein anderer von Yarjani 2002 nicht angesprochener Faktor ist aber die währungspolitische Integration der Golfstaaten. Dass sie in jüngster Zeit erhebliche Fortschritte macht, liegt nicht nur an der hohen Volatilität sowohl des Dollarkurses wie des Ölpreises in den letzten Jahren, sondern auch daran, dass die Golfstaaten ihre Importe in einem wachsenden Maße aus dem Euro-Raum beziehen und auch in Euro bezahlen müssen. Im Dezember 2008 hat der schon 2003 gefasste Plan, bis zum Jahr 2010 eine gemeinsame Währung der Golfstaaten zu schaffen, unter dem Eindruck der Finanzkrise auf einer Regierungskonferenz der Mitgliedstaaten des Gulf Cooperation Council (GCC)25 starke neue Impulse erhalten. Auch wenn es höchst unwahrscheinlich ist, dass dieser ehrgeizige Plan angesichts der noch ungelösten Fragen innerhalb des laufenden Jahres fristgemäß realisiert wird,26 dürfte doch in wesentlichen Fragen der währungspolitischen Kooperation bis hin zum Wechselkursregime der künftigen Währungsunion – Dollarbindung, flexibler oder an einem Korb mehrerer großer Währungen statt ausschließlich am US-Dollar orientierter Wechselkurs – eine Entscheidung näher rücken. In einer solchen Währungsunion mit flexiblem oder korbbasiertem Wechselkursregime würde die Fakturierung des zu exportierenden Öls in Dollar weniger attraktiv für die Förderländer werden. Allerdings sollte die sehr starke politische und ökonomische Bindung des Hauptförderlandes und dominierenden GCCMitglieds Saudi-Arabien an die USA, die sich bereits in der Bewältigung der Ölkrisen von 1973/74 und 1980 bewährte, nicht unterschätzt werden, wie zu Punkt 3 angesprochen wird. Zu 2. Größe und Tiefe des US-Finanzmarkts: Dies war noch das ganze Jahr 2006 hindurch gegenüber den bereits erkennbaren Anzeichen der heranziehenden Immobilienkrise in den USA das entscheidende Argument auch unabhängiger Finanzexperten für die Krisenresistenz des amerikani25 26 Mitglieder des GCC sind: Bahrain, Katar, Kuweit, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Vgl. Deutsche Bank Research, GCC Monetary Union: More political will, but don‘t expect any major results, 19.1.2009, www.dbresearch.com, sowie Efforts on to form GCC monetary union by 2010, Khaleej Times, 4.3.2009, http:// www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?xfile=/data/business/2009/March/business_March148.xml Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 273 schen Finanzsektors.27 Es ist unter den von Chinn/Frankel genannten vier Kriterien sicher dasjenige, hinsichtlich dessen die Finanzkrise die Stellung des Dollars am stärksten diskreditiert hat. Auch die Erweiterung des Euro zumindest um Dänemark und Schweden, aber selbst ein Beitritt Großbritanniens haben im Jahr 2009 einen deutlich höheren Wahrscheinlichkeitswert als noch 2007. Zu 3. Vertrauen in die Stabilität der Währung als Wertaufbewahrungsmittel: Hier stehen die von Chinn und Frankel angeführten, bereits erwähnten Negativa gegen die noch immer bestehende „safe haven“-Eigenschaft des Dollar. Einerseits wurde angesichts der seit 2003 wachsenden Leistungsbilanzdefizite der USA ein erheblicher Abwertungsdruck auf den Dollar vor allem im Verhältnis zum Euro antizipiert, und dieser realisierte sich ja auch bis ins Jahr 2008 hinein mit einem Anstieg des Dollar-EuroWechselkurses bis auf 1,60$/1€. Andererseits aber kam in dem Maß, wie die Finanzkrise sich zu einer globalen Wirtschaftskrise ausweitete, die „safe haven“-Qualität des Dollar wieder zur Geltung, auch im Anstieg seines Wechselkurses. Sie hat mindestens so sehr politische wie ökonomische Gründe. Schließlich sind die USA als Nation nicht nur die größte Wirtschafts-, sondern vor allem auch die größte Militärmacht. Ihrer Fähigkeit, Sicherheit in anderen Regionen zu garantieren und aktive Gegner der von der USA garantierten regionalen Sicherheitsordnungen durch den Einsatz militärischer Gewalt in die Schranken zu weisen oder auszuschalten, kommt kein anderes Land gleich. Dies spielt vor allem im Nahen Osten eine entscheidende Rolle. Als Garantiemacht der innen- und außenpolitischen Stabilität und Sicherheit der maßgeblichen Staaten des Nahen Ostens – Saudi-Arabien, die kleineren Golfstaaten, Ägypten und natürlich allen voran Israel – sind die USA in der Lage, von diesen Staaten einen politischen und wirtschaftlichen Preis für diese Leistung einzufordern. Ähnliches gilt in Ostasien für Japan und Südkorea. Auch hier kann von einem klaren hegemonialen Quid-pro-Quo von militärischer Sicherheitsgarantie und Stützung des Dollar gesprochen werden. Demgegenüber steht hinter dem Euro keine eigene politische Macht, da diese weiterhin bei den Mitgliedstaaten liegt. Als „Währung ohne Regierung“, aber mit einer sehr unabhängigen, ja in den Augen vieler Kritiker unzureichend politisch verantwortlichen Zentralbank repräsentiert der Euro ein neues Modell, dem andere Staaten trotz seiner Stabilität bei ihrer 27 Vgl. Mühleisen, Martin: Home Mortgages and the Attractiveness of U.S. Financial Markets, in: Sharing the Growing Economic Burden of World Order, hrsg. von Jens van Scherpenberg und Katharina Plück, Berlin 2006, Stiftung Wissenschaft und Politik, http://www.swp-berlin.org/common/get_document. php?asset_id=3355, S.48-56. Martin Mühleisen, Internationaler Währungsfonds, war 2006 stellvertretender Leiter der North America Division des IWF. 274 Jens van Scherpenberg Reservenallokation zunächst nicht das gleiche Vertrauen entgegenbringen wie der Währung der Weltmacht Nr. 1. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Attraktivität des Euro als Handels- und Reservewährung vor dem vollen Ausbruch der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise im September 2008 zwar gestiegen, die Dominanz des US-Dollar in dieser Rolle jedoch noch keineswegs gebrochen war. Ob sich daran noch etwas ändert, wird der weitere Verlauf der Krise zeigen. 4. Dollar und Euro in der Krise Die gegenwärtige globale Finanz- und Wirtschaftskrise stellt die genannten Kriterien des bisherigen Kräfteverhältnisses der Währungen und die bisherigen Abwägungen zwischen Dollar und Euro auf fundamentale Weise in Frage, ohne dass bereits klare Kriterien für ihr künftiges Verhältnis zueinander erkennbar sind. So können an dieser Stelle nur die erheblichen neuen Unsicherheitsfaktoren genannt werden, deren weitere Entfaltung einen noch längst nicht absehbaren Einfluss auf die künftige Rangfolge der großen Weltwährungen haben wird. 4.1 Die riskante Strategie von US-Regierung und Fed Die USA als das „Mutterland der Krise“ haben seit Amtsantritt der Regierung Obama mit außerordentlicher Entschlossenheit und hoher Risikobereitschaft den Weg einer konsequenten schuldenfinanzierten Nachfragebelebung eingeschlagen. Der Kongress verabschiedete im Februar 2009 ein Konjunkturprogramm von fast 800 Mrd. $ und damit über 6% des BIP, deren größter Teil im laufenden Haushaltsjahr 2009 (1.10.2008 – 30.9.2009) und im kommenden Haushaltsjahr 2010 ausgegeben werden soll. Nach Verabschiedung eines Nachtragshaushaltes und unter Berücksichtigung der wegbrechenden Steuereinnahmen schätzt das Office of Management and Budget (OMB) des Weißen Hauses das Defizit für das laufende Haushaltsjahr auf 1.752 Mrd. $. Das ist das Vierfache des Defizits von 459 Mrd. $ in 2008 und entspricht einem Anteil von 12,5% des BIP – ein Wert, der zuletzt im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs erreicht wurde. Auch der Budgetentwurf für das Haushaltsjahr 2010, den die Regierung Obama Ende Februar 2009 vorlegte, geht von einem Defizit von fast 1.200 Mrd. $ aus – bei eher optimistischen Wachstumsannahmen. Diese Zahlen übersetzen sich in eine gewaltige Inanspruchnahme des internationalen Kapitalmarktes durch amerikanische Staatsschuldpapiere Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 275 in Höhe von netto etwa drei Billionen Dollar in den nächsten beiden Jahren. Von den Staatsanleihen (Treasurys) zur Finanzierung der Defizite der letzten Jahre wurden nur etwa die Hälfte auf dem Kapitalmarkt an private in- und ausländische Investoren abgesetzt, die andere Hälfte übernahmen ausländische – vor allem asiatische – Zentralbanken. Bei einem vervierfachten Defizit müssten diese, selbst wenn man eine Verdoppelung des Absatzes an private Investoren annimmt, ihre Treasurys-Käufe um das Siebenfache steigern – eine offensichtlich absurde Perspektive. Tatsächlich dürften Japan und China als die beiden größten ausländischen Käufer von Treasurys diese Käufe schon wegen des Rückgangs ihrer Exporte in die USA und damit ihrer Dollareinnahmen deutlich reduzieren. Zudem steigt gerade auf chinesischer Seite die Sorge vor einem drastischen Wertverlust der eigenen Dollaranlagen.28 Und diese ist nicht unberechtigt, da die amerikanische Fed inzwischen begonnen hat, selbst langlaufende Treasurys anzukaufen, um den Kapitalmarkt zu entlasten – eine Operation, die man gemeinhin als Gelddrucken bezeichnet: Dem Staat wird durch die Zentralbank neues Geld zur Verfügung gestellt, das aus der Wirtschaft, sei es über Steuern, sei es durch Verschuldung auf dem Kapitalmarkt, nicht mehr zu holen ist. Die Bilanzsumme der Fed, die bis Mitte 2008 noch unter 1 Billion Dollar betrug, bis Ende 2008 aber bereits auf 2,3 Billionen angewachsen war, soll sich im Jahr 2009 noch einmal auf 4 Billionen $ verdoppeln. Die Regierung Obama und die Fed setzen damit bewusst die überlegene Kreditwürdigkeit der USA und die Rolle des Dollar als führende Transaktions- und Reservewährung der Welt als Instrument der Krisenbewältigung ein – in der Hoffnung, damit den entscheidenden Anstoß zur Überwindung der Krise in den USA zu geben, bevor der Dollar durch diese riskante Strategie seine Führungsposition verliert. Letzteres hätte allerdings einschneidende Konsequenzen, wie Chinn und Menzel bereits vor der Krise betonten: „If the dollar does indeed lose its role as leading international currency, the cost to the United States would probably extend beyond the simple loss of seigniorage narrowly defined. We would lose the exorbitant privilege of playing banker to the world, accepting short-term deposits at low interest rates in return for long-term investments at high average rates of return. When combined with other political developments, it might even spell the end of economic and political hegemony. These are century-long advantages that are not to be cast away lightly.“29 28 29 Vgl. „Wen Voices Concern Over China’s U.S. Treasurys“, Wall Street Journal Online, 13.3.2009, http://online.wsj.com/article/SB123692233477317069. html, Stand: 14.3.2009. Chinn/Frankel: Why the Euro Will Rival the Dollar, S.69. 276 Jens van Scherpenberg Aber nicht nur die Stellung des US-Dollar als Weltwährung steht in Frage. Auch dem Euro steht die ernsteste Bewährungsprobe seiner jungen Geschichte bevor. 4.2 Europa im Strudel drohender Staatsbankrotte? Derzeit ist nicht zu erkennen, dass die Staaten der Eurozone oder die EUStaaten generell und mit ihnen der Euro stärker aus der Krise hervorgehen als die USA und der Dollar. Zu tief waren ihre Finanzinstitutionen in den von den US-Finanzinvestmentbanken kreierten Derivatemarkt integriert und zu schwer sind sie daher durch die Krise in Mitleidenschaft gezogen worden. Das gilt in hohem Maße für Großbritannien, das mit dem Finanzplatz London einen der beiden Hauptschauplätze der für die Krise verantwortlichen rapiden Aufblähung von Kreditpapieren durch die großen Investmentbanken stellt. Um mehr Geld in die Wirtschaft zu schleusen, aber möglicherweise auch, um der explodierenden britischen Staatsverschuldung einen allzu harten Test auf dem internationalen Kapitalmarkt zu ersparen, hat die Bank of England noch vor der Fed begonnen, in größerem Umfang unmittelbar langfristige Staatsanleihen anzukaufen, also Geld zu drucken. Zugleich hat die Krise den Wechselkurs des britischen Pfundes zum Euro bis an die 1:1-Parität fallenlassen. Gravierender noch sind jene kleineren europäischen Staaten betroffen, deren Finanzsektoren tief in die internationalen Finanzmärkte integriert, dabei aber ebenso wie Teile des Nicht-Finanz-Unternehmenssektors in hohem Maße im Ausland verschuldet waren und nun fällige Kredite nicht mehr bedienen, geschweige denn refinanzieren können. Neben Island sind dies bislang Ungarn, Lettland und Litauen. Hier musste sich der Staat für die Vermeidung eines völligen Zusammenbruchs seines Finanzsektors so stark verschulden, dass er selbst vor der eigenen Zahlungsunfähigkeit stand, die nur durch konzertierte Rettungsaktionen des IWF, zum Teil unterstützt durch die EU, und verbunden mit einschneidenden Auflagen, abgewendet werden konnte. Aber auch Staaten der Eurozone wie Griechenland und Portugal und das bisherige Wirtschaftswunderland Irland, ja wegen der hohen Kredite seiner Banken an osteuropäische Schuldner selbst Österreich, sind unter Druck geraten – abzulesen an den „Spreads“, der Differenz des Zinssatzes, zu dem sie ihre Staatsschuldpapiere auf dem Kapitalmarkt unterbringen können, zu dem Zinssatz, zu dem Deutschland als das kreditwürdigste Land der Eurozone sich verschuldet. Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 277 Dementsprechend wuchsen die Zweifel auf den internationalen Finanzmärkten am Euro und am Zusammenhalt der Eurozone, ja der EU, wie sich am Eurowechselkurs Anfang 2009 ablesen ließ.30 Nachdem die EUStaats- und Regierungschefs auf ihrem Sondergipfel am 1. März 2009 jedoch erkennen ließen, dass die EU im Einzelfall und unter Auflagen von der Zahlungsunfähigkeit bedrohten Mitgliedstaaten helfen werde, hat diese Sorge abgenommen. Wahrscheinlicher dürfte es nun sein – und das wäre die gute Nachricht in der Krise –, dass die EU bzw. die Staaten der Eurozone über der Notwendigkeit zu solidarischem Handeln untereinander in der Krise zu einer zumindest ansatzweisen Behebung des Geburtsfehlers des Euro gelangen: der völlig unzureichenden fiskalpolitischen Flankierung der Währungsunion, nicht zuletzt, weil der EU die Gefahr und die Kosten eines Rückschlags bei der währungspolitischen Integration so deutlich wie nie vor Augen geführt wurden. 4.3 Ein dritter Weltwährungs-Pol? Es wäre allerdings ein Fehler, mit einem allzu atlantikzentrierten Blick die internationalen Währungsentwicklungen im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise zu betrachten. Die Bestrebungen der im Gulf Cooperation Council zusammengeschlossenen arabischen Ölexportländer wurden bereits angesprochen. Bei weitem gewichtiger aber sind die Fortschritte der währungspolitischen Integration in Asien. Unter dem traumatisch nachwirkenden Eindruck der asiatischen Finanzkrise von 1997/98 hatte sich in Ostasien bereits im Jahr 2000 die Chiang Mai Initiative der „ASEAN plus 3“-Staaten (die zehn ASEAN-Staaten plus China, Japan und Südkorea) konstituiert als eine Vereinbarung zur währungs- und finanzpolitischen Kooperation und zur gegenseitigen Liquiditätsunterstützung der Zentralbanken im Krisenfall durch bilaterale Swap-Vereinbarungen. Diese Initiative ist inzwischen im Grundsatz zu einem gemeinsamen asiatischen Währungsfonds „multilateralisiert“ worden, auch wenn noch eine Reihe von Einzelheiten zu vereinbaren ist.31 Bemerkenswert am hier erreichten Fortschritt ist, dass nunmehr neben Japan auch China die ökonomische Führungsrolle beansprucht. Grundlage hierfür ist nicht nur das seit der Asienkrise enorm gewachsene Ge30 31 Auch einer der führenden amerikanischen Euro-Skeptiker, Martin Feldstein, rechnet mit einem Auseinanderfallen der Eurozone. Vgl. Feldstein, Martin S.: Reflections on Americans‘ Views of the Euro Ex Ante, NBER Working Paper 14696/2009, http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2867, Stand: 13.3.2009. Vgl Henning., C. Randall: The Future of the Chiang Mai Initiative: An Asian Monetary Fund?, Peterson Institute for Inernational Economics, Policy Brief PB 09-5, February 2009, www.iie.com/publications/pb/pb09-5.pdf, Stand: 16.3.2009. 278 Jens van Scherpenberg wicht Chinas als Wirtschafts- und Handelsmacht,32 sondern auch die zunehmende Bedeutung des chinesischen Renminbi als Handelswährung in der Region. China hat seit Dezember 2008 Swap-Abkommen mit den Zentralbanken von Malaysia, Süd Korea, Hong Kong, Belarus, Indonesien und Argentinien über die Verwendung des Renminbi im bilateralen Handel abgeschlossen. Die Rivalität zwischen Japan und China wird zwar weitere substanzielle Fortschritte in der währungspolitischen Integration in Ostasien noch längere Zeit behindern – auch wenn die Chiang-MaiStaaten eine Währungsunion analog derjenigen der EU als anzustrebendes Fernziel bezeichnen. Allerdings schwächt die Finanzkrise Japan stärker als China und verschiebt damit das Kräfteverhältnis beider weiter zu Ungunsten Japans. Und vor allem: Die USA und der Dollar können von der chinesisch-japanischen Rivalität nicht mehr wie noch während der Asienkrise profitieren.33 Es ist sicher noch zu früh für die Prognose eines entstehenden währungspolitischen Multipolarismus, zumal es für die längerfristige Stabilität eines solchen multipolaren Modells auf der Grundlage von Fiat-Währungen, also ohne Goldfundierung, kein historisches Vorbild gibt. Orientierung für die künftigen Verschiebungen im Kräfteverhältnis der Weltwährungen könnten aber die anstehenden Bestrebungen zur Neuordnung der institutionalisierten Beziehungen unter den führenden Wirtschaftsmächten sowie in den internationalen Finanzinstitutionen, namentlich dem IWF, bieten. 5. Perspektiven transatlantischer und internationaler Kooperation Seit im Herbst 2008 anlässlich der Finanzkrise erstmals die Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer auf Gipfelebene zusammentrat, wird die Unerlässlichkeit enger internationaler Kooperation bei der Bewältigung der Krise betont. Dabei hat es sich schnell gezeigt, dass die bisherige Gruppe der 7 (in Finanz- und Währungsfragen) bzw. 8 wichtigsten Industriestaaten, die G7/8, nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, dass vielmehr die G20, in der auch China sowie große Schwellen- und Ölexportländer wie Indien, Brasilien und Saudi-Arabien vertreten sind, zum wichtigsten politischen Koordinationsort in der Krise geworden ist. Dem 2. Gipfeltreffen der G20 am 2. April 2009 in London folgte im selben Monat die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington. Ihre 32 33 Vgl. Shambaugh, David: China Engages Asia: Reshaping the Regional Order, in: International Security 3/2004, S.64-99. Vgl. hierzu ausführlich Dieter, Heribert: Lehren aus der Asienkrise. Neue Formen der finanzpolitischen Kooperation in Südost- und Ostasien, SWP-Studie S 33, Berlin 2008. Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 279 Handlungsfähigkeit hängt ebenfalls stark von der Kooperationswilligkeit der neuen Wirtschaftsmächte ab. Die Aussichten für eine wirtschafts- und währungspolitische Kooperation bei der Überwindung der Krise sind jedoch – auch wenn die Communiqués der internationalen Krisenkonferenzen des Jahres 2009 ein möglichst positives Bild zu malen versuchen – nicht gut. Zu weit auseinander liegen die Interessen der Beteiligten.34 Dabei geht es zum einen um die Kräfteverhältnisse in den wichtigsten internationalen Finanzinstitutionen, dem IWF und der Weltbank, zum anderen um wirtschaftspolitisches „burden sharing“, um die Verteilung der Kosten der Krisenbewältigung. 5.1 Aufstockung der IWF-Mittel Der IWF schien noch Mitte 2008 als nicht zum Mitwirken eingeladener Akteur unfreiwillig unbeteiligt am Rand der Krise zu stehen, die zu dem Zeitpunkt noch auf den privaten Bankensektor der westlichen Industriestaaten beschränkt war. Die Nachfrage nach Stützungskrediten war minimal, die eingeräumten Kredite beliefen sich Ende August 2008 gerade einmal auf 1,2 Mrd $. Seitdem jedoch ist der IWF in seiner Rolle als „lender of last resort“ ins Zentrum des Geschehens gerückt, da die Krise nach dem Zusammenbruch der Lehmann-Bank am 15. September 2008 immer mehr Staaten angesichts der riesigen Stützungskosten für ihren Finanzsektor und ihrer wachsenden Probleme, sich selbst auf dem internationalen Kapitalmarkt weiter zu verschulden, in akute Zahlungsnöte bringt. Um den Staatsbankrott abzuwenden, muss der IWF ihnen mit großen Stützungskrediten beispringen, die zudem anders als sonstige kurzfristige Zahlungsbilanzstützungsmaßnahmen längerfristig vergeben werden müssen. Allein von September 2008 bis März 2009 sind elf Ländern Stützungskredite in Höhe von fast 67 Mrd. Dollar (44 Mrd. SZR) eingeräumt worden.35 Damit drohte die Ausleihfähigkeit des IWF selbst auf dem Spiel zu stehen. Seine disponiblen Mittel betrugen per Ende Februar 2009 noch 150 Mrd. $. Umso dringender fordert der IWF eine Aufstockung seiner Mittel, und diese wurden ihm von der G20-Gipfelkonferenz von London am 2. April 2009 auch in Höhe von 500 Mrd. $ zugesagt. Davon entfallen je 100 Mrd. $ auf Japan, USA und EU, 10 Mrd. $ auf Kanada und eventuell 40 Mrd. $ auf China. Um 250 Mrd. $ soll der IWF zudem die Ausgabe von Sonderziehungsrechten (SZR) aufstocken können – möglicherweise eine erste 34 35 Vgl. Beattie, Alan: The gap of twenty. Es handelt sich um Belarus, El Salvador, Georgien, Ungarn, Island, Lettland, Pakistan, Rumänien, Serbien, Seychellen, Ukraine. Vom Gesamtbetrag von 67 Mrd. $ entfallen allein 57 Mrd. $ auf Pakistan, Rumänien, Ungarn und Ukraine, weitere 5,4 Mrd. $ auf Belarus, Island und Lettland. 280 Jens van Scherpenberg Konzession an China, das vor der G20-Konferenz vorgeschlagen hatte, die künstliche Korbwährung SZR als neue internationale Leitwährung anstatt des Dollar zu etablieren. China versucht zudem, wie auch Saudi-Arabien, sein Stimmengewicht im IWF deutlich zu erhöhen. Dem wurde Rechnung getragen durch das Vorziehen des ursprünglich für 2013 geplanten Termins zur Neufestsetzung der Quoten auf Januar 2011. Letztlich dürfte China daran interessiert sein, dass die Quote der USA bei einer Quotenneuverteilung unter die Sperrminorität von 15% (zurzeit halten sie 17% im IWF) absinkt und so der IWF aufhört, ein Instrument der amerikanischen hegemonialen Ordnung zu sein. Insbesondere wird in China übelgenommen, dass die USA den IWF gegen die Wechselkurspolitik des Landes und dessen vorgebliches Währungs-Dumping in Stellung brachten und damit explizit für ihre eigenen politischen Zwecke instrumentalisierten.36 5.2 Konjunkturprogramme Bei der Frage, in welchem Ausmaß die führenden Industriestaaten durch schuldenfinanzierte staatliche Nachfrageexpansion die Krise bekämpfen sollten, hat sich vor allem zwischen den USA und den Europäern eine deutliche Kluft aufgetan.37 Die Regierung Obama, die selbst ein Konjunkturprogramm in Höhe von über 6% des BIP aufgelegt hat, fordert von den EU-Staaten ein Programm in annähernd gleicher Höhe, und sie tut dies – etwa durch den früheren Finanzminister unter Präsident Clinton und heutigen Chef des National Economic Council im Weißen Haus, Lawrence Summers – in gewohnt drängender Weise,38 vehement unterstützt durch den Wirtschaftsnobelpreisträger und New York Times-Kolumnisten Paul Krugman.39 Da aber eine Reihe von EU-Ländern bereits jetzt an die Grenzen ihrer Verschuldungsfähigkeit zu geraten droht (oder diese erreicht hat), müsste ein überproportional hoher Anteil eines solchen zusätzlichen Programms von den noch verschuldungsfähigen großen EU-Staaten, also vor allem Deutschland und Frankreich, übernommen werden. Diese wiesen daher den Vorstoß von Summers mit klaren Worten zurück. Der amerikanische Druck auf die Europäer, sich für größere Konjunkturprogramme ebenfalls stärker zu verschulden, sowie die Zurückhaltung in 36 37 38 39 Vgl. Beattie, Alan: Geithner looks for a trade-off over IMF, Financial Times FT.com, 12.3.2009. Vgl. Stokes, Bruce: Balance of Payments: Europe on the Side, in: Congressional Daily, 5.3.2009. So in einem Interview mit der Financial Times. Vgl. Summers calls for boost to demand, Financial Times FT.com, 9.3.2009. Vgl. zuletzt Krugman, Paul: A Continent Adrift, in: New York Times, 16.3.2009, http://www.nytimes.com/2009/03/16/opinion/16krugman.html Dollar und Euro im Umbruch des Weltwährungssystems 281 Europa gegenüber solchen Forderungen aus den USA verdanken sich den spezifischen Lastenverteilungen und Lastenverschiebungsbestrebungen, die mit diesen Maßnahmen bzw. ihrer Unterlassung verbunden sind. Auf der einen Seite ist es für einen Staat, etwa die USA, ohne den Rückfall auf extremen Protektionismus kaum möglich zu verhindern, dass die eigenen Konjunkturprogramme zur Nachfragesteigerung nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland führen, also aus seiner Sicht Trittbrettfahrer begünstigen. Auf der anderen Seite beeinträchtigt eine extreme Anhebung der Staatsverschuldung durch milliardenschwere Konjunkturprogramme letztlich immer auch die Kreditwürdigkeit der eigenen Ökonomie und ihrer Währung – und zwar umso mehr, je stärker der Schuldenanstieg im Vergleich zu dem anderer Staaten ausfällt. Im Wissen um diesen Zusammenhang setzt zumal die deutsche Bundesregierung auf Zurückhaltung bei der Verschuldung – im Interesse einer künftigen stärkeren Stellung des Euro. Die Aussichten für einen engen transatlantischen Schulterschluss bei der Bekämpfung der Krise sind also nicht gut, so wenig wie die Aussichten, auf globaler Ebene im Rahmen der G20 zu wirksamer wirtschaftspolitischer Koordination zu finden. Der Druck der Krise kann sowohl zum Geburtshelfer für die Institutionen und Steuerungsmechanismen einer künftigen nicht-hegemonialen multipolaren internationalen Wirtschaftsordnung werden als auch zur Triebkraft eines tiefen Rückfalls in den Wirtschaftsnationalismus. Die Bekenntnisse des G20-Gipfels von London am 2. April 2009 zu Freihandel und Zusammenarbeit bei der Krisenbewältigung müssen sich erst noch in der konkreten Umsetzung gegenüber widrigen Realitäten und konkreten Interessendivergenzen bewähren. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? Die USA und Europa angesichts der neuen globalen Sicherheitsrisiken und der Notwendigkeit einer Grand Strategy Ralph Rotte / Christoph Schwarz 1. Einleitung: Wie viel Wandel ist realistisch? Walter Russell Mead stellt in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart amerikanischer Außenpolitik fest, dass die grand strategy der Vereinigten Staaten nicht in Strategiedokumenten oder Reden hochrangiger Regierungsvertreter gefunden werden könne. Ursächlich hierfür sei, dass in derartigen Stellungnahmen lediglich Ziele und Hoffnungen zum Ausdruck gebracht, jedoch keine Aussagen darüber getroffen würden, wie die USA in einer konkreten Entscheidungssituation tatsächlich handelten. Verhaltensmuster aus der Vergangenheit sind nach seiner Ansicht eher geeignet, Aufschluss über die höhere Strategie der USA zu gewinnen. Angesichts der Vielzahl der Einflussfaktoren sind Aussagen über die zukünftige Richtung der Außenpolitik jedoch mit beträchtlichen Unsicherheiten behaftet1 – und folglich mit Vorsicht zu genießen. Zwar kann man das von Mead impliziert formulierte anspruchsvolle Anforderungsprofil an eine grand strategy kritisch betrachten: Andere Autoren verweisen gerade auf die richtungsgebende Funktion als primäre Aufgabe der höheren Strategie, welche die verschiedenen Instrumente der Sicherheitsvorsorge entsprechend der außen- und sicherheitspolitischen Zielsetzungen eines Staates oder eines Bündnisses integriert und koordiniert.2 Ungeachtet dieser unterschiedlichen Auffassungen über Funktion und Aufgabe der grand strategy stellt die Beobachtung Meads einen geeigneten Ausgangspunkt für den vorliegenden Beitrag dar, der sich mit der Frage nach den Perspektiven für gemeinsame transatlantische Anstrengungen zur Bewältigung der vielfältigen neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen und Gefahren am Ende der ersten Dekade des 1 2 Mead, Walter Russell: Power, Terror, Peace and War. America’s Grand Strategy in a World at Risk, New York 2005, S.19f. Vgl. hierfür z.B. Liddell, Hart/Basil, Henry: Strategie, Wiesbaden 1955 oder Beaufre, André: Totale Kriegskunst im Frieden. Einführung in die Strategie, Berlin 1963. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 283 21. Jahrhunderts befasst: Erstens ist Meads Verweis auf die Komplexität des Strategiefindungsprozesses geeignet, die in den vergangenen Monaten insbesondere hierzulande zu beobachtende Obamania3 dahingehend zu relativieren, dass der 44. Präsident der USA trotz seiner weitgehenden Befugnisse gerade im Bereich der Außenpolitik keineswegs autonom seine Agenda verfolgen kann. Ganz im Gegenteil ist er in ein komplexes Beziehungs- und Interessengeflecht zwischen Kongress, Medien, Lobbygruppen und politischer Kultur der USA eingebunden. Es bleibt vor diesem Hintergrund abzuwarten, wie sich Barack Obama in verschiedenen Sachfragen abschließend positioniert und vor allem, ob er hierbei den im Wahlkampf verkündeten Positionen treu bleibt bzw. bleiben kann.4 Diese Zustandsbeschreibung gilt übrigens in gleichem, wenn nicht sogar in noch höherem Maße für die europäischen Regierungen. Wenn aus der Betrachtung der Vergangenheit Einsicht in Gegenwart und Zukunft des außenpolitischen Verhaltens der USA zu erlangen sind, wie dies Mead behauptet, dann darf mit Fug und Recht zweitens ein erhebliches Maß an Kontinuität bezüglich der determinierenden Faktoren in Gestalt von Werten, Selbstverständnis und Interessen für dieses Politikfeld unterstellt werden.5 Diese gerade in Europa häufig nur unzureichend wahrgenommenen und gewürdigten Elemente der Kontinuität sind geeignet, die derzeitige Euphorie für den proklamierten change zeitnah zu relativieren, weil dieser eher gradueller Natur sein und keine fundamentale Abkehr von der bisherigen Politik der Bush-Administration markieren dürfte. Damit einher geht die Beobachtung, dass das bisherige grundsätzliche Konfliktpotenzial im transatlantischen Verhältnis mit dem Amtsantritt Obamas keineswegs verschwunden ist. Vielmehr dürfte das Gegenteil der Fall sein: Bereits zum jetzigen Zeitpunkt zeichnen sich neue mögliche Konflikte ab.6 Drittens ist an die Bedeutung situativer Einflüsse als handlungsleitende Faktoren zu erinnern. Diese können, unabhängig von der vorherigen Positionierung einer Administration, einen prägenden Einfluss und eine totale Revision, zumindest aber eine veränderte Gewichtung verschiedener Politikfelder zur Folge haben. Ohne den 11. September 2001 ist George W. Bushs 3 4 5 6 Vgl. für die weltweit insgesamt hohe Erwartungshaltung an den neuen Präsidenten: Global Public Opinion in the Bush Years (2001-2008), hrsg. von The Pew Global Attitudes Project, Washington D.C. 2008, http://pewglobal.org/ reports/pdf/263.pdf, S.15, Stand: 10.2.2009. Vgl. Braml, Josef/Sandschneider, Eberhard/Koschut, Simon: Netzwerke entscheiden. Nicht alles wird gut nach den US-Wahlen im November, DGAPStandpunkt, 11.11.2008. Vgl. Hacke, Christian: Im Spannungsfeld von Kontinuität und Wandel. Herausforderungen an Präsident Obama, in: Die Politische Meinung 54/2009, S.10-16. Vgl. Braml/Sandschneider/Koschut: Netzwerke entscheiden; siehe auch Haftendorn, Helga: Die außenpolitischen Positionen von Obama und McCain, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 37-38/2008, S.35-40; Rudolf, Peter: USAußenpolitik und transatlantische Sicherheitsbeziehungen nach den Wahlen, SWP-Aktuell 64/2008. 284 Ralph Rotte/Christoph Schwarz Selbstverständnis als War President nicht denkbar, vor allem aber deutete im Vorfeld der verheerenden Anschläge vom 11. September nichts darauf hin, dass der Global War on Terror der prägende Gegenstand seiner beiden Amtszeiten werden würde. Dementsprechend erscheint es geboten, eine skeptische Haltung gegenüber jeglichen Erwartungen an eine Kehrtwende in der amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Obama im Verhältnis zur Amtsführung seines Vorgängers zu erwarten. Gleichzeitig ist ein gradueller Wandel bereits in den programmatischen Äußerungen des damaligen Präsidentschaftskandidaten deutlich erkennbar.7 Diese Veränderungen betreffen gerade jene neuen globalen Sicherheitsrisiken, die auch von der Europäischen Union unter dem Etikett „neue Herausforderungen“ ins Zentrum ihrer 2003 erstmals veröffentlichten Europäischen Sicherheitsstrategie gestellt wurden: den inter- bzw. transnationalen Terrorismus, die mit der anhaltenden Proliferation von Massenvernichtungswaffen verbundene Bedrohung der transatlantischen Sicherheit sowie schließlich die von sogenannten „failed states“ ausgehenden Gefahren.8 Letztere sind insbesondere bei der Diskussion um wirksame Instrumente zur Stabilisierung der Lage im Irak stets präsent. Diese drei Themenkomplexe, die lediglich einen Bruchteil der unter dem erweiterten Sicherheitsbegriff subsumierten potenziellen Bedrohungen repräsentieren, werden im Folgenden in vergleichender Perspektive näher betrachtet. Dabei ist zu betonen, dass Aussagen über die Kooperationsmöglichkeiten und Konfliktpotenziale zwischen den USA und Europa noch keine Angaben darüber enthalten, wie effektiv die Anstrengungen zur Bewältigung der in Angriff genommenen Risiken und Gefahren sein werden. In diesem Zusammenhang ist auf das in den vergangenen Jahren in erster Linie mit Blick auf die Politik der Bush-Administration wiederholt beklagte Strategiedefizit – genauer: die fehlende Verknüpfung von (politischem) Zweck und (militärischen etc.) Mitteln im Clausewitz’schen Sinne – zu verweisen.9 Eine derart mangelhafte zweckrationale Ausrichtung als Grundlage für die Anwendung des außen- und sicherheitspolitischen Instrumentariums kann allerdings gleichermaßen auch der EU und ihren Mitgliedstaaten 7 8 9 Vgl. Obama, Barack: Renewing American Leadership, in: Foreign Affairs 4/2007, S.2-16. Vgl. Solana, Javier: Ein sicheres Europa in einer besseren Welt, Brüssel 2003, S.4ff. Vgl. Strachan, Hew: The lost meaning of strategy, in: Survival 3/2005, S.33-54; Ders.: Making strategy: Civil-military relations after Iraq, in: Survival 3/2006, S.59-82. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 285 zum Vorwurf gemacht werden.10 Mithin geht es nicht nur um einen grundlegenden strategischen Konsens, der zweifelsohne von fundamentaler Bedeutung ist, sondern um die instrumentelle und effektive, möglicherweise gar arbeitsteilige11 Anwendung begrenzter Ressourcen zur Realisierung eines gemeinsamen politischen Zwecks. Eine derart angeleitete Evaluierung des Kooperationspotenzials der USA und Europas könnte die Grundlage eines strategischen Dialogs zwischen beiden Seiten bilden, der mit Blick auf den gemeinsam verfolgten Zweck die beiderseitig verfügbaren Instrumente bestmöglich einzusetzen und nicht zuletzt auch zu würdigen versteht. 2. Neue Sicherheitsbedrohungen in den internationalen Beziehungen und die strategischen Antworten der USA und Europas Es ist inzwischen politisches und politikwissenschaftliches Allgemeingut geworden, dass sich mit dem Wegfall des bipolaren Systemantagonismus 1989/90 auch das internationale Bedrohungsgefüge entscheidend verändert hat. Nicht mehr die Gefahr eines von antagonistischen Bündnissystemen unter Einsatz von Atomwaffen ausgetragenen zwischenstaatlichen Krieges beherrschte in der Folgezeit die Bedrohungswahrnehmung, vielmehr traten neue Herausforderungen als Sicherheitsrisiken sowie Konflikt- und Kriegsursachen hinzu.12 Das erweiterte Verständnis von Sicherheit trägt dieser Entwicklung durch die Integration einer Vielzahl nicht-militärischer Faktoren sowie neuer Formen militärischer Bedrohungen Rechnung, die neben die „klassischen“ staatszentrierten militärischen Szenarien treten. Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass diese traditionellen Bedrohungsmuster beispielsweise in Gestalt zwischenstaatlicher Kriege zunehmend an Bedeutung verlieren13, hat sich gerade im Verlaufe der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts das genaue Gegenteil als zutreffend herausgestellt: Aktuell kann man daher mit Fug und Recht davon sprechen, dass „klassische“ und neue Bedrohungen nationaler und internationaler Sicherheit parallel existieren. 10 11 12 13 Mit Blick auf Deutschland vgl. z.B. Krause, Joachim: Auf der Suche nach einer grand strategy. Deutsche Sicherheitspolitik seit der Wiedervereinigung, in: Internationale Politik 8/2005, S.16-25 sowie Rotte, Ralph/Schwarz, Christoph: Wo ist die Strategie? Anmerkungen CDU/CSU-Entwurf „Eine Sicherheitsstrategie für Deutschland“, in: Liberal 3/2008, S.36-41. Bahr, Egon: Plädoyer für eine transatlantische Arbeitsteilung, in: Transatlantische Beziehungen. Sicherheit – Wirtschaft – Öffentlichkeit, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse und Kai Oppermann, Wiesbaden 2005, S.489-496. Vgl. Frank, Hans: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen, in: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen, hrsg. von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Hamburg u.a. 2001, S.15-30, hier Abb.3 auf S.26. Vgl. Münkler, Herfried: Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie, Weilerswist 2006, S.27ff.; ähnlich auch Etzersdorfer, Irene: Krieg. Eine Einführung in die Theorien bewaffneter Konflikte, Wien u.a. 2007, S.7. 286 Ralph Rotte/Christoph Schwarz Fällt das Aufkommen des erweiterten Sicherheitsverständnisses zeitlich mit dem Ende des Kalten Krieges zusammen, so ist es nicht unproblematisch, die damit an Bedeutung gewinnenden sicherheitsrelevanten Entwicklungen weiterhin als „neu“ zu bezeichnen. Neu sind keinesfalls die Bedrohungen an sich – Terrorismus ist als Gewaltphänomen bereits aus dem Altertum bekannt.14 Was sich in der Tat verändert hat, ist einerseits die Qualität der Bedrohung, beispielsweise die am 11. September 2001 nachdrücklich demonstrierte Fähigkeit terroristischer Akteure zur fast simultanen, massenhaften Vernichtung von Menschenleben. Daraus resultiert andererseits eine Akzentverschiebung hinsichtlich der Prioritäten nationaler und internationaler Sicherheitspolitik: Als Folge von 9/11 ist der inter- bzw. transnationale Terrorismus als eine der zentralen, wenn nicht die herausragende Sicherheitsbedrohung identifiziert worden..15 Schließlich zählen die vielfach zu beobachtenden Interdependenzen zwischen den verschiedenen Sicherheitsrisiken – beispielsweise zwischen organisierter Kriminalität und Terrorismus – zu den zentralen Merkmalen der aktuellen Entwicklung. Insbesondere der letztgenannte Aspekt führt direkt zu einem Problemkomplex, dem in der bisherigen Rezeption des erweiterten Sicherheitsbegriffs und der dabei geäußerten Kritik zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Es handelt sich um das Problem der Operationalisierung, hier verstanden als Schwierigkeit der Anpassung der strategischen Ausrichtung nationaler und internationaler Außen- und Sicherheitspolitik an das erheblich komplexere Bedrohungsumfeld. Auch wenn die entsprechenden Primärdokumente staatlicher Akteure und internationaler Organisationen wie z.B. der NATO das veränderte Bedrohungsumfeld würdigen, so bleiben sie in der Regel den Nachweis der Verknüpfung dieser veränderten Rahmenbedingungen mit dem praktizierten operativ-taktischen Vorgehen16 schuldig. Anders ausgedrückt unterstreicht die erheblich komplexere Bedrohungslage nach dem Ende der Blockkonfrontation die Notwendigkeit für eine verstärkte Anwendung des Konzepts der grand strategy, also einer Außenpolitik, die das gesamte Mittelspektrum der Sicherheitsvorsorge in Abhängigkeit von einem klar definierten, richtungsgebenden Zweck einsetzt. 14 15 16 Mead: Power, Terror, Peace and War, S.3. Vgl. The National Security Strategy of the United States of America, hrsg. von The White House, Washington 2002; The National Security Strategy of the United States of America, hrsg. von The White House, Washington 2006; Solana: Ein sicheres Europa; The National Security Strategy of the United Kingdom. Security in an interdependent world, hrsg. von Cabinet Office, London 2008; schließlich: Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland und zur Zukunft der Bundeswehr, hrsg. vom Bundesministerium der Verteidigung, Berlin 2006. Dieses wird hier nicht im rein militärischen Sinne verstanden, sondern in Übereinstimmung mit der Auffassung Beaufres für den gesamten militärischen und nicht-militärischen Bereich außenpolitischen Handelns. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 287 Dieser Aspekt macht die Kritik an der amerikanischen Außenpolitik bis zum 11. September 2001 verständlich, wie sie Walter Russell Mead in seiner Etikettierung der Dekade als „verlorene Jahre“ unmissverständlich formuliert.17 Auch für die Zeit nach den Anschlägen von New York und Washington gilt die von Joseph Nye gemachte Beobachtung, dass die USA es nicht verstanden hätten, „hard“ und „soft power“ ausgewogen zur Anwendung zu bringen.18 Unmittelbar an diesen Punkt knüpft auch die Kritik Barack Obamas an der Anti-Terror-Politik seines Amtsvorgängers an, wenn er schreibt: „The Bush administration responded to the unconventional attacks of 9/11 with conventional thinking of the past, largely viewing problems as statebased and principally amenable to military solutions.“19 Obama selbst, aber auch die Europäer, werden sich daran messen lassen müssen, in wieweit sie, ausgehend von einer hinreichenden Analyse des Bedrohungsumfeldes bzw. der berechtigten Kritik an der Politik der Bush-Administration, die richtigen Schlüsse für ihre außenund sicherheitspolitische Praxis im Umgang mit neuen Herausforderungen in den kommenden Jahren ziehen werden. Anhand der drei bereits angesprochenen Themenkomplexe – der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus, die von „failed states“ und schließlich von der Proliferation von Massenvernichtungswaffen ausgehenden Gefahren – lässt sich das Kooperations-, aber auch das Konfliktpotenzial in den transatlantischen Beziehungen in den kommenden Jahren exemplarisch untersuchen. Die Verknüpfung des jeweiligen sicherheitspolitischen Themenfeldes mit einem konkreten Fallbeispiel erleichtert es hierbei, konkreten Handlungsbedarf zu identifizieren: So stellt Afghanistan unzweifelhaft den Hauptschauplatz in der Auseinandersetzung mit dem transnationalen Terrorismus dar. Die nach wie vor nicht vollständig und dauerhaft stabilisierte Lage im Irak lässt plastisch die aus Staatszerfall resultierenden Gefahren deutlich werden. Schließlich dokumentiert das anhaltende Bestreben der iranischen Regierung, trotz des Widerstandes der internationalen Gemeinschaft in den Besitz von Nuklearwaffen zu gelangen, nachdrücklich die Notwendigkeit einer effektiven Nichtverbreitungspolitik. 17 18 19 Mead: Power, Terror, Peace and War, S.3. Nye, Jose ph S. Jr.: Soft Power and Smart Power. The United States has forgotten how to use soft power, in: Internationale Politik, Transatlantic Edition, 3/2006, S.10-13. Vgl. Obama: Renewing American Leadership, S.4. 288 Ralph Rotte/Christoph Schwarz 3. Afghanistan und die Auseinandersetzung mit dem transnationalen Terrorismus Der Kollaps der New Yorker Zwillingstürme markierte den definierenden Moment der beiden Amtszeiten George W. Bushs.20 Die Bekämpfung des transnationalen Terrorismus stand fortan nicht nur unumstritten im Zentrum der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik, als Konsequenz der Anschläge vom 11. September 2001 erfolgte insgesamt „a fundamental reorientation of foreign policy“21, in den Augen Ivo Daalders und James Lindsays gar eine „Bush-Revolution“22, die mit den zentralen traditionellen Eckpunkten für das internationale Engagement der USA brach. Die anfängliche weltweite Solidarität mit den USA wich in zunehmendem Maße Skepsis, die sich schließlich im Vorfeld des Irakkrieges von 2003 aufseiten der Achse Paris-Berlin-Moskau-Peking in Fundamentalopposition verwandelte. Ursache und gleichzeitiger Gegenstand der seinerzeitigen Auseinandersetzung waren jedoch nicht in erster Linie die bereits deutlich gewordenen strategischen Defizite des Konzepts eines „global war on terror“23, vielmehr dominierten die unterschiedlichen Vorstellungen über die Ausgestaltung der internationalen Ordnung die politische Agenda. Nicht zuletzt spielte seitens der genannten Staaten auch das Gefühl einer machtpolitischen Marginalisierung angesichts einer augenscheinlich entfesselten „Hypermacht“ USA eine Rolle. Zweifelsohne war die Kritik an der Verknüpfung des Kriegs gegen den internationalen Terrorismus mit dem Bestreben eines Regimewechsels in Bagdad aufgrund der nicht vorhandenen Verbindungen Saddam Husseins zum Terrornetzwerk Osama bin Ladens berechtigt. Gleichzeitig ist jedoch festzuhalten, dass sich das „alte Europa“ dem notwendigen Diskurs über strategische Fragen nicht in ausreichendem Maß gestellt hat – dies gilt sowohl für die Debatte zwischen den transatlantischen Partnern als auch für die innereuropäische und schließlich auch für die innergesellschaftliche Diskussion in den genannten Staaten.24 Die notwendige transatlantische Grundsatzdebatte, wie die Auseinandersetzung mit dem transnationalen Terrorismus zu führen ist, lässt bis heute 20 21 22 23 24 Vgl. Staack, Michael: Die Außenpolitik der Bush-Administration, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 37-38/2008, S.7. Ikenberry, G. John.: American Grand Strategy in the Age of Teror, in: Survival 4/2001, S.19. Daalder, Ivo/Lindsay, James: America Unbound. The Bush Revolution in Foreign Policy, Washington 2003. Vgl. hierzu z.B. Howard, Michael: What’s in a Name? How to Fight Terrorism, in: Foreign Affairs 1/2002, S.8-13. Vgl. Jäger, Thomas: Ordnung, Bedrohung, Identität: Grundlagen außenpolitischer Strategien, in: Die Sicherheitsstrategie Europas und der USA. Transatlantische Entwürfe für eine Weltordnungspolitik, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse und Kai Oppermann, Baden-Baden 2005, S.24. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 289 auf sich warten. Dies muss vor allem angesichts des nahezu einmütigen Bekenntnisses in fast allen relevanten Primärdokumenten verwundern, die sämtlich im Terrorismus eine der, wenn nicht gar die zentrale sicherheitspolitische Herausforderung der Gegenwart sehen. Zudem sind auch die Europäer seit Jahren in beachtlichem Maße materiell und personell in der Bekämpfung des Terrorismus engagiert und tragen dabei zum Teil erhebliche Kosten, nicht zuletzt in Bezug auf eigene militärische Verluste. Den Kern des überfälligen strategischen Diskurses sollten Fragen danach bilden, in welchem Verhältnis militärische und zivile Mittel zur Anwendung kommen sollen, was der eigentlich determinierende politische Zweck ist, den es zu erreichen gilt, und schließlich, wer der eigentliche Gegner ist. In all diesen Punkten hat die Politik der Bush-Administration gravierende Defizite erkennen lassen. Nicht nur wurde dem Phänomen Terrorismus und nicht einer oder mehreren terroristischen Organisationen der Krieg erklärt, wobei zwangsläufig unklar bleiben musste, wie der zu erringende Sieg aussehen sollte.25 Auch in Bezug auf die avisierte breitgefächerte Anwendung des staatlichen Instrumentariums zur Bekämpfung des Terrorismus blieb die amerikanische Regierung vieles schuldig – nicht zuletzt aufgrund der selbst verschuldeten Eröffnung einer „zweiten Front“ im Irak, die diesen entgegen den Behauptungen des Präsidenten und seiner Vertrauten erst mit der Intervention einer „Koalition der Willigen“ zum Schauplatz der Auseinandersetzung werden ließen. Diese Fehleinschätzungen und Versäumnisse erscheinen gerade vor dem Hintergrund der Kernaufgabe strategischen Handelns, die in der Herstellung einer Balance zwischen verfolgtem Zweck und verfügbaren Ressourcen besteht, als unentschuldbar. Im Fall der Europäer stellt sich die Problematik genau umgekehrt dar: Zwar sind ihre zivilen Fähigkeiten und das Bewusstsein um die Notwendigkeit eines das gesamte Mittelspektrum integrierenden Vorgehens ausgeprägter, als dies bei den USA in den vergangenen Jahren der Fall war. Gleichzeitig lassen die militärischen Projektionsfähigkeiten der europäischen Streitkräfte nach wie vor zu wünschen übrig. Das stellt auch das Europäische Parlament in seiner Entschließung zur Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) fest.26 Schwer wiegt auch die unzureichende Verknüpfung von Bedrohungsanalyse und Mittelansatz in der ESS: Eine kohärente Umweltanalyse gibt keine Antwort auf die Frage, wann die Bedingungen für ein Eingreifen erfüllt sind, noch darüber, gegen wen sich ein derartiges Vorgehen richtet und an welchem Ort es erfolgt. Schließlich bedarf es einer konzisen Interessendefinition als Messgröße für Erfolg und Misserfolg 25 26 The National Security Strategy of the United States of America, hrsg. von The White House, Washington 2002, S.5ff. Vgl. P6_TA-PROV(2008)255, S.8f; Merkel, Angela/Sarkozy, Nicolas: Wir Europäer müssen mit einer Stimme sprechen, in: Süddeutsche Zeitung, 4.2.2009, S.9. 290 Ralph Rotte/Christoph Schwarz eines Engagements, die man in der ESS ebenfalls vergeblich sucht.27 Insgesamt offenbaren Europa und die USA in Bezug auf die Verknüpfung von Zweck und Mitteln in den vergangenen Jahren ähnliche Defizite, wie ein Blick auf die beiden unter George W. Bush veröffentlichten Nationalen Sicherheitsstrategien belegt.28 Mit dem Amtsantritt Obamas scheinen auf den ersten Blick die Grundlagen für eine Annäherung hinsichtlich der Strategie und insbesondere der Taktiken zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus gegeben. Der neue amerikanische Präsident sieht in Afghanistan und Pakistan die entscheidenden Orte der Auseinandersetzung29, eine Einschätzung, welche die Europäer teilen. Auch versteht Obama die Notwendigkeit, eine Strategie zu entwickeln, die sich in Abhängigkeit von der zu bewältigenden Herausforderung des gesamten staatlichen Mittelspektrums bedient.30 Diese Einschätzung hat auch bereits ein Echo beim einzig verbliebenen Minister der Bush-Administration im neuen Kabinett gefunden: So betont Verteidigungsminister Gates in einem bemerkenswerten Beitrag folgenden Sachverhalt: „[...] What the military calls kinetic operations should be subordinated to measures aimed at promoting better governance, economic programs that spur development, and efforts to address the grievances among the discontended, from whom the terrorists recruit.“31 Neben dieser Aufwertung nicht-militärischer Instrumente plant die neue Administration in Bezug auf Afghanistan unter anderem eine Truppenaufstockung durch eine schrittweise Verlegung von Kontingenten aus dem Irak, einen forcierten Aufbau afghanischer Sicherheitsbehörden sowie schließlich eine stärkere Inanspruchnahme Pakistans zur Unterstützung des Anti-Terror-Kampfes.32 Während diese Maßnahmen auch vonseiten der Europäer mitgetragen werden können, enthält die von Vizepräsident Biden auf der Münchener Sicherheitskonferenz Anfang Februar 2009 zum wiederholten Mal geäußerte Forderung der USA33 nach Aufgabe nationaler Vorbehalte seitens verschiedener NATO-Staaten beträchtliches Konfliktpotenzial. In diesem 27 28 29 30 31 32 33 Vgl. ebd., S.4f. Vgl. Daalder, Ivo H./Lindsay, James M./Steinberg, James B.: The Bush National Security Strategy: An Evaluation, in: Die Sicherheitstrategien Europas und der USA. Transatlantische Entwürfe für eine Weltordnungspolitik, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse und Kai Oppermann, Baden-Baden 2005, S.27. Vgl. Obama: Renewing American Leadership, S.9. Vgl. ebd., S.11. Gates, Robert M.: Balanced Strategy. Reprogramming the Pentagon for a New Age, in: Foreign Affairs 1/2009, S.28-40, hier S.30. Vgl. Rudolf, Peter: Amerikas globaler Führungsanspruch. Außenpolitik unter Barack Obama, SWP-Aktuell 77, November 2008, S.7. Vgl. Frankenberger, Klaus-Dieter: Neuanfang über den Atlantik hinweg, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.2.2009, S.1. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 291 Punkt wird sich zeigen, ob die Europäer und hier vor allem Deutschland zu einer Enttabuisierung des Diskurses in Bezug auf den Einsatz militärischer Mittel zur Realisierung politischer Ziele, mithin zu einer wirklichen strategischen Diskussion, willens und fähig sind. Angesichts der bereits im Vorfeld des Irakkrieges von 2003 deutlich gewordenen unterschiedlichen Bedrohungswahrnehmungen, vor allem jedoch der divergierenden Bereitschaft in der amerikanischen und europäischen Bevölkerung, auftretenden Bedrohungen präventiv und vor Ort zu begegnen, ist hier prinzipiell Skepsis angebracht. Das post-heroische Element scheint entgegen einer in der Forschung wiederholt implizit unterstellten gleichen Qualität34 in Europa tendenziell stärker ausgeprägt zu sein als in den USA. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, läuft das „alte Europa“ tatsächlich mittelfristig Gefahr, endgültig zu einem nachrangigen Partner der USA in Fragen internationaler Krisen- und Konfliktbearbeitung zu werden. Paradoxerweise könnte damit eine Befürchtung, die bereits während der Amtsjahre von Präsident Bush jr. kursierte, unter dem hoffnungsfroh erwarteten Barack Obama bittere Wahrheit werden. 4. Irak und die Gefahren im Zusammenhang mit „failed states“ Eines der Kernelemente der Nationalen Sicherheitsstrategien von Präsident Bush war es, die „Infrastruktur der Demokratie“35 weltweit auszubauen. Zumindest mit Blick auf die aktuelle Lage im Irak und in Afghanistan ist zu sagen, dass der Demokratieexport mittels eines militärisch durchgesetzten Regimewechsels die erhoffte Wirkung bisher verfehlt hat. Dieses Urteil gilt zumindest dann, wenn man unter Demokratisierung mehr versteht als die Durchführung nationaler Wahlen. Mehr noch: Der Krieg gegen den Irak hat wie kein Ereignis in den vergangenen Jahrzehnten dazu beigetragen, das amerikanische Ansehen in der Welt zu unterminieren, hat darüber hinaus mit Blick auf das regionale Gleichgewicht den Iran nachdrücklich gestärkt36 und Ressourcen vom eigentlichen Kampf gegen den transnationalen Terrorismus abgezogen sowie zu einem handfesten Streit mit den traditionellen Hauptverbündeten jenseits des Atlantiks geführt. Dies sind nur einige der Kollateralschäden, die mit der Ausnutzung des durch 9/11 gewährten „moment of opportunity“ (George W. Bush) verbunden sind.37 Unter der hier untersuchten Fragestellung sticht 34 35 36 37 Vgl. Münkler: Der Wandel des Krieges, S.310ff. The National Security Strategy of the United States of America, 2002, S.21. Carpenter, Ted Galen/Innocent, Malou: The Iraq War and Iranian Power, in: Survival 4/2007-08, S.67, ähnlich auch Staack: Die Außenpolitik der BushAdministration, S.11. Vgl. Allin, Dana H.: American Power and Allied Resraint: Lessons of Iraq, in: Survival 1/2007, S.128. 292 Ralph Rotte/Christoph Schwarz insbesondere der Punkt ins Auge, dass durch den Sturz des despotischen Regimes Saddam Husseins und des darauffolgenden katastrophalen Missmanagements des Wiederaufbaus seitens der USA38 der Irak nach wie vor Gefahr läuft, zu einem weiteren Fallbeispiel für einen „failed state“ zu werden. Gerade wenn man gewillt ist, der Theorie eines „positiven Dominoeffekts“ im Nahen und Mittleren Osten als Folge einer Demokratisierung des Irak Glauben zu schenken, muss die Lageentwicklung im Zweistromland bis zur zumindest temporären Stabilisierung durch die massive Truppenaufstockung im Jahre 2007 und den Seitenwechsel lokaler Clanchefs als eindrücklicher Nachweis strategischer Inkompetenz seitens der amerikanischen Führung erscheinen. Mit Barack Obama sehen sich die Europäer nun einem Präsidenten gegenüber, der wie die meisten der „alten Europäer“ von Anfang an gegen den Irakkrieg votierte. Daher überrascht es nicht, dass es das erklärte Ziel Obamas ist, diesen Krieg zu beenden.39 Im Zentrum der betreffenden Planungen steht die schrittweise Verlegung amerikanischer Streitkräfte vornehmlich nach Afghanistan. Auf diese Weise soll Druck auf die irakischen Behörden und die verschiedenen ethnischen Gruppen ausgeübt werden, eine tragfähige politische Ordnung zu etablieren. Bei einem planmäßigen Verlauf könnte die Truppenverlegung bis 2010 beendet sein, es verblieben lediglich einige Einheiten zur Terrorismusbekämpfung.40 Auch wenn die Einsicht, dass es keine rein militärische Lösung der Situation im Irak geben kann, plausibel ist, beinhaltet das skizzierte Vorgehen fundamentale Risiken mit Blick auf die (In-)Stabilität des Irak nach dem Ende der amerikanischen Präsenz. Zwar hat sich Obama die Möglichkeit vorbehalten, die Stationierungspraxis bei einer Verschlechterung der Situation vor Ort neu auszurichten. Toby Dodge hat jedoch in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass dieser Vorbehalt in erster Linie amerikanischen Interessen und nicht etwa der Stabilität des Irak geschuldet sei. Damit besteht nach wie vor die Gefahr, dass der Irak in einer neuerlichen Welle ethnischer Gewalt versinken könnte und im Ergebnis ein „failed state“ ohne Zentralgewalt und Kontrolle der Regierung über weite Landesteile entsteht. Angesichts dieser zumindest im Bereich des Möglichen liegenden Entwicklung erscheint das bisherige Schweigen der Europäer verwunderlich, insbesondere wenn man bedenkt, dass „gescheiterte Staaten“ in der ESS 38 39 40 Vgl. Ricks, Thomas: Fiasco. The American Military Adventure in Iraq, London/New York 2006; Woodward, Bob: Die Macht der Verdrängung. George W. Bush, das Weiße Haus und der Irak. State of Denial, München 2008. Vgl. Dodge, Toby: Iraq and the Next American President, in: Survival 5/2008, S.45. Vgl. Obama: Renewing American Leadership, S.5. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 293 gemeinsam mit Terrorismus und der Proliferation von Massenvernichtungswaffen zu den herausragenden neuen Bedrohungen gezählt werden. Explizit wird in der ESS darauf verwiesen, dass sich aus der Verbindung von Terrorismus, der Verfügbarkeit von Massenvernichtungswaffen und scheiternden Staaten eine „sehr ernste Bedrohung“41 für Europa ergeben könne. Auch im „Bericht über die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie“ werden die aus fragiler Staatlichkeit resultierenden Gefahren neuerlich betont.42 Warum, so ist an dieser Stelle zu fragen, wird der Irak nach wie vor als ein rein amerikanisches, vielleicht noch britisches Problem betrachtet, wenn auch die europäischen Staaten gleichermaßen von negativen Effekten eines gescheiterten Wiederaufbaus betroffen wären? Zugegeben, die EU hat sich beispielsweise im Rahmen der Mission EUJUST LEX am Wiederaufbau beteiligt. Aber dies reicht schwerlich aus, um für die Zukunft eine funktionierende Staatlichkeit im Irak zu gewährleisten. Begrenzte Ressourcen einerseits und die potenzielle Unmöglichkeit, ein verstärktes Engagement im Irak nach der Opposition gegen das Vorgehen der seinerzeitigen amerikanischen Regierung innenpolitisch zu rechtfertigen, sind sicherlich gewichtige Erklärungsfaktoren für das passive Verhalten der europäischen Regierungen. Gleichzeitig verweist die Tatsache, dass zusätzliche Anstrengungen seitens dieser Staatengruppe nicht einmal zur Debatte stehen, auf ein mangelhaftes Verständnis der strategischen Problemdimension: Zwar sind die USA und ihre Koalitionspartner die Verursacher der derzeitigen Instabilität und der daraus resultierenden Gefahren, aber die Folgen werden Urheber und Unbeteiligte gleichermaßen zu tragen haben. Folglich sollten beide Akteursgruppen bestrebt sein, ihre Fähigkeiten zur Abwehr der Gefahr anzuwenden. Gerade im Falle des Irak könnten sich die von der EU nach Ansicht verschiedener Autoren in die Waagschale zu werfenden Fähigkeiten gewinnbringend auswirken. Letztere umfassen neben den ausgeprägten zivilen Fähigkeiten einen Legitimitätszuwachs für das Wiederaufbauprojekt, der bereits aus der bloßen Teilhabe der Europäischen Union resultiert, sowie schließlich die aus der Partizipation resultierende Möglichkeit, Einfluss auf die USA auszuüben.43 Angesichts der unsicheren Erfolgsaussichten der aktuellen amerikanischen Planungen erscheint es dringend angezeigt, sich die Möglichkeit zu einem strategisch ausgerichteten Dialog mit Washington zu erhalten, wenn nötig auch durch Engagement in einem Projekt, dem man von Anfang an ablehnend gegenüberstand. 41 42 43 Vgl. Solana: Ein sicheres Europa, S.6. Vgl. Solana, Javier: Bericht über die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie. Sicherheit schaffen in einer Welt im Wandel, S407/08, Dezember 2008, S.8. Vgl. Allin: American Power, S.133. 294 Ralph Rotte/Christoph Schwarz 5. Iran und die Zukunft der Nichtverbreitungspolitik In Afghanistan besteht ein signifikantes Konfliktpotenzial zwischen Europa und den USA, mit Blick auf den Irak ist eine engere Zusammenarbeit der transatlantischen Verbündeten mit dem gemeinsamen Ziel der dauerhaften Stabilisierung des Landes nicht in Sicht. Wie steht es um die Kooperationsmöglichkeit und -wahrscheinlichkeit in Bezug auf das letzte hier betrachtete Problemfeld der Proliferation nuklearer Waffen und Trägersysteme? Kaum ein Begriff dokumentiert die anhaltende Relevanz nuklearer Waffensysteme als Instrument staatlicher Sicherheitsvorsorge und damit gleichzeitig die Bedeutung von Anstrengungen zur Begrenzung und Abrüstung in diesem Bereich nachdrücklicher als jener des „Second Nuclear Age“.44 Atomare Waffen sind entgegen vielfacher Hoffnungen mit dem Ende des Kalten Krieges keineswegs obsolet geworden: Die langsam, aber stetig zunehmende Zahl nuklear bewaffneter Staaten und das damit einhergehende wachsende Proliferationsrisiko, welches es als möglich erscheinen lässt, dass terroristische Akteure in den Besitz derartiger Waffensysteme gelangen, sowie die insgesamt schleppende Abrüstung der existierenden Arsenale lassen die Frage der Zukunft der Nichtverbreitungspolitik vielmehr aktueller denn je erscheinen.45 Das Streben des Iran, selbst zur Nuklearmacht zu avancieren, steht gegenwärtig im Zentrum der internationalen sicherheitspolitischen Agenda. Auch in diesem Politikfeld fällt die Bilanz der aus dem Amt geschiedenen amerikanischen Regierung nach Ansicht deutscher Kommentatoren vernichtend aus. Harald Müller spricht angesichts der amerikanischen Rüstungsanstrengungen zur Aufrechterhaltung einer „full spectrum dominance“ vom „amerikanischen Überlegenheitswahn“46, Michael Staack stellt in seiner kurzen außenpolitischen Bilanz der Bush-Administration für den Bereich der Rüstungspolitik ebenfalls ein vernichtendes Zeugnis aus, wenn er schreibt: „Bush [strebte, R.R/C.S.] nach umfassender militärischer, insbesondere nuklearer Überlegenheit als Grundlage der unipolaren Machtstellung der USA, löste sich von Verträgen, die diesem Ziel entgegenstanden, und wollte die Proliferation von Massenvernichtungswaffen mit allen Mitteln verhindern.“47 So berechtigt die Kritik an der einseitigen Kündigung des ABM-Vertrags oder den doppelten Standards 44 45 46 47 Gray, Colin S.: The Second Nuclear Age, Boulder CO 1999. Vgl. Baylis, John: The Role of Nuclear Weapons in Contemporary Strategic Thought, in: International Security and War. Policy and Grand Strategy in the 21st Century, hrsg. von Ralph Rotte und Christoph Schwarz, New York 2009 (i.E.). Müller, Harald: Wie kann eine neue Weltordnung aussehen? Wege in eine nachhaltige Politik, Bonn 2008, S.182. Staack: Die Außenpolitik der Bush-Administration, S.11. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 295 hinsichtlich der Interpretation des Nichtverbreitungsvertrags sein mag, sie verstellt zumindest teilweise den Blick auf Kontinuitätselemente in der amerikanischen Nuklearstrategie, vor allem den ungebrochen hohen Stellenwert atomarer Waffen während der gesamten Phase nach der Zeitenwende von 1989/90. Zudem zeichnet sich gerade die Diskussion um die amerikanischen Stationierungspläne eines Raketenabwehrschirms in Europa durch eine merkwürdige Asymmetrie aus, welche die russischen Vorbehalte gegenüber einem derartigen System nicht mit den machtpolitischen Motiven Moskaus verknüpft, sondern vornehmlich auf die Aufhebung der bisherigen Abschreckung abstellt.48 Unter strategischen Gesichtspunkten hat sich die amerikanische Politik zur Eindämmung der Proliferation atomarer Waffensysteme allerdings in der Tat nicht bewährt: Auch wenn man im Falle Libyens argumentieren kann, dass die nachdrückliche Demonstration des amerikanischen Willens zu militärischer Intervention an Hand des Irakkrieges von 2003 eine Rolle bei der Suspendierung des libyschen Atomprogramms gespielt hat, so bietet sich in Bezug auf Nordkorea und den Iran ein anderes Bild. Die Botschaft scheint zu lauten, so schnell als möglich in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen, während die USA noch an anderen Schauplätzen gebunden sind. Der Irakkrieg hat sich gerade im Hinblick auf das Ziel, einen nuklear bewaffneten Iran zu verhindern, nachteilig ausgewirkt. Ohne den Nachbarstaat wird kaum eine tragfähige Lösung im Zweistromland zu erreichen sein, daher wird die Führung in Teheran bestrebt sein, Kooperationsbereitschaft mit Blick auf den Irak mit Forderungen nach Akzeptanz seines Nuklearprogramms zu verknüpfen.49 Vergleicht man die Positionen des neuen amerikanischen Präsidenten mit denen der transatlantischen Verbündeten, so wird schnell klar, dass im Politikfeld Rüstungskontrolle und Nichtverbreitungspolitik das größte Maß an Übereinstimmung in Bezug auf die hier betrachteten Fallbeispiele herrscht. Obamas Pläne sind insgesamt als äußerst ehrgeizig zu bewerten: Die Sicherstellung sämtlicher nuklearer Materialien, die sich im Umlauf befinden, innerhalb von vier Jahren sowie das Bestreben, die gesamte Welt zur atomwaffenfreien Zone zu machen, stellen Ziele dar, die kaum höher gesteckt sein könnten. Selbst nachdrückliche Verfechter einer vollständigen Abschaffung derartiger Waffensysteme wie der bereits angesprochene Harald Müller betonen den langfristigen Zeithorizont eines derartigen Projekts, der selbst zwei mögliche Amtszeiten des Präsidenten Obama bei 48 49 Vgl. Bitter, Alexander: „Star Wars„ revisited? The Impact of Missile Defense on Strategic Thinking, in: International Security and War. Policy and Grand Strategy in the 21st Century, hrsg. von Ralph Rotte und Christoph Schwarz, New York 2009 (i.E.). Vgl. Carpenter/Innocent: The Iraq War, S.71f. 296 Ralph Rotte/Christoph Schwarz Weitem überschreitet.50 Darüber hinaus dürften die Europäer mit Genugtuung die avisierten Bestrebungen der neuen amerikanischen Regierung registrieren, die Bedeutung des Nichtverbreitungsvertrags neuerlich zu stärken. Über das Politikfeld der Rüstungskontrolle hinaus weckt diese Absicht Hoffnung darauf, dass die Stellung des internationalen Rechts und internationaler Institutionen durch die jetzige amerikanische Regierung allgemein gestärkt wird. Herrscht beiderseits des Atlantiks Einigkeit über die grundsätzlichen Ziele der Rüstungskontrollpolitik – auch wenn die abschließende Haltung der europäischen Nuklearmächte, insbesondere Frankreichs, zu einer völligen atomaren Abrüstung erst noch zu klären wäre –, so kann auch in Bezug auf den Umgang mit dem Iran ein hohes Maß an Übereinstimmung festgestellt werden. Vor dem Hintergrund der fortgesetzten Weigerung Teherans, seine Bemühungen um die Nutzung der Kernenergie strikt auf zivile Zwecke zu beschränken, haben auch die europäischen Regierungen trotz des grundsätzlichen Festhaltens an einer diplomatischen Lösung eine Verschärfung des Sanktionsregimes angedroht. Auch wenn der gegenwärtige Zustand insgesamt „eine unhaltbare Situation“ darstellt, haben die Europäer bisher nicht offen mit der Androhung militärischer Gewalt gedroht.51 Anders die amerikanische Regierung, die sich nach wie vor die Möglichkeit eines Waffengangs offenhält, um einen nuklear bewaffneten Iran zu verhindern. Tatsächlich kann es sich Präsident Obama leisten, in erster Linie eine Verhandlungslösung anzustreben und im Verhältnis hierzu die Drohkulisse verhältnismäßig klein zu halten. Ursächlich hierfür ist die Gewissheit, dass Israel unter keinen Umständen einen iranischen Atomstaat zulassen wird und über die hierfür notwendigen militärischen Projektionsfähigkeiten verfügt. Indes stellt die amerikanische Bereitschaft, Gespräche mit Teheran ohne Vorbedingung aufnehmen zu wollen, eine auch vonseiten der Europäer begrüßte Kursänderung dar, die zudem geeignet ist, die iranische Regierung unter Druck zu setzen. In diesem Sinne kann man dieses Angebot auch als Testballon der US-amerikanischen Führung verstehen, die einerseits die Verhandlungsbereitschaft Teherans, andererseits die prinzipielle Eignung multilateraler Verfahren zur Erzielung einer diplomatischen Lösung prüfen will. Insgesamt deutet sich damit für den Bereich der Nichtverbreitungspolitik ein verändertes Sicherheitsverständnis seitens der USA an, demzufolge Sicherheit durch eine schrittweise Verringerung der Bedrohung mittels wechselseitiger Abrüstung und nicht länger durch einen uneinholbaren qualitativen und quantitativen Vorsprung im Bereich der militärischen Rüstung erreicht werden soll – auch wenn die Bereitschaft zur Aufgabe der Nuklearwaffen nicht nur an die praktisch schwierig herzustellende 50 51 Vgl. Müller: Wie kann eine neue Weltordnung ausssehen?, S.183. Vgl. Merkel/Sarkozy: Wir Europäer müssen mit einer Stimme sprechen, S.9. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 297 verlässliche, d.h. verifizierbare Gegenseitigkeit aller Staaten gebunden wäre, sondern sich implizit auch auf das gewaltige konventionelle Übergewicht der USA gegenüber allen anderen Akteuren des internationalen Systems stützt. Es wäre jedoch ein Fehlschluss, wenn man diesen change als prinzipielle Hinwendung zum Multilateralismus interpretieren würde. Es handelt sich auch in diesem Fall vielmehr um einen instrumentellen Multilateralismus, der auf der Annahme wechselseitiger Zugeständnisse aufbaut. Wird diese Erwartung enttäuscht, wird Washington seine handlungsleitenden Interessen auf anderen Wegen verfolgen. 6. Fazit: Skepsis ist angebracht – vorsichtige Zuversicht auch Hinsichtlich des transatlantischen Kooperations- und Konfliktpotenzials mit Blick auf die Bewältigung neuer sicherheitspolitischer Herausforderungen und Bedrohungen fällt das Ergebnis ambivalent aus. Zwar besteht aufgrund des in Umrissen bereits erkennbar graduellen Wandels die Möglichkeit einer neuerlichen Annäherung zwischen den Verbündeten. Gleichzeitig darf das teils beträchtliche Konfliktpotenzial nicht übersehen werden, das erst als Folge des Amtsantritts Obamas und dem darauffolgenden Politikwechsel entsteht. Dieser Zusammenhang wird am Beispiel der anstehenden Diskussion um eine Anpassung der transatlantischen Lastenteilung in Afghanistan deutlich. Die bekannten gesellschaftlichen und politischen Vorbehalte gegenüber einem noch weiter gehenden Engagement am Hindukusch in einigen Mitgliedstaaten der NATO sowie die offensichtlich unzureichenden Fähigkeiten dieser Akteure richten den Blick auf das derzeitige Kernproblem der transatlantischen Partnerschaft: Trotz einer nahezu gleichlautenden Bedrohungsanalyse durch die Politik sieht sich diese einerseits als Folge der divergierenden innenpolitischen Bedrohungswahrnehmung in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Die Auffassung des damaligen Verteidigungsministers Struck, dass Deutschland am Hindukusch verteidigt wird, hat sich bisher in der deutschen Öffentlichkeit nicht durchsetzen können.52 Andererseits differieren bei weitgehender Kohärenz in Bezug auf die zentralen Ziele die Vorstellungen darüber, mit welchen ordnungspolitischen Instrumenten diese realisiert werden sollen. Joachim Krause hat hier auf den zentralen Unterschied hinsichtlich der Bewertung des Multilateralismus in den USA und im „alten Europa“ hingewiesen. Während Ersteren eine Kosten-Nutzen-Analyse als Bewertungsgrundlage dient, bedingen im Falle Letzterer strukturelle und historische Aspekte einen deutlich stärker ausgeprägten 52 Für eine kritische politikwissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Konzept vgl. Greven, Michael Th.: Militärische Verteidigung der Sicherheit und Freiheit gegen Terrorismus? Überlegungen zur neuen militärpolitischen Doktrin, in: Sicherheit und Freiheit. Außenpolitische, innenpolitische und ideengeschichtliche Perspektiven, hrsg. von Thomas Jäger u.a., Festschrift für Wilfried von Bredow, Baden-Baden 2004, S.10-21. 298 Ralph Rotte/Christoph Schwarz prinzipiellen Stellenwert multilateraler Verfahren.53 Dieser schwerwiegende Unterschied schmälert die Aussichten auf einen tatsächlichen strategisch ausgerichteten Dialog zwischen den Akteuren auf beiden Seiten des Atlantiks. Man muss an dieser Stelle nicht so weit gehen wie der britische Historiker Niall Ferguson, der die Schuld für den transatlantischen Streit im Vorfeld des Irakkrieges von 2003 eindeutig aufseiten Frankreichs und Deutschlands sah.54 Es gilt jedoch festzuhalten, dass auch die betreffenden Staaten in Folge ihrer mangelnden Dialogbereitschaft ihren Teil an der zumindest temporären Zerrüttung des Verhältnisses zu den USA tragen. Wenn sich an diesem Punkt keine Änderung einstellt, sind auch nach dem Amtsantritt Barack Obamas neuerliche Streitigkeiten vorprogrammiert. Dies gilt zumal vor dem Hintergrund, dass die USA ihren Führungsanspruch auch unter dem neuen Präsidenten nachdrücklich unterstreichen. Zudem steht Obama angesichts der nach wie vor herrschenden Fragmentierung der amerikanischen Gesellschaft und der gravierenden Finanz- und Wirtschaftskrise vor einer kolossalen Herausforderung, eine grand strategy mit innenpolitischer Integrationswirkung vorzulegen. Die Binnenperspektive als gewichtiger Faktor des amerikanischen Strategiebildungsprozesses darf keineswegs unterschätzt werden.55 Eine weitere zentrale Herausforderung, denen sowohl die USA als auch die europäischen Staaten gegenüberstehen, ist die Verknüpfung von Zweck und Mitteln in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. Die Bilanz der BushRegierung fällt in dieser Hinsicht in der Tat verheerend aus. Gleichzeitig sind die Versäumnisse der Europäer nicht minder schwer, nur weil sie kein strategisches Missmanagement in der Dimension des amerikanischen Versagens im Nachkriegsirak demonstriert haben. Die Anwendung des gesamten verfügbaren Mittelspektrums und die, falls nötig, Entwicklung benötigter Fähigkeiten zur Realisierung politischer Zielsetzungen sind ein erster notwendiger Schritt. Beiderseits des Atlantiks ist in diesem Zusammenhang auch der Blick für die Verhältnismäßigkeit von Zweck und Mitteln zu schärfen: Im Kern geht es darum, zu erkennen, welche Mittel notwendig sind, um das angestrebte Ergebnis zu erreichen. Strategisches Handeln ist demnach interdependent, jede der beiden Ebenen muss die Forderungen, aber auch die Möglichkeiten der jeweils anderen angemessen berücksichtigen. Insgesamt zeigt ein kritischer Blick auf die ESS, den im vergangenen Jahr erschienenen Bericht zu ihrer Umsetzung sowie die Stellungnahme des Europäischen Parlaments, dass die Euro53 54 55 Vgl. Krause, Joachim: Amerikanische und europäische Konzepte zur internationalen Ordnung, in: Transatlantische Beziehungen. Sicherheit – Wirtschaft – Öffentlichkeit, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse und Kai Oppermann, Wiesbaden 2005, S.53. Vgl. Ferguson, Niall: Nicht Amerika, Europa ist schuld!, in: Cicero 3/2005, S.54-57. Vgl. hierzu Kupchan, Charles A./Trubowitz, Peter L.: Grand Strategy for a Divided America, in: Foreign Affairs 4/2007, S.71-83. Gemeinsame Herausforderungen – gemeinsame Lösungen? 299 päische Union hier den weiteren Weg vor sich hat. In den USA geht es primär darum, das unter den Paradigmen des Global War on Terror und des Long War deutlich gewordene Ungleichgewicht auszugleichen und die Eckpunkte der amerikanischen Strategie neu zu vermessen. Hingegen fehlt in Europa immer noch die konzeptionelle Grundlage für eine kohärente Strategie, namentlich die Definition gemeinsamer europäischer Interessen als Ausgangspunkt kohärenten globalen Agierens. Gelingt es den transatlantischen Verbündeten, diese jeweiligen Defizite erfolgreich zu beseitigen, wären die notwendigen Grundlagen für einen echten strategischen Dialog gelegt, der die Kooperationsmöglichkeiten als Grundlage eines gemeinsamen internationalen Handelns ebenso freilegt wie Bereiche, in denen die Intentionen differieren und folglich alternative Wege der Interessenverfolgung gegangen werden müssen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Die Rolle von Ideen, Normen und Interessen in der transatlantischen Integration Tilman Mayer 1. Ideen Analysen während einer enormen weltwirtschaftlichen Krisenphase zu entwickeln, das ist nicht einfach. Alles ist in Bewegung, vieles ist möglich. Aufmerksamkeit finden diejenigen, die von der Krise profitieren. So könnte es sein, dass von der Schwäche der USA viele Rivalen gerne profitieren würden – seien es China oder Russland – aber auch diese Länder befinden sich ihrerseits im Strudel der weltkapitalistischen Entwicklung. Sie können sich nicht separieren, sie sitzen im gleichen Boot und müssen stillhalten. Doch wer steuert es, und wer rudert? In der Krise zeigt sich, wer trotzdem über Kapazität verfügt. Insofern kann man – Anfang 2009 – festhalten, dass in der Polaritätsdiskussion – unipolare, multipolare, nonpolare Strukturen – die USA nach wie vor den gewichtigsten Pol im Mächtespiel darstellen. Die USA haben die Air Force One und sie haben die Vormacht auch sonst inne – auch in der Krise! Die USA befinden sich nicht einmal in einer Ordnung, die ein Gleichgewicht darstellt, sondern ihr massives Gewicht dominiert eindeutig.1 Von Gleichgewicht zu sprechen ist dann euphemistisch. Eine nonpolare Ordnung anzunehmen bedeutet allenfalls eine diplomatische Höflichkeitsformel, um Rivalen nicht verbal deklassieren zu müssen. Nein, in den USA begangene Fehler erschüttern den Planeten nachhaltig, aber eben damit erweist sich erneut, welche zentrale Rolle die USA innehaben – und wie sie gefordert sind, weltwirtschaftlich und weltpolitisch restrukturierend und resilient zu wirken. Die USA müssen die Kraft aufbringen, durch die Krise hindurch Bewältigungsstrategien für sich und die Welt durchzusetzen. Begleitende Mächte wie die UNO oder die EU sind sicherlich mehr als früher gebeten mitzuwirken, und sie bringen etwa in der Gestalt der EU einiges mit. Doch ohne die weltpolitische Zentralmacht kann keine Sanierung stattfinden.2 1 2 Buzan, Barry: The United States and the Great Powers. World Politics in the 21st Century, Cambridge 2004; Joffe, Josef: Die Hypermacht. Warum die USA die Welt beherrschen, Bonn 2006. Vgl. auch Rühle, Michael: Keine Alternative zur globalen Rolle der USA. Von Europa bis Asien dominiert die amerikanische Sicherheitspolitik, in: NZZ online, 24.2.2009. Die Rolle von Ideen, Normen und Interessen 301 Die transatlantische Zivilisation, die USA und Europa, mögen sich im Moment in einer Krisenphase befinden. Vielleicht gar in einer Zerstörungsphase, wie sie Joseph Schumpeter als letztlich konstruktiv angesehen hat. Aber ihre planetarisch gesehen führende Rolle bleibt unbestritten. Auch die sinische Welt kann noch bei weitem keine Konkurrenz formieren, will das auch nicht.3 Die transatlantische Zivilisation4 ist ein geopolitisches, geoökonomisches und geostrategisches Bündnis, das auf einer sicherheitspolitischen Partnerschaft ruht und eine derartige Kapazität hat, dass in den vergangenen Jahren darüber nachgedacht wurde, aus ihm einen geoökonomischen, einheitlichen Markt zu bilden. Diese Idee ist gegenwärtig nicht aktuell,5 zeigt aber die Bedeutung dieses Bündnisses, dass es noch nicht am Endpunkt seiner Möglichkeiten angekommen ist. In diesem Bündnis stellen die USA nach wie vor eben nicht nur militärisch eine Supermacht dar, sondern ihr Charakter als Softpower pulsiert nach wie vor, und der überall anzutreffende Antiamerikanismus der letzten Jahre dürfte eher als Antibushismus charakterisiert werden können, als eine prinzipielle Ablehnung der USA bedeuten. Insofern sind die Europäer in einer privilegierten Lage, dass sie diesem transatlantischen Kommunikationsraum angehören dürfen, auch wenn sie notorisch dazu neigen, sich selbst zu überschätzen. Die Idee, eine wertorientierte, stabile Gemeinschaft in Opposition zur kommunistischen Welteroberungsstrategie der Nachkriegszeit zu schaffen, hat sich zwar bewährt und wurde durch den Untergang der Sowjetunion bestätigt, aber derartige Ideen sind keine ewigen, sondern solche auf Zeit. Insofern muss man die Alternativen bedenken und ihr Entstehen beobachten. Das transatlantische Bündnis bedeutet für die Amerikaner, den Blick nach Osten zu richten. Man kann ihn aber auch nach Westen richten und insofern einen pazifischen Raum ernster als bisher nehmen mit der Konsequenz, dass pazifische Partnerschaften an die Stelle des transatlantischen in den Blick kommen. Diese Idee hat deshalb besonderen Sinn, weil aus Sicht der USA auch hinter der transatlantischen Zivilisation ein Integrationsgedanke steht, nämlich Partner zu finden, die die eigene Macht absichern, bestätigen bzw. Konkurrenten einbinden. In dem Maße, in dem das Mittelmeer auch in der transatlantischen Kommunikation in Gestalt eines Raumes mit terroristischen Bestrebungen auf 3 4 5 De Burg, Hugo: China Friend or Foe?, Cambridge 2006. Miliopoulos, Lazaros: Atlantische Zivilisation und transatlantisches Verhältnis. Politische Idee und Wirklichkeit, Wiesbaden 2007. Deutsch, Klaus: Transatlantische Integration – jetzt oder nie, in: Deutsche Bank Research, Aktuelle Themen 421, 17.6.2008. 302 Tilman Mayer sich aufmerksam macht, kann die transatlantische Integrationsbewegung mit einer weiteren Integrationsaufgabe versehen werden, die die Präsenz der USA erforderlich macht,6 auch wenn sie gerade in diesem Kulturraum nicht unproblematisch ist. Die Idee, einen Greater Middle-East zu schaffen gemeinsam mit den Europäern und deren Mittelmeerunion, von der bisher wenig zu hören ist, könnte transatlantisch belebend wirken. 2. Normen Der Transatlantizismus verträgt es nur schwer, wenn unilaterale Politik betrieben wird bzw. wenn man als Europäer den Eindruck hat, nur Befehlsempfänger zu sein. Insofern liegt es in der Natur der Sache, dass die engen Beziehungen zwischen den USA und den Europäern, die schließlich auch zu einer institutionellen Ordnung in Gestalt der NATO geführt haben, bilateralen bzw. multilateralen Charakter annehmen. Diese Norm der internationalen Politik, Multilateralismus, wird jedenfalls vonseiten Europas über Parteigrenzen hinweg erwartet. Von europäischer Seite aus gesehen, und eher aus einer europa-euphorischen Warte, sieht man das transatlantische Bündnissystem in politischer Art als gegen niemand gerichtet an, man wünscht es konsensual gelenkt. Aus dieser Darstellung ergibt sich notwendigerweise auch eine zum Teil recht scharfe Kritik an einem händlerartigen pazifistischen Gebaren der Europäer, die deshalb auch als kriegsunfähig gelten. Dagegen wird man einwenden müssen, dass die Europäer immerhin auf dem Balkan – zwar mehr schlecht als recht – aber doch gezeigt haben, dass es auch für sie Gewalt als ultima ratio gibt, und auch ihre Präsenz in Afghanistan demonstriert, dass sie erkennen, dass sie eigentlich auch eine weltpolitische Rolle spielen müssten. Die Vereinigten Staaten und die Europäer teilen sicherlich sehr viele Normen und Werte, insbesondere im Vergleich zu anderen Kulturräumen. Man sollte einerseits diese Wertegemeinschaft nicht unterschätzen, und zwar deshalb nicht, weil andererseits zunehmend Mächte an Gestalt gewinnen, die jenseits dieser Werte angesiedelt sind und trotzdem Erfolg haben und insofern sich anschicken, eine Konkurrenz zum transatlantischen Normen- und Wertesystem weltweit zu vermitteln suchen, und sei es bisher allein durch ihre Präsenz. Vielleicht ist eine Demokratie zu haben nicht nötig? Kann man nicht trotzdem in Wohlstand leben? Wenn diese Botschaft weltweit akzeptiert würde, wäre es erneut höchst dringlich, einen Kampf um die Verteidigung 6 Luttwak, Edward: Er hat die Welt sicherer gemacht, in: WamS, 24.8.2008, S.8081; vgl. auch Gaddis, John Lewis: Das Ende der Tyrannei, in: IP 1/2009, S.70-82. Die Rolle von Ideen, Normen und Interessen 303 der Demokratie zu führen. Von der Liga der Demokratien war 2008 in den USA schon die Rede.7 Jedenfalls kann man von einem neuen Systemwettbewerb ausgehen, der die Normen und Werte der transatlantischen Zivilisation durch die Werte einer z.B. chinesischen sogenannten „harmonischen Gesellschaft“ in Frage stellt. Dieser neue Systemwettbewerb wird noch nicht richtig ernst genommen, zumal nicht in der gegenwärtigen Krise.8 Wir wissen auch nicht, wie die chinesische Gesellschaft die Krise überstehen wird. Tut sie es, wird auch rein demographisch bedingt der Systemwettbewerb an Intensität zunehmen. Die Demographie wirkt sich nicht zugunsten des Westens aus. Für die westlichen Werte und Normen muss geworben werden. Die Wahrnehmung eines Wettbewerbs der Kulturen und Zivilisationen liegt noch etwas im Argen. Die Abwehr gegen Samuel Huntingtons Thesen ist zu einfach, die kompetitive Struktur der kulturellen, zivilisatorischen Entwicklung sollte besser wahrgenommen werden, und diese Konstellation bedeutet auch eine demokratiewissenschaftliche Herausforderung. 3. Interessen Die wichtigste Basis des transatlantischen Kommunikationsraumes sind die Interessen. Es gab in den vergangenen Jahrzehnten beiderseits des Atlantiks das Interesse, im Ost-West-Konflikt zu kooperieren. Insofern hat die eine die andere Macht auf jeweils ihre Art unterstützt. Im 21. Jahrhundert könnte es, wie oben angedeutet, passieren, dass dieser Raum weltpolitisch peripher wird, und zwar deshalb, weil die amerikanische Supermacht an ihm vorbei planetar Politik in Räumen betreibt, die wichtiger geworden sind. Betrachten wir die US-Interessen. An erster Stelle wird man sagen können, dass die USA daran interessiert sind, ihre Stärke zu behalten, ihre Rivalen einzudämmen und aufstrebende Mächte für sich einzunehmen oder niederzuhalten. Aus europäischer Sicht sind die Interessen sicherlich andere, das Verhältnis der Europäer zur Machtpolitik ist nach wie vor objektiv schwierig,9 weil viele größere Nationalstaaten eine Rolle spielen, aber auch deshalb schwierig, weil sich diese Nationalstaaten untereinander kaum zugestehen, Führungspositionen einzunehmen. 7 8 9 Vgl. aber auch Ikenberry, John G.: The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive?, in: Foreign Affairs 1/2008. Kremp, Herbert: Konturen einer neuen Welt, in: Die Welt, 21.10.2008, S.7. Mayer, Tilman: Realpolitik redivivus, in: Außenpolitik und Staatsräson. Festschrift für Christian Hacke zum 65. Geburtstag, hrsg. von Volker Kronenberg, Jana Puglierin und Patrick Keller, Baden-Baden 2008. 304 Tilman Mayer Dass Rivalen eingedämmt werden sollen, liegt ebenfalls außerhalb des Horizonts der Europäer, einfach weil Europäer zu stark selbstbezogen handeln, jedenfalls in einem überwiegend europanahen Raum sich nur entfalten und sich mit sich selbst beschäftigen.10 Die Politik einzelner größerer europäischer Nationalstaaten außerhalb Europas steht dazu nicht im Widerspruch. Europa ist zu klein, um aufstrebenden Mächten Paroli bieten zu wollen. Die Europäer sind vielmehr daran interessiert, auch diese Mächte als Handelspartner zu gewinnen. In diesem Bestreben geraten sie zum Teil mit den amerikanischen Interessen in Widerspruch, weil vonseiten Amerikas Handelsbeziehungen sicherheitspolitisch nicht an erster Stelle stehen können. Die Europäer erlauben sich eher nach dem Modell des Trading State zu handeln,11 während die Amerikaner durchaus militärische Stärke in den Vordergrund stellen müssen. Es wird vonseiten Europas viel zu wenig honoriert, dass es allein die Amerikaner sind, die den weltkapitalistischen Globalisierungsprozess machtpolitisch dadurch absichern, dass sie den Planeten mit Dutzenden von Stützpunkten markiert haben und so für die notwendige Sicherheit des Handelsverkehrs sorgen. Europa profitiert vom amerikanischen Stützpunktsystem, ohne wie die USA Weltmacht und Seemacht12 und eine luft- und weltraumgestützte Macht zu sein oder sein zu wollen. Allein im Ansatz der Interessenslagen finden sich gravierende Unterschiede zwischen Europa und Amerika. Das muss keinen Gegensatz bedeuten. Wir haben ja bereits gesehen, dass geoökonomisch ein transatlantischer Wirtschaftsraum noch besser als bisher entwickelbar wäre und insofern den transatlantischen Integrationszusammenhang stärken würde. Das Interesse des transatlantischen Verteidigungsbündnisses in der nördlichen Hemisphäre ist ein über diesen Raum hinaus strahlendes Bündnis, das seinen Wert in sich hat, stabilisierend wirkt und Amerikanern und Europäern auch deshalb dient, weil autoritäre Kräfte im Umfeld des Bündnisses balanciert werden können. Insofern gibt – in Friedenszeiten sich befindlich – eben dieses militärische Bündnis die zentrale Stütze der transatlantischen Integration wider, und zwar in einer ähnlichen Funktion wie nach dem Zweiten Weltkrieg, als es auf eine starke Herausforderung eine Antwort darstellte. In diesem Militärbündnis müsste klar sein, dass unterschiedliche Mächte zu einer Kooperation zusammenkommen, die sich zuerst und vor allem 10 11 12 Dieser EU-Egoismus – eine Art Nationalismus – wird in der Literatur schon lange tabuisiert. Es gehört zum guten Ton, das als selbstverständlich anzusehen. Rosecrance, Richard: The Rise of the Trading State (1986), deutsch: Der neue Handelsstaat: Herausforderungen für Politik und Wirtschaft, Frankfurt 1987. Vgl. auch Qi, Xu: Maritime Geostrategy and the Development of the Chinese Navy in the 21st Century, in: Naval War College Review, Autumn 2006. Die Rolle von Ideen, Normen und Interessen 305 durch ihre Größe unterscheiden: eine Banalität, über die nicht gesprochen werden müsste, wenn nicht die Europäer notorisch unter dieser Asymmetrie zu leiden beliebten. Die hegemoniale Struktur der amerikanischen Macht wird noch von den Europäern mitgetragen, sie gelten doch in globaler Sicht als Teil der dominanten westlichen Welt. Sie begleiten das weltweite Auftreten der Amerikaner, etwa im Irak, in Afghanistan und andernorts. Natürlich gibt es Unterschiede im Auftreten von Amerikanern und Deutschen, etwa in Afghanistan. Trotzdem: Das Bedürfnis der Europäer, sich von den Amerikanern abgrenzen zu müssen, weist auf ein Rollenverhalten hin, das noch nicht als besonders reif bezeichnet werden kann. In diesem Kontext wird auch zu beobachten sein, ob die Wiederannäherung Frankreichs an die NATO etwas zum Reifungsprozess beiträgt. Man könnte auch sagen, dass die Europäer zu einer Art Hochstaplertum neigen, weil sie beanspruchen, auf Augenhöhe mit den Amerikanern verhandeln zu können. Die Rolle des definitiv bestehenden Juniorpartners wird strikt abgelehnt. Man verfällt daher in die peinliche Rolle der Selbstüberschätzung. Insofern wäre die sogenannte Huckepack-Strategie13 durchaus eine humorvolle Möglichkeit, das Bündnis augenzwinkernd als europäisch gesteuert auszugeben, jedenfalls von Zeit zu Zeit. Man verspielt andererseits sonst die kreative Idee der transatlantischen Integration, die mit der Idee der europäischen Integration in diesem Punkt ganz konform geht, dass die eigene Stärke in einem gemeinsamen Pool einzubringen allen Beteiligten nutzt,14 selbst wenn die eingebrachten Beträge deutlich unterschiedliche sind. Die helfende Hand der Amerikaner, nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus nicht überall gerne angenommen, ergab ein solidarisches Verhalten, der Schutz erzeugte und allen nützte, eben auch den Amerikanern, die damit ihrerseits ihre Hemisphäre besser absichern konnten. Man muss vielleicht das Interesse der Europäer gegen EU-enthusiastische Perspektiven stärker im ökonomischen Bereich suchen. Jedenfalls wird man an diesem gemeinsamen Interesse eher fündig als in sonstigen Gemeinsamkeiten. In der Ökonomie liegt ein gemeinsames Interesse transatlantischer Art. Unangenehm bleibt weiterhin die ungeklärte Institution und Ordnung Europas, welche seit Jahrzehnten eine Baustelle darstellt und zu einer Selbstbeschäftigung der Europäer führt. Eine Finalisierung des europäischen Integrationsprozesses ist längst überfällig. Weniger ist mehr. Aber 13 14 Bierling, Stephan: Die Huckepack-Strategie. Europa muss die USA einspannen, Hamburg 2007. „In einer Welt, in der die Grenzen durchlässiger sind als je zuvor, muss Amerika internationale Koalitionen schmieden und Institutionen aufbauen, damit globale Bedrohungen gemeinsam gemeistert werden können.“, so Nye, Joseph S.: Nie mehr allein. Amerika bleibt Supermacht. Aber ihre Probleme wird die Welt nur gemeinsam lösen können, in: Die Zeit, 8.1.2009, S.38. 306 Tilman Mayer noch haben europa-euphorische Integrationisten die Oberhand, auch wenn die momentane tschechische EU-Ratspräsidentschaft Wasser in den Wein gibt. Gemeinsame Interessen von Amerikanern und Europäern können zu einer Agenda führen, auf der die Aufgabe steht, dass das Umfeld der EU arrondiert werden muss. So etwa steht die Frage der Integration der Türkei an, weitere Staaten im Mittelmeerumfeld sind beachtenswert, und in einer kühnen Perspektive könnte der israelisch-palästinensische Raum als Sonderentwicklungsfeld betrachtet werden, womit man sich eine Konflikt mindernde Perspektive versprechen könnte. Zu befürchten ist, dass die Europäer lieber im oben genannten Sinne sich mit sich selbst beschäftigen als im Sinne der helfenden Hand der Amerikaner ihrerseits helfend sich im 21. Jahrhundert einbringen wollen. An sich haben die Europäer drei Perspektiven, sich strategisch auszurichten: einmal bezogen auf den russischen Raum, aus dem heraus aber seit Jahren eine Politik betrieben wird, die hauptsächlich energiepolitischer Natur ist und insofern nicht das Format abgibt für eine eigentliche strategische Partnerschaft, zumal ihr vonseiten Russlands, was Normen und eine Wertegemeinschaft betrifft, es an Unterfütterung fehlt.15 Die größere eurasische Perspektive über Russland hinweg ein Bündnis mit China einzugehen, also geopolitisch weit auszuholen, würde bedeuten, sich gegen die USA zu stellen, die wiederum geopolitisch gesehen gerade diese eurasische Landmasse stark beeinflussen wollen. Insofern ist die transatlantische Perspektive der Europäer unersetzbar, und daraus ergeben sich auch Perspektiven auf die neue amerikanische Administration 2009. Die neue amerikanische Administration ist im demokratischen Mainstream gut verankert, transatlantisch gesehen hat sie noch kein besonderes Profil eingenommen. Der neue amerikanische Präsident teilt sicherlich die europäischen Werte im Allgemeinen.16 Aber die europäischen Interessen sind für ihn sicherlich nur einige unter vielen globalen Interessen, die es vonseiten Amerikas zu beachten gilt. Es bedarf keiner Phantasie, dass die euphorische Stimmung bezüglich des neuen Präsidenten bald einer 15 16 Dagegen Rahr, Alexander: Kein Europa ohne Russland. Moskau muss über eine strategische Partnerschaft in ein europäisches Bündnis eingeschlossen werden, in: IP 1/2009, S.45-50. Asmus, Ronald D./Lindberg, Tod: Rue de la Lois: The Global Ambition of the European Project, Stanley Foundation, Working Paper, September 2008, www. stanleyfoundation.org/publications/other/EuropeanProject.pdf Die Rolle von Ideen, Normen und Interessen 307 Ernüchterung weichen wird.17 Fast könnte man sagen, die Administrationen kommen und gehen, aber die Interessen bleiben bestehen. Die Problemfelder der neuen amerikanischen Administration liegen jedenfalls nicht in Europa,18 und insofern wird die Aufmerksamkeit viel stärker auf den Iran, auf Palästina/Israel, Pakistan, Afghanistan, Irak gelenkt sein. Im Windschatten dieser Entwicklung liegt Europa. Es ist wie eh und je in ökonomischer Perspektive, zumal in einer Weltwirtschaftskrise gefragt. In dieser Rolle muss es sich bewähren. Damit wäre schon viel erreicht. Dass die gegenseitigen Erwartungen darüber hinausgehen, steht zwar fest. Aber realistischerweise ist gerade in einer derartig spektakulären Krisenphase das ökonomische Fundament zuerst gefragt. 17 18 Wenn man vielleicht auch nicht gleich so weit gehen muss wie Norman Podhoretz: „Obama ist der erste amerikanische Demagoge seit den Dreißigerjahren“, in: Die Welt, 18.3.2008. Vgl. auch das pragmatische militärisch-zivile Programm in dem von William Caldwell entwickelten Heereshandbuch „Stability Operations“, FM 3-07, 2008. Strukturelle Probleme im transatlantischen Beziehungsgefüge Helga Haftendorn Am 20. Januar 2009 wurde in Washington der 44. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Mit dem Versprechen eines grundlegenden politischen Wandels hatte Barack Obama, der erste afroamerikanische Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der USA, einen überzeugenden Wahlsieg über seinen republikanischen Gegenkandidaten und Senatorkollegen, George McCain, errungen. In einer stimulierenden Antrittsrede verwies Obama auf die großen Herausforderungen, mit denen die USA konfrontiert seien, zeigte sich aber zuversichtlich, dass sie diese meistern würden.1 1. Moralische statt machtpolitische Führung Obama trat sein Amt in der Überzeugung an, dass Amerika mit Staatskunst und moralischer Überzeugungskraft seinen Einfluss in der Welt zurückgewinnen könnte. Bereits im Wahlkampf beanspruchte er eine auf eine bessere globale Zukunft gerichtete Führungsrolle der USA – eine „visionary leadership“.2 Sein langfristiges Ziel ist die Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit und des Ansehens der USA. Die Führung, die Obama ausüben will, orientiert sich an einem Weltordnungsentwurf, der auf Franklin D. Roosevelt und die von ihm verkündeten „Vier Freiheiten“ zurückgeht. Danach wollen sich die USA dafür einsetzen, „dass jene, die heute Furcht und Not leiden, morgen in Würde und mit Chancen leben können“.3 In einer Rede im Juli 2008 in Berlin hatte Obama die Völker der Welt beschworen, bei der Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zusammenzustehen. Keine Nation, egal wie groß oder wie mächtig sie sei, könne den internationalen Terrorismus allein besiegen oder die Weiterverbreitung von Kernmaterial- und Waffen, die globale Klimakatastrophe oder die ethnischen Konflikte in Afrika verhindern. Nur wenn Europäer und Amerikaner partnerschaftlich kooperierten, 1 2 3 „Barack Obama’s Inaugural Address”, Transcript, 20.1.2009, www.nytimes. com/2009/01/20/us/politics/20text-obama.htlm Reiss, Mitchell B.: Restoring America’s Image: What the Next President Can Do, in: Survival, Okt./Nov. 2008, S.99-114. Rudolf, Peter: Amerikas neuer globaler Führungsanspruch. Außenpolitik unter Barack Obama, in: SWP-Aktuell 2008/A77, hrsg. von Stiftung Wissenschaft und Politik, November 2008, S.2. Strukturelle Probleme im transatlantischen Beziehungsgefüge 309 könne die gemeinsame Sicherheit erhalten und menschlicher Fortschritt erreicht werden.4 Das Weltbild Obamas unterscheidet sich grundlegend von dem seines Vorgängers. George W. Bush glaubte wie seine neokonservativen Berater an ein „Manifest Destiny“, eine göttliche Mission Amerikas. Nach dem Kollaps der Sowjetunion hatte Charles Krauthammer den Beginn eines unipolaren Zeitalters angekündigt, in dem die USA als globaler Hegemon in einer weitgehend anarchischen Welt wirken und die globale Agenda bestimmen könnten.5 Das Kernstück amerikanischer Hegemonialpolitik war die „Freiheits- und Demokratie-Agenda“. Herausgefordert durch die Attentate des „9/11“, erklärte die Bush-Administration dem internationalen Terrorismus den „Krieg“ (War on Terror).6 Er richtete sich gegen die Unterstützer des Terrors, die Washington vor allem in Afghanistan vermutete, wo die Taliban das Terrornetzwerk der Al Qaida beherbergt hatten. Aber auch die „Schurkenstaaten“ der „Achse des Bösen“ – Irak, Iran und Nordkorea – sollten bekämpft werden. Heute ist der Schock des Systembruchs von 1989-91 überwunden. Der neue Präsident hat erkannt, dass die Vereinigten Staaten ihre Rolle als globaler Hegemon eingebüßt haben. Der Irak-Krieg hat ihr internationales Ansehen beschädigt, die Glaubwürdigkeit der Freiheits- und DemokratieAgenda unterminiert und wesentlich zu ihrer politischen Schwächung beigetragen. Als Folge der Globalisierung sind neue Mächte – China, Indien, Brasilien und Südafrika – zu Weltmächten aufgestiegen und haben entsprechende Ansprüche entwickelt.7 Sinnfällig kam dies in der Sitzordnung beim Weltwirtschaftsgipfel in Washington im November 2008 zum Ausdruck. Im Zentrum saßen die mächtigen Schwellenländer, während die Europäer an die Tischenden verbannt waren. 2. Die USA in einer multipolaren Welt Die Globalisierung hat zur Entwicklung von weltweiten transgesellschaftlichen Strukturen geführt und nicht-staatliche Akteure – von internationalen Organisationen über transnationale Konzerne bis zu autonomen Terrorgruppen – aufgewertet. Die aktuelle Wirtschaftskrise wirkt ebenfalls als ein großer ökonomischer und politischer Gleichmacher. Von ihr sind 4 5 6 7 Obama’s Speech in Berlin, 24.7.2008, www.nytimes.com/2008/07/24/us/ politics/24text-obama.htlm?ref=politics&pag Krauthammer, Charles: The Unipolar Moment, in: Foreign Affairs 1/1991, S.23-33. Rede von Präsident George W. Bush am 20.9.2001 („Bush Doktrin”), www. whitehouse.gov./news/releases/2001/09/20010920-8.html Vgl. Global Trends 2025: A Transformed World, hrsg. von National Intelligence Council, 2008, www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.htlm, S. VI f. 310 Helga Haftendorn alle Industriestaaten und Schwellenländer – mittelbar auch die Entwicklungsländer – in gleicher Weise betroffen. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sich die USA ebenso wie Westeuropa von dieser Krise wieder erholen; die tiefe Rezession wird jedoch noch nicht abschätzbare Spuren in ihren Gesellschaften hinterlassen. Noch weitreichender könnte ihre Wirkung aber in den neuen Großmächten sein, da deren ökonomische Stärke und politische Stabilität zu einem großen Teil auf ihren hohen wirtschaftlichen Wachstumsraten beruhen, die von den nachlassenden Rohstoff- und Warenimporten der Industrieländer abhängig sind. In der Welt hat sich ein multipolares System herausgebildet, das durch ein Netz von asymmetrischen Beziehungen geprägt ist und in dem Macht nicht automatisch Einfluss gewährt. Die Entkoppelung von Macht und Einfluss erschwert eine erfolgreiche Diplomatie. In dem neuen System gibt es keine „Nr. 1“ mehr und es fehlen eindeutige multipolare Machtzentren.8 Die Folge sind ausgeprägte Rivalitäten zwischen den Zentren und insgesamt größere Instabilitäten sowie ein Verlust an Berechenbarkeit. Die Asymmetrien zwischen Europa und Amerika und die daraus resultierenden strukturellen Spannungen sind auch nach dem Regierungswechsel in Washington erhalten geblieben. Die USA beanspruchen weiterhin die Definitionsmacht für die transatlantischen Beziehungen, während die Europäer durch ihre Handlungsschwäche Amerika nicht mit einem ähnlichen Anspruch gegenübertreten können. In den transatlantischen Beziehungen ist die in der Bipolarität des Kalten Krieges wirksame „Pax Americana“, die Westeuropa Schutz und Ansehen bot, unwirksam geworden. Außerdem hat Amerika seine Funktion als „regional balancer“ verloren. Nur allmählich und widerwillig akzeptiert es seine gewandelte internationale Rolle. Ungeachtet der internen Differenzen und ihrem Unvermögen, zu einem akzeptierten Akteur auf der Weltbühne zu werden, sieht sich die Europäische Union aber als eine eigenständige weltpolitische Kraft und beansprucht eine Mitsprache in globalen Fragen. In seiner Berliner Rede bezeichnete Obama Europa seinerseits als den besten Partner, den Amerika besitze. Er erklärte, dass er die Brücken über den Atlantik festigen und die Europäer mit Respekt behandeln wolle. Ein verantwortungsvolles und kooperatives Amerika erwarte aber im Gegenzug, dass diese ihrer Verantwortung in Afghanistan, in Bezug auf den Iran, bei der Bekämpfung des Terrorismus, in Afrika und bei der Schonung der Umwelt nachkämen.9 Trotz mancher Divergenzen teilten Amerikaner und Europäer gemeinsame Werte und verfolgten ähnliche Interessen, so dass es keine Alternative zu einer engen Zusammenarbeit gebe. 8 9 Richard Haas spricht nicht von einem multipolaren, sondern einem nichtpolaren System, vgl. The Age of Nonpolarity: What Will Follow United States Dominance?, in: Foreign Affairs 3/2008, S.44-56. Vgl. Obama’s Speech in Berlin, 24.7.2008. Strukturelle Probleme im transatlantischen Beziehungsgefüge 311 Trotz des Bekenntnisses zu Europa hat dieses für die USA viel von seiner alten strategischen Bedeutung verloren; stattdessen beansprucht der rohstoffreiche Krisenbogen des Mittleren Ostens maßgeblich die Aufmerksamkeit der neuen Administration. Auch für Europa sind die USA nach dem Wegfall der Pax Americana nicht mehr „the indispensible nation“, welche die damalige Außenministerin, Madeleine Albright, beschworen hat.10 Im Unterschied zu der Zeit des Ost-West-Konflikts sehen sich die Europäer – zumindest die Westeuropäer – nicht mehr als militärisch bedroht an. Sie glauben, den atomaren Schutzschirm der USA und die Präsenz ihrer Streitkräfte nicht mehr zu benötigen. Sie legen größeren Wert auf Eigenständigkeit als auf eine enge Bindung an die Vereinigten Staaten. Europa möchte als ein gleichberechtigter Partner behandelt werden, träumt sogar davon, eines Tages ein Gegengewicht zu den USA zu bilden. Wenn die traditionelle strategische Partnerschaft zwischen Europa und Amerika fortbestehen soll, muss sie daher an die Bedingungen des 21. Jahrhundert angepasst werden.11 3. Ziele der Obama-Administration Obama hat sich ähnlich wie sein großes persönliches Vorbild, Abraham Lincoln, das Ziel gesetzt, das Land zu versöhnen und die innenpolitische Spaltung zu überwinden. Vor allem will er das amerikanische Volk wieder mit Hoffnung und Zuversicht erfüllen. Noch mehr als für seinen demokratischen Vorgänger gilt aber für ihn das Wort Clintons: „It’s the economy, stupid.“ Wenn Obama nicht gleich zu Beginn seiner Amtszeit scheitern will, muss er Amerika rasch aus der Rezession herausführen. Bereits vor seiner Vereidigung kündigte er daher ein Konjunkturpaket im Umfang von 825 Mrd. Dollar an, das vor allem Investitionen in die Infrastruktur, in das Gesundheits- und Schulsystem sowie in erneuerbare Energien vorsieht. Außerdem sind Steuererleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen sowie für die meisten Bürger vorgesehen. Hauptzweck ist die Erhöhung der Kaufkraft und die Schaffung neuer Arbeitsplätze.12 Das Programm wird allerdings zu einem Rekorddefizit im US-Haushalt führen und hat bereits im Kongress Widerstand ausgelöst. Ein erster Test steht Obama daher in der Frage bevor, ob er sich gegenüber den Interessen der Volksvertreter durchsetzen kann. 10 11 12 Madeleine Albright in einem Gespräch mit der Washington Post am 5.12.1996, www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/govt/admin/stories/ albright120696.htm Ikenberry, G. John: Explaining Crisis and Change in Atlantic Relations: An Introduction, in: The End of the West? Crisis and Change in the Atlantic Order, hrsg. von Jeffrey Anderson, G. John Ikenberry und Thomas Risse, Ithaca/ London 2008, S.1-27, bes. S.5. „Obama Speech on Economic Crisis”, 8.1.2009, Transcript, www.inqusitr. com/14074/obama-speech-january-8-video-transcriptp/ 312 Helga Haftendorn Bereits am Tag nach seiner Amtseinführung hat der Präsident sein Wahlversprechen eingelöst und die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba innerhalb eines Jahres verfügt. Sämtliche Terrorverfahren sollten für 120 Tage auf Eis gelegt und bis dahin geklärt werden, wie die nachweisbar Schuldigen rechtsstattlich einwandfrei angeklagt werden können. Die anderen Gefangenen sollten freigelassen werden. Er ordnete ferner an, alle CIA-Lager im Ausland zu schließen und künftig auf die Anwendung harscher Verhörmethoden zu verzichten. Obama sagte, dass sich die USA auch beim Kampf gegen Gewalt und Terrorismus an die Regel halten müssten, dass sie nicht folterten.13 Zu seiner Außenministerin ernannte Obama seine Gegnerin im Vorwahlkampf, die frühere First Lady Hillary Clinton. Er tat dies auch, um eine mögliche einflussreiche Opponentin in die Kabinettsdisziplin einzubinden. Bei den Anhörungen zu ihrer Bestätigung als Secretary of State bezeichnete Frau Clinton robuste Diplomatie und nachhaltige Entwicklung als die besten Mittel, um die Zukunft der USA zu sichern. Sie versprach, sich verstärkt um eine Lösung der Konflikte im Nahen Osten und um die Befriedung Afghanistans zu bemühen. Sie will sich ferner für die Verbesserung der Beziehungen zu den Partnern in Lateinamerika einsetzen und die Rüstungskontrollverhandlungen mit Russland wiederbeleben.14 Die Vertrautheit Obamas und Clintons mit dem Senat als dessen ehemalige Mitglieder hat die rasche Bestätigung der wichtigsten Regierungsmitglieder erleichtert. Ursprünglich wollte der neue Präsident den Fehler seines demokratischen Vorgängers vermeiden und nicht zu viele Projekte zu rasch in Angriff nehmen. Der Krieg im Gaza-Streifen zwang ihn jedoch zu schnellem Handeln. Obama kündigte daher neue Initiativen zur Lösung des arabisch-israelischen Konfliktes an und ernannte den in der Streitschlichtung erfahrenen ehemaligen Senator George Mitchell zum Sonderbotschafter für Nahost. Neben diesem Konflikt hat die Stabilisierung Afghanistans auf der außenpolitischen Agenda der Administration höchste Priorität. Hier ernannte Obama den bewährten Diplomaten Richard Holbrooke zum Sonderbotschafter für Afghanistan und Pakistan. Er kündigte an, dass die USA ihre Truppen dort um 17.000 Mann verstärken werden und forderte in einer Botschaft an die NATO auch von dieser ein stärkeres Engagement.15 Schon zuvor hatte der Präsident Verteidigungsminister Robert Gates und seinen Sicherheitsberater, General James Jones, angewiesen, einen raschen Abzug der amerikanischen Kampftruppen aus dem Irak in die Wege zu leiten. Einige dieser Maßnahmen erläuterte Obama in einer Rede anlässlich der Amtseinführung von Frau Clinton 13 14 15 Rüb, Matthias: Obama ordnet Schließung von Guantanamo und CIA-Gefängnissen an, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), 23.1.2009, S.6. Ders.: Die harte mit der weichen Macht verbinden, in: FAZ, 14.1.2009, S.7. Nüsse, Andrea: Obama schickt Beauftragte in Krisengebiete, in: Tagesspiegel, 24.1.2009, S.6; Dies.: Obama: Die NATO muss mehr tun, in: FAZ, 24.1.2009, S.6. Strukturelle Probleme im transatlantischen Beziehungsgefüge 313 im State Department und signalisierte damit, dass er in Abstimmung mit dieser handelt und eine Konkurrenzsituation zwischen einem außenpolitisch aktiven Präsidenten und einer ehrgeizigen Außenministerin vermeiden will. Wird er aber sein Versprechen eines grundlegenden Wandels einlösen können? Die Ernennung des Trios Clinton, Gates und Jones hat Frankenberger ein „realpolitisches Dementi des Großen Wandels“ genannt.16 Die Erwartung, Obama werde und könne schon bald eine Politik aus einem Guss betreiben, übersehe jedoch die inneren und äußeren Beschränkungen und ignoriere „ein ehernes politisches Gesetz“: Noch jeder Präsident sei bisher von Krisen überrascht worden; erst durch diese Herausforderungen habe sich so etwas wie ein Regierungsprogramm herauskristallisiert. 4. Instrumente amerikanischer Führung Wie und mit welchen Mitteln wird der neue Präsident führen? In einer außenpolitischen Grundsatzrede vor dem Chicago Council on Global Affairs beschrieb der damalige Präsidentschaftsbewerber diese Führung so: „Wir müssen führen, nicht im Geiste eines Patrons, sondern im Geiste eines Partners“.17 Die Führungsrolle Amerikas gründe sich nicht primär auf militärische Macht, sondern vor allem auf „soft power“, d.h. auf Diplomatie und Überzeugung. Sie beruhe auf der Erkenntnis, dass gemeinsame Sicherheit vor allem ein Verständnis von gemeinsamer Menschlichkeit (common humanity) voraussetze.18 Er werde die Konflikte entideologisieren und den Dialog auch mit den Feinden Amerikas suchen. Vor dem Einsatz der Streitkräfte – die modernisiert und einsatzfähig gehalten werden müssten – werde er aber dann nicht zurückschrecken, wenn alle anderen Mittel versagt hätten und dies zum Schutz der USA und zur Verteidigung ihrer nationalen Interessen erforderlich sei.19 Von Obama ist daher ein zurückhaltender Umgang mit militärischer Gewalt als Mittel zur Konfliktregulierung zu erwarten. Dies gilt auch für seine Außenministerin. Bei der Senatsanhörung erläuterte Frau Clinton ihr außenpolitisches Leitmotiv der „smart power“: Danach soll „kluge Macht“ das Potenzial der „harten Macht“ militärischer Stärke mit der „weichen Macht“ der kulturell-politischen Anziehungskraft Amerikas verbinden.20 16 17 18 19 20 Frankenberger, Klaus-Dieter: Obamas realpolitisches Dementi, in: FAZ, 5.12.2008, S.1. Remarks of Senator Obama to the Chicago Council on Global Affairs, 24.4.2007, www.realclearpolitics.com/printpage/?url=http://realclearpolitics. com/ari... Obama, Barack: Renewing American Leadership, in: Foreign Affairs 4/2007, S.2-16. Ebd., S.7. Vgl. Rüb: Die harte mit der weichen Macht verbinden. 314 Helga Haftendorn Neue politische Ansätze sind vor allem in der Politik gegenüber dem Iran zu erkennen. Obama sieht in dem Regime der Mullahs eine der größten Herausforderungen für die USA. Es müsse sowohl vom Erwerb von Kernwaffen abgehalten als auch ein Ende der Unterstützung radikaler islamischer Gruppen gemacht werden. Er werde sich aber nicht scheuen, persönlich mit der iranischen Führung zu sprechen, wenn das Erfolg verspreche. Vermutlich könne der Iran eher mit vertrauensbildenden Maßnahmen zur Kooperation gewonnen werden als mit der bisher praktizierten Containment-Politik.21 Der Präsident will eine aktive Führungsrolle auch in der Energie- und Klimapolitik ausüben. Er hat bereits erste Schritte zur Förderung alternativer Energien angekündigt, um die Abhängigkeit der USA von ausländischem Öl zu verringern.22 Im Gegensatz zu den europäischen Prioritäten hat für die USA die Energiepolitik Vorrang vor der Ökologie. Sie wollen diese aber mit dem Einstieg in eine nachhaltige Umweltpolitik verbinden, die z.B. auf die Erschließung neuer Öl- und Gasquellen in ökologisch sensiblen Gebieten verzichtet und stattdessen auf eine größere Wirksamkeit der fossilen Brennstoffe setzt. Kernpunkte des Umweltprogramms sind die verstärkte Nutzung alternativer Energien und drastische Reduzierungen der Emissionen von Kohlenwasserstoffen. Obama will in der Klimapolitik aber nicht nur das eigene Haus in Ordnung bringen, sondern sich auch intensiv um ein Nachfolgeabkommen für das 2012 auslaufende KyotoProtokoll bemühen. Diese Absicht findet den Beifall der Europäer. Um die Schwellenländer in der Klimapolitik mit ins Boot zu holen, strebt Obama eine Vorbildfunktion der USA an und will ein „Global Energy Forum“, bestehend aus den G-8-Staaten sowie China, Indien und Brasilien einberufen. Es ist jedoch eine offene Frage, welche Beschränkungen der Industrie der Kongress akzeptieren wird. Dieser hat bei der Umweltgesetzgebung ein entscheidendes Wort mitzusprechen. Der Präsident und seine Außenministerin haben sich mehrfach für die Wiederaufnahme der Abrüstungsverhandlungen ausgesprochen und als Fernziel für eine Abschaffung der Kernwaffen („Global Zero“) plädiert. Sie können sich dabei auf den Vorschlag der „Vierer-Bande“ – George Shultz, William Perry, Henry Kissinger und Sam Nunn – für eine Welt ohne Nuklearwaffen stützen.23 Dazu soll der Rüstungskontroll-Dialog mit Russland wiederbelebt werden. Aus Sicht der USA ist neben der Revitalisierung des Vertrages über nukleare Nichtverbreitung die Aushandlung eines Nach21 22 23 Obama: Interview mit ABC am 11.1.2009, www.haaretz.com/hasen/apages/1054461.htlm Barack Obama on climate change, in: Physics Today Campaign 2008 – Where do they stand on Science?, http://blogs.physicstoday.org/politics08/2008/01/ where_do_you_stand_on_climate_7 Vgl. Daalder, Ivo/Lodal, Jan: The Logic of Zero: Toward a World Without Nuclear Weapons, in: Foreign Affairs 6/2008, S.80-95. Strukturelle Probleme im transatlantischen Beziehungsgefüge 315 folge-Abkommens für den START-Vertrag vordringlich, der Ende 2009 ausläuft; Moskau fordert aber seinerseits den Verzicht auf das in Polen und Tschechien geplante Raketenabwehrsystem. Nachdem sich Obama während des Wahlkampfes für ein Raketenabwehrsystem ausgesprochen hat, ist offen, wie er sich in dieser Frage verhalten wird. Die Europäer begrüßen zwar die Absicht neuer bilateraler Rüstungskontrollbemühungen, drängen aber gleichzeitig auf eine Ratifizierung und Anpassung des multilateralen Vertrages über konventionelle Streitkräfte in Europa (A-KSE). Russland hat in den letzten Jahren an Selbstbewusstsein gewonnen. Gestützt auf seine reichen Energieressourcen fordert es das Recht auf einen eigenen Entwicklungsweg ebenso wie auf eine Mitsprache in weltpolitischen Fragen „auf gleicher Augenhöhe“. Im Gegensatz zu John McCain, seinem Mitbewerber um die Präsidentschaft, vertritt Obama die Auffassung, dass ein Gegner nicht niedergerungen oder ausgegrenzt, sondern durch eine Strategie des „engagements“ eingebunden und sein Verhalten verändert werden soll. Die Administration behandelt daher Russland mit einer Mischung aus Kooperation und Containment. Sie hat erkannt, dass eine Stabilisierung der Kaukasus-Region und des Mittleren Ostens sowie die Verhinderung eines nuklear gerüsteten Iran ohne russische Unterstützung keinen Erfolg haben werden. Der Wunsch nach Zusammenarbeit mit Russland entspricht auch den Interessen Deutschlands, das in hohem Maße von Öl- und Gaseinfuhren aus Sibirien angewiesen ist und sich um einen kooperativen – allerdings nicht unkritischen – Umgang mit Moskau bemüht. In der Vergangenheit war es deshalb scharfer amerikanischer Kritik ausgesetzt. Die Administration will auch verstärkt mit China kooperieren und dieses in regionale Sicherheitsstrukturen einbeziehen. Voraussetzung ist aber, dass sich die Volksrepublik an die Spielregeln hält und es nicht zu einem Konflikt über Taiwan kommt oder durch grobe Verletzungen der Menschenrechte die Öffentlichkeit der USA gegen China aufgebracht wird. 5. Transatlantische Meinungsverschiedenheiten Die Mehrzahl der Europäer knüpft große Hoffnungen an die neue Administration. Obamas Ankündigung, Guantanamo zu schließen, die Truppen aus dem Irak abzuziehen, eine neue Klimapolitik zu initiieren und die multilateralen Institutionen zu stärken, sind in Europa enthusiastisch begrüßt worden und haben große Erwartungen geweckt. Es wäre aber voreilig, von der neuen Administration fundamentale Änderungen in der Außenpolitik zu erwarten. Nicht alle im Wahlkampf gemachten Versprechen dürfen auf die Goldwaage gelegt werden, da im Frühjahr 2008 weder die Wirtschaftskrise noch der Gaza-Krieg abzusehen waren. 316 Helga Haftendorn Ein Hauptproblem ist die auch bei der neuen Administration sichtbare Tendenz zum einseitigen Vorgehen. Um seine Entschlossenheit zum Handeln zu demonstrieren, kündigte der Präsident seine ersten außenpolitischen Maßnahmen ohne Konsultationen mit den Partnern an. Bei der neuen Nahostinitiative war von einer Einbeziehung des „Quartetts“ – neben den USA Russland, die UN und die EU – nicht die Rede. In seiner ersten Botschaft an die NATO forderte er die Partner zu einem stärkeren Engagement in Afghanistan auf. Er lud sie aber nicht ein, zusammen mit Washington über eine geeignete Strategie nachzudenken. Auch in vielen Sachfragen wird es weiterhin zwischen Amerikanern und Europäern (aber auch unter den Europäern) unterschiedliche Einschätzungen geben. Bisher gibt es keinen Konsens über das Vorgehen in Afghanistan. Zwar sieht Obama – nun ähnlich wie die Europäer – in der Intensivierung der Anstrengungen beim zivilen Wiederaufbau und in regionalen Verhandlungen mit den Nachbarn sowie den Taliban wichtige Voraussetzungen für eine nachhaltige Stabilisierung des Landes. Zunächst setzt er aber auf eine Verstärkung der Kampfeinsätze und fordert von den Allianzpartnern ein größeres Engagement und die Aufhebung von Dislozierungsbeschränkungen. Die kriegsmüden Europäer drängen dagegen auf eine Verhandlungslösung unter Einbeziehung der Nachbarstaaten und die Entwicklung einer „Exit-Option“ für Afghanistan. Weitere transatlantische Konflikte sind in der Handelspolitik zu erwarten. Im Wahlkampf hat sich Obama kritisch über das nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) geäußert und eine Überprüfung der Abkommen mit verschiedenen Staaten, z.B. Kolumbien, gefordert. Diese Äußerungen lassen sich zwar als Wahlkampfrhetorik abtun; die akuten wirtschaftlichen Schwierigkeiten könnten aber vor allem den Kongress dazu verleiten, die Rezession mit protektionistischen Maßnahmen zu bekämpfen. Gerade unter den demokratischen Kongressmitgliedern gibt es viele Befürworter eines handelspolitischen Kurses, der die einheimische Industrie schützt und die Arbeitsplätze sichert. Ein erfolgreicher Abschluss der Doha-Runde ist unter diesen Bedingungen kaum zu erwarten, auch wenn die meisten Regierungsmitglieder Befürworter einer liberalen Außenwirtschaftspolitik sind. Es ist aber zu erwarten, dass diese und andere „Knackpunkte“ zwischen den USA und den Europäern konsensualer als zu Zeiten der Bush-Administration geregelt werden können. Es wird dabei darauf ankommen, welche Bedeutung Washington multinationalen Institutionen und dem internationalen Recht beimisst. Im Wahlkampf hat sich Obama für eine Stärkung der UN ausgesprochen, die er allerdings eher als ein nützliches Instrument amerikanischer Politik denn als eine übernationale Organisation mit auch für die USA bindenden Beschlüssen sieht. Strukturelle Probleme im transatlantischen Beziehungsgefüge 317 Für die Europäer steht an erster Stelle die Frage, welche Rolle die NATO haben wird. Obama betrachtet diese als eine Institution, mit der die USA sowohl die Sicherheit ihres Landes als auch die der Welt fördern können. Im Wahlkampf hat er darauf hingewiesen, dass Amerika und Europa aufgrund geteilter Verantwortung und gemeinsamer Werte Demokratie und Stabilität in Europa verankern sowie ihre Interessen und Werte weltweit verteidigen könnten. Die USA erwarten daher von ihren Verbündeten, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden, sich den Herausforderungen der Stunde stellen und zur Lastenteilung bereit sind.24 Wird die Obama-Administration sie aber als Partner behandeln und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen suchen, durch die Glaubwürdigkeit und Effektivität der Atlantischen Allianz erhöht werden können? Auf dem NATO-Gipfel im April 2009 sind dazu noch keine konkreten Vorschläge zu erwarten. Zunächst muss die Administration eine neue nationale Sicherheitsstrategie entwickeln; sie wird dabei auch die NATO auf den Prüfstand stellen und deren Nutzen für die Bündnispolitik bewerten. Dann wird sie daran gehen, mit den Verbündeten über ein neues Allianzkonzept nachzudenken und, darauf gestützt, Reformen der Organisation und der militärischen Fähigkeiten der Allianz in Angriff nehmen. Inzwischen hat die Obama-Administration allerdings daran zu zweifeln begonnen, dass die europäischen NATO-Partner in der Lage und bereit sind, globale Verantwortung zu übernehmen.25 Sie setzt daher verstärkt auf Koalition der Willigen („coalitions of the willing“), wobei diese Tendenz zu einem weiteren Verlust an Kohäsion in der Allianz führen dürfte. 6. Die Koordinierung transatlantischer Politik Erst nach einer Reform des Bündnisses wird abzuschätzen sein, ob die NATO künftig wieder als Koordinierungsrahmen für die transatlantischen Beziehungen dienen kann. Die Allianz würde davon profitieren, wenn die Zusammenarbeit in enger Abstimmung mit der EU erfolgen würde. Dies wird aber bislang durch das Zypern-Problem erschwert, das der Türkei als Vorwand dient, um eine formale Zusammenarbeit zwischen NATO und EU abzulehnen, so lange Zypern nicht wiedervereinigt ist. Durch eine engere Abstimmung zwischen beiden Organisationen könnten auch Nichtmitglieder wie Schweden, Finnland und Irland in den Dialog einbezogen und die Gefahr innereuropäischer Blockaden vermindert werden. 24 25 Obama, Barack: Statement, 3.3.2008, http://advanced.jhu.edu/academic/government/new-president/foreign-policy-issues/in Dempsey, Judy: U.S. and NATO allies facing hard questions, in: International Herald Tribune, 18.3.2009, in: www.iht.com/bin/printfriendly. php?id=20896764 318 Helga Haftendorn Bereits in seiner Berliner Rede hat Obama versprochen, dass er mit der Europäischen Union partnerschaftlich zusammenarbeiten wolle. Doch was beinhaltet dieses Versprechen? Bei allem Lob für die EU dürfen sich ihre Mitglieder nicht der Illusion hingeben, dass die USA sie als einen Partner von Gewicht betrachtet. In Amerika wird die EU von vielen als „ein humpelnder Riese“ angesehen, der aufgrund nationaler Idiosynkrasien und interner Zerwürfnisse unfähig ist, seine wirtschaftliche Macht in diplomatische oder militärische Stärke umzusetzen.26 Aber selbst wenn es den Europäern gelänge, eine gemeinsame Position zu vertreten, so fehlt ein geeigneter institutioneller Rahmen für die Zusammenarbeit über den Atlantik hinweg. Die EU-USA-Gipfel haben sich in der Vergangenheit als wenig effektiv erwiesen. Sie sollten daher durch die Schaffung eines geeigneten organisatorischen Unterbaus aufgewertet werden. Von Fall zu Fall könnten sie ergänzt werden durch kleinere funktionale Gremien, in denen die USA und die Europäer sachbezogen zusammen arbeiten. Als Vorbilder bieten sich die Vierer-Gruppe, die Library-Group oder die diversen Kontaktgruppen an, die in der Vergangenheit eine erfolgreiche Abstimmung im kleinen Kreis ermöglicht haben. Ursprünglich dienten die von Frankreich und Deutschland in den siebziger Jahren initiierten Weltwirtschaftsgipfel diesem Zweck; sie sind jedoch zu Medienspektakeln degeneriert, die kaum noch einen vertraulichen Meinungsaustausch erlauben. Angesichts der strukturellen Veränderungen im internationalen System entsprechen sie heute weder als G-7 der großen Industriestaaten noch als G-8 unter Mitwirkung Russlands den machtpolitischen Realitäten. Dies wurde beim Wirtschaftsgipfel der Zwanzig Ende November 2008 in Washington deutlich. Künftig werden viele der globalen Probleme – nicht nur die ökonomischen, sondern auch die politischen – im Kreis der 20 besprochen werden müssen. Diese Treffen bedürfen auch eines institutionellen Rahmens und der sorgfältigen Vorbereitung, wenn ihr Ergebnis über Absichtserklärungen und ein Gruppenfoto hinausgehen soll. Auch wenn die USA weiterhin das einflussreichste Land der Welt sind, so haben sie ebenso wie die Staaten Europas den Zenit ihrer Macht überschritten. Der westliche Ordnungsentwurf stößt zunehmend auf selbstbewusst vertretene, autoritäre Gegenmodelle. Um deren Dominanz zu verhindern, ist eine enge europäisch-amerikanische Zusammenarbeit unerlässlich. Aber diese allein ist nicht mehr ausreichend, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen.27 Hinzukommen muss die Kooperation mit anderen Nationen. Die Entwicklung gemeinsamer Lösungsansätze wird aber durch Unsicherheiten in der Einschätzung des 26 27 „Global Trends 2025”, S.32. Frankenberger, Klaus-Dieter: Ein Unterbau für den Westen, in: FAZ, 26.11.2008, S.1. Strukturelle Probleme im transatlantischen Beziehungsgefüge 319 Partners belastet. Noch sind das Misstrauen der Europäer wegen der hegemonialen Ambitionen der USA und in Amerika die Zweifel an der Verlässlichkeit der Europäer nicht überwunden. Bei der Gestaltung der transatlantischen Beziehungen kommt Deutschland eine besondere Verantwortung als „Zentralmacht Europas“28 zu. Für das Land in der Mitte Europas gibt es keinen nationalen oder gar „deutschen Weg“29, weder in den transatlantischen Beziehungen noch in der Außenpolitik insgesamt. Doch wird es dieser Rolle gerecht? Angesichts der militärischen Selbstbindung Deutschlands und des vielen zu zögerlich erscheinenden Vorgehens bei der Bekämpfung der globalen Rezession wird in Washington bezweifelt, dass Berlin eine Führungsrolle ausüben kann. Die Bundesregierung sollte sich daher in Abstimmung mit ihren europäischen Partnern um die Erneuerung einer starken gemeinsamen Stimme bemühen, wenn Deutschland nicht sukzessive an politischer Relevanz verlieren will. Außerdem sollte sie über geeignete multilaterale transatlantische Prozesse und Strukturen zur Konfliktregelung nachdenken. Die in den letzten Jahren präferierten bilateralen Kontakte bergen die Gefahr neuer Spannungen. Sie könnten eine über die Langsamkeit der Entscheidungsprozesse frustrierte amerikanische Administration dazu veranlassen, die Europäer auseinanderzudividieren. Noch abträglicher wäre es, wenn Washington, trotz aller anderslautenden Bekenntnisse, in den Unilateralismus der Bush-Administration zurückfiele. 28 29 Schwarz, Hans-Peter: Die Zentralmacht Europas auf Kontinuitätskurs. Deutschland stabilisiert den Kontinent, in: Internationale Politik, 11/1999, S.1-10. Rede des Bundeskanzlers Gerhard Schröder zum SPD-Wahlkampfauftakt in Hannover am 5.8.2002, www.wahlkampf2002.net/redendokumente.htlm Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen euro-atlantischen Strategie Thomas Jäger 1. Auf dem Weg zur post-amerikanischen Welt? Auch wenn es über die konkrete Ausgestaltung der internationalen Ordnung, die aus dem „unipolaren Moment“, wie es Charles Krauthammer nannte, eine auf Dauer gestellte Dominanz der USA hervorbringen sollte, und es insbesondere über die beziehungsreiche Formation zwischen uniund multilateralen Elementen in der Abfolge der Präsidentschaften nach dem Ost-West-Konflikt von Bush über Clinton zu Bush keinen Konsens gab, sondern verschiedene Strategien der Dominanz gewählt wurden, so blieb das Ziel, die USA als mächtigsten Staat in einer für alle wichtigen Fragen zentralen Rolle zu halten, doch gleich.1 Hegemonie, die Anerkennung ihrer Führungsrolle, konnten die USA in der Zeit nach 1991 von den übrigen Großmächten nicht in gleichem Maß erwarten wie zuvor von den westeuropäischen Staaten. Von diesen nicht, weil sie sich in dem veränderten Umfeld nach dem Ende des Ost-West-Konflikts neu finden und politisch aufstellen mussten und ihren politischen Anspruch in der Einführung einer gemeinsamen Währung ausdrückten. Aber auch die asiatischen Staaten, insbesondere China und Indien, sahen sich selbst eher auf dem Weg zu mehr internationalem Einfluss und mithin in einer kalkulierten Kooperation mit den USA. Aus diesem Blickwinkel nahm die Kraft der Westernisierung ab.2 Die Konsequenzen aus amerikanischer Sicht: So wie durch die ökonomische Macht der EU schon Bipolarität auf dem Gebiet der Wirtschaft hergestellt sei, würden auch in anderen Bereichen die USA ihre herausgehobene Stellung verlieren und in der post-amerikanischen Welt nurmehr ein wichtiger Staat unter anderen sein, die militärische Macht einstweilen ausgenommen.3 Auf dem Gebiet der militärischen Sicherheit erwartet die chinesische Regierung hingegen in naher Zukunft intensiveren Wettbewerb.4 Die amerikanischen Dienste selbst prognos1 2 3 4 Haley, Edward P: Strategies of Dominance. The Misdirection of U.S. Foreign Policy, Washington D.C./Baltimore 2006. Mahbubani, Kishore: The New Asian Hemisphere. The Irresistible Shift of Global Power to the East, New York 2008. Zakaria, Fareed: The Post-American World, New York/London 2008. Information Office of the State Council of the People´s Republic of China: China´s National Defense in 2008, Beijing 2009, S.4. Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen euro-transatlantischen Strategie 321 tizierten zwar, dass die USA auch noch 2025 die militärisch dominante Macht sein werden. Allerdings könnte ihre Fähigkeit zur Machtprojektion durch neue Nuklearwaffenstaaten eingeschränkt werden. Israel und Japan würden auch deshalb an Sicherheit einbüßen können. Doch bleiben es die USA, so die Globalen Trends 2025, die bis zu diesem Jahr die Entwicklung der internationalen Ordnung stärker prägen werden als irgendein anderer Staat, auch wenn sie in der heraufziehenden multipolaren Welt nie mehr den Einfluss erreichen würden, den sie in den letzten Jahren gehabt hätten.5 2. Anfang und Ende der Dominanz? Die große Dominanz der USA in den internationalen Beziehungen nach 1991 ist für die deutsch-amerikanischen Beziehungen und das Verhältnis zwischen Europa und den USA eine sehr schwierige Zeit gewesen. Diese verdeutlicht ein knapper Vergleich des Endes der Präsidentschaft von George H.W. Bush mit dem Anfang der Präsidentschaft von Barack Obama. Unter Präsident Bush (41) hatten die USA, vollständig jedenfalls in ihrer Selbsteinschätzung und vornehmlich in jeder Beurteilung, den militärisch hochgefährlichen Konflikt mit der Sowjetunion friedlich beilegen können. Es war nicht zur von vielen befürchteten militärischen Auseinandersetzung gekommen, als die zweite Weltmacht in sich zusammenbrach. Auf ökonomischem Gebiet wurde der Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus als Durchsetzung des wirtschaftlich effektivsten und sozial gerechtesten, gleichzeitig besonders flexiblen und anpassungsfähigen Systems gefeiert. Die freie Marktwirtschaft hatte sich damit weltweit (mit Ausnahme einiger Pariahstaaten) durchgesetzt. Chinas Entwicklung bestätigte dies nachdrücklich. Die Beziehungen zu Deutschland hatte Präsident Bush im Mai 1989 während seines Besuches als Partnerschaft in der Führung (partnership in leadership) beschrieben und damit die Rolle Deutschlands in den transatlantischen Beziehungen hervorgehoben. Zu Beginn der Amtszeit von Präsident Obama sehen auf allen drei Gebieten die Bedingungen grundlegend anders aus. Zwar sind die USA die stärkste Militärmacht der Welt, doch gerät ihre militärische Handlungsfähigkeit an die Grenze. Die beiden Kriege in Irak und Afghanistan konnten in den letzten Jahren nicht gewonnen werden. Die Lage im Irak wurde stabilisiert, nachdem sich die USA zur Zusammenarbeit mit den Milizen, die sie zuvor bekämpft hatten, entschlossen hatten. Für Afghanistan wird von General Petraeus derzeit eine parallele Strategie ausgearbeitet. Die USA stehen nicht als die Macht dar, die im Bewusstsein militärischer Stärke politisch zurückhaltend agiert, sondern als mit hohen Verlusten Krieg führende Macht. 5 National Intelligence Council: Global Trends 2025. A Transformed World, Washington D.C. 2008, S.93ff. 322 Thomas Jäger Mit dem endgültigen Ausbruch der Finanzkrise hat die kapitalistische Wirtschaftsordnung bewiesen, dass sie sich selbst zu ruinieren in der Lage ist. Damit erlebt die Diskreditierung dieses Wirtschaftssystems, die zuvor schon, unter den Präsidenten Clinton und Bush (43) mit dem drastischen Auseinanderklaffen der Einkommen eingesetzt hatte, einen weiteren Schub. Dies schlug derart heftig auf das transatlantische Verhältnis durch, dass Kooperation mit drastischen Warnungen eingefordert wurde.6 Nicht mehr das Gefühl vom Ende der Geschichte, sondern die Suche nach einem neuen ordnungspolitischen Anfang ist weit verbreitet. Schließlich haben sich die deutsch-amerikanischen Beziehungen nicht zur Führung in der Partnerschaft entwickelt, sondern erreichten in den Jahren 2002 und 2003, im Vorfeld des Irakkrieges, einen historischen Tiefpunkt. Sicherheitspolitisch sind sie seither nicht produktiv geworden und mit der Ausweitung des Krieges in Afghanistan und Pakistan steht ein neuer Konflikt an. Ökonomisch gab es tiefe Verstimmungen gerade zwischen der demokratischen Seite der USA und der Großen Koalition zu Beginn der Finanzkrise, deren öffentliche Austragung beweisen, wie wenig belastbar die Beziehungen derzeit sind.7 3. Was wird aus der westlichen Allianz? Das spiegelt sich in der öffentlichen Wahrnehmung. Seit 2004 fordern rund drei Viertel der Deutschen, dass sich die EU als ein den USA gleichwertiger internationaler Akteur konstituieren sollte und insbesondere, dass die EU der primäre Kooperationsrahmen deutscher Sicherheitspolitik sein solle. Die NATO wird auch von den Mitgliedern des Deutschen Bundestages als für die deutsche Außenpolitik nur von nachrangiger Bedeutung angesehen.8 Auch wenn sich die internationalen und inneren Verhältnisse in den letzten Jahren drastisch geändert haben, bleibt Henry Kissingers Frage „Was wird aus der westlichen Allianz?“ für die Diskussion 6 7 8 Boone, Peter/Johnson, Simon: The Next World War? It Could Be Financial, in: The Washington Post, 21.10.2008, B01, http://www.washingtonpost. com/wp-dyn/content/article/2008/10/10/AR2008101002441_pf.html, Stand: 24.1.2009. Krugman, Paul: The economic consequences of Herr Steinbrueck, in: The New York Times, 11.12.2008, unter: http://krugman.blogs.nytimes. com/2008/12/11/the-economic-consequences-of-herr-steinbrueck/, Stand: 29.1.2009. Jäger, Thomas/Oppermann, Kai/Höse, Alexander/Viehrig, Henrike: Die Salienz außenpolitischer Themen im Bundestag. Ergebnisse einer Befragung der Mitglieder des 16. Deutschen Bundestages, in: Arbeitspapiere zur Internationalen Politik und Außenpolitik (AIPA) 4/2006. Die zweite Befragung 2007 bestätigte dieses Ergebnis. Siehe hierzu Dies: The Salience of Foreign Affairs Issues in the German Bundestag, in: Parliamentary Affairs 3/2009. Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen euro-transatlantischen Strategie 323 des transatlantischen Verhältnisses zentral.9 Seine Antworten sind nicht in allen Teilen überholt, stehen bleibt: „Vielleicht gibt es für die Länder des Westens keine dringlichere Frage als die nach dem Bilde, das sie sich von ihrer Zukunft machen.“ Das Management der transatlantischen Beziehungen selbst ist dann die vorherrschende Aufgabe der Regierungen und Gesellschaften.10 Hierfür lässt sich eine Reihe von Gründen anführen, insbesondere, dass beide Seiten miteinander besser die Wohlfahrt ihrer Gesellschaften sicherstellen können, dass die USA für die sicherheitspolitische Entwicklung Europas noch immer eine wichtige Rolle spielen, vor allem aber, dass beide zusammen handlungsmächtiger für internationale Sicherheit sorgen können.11 Dabei liegt die Betonung nicht nur auf handlungsmächtiger, sondern insbesondere auf zusammen. Denn internationale Sicherheit, so hatte Peterson in realistischer Tradition argumentiert, setzt die Dominanz von Status quo-Mächten voraus. 1996 war noch nicht abzusehen, dass sich die USA kurze Zeit später von einer Status quo-Macht zu einer quasi-revolutionären Macht in den internationalen Beziehungen entwickeln würden. Sie strebten zwar nicht die Veränderung der internationalen Ordnung an, wollten aber regionale Ordnungsstrukturen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, mit Gewalt ändern. 4. Das Ende der Westernisierung ist nicht das Ende des Westens Die Entwicklungen in den USA und Europa waren nie gleichförmig, der Westen war stets ein heterogenes Gebilde und keine einheitliche Formation. Viele der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die beide Seiten des Atlantiks voneinander trennen, sind älter als die bisher angesprochenen Gründe, die in den Veränderungen der internationalen Ordnung zu suchen sind.12 Und sicherlich wird in den nächsten Monaten und Jahren angesichts der finanziellen und ökonomischen Probleme eine Verschiebung der Prioritäten zu beobachten sein. Ob hieraus eine höhere Heterogenität der westlichen Industriegesellschaften oder eine stärkere Angleichung resultiert, bleibt abzuwarten. Die Verlautbarungen in den USA deuten auf die letztere Entwicklung hin, als Verlaut9 10 11 12 Kissinger, Henry: Was wird aus der westlichen Allianz?, Wien/Düsseldorf 1965, das folgende Zitat dort S.293. Diesen Gedanken habe ich an anderer Stelle ausgeführt. Jäger, Thomas: Die Entwicklung der transatlantischen Beziehungen unter den Bedingungen machtpolitischer Asymmetrie und kultureller Differenz, in: Transatlantische Beziehungen. Sicherheit – Wirtschaft – Öffentlichkeit, hrsg. von Thomas Jäger, Alexander Höse und Kai Oppermann, Wiesbaden 2005, S.13-33. Peterson, John: Europe and America. The Prospects for Partnership, London/ New York 1996, S.2, 8f. Kopstein, Jeffrey/Steinmo, Sven (Hrsg.): Growing Apart? America and Europe in the Twenty-First Century, Cambridge 2008. 324 Thomas Jäger barung nicht zum ersten Mal. Die Politik der Selbstvergewisserung wird in naher Zukunft in den USA eine höhere Bedeutung erlangen.13 Über das veränderte Verhältnis von Religion und Politik ist nach deren konservativer Instrumentalisierung schon eine breite Debatte ausgebrochen14, ebenso über die Einwanderung.15 Auch in der Europäischen Union wird die Diskussion über Grenzen und Identität mit Blick auf die Türkei und die Ukraine neu entfacht werden. Welche Entwicklung die USA gesellschaftlich nun nehmen, ist ein wichtiger Faktor für die Bestimmung der zukünftigen amerikanischen Interessen. Denn die jetzt sich neu organisierenden Interessen werden ihren Einfluss mittelfristig geltend machen. Für die kurze Frist stehen aber drei andere grundlegende Fragen der Veränderung an, die davon geleitet sind, dass die jeweilige Regierung und der jeweilige Präsident eine bedeutende Rolle bei der Politikgestaltung spielen. Neben diesen eher kurz- und mittelfristig wirkenden Faktoren sollten die langfristigen nicht übersehen werden. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass die Entwicklung der deutsch-amerikanischen Beziehungen von den folgenden drei Fragen intensiv beeinflusst wird. 5. Der Obama-Faktor Präsident Obama hat seinen Wahlkampf so geführt, dass die politischen Inhalte und die bewegungspolitische Aufbereitung zentral auf seine Person bezogen waren. Das verwundert in einem Präsidentschaftswahlkampf nicht, war aber schon früher die Handschrift seines Wahlkampfstrategen David Axelrod. Da Axelrod im Weißen Haus eine ähnlich herausgehobene Stellung einnimmt, wie sie bisher nur Karl Rove zukam, kann erwartet werden, dass er Obama auch als Präsidenten so gestalten wird, dass die Wahlen 2012 gewonnen werden können. Obama muss in den USA kommunizierbar bleiben. Hierzu ist notwendig, über die Bewegung von 2008 hinaus Wählerkoalitionen aufzubauen, die auch angesichts der zu erwartenden Schwierigkeiten stabil gehalten werden können. Dies wird parallel zur Bearbeitung der anstehenden Aufgaben erfolgen, policy und politics werden, wie in den letzten acht Jahren, Hand in Hand gehen.16 Deshalb stellt sich die Frage, welche öffentliche Ausgestaltung Obama als 13 14 15 16 Schuck, Peter H./Wilson, James Q. (Hrsg.): Understanding America. The Anatomy of an Exceptional Nation New York 2008. Die ethnische Dimension dieser Entwicklung hatte Samuel Huntington thematisiert. Dionne, E.J. Jr.: Souled out. Reclaiming Faith and Politics After the Religious Right, Princeton/Oxford 2008. Barone, Michael: The New Americans. How the Melting Pot can Work Again, Washington D.C., 2.Aufl., 2006. Moore, James/Slater, Wayne: The Architect. Karl Rove and the Dream of Absolute Power, New York 2006. Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen euro-transatlantischen Strategie 325 Präsident erfahren wird. Das lässt sich nach den ersten Wochen noch nicht vollständig absehen. Es kommen gemischte Signale. Das Konjunkturpaket beispielsweise enthielt deutlich mehr Anteil an Steuersenkungen, als die Demokraten im Kongress befürworteten, und auch hinsichtlich der Steuergesetzgebung waren die ersten Äußerungen Obamas dazu angetan, republikanische Positionen zu integrieren. Auch beim Kampf gegen den Terror, der weiter unten ausgeführt wird, war dieses Doppelspiel zu beobachten. Für die Einschätzung der deutsch-amerikanischen Beziehungen der nächsten acht Jahre ist nicht unerheblich, welcher Präsident Obama sein wird. Je nach thematischen und symbolischen Schwerpunkten könnte Deutschland ein eher wichtiger oder ein eher nachrangiger Partner werden. Der Präsident hat seine Prioritäten noch nicht gesetzt. Sie werden ihm teilweise von außen aufgezwungen werden, aber er wird sie in einer Weise öffentlich interpretieren, die es ihm erlaubt, sich als erfolgreich darzustellen. Dies wird genau zu beobachten sein, um die deutschen Einflusschancen zu erkennen. Denn im Verhältnis der beiden steht fest, wer sich in die Prioritäten des anderen einfinden muss, soll es zu einer Revitalisierung des transatlantischen Verhältnisses kommen. 6. Die Stellung der Exekutive in den USA Die Entwicklung des politischen Systems der USA hatte unter der Präsidentschaft Bush/Cheney eine Konzentration der Entscheidungs- und Umsetzungsfähigkeit auf Seiten der Exekutive erfahren.17 Je nach politischer Intention ist von einer neuen Phase der imperialen Präsidentschaft gesprochen worden18 oder von der dunklen Seite der Macht.19 Die Regierung hatte aufgrund eigener rechtlicher Expertise den Kongress aus einer Reihe von zentralen Entscheidungen ausgeschlossen, nicht informiert und auf Nachfrage das Recht, bestimmte Informationen zu erhalten, bestritten. Sie ist dafür sogar von eigenen Juristen heftig kritisiert worden.20 Für die nahe Zukunft stellt sich die Frage, ob das Verhältnis zwischen Präsident und Kongress in der unter Präsident Bush ausgebildeten Form bestehen bleibt oder ob es dem Kongress gelingt, Partizipations- und Kontrolloptionen zurückzuholen. Das ist für die Gestaltung der bilateralen und transatlantischen Beziehungen wichtig, um die Diskussion in den 17 18 19 20 Gellman, Barton: Angler. The Cheney Vice Presidency, New York 2008. Cohen, Adam: Just What the Founders Feared: An Imperial President Goes to War, in: The New York Times, 23.7.2007, http://www.nytimes. com/2007/07/23/opinion/23mon4.html, Stand: 12.1.2009. Mayer, Jane: The Dark Side. The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals, New York 2008. Goldsmith, Jack: The Terror Presidency. Law and Judgement Inside the Bush Administration, New York 2007. 326 Thomas Jäger USA richtig einschätzen und politisch die relevanten Verbündeten identifizieren zu können. Die bisherigen Hinweise auf das Programm von Präsident Obama lassen darauf schließen, dass er versuchen wird, die herausgehobene Stellung der Exekutive zu bewahren. Erstens wird immer wieder darauf hingewiesen, dass sein deutlicher Wahlsieg eine eigenständige Legitimation zur Führung des Landes bedeute; zweitens laufen alle Programme, insbesondere die über 1.500 Milliarden schweren Konjunktur- und Unterstützungsgesetze, auf eine zumindest pekuniär unvergleichliche Handlungsmacht der Regierung hinaus; drittens sehen die Reformen insbesondere im Gesundheitsbereich eine größere Rolle des Staates vor. Alle Pläne der Demokraten,21 aber auch die der Reform-Republikaner22 sehen für die Zukunft kein small government in den USA. Für die Überlegungen zu einer gemeinsamen transatlantischen Strategie und der Rolle, die Deutschland darin einnehmen kann, ist es von Bedeutung, über welchen Handlungsspielraum die amerikanische Exekutive in ihrer Beziehung zum Kongress verfügt. Dieser stellt zwischen den Wahlen den einzigen Vetospieler im politischen System der USA dar. Die öffentliche Meinung, der zweite Vetospieler, der allerdings nur bei Wahlen wirklich relevant ist, wird von der Administration Obama sicherlich anders und klüger gesteuert werden, als dies der Administration Bush nach 2004 gelang. Sie wird zudem derzeit nicht fürchten müssen, dass die Medien sie ähnlich kritisch begleiten, wie dies in der zweiten Amtszeit von Bush der Fall war. Das deutet auf eine starke Stellung der Exekutive der USA hin. 7. Neue amerikanische Außenpolitik? Zur Entfremdung zwischen den USA und Europa hatte wesentlich die Außenpolitik von Präsident Bush beigetragen, die es als unerheblich ansah, die hegemoniale Stellung der USA im Westen aufrechtzuerhalten. Die eigenen Fähigkeiten wurden als ausreichend angesehen, die Erfahrungen der Koalitionskriegsführung aus dem Kosovokrieg sprachen ebenfalls für autonomes Handeln, und die Terroranschläge vom 11. September 2001 statteten die Administration mit einem dicken Legitimationspolster bei der eigenen Bevölkerung aus. Und nur die amerikanische Bevölkerung war in der Einschätzung der USA für die Legitimation wichtig.23 Hier hatte sich die Beurteilung seit dem ebenfalls ohne UN-Mandat geführten Kosovokrieg gewandelt. 21 22 23 Emanuel, Rahm/Reed, Bruce: The Plan. Big Ideas for America, New York 2006. Frum, David: Comeback. Conservatism That Can Win Again, New York 2008. Jäger, Thomas: Die Rolle der amerikanischen Öffentlichkeit im unipolaren System und die Bedeutung von Public Diplomacy als strategischer und taktischer Kommunikation, in: Die amerikanische Regierung gegen die Weltöffentlichkeit? Theoretische und empirische Analysen der Public Diplomacy zum Irakkrieg, hrsg. von Thomas Jäger und Henrike Viehrig, Wiesbaden 2008, S.15-38. Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen euro-transatlantischen Strategie 327 Als die amerikanische Bevölkerung ihrer Regierung die Unterstützung für die Außenpolitik versagte und bei den Wahlen 2006 die damalige Opposition wählte, gelangte diese Form des Unilateralismus an ihr Ende. Die unilaterale Handlungsoption stand nun nicht mehr an erster Stelle, sondern war die Möglichkeit des stärksten Staates der Welt, auch wenn alle anderen sich versagten, alleine bestimmte Ziele zu verfolgen. In dieser Interpretation hatte schon Präsident Clinton unilaterale Politik betrieben. Noch ist nicht abzusehen, welchen Stellenwert unilaterale Handlungen für die Administration Obama haben. Wenig deutet darauf hin, dass die Erwartung eines umfassenden Multilateralismus erfüllt werden wird, auch wenn dies zum außenpolitischen Kanon aller Kandidaten im Wahlkampf 2008 gehörte.24 Die Entscheidungen, die amerikanischen Truppen aus dem Irak abzuziehen, den Krieg in Afghanistan und Pakistan zu intensivieren, Nuklearwaffen im Iran mit allen Mitteln zu verhindern oder die eigenen Nuklearwaffen zu modernisieren, werden alle von der amerikanischen Regierung getroffen. Mitentscheidungen anderer Regierungen sind nicht vorgesehen. Die Frage wird sein, wie sich die amerikanischen, europäischen und deutschen Interessen in einzelnen Konflikten verbinden lassen, ob sie parallel oder gegensätzlich wirken und wer am Ende mit seiner Politik erfolgreich sein wird. Nicht immer muss der stärkste Staat Erfolge erzielen; kein anderer kann ihn daran hindern, Fehler zu begehen. 8. Nukleare Modernisierung Mit der Ankündigung neuer Abrüstungsgespräche mit Russland und der Beschreibung der Vision einer nuklear-waffenfreien Welt nimmt die Nuklearpolitik der Administration Obama erste Konturen an. Schon Senator Kerry hatte zum Antritt seines Amtes als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Senats die parallel mit Russland vorzunehmende Reduzierung auf tausend Sprengköpfe propagiert. Damit griff er eine Diskussion um nukleare Abrüstung auf, die hochrangig geführt wird.25 Der von Präsident Obama im Amt behaltene Verteidigungsminister Gates hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine ausreichende Abschreckungskapazi- 24 25 Jäger, Thomas: Kann die neue amerikanische Administration Hegemonie provozieren? Nach George W. Bush zeichnet sich ein neuer außenpolitischer Konsens ab, in: Sicherheit und Frieden 3/2008, S.119-126. Shultz, George P./Perry, William J./Kissinger, Henry A. u.a.: Toward a Nuclear-Free World, in: The Wall Street Journal, 15.1.2008, http://online.wsj.com/ article/SB120036422673589947.html?mod=opinion_main_commentaries, Stand: 16.1.2009. 328 Thomas Jäger tät aufrechtzuerhalten,26 und das bedeutet, die Nuklearwaffen zu modernisieren, wie es das Reliable Replacement Warhead Program vorsieht. Hier wird es noch zu Auseinandersetzungen in der Administration kommen und noch ist die politische Linie nicht zu erkennen. In Deutschland wird sie hingegen vorweggenommen, indem Präsident Obama auf das Interesse an weiterführenden Abrüstungsschritten festgelegt wird. Aus dem State Department wurde hiervor gewarnt, weil dies eine den amerikanischen Prioritäten nicht angemessene Einschätzung sein könnte.27 Insbesondere wird auch von der neuen Administration der Nexus zwischen terroristischen Vereinigungen und Massenvernichtungswaffen betont. „The gravest threat that America faces is the danger that weapons of mass destruction will fall into the hands of terrorists.”28 Solange dieser Zusammenhang als größte Gefahr für die amerikanische Sicherheit gesehen wird und das strategische Denken anleitet, ist nicht zu erkennen, wie der Kampf gegen den Terror, der genau auf diesem Nexus aufbaut, beendet werden kann. 9. Afghanistan und Pakistan Die neue amerikanische Administration beabsichtigt, den Krieg gegen den Terror, zu dessen Hauptschauplatz die Regierung Bush den Irak erklärt hatte, in Afghanistan zu intensivieren. Dies schließt das Grenzgebiet zu Pakistan mit ein. Präsident Obama hat, wenige Tage im Amt, weitere zwei Angriffe mit Drohnen in Pakistan befohlen. Anders als für Guantanamo, dessen Schließung am ersten Tag verkündet wurde, wurde für das fast dreimal größere Gefängnis in Bagram nahe Kabul nur eine Überprüfungskommission eingesetzt, die innerhalb der ersten sechs Monate einen Bericht vorlegen soll. Diese Zweigleisigkeit verdeutlicht, dass auch unter Präsident Obama der Krieg gegen den Terror weitergeführt wird.29 Deutlich wurde dies auch im Zusammenhang des Gazakrieges, der noch vor die Amtseinführung Obamas fiel. Hillary Clinton hatte in ihrer Anhörung vor dem Senat erklärt, dass auch die neue Administration keine Gespräche mit der Hamas führen werde, solange diese sich nicht von ihrem Programm distanziert. 26 27 28 29 Gates, Robert M.: A Balanced Strategy. Reprogramming the Pentagon for a New Age, in: Foreign Affairs, Januar/Februar 2009, http://www.foreignaffairs. org/20090101faessay88103-p10/robert-m-gates/a-balanced-strategy.html, Stand: 17.1.2009. Guevara, Hugo: Germany´s Transatlantic Agenda: Recipe for Disappointment, AICGS 19.9.2008. Das Dokument wurde nach einigen Tagen von der Homepage genommen und ist derzeit im Netz nicht zu finden. Senate Confirmation Hearing: Hillary Clinton, in: The New York Times, 13.1.2009, http://www.nytimes.com/2009/01/13/us/politics/13text-clinton. html, S.14ff., Stand: 14.1.2009. Eine andere Einschätzung über die strategische Ausrichtung der amerikanischen Politik vertritt Roger Cohen: After the War on Terror, in: The New York Times, 29.1.2009, http://www.nytimes.com/2009/01/29/opinion/29cohen. html?_r=1&ref=opinion, Stand: 29.1.2009. Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen euro-transatlantischen Strategie 329 Dieser langanhaltende Krieg, der möglicherweise einen neuen Namen bekommen wird, soll in Afghanistan intensiviert werden. Der Druck auf die afghanische Regierung soll erhöht und die Distanz zu Präsident Karzai, dem entscheidenden Verbündeten von Präsident Bush in Afghanistan, hergestellt werden. Parallel zur militärischen Aufrüstung um mehrere zehntausend Soldaten deutet sich an, dass die amerikanische Regierung das Konzept des Irakkrieges nach Afghanistan transferieren möchte: Koalitionen mit lokalen Machthabern eingehen, um das Land zu befrieden. Dieser Strategiewechsel stand hinter dem Erfolg der surge im Irak. Allerdings weist der Irak eine andere ethnische Struktur als Afghanistan auf, weshalb hier aus dem gleichen amerikanischen Verhalten ein Bürgerkrieg gegen die Paschtunen, die Hauptträger der Taliban, resultieren könnte. Die Gefahren sind für das afghanische Territorium schon enorm, sie potenzieren sich, wenn die Kampfhandlungen nach Pakistan ausgeweitet werden. In ihrer Anhörung vor dem Senat hat die neue amerikanische Außenministerin Clinton den Konflikt schon unter Nennung beider Staaten beschrieben, und im amerikanischen Jargon bildet sich die Bezeichung „Af Pak“ heraus.30 Hier ergeben sich möglicherweise sehr bald unterschiedliche Einschätzungen zwischen Washington und Berlin, da die amerikanische Regierung für den Kampf in Afghanistan frische Truppen und mehr Geld benötigt und die Bundesregierung beides nicht zur Verfügung stellen will. Es mag sich dann als Nachteil erweisen, die letzten Jahre in Deutschland nicht intensiver dafür genutzt zu haben, über eine alternative Strategie für diesen Konflikt nachgedacht zu haben. Denn der seitens der Bundesregierung betonte Ansatz, einen Staat samt Zivilgesellschaft aufbauen zu wollen, hat bisher eher geringe Erfolge gezeitigt und wirkte eher verhüllend als aufklärend. Die Vermeidung kognitiver Dissonanzen führt häufig in tiefere Probleme. Die mangelhafte politische und strategische Abstimmung könnte nun die Kosten für alle Beteiligten erhöhen, wenn die amerikanische Regierung diesen Krieg intensivieren will. 10. Nuklearmacht Iran? Mit allen diesen Fragen hängt die regionale und internationale Rolle des Iran zusammen, manche Beobachter sehen in der iranischen Regierung sogar einen Schlüssel, die verschiedenen Probleme zu lösen. Das mag übertrieben sein. Richtig aber ist, dass die iranische Regierung die USA und ihre Verbündeten, insbesondere Israel, an verschiedenen Standorten im Nahen und Mittleren Osten verletzen kann. Möglicherweise hat diese 30 Senate Confirmation Hearing: Hillary Clinton, in: The New York Times, 13.1.2009, S.14ff. 330 Thomas Jäger Form der Abschreckung durch asymmetrische Kriegsführung dazu beigetragen, dass die Administration Bush keinen militärischen Schlag gegen Iran geführt hat, wie es Vizepräsident Cheney gefordert und die israelische Regierung angeboten hat. Auch die Administration Obama verfolgt das Ziel, dem Iran mit allen Mitteln Nuklearwaffen zu verweigern. Dass dies nun auf diplomatischem Weg möglich sein soll, wird von vielen bezweifelt. Allerdings mangelt es an Ideen, wie der Iran anders davon abgehalten werden kann. Vielleicht muss man eingestehen, dass dies nicht gelingen wird. 11. Das Ende der externen Demokratisierung? Es gibt in den USA eine breite Unterstützung für die Demokratisierung anderer Staaten. Sie reicht von der demokratischen Partei bis zur Idee einer Liga der Demokratien bei John McCain. Präsident Bush, der 2001 mit großen Vorbehalten gegen Projekte des nation-building ins Amt kam, übernahm die Perspektive der Demokratisierung und fügte diese idealistische Komponente seiner Außenpolitik zu. Die Unterstützung demokratischer Entwicklungen lag auch jeweils im Interesse der europäischen Staaten, doch gab es einen kategorialen Unterschied. Während die europäischen Staaten hier einen bottom-up-Ansatz verfolgen, der den Aufbau von zivilgesellschaftlichen Strukturen anstrebt, aus denen später ein demokratisches System erwachsen soll, ging es im amerikanischen Verständnis um Demokratisierung von oben: Elitentausch, Regimewechsel und eine veränderte Anreizstruktur. Die intellektuelle Herkunft solcher Konzepte ist in ökonomischer Literatur leicht zu finden. Präsident Obama hat in seinem ersten Interview, das er einem ausländischen Sender gab, gegenüber Al-Arabiya erklärt: „To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest and mutual respect.“ Dies wurde in den USA als Abkehr von dem Ziel der Demokratisierung verstanden und entsprechend kommentiert.31 Ob damit wirklich die Diplomatie der Freiheit an ihr Ende gekommen ist, wird man abwarten müssen. Jedenfalls lassen sich Zeichen dafür erkennen, dass der von Präsident Bush gewählte Ansatz einer offenen und robusten Demokratisierung nicht mehr die Außenpolitik der USA bestimmen wird. 31 Ajami, Fouad: Obama Tells Arabia´s Despots They`re Safe, in: The Wall Street Journal, 28.1.2009, http://online.wsj.com/article/SB123310499999722371. html, Stand: 29.1.2009. Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen euro-transatlantischen Strategie 331 12. Militärische Prävention Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Doktrin der militärischen Prävention, die Präsident Bush nach der Nationalen Sicherheitsstrategie von 2002 eingeführt hatte, von Präsident Obama aufgehoben werden wird.32 Die Bush-Doktrin war ein Symbol für die unilaterale Ausrichtung der amerikanischen Außenpolitik, weil sie das militärische Handeln der USA außerhalb von internationalem Recht ansiedelte. Restriktionen, die für andere Staaten gelten sollten, wurden für die USA abgelehnt. Zwar wurden die internationalen Normen auch früher missachtet, beim Kosovokrieg beispielsweise, aber die Regierungen bemühten sich erstens dies zu bedauern und zweitens zu heilen. Das Recht auf antizipatorische Selbstverteidigung sollte den USA hingegen aus eigenem Recht, d.h. aus eigener Macht zustehen. Auch ist nicht zu erkennen, dass die amerikanische Art, Krieg zu führen,33 und die damit verbundene Transformation der Streitkräfte aufgehoben werden wird. Die grundlegenden Herausforderungen für die Neuordnung der Sicherheitsinstitutionen haben sich nicht geändert und die im Wahlkampf von Präsident Obama angekündigten Vorhaben deckten sich schon damals passgenau mit den Planungen von Verteidigungsminister Robert Gates. 13. Deutschland und Europa Kann die Bundesregierung ausreichend Einfluss in der EU entfalten, um als Vorreiter einer neuen transatlantischen Agenda erfolgreich agieren zu können? Es ist noch nicht die Frage, ob sie es will, nur, ob sie es kann. Die deutsche Präsidentschaft liegt erst kurze Zeit zurück und sie wurde hierfür nicht verwendet. Die Finanzkrise hat offen gelegt, dass sehr unterschiedliche wirtschaftliche Interessen bestehen und divergierende Lösungen zu ihrer Überwindung beschlossen wurden, und zwar nicht nur zwischen der EU und den USA, sondern auch innerhalb der EU. Über die Irakpolitik bestand von Beginn an Uneinigkeit und die Afghanistanpolitik hat tiefe Gräben zwischen den NATO-Mitgliedstaaten dokumentiert. Die Energiepolitik weist äußerst unterschiedliche Strategien sowohl innerhalb der EU (etwa am Beispiel der Kernenergie) als auch zwischen den USA und der EU aus. Die Russlandpolitik ist zwischen den EU-Staaten und im transatlan32 33 Jäger, Thomas/Höse, Alexander/Oppermann, Kai (Hrsg.): Die Sicherheitsstrategien Europas und der USA. Transatlantische Entwürfe für eine Weltordnungspolitik, Baden-Baden 2005. Boot, Max: The New American Way of War, in: Foreign Affairs, Juli/August 2003, http://www.foreignaffairs.org/20030701faessay15404/max-boot/thenew-american-way-of-war.html, Stand: 18.1.2009. 332 Thomas Jäger tischen Verhältnis umstritten. Einzig in der Klimapolitik sind Beschlüsse gefasst worden, die eine größere Übereinstimmung mit der neuen amerikanischen Regierung erwarten lassen. Doch wird hier die Finanzkrise dahingehend Spuren hinterlassen, dass das Thema an Priorität einbüßt und eine erfolgreiche amerikanische Umweltpolitik Exportkonkurrenz auslösen könnte. Die derzeit sichtbaren amerikanischen Prioritäten sind nicht die deutschen und umgekehrt. Und wo die gleichen Prioritäten bestehen, etwa bei der Stabilisierung der Welthandelsordnung, existieren unterschiedliche Interessen. Die geld- und handelspolitische Konkurrenz könnte in kurzer Frist verschärft werden. Darauf, wie auf die Intensivierung der Kriege, die seitens der USA und der NATO gerade geführt werden, wird die Bundesregierung vorbereitet sein. Jedenfalls sollte das Nachdenken über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen einen hohen Stellenwert in der Regierung einnehmen. Die EU-Mitgliedstaaten nehmen auf den wichtigen Gebieten unterschiedliche Positionen ein und stehen bei der Festlegung der transatlantischen Agenda in Konkurrenz zueinander. 14. Deutschland und die USA Es ist fraglich, ob es in den zentralen Herausforderungen zu Beginn des Jahres 2009, so wie sie von den Regierungen wahrgenommen und interpretiert werden, ausreichend Übereinstimmungen zwischen der amerikanischen und deutschen Auffassung gibt, um in den bilateralen Beziehungen den Kern einer neuen transatlantischen Agenda ausarbeiten zu können. Diese setzt voraus, dass die gleichen Herausforderungen wahrgenommen werden, dass diese Herausforderungen und die möglichen Lösungen kompatibel interpretiert und bewertet werden, dass über die Prioritätenliste Einigkeit besteht und schließlich ein Modus zur Verteilung von Kosten und Gewinnen gefunden werden kann, dem alle Beteiligten zustimmen können. Angesichts der Bedeutung, die die USA für Deutschland und die europäische Entwicklung immer noch haben, angesichts ihrer überragenden Stellung in den internationalen Beziehungen und der Tatsache, dass größere Konflikte ohne sie nicht produktiv bearbeitet werden können, ist es keine gute Ausgangslange, wenn die Prioritäten zwischen Deutschland und den USA inkompatibel und die politischen Interessen disparat sind. Die Arbeit am transatlantischen Verhältnis beginnt für beide zu Hause. Für die USA, weil sie zur Wiedererlangung ihrer hegemonialen Stellung im Westen auf die politischen Prioritäten ihrer Verbündeten Rücksicht nehmen müssen. Für Deutschland, weil es, um Einfluss gewinnen zu können, die politischen Prioritäten der USA berücksichtigen muss. Derzeit aber schei- Berlin – Washington: Nucleus einer gemeinsamen euro-transatlantischen Strategie 333 nen beide Staaten zu sehr mit eigenen Schwierigkeiten konfrontiert, um sich dieser Aufgabe widmen zu können. Dabei stellt die Gestaltung der internationalen Ordnung in sicherheits- und wirtschaftspolitischer Hinsicht die primäre, andere Herausforderungen beeinflussende Aufgabe dar. In den USA sieht man dies aufgrund der eigenen Größe hin und wieder nicht, in Deutschland wegen der Orientierung auf die EU nicht. Das wäre aber nicht nur ein Rezept für Enttäuschungen, sondern in der gegebenen Lage eine katastrophale Entwicklung. 15. Fazit Deutschland ist auf ein stabiles Umfeld in Europa und der Welt angewiesen. Sicherheitspolitische Stabilität und offene Märkte haben die Entfaltung Deutschlands in den letzten Jahrzehnten ermöglicht. An den grundlegenden Bedingungen, die für eine erfolgreiche Entwicklung benötigt werden, hat sich nichts geändert. Kein anderer Staat prägt die Umwelt für deutsche Außenpolitik so stark wie die USA und die amerikanische Position ist für die Gestaltung der regionalen und internationalen Ordnung von großer Bedeutung. Deshalb wäre es den deutschen Interessen förderlich, wenn es eine große Überschneidung mit amerikanischen Interessen geben würde. Das ist derzeit nicht zu beobachten, im Gegenteil bilden sich seit einigen Jahren Indifferenzen und Rivalitäten aus. Das lässt sich unter den gegebenen Bedingungen nur schwer ändern. Die Bundesregierung sollte deshalb Felder der intensivierten Kooperation identifizieren, auf denen gesellschaftliche Interessengruppen parallelen Nutzen erarbeiten können. Dies kann dann eine gute Grundlage für die Verständigung über politische Ordnungsmodelle sein. Bis dahin gilt: Ein Imperativ für deutsche Außenpolitik ist, nicht in diametralen Gegensatz zu den USA zu geraten und die Balance der transatlantischen Beziehungen zur europäischen Entwicklung zu halten. Die deutsch-amerikanische Sicherheitspartnerschaft Christian Schmidt Die zentrale Bedeutung und der hohe Stellenwert der sicherheitspolitischen Partnerschaft Deutschlands mit den USA lassen sich im Kern mit drei grundlegenden gemeinsamen Zielen umschreiben: Wahrung der Freiheit, Erhalt der demokratischen Werte und Sicherung des Wohlstands. Die Bedeutung und Aktualität dieser Inhalte wird im Wesentlichen vor dem Hintergrund der Katastrophen des 20. Jahrhunderts für Deutschland wie für die gesamte Welt deutlich. Der Wiederaufbau Deutschlands, unsere Verankerung in die westliche Wertegemeinschaft und nicht zuletzt die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands 1990 wären ohne amerikanische Hilfe nicht möglich gewesen. Die so geschaffenen Grundlagen einer bei allen Schwankungen und Bewährungsproben doch stets verlässlichen Zusammenarbeit und Sicherheitspartnerschaft zwischen den USA und Deutschland tragen uns noch heute, auch wenn sich die Rahmenbedingungen nach Ende des Kalten Krieges schwieriger und unübersichtlicher gestalten. Im Zeitalter der Globalisierung und komplexer Herausforderungen hat unilaterales staatliches Handeln kaum Aussicht auf Erfolg. Das Handeln im Rahmen von multinationalen Organisationen und Bündnissen, zuallererst in NATO, Europäischer Union und den Vereinten Nationen, ist daher für Deutschland zentrales Element außen- und sicherheitspolitischer Handlungsfähigkeit. Dies ist der Rahmen, in dem wir unsere Freiheit und unseren Wohlstand erhalten sowie wirksame Politik betreiben können. Bi- und multilaterale Partnerschaften und Bündnisse bleiben nur dann effektiv, wenn sie gepflegt werden und sich an veränderte Herausforderungen anpassen. Wie jede Partnerschaft sind sie Schwankungen unterworfen. Dies gilt in ganz besonderem Maße für die Freundschaft und die sicherheitspolitische Partnerschaft mit den USA und damit in einem größeren Kontext auch für die transatlantische Partnerschaft zwischen Nordamerika und Europa. In einer Partnerschaft gilt es auch, die gebotene Offenheit und Ehrlichkeit an den Tag zu legen: Das aktuelle deutschamerikanische Verhältnis ist verbesserungsbedürftig. Unterschiedliche Auffassungen zum Krieg im Irak und fortgesetzte Diskussionen über Die deutsch-amerikanische Sicherheitspartnerschaft 335 eine gerechte Lasten- und Risikoverteilung in aktuellen NATO-Einsätzen haben das Klima auf beiden Seiten teilweise emotionalisiert. Mit der Wahl Barack Obamas zum Präsidenten der USA und seinem Amtsantritt verbindet sich die Hoffnung auf eine Belebung unserer Zusammenarbeit und die Erwartung, dass sich die strategische Partnerschaft mit neuem Leben füllt. Dabei ist es wahrscheinlich, dass die USA Deutschland und Europa nicht mehr als den bevorzugten Partner, sondern als eine unter vielen Regionen betrachten. Natürlich bleibt Europa ein wichtiger und willkommener Partner, aber es gibt keinen Automatismus. Wenn wir also mit den USA zusammenarbeiten wollen, müssen wir etwas dafür tun. Barack Obama und die Demokraten feierten einen großen Wahlsieg. Seit dem Triumph Lyndon B. Johnsons über Barry Goldwater 1964 hat kein Demokrat mehr derart überlegen gewinnen können. Dass dies dem ersten afro-amerikanischen Präsidenten in der Geschichte der USA gelungen ist, verleiht der Wahl zweifellos das Etikett „historisch„. Man kann die Wahl und ihre zu erwartenden Auswirkungen mit den Umbrüchen von 1932 (Roosevelt und der „New Deal„) und von 1980 (Reagan und „Reagonomics„) vergleichen. Barack Obama erreichte nicht nur eine klare Mehrheit bei den Wahlmännern, sondern auch mehr als 50 Prozent aller Stimmen der Bevölkerung. Von Präsident Obama wird nun erwartet, dass er sein Versprechen zur überparteilichen Zusammenarbeit einlöst. Er wird von vielen im In- und Ausland fast als Heilsbringer wahrgenommen. Dennoch gilt es, die Erwartungen an ihn realistisch zu gestalten. Nachdem die USA unter der Präsidentschaft George W. Bushs psychologisch, wirtschaftlich und in ihrer internationalen Anerkennung ein historisches Tief erreicht haben, steht der neue Präsident vor drei zentralen Herausforderungen: – – – Versöhnung der tief verunsicherten und polarisierten amerikanischen Gesellschaft, Umkehrung des wirtschaftlichen und außenpolischen Niedergangs sowie Reduzierung des Glaubwürdigkeitsverlustes der USA im internationalen Kontext. In den nächsten Wochen werden die Versprechen des Wahlkampfes in konkrete Politikpläne transformiert. Innenpolitisch werden von der neuen US-Administration schnelle Erfolge in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit, Bildung sowie Klima und Einwanderungspolitik erwartet. Außenpolitisch drängt eine Reihe weiterer Herausforderungen: Zu nennen sind hier unter anderem der Rückzug der Truppen aus dem Irak, das iranische Nuklearprogramm, ein Neuansatz im Nahost-Friedensprozess angesichts der Kämpfe im Gaza-Konflikt, eine konstruktivere Ausgestaltung der Beziehungen zu Russland, die Verstärkung des internationalen Engagements in Afghanistan sowie die Stabili- 336 Christian Schmidt sierung Pakistans. Aber auch die Fragen nach der amerikanischen Haltung zur Energie- und Klimaschutzpolitik sowie nach der Möglichkeit, die protektionistische Grundstimmung der US-Gewerkschaften mit dem internationalen Freihandel in Einklang zu bringen, werden zu beantworten sein. Das übergeordnete Ziel Obamas wird es sein, die „Marke„ USA durch eine Politik des Multilateralismus (unter Führung der USA) in ein positiveres Licht zu rücken. Unverändert gilt für die neue US-Administration, dass Inneres und Äußeres eng miteinander verknüpft sind und eine ausgreifende Außenpolitik nur durch die Wähler unterstützt wird, wenn es zu einem wirtschaftlichen Aufschwung im Inneren kommt. 1. Die deutsch-amerikanischen sicherheits- und militärpolitischen Beziehungen Die sich abzeichnende Ausgangsposition der neuen US-Administration mit Blick auf die deutsch-amerikanischen, aber auch auf die europäischen Beziehungen (einschließlich NATO) dürfte wohl weitgehend identisch mit der Linie der alten Administration sein und damit auch zukünftig bei folgenden Themen für Auffassungsunterschiede sorgen und damit Diskussionen anregen: – – – Weiterentwicklung der NATO zu einer global handlungsfähigen Allianz, Fähigkeitenaufbau und generelle Erhöhung der Verteidigungsausgaben, Forderung nach Übernahme größerer Lasten und Risiken durch die europäischen Partner, insbesondere auch Deutschlands, zumindest im „Soft-Power-Bereich„, entweder durch Kräfte- und Fähigkeitenbeiträge oder größere finanzielle Leistungen. Für die anstehenden Herausforderungen ist Präsident Obama auf Mitstreiter jenseits seiner Partei und Bewegung angewiesen – auf moderate Republikaner ebenso wie auf Verbündete in Europa und anderswo. Klar ist, dass die Europäer nur insoweit miteinbezogen werden, wie sie auch bereit sind, auf die Erwartungen und Forderungen der USA einzugehen. Die transatlantische Beziehung ist unverändert zentrales Element unseres innen- und außenpolitischen Selbstverständnisses sowie unserer sicherheits- und verteidigungspolitischen Praxis. In diesem Sinne wird es zukünftig besonders darauf ankommen, konsensfähige Elemente einer USamerikanischen Politik und Führungsrolle in jeder Hinsicht – auch bei unseren EU-Partnern – nachhaltig zu unterstützen. Gleichzeitig sollten aber weiterhin die Bestandteile einer USA-Politik, die unseren oder auch europäischen Interessen widersprechen, im Geiste einer engen, traditionell offenen Partnerschaft auch deutlich angesprochen und diskutiert werden. Einen wichtigen Beitrag für eine vertrauensvolle Zusammenar- Die deutsch-amerikanische Sicherheitspartnerschaft 337 beit leistet das über Jahrzehnte entwickelte militärpolitische und militärische bilaterale Netzwerk, das sich in Zeiten der gegenseitigen Irritationen und Missverständnisse als besonders belastbar erwiesen und bewährt hat. Deshalb liegt es in unserem Interesse, die bilateralen Kontakte und gemeinsamen Aktivitäten mit den USA, gerade wegen der Reduzierung der US-amerikanischen Streitkräfte in Deutschland, auf einem möglichst hohen Niveau zu halten und – wo möglich – weiter auszubauen. Die gegenseitige Nutzung von Ausbildungseinrichtungen, Ausbildungs- und Lehrgangsangeboten sowie gemeinsame Übungen sind ein wesentliches Element für die enge Abstimmung im Transformationsprozess und verhindern ungewünschte Abkopplungen. 2. Perspektiven und Chancen An die neue US-amerikanische Regierung ist eine hohe Erwartungshaltung geknüpft, die vor dem Hintergrund der aktuellen Probleme nicht in jeder Hinsicht einzuhalten sein wird. Dennoch scheint es, dass sich hier neue Möglichkeiten für die Ausgestaltung der transatlantischen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA ergeben werden. Für diese Partnerschaft gibt es einen neuen Rückhalt in der deutschen Bevölkerung. Nach den Ergebnissen verschiedener Umfragen zu urteilen, hätten zwischen 70 und 80 Prozent der Deutschen Barack Obama ebenfalls gewählt. Unter den jungen Deutschen ist der Zuspruch für Präsident Obama sogar noch größer, und der unerwartet hohe Zuspruch mit ca. 200.000 Besuchern beim Redeauftritt des damaligen Präsidentschaftskandidaten an der Berliner Siegessäule am 24. Juli 2008 unterstreicht diese Einschätzung. Ein Grund hierfür ist, dass Amerika künftig nicht mehr nur Macht, sondern auch wieder Vorbild und Idee sein will. Nach dem Irakkrieg mit seinen Begleiterscheinungen Abu Ghraib und der Diskussion um Guantanamo sowie der gegenwärtigen Finanzkrise soll Amerika nach dem Willen der neuen Administration seine moralische und politische Autorität wiedergewinnen. So wird der neue Präsident die amerikanischen Truppen schrittweise aus dem Irak abziehen, das Gefangenenlager Guantanamo schließen und die internationalen Partner stärker in die Stabilisierung regionaler Konflikte und die Bewältigung globaler Probleme einbeziehen. Eine verantwortungsvolle Reduzierung der amerikanischen Truppen im Irak (Abzug aller Kampftruppen binnen 18 Monaten, Abzug aller Truppen bis Ende 2011) soll es den USA auch ermöglichen, sich verstärkt in Afghanistan und Pakistan zu engagieren. Flankiert wird der Truppenabzug von verstärktem zivilen Engagement im Irak sowie politischem und diplomatischem Engagement mit allen Staaten der Region, namentlich auch mit Iran und Syrien. Wir erwarten, dass Präsident Obama pragmatisch an die anstehenden Themen herangehen wird. Viele politische Ansätze der alten Administration stehen zurzeit auf dem Prüfstand. Nicht alles wird verändert werden, aber die Schwerpunktsetzung 338 Christian Schmidt Präsident Obamas und seiner Berater entspricht in vielen Punkten eher den Prioritäten der Europäer: Fortschritte beim Klimaschutz und der Entwicklung einer nachhaltigen Energiepolitik, Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte und der Weltwirtschaft, neue Initiativen in der Abrüstung und Rüstungskontrolle und die Bewältigung von regionalen Krisen, vor allem im Nahen Osten. Zudem hat Präsident Obama versprochen, der Diplomatie und dem multilateralen Handeln eine größere Chance zu geben, als dies die Bush-Administration tat. Dies stimmt uns hoffnungsvoll. Allerdings sollten wir uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass Amerika eine Weltmacht bleibt und dass auch dem Multilateralismus eines Präsidenten Obama Grenzen gesetzt sein werden. Nie wird der Multilateralismus für Amerika die gleiche Rolle spielen wie für uns Deutsche. Amerikaner und Europäer vertreten in vielen Bereichen ähnliche Interessen und Sichtweisen. Aber wie jeder andere amerikanische Präsident wird auch Präsident Obama dort, wo Europa und die USA sich unterscheiden, in erster Linie amerikanische Interessen und Sichtweisen vertreten und weiterhin die Führungsrolle für die USA in der Welt beanspruchen. Er hat im Wahlkampf deutlich gemacht, dass auch er das Militär unverändert als Mittel der Außen- und Sicherheitspolitik einsetzen wird. Sollten amerikanische Sicherheitsinteressen bedroht sein, werden der Einflussnahme von Partnern weiterhin Grenzen gesetzt sein. Dennoch scheinen eine größere Transparenz und Einbindung aller Beteiligten bei der Stabilisierung regionaler Konfliktsituationen wieder greifbarer zu werden. So hat Obama im Vorfeld angedeutet, dass seine Administration direkte Gespräche mit Staaten wie Iran und Syrien führen wird, um Verhandlungsspielräume auszuloten und möglicherweise auch realistischere Ziele zu setzen, als dies unter Bush der Fall war. So soll für den Krisenherd Afghanistan eine neue regionale Strategie entwickelt werden, welche den benachbarten Schlüsselstaat Pakistan, aber auch den Iran mit einbezieht. Zudem heißt es im Beraterumfeld Obamas, dass dieser dem möglichen Dialog der afghanischen Regierung mit eventuell verhandlungsbereiten Teilen der Taliban aufgeschlossen gegenüberstehe. Dies sind alles unterstützenswerte Ansätze, die sich mit unseren Ideen decken. Aber auch der Betonung und Umsetzung der weltweiten Abrüstung und Rüstungskontrolle als zentralem Anliegen Deutschlands und Europas wird zukünftig ein größeres Augenmerk geschenkt werden. Präsident Obama hat sich zu dem Ziel einer deutlichen Verringerung der Kernwaffenarsenale und langfristig sogar zum grundsätzlichen Ziel vollständiger nuklearer Abrüstung bekannt, auch wenn er sich im Wahlkampf gegen unilaterale Abrüstungsschritte ausgesprochen hat. Damit soll auch die Glaubwürdigkeit der Nichtverbreitungspolitik der USA wiedergewonnen werden. Für neue weltweite Abrüstungsinitiativen, Lösungsansätze für Regionalkonflikte, aber auch Klimaschutzvereinbarungen und die Sicherung der Energieversorgung muss freilich auch Russland gewonnen werden. Die Die deutsch-amerikanische Sicherheitspartnerschaft 339 Einstellung gegenüber Russland ist nicht nur bei den Republikanern, sondern auch in Teilen der demokratischen Partei und des Kongresses sehr negativ. Präsident Obama hat sich bislang zu diesem Thema, auch während des Georgienkonfliktes im August, zurückhaltend geäußert. Daher besteht die Hoffnung auf eine künftige amerikanische Politik, die gegenüber Russland bei aller Deutlichkeit der Kritik an dortigen Entwicklungen nach möglichst viel partnerschaftlicher Zusammenarbeit strebt und es bei der Lösung drängender internationaler Probleme einbeziehen und nicht ausgrenzen will. 3. NATO Die Nordatlantische Allianz war, ist und bleibt Basis der transatlantischen Beziehungen. Sie ist bewährte Grundlage der kollektiven Verteidigung und stärkster Anker unserer Sicherheit. Die NATO bietet ein einzigartiges transatlantisches Konsultationsforum und bleibt erste Anlaufstelle für militärische Operationen europäischer und amerikanischer Verbündeter. Gegenwärtig wird die Arbeit im transatlantischen Bündnis neben den laufenden Operationen von mehreren Kernthemen dominiert, die teilweise auch kontrovers mit den USA diskutiert werden. Der Gipfel anlässlich des 60. Jahrestages der NATO im April 2009 wird mit der Annahme der „Declaration on Alliance Security„ nicht nur zur Bilanzierung der bisherigen Leistungen des Bündnisses dienen, sondern zugleich mit der Begrüßung des neuen amerikanischen Präsidenten in Europa eine passende Gelegenheit bieten, die atlantische Sicherheitspartnerschaft im Verhältnis zu einer stärkeren europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu definieren. Gegebenenfalls wird ein neues Strategisches Konzept beauftragt werden, das die Entwicklungen nach 1999 besser reflektiert und die Erfahrungen der letzten zehn Jahre auf die künftige Ausrichtung des Bündnisses projiziert. Die USA stehen als Führungsmacht der Allianz vor dem Hintergrund langfristiger Machtverschiebungen im internationalen System und neuer globaler Risiken vor der Herausforderung, die von ihnen geschaffenen multilateralen (aber in letzter Zeit nachrangig genutzten) Strukturen einem sich wandelnden transatlantischen Bündnis anzupassen, um dadurch den eigenen Führungsanspruch zu wahren. Präsident Obama will dazu die bestehenden Strukturen stärken, Prozesse vereinfachen und durch eine starke Einbindung anderer Staaten einen Teil der mit der amerikanischen Führungsrolle verbundenen Kosten und Verpflichtungen mit diesen teilen. Deutschland wird sich weiterhin einer fortgesetzten Diskussion bezüglich einer angemessenen Lasten- und Risikoteilung im Bündnis ausgesetzt sehen, wobei unter der neuen Administration eine Verlagerung des Schwerpunkts auf die Bereitstellung von zivilen Fähigkeiten speziell in Afghanistan erfolgen könnte. 340 Christian Schmidt Neben den laufenden Operationen werden die zahlreichen politischen und militärischen Transformationsthemen weiter zu diskutieren sein. Für die Fortsetzung der Transformation des Bündnisses hat der NATO-Generalsekretär eine ambitionierte, von den USA in weiten Teilen initiierte „Roadmap„ vorgelegt, die auf die Weiterentwicklung des Fähigkeitsprofils (Missile Defence, Zukunft der NATO Response Force, NATO-Kommandostruktur, multinationale Fähigkeitsentwicklung) und auf den Abschluss von Reformen im Bereich des NATO-Hauptquartiers und der NATO-Verteidigungsplanung abzielt. In Zeiten, in denen die Wirtschaftskrise die Haushalte der NATO-Mitgliedstaaten massiv belastet, werden sich allerdings auch die USA gemäßigtere Ziele für den zukünftigen Fähigkeitserwerb setzen müssen bzw. auf multinationale Zusammenarbeit angewiesen sein. Da die NATO aber weitaus mehr als ein rein militärisches Verteidigungsbündnis ist und sich im Kern als ein politisches Bündnis von Staaten gemeinsamer Werte definiert, muss parallel zu der fortschreitenden militärischen Transformation auch die politische Umgestaltung des Bündnisses vorankommen. Deutschland hat deshalb unverändert ein hohes Interesse daran, alle sicherheitspolitischen Probleme ohne Tabus im NATO-Rahmen zu diskutieren. Für uns ist es wichtig, zu einem transatlantischen Konsens zu finden, ohne den die großen Herausforderungen dieser Zeit nicht erfolgreich zu bewältigen sein werden: Gemeinsam analysieren, im Konsens entscheiden und dann gemeinsam entschlossen handeln – das sind die zentralen Maxime, die das Bündnis zukünftig weiter leiten müssen. Am deutlichsten manifestiert sich die enge sicherheitspolitische Partnerschaft gegenwärtig in den NATO-geführten Operationen. Hier muss sich diese Partnerschaft erneut bewähren. ISAF stellt dabei die größte Herausforderung für die Allianz dar. Die USA leisten in Afghanistan einen zentralen Beitrag. Gemeinsames Ziel ist es, im Rahmen des internationalen Engagements die afghanische Regierung zu befähigen, eigenverantwortlich dauerhaft zur Stabilität in einer kritischen Region der Welt beizutragen und eine friedliche wirtschaftliche und soziale Entwicklung Afghanistans zu ermöglichen. Die USA werden dabei weiterhin auf eine faire Teilung von Risiken und Lasten des militärischen Engagements drängen. Aufbau, Ausbildung und Finanzierung der afghanischen Armee, Absicherung der Wahlen in Afghanistan in 2009, die Verbesserung der Sicherheitslage und die Unterstützung der Gesamtoperation ISAF bieten hier zahlreiche Anknüpfungspunkte. Darüber hinaus muss der Konsens über den einzuschlagenden Weg erhalten bleiben und gemeinsam entschieden werden, wie der für Afghanistan vereinbarte umfassende Ansatz konkret weiter ausgestaltet werden soll. Neben ISAF gilt es, den KFOR-Einsatz nicht aus den Augen zu verlieren. Auch in dieser Region sind die USA zentraler Partner. Angesichts der Bin- Die deutsch-amerikanische Sicherheitspartnerschaft 341 dung von US-Kräften an anderen Krisenschauplätzen könnten hier jedoch im Sinne von Lastenteilung und Verantwortungsübernahme die Europäer eine stärkere Rolle übernehmen. Im Wahlkampf hatte Präsident Obama, als Ablösung einer Politik der selektiven Kooperation, die Entwicklung einer umfassenden Strategie gegenüber Russland angekündigt. Ausgelöst durch den Georgien-Konflikt Anfang August 2008 sind die Beziehungen der NATO zu Russland allerdings belastet. Die Erklärung der NATO-Außenminister vom August 2008 zum Konflikt hat unter maßgeblicher Führung der USA gegenüber Russland ein einvernehmliches Zeichen der Entschlossenheit gesetzt. Nach der zukunftsgerichteten Entscheidung der NATO-Außenminister bei ihrem Treffen Anfang Dezember 2008 zur Wiederaufnahme der Gespräche gilt es jetzt wieder, eine verlässliche Partnerschaft aufzubauen. Im Focus steht daneben die Erweiterungspolitik der Allianz. Der sicherheitspolitische Horizont des Bündnisses hat spätestens mit dem Konflikt in Georgien eine vermeintlich bündnispolitische Grenze erfahren, die speziell die Ambitionen der von amerikanischer Seite geförderten Kandidaten Georgien und Ukraine für einen Mitgliedschaftsaktionsplan (MAP) relativiert hat. Schon beim Gipfeltreffen in Bukarest im Jahre 2008 hatten sich nach intensiver Diskussion die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, der Ukraine und Georgien langfristig eine Beitrittsperspektive zu bestätigen. Dazu stehen wir. Aus deutscher Sicht erscheint die politische Reife für eine Aufnahme in einen MAP, entsprechend den Beschlüssen des NATO-Außenministertreffens im Dezember 2008, für beide Staaten aus unterschiedlichen Gründen jedoch aktuell nicht gegeben. Gerade aus diesem Grund bleibt der MAP weiterhin ein unverzichtbarer Schritt zur Aufnahme in die Allianz. Die Schaffung der neuen NATO-GeorgienKommission und die stärkere Nutzung der bestehenden NATO-UkraineKommission sollen den MAP nicht ersetzen, sondern vielmehr der Ausgestaltung des Heranführens an die Allianz dienen und den Reformprozess der beiden Nationen aktiv begleiten. Wir werden beide Nationen sowohl seitens der NATO als auch bilateral weiterhin zielgerichtet unterstützen. Die NATO hat immer wieder erfolgreich die politischen und konzeptionellen Schlussfolgerungen aus dem veränderten sicherheitspolitischen Umfeld gezogen und sich durch ihre militärische und politische Transformation den Herausforderungen im 21. Jahrhundert angepasst. Mit Amtsantritt des neuen amerikanischen Präsidenten sind neue Impulse zu erwarten, welche die Zukunftsperspektive des Bündnisses und dessen Rolle als Eckpfeiler in der transatlantischen Sicherheitsarchitektur beeinflussen werden. Wir stehen für eine behutsame Weiterentwicklung der NATO sowohl in funktionaler (Konsultation und Kooperation) als auch in geographischer 342 Christian Schmidt Hinsicht (immer mit Bezug zur transatlantischen Sicherheit). Dabei gilt, dass die NATO ein Spieler und nicht der Spieler bei internationaler Krisenreaktion im Sinne vernetzter Sicherheit ist, jedoch der Kern der Verteidigungspolitik in Europa bleibt. 4. Europäische Union Mit der 2003 verabschiedeten Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) hat sich die Europäische Union (EU) zum Ziel gesetzt, ihre internationale Verantwortung aktiv wahrzunehmen. 2003 war auch das Jahr, in dem die EU erstmalig eine militärische Operation durchführte. Damit sind die treibenden Kräfte bei der Entwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) benannt: Zum einen ist dies der politische Wille der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der EU, diese zu einem vollwertigen Akteur in der internationalen Politik zu entwickeln, der neben seinem beträchtlichen wirtschaftlichen Gewicht auch seinen Beitrag zur Gewährleistung von Frieden und Sicherheit in der Welt leistet. Zum anderen ist es die steigende Nachfrage nach einem Engagement der EU in verschiedenen Konfliktregionen, sei es in zivilen Missionen oder militärischen Operationen. Dieses umfassende Engagement, das von Europa über Afrika bis nach Zentralasien und in den Kaukasus reicht, ist Ausdruck des in der ESS ausgedrückten Strebens nach einer aktiven, kohärenten und handlungsfähigen Europäischen Union, die konstruktiv mit Partnern zusammenarbeitet. Ein für Deutschland besonders wichtiger Aspekt ist die zivile Komponente der ESVP. Der integrierte zivil-militärische Ansatz der EU zeigt sich nicht zuletzt darin, dass es gelungen ist, das militärische und das zivile Planziel zeitlich zu synchronisieren und damit einen ersten Schritt hin zu einer übergreifenden zivil-militärischen Fähigkeitsplanung zu machen. Darüber hinaus ist durch die Schaffung einer zivilen Planungs- und Führungsfähigkeit unter der Führung eines für alle Missionen zuständigen Leiters eine deutliche Verbesserung europäischer ziviler Fähigkeiten erreicht worden. Mit der nun vom Hohen Repräsentanten/Generalsekretär des Rats, Javier Solana, angekündigten Schaffung eines Direktorats zur strategischen zivil-militärischen Planung wird die EU einen weiteren Schritt zur praktischen Umsetzung des «vernetzten Ansatzes» leisten und damit weiter Vorreiter auf diesem Feld sein. Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist lange Zeit von den USA mit einem durchaus auch kritischen Blick verfolgt worden. Es bestanden Befürchtungen, dass der Ausbau der ESVP zu einer Schwächung der NATO führen könnte, was aus amerikanischer Sicht unbedingt zu vermeiden war. Diese Haltung kann heute als überwunden gelten. Die prak- Die deutsch-amerikanische Sicherheitspartnerschaft 343 tische Erfahrung der vergangenen Jahre hat bewiesen, dass eine Stärkung Europas auch der NATO zugute kommt. Während des NATO-Gipfels in Bukarest im April 2008 unterstrich Präsident Bush in einer bemerkenswerten Positionsänderung, dass aus amerikanischer Sicht eine starke Allianz auch eine starke europäische Verteidigungsfähigkeit voraussetze. Noch expliziter hatte dies vorher die amerikanische NATO-Botschafterin in Vorträgen in Paris und London formuliert: Eine ESVP, die sich auf „soft power“ beschränke, sei nicht genug. Damit ist der Mythos von den konkurrierenden Organisationen endgültig ad acta zu legen. Komplementarität, nicht Konkurrenz, prägt das Zusammenspiel beider Organisationen. 5. Vereinte Nationen Deutschlands Sicherheit war, ist und bleibt untrennbar mit der politischen Entwicklung Europas und der Welt und damit auch Amerikas verbunden. Neben NATO und EU sind die VN wichtiges „drittes Standbein” der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Seit dem Beitritt im Jahr 1973 engagiert sich Deutschland mit stetig steigender Tendenz im System der VN. Die VN sind die einzige internationale Organisation mit universellem Charakter. Ihre Charta bildet den grundlegenden völkerrechtlichen Rahmen für die internationalen Beziehungen. Der VN-Sicherheitsrat trägt die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und die internationale Sicherheit. Wie kaum eine andere Organisation stehen die VN für die Umsetzung einer vernetzten Sicherheit, für die Sicherung des Friedens, die Abwehr globaler Bedrohungen, die Förderung von Demokratie und Menschenrechten, eine nachhaltige Entwicklung und kooperative Sicherheit. Durch die unter ihrer Führung stattfindenden Friedensmissionen genießen die VN im Vergleich zu anderen Organisationen in vielen Regionen der Welt größere politische Akzeptanz und Glaubwürdigkeit bei Konfliktparteien und der Bevölkerung, da die VN nahezu alle Staaten dieser Erde einbinden. Deutschland setzt sich im Rahmen der VN dafür ein, dass auch die VNFriedenssicherung in ein effektives System der politischen und entwicklungspolitischen Begleitung zur Lösung von Konflikten eingebettet ist, denn Friedensmissionen allein schaffen keinen dauerhaften Frieden. Jedoch kann Militärpräsenz günstige Rahmenbedingungen und damit eine Basis für eine zivile Mission und einen erfolgreichen politischen Prozess schaffen. Friedensmissionen müssen eingebettet sein in frühzeitige außen- und entwicklungspolitische Maßnahmen. Politische Stabilität und wirtschaftliche Konsolidierung schaffen auch die Voraussetzungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Beendigung von Friedensmissionen. 344 Christian Schmidt Hier wäre es in unserem Sinne, wenn die neue US-Administration ihre angekündigte stärkere Berücksichtigung von multilateralen Strukturen bei der Konfliktprävention und -reaktion auch im Rahmen und unter Nutzung der Vereinten Nationen umsetzen würde. 6. Rüstungskontrolle Auf Basis eines überwältigenden nuklearen und konventionellen Übergewichts konnten die USA sich ein geringeres Engagement in diesem Bereich erlauben, ohne die eigenen sicherheitspolitischen Interessen kurzund mittelfristig zu vernachlässigen. Ergebnis bisheriger Politik waren Enttäuschung und Vertrauensverlust nicht nur auf russischer Seite, sondern auch bei den Partnern innerhalb der Allianz. Im Bereich der nuklearen Rüstungskontrolle dagegen haben die USA, vor dem Hintergrund der bekannten Proliferationsfälle und einer daraus resultierenden, stetig wachsenden Bedrohung auch des USA-Territoriums, in ihrem Engagement nicht nachgelassen und sich aktiv an der Proliferationsbekämpfung beteiligt. Wesentliche Grundlage einer funktionierenden, sich den sicherheitspolitischen Verhältnissen anpassenden Rüstungskontrolle ist gegenseitiges Vertrauen. Dies gilt sowohl gegenüber den eigenen Partnern als auch gegenüber anderen an Rüstungskontrollregimen beteiligten Staaten. Eben dieses Vertrauen hat in den vergangenen Jahren erheblich Schaden genommen und ist auf russischer Seite einem tiefgreifenden Misstrauen gewichen. Die derzeitige KSE-Krise ist unter anderem auch zu großen Teilen auf dieses gewachsene Misstrauen zurückzuführen. Zu dieser Entwicklung haben auch die USA in erkennbarem Umfang beigetragen. Wesentliche Herausforderung für die Rüstungskontrollpolitik in der nahen Zukunft wird es sein, die Folgen der oben genannten Enttäuschung zu beseitigen und das Vertrauen Russlands wiederzugewinnen. Gelingt dies, ist eine wichtige Voraussetzung für die Lösung bestehender Probleme erfüllt und gleichzeitig die Basis gelegt für eine erforderliche Weiterentwicklung der Rüstungskontrolle, z.B. zur Eindämmung kleinerer, regionaler Konflikte oder global verbindlicher Regeln für Waffenexporte. Der neuen US-Administration kommt hierbei eine herausragende Rolle zu. Im Prozess einer neuen Vertrauensbildung zwischen Russland und den USA kann Deutschland eine besondere Mittlerrolle spielen, die auch positiv auf die deutsch-amerikanischen Beziehungen ausstrahlen und diese wieder im Sinne einer „Partnership in Leadership„ stärken kann. Die deutsch-amerikanische Sicherheitspartnerschaft 345 Erste Signale aus den USA stimmen hoffnungsfroh und machen deutlich, dass die neue US-Administration das Thema Rüstungskontrolle wieder stärker in das Zentrum sicherheitspolitischer Überlegungen zu rücken beabsichtigt. Dies gilt sicherlich vornehmlich für die nukleare Rüstungskontrolle, insbesondere für die anstehenden START-Folgeverhandlungen. Es ist davon auszugehen, dass die USA sich zukünftig auch der konventionellen Rüstungskontrolle zuwenden werden. Vor zu großer Euphorie und unrealistischen Erwartungen muss dennoch gewarnt werden. Der Präsidentenwechsel wird im Bereich der Sicherheitspolitik zu keiner Neudefinition amerikanischer Interessen führen und die USA werden auch unter Präsident Obama nicht gegen die eigenen Interessen handeln. Dies wird aus seinen Äußerungen zum Thema „global zero„ deutlich, in denen er zwar das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt unterstreicht, aber gleichzeitig hervorhebt, dass die USA solange über Nuklearwaffen verfügen werden, wie es anderswo auf der Welt noch solche Waffen gibt. Diese Aussage ist auf einer Linie mit dem im Dezember 2008 vorgelegten Bericht des US-Verteidigungsministeriums „Review of the Department of Defense Nuclear Mission„, der die Notwendigkeit US-amerikanischer Nuklearwaffen zur Abschreckung und zum Schutz der Partner konstatiert. Die USA werden auch weiterhin eine weltweite Führerschaft beanspruchen. Es ist aber zu erwarten, dass den Aspekten Kooperation und Kommunikation ein größerer Stellenwert zugeordnet werden wird. Die sich daraus ergebenden neuen Möglichkeiten für Vertrauensbildung gilt es zu nutzen, um eine langfristig angelegte Weiterentwicklung der Rüstungskontrolle zu ermöglichen und damit zu mehr Sicherheit und Stabilität in der Welt beizutragen. 7. Ausblick Völlig ungeachtet der Entwicklung der Sicherheitslage in Europa und sogar unabhängig von der Einschätzung der konkreten Politik der jeweiligen US-Administration besteht auch heute noch dieses tiefe Vertrauen und die innere Bereitschaft, die USA in Sicherheitsfragen zu akzeptieren. Im Gegenzug sind die europäischen Partner für die USA historisch und kulturell die natürlichsten Partner bei der Gestaltung und Bewältigung der globalen Herausforderungen. Auch künftig werden Grundfragen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik nur gemeinsam mit den USA zu beantworten sein. Das transatlantische Bündnis und die strategische Partnerschaft zwischen NATO und EU bieten sowohl den Europäern als auch Amerikanern einen verlässlichen 346 Christian Schmidt sicherheitspolitischen Handlungsrahmen. Ziel dieser Kooperation müssen die Festigung der Fundamente unserer gemeinsamen Sicherheit sowie substanzielle komplementäre Beiträge zur Lösung der sicherheitspolitischen Herausforderungen sein. Mit dem Amtsantritt der neuen US-Administration sind vor allem Hoffnungen, Erwartungen, große Chancen, aber auch Risiken verbunden. Inmitten der tiefen außenpolitischen und wirtschaftlichen Krise der USA wird der amerikanische Wille zum Neuanfang und Aufbruch, der seit Obamas Wahl am 4. November 2008 noch gewachsen zu sein scheint, immer deutlicher. Im Rahmen seiner Vereidigung am 21. Januar 2009 wurde nicht nur die euphorische Erwartungshaltung auf Seiten der Amerikaner deutlich, sondern auch, dass der neue Präsident seine amerikanischen Landsleute für eine Agenda mobilisieren möchte, die – gerade in und wegen der tiefen Krise – auf traditionelle Tugenden, nationale Einheit, Dienst am Gemeinwohl, die differenzierende Kraft der Vernunft und einen Neuanfang gegenüber der Welt setzt. Amerika gibt ihm dafür einen großen Vertrauensvorschuss mit auf den Weg, dem sich Deutschland anschließen sollte. Daher können und dürfen wir uns der Verantwortung zur gemeinsamen konstruktiven Gestaltung und Bewältigung der sicherheitspolitischen Herausforderungen mit unserem engsten und wichtigsten Partner nicht entziehen, sondern müssen diesen Neuanfang tatkräftig und aufgeschlossen begleiten. Wie „special“ ist die „special relationship“ zwischen Washington und London? Alice Neuhäuser 1. Zur Bedeutung der „special relationship“ Großbritannien verbindet mit den Vereinigten Staaten von Amerika seit Generationen eine besondere Beziehung, die sogenannte „special relationship“. Deshalb verwundert es nicht, dass beide Staaten mit keinem anderen Land ähnlich eng befreundet sind. Ein breites Fundament an Gemeinsamkeiten trägt dazu bei, die Verbindung über die lange Zeit auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten: Hierzu zählen gemeinsame Werte und ähnliche Rechtssysteme.1 Briten und Amerikaner haben überdies verwandte demokratische Prinzipien und häufig identische nationale Interessen.2 Sie teilen zudem das Erbe der Magna Charta sowie der Bill of Rights und sprechen eine gemeinsame Sprache, das Englische.3 Auch ökonomisch sind sie eng verflochten: „The USA is overwhelmingly the UK’s biggest FDI [Foreign Direct Investment] partner in both directions.”4 Den zwei Ländern sind der Exklusivcharakter der „special relationship” und die vielfältigen Vorzüge der einzigartigen Freundschaft bewusst. Dies führt dazu, dass beide Seiten diesen gut 100 Jahre alten Begriff oder bedeutungsgleiche Termini als Synonyme für die britisch-amerikanischen Beziehungen bei beiderseitigen Konsultationen betonen. Während vor allem Winston Churchill und Richard Nixon ständig von einer „special relationship” sprachen, akzentuierte Harold Wilson die Verbindung der zwei Staaten als „close relationship”;5 Margaret Thatcher schließlich prä1 2 3 4 5 Vgl. Himmler, Norbert: Zwischen Macht und Mittelmaß. Großbritanniens Außenpolitik und das Ende des Kalten Krieges, Diss., Berlin 2001, S.72. Vgl. ebd.; Gauland, Alexander: Keine Spur mehr von Augenhöhe, 21.1.2009, http://www.welt.de/welt_print/article3063528/Keine-Spur-mehr-von-Augenhoehe.html, Stand: 26.1.2009. Vgl. Gauland: Keine Spur mehr von Augenhöhe. Milne, Ian: Foreign Direct Investment, in: Global Britain Briefing Note, hrsg. von der University of Birmingham, Birmingham 30.6.2000, http://www.globalbritain.org/BNN/BN09.htm, Stand: 29.12.2004; vgl. Ibarra, Marilyn/Koncz, Jennifer: Direct Investment Positions for 2007. Country and Industry Detail, in: Survey of Current Business 7/2008, S.35. Vgl. Reynolds, David: A „Special Relationship”? America, Britain and the International Order since the Second World War, in: International Affairs 1/1986, S.1-20, S.1. 348 Alice Neuhäuser ferierte die Bezeichnung „extraordinary alliance“.6 Eine Anekdote in diesem Zusammenhang schildert Howard Temperley in Anlehnung an Raymond Seitz, den früheren US-Botschafter in London: John Major war zu einem politischen Gedankenaustausch nach Washington geflogen. Ein Berater erinnerte den wenige Tage zuvor vereidigten Bill Clinton: „Don’t forget to say ‚special relationship‘ when the press comes in.”7 „Oh yes, the special relationship”, antwortete Clinton. „How could I forget?”8 Dieses Beispiel zeigt, dass eine Nichtnennung jenes Begriffs womöglich zu zwei Verdachtsmomenten hätte führen können. Zum einen wäre sie ein Indiz für die außenpolitische Unerfahrenheit oder gar Inkompetenz des neuen Präsidenten gewesen, wenn er das besondere Verhältnis nicht explizit benannt und damit gewürdigt hätte. Zum anderen hätte die Gefahr bestanden, die Nichterwähnung als einseitige Aufkündigung der engen Beziehung misszuverstehen. In London ist der Begriff der „special relationship” gängiger und wird von Politikern häufiger verwendet als in der US-Hauptstadt,9 wo „the idea may never have been taken too seriously, but nor did U.S. officials actively discourage it“10. Die Ursache liegt darin, dass die „Insel zweimal … von den Vettern aus Übersee gerettet worden war, was sich tief in das nationale Gedächtnis der Briten eingegraben hat”11. Gewisse unterschiedliche Akzentuierungen im politischen Alltag können diesseits und jenseits des Atlantiks festgestellt werden: Neben der von beiden Seiten ohne weiteres unterstützten Prämisse „keeping the relationship alive“12 strebt Großbritannien an, niemals mit den USA in der Öffentlichkeit zu streiten.13 Im Grunde teilen die Amerikaner diesen Vorsatz; jedoch sind sie in der praktischen Ausgestaltung etwas flexibler und bekennen deshalb, nur dann mit den Briten öffentlich zu streiten, wenn sie dazu gezwungen seien.14 Dies führte dazu, dass sich schon mancher britische Premierminister gekränkt gefühlt hat, wenn es um inhaltliche Auseinandersetzungen mit den USA ging, etwa bei den Themen Freihandel oder Klimaschutz.15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vgl. ebd. Temperley, Howard: Britain and America since Independence, New York 2002, S.190. Ebd. Vgl. Reynolds: A „Special Relationship”?, S.1f. Freedman, Lawrence D.: The Special Relationship, Then and Now, in: Foreign Affairs 3/2006, S.61-73, S.61. Gauland: Keine Spur mehr von Augenhöhe. White, Michael: Keeping the relationship alive, in: The Guardian, 6.11.2008, S.12f., S.12. Vgl. ebd. Vgl. ebd. Vgl. ebd. Wie „special“ ist die „special relationship“ zwischen Washington und London? 349 Hier erkannten die Briten die Grenzen der „special relationship“; gemeinsame Wurzeln und Werte zu haben bedeutete einerseits nicht zwangsläufig, stets dieselben Interessen zu vertreten.16 Andererseits haben die USA als einzig verbliebene Weltmacht die Überlegenheit, ihre Forderungen auch gegen den besten Verbündeten auf die politische Agenda zu setzen, wie z.B. in der Amtszeit Blairs, als George W. Bush Zölle auf Stahl erhob. Das Vereinigte Königreich könnte sich umgekehrt wegen seiner relativen Schwäche ein derartiges Verhalten nicht erlauben. Es ist von der US-Unterstützung abhängig, will es eigene Anträge auf der politischen Weltbühne, z.B. bei den Vereinten Nationen, zum Erfolg führen.17 Die Briten lassen diese vereinzelten Alleingänge der Amerikaner zu, weil sie sich bewusst sind, dass sie letztlich nur ihrem Partner in der „special relationship” vorbehaltlos vertrauen können.18 Einen vergleichbaren Freund werden sie binnen kurzem in der Europäischen Union nicht finden können, da sie sich bei europäischen Einigungsprozessen oftmals selbst isolieren.19 2. Entwicklung der „special relationship“ vom Ersten Weltkrieg bis heute Noch vor rund 95 Jahren dominierte London die „special relationship“;20 Großbritannien verstand sich damals als Weltpolizei, so wie heute die Vereinigten Staaten.21 Aus einer Vorherrschaft des Inselreichs wurde eine Freundschaft „auf Augenhöhe“22 während des Zweiten Weltkriegs, der einen Höhepunkt der „special relationship“ markierte,23 obwohl auch diese Zeit nicht frei von Unstimmigkeiten war.24 Churchill wurde z.B. auf der Teheraner Konferenz von Franklin Delano Roosevelt ignoriert, der in realpolitischer Manier die neue Großmacht UdSSR umgarnte.25 Trotzdem suchte Großbritannien auch nach 1945 enge bilaterale Beziehungen zu den USA, um seine ökonomischen und militärischen Interessen wirksam zu vertreten.26 Im wirtschaftlichen Bereich war zunächst der Wiederaufbau eine zentrale Intention des Vereinigten Königreichs, während es militärisch auf ein entschiedenes Eintreten gegenüber der Sowjetunion abzielte.27 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Vgl. ebd., S.13. Vgl. ebd. Vgl. ebd.; Gauland: Keine Spur mehr von Augenhöhe. Vgl. Gauland: Keine Spur mehr von Augenhöhe. Vgl. White: Keeping the relationship alive, S.13. Vgl. ebd. Gauland: Keine Spur mehr von Augenhöhe. Vgl. Himmler: Zwischen Macht und Mittelmaß, S.73. Vgl. Gauland: Keine Spur mehr von Augenhöhe. Vgl. ebd. Vgl. Himmler: Zwischen Macht und Mittelmaß, S.73, S.75. Vgl. ebd., S.73. 350 Alice Neuhäuser Die besondere Qualität der Beziehung in den vierziger und fünfziger Jahren hatte nach Norbert Himmler drei Hauptgründe: Zum einen verbanden Amerikaner und Briten eine kongruente Ideologie und setzten sich dementsprechend für eine liberale sowie kapitalistische Demokratie ein.28 Überdies kämpften sie für ein unabhängiges Westeuropa, zunächst gegen Hitler, später gegen Stalin.29 Schließlich stimmte die Chemie untereinander, und so entwickelten sich persönliche Beziehungen zwischen britischen und amerikanischen Politikern.30 In den darauffolgenden Jahrzehnten verzeichnete der Inselstaat einen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Machtverlust. Großbritannien gelang es nach dem Niedergang des Empire nicht, eine internationale Rolle zu finden. Dean Acheson, Außenminister unter Harry S. Truman, analysierte 1962, der Plan, eine Rolle über die „special relationship“ und das Commonwealth, aber außerhalb der europäischen Integration anzustreben, sei eine Politik ohne Struktur.31 Später wurde der Versuch gestartet, „mit Hilfe der EG zu einer vitalen und international wahrnehmbaren Rolle zurückzufinden”32. Doch war das Vereinigte Königreich nur zu einer stärkeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit bereit und konnte sich zu einer wachsenden politischen Verschmelzung nicht durchringen,33 so dass die „special relationship“ letztlich für Großbritannien alternativlos blieb. Alle diese Faktoren führten dazu, dass es heute nur noch als Junior-Partner der USA charakterisiert werden kann.34 Das Jahr 1989 markierte einen Tiefpunkt in den britisch-amerikanischen Beziehungen, was in der Reform der Sowjetunion begründet lag. US-Präsident Bush sen. und sein Außenminister Baker wollten flexibel auf die Umbrüche reagieren. Die versöhnlichen Signale an die UdSSR sowie die weitreichende Unterstützung des deutschen Einigungsprozesses rüttelten dabei an den sicherheitspolitischen Grundpfeilern Großbritanniens, z.B. der Rolle der NATO.35 So schien es nicht anpassungsbereit für politische Veränderungen zu sein und fühlte sich teilweise vom besten Freund, den USA, übergangen. Hinzu kommt, dass Thatcher und Bush sen. kein ausgesprochen gutes Verhältnis pflegten. Im Vergleich dazu stimmte „die eiserne Lady“ mit Bushs Vorgänger Ronald Reagan in einer Vielzahl inhaltlicher Fragen überein. Vor allem aber 28 29 30 31 32 33 34 35 Vgl. ebd., S.74. Vgl. ebd. Vgl. ebd. Vgl. Temperley: Britain and America since Independence, S.189. Neuhäuser, Alice: Triebkräfte und Hemmnisse auf dem Weg zum britischen Euro-Beitritt, Diss., Münster 2005, S.56. Vgl. ebd. Vgl. Himmler: Zwischen Macht und Mittelmaß, S.80. Vgl. ebd., S.252f. Wie „special“ ist die „special relationship“ zwischen Washington und London? 351 waren die beiden Politiker persönlich eng miteinander befreundet. Mit der Amtsübernahme Bushs verlor Thatcher also nicht nur ihren Vertrauten Reagan, sondern auch noch die traditionell nahezu ständig vorhandene inhaltliche Kongruenz mit den USA, da die Revolution in Osteuropa mit dem Beginn der Bush-Administration zeitlich einherging. Erst Monate später verbesserte sich das Verhältnis zusehends. Der erste Golfkrieg ließ eine erkennbare Annäherung zu, da wieder eine Deckungsgleichheit der Interessen erreicht wurde.36 Nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 drückten die Verbündeten ihre Solidarität aus und unterstützten den von den USA geführten Militäreinsatz gegen das Taliban-Regime in Afghanistan. Eineinhalb Jahre später waren nur noch wenige europäische Länder bereit, den Irak-Kurs der Amerikaner mitzutragen. Einzig der beinahe grenzenlosen Loyalität Großbritanniens konnte sich Präsident Bush jun. sicher sein. „If anything, in recent years, this special relationship has enjoyed something of a revival, with George W. Bush apparently relived to have at least one reliable friend.”37 Tony Blair folgte Bush in den unpopulären und von Problemen und Rückschlägen dominierten Irak-Krieg. In der britischen Öffentlichkeit wurde Blairs Politik scharf angegriffen; seine Ansicht, er habe mit diesem Militäreinsatz auch seine tiefe Dankbarkeit gegenüber den USA erneut beweisen wollen, wurde nicht geteilt.38 Vielmehr wurde Blairs Kurs als Unterwürfigkeit gegenüber Bush kritisiert. Ferner wurde der Vorwurf laut, er habe die Solidarität in der „special relationship“ beim Irak-Krieg mit blinder Loyalität verwechselt, so dass aus britischer Sicht der gemeinsame „Einmarsch in den Irak als fehlgeleitetes Beispiel für das ‚besondere Verhältnis‘ zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten galt“39. Letztendlich hat der Irak-Krieg Blair die politische Karriere gekostet. Zwar hatte er daneben auch Einsätze in Afghanistan, Sierra Leone und im Kosovo autorisiert; aber kein Krieg und dessen Notwendigkeit wurden weltweit in den Medien so sehr infrage gestellt wie im Fall des Irak. Blair hatte eine wöchentliche Video-Konferenz mit George W. Bush, um über tagesaktuelle Politik und Fortschritte sowie Rückschläge des IrakKriegs zu reflektieren. Als Gordon Brown die Amtsgeschäfte von Blair übernahm, reduzierte er den Kontakt mit dem US-Präsidenten auf einen 36 37 38 39 Vgl. ebd., S.254. Freedman: The Special Relationship, S.61. Vgl. Neuhäuser: Triebkräfte und Hemmnisse auf dem Weg zum britischen Euro-Beitritt, S.169f. Leithäuser, Johannes: Gordon Brown muss zurückstehen. Für Obama nicht der erste Gesprächspartner, 25.7.2008, http://www.faz.net/s/RubFC06D389EE76479E9E76425072B196C3/Doc~E1F672018, Stand: 29.10.2008. 352 Alice Neuhäuser monatlichen Gedankenaustausch.40 Gern delegiert Brown das Politikfeld der transatlantischen Beziehungen an seine Kabinettsmitglieder, was verdeutlicht, dass er der „special relationship“ weniger Bedeutung beimisst als sein Vorgänger.41 Allen voran Außenminister David Miliband und den Verteidigungsministern Des Browne bzw. John Hutton überlässt er die Aufgabe, eine gemeinsame Politik mit den US-Amtskollegen Condoleezza Rice bzw. ihrer Nachfolgerin Hillary Clinton und Robert Gates auszuloten.42 David Miliband, der möglicherweise eines Tages Gordon Brown politisch beerben wird, sieht die britisch-amerikanischen Beziehungen in erster Linie pragmatisch: „If you look at any of the big problems of the world you need an active relationship with the United States.”43 Nach seinem Amtsantritt als Premierminister erkannte Brown, dass der Irak-Krieg die britische Bevölkerung und die Labour Party spaltete, so dass er die Losung ausgab, aus den Fehlern zu lernen.44 Er beschloss zunächst, die Truppen zu reduzieren, während Präsident Bush damals eine entgegengesetzte Politik verfocht und die Zahl seiner Streitkräfte aufstockte. Bis Juni 2009 plant Brown, fast alle britischen Soldaten aus dem Zweistromland abzuziehen. Mit dieser Entscheidung erreicht er nun wieder eine Deckungsgleichheit der Interessen mit seinem neuen Partner in der „special relationship”, Barack Obama, der die amerikanischen Truppen in absehbarer Zeit vom Irak nach Afghanistan verlegen möchte. 3. Die nahe Zukunft der „special relationship“ Um die „special relationship“ auf hohem Niveau aufrechtzuerhalten, bedarf es auch der „Erinnerung an angelsächsische kulturelle Gemeinsamkeiten“45. Diese droht aber aufgrund demographischer Veränderungen diesseits wie jenseits des Atlantiks zu verblassen.46 Denn in die zwei Länder wandern verstärkt Menschen mit asiatischen und lateinamerikanischen Wurzeln ein, denen „die gemeinsame Geschichte der englischsprechenden Völker“47 nicht mehr als wichtig erscheint. 40 41 42 43 44 45 46 47 Vgl. Coughlin, Con: The special relationship without George Bush, 8.2.2008, http://www.telegraph.co.uk/core/Content/displayPrintable. jhlml;jsessionid=XNRMS2, Stand: 29.10.2008. Vgl. Ananieva, Elena: The Brownian Movement, in: International Affairs September/2007, S.12-20, S.16. Vgl. Coughlin: The special relationship without George Bush. Zitat David Milibands, in: Ananieva: The Brownian Movement, S.16. Vgl. ebd., S.17. Gauland: Keine Spur mehr von Augenhöhe. Vgl. ebd.; Huntington, Samuel P.: Who are we? Die Krise der amerikanischen Identität, New York u.a. 2004. Gauland: Keine Spur mehr von Augenhöhe. Wie „special“ ist die „special relationship“ zwischen Washington und London? 353 Bei der Beantwortung der Frage, ob Obama bereit sein wird, die britischamerikanischen Beziehungen als eine seiner Prioritäten zu definieren, könnte er nach Meinung einiger Beobachter von seiner eigenen Familiengeschichte eingeholt werden. Sein Großvater, der den kenianischen Unabhängigkeitskampf unterstützte, wurde von britischen Kolonialherren verhaftet und gefoltert.48 Doch wird dieses Schicksal keine Auswirkungen auf Barack Obamas Politik gegenüber dem Vereinigten Königreich haben. Schließlich weiß er zwischen Erlebnissen Verwandter und der Ausübung seines Präsidentenamts zu differenzieren. Ferner ist er nicht mit dieser Erfahrung seines Großvaters aufgewachsen, da er bei der Familie seiner Mutter lebte. Die noch vor einem Jahrzehnt unübertroffene Überlegenheit US-amerikanischer Handlungsfähigkeit verschwindet mehr und mehr.49 Heute sind die Vereinigten Staaten schwächer als zu Beginn der Bush-Administration. Dies liegt vor allem an dem riesigen Defizit, das Bush hinterlässt. Somit sind die USA heute weniger gestaltungs- und handlungsfähig, da finanzielle Mittel ohnehin immer begrenzt und jetzt nur noch zu einem weitaus geringeren Teil vorhanden sind. Die gigantische Verschuldung korreliert überdies mit der schwersten internationalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise seit den 1920er-Jahren. Durch den Irak-Krieg haben die USA außerdem ihre hegemoniale Stellung aufs Spiel gesetzt. Obamas Aufgabe wird nun darin bestehen, den relativen Machtverlust in beiden Bereichen mindestens zu managen, nach Möglichkeit sogar zu kompensieren. Aus diesem Grund besinnt er sich seines besten Verbündeten. Er möchte die „special relationship” erneuern und transferieren in „a fairer, more equal partnership”50 und unterstrich dies mit der Aussage: „We have a chance to recalibrate the relationship and for the United Kingdom to work with America as a full partner.”51 Dieses Ziel formulierte er schon in seinem Wahlkampf, als er eine Telefonansprache für in Großbritannien lebende Amerikaner hielt. Obama „has long been seen by British officials as the most anglophile to the three presidenzial candidates, but these latest comments are his first public suggestion that the relationship is un48 49 50 51 Vgl. Macintyre, Ben/Orengoh, Paul: Beatings and abuse made Barack Obama’s grandfather loathe the British. The President-elect’s relatives have told how the family was a victim of the Mau Mau revolt, 3.12.2008, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/africa/articles5276010.ece?print, Stand: 29.1.2009. Vgl. Neuhäuser, Alice: Zum Bestand der transatlantischen Partnerschaft. Von der Entfremdung zur Wiederannäherung, in: Die Politische Meinung 8/2006, S.38-42, S.38. Zitat Barack Obamas, in: Borger, Julian: UK‘s special relationship with US needs to be recalibrated. Obama tells ex-pats in Britain, 27.5.2008, http://www.guardian.co.uk/world/2008/may/27/barackobama.uselection2008/print, Stand: 29.10.2008. Zitat Barack Obamas, in: ebd. 354 Alice Neuhäuser equal and ripe for change”52. Dabei fügen sich diese Bemerkungen Obamas nahtlos ein in seine außenpolitische Vision, nach der das Denkmuster, die Amerikaner führten und Verbündete nähmen ohne weiteres die US-Sichtweise an, überholt sei.53 Gleichberechtigte Partner sollten laut dem neuen amerikanischen Präsidenten nicht nur einander zuhören, sondern auch einander situationsabhängig folgen.54 Dies impliziert natürlich, dass auch die Amerikaner bereit sein müssen, sich ihren Partnern und deren Positionen gegebenenfalls anzuschließen. Die britische Öffentlichkeit müsste eine Umsetzung dieses Vorsatzes einhellig begrüßen. Denn der Eindruck, Blair habe für seine Unterstützung des Irak-Kriegs wenig von den USA zurückerhalten, ist nach wie vor sehr stark wahrzunehmen.55 Vermutlich könnte auch Kontinentaleuropa von einer Erneuerung des britisch-amerikanischen Verhältnisses profitieren. Großbritannien eine gleichberechtigte Rolle in der „special relationship” zuzugestehen wäre ein willkommener Anlass, um auch einen substanziellen Neuanfang in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kontinentaleuropa einzuläuten. Seit der Zeit des Irak-Einmarsches, als „die Kriegsgründe unterschiedlich bewertet wurden und auf der einen Seite die USA und atlantisch orientierte Staaten Europas – auf der anderen Seite multipolare, eurozentristische Staaten um Deutschland und Frankreich standen”56, gibt es in vielen europäischen Regierungen immer noch Unbehagen über die Politik der Amerikaner.57 Der personelle Wechsel im Weißen Haus ist ein günstiger Moment für eine Revitalisierung der transatlantischen Allianz. Zudem könnte Großbritannien in dieser Frage als Mittler zwischen den USA und Kontinentaleuropa fungieren. Barack Obama strebt Macht und Einfluss durch geschickte Einbindung an, indem er mit Gegnern seines Landes kooperieren und einstige Mitbewerber wie Hillary Clinton durch einen wichtigen Kabinettsposten besänftigen möchte.58 Er bedient sich also klassischer Methoden einer „soft power“. Die USA haben noch Nachholbedarf, als Partner zu führen, und müssen daher erst lernen, im Stil einer „soft power“ zu agieren. Kontinentaleuropa ist das entgegengesetzte Beispiel: Es definiert sich als „soft power“, hat aber erhebliche Schwierigkeiten, Ansätze einer „hard power“ 52 53 54 55 56 57 58 Ebd. Vgl. ebd.; Granieri, Ronald J.: False Friends and Unnecessary Enemies? American Liberals and Conservatives and European Integration, in: Orbis 3/2008, S.446-459, S.459. Vgl. Borger: UK‘s special relationship with US needs to be recalibrated. Vgl. ebd. Neuhäuser: Zum Bestand der transatlantischen Partnerschaft, S.39. Vgl. Granieri: False Friends and Unnecessary Enemies?, S.459. Vgl. Krauel, Torsten: Obama bricht mit Bushs Konfrontations-Politik, 27.1.2009, http://www.welt.de/politik/article3101389/Obama-bricht-mit-Bushs-Konfrontations-Politik.html, Stand: 28.1.2009. Wie „special“ ist die „special relationship“ zwischen Washington und London? 355 für sich anzunehmen und entsprechend zu operieren. Von ihrem Verbündeten Großbritannien können die Vereinigten Staaten auf diesem Gebiet lernen, da einzig das Inselreich beide Politiken schon beherrscht und somit als „smart power“ bezeichnet werden kann.59 Die Hauptzielsetzung der NATO ist nach Auffassung der Amerikaner, der Briten und vieler mitteleuropäischer Länder, als „global security provider“ zu agieren. Westeuropa hat (noch) Vorbehalte gegen diese neue Ausrichtung der NATO. Ein folgenschweres Problem ist das Fehlen tragfähiger Strukturen für die transatlantischen Beziehungen. Der NATO-Gipfel im April 2009 wird in dieser Angelegenheit noch nicht zu konstruktiven Beschlüssen führen, da er zu früh nach der Vereidigung Obamas stattfindet.60 Trotzdem werden sicher erste Versuche für eine Wiederbelebung der transatlantischen Partnerschaft unternommen, z.B. in Form bilateraler Abstimmungen zwischen den USA und Großbritannien. Ein nächster Schritt, der spätestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2009 begonnen werden muss, ist eine Klärung der Mitgliedsstaaten darüber, ob die NATO vorrangig ein Interventions- oder Koordinierungsgremium sein soll. Neben den noch offenen sicherheitspolitischen Fragen können die vielfältigen Reaktionen auf die Finanzmarktkrise das transatlantische Verhältnis nachhaltig beeinflussen. Es ist nicht klar abzusehen, ob sich die Krise langfristig positiv oder negativ auf die Beziehungen auswirken wird. Ein Grund hierfür liegt darin, dass es keine europäische Antwort auf die gegenwärtige Situation gibt, sondern durchaus miteinander konkurrierende Ansätze der einzelnen Nationalstaaten in Europa. Auf der einen Seite könnte die Finanzmarktkrise die verstärkte Notwendigkeit zur Zusammenarbeit zwischen den USA und den Europäern aufzeigen; auf der anderen Seite sind besonders die Verstaatlichungstendenzen ein Beleg für versteckten Protektionismus, der die Gefahr einer Verschlechterung der transatlantischen Beziehungen in sich birgt. Weiter können neue Animositäten entstehen, wenn die USA vor allem mit den G8-Partnern aus Europa um dieselben Märkte kämpfen werden. Sowohl noch während der Krise als auch bei eintretender Wiederbelebung der Weltwirtschaft können diese Probleme auftreten. 59 60 Vgl. Naughton, Philippe: Hillary Clinton says „smart power” will restore American leadership, 13.1.2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/ world/us_and_americas/article5510049.ece?pr, Stand: 24.1.2009; What is Hillary Clinton‘s „smart power”?, 13.1.2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/ news/world/us_and_americas/article5511343.ece?pr, Stand: 24.1.2009. Manuskriptabgabe: 31.1.2009. 356 Alice Neuhäuser 4. Persönliche Beziehung zwischen Gordon Brown und Barack Obama Wenn die Chemie zwischen dem britischen Premierminister und dem amerikanischen Präsidenten nicht stimmen sollte, führt dies in der Regel maximal zu atmosphärischen Störungen. Es kommt nicht zu einer substanziellen Beschädigung der Beziehungen, da die Verbindung der zwei Länder durch viele Gemeinsamkeiten stark ist, beide zudem einer Wertefamilie angehören, enge wirtschaftliche Beziehungen unterhalten und in Organisationen wie der NATO fest verankert sind. Im April 2008 hatte Brown die drei zu dieser Zeit noch im Rennen befindlichen US-Präsidentschaftsbewerber getroffen, also John McCain, Hillary Clinton und Barack Obama. Allen gewährte er einen jeweils 45-minütigen Gedankenaustausch unter vier Augen. Während Brown die einstige First Lady schon mehrfach gesprochen hatte und McCain wenige Wochen zuvor in London begrüßen konnte, war es sein erster persönlicher Kontakt mit Obama.61 Mit McCain teilte Brown die Einstellung zum Freihandel; bei Auftritten der zwei demokratischen Bewerber war er sich nicht sicher, ob deren dort geäußerte protektionistische Ansätze als Wahlkampfrhetorik oder echte Überzeugungen zu verstehen waren.62 Obama betonte darüber hinaus, dass ihm „Diplomatie wichtiger als militärische Stärke”63 sei. „Er hat angekündigt, dass er bereit sei, sich auch mit den Feinden der USA zu treffen – so mit dem iranischen Präsidenten –, wenn es der Sache und dem Frieden diene.“64 Brown begriff, dass eine Wahl Obamas und damit eine Umsetzung der liberalen Außen- und Sicherheitspolitik Auswirkungen auf den britischen Kurs in diesen Politikfeldern haben würde; Veränderungen von Afghanistan über den Iran bis hin zu Russland und selbst zu Kuba wären die logische Konsequenz,65 so dass er zunächst mit einer gewissen Skepsis auf die wachsende Beliebtheit Obamas reagierte. Obwohl Brown mit einigen Positionen des Republikaners McCain übereinstimmte, hatte er sich bereits Monate vorher aufgrund der ideologischen Nähe zwischen der Labour Party und der Demokratischen Partei und der zum damaligen Zeitpunkt noch aussichtslos geltenden Kandidatur Obamas „auf Hillary Clinton festgelegt“66. 61 62 63 64 65 66 Vgl. MacAskill, Ewen: Brown meets US presidential hopefuls, 17.4.2008, http://www.guardian.co.uk/politics/2008/apr/17/gordonbrown.foreignpolicy/print, Stand: 29.10.2008. Vgl. ebd. Haftendorn, Helga: Die außenpolitischen Positionen von Obama und McCain, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 37-38/2008, S.35-40, S.37. Ebd.; vgl. Krauel: Obama bricht mit Bushs Konfrontations-Politik. Vgl. MacAskill: Brown meets US presidential hopefuls. Borger, Sebastian: Verlegene Gratulation aus Downing Street, 5.11.2008, http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-588630,00.html, Stand: 5.11.2008. Wie „special“ ist die „special relationship“ zwischen Washington und London? 357 Barack Obama hatte seine große außenpolitische Rede während seiner Wahlkampftour um den Globus im Juli 2008 in Berlin gehalten und war zudem zu einer Pressekonferenz mit Präsident Nicolas Sarkozy in Paris erschienen. In London trat er allein ohne Brown vor die Medienvertreter. Einige Wochen früher war geplant gewesen, die Weltreise in Großbritannien zu starten, doch hat der demokratische Präsidentschaftskandidat sie dort beendet. Brown war von der Entscheidung des Obama-Teams enttäuscht. Außerdem passte dieser Entschluss Obamas nicht zu seinem Bestreben, die britisch-amerikanischen Beziehungen zu erneuern. Als Gründe für sein Verhalten können angeführt werden, dass er Brown für die Unterstützung Hillary Clintons etwas abstrafen wollte und der britische Premierminister im vergangenen Juli vor dem offensichtlichen Ausbruch der internationalen Finanzmarktkrise politisch angeschlagen war. Wahlkämpfer Obama wollte sich in dieser Situation so wenig wie möglich mit Brown öffentlich zeigen, da sich dessen Imageprobleme unter Umständen negativ auf seine Umfragewerte ausgewirkt hätten. Aus dem Umfeld Tony Blairs hieß es, „Obama wolle ebenjene wichtigen Personen treffen, mit denen er die nächsten sieben oder acht Jahre zusammenzuarbeiten habe“67. Im letzten Sommer ging niemand mehr davon aus, dass sich Brown noch länger an der Spitze der Regierung halten könne. Ferner sprach Obama in seiner Berliner Rede zu den Völkern Europas. Diesen Adressatenkreis hätte er in London umformulieren müssen, da Großbritannien nach wie vor Schwierigkeiten damit hat, sich als ein Volk Europas zu definieren, da Europa hier immer noch allzu gern mit Kontinentaleuropa gleichgesetzt wird. In seiner Berliner Rede bekannte sich Obama wie noch nicht zuvor zu den transatlantischen Beziehungen.68 Warum er hierfür Deutschland ausgewählt hat, blieb rätselhaft. Denn die Bundesrepublik hat sich des Öfteren als unzuverlässig gegenüber den USA erwiesen. Mit der Wahl der Stadt stellte er sich unbeabsichtigt fast in die Tradition von George Bush sen., der Deutschland das Angebot „partner in leadership“ offeriert hatte. „Die größer gewordene Bundesrepublik reagierte [zu jener Zeit] mit Passivität und Schwächlichkeit, nicht willens, plötzlich machtpolitisch orientiert zu handeln.“69 Einen Unterschied kann man jedoch darin erkennen, dass der einstige Präsident seine Aufforderung allein auf Deutschland bezog, während Obama die „Kooperation mit den Europäern“70 beschwor und nicht nur mit Deutschland, bloß durch die Wahl des Redeorts die Bundesrepublik hervorhob und hofierte. 67 68 69 70 Leithäuser: Gordon Brown muss zurückstehen. Vgl. Haftendorn: Die außenpolitischen Positionen von Obama und McCain, S.37. Neuhäuser: Zum Bestand der transatlantischen Partnerschaft, S.41. Haftendorn: Die außenpolitischen Positionen von Obama und McCain, S.37. 358 Alice Neuhäuser Am 5. November 2008 lieferten sich Premierminister Brown und Oppositionsführer David Cameron ein Rededuell im Unterhaus. Beide beanspruchten den Triumph Obamas bei der Präsidentschaftswahl am vorherigen Tag für sich, betrachteten dessen Erdrutschsieg als Beleg für die angebliche Richtigkeit der jeweils eigenen Politik und versuchten, sich in der Woge der Euphorie für das künftige amerikanische Staatsoberhaupt zu sonnen. Statt außenpolitische Programme vorzutragen, fand ein innenpolitischer Schlagabtausch im House of Commons statt. Die Reden waren recht phrasenhaft und erinnerten deshalb eher an einen bevorstehenden Wahlkampf. Brown nannte Obama „a true friend of Britain”71 und ergänzte: „The truth is that the Conservative policy has been rejected in America and in Britain.”72 Zwei Hauptgründe machte der britische Premierminister für den Erfolg Obamas aus; zum einen sei er ein ernsthafter Kandidat in schwierigen Zeiten gewesen, zum anderen vertrete er dieselben populären Werte wie die Labour Party.73 In diesem Zusammenhang lobte Brown vor allem Obamas inspirierenden Wahlkampf und seine Zukunftsvision.74 Die Reaktionen des Vorsitzenden der Torys waren diametral: Der Sieg Obamas „represented a triumph for the advocates of change“75, wobei Cameron hier „change”, also Wandel, mit einem möglichen Regierungswechsel im Vereinigten Königreich gleichsetzte. Noch 2006 hatten die Conservatives John McCain als Redner auf ihrem Parteitag zu Gast. Cameron stellte ihn damals als den nächsten US-Präsidenten vor. Doch ist Cameron bekannt dafür, bei politischen Überzeugungen ziemlich beweglich zu sein, so dass es ihm nicht schwer gefallen sein wird, entsprechend der politischen Stimmung in den USA von den Republikanern zu den Demokraten gewechselt zu haben. Des Weiteren nennt er den neuen amerikanischen Präsidenten den ersten Staatsmann einer neuen Generation und meint damit erstens, dass den jüngeren Politikern die nahe Zukunft gehöre76 und zweitens, dass er sich selbst augenscheinlich dazuzähle. Aber nicht nur Obama und Cameron, sondern auch Außenminister Miliband, die Nachwuchshoffnung der Labour Party, ist noch recht jung. Alle drei sind in den 1960er-Jahren geboren. Die Maßnahmen, die in Großbritannien ergriffen wurden, um die erwartete Rezession abzumildern wie die Senkung der Mehrwertsteuer oder 71 72 73 74 75 76 Debatte im Unterhaus, 5.11.2008. Ebd. Vgl. ebd. Vgl. ebd. Ebd.; vgl. Watt, Nicholas/Wintour, Patrick: Party leaders compete to cover themselves in reflected glory, in: The Guardian, 6.11.2008, S.13. Vgl. Debatte im Unterhaus, 5.11.2008. Wie „special“ ist die „special relationship“ zwischen Washington und London? 359 des Leitzinses, führten nicht zu positiven Effekten.77 Trotzdem gewann Gordon Brown durch die Finanzmarktkrise kurzzeitig als Krisenmanager wieder Oberwasser,78 so dass er aktuell keinen Austausch durch David Miliband fürchten wird. Bis mindestens zur nächsten Parlamentswahl, die spätestens im Mai 2010 stattfinden muss, wird Brown wahrscheinlich im Amt bleiben. Insofern wird er in den kommenden Monaten definitiv der erste Ansprechpartner der USA sein. Sowohl Brown als auch Obama gelten als klug und begabt. Beide haben an Elitehochschulen studiert. Was sie jedoch unterscheidet, ist ihr voneinander stark abweichendes Interesse, wie sie auf Menschen wirken. Dem britischen Premierminister ist dies bisweilen gleichgültig, weswegen seine Intelligenz oft als Makel beschrieben wird. Anders verhält es sich bei Barack Obama: Er legt großen Wert darauf, in der Öffentlichkeit positiv zu erscheinen, und plant daher seine Auftritte minuziös. So gilt er als brillanter Rhetoriker und guter Gesprächspartner. Sein politisches Talent wird demzufolge anerkennend herausgestellt. Synergien, wie sich die zwei Politiker gut ergänzen können, lassen sich schnell erkennen: „Obama is a great communicator, but he is the kind of person that is going to listen to someone with the experience and knowledge of Brown.”79 Auch ideologisch gibt es eine Nähe. Obama ließ im Wahlkampf kaum Zweifel daran, dass er ein Sozialdemokrat europäischen Zuschnitts ist. Wenn sich dieser Eindruck in den ersten Amtswochen bestätigen sollte, müsste er nicht nur gut mit Brown zusammenarbeiten können, sondern sich darüber hinaus mit ihm verstehen und Einigkeit in zahlreichen Politikfeldern finden. Die Bedenken Browns bezüglich der im Wahlkampf angekündigten liberalen Außenpolitik werden sicher schon verflogen sein. Denn Kontinuität sowie Erfahrung waren die wichtigsten Kriterien für das neue US-Kabinett. Dies war für viele im linken Spektrum der Demokratischen Partei beheimateten Anhänger Obamas überraschend. Mit Verteidigungsminister Robert Gates wurde sogar ein Republikaner aus der Bush-Administration eingebunden. Neben Joseph Biden, einem der profiliertesten Außenpolitiker des Landes, setzt Obama vor allem auf Hillary Clinton. Den ganz großen Wandel wird es also nicht geben. Selbst bei einem linken Kabinett wäre dieser analog zum Wahlkampf nicht möglich gewesen, da beide Häuser zwar eine demokratische, aber keine linke Mehrheit haben. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ist das Thema Klimaschutz. Konkrete 77 78 79 Vgl. Volkery, Carsten: Der Stern des Gordon Brown sinkt, 11.1.2009, http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,druck-600403,00.html, Stand: 14.1.2009. Vgl. ebd.; Borger: Verlegene Gratulation aus Downing Street; Brown senkt Mehrwertsteuer, 23.11.2008, http://www.rundschau-online.de/servlet/Origin alContentServer?pagename=ksta/ksArt, Stand: 14.1.2009. Wintour, Patrick: We can breathe again, says „energised” Downing Street, in: The Guardian, 6.11.2008, S.12. 360 Alice Neuhäuser Maßnahmen wie verbindliche Grenzwerte für den CO2-Ausstoß müssten vom Kongress verabschiedet werden, dessen Mitglieder weit weniger ambitionierte Ziele verfolgen als Obama. Ein veränderungsbereiter Präsident allein reicht deshalb trotz seiner weit gefassten Befugnisse nicht aus. Während des Wahlkampfs hat Obama die Erwartungen an seine Person und seine Durchsetzungskraft derart überhöht, dass er nun die Hoffnungen, die mit seiner Wahl verbunden waren, arg dämpfen muss, um seine Sympathisanten nicht übermäßig zu enttäuschen. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass alsbald Abnutzungstendenzen entstehen, mit denen z.B. auch Blair – allerdings nicht schon in seiner ersten Amtsperiode – zu kämpfen hatte.80 5. Fazit Die „special relationship“ zwischen Washington und London ist nach wie vor „special“. Der relative Machtverlust der USA und die ausgeprägte Kooperationsbereitschaft Obamas werden dazu führen, dass die britischamerikanische Freundschaft noch enger wird. Denn das Vereinigte Königreich wird nach den Jahren als Juniorpartner in Kürze eine nahezu gleichberechtigte Rolle einnehmen. Zudem sind die Aussichten gut, dass Barack Obama und Gordon Brown erfolgreich zusammenarbeiten werden. Viele Aufgaben liegen vor ihnen: die Bewältigung der Weltwirtschaftskrise, der Irak-Abzug, die Aufstockung der Streitkräfte in Afghanistan, die Entschärfung der Konflikte im Nahen Osten, die Energiesicherheit und die Revitalisierung der transatlantischen Beziehungen. 80 Vgl. Schwarz, Patrick: Vorsicht Ideale! Warum uns Präsident Obama bei aller Hoffnung in einen Zwiespalt stürzt, in: Die Zeit, 27.11.2008, S.4. Frankreichs neue NATO-Politik: Hebel für eine Neuausrichtung des Bündnisses? Gisela Müller-Brandeck-Bocquet 1. Einleitung Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy ist angetreten, um die Politik seines Landes nach langen Jahren des Stillstands fundamental zu erneuern; hierbei macht er auch vor einem großen Tabu der französischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik nicht halt. So kündigte er seit Mitte 2007 mehrfach an, die schon von seinen Vorgängern eingeleitete Rückkehr Frankreichs in die militärischen Strukturen der NATO zu vollenden bzw. die Beziehungen Frankreichs zur NATO zu normalisieren. Dieser Schritt wurde am 11. März 2009 offiziell bekannt gegeben und anlässlich des 60. Geburtstages der NATO, der am 3./4. April 2009 in Straßburg und Kehl gefeiert wurde, definitiv vollzogen.1 Damit kommt die seit 1966 gepflegte Sonderrolle Frankreichs in der Nordatlantischen Allianz an ihr Ende. Diese Sonderrolle, die vor allem Frankreichs Unabhängigkeit und damit seinen internationalen Geltungsanspruch garantieren sollte, war nicht nur integraler Bestandteil der nationalen Identität, sondern machte Frankreich auch zum enfant terrible des Bündnisses, zum häufig einzigen, sehr wohl vernehmbaren Opponenten gegen die US-amerikanische Dominanz über Europa. „Speedy Sarko“, wie der ungewöhnlich zupackend und temporeich auftretende Staatspräsident gerne genannt wird, begeht mit seiner neuen NATO-Politik einen Tabubruch, der das politische Establishment des Landes spaltet und den parteiübergreifend wirksamen sicherheits- und verteidigungspolitischen Konsens der V. Republik zur Disposition stellt. Folglich fragt sich, welche übergeordneten Zielsetzungen Sarkozy mit diesem markanten Politikwechsel verfolgt. Ist er ins Lager der Atlantiker gewechselt? Oder kann er damit den tradierten französischen Forderungen an das Bündnis neue Durchsetzungschancen verschaffen? Um hier Antworten formulieren zu können, müssen die komplexen strategischen Überlegungen, die die Normalisierung der Beziehungen Frankreichs zur NATO begründen, dargelegt werden. Dies setzt zunächst eine Bilanzierung der derzeitigen französischen Sonderstellung in der NATO voraus. 1 Wegen mangelnder Repräsentativität der Örtlichkeiten in Kehl fand die Abendveranstaltung des Jubiläumsgipfels in Baden-Baden statt. 362 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet 2. Frankreichs Annäherung an die NATO in den 1990er-Jahren Am 7. März 1966 trat Frankreich aus den integrierten Militärstrukturen und dem Atomwaffenprogramm der NATO aus, blieb jedoch Mitglied des Atlantikpaktes. Dies war de Gaulles Reaktion auf die angelsächsische Dominanz im Bündnis sowie auf den US-amerikanischen Strategiewechsel hin zur flexible response, der die Gefahr eines auch mit Nuklearwaffen ausgetragenen Konfliktes in Mitteleuropa in Kauf nahm.2 Seither galt in der französischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik das de Gaullesche Prinzip: „Wenn die westliche Welt bedroht ist, dann ist Frankreich solidarisch mit der westlichen Wertegemeinschaft; in Zeiten der Entspannung versucht es, seine Unabhängigkeit vor allem gegenüber den USA zu bewahren.“3 Eine nennenswerte Abweichung von diesem Kurs ergab sich erst unter dem Sozialisten François Mitterrand (1981-1995). Der Staatspräsident war entschieden transatlantischer ausgerichtet als seine Amtsvorgänger. So hatte er sich im Kontext des NATO-Doppelbeschlusses ganz auf die Seite des Bündnisses gestellt und im Januar 1983 vor dem Deutschen Bundestag mit seinem Diktum „Les pacifistes sont à l’Ouest mais les missiles sont à l’Est“ eindringlich für die Nachrüstung geworben. Doch obgleich Mitterrand die überragende Rolle der NATO für Europas (und Frankreichs) Sicherheit anerkannte, hielt er zunächst an der französischen Sonderrolle im Bündnis fest. Eine neue NATO-Politik entwickelte er erst im Rahmen des Golfkriegs 1991. Frankreich, das mit 14.500 Soldaten an den Kampfhandlungen beteiligt war, musste bitter die Unterlegenheit der eigenen militärischen Fähigkeiten im Vergleich zu den amerikanischen erfahren. „France’s experience of participating in a multinational force commanded by an US general under NATO procedures [...] was both humiliating and revealing – particularly for the military. Any illusion which might have remained about France’s (and Europe’s) capacity to underwrite the collective security of the Continent was shattered in the Saudi Arabian desert.”4 Daher kann der Golf-Krieg als „der Wendepunkt in der französischen NATO-Politik“ gewertet werden.5 Als sich ab 1993 ein NATO-Engagement im zerfallenden Jugoslawien anbahnte, festigte sich in Paris die Erkenntnis, 2 3 4 5 Maulny, Jean-Pierre: Frankreich und seine zukünftige Stellung in der NATO – eine politische, keine militärische Debatte, in: Frankreich-Analysen der FES, November 2007, S.2. Veit, Winfried: Bruch oder Bluff? Französische Außenpolitik unter Sarkozy, in: IPG 2/2008, S.33. Howorth, Jolyon: European integration and defence. The ultimate challenge?, in: Chaillot Papers Nr.43, Institute for Security Studies, Paris 2000, S.18. Burmester, Kai: Atlantische Annäherung – Frankreichs Politik gegenüber der NATO und den USA, in: Die verhinderte Großmacht. Frankreichs Sicherheitspolitik nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, hrsg. von Hanns W. Maull, Michael Meimeth und Christoph Neßhöver, Opladen 1997, S.102. Vgl. auch Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela: Frankreichs Europapolitik, Wiesbaden 2004, S.111ff. und 133ff. Frankreichs neue NATO-Politik: Hebel für eine Neuausrichtung des Bündnisses? 363 dass eine Annäherung an die NATO, eventuell sogar eine Re-Integration, Frankreichs Einfluss im Bündnis stärken könnte. Nachdem Verteidigungsminister Joxe erklärt hatte, dass Frankreich „in den entscheidungsfällenden Gremien anwesend sein müsse [...], in denen [...] über unsere Sicherheit entschieden wird“,6 beteiligte sich Paris ab April 1993 wieder an der Arbeit des NATO-Militärausschusses. Mit Léotard nahm 1994 erstmals seit 1966 wieder ein französischer Verteidigungsminister an einem – allerdings informellen – Treffen der NATOVerteidigungsminister teil.7 Doch obwohl einige damals die vollständige Rückkehr Frankreichs in die NATO-Strukturen erwartet hatten, blieb es unter Mitterrand bei dieser insgesamt begrenzten Annäherung. Staatspräsident Jacques Chirac (1995-2007) forcierte diese proatlantische Kurskorrektur weiter. Im Bosnien-Krieg (1991-1995) musste Europa erneut seine Unterlegenheit Amerika gegenüber erfahren. Daraufhin kündigte Chirac im Dezember 1995 Frankreichs offizielle Rückkehr in den Rat der Verteidigungsminister und den Militärausschuss an. Somit blieb noch eine Hürde für eine vollständige Re-Integration bestehen: die Rückkehr in die militärischen Strukturen. Als im Juni 1996 in Berlin das Combined Joint Task-Forces (CJTF)-Konzept verabschiedet wurde, das den Europäern den Aufbau einer eigenständigen Sicherheits- und Verteidigungsidentität innerhalb der Allianz – als europäischer Pfeiler der NATO – erlaubte, sah Chirac den Moment für eine vollständige Rückkehr gekommen. Denn das CJTF-Konzept entsprach seinen Vorstellungen von einer neuen NATO, die es Frankreich erlaube, „à prendre toute sa place“.8 Vor der Umsetzung des CJTF-Konzepts mussten allerdings noch die Kommandostellen innerhalb des europäischen Pfeilers definiert werden. Weil der NATO-Oberbefehlshaber in Europa, der SACEUR (Supreme Allied Commander Europe), immer ein Amerikaner ist, forderte Chirac, hierin unterstützt von Deutschland, die Posten der regionalen Befehlshaber mittels eines Rotationssystems mit Europäern zu besetzen. Konkret ging es ihm um den Kommandeur der Allied Forces South Europe mit Sitz in Neapel. Doch die USA weigerten sich, das strategisch wichtige Südkommando einem europäischen Offizier zu übertragen. Daraufhin beschloss Frankreich, den militärischen Strukturen der NATO auch weiterhin fernzubleiben. Rückblickend muss Chiracs taktischer Fehler verwundern, die Rückkehr anzukündigen, ohne zuvor den Preis ausgehandelt zu haben.9 6 7 8 9 Joxe zitiert in Burmester: Atlantische Annäherung, S.101. Woyke, Wichard: Deutsch-französische Beziehungen seit der Wiedervereinigung. Das Tandem fasst wieder Tritt, Opladen 2004, S.136. Howorth, Jolyon: La France, l’OTAN et la sécurité européenne: statu quo ingérable, renouveau introuvable, in: Politique étrangère 4/2002, S.1005. David, Dominique: France/OTAN: la dernìere marche, in: Politique étrangère 2/2008, S.431. 364 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet 3. Frankreichs aktuelle undankbare Position innerhalb der NATO Auch wenn Chirac wegen der amerikanischen Unnachgiebigkeit 1997 den Prozess der formellen Re-Integration abbrach, so trieb er angesichts der weltpolitischen Herausforderung in Folge des 11. September 2001 doch die faktische Annäherung substanziell weiter voran. 2002 willigte er sowohl in Frankreichs aktive Beteiligung an der NATO Response Force (NRF) als auch am neuen ACT-Kommando (Allied Command Transformation) in Norfolk/Virginia ein.10 Seit 2004 ist Frankreich mit rund 100 Offizieren bei den integrierten Kommandostrukturen (SHAPE in Mons und ACT in Norfolk) vertreten. Mit insgesamt rund 280 für die Kooperation mit der NATO abgestellten Militärs liegt Frankreichs Personalpräsenz allerdings „nur bei rund 10 Prozent der deutschen oder britischen“.11 Trotz der faktischen Mitarbeit in integrierten NATO-Strukturen bewirkt Frankreichs Sonderstatus außerdem, dass es nicht Teil der ständigen Befehlskette ist – und mithin auch keine führenden Kommandoposten besetzt. Auch verbleiben zwei zentrale NATO-Strukturen, denen Frankreich nicht angehört: die nukleare Planungsgruppe (NPG, Nuclear Planning Group) sowie der Ausschuss für Verteidigungsplanung (DPC, Defence Planning Committee). Demgegenüber sind Frankreichs operative und finanzielle Beiträge zur NATO beachtlich. Frankreich, das sich seit 2003 an allen out-of-area-Einsätzen der NATO beteiligt, war 2007 der drittgrößte Truppensteller und der viergrößte Geldgeber der Allianz.12 Dem steht kein entsprechender Einfluss im Bündnis gegenüber, so dass das Kosten-Nutzen-Kalkül aus französischer Sicht negativ ausfällt. Frédéric Bozo spricht von einer „unsatisfactory role”, weil „the involvement of France at decision making levels is still proportionally much less than its operational participation”.13 Hinzu kommt, dass die globale Entwicklung der NATO während der achtjährigen Amtszeit von US-Präsident Bush mit dem neuen Leitmotiv, dass die Mission die Koalition bestimme, den partnerschaftlichen Ansatz in den Hintergrund gedrängt hat. Für Präsident Sarkozy gibt es also Gründe genug, die unbefriedigende, undankbare und unkomfortable Position Frankreichs in der NATO zu beenden. 10 11 12 13 Ebd. Michel, Léo: Liaison dangereuse. Kehrt Frankreich tatsächlich zurück in die NATO-Strukturen?, in: Internationale Politik, März 2008, S.35. Maulny: Frankreich und seine zukünftige Stellung in der NATO, S.2. Bozo, Frédéric: France and NATO under Sarkozy: End of the French exception?, in: Working Paper der Fondation pour l’innovation politique, Paris 2008, S.6. Frankreichs neue NATO-Politik: Hebel für eine Neuausrichtung des Bündnisses? 365 4. Sarkozys neue NATO-Politik: die Ankündigungen Seine neue NATO-Politik kündigte Sarkozy erstmals in einer Rede vor den in Paris versammelten Botschaftern am 27. August 2007 an. Dies kam überraschend, denn im Wahlkampf war das Thema nicht angesprochen worden. Nachdem er für die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) eindringlich einen „neuen Elan“ gefordert hatte, betonte Sarkozy, dass es zwischen EU und NATO keine Konkurrenz gäbe, vielmehr ergänzten sich beide. „Ich wünsche“, so Sarkozy weiter, „dass wir in den kommenden Monaten gleichzeitig die Stärkung des Europas der Verteidigung und die Erneuerung der NATO und folglich auch deren Beziehung zu Frankreich angehen. Beides gehört zusammen. Ein unabhängiges Europa der Verteidigung und ein transatlantisches Bündnis, wo wir unseren Platz vollständig einnehmen“.14 Ein zweites Mal sprach Sarkozy von seinen NATO-Plänen am 7. November 2007 vor dem US-Kongress. Zunächst erinnerte er daran, dass die USA angesichts der instabilen Weltlage ein starkes und entschlossenes Europa bräuchten. „Es gibt mehr Krisen als Mittel, diese zu bewältigen. Die NATO kann nicht überall präsent sein. Die Europäische Union muss handlungsfähig sein.“ Nachdem er, ganz Pädagoge, das „strategische und legitime Interesse“ dies- und jenseits des Atlantiks an einem starken Europa betont hatte, kam er auf seine neue NATO-Politik zu sprechen. „Hier am Rednerpult des Kongresses sage ich: Je erfolgreicher das Europa der Verteidigung sein wird, umso mehr reift Frankreichs Entscheidung, seinen Platz in der NATO wieder vollständig einzunehmen. Ich wünsche, dass Frankreich, Gründungsmitglied der Allianz und einer ihrer größten Truppensteller, eine wichtige Rolle bei der Erneuerung ihrer Instrumente und Handlungsfähigkeiten übernimmt und dass Frankreich in diesem Kontext seine Beziehung zur Allianz parallel zur Entwicklung und Stärkung des Europas der Verteidigung weiterentwickelt.“ Abschließend sprach Sarkozy noch von einem „glaubwürdigen und starken Europa innerhalb eines neu strukturierten Bündnisses“.15 Ein drittes Mal thematisierte Sarkozy seinen neuen Politikansatz anlässlich des NATO-Gipfels vom 3. April 2008 in Bukarest. Nachdem er im Vorfeld des Treffens bereits eine Aufstockung des französischen Kontingents für Afghanistan um rund 1.000 Soldaten angekündigt hatte, wiederholte er vor seinen Kollegen, dass Frankreich seine Verteidigungsausgaben nicht senken werde, wie schwierig auch immer die Haushaltslage sei. Nach dieser doppelten Zusage, die den Bündnispartnern die Solidarität Frankreichs 14 15 Rede Sarkozys vor der Botschafterkonferenz am 27.8.2007 in Paris, http:// www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=embassadeur-27-08-07.pdf Rede Sarkozys vor dem US-Kongress am 7.11.2007, http://www.elysee.fr/edito/index.php?id=23 366 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet im Kampf gegen den Terrorismus versprach, ging Sarkozy quasi zum Angriff über. Wieder betont er die Notwendigkeit sowohl der NATO wie auch eines starken Europas der Verteidigung. Sarkozy sah sich hier von Präsident Bush bestätigt, der am 2. April 2008 völlig unerwartet erklärt hatte: „Building a strong NATO alliance also requires a strong European defense capacity.” Sarkozy nahm dies begierig auf und dankte Bush in seiner Bukarester Ansprache gleich zwei Mal für dieses Bekenntnis. „Dies eröffnet für Frankreich die Möglichkeit, seine Beziehungen zur NATO grundlegend zu erneuern.” Erstmals nannte er auch ein Datum für die Umsetzung seiner neuen NATO-Politik: Der Prozess der Normalisierung werde anlässlich des NATO-Gipfels vom 3./4. April 2009 abgeschlossen werden, der zugleich den 60. Geburtstag der Allianz begehen und in Straßburg und Kehl stattfinden wird. „Das wird das Symbol der deutsch-französischen Freundschaft, der europäischen Versöhnung und der transatlantischen Partnerschaft sein.”16 5. Das doppelte Junktim in Sarkozys neuer NATO-Politik Eine genauere Analyse der Ankündigungen Sarkozys zeigt, dass diejenigen viel zu kurz greifen, die den neuen Politikansatz lediglich als Ausdruck des „Atlantizismus“ des Staatspräsidenten bzw. seines Wunsches interpretieren, Briten und Deutschen den Rang als verlässlichste Partner Washingtons abzulaufen. Zwar ist Sarkozy ohne jeden Zweifel der amerikafreundlichste aller bisherigen Präsidenten der V. Republik. Dafür lassen sich zahlreiche Belege finden – seine NATO-Initiative aber gehört nicht dazu. Vielmehr sucht der Staatspräsident, die Dilemmata des aktuellen Status’ Frankreichs in der NATO aufzulösen. Diese stellen sich auf der Grundlage der obigen Ausführungen folgendermaßen dar:17 Wie ist die Diskrepanz zwischen Frankreichs geringem Einfluss in der Allianz und seinen konkreten Beiträgen aufzulösen? Wie kann Paris angesichts seiner der Sonderrolle geschuldeten relativen Isolation wirksam auf die langfristigen Entwicklungen des Bündnisses Einfluss nehmen? Und wie kann Frankreich gleichzeitig seinen jahrzehntelangen Bemühungen um ein auch sicherheits- und verteidigungspolitisch handlungsfähiges Europa, um ein Europe Puissance,18 nachhaltig zum Durchbruch verhelfen? 16 17 18 Rede Sarkozys auf dem NATO-Gipfel von Bukarest am 3.4.2008, http:// www.elysee.fr/documents/index.php?mode=view&lang=fr&cat_id=7&press_ id=1243 Bozo: France and NATO under Sarkozy, S.5. Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela: The big Member States’ influence on the shaping of European Union’s Foreign, Security and Defence Policy, in: The future of the European Foreign, Security and Defence Policy after Enlargement, hrsg. von Gisela Müller-Brandeck-Bocquet, Baden-Baden 2006, S.25-53. Frankreichs neue NATO-Politik: Hebel für eine Neuausrichtung des Bündnisses? 367 Die Antwort des Präsidenten besteht in einem doppelten Junktim, d.h. er verknüpft die vollständige Rückkehr Frankreichs in die NATO mit gewissen Bedingungen. Dies verdeutlicht bereits, dass sich Sarkozy keineswegs sang- und klanglos ins Lager der Atlantiker einreihen möchte. Vielmehr erwartet er, dass sein Rückkehrbeschluss der ESVP, dem Europa der Verteidigung, wie er zu sagen pflegt, eine neue Dynamik verleiht (erstes Junktim). Denn eine stärkere ESVP, die auf Komplementarität zur NATO beruht und deren Beitrag zur internationalen Sicherheit die USA explizit wünschen und würdigen, wird das Gewicht der Europäer in der NATO zwangsläufig vergrößern. Daran schließt das zweite Junktim an: Frankreich will nur in eine erneuerte NATO zurückkehren – wobei die angemahnte Erneuerung so zu verstehen ist, dass Frankreich die seit Gründung der Allianz bestehende Asymmetrie zugunsten der Amerikaner beendet und Europa als gleichberechtigten sicherheits- und verteidigungspolitischen Partner anerkannt sehen möchte. „Ein Frankreich, das seinen Platz in der NATO vollständig einnimmt, das wäre eine Allianz, die Europa mehr Platz einräumt.“19 Um seinen Landsleuten die vollständige Rückkehr Frankreichs in die NATO schmackhaft und akzeptabel zu machen, entfaltete Sarkozy im Vorfeld des April-Gipfels der Allianz also einen komplexen, mit Junktims versehenen Ansatz, der folgendermaßen argumentierte: Frankreich wird nur in eine erneuerte NATO zurückkehren, die die ESVP als gleichberechtigten Partner akzeptiert. Um diese Gleichberechtigung aber glaubwürdig einfordern zu können, muss die ESVP grundlegende Fortschritte machen und den seit 1999 erreichten, insgesamt aber noch bescheidenen Stand endlich überwinden. Eine substanzielle Stärkung der ESVP setzt nach Sarkozys Ansicht jedoch wiederum voraus, dass Frankreich auf seine Sonderrolle verzichtet und ein „normales“ NATO-Mitglied wird. Der Präsident ist der Auffassung – das zeigen alle seine Ankündigungen –, dass Frankreich nur als vollwertiges NATO-Mitglied die ESVP glaubhaft vorantreiben kann. Denn ein auf seinem Sonderstatus beharrendes Frankreich provoziert bei seinen Partnern dies- und jenseits des Atlantiks Misstrauen und Blockadereflexe, weil man ihm konstant unterstellt, letztlich eine Schwächung der transatlantischen Allianz zu betreiben. In der Tat war dies über Jahrzehnte hinweg ein zentraler Grund, weshalb das integrierte Europa die US-Dominanz in der NATO akzeptierte, bis Ende der 1990er-Jahre sicherheits- und verteidigungspolitisch abstinent blieb und der Ausbau der ESVP seither nur schleppend vorangeht.20 Dieses Misstrauen wird in der osterweiterten EU konstant neu geschürt, da neben dem traditionell ESVP-skeptischen Großbritannien nun auch die neuen Mitglieder aus Osteuropa mit ihrem ausgeprägten Atlantizismus Frankreich bezichtigen, das 19 20 Sarkozy zitiert in Le Monde, 18.6.2008. Siehe Müller-Brandeck-Bocquet: Frankreichs Europapolitik; Dies.: The big Member States´ influence. 368 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet Bündnis schwächen zu wollen. Sarkozys neue NATO-Politik dient folglich in großem Maße der Vertrauensbildung in der EU-27 als Voraussetzung für eine Stärkung der ESVP. Während tatsächlich einiges dafür spricht, dass Frankreichs Rückkehr in die NATO die ESVP deutlich beflügeln könnte, so bleibt fraglich, ob die geplante Re-Integration zu einem vermehrten französischen Einfluss im Bündnis führen kann. Hier geht es darum – und das ist ein weiterer Aspekt des französischen Rufs nach einer erneuerten Allianz –, dass Paris grundlegende Reformen der NATO für notwendig erachtet und nach Mitteln sucht, diese aktiv mitzugestalten. Denn Frankreich will – übrigens seit langem schon – den überdimensionierten Militärapparat der NATO verkleinern und den neuen strategischen Erfordernissen anpassen. Zweitens möchte Paris – ebenfalls schon seit Jahren – die wachsende Politisierung der Allianz begrenzen, um zu verhindern, dass sie zum wichtigsten, zwangsläufig von den USA dominierten Eckpfeiler der internationalen Ordnung wird. Diesen Abwehrkampf gegen eine globale und politisierte NATO hatte Mitterrand angesichts der raschen Erweiterung der Allianz nach Ende des Kalten Krieges eingeleitet.21 Angesichts der amerikanischen NATO-Politik der Bush-Jahre, in der die Mission die Koalition bestimmte und Washington vor allem die Legitimationsressourcen des Bündnisses schätzte, wehrte Paris sich erneut gegen die „Globalisierung“ der NATO, zum Beispiel, gemeinsam mit Deutschland, gegen den schnellen Beitritt Georgiens und der Ukraine. Zu den klassischen Reformforderungen, die Paris an die NATO stellt, gehört schlussendlich auch das schon erwähnte Anliegen, den Europäern im Bündnis mehr Gewicht – inklusive hochrangiger Kommandoposten – einzuräumen, um dadurch die Asymmetrie sprich die amerikanische Dominanz zu beenden. Angesichts der sehr weitreichenden Reformforderungen, die Paris seit jeher an die NATO stellt, darf bezweifelt werden, dass die Normalisierung eine Neuausrichtung der Allianz nach französischen Vorstellungen herbeiführen könnte.22 6. Die Stärkung der ESVP als Pendant zur Rückkehr – Mission erfüllt? Wenn Präsident Sarkozy seine neue NATO-Politik vorrangig als Dienst an Europa ausgibt, so heißt dies konkret, dass er der Stärkung der ESVP oberste Priorität einräumt. Hier eröffnete ihm die französische EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2008 wirkungsvolle Handlungsmöglich21 22 Müller-Brandeck-Bocquet: Frankreichs Europapolitik, S.133ff; Dies.: Wie halten wir es mit Amerika? Die transatlantischen Beziehungen, die Konstruktion Europas und die deutsch-französische Zusammenarbeit in der Ära Kohl, in: Historisch-politische Mitteilungen, Archiv für Christlich-Demokratische Politik, 14/2007, S.280ff. Skeptisch auch Bozo: France and NATO under Sarkozy, S.9ff. Frankreichs neue NATO-Politik: Hebel für eine Neuausrichtung des Bündnisses? 369 keiten. Sarkozy ergriff sie und erklärte das Ziel, der ESVP einen neuen Impuls zu verleihen, zu einem der vier Schwerpunkte seines Präsidentschaftsprogramms. Konkret plante Frankreich die Ausarbeitung einer neuen europäischen Sicherheitsstrategie (ESS), die das 2003 verabschiedete Dokument ersetzen soll. Vorrangig strebte Sarkozy jedoch den Ausbau der militärischen und zivilen ESVP-Kapazitäten an.23 Der im Präsidentschaftsprogramm ebenfalls angesprochenen vertieften Zusammenarbeit zwischen EU und NATO diente ein bereits im Oktober 2007 dem NATORat unterbreitetes Papier Frankreichs mit weitreichenden Kooperationsvorschlägen. Damit – so ein Kommentar – habe Paris seine traditionelle Obstruktion gegen eine Annäherung von EU und NATO aufgegeben und sei den Wünschen Washingtons und Londons substanziell entgegengekommen.24 Angesichts der französischen Ambitionen und Vorleistungen ist nun zu fragen, ob Ratspräsident Sarkozy der ESVP tatsächlich einen spürbaren neuen Impuls verleihen konnte? Oder haben die turbulenten Ereignisse während Frankreichs EU-Vorsitz (das irische Nein zum Lissabonner Vertrag vom 12. Juni 2008,25 der Georgien-Russland-Krieg vom August 2008 sowie die Finanzkrise ab Herbst 2008) den zum obersten europäischen Krisenmanager avancierten Sarkozy von seinen Plänen abgebracht? Nein, denn weitgehend unbeachtet von der Öffentlichkeit hat der Europäische Rat vom 11./12. Dezember 2008 „seinen Willen bekräftigt, der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit konkreten Entscheidungen einen neuen Impuls zu geben und so den neuen Aufgaben Rechnung zu tragen, die sich auf dem Gebiet der Sicherheit Europas stellen“.26 Die „Erklärung des Europäischen Rats zum Ausbau der ESVP“ enthält alles, was Frankreich vorgeschlagen hatte: eine allerdings nur halbherzige Überarbeitung der ESS, das Versprechen, die „Unzulänglichkeiten der verfügbaren Mittel in Europa durch eine schrittweise Verbesserung der zivilen und militärischen Fähigkeiten zu beheben“ mitsamt einer detaillierten „Erklärung zur Verstärkung der Fähigkeiten“,27 die Verpflich23 24 25 26 27 Vgl. Punkt 3.1 des französischen Präsidentschaftsprogramms, das zahlreiche Vorschläge zur Kapazitätsverbesserung enthält. Le Monde, 10.10.2007; Veith: Bruch oder Bluff?, S.45. Mit Blick auf die ESVP-Priorität wirkt sich die Infragestellung des Lissabonner Vertrags durch Irland und neuerdings wieder Tschechien besonders gravierend aus, da nun ein Rückgriff auf das nützliche und pragmatische Instrument der strukturierten Zusammenarbeit in absehbarer Zeit ebenso obsolet geworden ist wie die neue Position eines Fast-Europäischen Außenministers. Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Brüssel, 12.12.2008, Dok.17271/08. Erklärung des Rats vom 8.12.2008 zur Stärkung der Fähigkeiten der ESVP, Dok.16840/08. Konkrete Projekte sind u.a. die Aufstellung einer europäischen Lufttransportflotte, Verbesserung bei der Aufklärung und v.a. verstärkte Rüstungskooperationen, um den Fähigkeitsentwicklungsplan der European Defence Agency (EDA) umzusetzen. 370 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet tung, bis zu 19 zivile und militärische ESVP-Missionen unterschiedlicher Dimension gleichzeitig führen zu können, ein „Erasmus militaire“, das die Kooperation im Ausbildungsbereich fördert, sowie ein klares Bekenntnis, „in vollständiger Komplementarität [...] im Rahmen einer erneuerten transatlantischen Partnerschaft [...] die Zusammenarbeit zwischen EU und NATO zu stärken“. Deshalb soll – wie von Frankreich vorgeschlagen – „eine informelle hochrangige EU-NATO-Gruppe“ eingerichtet werden. Als einziges, allerdings gravierendes Defizit der ESVP-Beschlüsse bleibt, dass der ER in der hochsensiblen Frage des Aufbaus eines unabhängigen europäischen Hauptquartiers sich lediglich zur Bestärkung der Bemühungen Solanas „um die Schaffung einer neuen ganzheitlichen Struktur zur zivil-militärischen Planung“ von ESVP-Missionen bereitfand. Vor allem Großbritannien erteilte den französischen Plänen, das bereits bestehende, aber noch embryonäre EU-Operations-Centre mit seinen 90 Mitarbeitern um 20 bis 30 Personen aufzustocken, eine Abfuhr.28 Dennoch erklärte Verteidigungsminister Hervé Morin nach dem Dezember-Gipfel 2008: „Alles, was wir vor einem Jahr auf den Tisch gelegt haben, ist auf dem Wege.“29 7. Beendet die Rückkehr die „exception française“? Sarkozys neue NATO-Politik beruht auf der Erkenntnis, dass Frankreichs Sonderrolle im Bündnis unhaltbar geworden ist und den französischen Interessen nicht mehr entspricht. Diese Sicht teilte auch das Expertenteam, das im Juni 2008 das neue Weißbuch „Verteidigung und nationale Sicherheit“ vorlegte. Es plädiert eindeutig für die Rückkehr Frankreichs in die integrierten NATO-Strukturen und stützt damit Sarkozys Linie.30 Es stellt sich nun die Frage, wie man sich diese „vollständige Rückkehr“ konkret vorzustellen hat. Wird Frankreich damit ein NATO-Mitglied wie jedes andere auch? Wird Paris sein Motto: „Friends, allies, but not aligned“ vollständig aufgeben und sich brav ins Lager der Atlantiker einreihen? Kurz: Kommt die sicherheits- und verteidigungspolitische „exception française“ damit definitiv an ihr Ende? 28 29 30 Kempin, Ronja: Frankreich und die Annäherung von NATO und EU, in: SWPAktuell, April 2008, S.2. Zum europäischen Hauptquartier vgl. auch MüllerBrandeck-Bocquet, Gisela: Deutsch-französische Beziehungen und das Projekt „Friedensmacht Europa“, in: Berliner Friedenspolitik?, hrsg. von Peter Schlotter, Wilhelm Nolte und Renate Grasse, Baden-Baden 2008, S.233-260. Le Monde, 4.10.2008. Kritisch hingegen Kempin, Ronja/Overhaus, Marco: Kein großer Sprung in der Entwicklung der ESVP. Lehren aus der französischen Ratspräsidentschaft, in: SWP-Aktuell, Januar 2009. Kempin, Ronja: Modernisierung der französischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, in: SWP-Aktuell, August 2008, S.1. Außerdem plädiert das Weißbuch für eine „stärkere Europäisierung der französischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ und fordert, die autonomen Planungs- und Führungskapazitäten der EU auszubauen. Frankreichs neue NATO-Politik: Hebel für eine Neuausrichtung des Bündnisses? 371 Die Antwort kann nur „Nein“ lauten. Denn zum einen wird die „vollständige Rückkehr“ nicht vollständig sein. Während Frankreich in das DPC – in dem so zentrale Themen wie aktuell der US-Raketenabwehrschild entschieden werden – zurückkehrt, wird das nicht für die NPG gelten. Dies ermöglicht es Frankreich, die autonome Entscheidungsbefugnis über die Force de Frappe beizubehalten. Dazu Sarkozy: „Die nukleare Abschreckung Frankreichs wird strikt national bleiben.“31 Auch weiterhin wird Frankreich der NATO in Friedenszeiten keine Truppen unterstellen. Schließlich ist nicht damit zu rechnen, dass Frankreich quantitativ vollständig in die integrierten Strukturen zurückkehrt. Denn um auf gleichem Niveau wie Briten oder Deutsche in diesen Strukturen vertreten zu sein, müsste Frankreich seine Präsenz von derzeit 120 auf rund 1.200 Personen verzehnfachen. Da dies weder finanz- noch personalpolitisch in kurzer Zeit zu stemmen ist und Frankreich den NATO-Apparat eh als überdimensioniert betrachtet, wird vielmehr mit einer „reintegration a minima“ gerechnet, „whose significance would be more symbolic or political than practical or military“.32 Insgesamt, so wurde beim NATO-Gipfel vom 3./4. April 2009 bekannt, wird Frankreich rund 15 Generäle in die Militärstrukturen entsenden.33 Eine hohe symbolische Bedeutung kommt auch dem künftigen Zugriff Frankreichs auf NATO-Kommandoposten zu. „Frankreich kann seinen Platz in der NATO nur dann einnehmen, wenn ihm auch ein Platz eingeräumt wird“ – so vormals Chiracs und nun Sarkozys Mantra.34 Laut Presseberichten hat Sarkozy bzw. sein Chefberater Jean-David Levitte bereits die Zustimmung von James Jones, Präsident Obamas neuem Nationalen Sicherheitsberater, erhalten, dass Frankreich das ACT-Kommando in Norfolk sowie das Regionalkommando in Lissabon übernehmen kann, wo sich das Hauptquartier der NRF, zu welcher Paris ja erheblich beiträgt, befindet.35 Diese konkreten Aussichten sowie die Rückkehr-Perspektive insgesamt haben in Frankreich eine lebhafte Debatte ausgelöst. Denn nicht nur in der Armee gibt es gegen Sarkozys Angriff auf das gaullistische Allerheiligste Widerstand. Auch in der breiteren Öffentlichkeit wird befürchtet, dass Sarkozys neue NATO-Politik das internationale Gewicht Frankreichs, seinen Einfluss, seine auf Unabhängigkeit beruhende Rolle, oft laut auszu31 32 33 34 35 Sarkozy zitiert in Le Monde, 18.6.2008. Vgl. auch Sarkozys Rede vom 11.3.2009, in der er seine Rückkehrpolitik offiziell bekannt gab, in: Le Monde, 13.3.2009. Bozo: France and NATO under Sarkozy, S.14; siehe auch Kempin: Frankreich und die Annäherung von NATO und EU, S.2. Le Monde, 4.4.2009. Sarkozy zitiert in Le Monde, 5.2.2009. Le Monde, 5.2.2009; Süddeutsche Zeitung, 20.2.2009. 372 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet sprechen, was andere leise denken, beschädigen könnte. Besonders drastisch formuliert der frühere sozialistische Außenminister Hubert Védrine: Wenn Frankreich ein „normaler Bündnispartner“ würde, sähen dies viele Länder als eine „Wiedereinordnung unter die USA an“; dies würde zu einer „Marginalisierung von Frankreichs internationalem Gewicht führen“.36 Andere fürchten die Aufgabe eines wichtigen Bestandteils der Identität Frankreichs.37 Und wieder andere fordern, dass das Junktim zwischen Rückkehr und Europäisierung der NATO strikt umgesetzt wird. Besonders weit verbreitet sind die Zweifel daran, dass Sarkozys neue NATOPolitik der ESVP entscheidende Impulse verschaffen könnte. Ist es nicht vielmehr so, dass mit seiner Rückkehr nun auch Frankreich auf seine tradierten Ambitionen verzichte, fragt Laurent Zecchini und orakelt: „La messe atlantiste est dite.“38 Nicht zuletzt um solchen Vorwürfen einer schlussendlich doch bedingungslosen vollständigen Rückkehr Frankreichs in die NATO den Wind aus den Segeln zu nehmen bzw. politisch zu neutralisieren, hat Premierminister François Fillon die Parlamentsdebatte, die am 17. März 2009 stattfand, mit der Vertrauensfrage gekoppelt, so dass widerstrebende Abgeordnete der Regierungsmehrheit deutlich diszipliniert wurden.39 Außerdem bemühte sich Sarkozy anlässlich des Gipfelmarathons von Anfang April 2009 (G-20 in London, NATO-Jubiläum in Straßburg und Kehl, USAEU-Gipfel in Prag) dem neuen US-Präsidenten gegenüber seine Unabhängigkeit zu demonstrieren. So kam er – ebenso wie die anderen Europäer – Obamas Appellen, ein stärkeres Engagement in Afghanistan zu zeigen, nur in Nuancen nach. Dessen Ansicht, dass die Türkei Vollmitglied der EU werden sollte, widersprach er gar offen. Eine gewisse Konkurrenz beider zeichnet sich in der künftigen Abrüstungspolitik ab. Denn bereits am 8. Dezember 2008 hatte der scheidende Ratspräsident Sarkozy die EU-Außenminister veranlasst, eine der nuklearen Abrüstung gewidmete Erklärung anzunehmen. Im Vorfeld der für 2010 angesetzten Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags unterbreitete die EU somit erstmals konkrete Vorschläge zur nuklearen Abrüstung.40 Damit wollte Sarkozy dem neuen US-Präsidenten bedeuten, dass hier auch Europa ein Mitspracherecht hat. Obama hingegen betrachtet die Vision einer atomwaffenfreien Welt, wie er sie höchst publikumswirksam am 5. April 2009 in Prag vorstellte, 36 37 38 39 40 Védrine zitiert nach Michel: Liaison dangereuse, S.35. So Modem-Chef F. Bayrou in: Le Monde, 5.2.2009. Le Monde, 11.3.2009. In der Bevölkerung wird der Schritt positiver aufgenommen; so stimmen 58% der Franzosen dieser Entscheidung zu, 76% der UMP- und 52% der PS-Anhänger. Siehe hierzu Le Monde, 12.3.2009. Z.B. wird ein Verbot der Herstellung spaltbaren Materials sowie eine Weiterführung des START-Abkommens zwischen den USA und Russland gefordert, vgl. Erklärung des Rats zur Stärkung der internationalen Sicherheit vom 8.12.2008, Dok.16751/08. Frankreichs neue NATO-Politik: Hebel für eine Neuausrichtung des Bündnisses? 373 als Bestandteil seines globalen Führungsanspruchs.41 Sarkozy minimisiert nun die Tragweite von Obamas Vorstoß: Der US-Präsident greife lediglich bereits existierende Maßnahmen und Vorschläge auf, um die bisherige Verzögerungspolitik der USA zu kaschieren.42 Es lässt sich zusammenfassen, dass ein Frankreich, das sich selbst angesichts der eben vollzogenen vollständigen Rückkehr in die NATO gewisse Sonderrechte reserviert und bemüht ist, den US-amerikanischen Führungsanspruch zu begrenzen, so angepasst, so aligned nicht sein kann. Ein vollständiges Ende der „exception française“ steht also nicht an. 8. Das katalytische Potenzial von Frankreichs neuer NATO-Politik: ein Ausblick Präsident Sarkozy hat Frankreichs vollständige Rückkehr in die NATO durchgesetzt, weil er diesem Schritt ein hohes katalytisches Potenzial beimisst. Der sicherheitspolitische Schulterschluss, den er im Kontext der Münchner Sicherheitskonferenz vom Februar 2009 mit Deutschland erreichte, gab ihm ein erstes Mal Recht. Denn am 4./5. Februar 2009 legte er gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ein Papier zur Zukunft des Bündnisses und zur Beziehung NATO-EU vor, in dem die beiden ohne vorausgegangene Konsultationen mit der neuen US-Regierung erstmals deutsch-französische Vorschläge unterbreiteten.43 Aus diesem bemerkenswerten, inhaltlich dichten Vorstoß ist besonders hervorzuheben, dass Merkel und Sarkozy im Bündnis gemeinsame Entscheidungsfindung einfordern – „einseitige Schritte würden dem Geist dieser Partnerschaft widersprechen“ – und als Voraussetzung der transatlantischen Gleichberechtigung eine weitere Stärkung der Europäischen Sicherheitspolitik verlangen: „Wir Europäer müssen mit einer Stimme sprechen.“ Am deutlichsten aber ist ihr gemeinsamer Widerstand gegen eine Umwandlung der NATO in eine globale Sicherheitsagentur, wie die USA sie seit längerem anstreben. Paris und Berlin hingegen möchten die Grundlagen der NATO „nicht neu erfinden“ und erkennen in Art. 5 des Vertrags den „Wesenskern“ der „militärisch geprägten Allianz“. Damit setzen Merkel und Sarkozy einen deutlich konturierten, mit deutsch-französischen Anliegen unterfütterten Rahmen für die nun anstehenden Debatten über eine neue NATO-Strategie. Auch nehmen sie die neue US-Administration 41 42 43 Mit seiner Vision schließt sich Obama der „process global zero“-Initiative an, die derzeit von Teilen des amerikanischen sicherheitspolitischen Establishments propagiert wird. Der Kampagne gehört u.a. Henry Kissinger an. Vgl. auch Rudolf, Peter: Amerikas neuer globaler Führungsanspruch, in: SWP-Aktuell, November 2008, S.5. Le Monde, 11.4.2009. Abgedruckt am 4.2.2009 in der Süddeutschen Zeitung und am 5.2.2009 in Le Monde. 374 Gisela Müller-Brandeck-Bocquet beim Wort, die in der Person des neuen Nationalen Sicherheitsberaters, des Vier-Sterne-Generals James Jones, den Verbündeten Zusammenarbeit und gegenseitige Abstimmung zugesagt hat.44 Frankreichs neue NATOPolitik kann – so hat es den Anschein – insofern katalytisch wirken, als Deutschland mit einem NATO-Vollmitglied Frankreich an seiner Seite es nun wagen könnte, Europas Außen- und Sicherheitspolitik substanziell stärken zu wollen. Demgegenüber hat der konkrete Vollzug von Frankreichs Rückkehr in die NATO keine direkten dynamisierenden Auswirkungen gezeitigt. Die Rückkehr wurde während des NATO-Geburtstages eher als „non-event“ begangen, in der „Strasbourg/Kehl Summit Declaration“ heißt es höchst lapidar: „We warmly welcome the French decision to fully participate in NATO structures; this will further contribute to a stronger Alliance.“ Auch der Punkt 20 dieser Erklärung, in welchem die NATO „recognises the importance of a stronger and more capable European defence and welcomes the EU’s efforts to strengthen its capabilities and its capacity to address common security challenges”, eröffnet dem Europa der Verteidigung noch keine neuen Horizonte.45 Insofern muss man die neue Strategie der Allianz abwarten, die der Jubiläumsgipfel in Auftrag gegeben hat und die bis 2010 vorliegen soll, um das tatsächliche katalytische Potenzial von Frankreichs neuer NATO-Politik für die europäische Rolle im Bündnis bewerten zu können. Um hier substanzielle Veränderungen zu erreichen, sind nun vor allem die Europäer gefordert. Sind Frankreichs 26 EU-Partner überhaupt willig und fähig, in einer reformierten Allianz power und burder sharing glaubwürdig neu auszutarieren? Erst dann wird sich erweisen, ob Sarkozys Rechnung aufgeht, dass seine neue NATO-Politik eine Neuausrichtung des Bündnisses auslösen könnte. 44 45 Vgl. das Interview mit Jones in der Süddeutschen Zeitung, 9.2.2009. Vgl. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52837.htm?mode=pressrelease. In der Declaration on Alliance Security findet sich diese Passage wortgleich wieder, vgl. http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_52838.htm?mode=pressrelease Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen Reinhard Wolf „After eight years of often gratuitous unilateralism, arrogance, and lack of diplomacy, Barack Obama and Joe Biden will treat allies with respect, repair America’s damaged moral authority, and recreate a mutually beneficial partnership with valuable partners.”1 Dass Menschen im Alltag immer respektiert werden möchten, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die keiner näheren Begründung bedarf. Ebenso verwundert es niemanden, wenn eine Person, die sich missachtet fühlt, hierauf schroff reagiert. Bei der Analyse internationaler Beziehungen wird dieser Gesichtspunkt jedoch nach wie vor ausgeklammert. Entweder geht man davon aus, dass Politiker und insbesondere Diplomaten stets besonderes Geschick beweisen, wenn es um die Achtung ihres Gegenübers geht. (Diese Vermutung schlägt sich in unserem alltäglichen Sprachgebrauch nieder, der ein besonders taktvolles Vorgehen als „diplomatisch” kennzeichnet.) Oder es wird einfach unterstellt, Diplomaten und ihre politischen Vorgesetzten könnten alle Formen der Missachtung, die ihnen persönlich oder ihrem Staat gezeigt wird, einfach professionell ausblenden oder „hinunterschlucken”. Nach der gängigen Vorstellung beeinflussen solche Aspekte des Verhaltens kaum das internationale Geschehen. Entscheidend für Kooperation oder Konflikt seien letztlich nur Interessens- und Machtkonstellationen. Demgegenüber soll hier die These vertreten werden, dass die Erfahrung von Respekt oder Missachtung durchaus wichtige Beziehungen wie die zwischen den atlantischen Verbündeten bestimmen kann. Die nachhaltige Entfremdung, welche nach dem Amtsantritt von George W. Bush zwischen den USA und ihren europäischen Verbündeten zu beobachten war, ist zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass die Partner jeweils nicht die Beachtung erfuhren, die sie voneinander erwarteten. Die dadurch ausgelöste Frustration, Empörung, ja sogar kaum verhohlene Wut, trugen wesentlich zur Eskalation der Auseinandersetzungen bei. Langfristig veränderten diese kränkenden Erlebnisse die wechselseitige Wahrnehmung, insbesondere die europäische Perzeption der USA, und untergruben das Vertrauen zwischen den Partnern. Künftige Zusammen1 Obama, Barack/Biden, Joe: A Stronger Partnership with Europe for a Safer America, www.barackoboma.com, Stand: 4.11.2008. 376 Reinhard Wolf arbeit wird dadurch zwar nicht verhindert, aber eben doch erschwert. Insofern erscheint es aus einer transatlantischen Perspektive durchaus sinnvoll, wenn die neue US-Administration bewusst einen neuen Umgangsstil in Aussicht stellt, der europäische Empfindlichkeiten stärker berücksichtigt. Der Beitrag gliedert sich in drei Teile. Zunächst wird der Versuch unternommen, die Begriffe „Respekt” und „Missachtung” in einer Weise einzugrenzen, die sie für die Anwendung auf die internationale Politik fruchtbar macht. Im zweiten Teil werden Überlegungen vorgestellt, die dafür sprechen, dass die Erfahrung von Respekt die Zusammenarbeit zwischen Staaten fördert und dass umgekehrt erfahrene Missachtung die Eskalation von Konflikten begünstigt. Anschließend wird demonstriert, wie die unerfüllten Respekterwartungen der USA, Frankreichs und Deutschlands die transatlantische Auseinandersetzung über die Entwaffnung des Irak anheizten. Das kurze Fazit zieht hieraus Schlussfolgerungen für die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. 1. „Respekt“ und „Missachtung“ im internationalen Kontext „Respekt“ ist ein ganz alltägliches Wort. Es wird verwendet, um zum Beispiel die Anerkennung für eine bestimmte Leistung auszudrücken, oder auch als Synonym für „Ansehen“. Im letzteren Sinne wird es zunehmend auch in der internationalen Politik gebraucht, etwa wenn die ehemalige Senatorin (und heutige Außenministerin) Hillary Clinton im Wahlkampf dem amtierenden Präsidenten vorwirft, er habe mit seiner Politik den internationalen Respekt verspielt, welchen die USA lange genossen hätten: „To lead, a great nation must command the respect of others. … The tragedy of the last six years is that the Bush administration has squandered the respect, trust, and confidence of even our closest allies and friends.”2 Im Folgenden ist mit dem Ausdruck jedoch etwas anderes gemeint, nämlich die angemessene Beachtung eines Akteurs durch sein soziales Umfeld. Eine Missachtung wird hingegen erfahren, wenn der Akteur nicht die Beachtung zu bekommen glaubt, die ihm seiner Ansicht nach zusteht. Entscheidend für die tatsächliche Reaktion eines Akteurs sind schließlich seine subjektiven Wahrnehmungen und Einschätzungen und nicht die Ansprüche an das Verhalten anderer, die er gemäß objektiv begründbarer Normensysteme stellen dürfte. Angemessene Beachtung beanspruchen Akteure in der Regel in folgenden Dimensionen: 2 Clinton Rodham, Hillary: Security and Opportunity for the Twenty-first Century, in: Foreign Affairs 6/2007, S.2-18, hier S.2. Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen – – – – – 377 für ihre soziale Bedeutung (im Sinne von Wichtigkeit), für ihre Bedürfnisse, für ihre Leistungen und Vorzüge, für ihre Standpunkte, Ideen und Werte sowie für ihre Rechte. Es geht also um die Würdigung einer ganzen Palette von Attributen, die sich zum Teil auf die positiven Momente der eigenen Identität beziehen (Leistungen, Vorzüge, Standpunkte und Werte), teilweise auf die abstrakte persönliche Würde, die erst die Grundlage für die Herausbildung solch einer individuellen Identität schafft (soziale Bedeutung als zurechnungsfähiger Akteur und grundlegende Rechte), auf Status (besondere Bedeutung in einer sozialen Ordnung und besondere Rechte) und zum Teil auf ganz gewöhnliche Bedürfnisse (z.B. Ernährung), deren Nichtbeachtung ebenfalls als kränkend erlebt werden kann. „Angemessene Beachtung” ist dabei nicht unbedingt gleichzusetzen mit Zustimmung, Befürwortung oder aktiver Förderung. Oft erwarten Akteure nur, dass ihre Bedürfnisse, Standpunkte oder die soziale Bedeutung nicht übersehen, sondern wenigstens ernst genommen werden. Ganz wesentlich für die Konzeption von Respekt, so wie sie hier vertreten wird, ist der Gesichtspunkt, dass Akteure stets der Überzeugung sind, sie hätten Anspruch auf ein bestimmtes Mindestmaß an Beachtung. So betrachtet wird Respekt nicht freiwillig entgegengebracht – wie dies vielleicht für Bewunderung gilt. Respekt wird nicht geschenkt, er wird einem „abgenötigt”. Respekt wird „gezollt” – oder er müsste zumindest gezollt werden. Wo dies nicht geschieht, verstößt das Gegenüber also gegen eine Norm, jedenfalls nach Auffassung dessen, der die Beachtung einfordert. Es ist dieser subjektiv erlebte Verstoß gegen angeblich etablierte Normen, der die Erfahrung von Missachtung so kränkend macht. Man erfährt nicht die Behandlung, die einem nach eigener Überzeugung zusteht. Die häufige Folge ist Empörung, wenn nicht gar Wut. Umgekehrt wird die angemessene Beachtung durch andere natürlich positiv erlebt. Wenn unsere Bedeutung und unsere Vorzüge und Leistungen so gewürdigt werden, wie wir das erwarten, dann wird das als Bestätigung erfahren. Es stärkt unsere Selbstachtung und oft auch unser Selbstwertgefühl. In den Erfahrungen von Respekt oder Missachtung verbinden sich also unsere normativ begründeten Erwartungen mit der tatsächlich erfahrenen Behandlung durch andere in einer besonders brisanten Weise, welche unmittelbar die emotionale Verbindung mit oder Abgrenzung gegenüber dem sozialen Umfeld beeinflusst. Insofern ist es nur verständlich, dass diese Erfahrungen die Bereitschaft, mit anderen zu kooperieren, spürbar beeinflussen. 378 2. Reinhard Wolf Respekt, Missachtung und internationale Zusammenarbeit 2.1 Negative Folgen von Missachtung Die offenkundige Verweigerung von Respekt steht einer kooperativen Beziehung fast immer im Wege. Besonders augenfällig ist dies bei der Missachtung von Rechten, die man für sich beansprucht. Viele sozialpsychologische Untersuchungen haben einen engen Zusammenhang zwischen solchen Missachtungserfahrungen und der Wut und aggressiven Gegenwehr der Betroffenen bestätigt.3 Entsprechende Reaktionen dienen dabei nicht allein dazu, impulsiv den sprichwörtlichen „Dampf“ abzulassen, sie können darüber hinaus auch noch die rational intendierte Konsequenz haben, den eigenen Status wiederherzustellen oder den Beleidiger gleichsam zu erziehen.4 Oft erscheint der offene Kampf sogar als die einzige Option, um den Respekt zu erlangen, auf den man Anspruch zu haben glaubt. Selbst wo die missachtete Seite – aus welchen Gründen auch immer – auf eine Vergeltungsaktion verzichtet, wird sie in der Folge jedoch kaum eine kooperative Haltung einnehmen. Schließlich hat sie kein originäres Interesse daran, mit „business as usual“ unter Beweis zu stellen, dass sie ihre Missachtung „einfach schluckt“. In diesem Fall würde sie implizit bestätigen, dass sie tatsächlich die Art von Akteur ist, „mit der man so etwas machen kann“. Ebenso wenig kann ihr daran gelegen sein, das Wohlergehen des Beleidigers (und indirekt damit vielleicht auch sein soziales Ansehen) zu erhöhen, indem sie mit ihm kooperiert. Die damit verbundene Aufwertung würde schließlich nur den sozialen Stellenwert seiner öffentlichen Gesten und damit auch die Bedeutung der durch ihn erfahrenen Missachtung verstärken. Kooperation wird nach einer Missachtungserfahrung also nur dann fortgesetzt, wenn gewichtige materielle Gründe dafür sprechen. Dass solche individuellen Reaktionsweisen grundsätzlich auch auf die Beziehungen zwischen Gruppen, zumal über Grenzen hinweg, übertragen werden können, steht außer Frage. Einschränkungen in dieser Hinsicht ergeben sich allenfalls dann, (a) wenn die Missachtung seitens der Fremdgruppe überhaupt nicht wahrgenommen wird, (b) wenn sie innerhalb der Eigengruppe ganz unterschiedlich interpretiert wird, (c) wenn man der missachtenden Seite Unkenntnis der aktuell verletzten Gruppennorm unterstellen kann oder (d) wenn die Missachtung allgemein für unwichtig gehalten wird, weil die missachtende Fremdgruppe völlig unbedeutend 3 4 Miller, Dale T.: Disrespect and the Experience of Injustice, in: Annual Review of Psychology 52/2001, S.527-553, hier S.532f., 536. Ebd., S.540f.; vgl. Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt a.M. 1994, S.263. Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen 379 erscheint. Im Normalfall reagieren missachtete Gruppen aber ganz ähnlich wie respektlos behandelte Individuen – einmal abgesehen von der intervenierenden Wirkung gruppeninterner Diskurse und Entscheidungsprozesse.5 Dies gilt auch für grenzüberschreitende Zusammenhänge.6 Ein Mangel an Respekt kann sich aber auch dort negativ bemerkbar machen, wo die geringe Achtung des potenziellen Partners lediglich vermutet wird oder einfach nur möglich erscheint, weil sichtbare Anzeichen einer respektvollen Einstellung fehlen. Solche Konstellationen stehen oft einer pragmatischen Zusammenarbeit im Wege. Je größeren Wert der verunsicherte Akteur auf den Respekt seines Partners legt, umso schwerer wird es ihm dann fallen, sich ganz auf das zu bearbeitende Kooperationsproblem zu konzentrieren. Vielmehr wird er das Verhalten des Partners immer auch im Hinblick darauf beobachten, was es über seine eigene Bewertung, seinen Status in den Augen des Anderen impliziert. Aktivitäten des Anderen werden dadurch in einer Weise symbolisch „aufgeladen“, die eine rein auf den Nutzen orientierte Zusammenarbeit verkompliziert. Beispielsweise werden dann Gegenvorschläge des Partners nicht mehr ohne weiteres als Ideen betrachtet, die nur den gemeinsamen Nutzen erhöhen sollen, sondern vielleicht auch als Belege für eine angebliche Geringschätzung der eigenen Kompetenz oder als Versuch, mit der Durchsetzung des Alternativvorschlags den eigenen Vorrang deutlich zu machen. Infolgedessen wächst dann die Neigung, „aus Prinzip“ auf der eigenen Position zu beharren, um dadurch die eigene Bedeutung und den selbst zugeschriebenen Status zu unterstreichen. Im Extremfall kann dies vorübergehend zu einer kompletten Verweigerung von Kooperation führen, wenn man nämlich glaubt, nur so deutlich machen zu können, wie sehr der Andere auf einen angewiesen ist.7 2.2 Wechselseitiger Respekt als Ursache von Kooperation Ist der gegenseitige Respekt hingegen offenkundig, dann kann sich dies nur günstig auf die Zusammenarbeit auswirken. Hierfür sprechen zahlreiche sozialpsychologische Untersuchungen, wonach Individuen, die sich von ihrer Gruppe respektiert fühlen, zu überdurchschnittlichen und freiwilligen Leistungen zugunsten der Gruppe bereit sind. Wertschätzung der eigenen Arbeit und ausreichendes Gehör innerhalb der Gruppe (sog. voice 5 6 7 Honneth: Kampf um Anerkennung. Lindner, Evelin: Making Enemies. Humiliation and International Conflict, Westport 2006; Scheff, Thomas J.: Bloody Revenge. Emotions, Nationalism and War, Lincoln 2000; Wolf, Reinhard: Respekt. Ein unterschätzter Faktor in den Internationalen Beziehungen, in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen 2/2008, S.5-42. Kelley, Judith: Strategic non-cooperation as soft balancing. Why Iraq was not just about Iraq, in: International Politics 2/2005, S.153-173. 380 Reinhard Wolf opportunities) führen zu einer höheren Selbsteinstufung des gruppeninternen Status, damit zu mehr individueller Wertschätzung für die Gruppe und entsprechend auch zu einem stärkeren Interesse an deren Wohlergehen und Erfolg.8 Größere Identifikation mit der Gruppe fördert so eine kooperative Einstellung. Solche psychologischen Forschungsergebnisse können natürlich nicht ohne weiteres auf grenzüberschreitende Interaktion zwischen kollektiven Akteuren übertragen werden. Letztlich können analoge Kausalbeziehungen in der internationalen Politik nur durch empirische Forschung bestätigt werden. Immerhin lassen sich plausible Hinweise dafür anführen, dass gegenseitiger Respekt die bekanntesten Hindernisse grenzüberschreitender Zusammenarbeit abschwächen kann.9 An erster Stelle ist hier das Vertrauensproblem zu nennen, das durch die gezeigte Achtung und Wertschätzung verringert wird. Umfassender Respekt schließt ja die Beachtung und Berücksichtigung fremder Bedeutung, Bedürfnisse, Vorzüge und Rechte (inkl. Vorrechte, die sich aus einem besonderen Status ergeben) ein. Gerade die bisherige Respektierung der Rechte eines anderen internationalen Akteurs lässt eher die Vermutung zu, dass das Gegenüber auch künftig Absprachen und sonstige Verpflichtungen erfüllen wird. Hierfür spricht nicht zuletzt die damit verbundene Internalisierung von Normen in bürokratische Prozesse und kollektive Selbstbilder. Die Beachtung fremder Bedürfnisse macht eine leichtfertige Verletzung der Absprachen unwahrscheinlicher, weil man sich dann offensichtlich besser darüber im Klaren ist, was für den Kooperationspartner auf dem Spiel steht. Deshalb wird man von unkooperativem Eigenverhalten eher negative Rückwirkungen erwarten. Mindestens ebenso wichtig ist schließlich die offensichtliche Anerkennung fremder Bedeutung und Vorzüge. Wer sie zum Ausdruck bringt, gibt damit zu erkennen, dass er das positive Selbstbild des respektierten Akteurs teilt, ihn also ähnlich wertschätzt wie dieser sich selbst. Diese Wertschätzung hat zweierlei Konsequenzen für die Regeleinhaltung: Zum einen legt man gemeinhin Wert auf eine positive Beurteilung durch diejenigen, die man selbst schätzt, und identifiziert sich eher mit ihnen. Von daher wird man sie auch seltener hintergehen als Akteure, die einem gleichgültig sind. Zum anderen geht man ceteris paribus davon aus, dass der besonders geschätzte Akteur auch bei anderen in hohem Ansehen steht. In diesem Fall fördert die kooperative Verbindung mit ihm auch das eigene Ansehen in den Augen Dritter. Auch dieser Effekt würde die Kosten einer Regelverletzung erhöhen. 8 9 Tyler, Tom R./Blader, Steven, L.: Cooperation in Groups. Procedural Justice, Social Identity, and Behavioral Engagement, Philadelphia 2000, S.194-197. Ausführlicher dazu Wolf, Reinhard: Respect and International Relations: State Motives, Social Mechanisms and Hypotheses. Paper presented at the 49th Annual Convention of the International Studies Association, San Francisco, 26.-29.3.2008. Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen 381 In dem Maße, in dem das Vertrauensproblem gelöst ist, gehen auch zwei weitere Kooperationshindernisse zurück, die in der wissenschaftlichen Literatur große Beachtung gefunden haben: das Autarkiestreben und die Ablehnung disproportionaler Kooperationsgewinne, welche die Machtverhältnisse zugunsten des Partners verschieben könnten. Wer seinem Partner wirklich vertraut, befürchtet nicht, dass dieser Lieferabhängigkeiten oder Machtungleichgewichte absprachewidrig ausnutzen könnte. Verteilungsfragen sollten bei Partnern, die sich gegenseitig respektieren, auch deshalb eine geringere Rolle spielen, weil diese dann die Verteilung der Kooperationsgewinne nicht länger als wichtigen Indikator für ihren relativen Status ansehen: Bekanntlich setzen sich viele Gruppen für ihre materiellen Interessen deshalb so nachdrücklich ein, weil sie deren Durchsetzung auch als erfolgreichen „Test“ für ihre soziale Anerkennung verstehen.10 Wo sich die Interaktionspartner gegenseitig achten, entfällt damit ein Motiv für hartes Verhandeln. Sie können sich daher eher auf die materielle Verteilungsdimension konzentrieren. Möglicherweise erleichtert auch in diesem Bereich der gegenseitige Respekt eine Einigung, weil die reziproke Anerkennung des jeweiligen Status implizit schon einen akzeptablen „Verteilungsschlüssel“ vorgibt. Schließlich kann wechselseitiger Respekt auch die Präferenzbildung in einer Weise beeinflussen, welche die Chancen für Zusammenarbeit erhöht. Einerseits verbessert er, wie zuvor schon angedeutet, die Aussichten für eine verständigungsorientierte Suche nach adäquaten Problemdefinitionen und -lösungen.11 Ein argumentativer Gedankenaustausch, der von Statusunsicherheiten entlastet ist, ist also offener und deshalb besser geeignet, eine umfassende Analyse des Problemzusammenhangs und eine optimale Lösungsstrategie zu ermitteln. Ersteres sollte zumindest die Stabilität der Absprachen erhöhen, weil nach einer besonders gründlichen Erörterung des gemeinsamen Problems seltener neue, überraschende Aspekte auftauchen dürften, welche eine (einseitige) Aufkündigung der Übereinkunft attraktiv erscheinen lassen könnten. Effizientere Lösungsoptionen stärken unmittelbar das Interesse an einer kooperativen Lösung. Andererseits ist zu vermuten, dass der Respekt der Gegenseite auch das soziale Interesse an kooperativen Lösungen anregt. Wer uns in der Vergangenheit in hohem Maße respektiert hat, der wird unsere kooperative Haltung wahrscheinlich auch künftig angemessen würdigen. Insofern erhöhen sich die Aussichten darauf, durch Zusammenarbeit im Ansehen des Partners (weiter) zu steigen. 10 11 Ross, Marc Howard: Psychocultural Interpretations and Dramas: Identity Dynamics in Ethnic Conflict, in: Political Psychology 1/2001, S.157-178, hier S.163. Risse, Thomas: „Let’s Argue!“ – Communicative Action in World Politics, in: International Organization 1/2000, S.1-39. 382 Reinhard Wolf Erfahrungen von Respekt und Missachtung können also die Aussichten für Zusammenarbeit in vielfältiger Weise beeinflussen. Zweifellos spielen sie dabei oft eine geringere Rolle als materielle Interessen oder institutionelle Rahmenbedingungen. Manche der beschriebenen Zusammenhänge werden die Interaktion nicht dominieren, sondern eher verstärkende oder abschwächende Wirkungen entfalten. Wenn die Missachtungserlebnisse aber sehr ausgeprägt sind oder als regelrechte Demütigungen empfunden werden, wird Zusammenarbeit nahezu zwangsläufig scheitern. Die Beziehungen werden dann stärker von Konflikten geprägt sein. Genau diese eskalatorische Verhärtung ist bei den transatlantischen Kontroversen um die amerikanische Irak-Invasion klar zu beobachten. Eine Rückkehr zur Kooperation kann unter diesen Umständen nur gelingen, wenn beide Seiten (wieder) zum Ausdruck bringen, dass sie einander respektieren. 3. Kränkungen im transatlantischen Verhältnis nach 2001 Die dramatische Zuspitzung des transatlantischen Konflikts um die amerikanische Irak-Invasion ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass die USA auf der einen Seite und Frankreich und Deutschland auf der anderen ihre jeweiligen Statusansprüche wechselseitig missachtet haben. Die Bush-Administration hielt sich angesichts der überragenden Machtposition der USA für befugt, den Alliierten eine gemeinsame Irak-Politik vorzugeben. Hingegen glaubten die Regierungen in Berlin und Paris, eine nahezu gleichberechtigte Mitsprache oder doch wenigstens intensive und offene Konsultationen beanspruchen zu können. Als diese unvereinbaren Ansprüche keine gegenseitige Beachtung fanden, eskalierte die sachliche Auseinandersetzung zur offenen Konfrontation, die für das atlantische Bündnis – so der damalige amerikanische NATO-Botschafter Burns – in eine „near death experience“ mündete. Für viele Mitglieder der amerikanischen außenpolitischen Elite (und hier insbesondere für die Neokonservativen) hatten die neunziger Jahre gezeigt, dass die Europäer als weltpolitische Akteure nicht mehr richtig ernst genommen werden mussten. Nicht zuletzt die Kosovo-Intervention der NATO hatte in ihren Augen demonstriert, dass der militärische Beitrag der Europäer in keinem Verhältnis mehr zu ihren Mitspracheforderungen stand. Diesem militärischen Abstieg entsprach in der amerikanischen Wahrnehmung ein wachsender wirtschaftlicher Rückstand, der sich in den hohen Arbeitslosenzahlen und niedrigen Wachstumsraten niederschlug. Angesichts dieser Kräfteverschiebung zugunsten der USA sahen vor allem die Neokonservativen, aber auch die übrigen Verfechter amerikanischer Überlegenheit innerhalb der Bush-Administration immer weniger Veranlassung dazu, vor der Festlegung amerikanischer Positionen die Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen 383 Meinungen der europäischen Verbündeten einzuholen.12 Aufseiten der Regierungen in Paris und Berlin sah man jedoch keinen Grund, auf den tradierten Anspruch auf echte Konsultationen zu verzichten. Frankreich bestand als Atommacht und ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates traditionell auf einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Deutschland sah sich unter der Regierung Schröder/Fischer als eine Macht, die nach Jahrzehnten der Abhängigkeit und Unterordnung endlich auf dem Weg war, ein selbstbewusster Mitspieler auf der internationalen Bühne zu werden. Sowohl die Regierung Chirac als auch die Regierung Schröder glaubten sich umso mehr berechtigt, auf wirksame Mitsprache zu bestehen, als sie zunächst die amerikanisch geführte Kosovo-Intervention und dann nach dem 11. September die amerikanische AfghanistanIntervention militärisch unterstützt hatten – noch dazu trotz beachtlicher interner Widerstände. Zudem hatte die Regierung in Washington zumindest der Bundesregierung auch wiederholt ernsthafte Konsultationen zugesichert.13 In der deutschen Bundesregierung gewannen die maßgeblich Beteiligten indes bald den Eindruck, dass die Bush-Administration, ungeachtet der europäischen Solidaritätsbekundungen nach dem 11. September 2001, an die unilaterale Vorgehensweise aus den ersten Amtsmonaten wieder anknüpfte, die Berlin schon damals erheblich irritiert hatte. Bereits im Februar des Jahres 2002 fühlte sich Außenminister Fischer zu der Bemerkung genötigt, Alliierte seien Partner und keine Satelliten.14 Der Eindruck, man werde nicht als ernstzunehmender Verbündeter behandelt, verstärkte sich in Berlin, je weiter die amerikanischen Vorbereitungen für die Irak-Invasion voranschritten. Nachdem Vizepräsident Cheney in einer Rede vor amerikanischen Veteranenverbänden die Kriegsbereitschaft der amerikanischen Regierung deutlich gemacht hatte, beklagte sich Bundeskanzler Schröder offen über den politischen Stil der US-Regierung. In einem Interview mit der New York Times erklärte er, „it is just not good enough if I learn from the American press about a speech which clearly states: We are going to do it, no matter what the world or our allies think. That is no way 12 13 14 Szabo, Stephen F.: Parting Ways. The Crisis in German-American Relations, Washington 2004, S.58f., 129, 132. Szabo: Parting Ways, S.11-28, S.119, 134; Forsberg, Thomas: German Foreign Policy and the War on Iraq: Anti-Americanism, Pacifism or Emancipation?, in: Security Dialogue 2/2005, S.213-231, hier S.224-226. Kelley: Strategic non-cooperation, S.165; vgl. Szabo: Parting Ways, S.134. 384 Reinhard Wolf to treat others.”15 Angesichts dieses wenig rücksichtsvollen Vorgehens fühlte sich die Bundesregierung ihrerseits berechtigt, ohne Rücksprache mit Washington vollendete Tatsachen zu schaffen. Bundeskanzler Schröder nahm deshalb keine diplomatischen Rücksichten mehr auf die amerikanische Regierung, als er im Wahlkampf jegliche deutsche Beteiligung an einer amerikanischen Intervention unmissverständlich ausschloss. Diese unilaterale Vorgehensweise wurde wiederum in den USA als Missachtung des besonderen amerikanischen Status aufgefasst. Den Deutschen stand nach Ansicht der Bush-Administration keinerlei Führungsrolle zu – und auch keine offene Kritik an amerikanischen Bemühungen, einen gefährlichen Diktator unschädlich zu machen.16 Diese Erfahrung respektlosen Verhaltens erreichte in der Perspektive der Bush-Administration ihren dramatischen Höhepunkt mit dem umstrittenen Bush-Hitler-Vergleich der deutschen Justizministerin Herta DäublerGmelin. In der Folgezeit ließ vor allen Dingen US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld die deutsche Regierung spüren, dass sie in den USA nicht mehr viel zählte. So nannte er Deutschland in einem Atemzug mit Libyen und Kuba als eines der Länder, die sich an der Irak-Intervention in keiner Weise beteiligen wollten, und verließ auf einer NATO-Tagung demonstrativ den Raum, als sein deutscher Amtskollege Struck („that person“, so Rumsfeld) seine Rede hielt.17 Die bilateralen Beziehungen – so übereinstimmend Rumsfeld und Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice – waren nach Däubler-Gmelins „outrageous and insulting“ Bemerkung (Regierungssprecher Ari Fleischer) und der nur halbherzigen Distanzierung Schröders „vergiftet“18. Die Differenzen zwischen Washington und Paris nahmen sogar noch dramatischere Formen an. Im Gegensatz zur damaligen Bundesregierung lehnte man aber in Paris eine militärische Beteiligung nicht sofort ab. Noch im Januar 2003 wies Staatspräsident Jacques Chirac die eigenen EUStreitkräfte an, sich für alle Eventualitäten bereit zu halten. Ferner wurden hochrangige Vertreter nach Washington entsandt, um die operativen Ein15 16 17 18 Zit. nach Gordon, Philip H./Shapiro, Jeremy: Allies at War. America, Europe, and the Crisis over Iraq, Washington DC 2004, S.100; vgl. auch Szabo: Parting Ways, S.25f. Ganz ähnlich äußerte sich Schröder in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit (Szabo: Parting Ways, S.23). Tatsächlich antwortete später ein enger Mitarbeiter des US-Vizepräsidenten auf die Frage, ob sein Chef auch die möglichen Auswirkungen der Rede in Deutschland bedacht habe: „Why should he care about the reaction in Germany?” (zit. nach Gordon/ Shapiro: Allies at War, S.160). Gordon/Shapiro: Allies at War, S.102; Pond, Elizabeth: Friendly Fire. The NearDeath of the Transatlantic Alliance, Washington DC 2004, S.22, 38, 59; Szabo: Parting Ways, S.6; Forsberg: German Foreign Policy, S.226. Szabo: Parting Ways, S.34, 39f. Gordon/Shapiro: Allies at War, S.103, 128; Pond: Friendly Fire, S.59f. Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen 385 zelheiten einer möglichen französischen Beteiligung zu koordinieren.19 Eine zentrale Voraussetzung dafür, dass französische Streitkräfte den amerikanischen Einsatz unterstützten, war jedoch ein angemessenes Mitspracherecht für Frankreich bei der Entscheidung über die Notwendigkeit einer Intervention. Diese Einflussmöglichkeit verweigerte Washington indes der Pariser Regierung.20 Aus französischer Sicht bedeutete dies nicht nur eine Missachtung der französischen Partnerschaftsansprüche, ja vielleicht sogar eine persönliche Respektlosigkeit gegenüber dem Präsidenten der Republik,21 sondern es implizierte auch eine eklatante Entwertung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, in dem Frankreich als eine der fünf Vetomächte nach wie vor den Status einer erstrangigen Macht demonstrativ wahrnehmen konnte. Frankreichs Versuch, den damit drohenden Prestigeverlust durch die Führung der europäischen Opposition gegen die USA wettzumachen, endete ebenso mit einer diplomatischen Niederlage. Die Solidaritätsadressen, welche die Mehrzahl der europäischen Staaten zunächst im sogenannten „Brief der Acht“ und dann im „Brief der Zehn„ an die Bush-Administration richteten, machten überdeutlich, dass Paris keineswegs im Namen Europas sprach, wenn es Front gegen den US-Feldzug machte. Besonders pikant war dabei der Umstand, dass zumindest der „Brief der Zehn„ mit indirekter Unterstützung amerikanischer Regierungsstellen formuliert worden war. Dass Paris sich dadurch bloßgestellt, wenn nicht gar gedemütigt fühlte, zeigte die überaus emotionale Reaktion Präsident Chiracs, die in dem öffentlichen Vorwurf gipfelte, den EU-Beitrittskandidaten fehle es augenscheinlich an einer guten Kinderstube.22 Frankreichs Eliten reagier19 20 21 22 Rieker, Pernille: Power, Principles and Procedures. Reinterpreting French foreign policy towards the USA (2001-2003). Paper prepared for the 2005 annual convention of the International Studies Association, Hawaii, 1.-8.3.2005, S.5; Hymans, Jacques E. C.: A Sheep in Wolf’s Clothing: France’s Struggle with Preventive Force. Ridgway Center. Working Papers in Security Studies, WP 20068, http://www.ridgway.pitt.edu/docs/working_papers/PPMI/HymansWP.pdf, S.7, Stand: 20.12.2008; Gordon/Shapiro: Allies at War, S.142. Cogan, Charles G.: The Iraq crisis and France: heaven-sent opportunity or problem from hell?, in: French Politics, Culture and Society 3/2004, S.120-134, hier S.126. So berichtete der saudische Botschafter in den USA, Prinz Bandar, Anfang Februar 2003 in Washington, Chirac habe ihm in einem persönlichen Gespräch erklärt, es gäbe eine grundsätzliche Differenz zwischen Paris und Washington. Diese rühre zum einen daher, dass die USA ihn nicht respektvoll behandelten, und zum anderen davon, dass sie die Erkenntnisse ihrer Nachrichtendienste nicht an ihn weitergäben. George W. Bush reagierte auf diese Mitteilung mit der Äußerung, er sei bereit, Chirac mit Aufmerksamkeit und Respekt zu ersticken – offensichtlich mit wenig Erfolg. Siehe hierzu Woodward, Bob: Plan of Attack, New York 2004, S.312. Gaffney, John: Highly Emotional States: French-US Relations and the Iraq War, in: European Security 3/2004, S.247-272, hier S.254, 265; Gordon/Shapiro: Allies at War, S.132-134. 386 Reinhard Wolf ten mit offenkundigem Trotz und kehrten zurück zum traditionell gaullistischen Diskurs mit seiner Betonung französischer Selbstbehauptung gegenüber den arroganten Vereinigten Staaten.23 Zum überragenden Ziel Frankreichs und seines Präsidenten wurde es nunmehr, „den amerikanischen Unilateralismus einzuhegen“24. In den USA reagierte man auf den kompromisslosen Widerstand aus Paris mit „breathtaking anger and outrage“25. Aus amerikanischer Sicht ignorierte Paris nicht nur Amerikas Leistungen bei der Befreiung Frankreichs, bei der Eindämmung von Saddam Hussein und bei der Durchsetzung effizienterer Rüstungsinspektionen, sondern es missachtete auch das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis der USA nach dem 11. September 2001. Das französische Vorgehen respektierte aus amerikanischer Sicht somit weder den besonderen Status der Vereinigten Staaten noch ihre akuten Bedürfnisse. Die Krise nahm deshalb so scharfe Formen an, weil Frankreich glaubte, es könne den USA in diesen Fragen offen widersprechen, ohne die Grundlagen der Beziehung zu gefährden. In den USA waren Regierung und Bevölkerung jedoch dezidiert gegenteiliger Auffassung.26 Die Folge war ein nie dagewesener Ausbruch an anti-französischen Ressentiments und Anklagen.27 Der diplomatische Chefkorrespondent der New York Times verstieg sich sogar zu der These, Frankreich sei nunmehr der eigentliche Feind der USA. Dass gerade der französische Widerstand Washington besonders empörte, zeigte auch die Äußerung der amerikanischen Sicherheitsberaterin Rice, man werde Russland seinen Widerstand verzeihen, Deutschland künftig ignorieren, Frankreich aber bestrafen.28 Seitdem haben sich die Beziehungen zweifellos wieder deutlich verbessert. Nicht zuletzt der Europa-Besuch Bushs im Februar 2005 hat die Wogen demonstrativ geglättet, und auch der Kanzlerwechsel von Schröder zu Merkel hat in dieser Hinsicht positiv gewirkt. Dennoch wäre es verfehlt, in diesen wechselseitigen Kränkungen nur eine Episode ohne nachhaltige Bedeutung zu sehen. Vor allem auf europäischer Seite hat das Image der USA stark gelitten. Umfragen haben immer wieder gezeigt, dass die öffentliche Sympathie für Amerika in den letzten Jahren der Bush-Administration einen historischen Tiefststand erreicht hat. Die Vereinigten Staaten werden in den meisten europäischen Gesellschaften zunehmend als 23 24 25 26 27 28 Kempin, Ronja: Frankreichs neue Sicherheitspolitik. Von der Militär- zur Zivilmacht, Baden-Baden 2008, S.182-187. Ebd., S.185; ähnlich Cogan: The Iraq crisis, S.124. Gaffney: Highly Emotional States, S.256; vgl. auch Pond: Friendly Fire, S.70-72. Bozo, Frédéric/Guillaume Parmentier: France and the United States: Waiting for Regime Change, in: Survival 1/2007, S.181-198, hier S.192; Pond: Friendly Fire, S.22. Hymans: A Sheep in Wolf‘s Clothing, S.15; Gaffney: Highly Emotional States, S.249. Szabo: Parting Ways, S.132. Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen 387 eine Macht angesehen, die die Interessen anderer Staaten nicht beachtet. Dieser Eindruck hat das Vertrauen in die weltpolitische Vorgehensweise der USA nachhaltig geschwächt und den Ruf nach einem machtpolitischen Gegengewicht lauter werden lassen. Statt einer Stärkung der transatlantischen Beziehungen befürworten die Bürgerinnen und Bürger heute mehr europäische Eigenständigkeit.29 Eine engere und vertrauensvollere Kooperation wird nur dann wiederhergestellt werden können, wenn die gegenseitige Achtung erneut zur Selbstverständlichkeit wird. 4. Ausblick Ob die neue Obama-Administration hier einen nachhaltigen Wandel bewirken kann, ist derzeit noch nicht abzusehen. Optimistisch stimmen zweifellos die großen Sympathien, die dem neuen Präsidenten aus Europa entgegengebracht werden, sowie dessen erklärte Absicht, auf die oft arrogant wirkende Haltung der Bush-Administration eine respektvolle Politik der Partnerschaft folgen zu lassen. Die Entsendung von Vize-Präsident Biden zur Münchner Sicherheitskonferenz kann in dieser Hinsicht als ein wichtiges Signal gesehen werden. Wie wichtig solche Gesten sind, verdeutlicht nicht zuletzt die Aussage von Bundeskanzlerin Merkel, die künftige Zusammenarbeit sollte wieder von multilateralen Absprachen, gemeinsamen Anstrengungen und überhaupt davon geprägt sein, „dass man einander zuhört“30. Indem die neue amerikanische Regierung solche Erwartungen berücksichtigt, zeigt sie einmal mehr, dass sie aus Fehlern und Versäumnissen der Bush-Administration die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat. In vielen Politikfeldern können sich so die Chancen für konstruktive Dialoge und wirksame Zusammenarbeit deutlich verbessern. Allerdings sind Amerikas mögliche Partner – und allen voran die Europäer – gut beraten, wenn sie von Obamas neuer Diplomatie keine Wunderdinge erwarten. Nicht nur werden viele inhaltliche Differenzen fortbestehen, etwa in der Klima-, Handels- und Nahost-Politik. Zudem muss der neue Präsident gerade bei diesen Themen auch besondere Rücksichten auf den Kongress nehmen. Wichtig ist aber auch die Einsicht, dass einer „Politik des Respekts“ natürliche Grenzen gesetzt sind, insbesondere, wenn sie auf den intensiven Dialog mit dem Gegenüber setzt. Das Bezeugen von 29 30 Pew Global Attitudes Project: American Character Gets Mixed Reviews: US Image up Slightly, but still Negative, Washington DC 2005, S.12, 23, 30; German Marshall Fund of the United States/Compagnia di San Paolo (Hrsg.): Transatlantic Trends 2005, Topline Data, S.6, 8-9, http://www.transatlantictrends.org/trends/index_archive.cfm?id=4#Breakdowns, Stand: 31.3.2009. Merkel zu Obama: „Mehr zuhören, mehr Zusammenarbeit“ – ExklusivInterview im ARD-Morgenmagazin zur Amtseinführung des US-Präsidenten, in: ARD-Morgenmagazin, 20.1.2009, http://www.presseportal.de/ pm/7899/1337860/wdr_westdeutscher_rundfunk/rss, Stand: 12.2.2009. 388 Reinhard Wolf Respekt kostet nicht nur Zeit und Aufmerksamkeit, es verschafft dem respektierten Akteur auch mehr Einfluss. Wer anderen mehr zuhört, ihre Rechte, Bedürfnisse und Standpunkte ernst nimmt, öffnet sich für ihre Argumente und wertet den Sprecher implizit auf. Selbst in den Situationen, in denen eine respektvolle Haltung nur erfolgreich vorgetäuscht wird, entsteht bei der anderen Seite zumindest der Eindruck, sie genieße einen höheren Einfluss. Hieraus können vor allem zwei Probleme erwachsen: Zum einen verlangt ein respektvoller Akteur – bewusst oder unbewusst – oft auch eine Gegenleistung für den Einflussgewinn, den er der anderen Seite ermöglicht. So hat auch Obama keinen Zweifel daran gelassen, dass er für die Wiederbelebung der transatlantischen Partnerschaft von den Verbündeten mehr Engagement in Afghanistan erwartet – und das wird kaum die einzige Hoffnung sein, die er und sein außenpolitisches Team mit einer respektvolleren Behandlung der Europäer verbinden. Wenn solche Erwartungen zunehmend enttäuscht werden sollten, sind Frustrationen beiderseits des Atlantiks vorprogrammiert. Neuer Respekt für Europa, der nicht durch größere Beiträge verdient erscheint, wird kaum lange vorhalten. Zum anderen kann ein respektvoller Umgang auch dazu führen, dass Statusunterschiede unbeabsichtigt verwischt werden. Schließlich hatten die Regierungen in Berlin und Paris schon gegenüber der Bush-Administration immer wieder „Partnerschaften auf gleicher Augenhöhe“ eingefordert. Je mehr Respekt die neue Regierung ihnen jetzt bezeugt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Amerikas Partner sich zunehmend (wieder) als ebenbürtige Akteure sehen. Eventuell ist man in Washington aber keineswegs dazu bereit, solche Statusverschiebungen zu akzeptieren. Die mögliche Folge wären Missverständnisse und vielleicht sogar neue Konflikte. Zur Vermeidung solcher Risiken sollten die Europäer nicht einfach darauf bauen, dass mit dem neuen Ton der Obama-Administration die transatlantischen Beziehungen wieder so harmonisch und vertraulich werden wie in den ersten beiden Jahren der Regierung Clinton (als diese sich auch noch auf einen demokratisch dominierten Kongress stützen konnte). Vielmehr sollten sie möglichst rasch mit den amerikanischen Verbündeten klären, welche Erwartungen beide Seiten mit einer respektvolleren Partnerschaft verbinden. Insbesondere sollten sie ein Einvernehmen darüber anstreben, wann und in welcher Form Konsultationen durchzuführen sind und welches Entgegenkommen Washington für ein effektives Mitspracherecht der Europäer fordern kann. Nur wenn diese grundlegenden Erwartungen offen besprochen werden, können beide Seiten rechtzeitig lernen, was ihr Gegenüber unter angemessener Beachtung versteht. Entscheidend ist deshalb, dass Amerikaner und Europäer das offene Gespräch über ihre Selbst- und Fremdbilder und die daraus resultierenden Statusan- Respekt und Missachtung in den transatlantischen Beziehungen 389 sprüche und Verhaltenserwartungen führen. Dadurch können nicht nur unnötige Missverständnisse vermieden werden, die neuerliche Kränkungen verursachen würden, sondern die Institutionalisierung von Konsultationsregeln wäre darüber hinaus auch ein deutliches Signal, dass man sich auf beiden Seiten des Atlantiks wieder als wertvoller Partner sieht – und dies ist unerlässlich, wenn die transatlantische Solidarität so weit wiederbelebt werden soll, dass offen-konstruktiver Dialog, faire Lastenteilung und konsequenter Einsatz für gemeinsame Ziele nicht länger die Ausnahmen bleiben. Asymmetrische Interdependenz: Warum brauchen Europa und die USA einander? Beate Neuss 1. Das Ende des „unipolar moment“1 „America and Europeans still look to one another before they look to anyone else. Our partnership has benefited us all.”2 Vizepräsident Joe Biden, erst wenige Tage im Amt, nutzte die Münchener Sicherheitskonferenz Anfang Februar 2009, um seine Vorstellung über die transatlantische Kooperation zu propagieren. Sagte er mit seiner Charme-Offensive nicht deutlich: Liebe Europäer: Ja, wir sind voneinander abhängig! Ja, wir brauchen einander noch! Ohne Kooperation geht es nicht! Und: Wir brauchen den Rat und die Unterstützung der Europäer!? Die amerikanische Antwort auf die Frage der Symmetrie oder Asymmetrie des Verhältnisses lässt sich diplomatisch verpackt aus der Gesamtrede herauslesen. Sie lautete: „We’re going to attempt to recapture the totality of America’s strength.” Der Anspruch der Vereinigten Staaten, Weltordnungsmacht und damit Erster unter Gleichen zu sein, ist geblieben. Der in Europa so dringend gewünschte Dialog zwischen der EU und den USA „auf Augenhöhe” wird nicht allein auf