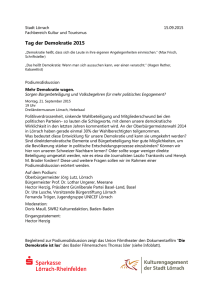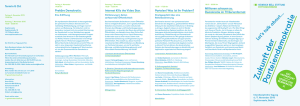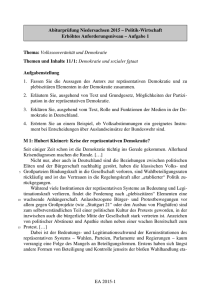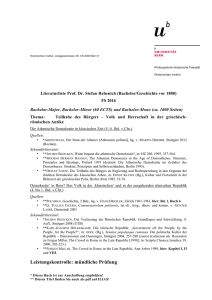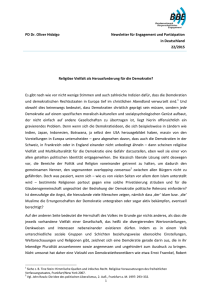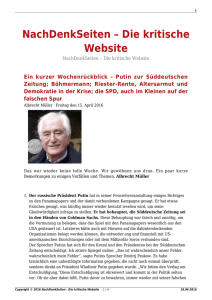10. Politische Parteien und direkte Demokratie in der Schweiz, den
Werbung
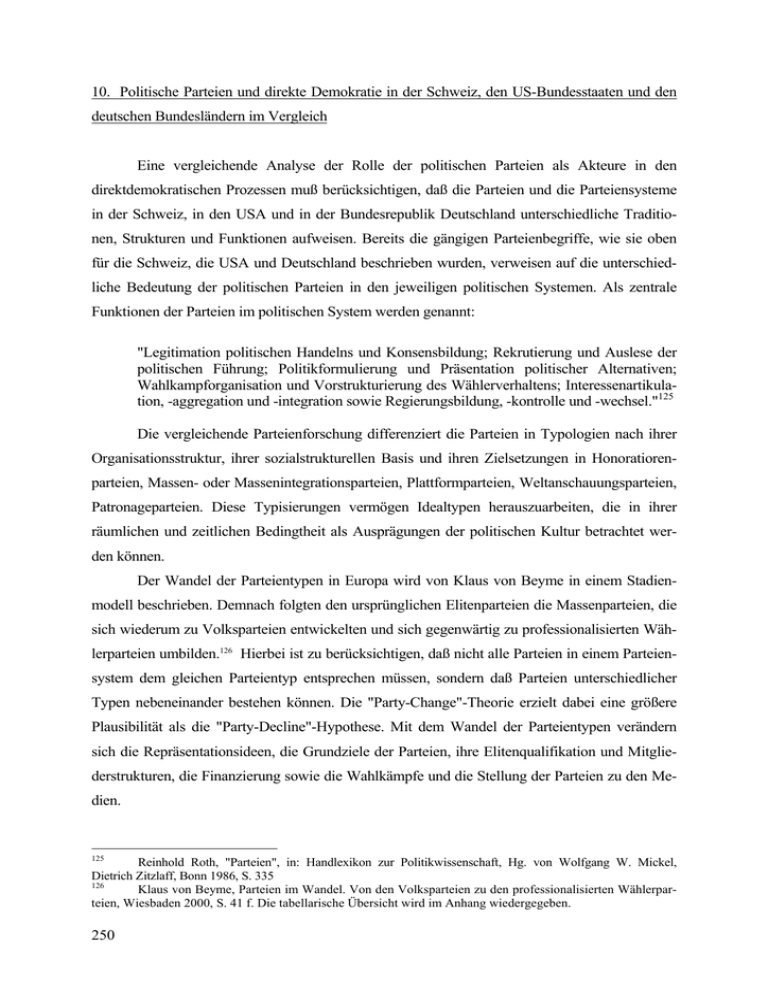
10. Politische Parteien und direkte Demokratie in der Schweiz, den US-Bundesstaaten und den deutschen Bundesländern im Vergleich Eine vergleichende Analyse der Rolle der politischen Parteien als Akteure in den direktdemokratischen Prozessen muß berücksichtigen, daß die Parteien und die Parteiensysteme in der Schweiz, in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland unterschiedliche Traditionen, Strukturen und Funktionen aufweisen. Bereits die gängigen Parteienbegriffe, wie sie oben für die Schweiz, die USA und Deutschland beschrieben wurden, verweisen auf die unterschiedliche Bedeutung der politischen Parteien in den jeweiligen politischen Systemen. Als zentrale Funktionen der Parteien im politischen System werden genannt: "Legitimation politischen Handelns und Konsensbildung; Rekrutierung und Auslese der politischen Führung; Politikformulierung und Präsentation politischer Alternativen; Wahlkampforganisation und Vorstrukturierung des Wählerverhaltens; Interessenartikulation, -aggregation und -integration sowie Regierungsbildung, -kontrolle und -wechsel."125 Die vergleichende Parteienforschung differenziert die Parteien in Typologien nach ihrer Organisationsstruktur, ihrer sozialstrukturellen Basis und ihren Zielsetzungen in Honoratiorenparteien, Massen- oder Massenintegrationsparteien, Plattformparteien, Weltanschauungsparteien, Patronageparteien. Diese Typisierungen vermögen Idealtypen herauszuarbeiten, die in ihrer räumlichen und zeitlichen Bedingtheit als Ausprägungen der politischen Kultur betrachtet werden können. Der Wandel der Parteientypen in Europa wird von Klaus von Beyme in einem Stadienmodell beschrieben. Demnach folgten den ursprünglichen Elitenparteien die Massenparteien, die sich wiederum zu Volksparteien entwickelten und sich gegenwärtig zu professionalisierten Wählerparteien umbilden.126 Hierbei ist zu berücksichtigen, daß nicht alle Parteien in einem Parteiensystem dem gleichen Parteientyp entsprechen müssen, sondern daß Parteien unterschiedlicher Typen nebeneinander bestehen können. Die "Party-Change"-Theorie erzielt dabei eine größere Plausibilität als die "Party-Decline"-Hypothese. Mit dem Wandel der Parteientypen verändern sich die Repräsentationsideen, die Grundziele der Parteien, ihre Elitenqualifikation und Mitgliederstrukturen, die Finanzierung sowie die Wahlkämpfe und die Stellung der Parteien zu den Medien. 125 Reinhold Roth, "Parteien", in: Handlexikon zur Politikwissenschaft, Hg. von Wolfgang W. Mickel, Dietrich Zitzlaff, Bonn 1986, S. 335 126 Klaus von Beyme, Parteien im Wandel. Von den Volksparteien zu den professionalisierten Wählerparteien, Wiesbaden 2000, S. 41 f. Die tabellarische Übersicht wird im Anhang wiedergegeben. 250 Wenn in der Bundesrepublik Deutschland die Rolle der Parteien sehr stark ausgeprägt, in den Vereinigten Staaten dagegen relativ gering ist, so wäre hinsichtlich der Schweiz von einem mittleren Grad der Bedeutung von Parteien im politischen System zu sprechen. Die Differenzen in den drei Parteienlandschaften sind hier umrissen worden. Die komparative Analyse der Schweiz, der US-Bundesstaaten und Deutschlands zeigt, daß die verschiedenartige Stellung der politischen Parteien in den Regierungssystemen und die differierenden direktdemokratischen Verfahren unterschiedliche Wirkungsweisen der Parteien in den direktdemokratischen Entscheidungsprozessen erzeugen. Im föderalistisch strukturierten Vielparteiensystem in der Schweiz sind die kantonalen Parteiaktivitäten, zum Beispiel die Parolenausgabe für Volksabstimmungen relevant; die Parteien haben in den direktdemokratischen Verfahren eine beträchtliche Bedeutung. In den US-Bundesstaaten mit ihrem Zweiparteiensystem und präsidentieller Regierung zeigt sich ein individualisierter Politikbetrieb, in dem sich einzelne Politiker in den Initiativprozessen engagieren. In den Ländern der Bundesrepublik mit ihrem parlamentarischen Regierungs- und Mehrparteiensystem haben die Parteien bei Volksbegehren und Volksentscheiden einen sehr starken Einfluß. In den US-Bundesstaaten ist die Position der Parteien im Gesamtsystem stark begrenzt. Auch das direktdemokratische Verfahren, etwa der kalifornischen Volksinitiative, erfolgt ohne wesentliche Einflußnahme der Parteien. Zwar werden Initiativen oder Referenden von Parteimitgliedern, auch zu Wahlkampfzwecken, lanciert, aber die Form der direkten Initiative schaltet die parlamentarische Mitwirkung aus; die zustande gekommene Initiative wird direkt dem Volk vorgelegt, ohne daß die Repräsentativorgane in den Entscheidungsprozeß institutionell eingreifen könnten. Die amerikanischen Parteien sind besonders ausgerichtet auf die Personalrekrutierung und weniger beschäftigt mit der Beratung und Lösung von Sachproblemen; Sachfragen werden von den Parteien dem Parlament, der Regierung, den Gerichten, der Verwaltung und dem Volk überlassen. In den US-Bundesstaaten ist ferner der Einfluß der campaign industry und der Medien im Abstimmungskampf am stärksten ausgeprägt, so daß die politischen Parteien keine spezielle Aufgabe in der Meinungsbildung wahrnehmen, wenn sie nicht an bestimmten Vorlagen selbst interessiert sind. Fraglich ist, ob der Ausbau der direktdemokratischen Instrumente und ihr vielfacher Gebrauch, besonders in Kalifornien, insgesamt zur Schwächung der Parteien geführt oder beigetragen haben. Die Parteien spezialisieren sich auf die Auswahl der politischen Repräsentanten, bestreiten umfangreiche Wahlkämpfe für zahlreiche Wahlämter und versorgen ihr Klientel mit politischen Beamtenstellen. Nicht mehr und nicht weniger wird von ihnen erwartet. 251 Dabei können Auftritte bei Initiativen und Referenden für Gouverneure, Senatoren und Abgeordnete für ihre Wahlkämpfe nützlich sein. In der Schweiz haben die Parteien bei der Sachdiskussion, Meinungsbildung und Mobilisierung der Stimmberechtigten eine wichtige Funktion. Sie geben regelmäßig Abstimmungsempfehlungen heraus und engagieren sich im Abstimmungskampf nach ihrer jeweiligen Interessenlage unterschiedlich stark. Die kleinen Parteien können sich mit direktdemokratischen Mitteln öffentliche Wirkung und gelegentlich indirekte oder sogar direkte Erfolge verschaffen, vor allem wenn die Bundesratsparteien bestimmte Themen vernachlässigen. Die Freisinnig-Demokratische Partei FDP erlitt im Laufe ihrer Geschichte aufgrund der Volksrechte Einbußen in ihrer Machtposition, da sie die starken, referendumsfähigen Parteien schrittweise an der Regierungsbildung beteiligen mußte. Von der alleinregierenden Partei wurde sie zu einer von vier Regierungsparteien; aber sie ist seit ihrem Bestehen in der Regierungsposition geblieben. Die Kooptation der erstarkten referendumsfähigen Parteien in die Konkordanzregierung festigte schließlich sogar die Position der FDP als stabile Regierungspartei. Die Parteien sind im Laufe des verfassungsgeschichtlichen Ausbaus der Volksrechte mit den direktdemokratischen Einrichtungen gewachsen. Daraus kann gefolgert werden, daß die direkte Demokratie in der Schweiz den Wandel der Parteien und ihre Anpassungsfähigkeit an den gesellschaftlichen Prozeß gefördert hat. Unter den Bundesratsparteien operiert die Sozialdemokratische Partei besonders häufig mit Volksinitiativen und übernimmt dabei eine Oppositionsrolle. Die SPS nimmt damit Einfluß auf die Politik von Bundesrat und Bundesversammlung; ferner verfolgt sie die Interessen ihrer Mitgliedschaft, Anhängerschaft und nahestehender Verbände. Diese ambivalente Haltung zwischen Regierung und Opposition zeigte im vergangenen Jahrzehnt immer stärker die Schweizerische Volkspartei mit eigenen fakultativen Referenden und Volksinitiativen. Das direktdemokratische Engagement der SVP mag zu ihren Wahlerfolgen beigetragen haben; wichtiger scheint dafür aber ihre profilierte programmatische Positionierung und vor allem ihre organisatorische Entwicklung gewesen zu sein. "Neue negative Massstäbe des Einsatzes von Geld und Polemik in der direkten Demokratie hat wiederum die zürcherische SVP mit ihrer plutokratischen Führung gesetzt. Das erste grosse Beispiel einer üblen Kampagne war der Kampf gegen den UNO-Beitritt im Jahre 1986. Im Rausch des Erfolges haben SVP und die 'Auns' als ihre reaktionäre Annexanstalt populistische Kampagnen immer wieder auf die Spitze getrieben."127 127 252 Leonhard Neidhart, Die politische Schweiz. Fundamente und Institutionen, Zürich 2002, S. 395 Neidhart vermerkt aber auch, daß Erfolge bei Wahlen und Volksabstimmungen nicht zusammenfallen. In den neunziger Jahren hätten SVP und SPS zahlreiche Abstimmungen verloren, aber in den Wahlen gewonnen; die CVP habe die meisten Volksabstimmungen gewonnen, aber in den Wahlen verloren.128 Dementsprechend formuliert Linder auf der theoretischen Ebene die These des "Trade-Offs" (Tauschgeschäft) zwischen Abstimmungs- und Wahldemokratie. "Sie behauptet, es sei nicht möglich, in einem politischen System gleichzeitig die Wahlund Abstimmungsdemokratie zu maximieren. Die Ausgestaltung eines Systems für einen maximalen Einfluss der Bürgerschaft durch Wahlen zwingt zur Begrenzung ihres Einflusses durch Abstimmungen und umgekehrt."129 In der verfassungsgeschichtlichen Entwicklung hat sich der Gesetzgebungsprozeß mit der Einführung des Vernehmlassungsverfahrens gewandelt; die Parteien mußten dabei auch Einfluß an die Interessengruppen und Verbände abgeben. Doch ist dieser Wandel nicht ausschließlich den Volksrechten anzulasten. Zu bedenken ist dabei auch, daß durch das Milizsystem zahlreiche Parlamentsmandate über die Parteien an Interessenvertreter vergeben werden. Die Zuständigkeit der schweizerischen Parteien für die Lösung von Sachfragen in der parlamentarischen Gesetzgebung ist durch Volksinitiativen und Gesetzesreferenden beschränkt, aber nicht aufgehoben worden. Ihre Funktion wird in Richtung auf die Personalrekrutierung hin transformiert. Der Einfluß der Parteien auf die Abstimmungsergebnisse mag geringer sein als die Macht der Interessengruppen, Medien und Verbände; aber unbestreitbar verfügen die Parteien über beträchtliche Einflußchancen auf den Gesetzgebungsprozeß sowohl im vorparlamentarischen, wie im parlamentarischen und im direktdemokratischen Verfahren. Auch die schweizerische Politik kennt Politikverdrossenheit, Parteienverdrossenheit, politische Affären und Skandale sowie zusätzlich die Phänomene der "Abstimmungsverdrossenheit" und der Stimmabstinenz. Demnach kann vom Ausbau der direkten Demokratie kein Abbau der Politikverdrossenheit erhofft werden. Der Zusammenhang ist andersherum positiv: Die Institutionen der direkten Demokratie als Form der bürgerschaftlichen Selbstregierung bilden einen Kern des politischen Selbstverständnisses der Schweiz und ihrer Bürgerinnen und Bürger. Direktdemokratische Reformen werden laufend diskutiert, aber keine Partei würde die direkte Demokratie insgesamt zur Disposition stellen. 128 129 Neidhart, Die politische Schweiz, a.a.O., S. 388 Wolf Linder, Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Bern 1999, S. 315 253 Die Frage, wie sich die direkte Demokratie in der Schweiz im Zuge der fortschreitenden Globalisierung und Europäisierung entwickeln wird, kann hier nur angedeutet werden. Linder bezeichnet die haldirekte, föderalistische Demokratie als "eurokompatibel".130 Die direkte Demokratie könne sich im Falle eines Beitritts der Schweiz zur Europäischen Union - mit Referenden über die Anpassung des schweizerischen an das europäische Recht - möglicherweise besser behaupten als bei einem Alleingang der Schweiz außerhalb der Europäischen Union, welche die Schweiz übergehen oder zu unerwünschten Verträgen zwingen könne. Von den hier zu betrachtenden drei politischen Systemen verfügen die politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland vergleichsweise über die stärkste Machtfülle. Die Parteien stehen teilweise, insbesondere die Parteiführungen, den direktdemokratischen Beteiligungsund Entscheidungsverfahren reserviert gegenüber, weil sie eine Beschränkung ihres parlamentarischen Entscheidungsmonopols befürchten. Diese Ablehnung direktdemokratischer Instrumente geht über die Parteigrenzen hinweg. Von den Ländern und Kommunen ausgehend wird die direkte Demokratie aber auch als ein Mittel der Modernisierung des politischen Systems aufgenommen. Die rot-grüne Regierung hat als erste Bundesregierung die Einführung der direkten Demokratie auf Bundesebene in ihrem Koalitionsvertrag vorgesehen. Wenn sie auch mit der Vorlage eines betreffenden Entwurfs lange zögerte, konnte sie doch erstmals eine einfache Mehrheit im Bundestag erzielen. In den deutschen Bundesländern haben die politischen Parteien mit ihren Apparaten und Einflußsphären gerade in den Abstimmungskampagnen um Volksbegehren und Volksentscheide eine starke Position. Wegen der relativ hohen Unterschriftenhürden sind Volksbegehren ohne die massive Unterstützung von Parteien aussichtslos. In den Volksentscheiden ist die Parteienkonstellation im Abstimmungskampf mitentscheidend. Verfassungsreferenden, die aus parteiübergreifenden Parlamentsbeschlüssen hervorgehen, finden in der Abstimmung - mangels Konfrontation - die notwendigen Mehrheiten. Dagegen ist bei kontroversen Volksbegehren und Volksentscheiden das Gewicht der Parteien und der ihnen nahestehenden Verbände maßgeblich. Nur in ganz seltenen Fällen mußten Regierungsparteien in Volksentscheiden Niederlagen hinnehmen. Es ließe sich also argumentieren, daß die Parteien in der Bundesrepublik von Volksbegehren und Volksentscheiden insgesamt wenig zu befürchten haben. Die direktdemokratischen Instrumente mögen zwar ihr parlamentarisch-repräsentatives Gesetzgebungsmonopol begrenzen, in den direktdemokratischen Prozessen führt jedoch kein Weg an den Parteien vorbei. 130 254 Wolf Linder, Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Bern 1999, S. 387 Aus der Literatur ergeben sich zum Verhältnis der politischen Parteien zur direkten Demokratie unterschiedliche, teilweise gegensätzliche Befunde. Einerseits wird argumentiert, so von Gebhardt, die Funktion der Parteien würde durch direktdemokratische Entscheidungen beeinträchtigt. "Auch als komplementäres Element in einer repräsentativen Demokratie mindert das Referendum die Rolle der Parteien als zentrale Steuerungsinstanz der Politik."131 Andererseits wird argumentiert, den politischen Parteien entstünde durch den Ausbau der direkten Demokratie ein größeres Operationsfeld. "Vielmehr ist zu erwarten, daß solche Einrichtungen 'das Operationsfeld der politischen Parteien' aber auch das gutorganisierter finanzkräftiger Verbände oder Bürgerinitiativen, also partikularer Interessen, nur noch vergrößern." 132 Schließlich wird eine stabilisierende Wirkung auf die Parteien im Sinne von Kooperationsbereitschaft und Konsensbildung postuliert.133 Referenden wirkten "eher stabilisierend" auf die Parteien und steigerten "die Kooperationsbereitschaft zwischen Regierung und Opposition".134 Die Auswirkungen für die politischen Systeme werden wiederum positiv und negativ interpretiert. Das Aufbrechen der politischen Parteien könne das repräsentative System beschädigen; andererseits könnten versteinerte Systeme angeregt werden, sich neu zu ordnen. Volksabstimmungen werden als Korrektive der repräsentativen Regierung angesehen, als "Mittel demokratischer Balancierung und Kontrolle der Parteienmacht". "Diese Kontroll-, Balance- und Vetofunktionen sollen die Bevölkerung in die Lage versetzen, die Politik politischer Parteien bei ihren Politikentscheidungen zu begrenzen und zu korrigieren."135 Die Korrekturfunktion von Volksabstimmungen im repräsentativen System ist eine seit über hundert Jahren immer wiederkehrende Argumentationsfigur.136 131 Jürgen Gebhardt, Direkt-demokratische Institutionen und repräsentative Demokratie im Verfassungsstaat, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 23, 1991, S. 27 132 Bugiel, a.a.O., S. 473. Bugiel schlägt vor, die Defizite der repräsentativen Demokratie durch "systemkonforme" Mittel statt durch die "systemfremden" der direkten Demokratie zu verringern. Mögliche Maßnahmen wären veränderbare Wahllisten, Kandidatenaufstellung durch Briefwahl der Parteimitglieder, Stärkung der unabhängigen Stellung des Abgeordneten gegenüber Partei und Fraktion, Rückbesinnung auf das Ethos der Repräsentation durch mehr Selbstkritik und Selbstkontrolle. S. 474 ff 133 Luthardt, a.a.O., 1992, S. 70 134 Albrecht Weber, Direkte Demokratie im Landesverfassungsrecht, in: Die öffentliche Verwaltung, 1985, S. 178 -185, S. 184 135 Luthardt, a.a.O., 1992, S. 86 136 Eugen Wachter, Volksbegehr und Volksentscheid nach bayerischem Verfassungsrecht unter Hinweis auf Initiative und Referendum der Schweizer Bundesrepublik und ihrer Kantone, Diss. Erlangen 1921, zitiert einen Aufsatz von Immanuel Hoffmann, Das Plebiszit als Korrektiv der Wahlen, Berlin 1884. 255 Die Bedingungen des Parteiwesens in der Schweiz vergleicht Neidhart mit der Bundesrepublik. "In der Bundesrepublik werden gesellschaftliche Problemlösungsverantwortlichkeiten in stärkerem Maße dem Staat und auch den Parteien zugeschrieben als das in der Schweiz der Fall ist. Eine nur annähernd gleich starke Konzentration des politischen Geschehens auf den Parteienwettbewerb mit all den daraus erwachsenden Einflußpotentialen, Konfliktintensitäten, Anerkennungs- und Verachtungsemotionen, wie das in der Bundesrepublik an der Tagesordnung ist, gibt es in der Schweiz nicht."137 So unterschiedlich die Kulturen und Strukturen sind, so verschieden lauten direktdemokratischen Reformvorschläge in der Schweiz und in Deutschland, die wiederum Neidhart dokumentiert: "Als Medium, in dem sich gesellschaftliche Spannungen, Ungleichheiten, Emotionen und Konflikte sowie Machtstrukturen widerspiegeln, sind sie ein funktionales Äquivalent für Prozesse, wie sie sich auch in der parteienstaatlichen Demokratie abspielen. Nur ist es eben oft so, dass man - wenn man über die Wirksamkeit der eigenen Instrumente enttäuscht ist - jene für besser hält oder idealisiert, die man nicht hat. Bekanntlich gibt es in der Bundesrepublik Deutschland eine Reihe von Wortmeldungen, die für einen Einbau direktdemokratischer Elemente eintreten, während es in der Schweiz umgekehrte Forderungen gibt. Die einen wollen die direkte Demokratie aus-, die anderen abbauen."138 Durch die Beteiligung und Souveränität der Bürger in den direktdemokratischen Verfahren der Schweiz erzielen gerade umstrittene politische Entscheidungen ein höheres Maß an Legitimität und durch die intensiven öffentlichen Sachdiskussionen eine stärkere Akzeptanz.139 So argumentiert Riklin: "Stärken der direkten Demokratie sind insbesondere die hohe Legitimations- und Durchsetzungskraft durch Volksabstimmung sanktionierter Entscheide sowie der ständige Lernprozeß der Stimmbürger."140 Die Partizipationschancen erhöhen die Integrationsleistung des politischen Systems und sie gewährleisten eine nachhaltige Rückbindung der Parteien und Repräsentanten an die Bedürfnisse und Erwartungen der Bürgerschaft. Daß das Referendum die Funktion eines "Sicherheitsventils" habe, wurde in der Schweiz schon 1876 thematisiert; es verhindere ein tiefes Mißtrauen zwischen dem Volk und seinen Repräsentanten.141 137 Neidhart, Das Parteiensystem der Schweiz, a.a.O., S. 198 f Neidhart, Grundlagen und Besonderheiten des schweizerischen Regierungssystems, in: Abromeit, Pommerehne, Staatstätigkeit in der Schweiz, Bern, Stuttgart, Wien 1992, S. 15 - 42, S. 30 139 Hans Peter Hertig, Volksabstimmungen, in: Handbuch Politisches System der Schweiz, Bd. 2, Bern, Stuttgart 1984, S. 247 - 277, S. 253 140 Alois Riklin, Die schweizerische Staatsidee, in: Zeitschrift für schweizerisches Recht, 101, N.F., 1982, S. 217 - 246, S. 230 141 Neidhart, Plebiszit, 1970, S. 71 138 256 Für die schweizerische Volksinitiative lehnt Sigg die Rede vom Ventil ab. "Dampf ablassen und nichts verändern - das war ihre Rolle. Ein Kult eben, zur Besänftigung der Gemüter." 142 Die Parteien sollten den Umgang mit der Volksinitiative pflegen; sie sei in den letzten Jahren wichtiger geworden, und häufiger konnten sich Anliegen von Volksinitiativen durchsetzen (Preisüberwachung, Rothenthurm, AKW-Moratorium). Die Parteien sollten eine politische Kultur der Volksrechte entwickeln. Der Verfassungsrechtler Schneider äußert über die Parteien und die Ventilfunktion der direkten Demokratie - und entspricht damit den unten folgenden Aussagen Fraenkels: "Je mehr hingegen die politischen Parteien in der Lage sind, elementare Bevölkerungsinteressen (auch partikularer Art) in konkrete Politik zu übertragen und durchzusetzen, desto geringer ist der Bedarf des parlamentarischen Repräsentativsystems nach plebiszitären Ventilen".143 Die Fraenkelsche Grundthese von der Strukturwidrigkeit plebiszitärer und repräsentativer Elemente in der Demokratie ist für das politische System der Schweiz nicht anwendbar.144 Wenn es auch vielfältige Probleme gibt, so ist doch unbestreitbar, daß die halbdirekte Demokratie in der Schweiz auf ihre eigene Weise funktioniert. Hier ist die Differenzierung zwischen parlamentarischen und nicht-parlamentarischen Regierungssystemen zu treffen. Für die Schweiz ebensowenig zutreffend ist die These von Fraenkel, daß eine Partei zerfallen müsse, wenn ihre Abgeordneten und Funktionäre die "Plebiszitdisziplin" nicht befolgen.145 Im nicht-parlamentarischen System, das heißt dort, wo das Parlament die Regierung oder einzelne Minister nicht abwählen kann, ist die Abstimmungsdisziplin für die Parteien nicht erforderlich. Dagegen brauchen die Parteien im parlamentarischen System die Parteidisziplin in der Volksabstimmung, so Möckli, weil diese unter Umständen wie die parlamentarische Vertrauensfrage wirkt.146 142 Oswald Sigg, Politischer Kult oder politische Kultur? Ein Plädoyer für die Volksinitiative, in: Die Schweiz: Aufbruch aus der Verspätung, Zürich 1991, S. 66 - 69, Zitat S. 68 143 Hans-Peter Schneider, Das parlamentarische System, in: Ernst Benda, Werner Maihofer, Hans-Jochen Vogel, Hg., Handbuch des Verfassungsrechts, Berlin, New York 1983, S. 239-293; S. 290 144 Ernst Fraenkel, Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im demokratischen Verfassungsstaat, in: Ernst Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, Hg. von Alexander von Brünneck, Frankfurt 1991, S. 153 - 203, S. 176 f. Fraenkel vergleicht England, USA, Frankreich und Deutschland. Auf die Schweiz geht er nur beiläufig ein: "Nur in der Schweiz liegt es anders; von der Schweiz hat aber bereits Napoleon I. gesagt, daß sie dank ihrer Geschichte und der Vielartigkeit ihrer Sprachen, Religionen und Gebräuche mit keinem anderen Land der Welt verglichen werden könne." Fraenkel zitiert James Bryce, Modern Democracies, London 1921, Band 1, S. 455 145 Fraenkel, a.a.O., S. 175 146 Möckli, Direkte Demokratie im internationalen Vergleich, Bern 1994 (Habil. 1992), S. 267 257 Wie dargelegt wurde, gibt es zahlreiche abweichende Parteivoten bei Volksabstimmungen in der Schweiz, aber sie gefährden den Bestand der politischen Parteien und ihre Regierungsstellung kaum. Abweichende Meinungen bei Abstimmungsempfehlungen zu Volksabstimmungen können meines Erachtens äquivalent wie Sondervoten in der Verfassungsrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des U.S. Supreme Courts beurteilt werden. Sie können die Akzeptanz und Transparenz von Entscheidungen fördern; sie haben die Chance, in zukünftigen Entscheidungen mehrheitsfähig zu werden. Ernst Fraenkels These vom Zusammenhang der Staatsverfassung mit den Parteiverfassungen ist zuzustimmen. Politische Parteien sind die Kräfte im demokratischen Verfassungsstaat, die direktdemokratische Erwartungen mit repräsentativ-parlamentarischen Ansprüchen wechselweise verbinden. "Von Grenzfällen abgesehen, ist die Frage, ob unter Herrschaft einer parlamentarischen Verfassung ein Ausgleich zwischen den plebiszitären und repräsentativen Komponenten jeweils möglich ist, primär nicht ein Problem der Staatsverfassung, sondern der Parteiverfassungen. Der Ruf nach plebiszitären Verfassungsinstitutionen wird sich in politisch erträglichen Grenzen halten, solange die Wähler die Überzeugung besitzen, daß sie in ihren Parteien Gebilde besitzen, die ihre Wünsche und Ansichten ausreichend vertreten. (...) Der Bestand der Demokratie im Staat hängt ab von der Pflege der Demokratie in den Parteien. Nur, wenn den plebiszitären Kräften innerhalb der Verbände und Parteien ausreichend Spielraum gewährt wird, kann eine Repräsentativverfassung sich entfalten."147 Wie läßt sich die Demokratie in den Parteien pflegen? In den vergangenen Jahren haben mehrere Parteien in Deutschland Urwahlen, Mitgliederbefragungen und Mitgliederentscheide durchgeführt.148 Die jeweiligen Verfahren sind noch nicht sehr ausgereift. Neben direktdemokratischen Formen von Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheiden können auch Amtszeitbeschränkungen für leitende Parteiämter in Erwägung gezogen werden. In der Schweiz besteht nach Auffassung von Tschannen kaum eine Schwierigkeit mit der innerparteilichen Demokratie. Die Forderung nach einer Binnendemokratisierung der politischen Parteien "... stellt in der Schweiz kein wirkliches Problem dar. Die Parteien hier sind demokratisch strukturiert, tatsächlich leider sie unter einem Demokratieüberschuß, wenn man sieht, welch kläglichen Respekt die Kantonalsektionen ihren schweizerischen Mutterparteien oftmals zollen. Sodann fungieren die Parteien doch eher als Rekrutierungs147 Ernst Fraenkel, a.a.O., S. 202 und 203 Klaus Seidel, Direkte Demokratie in der innerparteilichen Willensbildung, Frankfurt am Main u.a. 1998; Bernd Becker, Innerparteiliche Reformmöglichkeiten für die deutschen Parteien. Von Großbritannien lernen, in: Zparl, 30 / 1999, S. 447 - 466 148 258 basis und nicht primär als Organisatoren von Fachinteressen. Was die Kandidatennomination angeht, so mag es innerparteiliche Demokratiedefizite geben, aber die legitimierende Wirkung der Volkswahl dürfte angesichts der Gestaltungsmöglichkeiten der Bürger - sie können Kandidaten streichen, kumulieren, panaschieren - darunter kaum leiden."149 Im Spannungsfeld zwischen Effizienz und parteiinterner Demokratie waren die siebziger und achtziger Jahre stärker dominiert von den demokratischen Idealen, in den neunziger Jahren ist nach den Ergebnissen von Ladner und Brändle die Effizienz wichtiger geworden. "Eine professionelle Organisation wird jedoch nicht zum Mass aller Dinge. Die Devise heisst nicht 'entweder oder', sondern 'sowohl als auch'."150 149 Pierre Tschannen, Pierre, Stimmrecht und politische Verständigung. Beiträge zu einem erneuerten Verständnis von direkter Demokratie, Basel und Frankfurt am Main 1995; S. 508, Nr. 762 150 Andreas Ladner, Michael Brändle, Die Schweizer Parteien im Wandel. Von Mitgliederparteien zu professionalisierten Wählerorganisationen?, Zürich 2001, S. 314 259