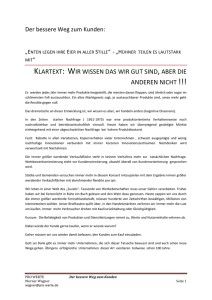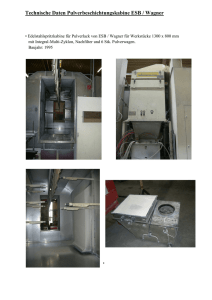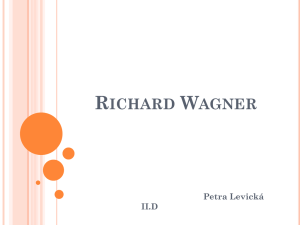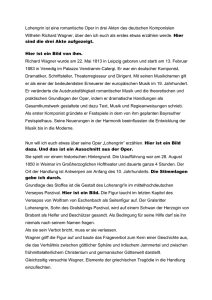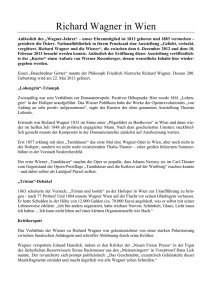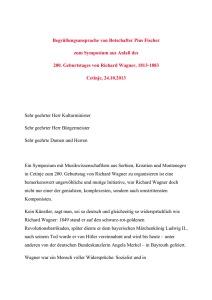Wagner - SolarBau : MONITOR
Werbung

03 Wagner mask 15.02.2000 15:24 Uhr Seite 2 Portrait Nr. 3 Verwaltungsgebäude Wagner Solartechnik Büro und Verwaltung Institute, Schulen und Hochschulen Verkaufsstätten Produktionsstätten 3 Heil- und Pflegeeinrichtungen Hotels und Gastronomie Integraler Entwurfsprozess Simulationsrechnungen erhöhter Wärmeschutz Passive Kühlung Tageslichtnutzung Atrium Solarthermie Solarstrom Wärmerückgewinnung Erdwärme-, Erdkältenutzung Kraft-/WärmeKopplung Wärme-/KälteVerbund Wärmepumpe Gebäudeautomatisierung Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) Biomassenutzung Regenwasserkonzept Baustoffökologie 03 Wagner mask 15.02.2000 15:24 Uhr Seite 1 Projektportrait Das Verwaltungsgebäude der Firma Wagner befindet sich in einem Gewerbegebiet der Kleinstadt Cölbe nördlich von Marburg. Die Nachbargebäude sind firmeneigen, die umliegende Bebauung ist ein- bis dreigeschossig. Die Planung des Gebäudes ist das Ergebnis eines beschränkten Wettbewerbs, bei dem die große solarthermische Anlage vorgegeben war. Der Baukörper bildet einen rechteckigen Grundriß, der auf der westlichen Seite zu einem Rundbau erweitert wurde, die Längsseiten orientieren sich nach Süden und Norden. Die vertikale Erschließung und die Nebenräume sind in einer räumlichen Einheit an der Nordseite Besonderheiten des Gebäudes untergebracht. Der Verwaltungsbau umfaßt unterschiedliche Funktionsbereiche. Im Erdgeschoß befinden sich Ausstellungsräume, Kundenberatung eine Werkstatt und ein Versandbereich. Das Mittelgeschoß bietet Platz für ca. 40 Arbeitsplätze in Großraum- und Einzelbüros. Im Dachgeschoß befinden sich ein Speisesaal mit Küche und ein Seminarbereich. Der Solarspeicher ist zentrales Gestaltungselement, er steht in der Mitte des Rundbaus. Die Dächer des Gebäudes sind jeweils als Sattel- und Pultdächer ausgebildet, um das Tageslicht zu nutzen. In diesem Gebäude wurden die hohen wärmetechnischen Anforderungen, die an ein Passivhaus gestellt werden, erstmalig in einem Verwaltungsgebäude umgesetzt. Der Dämmstandard ist extrem hoch und die Gebäudehülle ist luftdicht ausgeführt, um unkontrollierte Lüftungsverluste auszuschalten. Die im Sommerhalbjahr anfallende Energie wird über eine saisonale Speicherung für die Wintermonate nutzbar gemacht. Die Solaranlage mit Saisonspeicher ist eine konsequente Demonstration der Produkte des Bauherrn. Abb. 3: Lageplan Abb. 1: Grundriss, 1. OG Abb. 2: Gebäudeschnitt AB 2 Verwaltungsgebäude Wagner Solartechnik Stand 02/2000 03 Wagner mask 15.02.2000 15:25 Uhr Seite 4 Gebäudeinformation Erste Erfahrungen Die Dämmung des Hauses orientiert sich mit U-Werten unter 0,15 W/m2K am Standard der Passivhäuser. Eine Skelett-Konstruktion aus Stahlbeton mit einer massiven Bodenplatte wird von einer dämmenden Hülle komplett umschlossen. Im Fassaden und Dachbereich besteht diese aus Leichtbau-Elementen in Holztafelbauweise mit Dämmstärken bis zu 40 cm, die vollständig außerhalb der tragenden Bauteile montiert sind. Die Schaumglasdämmung unter der Bodenplatte schließt im Sockelbereich direkt an die Fassadendämmung an. Die Fenster bestehen aus einer 3-fachen Wärmeschutzverglasung mit Edelgasfüllungen und thermisch durch einen Polyurethankern getrennten Holzrahmen, um die Verluste an Rahmen und Glasverbund zu minimieren. Nutzung Wärmeschutznachweis Nutzungszeiten Anzahl der NutzerInnen Fertigstellung Mo-Fr 8-18 Uhr, 40 1998 Baukörper Geschosse 3 Geschosse nicht unterkellert mittlere Raumhöhe (NRI/NGF) 3,5 m A/V-Verhältnis 0,36 m -1 Bauteil U-Wert (W/m2K) 0,14 0,11 0,12 0,85 0,21 Aussenwand Dach Boden Fenster mittlerer U-Wert Jahresheizwärmebedarf (Qh) nach WSVO ´95 maximal zulässiger Qh /V Qh/V vorhanden Qh/An vorhanden Unterschreitung von max. zul. Flächen und Volumen, DIN 277 20,1 kWh/m3a 10,5 kWh/m3a 32,8 kWh/m2a Qh um 48 % Volumen BruttoRaumInhalt 8.533 m3 Fensterflächen Flächen 60% NettoGrundFläche 1.948 m2 HauptNutzFläche 1.743 m2 Konzentration HNF/NGF 90 % Nord 50% Ost West 17% 37% Süd 69% Anteil der Fensterflächen an den Fassadenflächen. In Summe 0,25 m2 Fensterfläche je m2 NGF Kosten Bauwerkskosten Brutto, Stand Kostenfeststellung Bezug BruttoRaumInhalt DIN 277 NettoGrundFläche DIN 277 3 Baukonstruktion DIN 276: KG 300 450 DM/m3 Technische Anlagen DIN 276: KG 400 110 DM/m3 Bauwerkskosten KG 300+KG 400 560 DM/m3 1.970 DM/m2 490 DM/m2 2.460 DM/m2 Verwaltungsgebäude Wagner Solartechnik Stand 02/2000 Im Rahmen des integralen Planungsprozesses vom Entwurf bis zur Fertigstellung gab es zahlreiche, teilweise gravierende Veränderungen, insbesondere zur energetischen Optimierungen. Aus dem ursprünglich geplanten Niedrigenergiehaus wurde erst im Lauf dieses Prozesses ein Passivhaus. Zugunsten einer Erhöhung des Dämmstandards und der Lüftung mit Wärmerückgewinnung wurden die Heizkörper vollständig eingespart. Das Gebäude wird ausschließlich über die Zuluft beheizt. Mit diesem Ansatz konnte das Kostenziel weitestgehend erreicht werden. Die für den sinnvollen Betrieb der Wärmerückgewinnung erforderliche Dichtheit der Gebäudehülle konnte durch ein Drucktestergebnis von nL50=0,4 h-1 nachgewiesen werden. Das fertige Gebäude wird von den Nutzern gut akzeptiert. Der Komfortgewinn gegenüber den zuvor genutzten Räumlichkeiten, insbesondere durch die Lüftungsanlage, wird dabei besonders hervorgehoben. Auch ohne Befeuchtung der im Winter oft trockenen Zuluft blieb die mittlere Feuchte der Abluft im ersten Winter immer oberhalb von 30%. Die Meßwerte mit Spitzentemperaturen von maximal 29°C in den Büros bei 32°C Außentemperatur bestätigen die Funktion des passiven Kühlkonzeptes aus wirksamer Verschattung, Nachtlüftung und Erdregister. Vollständige Meßwerte zum Heizwärmeverbrauch im ersten Winter liegen noch nicht vor; in der Tendenz werden die Erwartungen aber bestätigt. Die maximal erforderliche Heizleistung lag bei nur 11 W/m2. Erfreulich groß war die Resonanz der Öffentlichkeit auf das erste Bürogebäude mit einem Wärmebedarf auf dem Niveau von Passivhäusern. 03 Wagner mask 15.02.2000 15:25 Uhr Seite 5 Energiekonzept Für einen geringen Heizwärmebedarf setzt das Passivhauskonzept auf eine konsequente Reduktion der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste. Erst diese Maßnahmen ermöglichen es, dass der verbleibende Jahresheizwärmebedarf von ca. 10 kWh pro m2 NGF zu 50% durch aktive Solarenergienutzung abgedeckt werden kann: Die im Sommerhalbjahr anfallende Energie wird über eine saisonale Speicherung für das Winterhalbjahr nutzbar gemacht. Vorgefertigte, 10 m2 große Kollektordachelemente (solar roof) erwärmen während der Sommermonate über einen Plattenwärmetauscher einen zentral im Gebäude angeordneten, 87 m3 fassenden Wasserspeicher. Dieser Speicher wird schichtenweise be- und entladen. Der Restbedarf an Heizenergie wird mit der Produktion der im Bürogebäude erforderlichen elektrischen Energie gekoppelt. Dazu deckt ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk (BHKW) einen Teil des Stromverbrauchs und liefert Heizenergie an die Heizregister. Zur Verlängerung der Laufzeiten des BHKW auf etwa 4.500 Stunden wird zum einen der Großspeicher als Pufferspeicher genutzt, zum anderen wurde ein nebenstehendes älteres Gebäude thermisch angekoppelt (Nahwärmeverbund). Regenwasser wird in einem Betonerdtank von 11 m3 Größe gesammelt und für die Toiletten verwendet. Kennwerte zur Energieversorgung Blockheizkraftwerk Kollektoren Spez. Leistung (W/m2) Kennwerte thermische Solaranlage Größe des Kollektorfeldes Speichervolumen Dämmschichtdicke Automatische Beleuchtungssteuerung und stromsparende Geräte tragen durch Verbrauchsminderung dazu bei, dass das BHKW einen großen Teil des elektrischen Verbrauchs decken kann. Ein Datenbussystem steuert die gesamte Haustechnik. Strom Wärme Fläche kW kW m2 5,5 12,5 65 6,4 64 m2 87 m 3 50 cm Kennwerte Erdregister Anzahl der Kanäle Material Länge der Kanäle Nennweite Verlegetiefe Nennvolumenstrom 4 Betonrohre je 32 m DN 500 mm 1,5 m 3.000 - 6.000 m3/h Abb. 6: Der Solarspeicher in der Bauphase Abb. 8: Schema des Erdregisters Abb. 5: Energieversorgung Abb. 7: Das Klein-BHKW Verwaltungsgebäude Wagner Solartechnik Stand 02/2000 4 03 Wagner mask 15.02.2000 15:25 Uhr Seite 6 Gebäude- und Technikkonzept Lüftung und Heizung Tageslicht und Beleuchtung Zur Deckung des geringen Heizwärmebedarfs wird auf Heizkörper verzichtet. Die Heizwärme wird ausschließlich mit der Lüftungsanlage im Gebäude verteilt. Sie schafft in Verbindung mit der Wärmerückgewinnung die Voraussetzungen für einen derartig niedrigen Wärmebedarf. Die Luftwechselrate ist auf den hygienisch notwendigen Bedarf von 0,3 -1,0-fach je Stunde beschränkt. Das Gebäude ist in 9 Regelungszonen unterteilt. Die Räume werden einzeln belüftet (Zuluftzonen); entlüftet werden sie durch Überströmen über die Verkehrsflächen zu Nebenräume wie Technik- oder Sanitärzonen (Abluftzonen). Aussenliegende, elektrisch betriebene Sonnenschutzjalousien an der Ost- Südund Westfassade helfen unerwünschte solare Wärmegewinne zu vermeiden. Die Zweiteilung der Bedienung erlaubt die Tageslichtnutzung auch bei im unteren Bereich geschlossenen Lamellen. Nutzereingriffe in die automatische Jalousiesteuerung sind jederzeit möglich. Ein deckenbündiges Fensterband oberhalb der Sichtfenster in der Lochfassade verbessert die Tageslicht verhältnisse im rückwärtigen Bereich der fast 6 m tiefen Büros. Die Wände zwischen Büros und Fluren sind nicht vollständig geschlossen, wodurch die Tageslichtgrundversorgung der Verkehrsflächen erreicht wird. Die Deckenleuchten der Büros werden automatisch über ein Bussystem auf eine Beleuchtungsstärke von 500 Lux am Arbeitsplatz geregelt. Die dazugehörigen Lichtsensoren befinden sich neben den Leuchten an den Geschoßdecken. Es gibt keine Präsenzmelder. Die Deckenleuchten der Flure werden manuell ein- und ausgeschaltet. Abb. 6: Lüftung der Büros Winter: Das Erdregister und die Wärmerückgewinnung wärmen die zugeführte Außenluft vor. Anschließend bringt ein Vorheizregister die Lufttemperatur auf 25 °C. In den 9 Zonen des Gebäudes befinden sich in den Zukuftkanälen kleine Nachheizregister für eine zonenweise Regelung der Temperatur. Die Luft kann hier auf Werte zwischen 30 und 40 °C gebracht werden. Das Vor- und Nachheizregister wird aus dem saisonalem Wärmespeicher gespeist. Ein 4-facher Kreuzstromwärmetauscher entzieht der Fortluft ca. 80 % der Wärme und überträgt diese direkt auf die Zuluft. Das Gebäude muß voraussichtlich nur von Dezember bis Februar beheizt werden. Sommer: Die nächtliche Auskühlung des Gebäudes wird mittels freier Auftriebslüftung gewährleistet. Bei Bedarf öffnen sich Lüftungsklappen im Dachbereich und die Oberlichter der Büros automatisch. Thermischer Auftrieb läßt die frische Außenluft durch die offenen Großraumbüros über die Eingangshalle wieder nach draußen strömen. Die unverkleideten Geschoßdecken werden hierdurch entwärmt und dienen am Folgetag wieder als thermischer Puffer für die Temperatur im Raum. Die Wärmerückgewinnung wird im Sommer mit einem Bypass umgangen. Nachträglich wurde eine aktive Kühlungsanlage für die Computerzentrale eingebaut. Der Aufstellungsbereich war zuvor als reine Abluftzone vorgesehen, die einströmende Luft hatte sich im Sommer aber als zu warm erwiesen. Abb. 7: Beleuchtung der Büros Verwaltungsgebäude Wagner Solartechnik Stand 02/2000 5 03 Wagner mask 15.02.2000 15:25 Uhr Seite 3 Impressum Projektteam SolarBau :MONITOR Team Monitoring Dieses Dokument wurde im Rahmen des Begleitforschungsprojekts „SolarBau : MONITOR“ erstellt. Die Begleitforschung dokumentiert, analysiert und kommuniziert die Ergebnisse der Demonstrationsprojekte des Förderprogramms SolarBau des BMWi. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Faltblattes liegt beim Fraunhofer ISE. Bauherrschaft, Nutzer Wagner & Co Ansprechpartner: Herr Schweitzer Zimmermannstr. 12 35091 Cölbe Universität Marburg, Fachbereich Physik Ansprechpartner: Herr Dr. Vajen 35032 Marburg Telefon: (0 64 21) 2 82 41 31 Felefax: (0 64 21) 2 82 65 35 Email: [email protected] Kontaktadresse: Gesamtverantwortung und Koordination Dokumentation und Analyse Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE Gruppe Solares Bauen Herr Dr. Voss Oltmannsstr. 5 79100 Freiburg Telefon (0761) 4588 -135 Telefax (0761) 4588 -132 e-mail: [email protected] Kommunikation sol°id °ar Architekten und Ingenieure Herr Dr. Löhnert Forststr. 30 12163 Berlin Lehre, Aus-und Weiterbildung Universität Karlsruhe Herr Prof. Wagner Fakultät Architektur Fachgebiet Bauphysik und Technischer Ausbau (fbta) Englerstr. 7 76128 Karlsruhe Projektsteuerung Wagner & Co Ansprechpartner: Herr Schweitzer Förderung Architektur Architektur Stamm Dannenröderstr. 12 35260 Schweinsberg Erweiterte Planung: 100.334 DM, Laufzeit von 1.6.97 - 31.5.98 Energiekonzept, Thermische Bauphysik, Simulation Passivhaus-Institut Ansprechpartner: Herr Dr. Feist Rheinstr. 44/46 64283 Darmstadt Technische Gebäudeausrüstung I (Solartechnik, Heizung, Sanitär) Wagner & Co Ansprechpartner: Herr Dipl.-Ing. Rustige Zimmermannstr. 12 35091 Cölbe Monitoring: 801.720 DM, 1.11.1997 bis 31.12.2001 Projektadresse Verwaltungsgebäude der Firma Wagner & Co Zimmermannstr. 12 35091 Cölbe Technische Gebäudeausrüstung II Ingenieurgesellschaft Haustechnik GmbH Ansprechpartner: Herr Johannböke, Herr Mengel Ketzerbach 25-28 35037 Marburg Projektförderung Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) über Projektträger Biologie, Energie, Umwelt des BMBF und des BMWi Herr Dr. Bertram Forschungszentrum Jülich GmbH 52425 Jülich Abbildungsnachweis Titel: Wagner & Co. Abb.1-3: Chr. Stamm Abb.4, 5, 7: Fraunhofer ISE Abb.6, 8: Wagner & Co. Besuchen Sie uns im Internet http://www.solarbau.de Bauherr/ Projektsteuerer Architekt TGA I, TGA II Energiekonzept, Thermische Bauphysik, Simulation