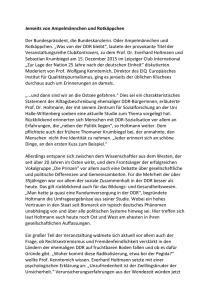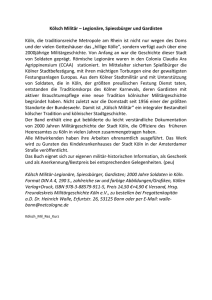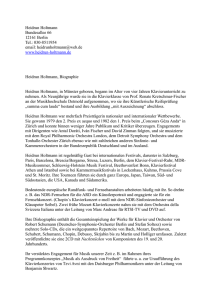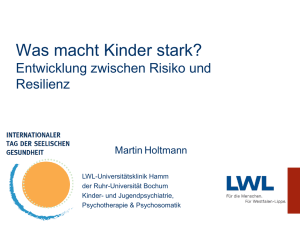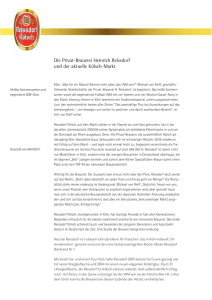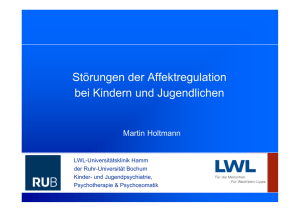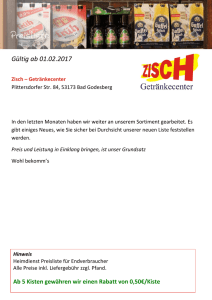Professor Dr. Everhard Holtmann Politikwissenschaftler im Gespräch
Werbung

Sendung vom 28.5.2013, 21.00 Uhr Professor Dr. Everhard Holtmann Politikwissenschaftler im Gespräch mit Jochen Kölsch Kölsch: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen alpha-Forum. Politik ist ein schmutziges Geschäft, so denken viele Menschen – auch in Deutschland. Politiker haben ein miserables Image. Das ist eines der Themen, die ich mit unserem heutigen Studiogast diskutieren möchte, nämlich mit Professor Everhard Holtmann, Politologe von der Universität Halle-Wittenberg. Herr Holtmann, warum ist das so? Warum hat die Politik ein so wahnsinnig negatives Image? Holtmann: In der Tat hängt das der Politik und den Politikern als ein fast unausrottbarer Generalverdacht seit Langem an. Das ist einmal deshalb so, weil es ja in der langen Geschichte der Politik und der politischen Systeme immer wieder zahlreiche Einzelfälle gegeben hat, bei denen sich Menschen, die in Amt und Mandat gekommen waren, unangemessen bereichert haben. Denken Sie hier z. B. an die römischen Konsuln, für die das Amt des Konsuls vor allem auch deswegen so attraktiv gewesen ist, weil sie dann eine Provinz für die eigene Tasche ausbeuten konnten. Oder nehmen Sie Fälle in der Gegenwart, bei denen es um Amtsmissbrauch und Veruntreuung geht. Strukturell erklärt sich dieses negative Image dadurch, dass die Politiker dann, wenn sie in Amt und Würden sind, nicht nur über eine herausgehobene Position verfügen, sondern ja auch Macht haben. Und Macht bedeutet nicht nur, Einfluss zu nehmen auf Entscheidungen, sondern damit verbunden ist ja auch die Befugnis, nicht unerhebliche Geldbestände zu verteilen, also für die sogenannte Allokation öffentlicher Mittel zu sorgen. Auch von daher nährt sich ein Grundmisstrauen, dass Politiker hier nicht tadelsfrei mit dem ihnen anvertrauten Gut umgehen könnten. Kölsch: Und Politiker erhöhen ja auch manchmal Steuern. Der Staatsanteil ist ja sehr hoch, den wir als Bürger von unserem Geldeinkommen abgeben müssen. Holtmann: So ist es. Das hat etwas zu tun mit der Tradition des Sozialstaates in der Bundesrepublik. Wobei damit ja auch gleichzeitig angedeutet ist, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Steuern zahlen, entsprechend etwas zurückbekommen, was z. B. auch an bestimmten Gewährleistungen erkennbar ist. Die Steuerquote ist übrigens hierzulande noch nicht so hoch wie z. B. in Skandinavien. Kölsch: Wobei die Menschen dort mit ihrer Lebenssituation allerdings auch sehr zufrieden sind. In Ihrem Buch, das ich anschließend gleich noch explizit vorstellen werde, fand ich die interessante Tatsache, dass dieses generell schlechte Image letztlich gar nicht so ganz stimmt. Sie sagen, dass man sich das schon sehr viel genauer anschauen muss, weil viele Menschen bei uns die politischen Parteien auf der einen Seite als katastrophal vertrauensunwürdig empfinden, während sie auf der anderen Seite diejenige Partei, die sie wählen, doch erheblich positiver einschätzen. Holtmann: Wir können über längere Zeit hinweg durch Umfragedaten auch belegen, dass sich bis heute immer noch eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung – übrigens in Ost wie in West, wenn auch in Ostdeutschland in etwas abgeschwächtem Umfang – einer Partei ihrer bevorzugten Wahl zuordnet. Die Politologen sprechen in diesem Fall von der sogenannten "Parteiidentifikation". Das heißt, man ordnet sich einer Partei über eine längere Zeit, also länger als eine Legislaturperiode, auch gefühlsmäßig zu, weil man dort die eigenen Überzeugungen am besten aufgehoben findet. Diese Parteibindung ist zwar seit vielen Jahren im Rückgang begriffen – zumindest die starke Parteibindung –, aber sie ist doch immer noch prägend und bestimmt auf diese Weise auch das Verhältnis der Bürgerinnen zur Politik mit. Kölsch: Sie haben in Ihrem Buch "Der Parteienstaat in Deutschland" – eine gewissermaßen trockene, aber, wie ich finde, dennoch wichtige Lektüre für jeden, der sich ein bisschen politisch interessiert – ausgeführt, dass das Problem eigentlich nicht darin besteht, dass die Bürger die Parteien als schwierig und negativ empfinden, sondern dass das letztlich eine Frage des Zutrauens in die Demokratie insgesamt darstellt. Und genau das macht dieses Problem so brisant. Holtmann: Man muss hier allerdings unterscheiden – und das macht man ja auch aus guten Gründen – zwischen dem Vertrauen, der Akzeptanz der Demokratie als Idee auf der einen Seite und dem praktischen Funktionieren der Demokratie. Kölsch: Aber lässt sich das trennen? Holtmann: Das kann man zunächst einmal analytisch trennen und das macht auch Sinn, denn man kann ja auch als demokratisch überzeugter Bürger, also als Bürger, der die Idee der Demokratie für grundsätzlich gut hält, durchaus begründet die Einschätzung haben, dass in der Praxis des demokratischen politischen Systems einiges nicht rund läuft, dass es da Fehlentscheidungen gibt usw. Das ist also die Frage nach dem Funktionieren der Demokratie. Wie gesagt, man tut gut daran, beides auseinanderzuhalten. Kölsch: Dennoch, in dem Moment, in dem die Praxis nicht gut funktioniert, wird doch auch die grundsätzliche Bejahung abnehmen, oder? Holtmann: Das ist durchaus eine Gefahr, wenn sich über längere Zeit hinweg die begründete Einschätzung einstellt, dass da etwas nicht gut funktioniert. Aber in unseren Umfragedaten finden wir derzeit immer noch vor, dass eine solide Mehrheit in der Bevölkerung mit der Idee der Demokratie konform geht. Mit der Praxis dessen, was die Politik macht, hat sie allerdings auch ihre Probleme. Kölsch: Sie analysieren in Ihrem Buch ja auch u. a., dass den Parteien das Personal ausgeht, d. h. man kann allgemein beobachten, dass sich die Qualifikation derer, die sich auf diese Mühle der Politik einlassen, insgesamt eher sinkt. Es nimmt auch das Interesse der Menschen an der Politik, an den politischen Parteien ab. Die Mitgliedschaften der Parteien gehen seit vielen Jahren kontinuierlich zurück. Wenn es so weitergeht, werden wir irgendwann gar keine Politiker mehr haben. Holtmann: Das ist eine Frage, die schon so mancher Parteistratege gestellt hat. Wenn der Abstrom der Mitglieder so weitergeht, dann kann man sich ausrechnen, in welchem Jahr das letzte Parteimitglied das Licht ausmacht und die Tür der Parteizentrale für immer schließt. Es ist kein Trost für die Politik, dass das eine Tendenz ist, die auch andere Großorganisationen erleben wie z. B. Unternehmerverbände, Gewerkschaften, Kirchen usw. Das verweist darauf, dass der Mitgliederschwund der Parteien nicht unbedingt nur und ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass die Akzeptanz der Parteien und der Politiker so schwach wäre. Stattdessen spielen hier wohl tiefergehende Wertewandelmomente eine Rolle. Kölsch: Aber gerade in Zeiten wie der heutigen Eurokrise wird doch klar, dass die Wirtschaft als solche nicht alles wird regeln können und wollen. Und wenn die Wirtschaft es selbst in die Hand nimmt, dann endet es u. U. so wie bei der Bankenkrise, nämlich katastrophal für alle. Das heißt, die Politik ist eigentlich der Ort, an dem Gesellschaft organisiert wird und quasi gerettet werden kann, wo sie wieder zum Funktionieren gebracht werden kann. Außerhalb der Politik gibt es dafür keinen Ort. Holtmann: Es gibt in der Tat keine Alternative zu diesem Modell, also zu dem Modell, das wir den "Primat der Politik" nennen: Das ist die durch Wahlen legitimierte Vorrangposition demokratischer Politiker, sich die Letztentscheidung bei den zentralen Fragen, die die Nation und die Gesellschaft betreffen, vorzubehalten. Die Bevölkerung realisiert das ja auch instinktiv – bei aller Kritik an der Politik und den Politikern. Man kann das z. B. daran erkennen, dass sich in Krisenzeiten die Bürgerinnen und Bürger doch vermehrt sozusagen um die Exekutive scharen, dort also gewissermaßen Schutz suchen vor diffusen und manchmal auch sehr konkreten Fährnissen und Bedrohungen, die beispielsweise aus dem Bereich der Ökonomie herrühren. Kölsch: Die Mitgliederzahlen der Parteien nehmen also ab und es gibt immer weniger Interesse an der aktiven Politik. Aber auf der anderen Seite gibt es da z. B. die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen. Diese nicht parteiorientierten nicht staatlichen Organisationen können nämlich einen großen Zuwachs verzeichnen. Das heißt, die Menschen in Deutschland sind ungeheuer aktiv in der Gesellschaft, sind in unendlich vielen Vereinen usw. Sie engagieren sich zwar nicht mehr in Parteien und in der aktiven Politik, aber sie machen dennoch Politisches, indem Sie sich für bestimmte Themen engagieren und dort versuchen, etwas durchzusetzen. Holtmann: Ja, und das ist ja eigentlich auch gut so. Die Politikwissenschaft plädiert ja eigentlich schon seit Längerem dafür, von einem etwas weiteren Politikbegriff auszugehen, also die Bandbreite der Tätigkeiten, der Partizipation nicht nur sehr eng auf den Sektor der Parlamente zu beschränken. So gesehen holt uns also hier die Wirklichkeit ein. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass damit neuerliche Probleme erzeugt werden. Denn häufig wird ja die Hinwendung zu Formen der unmittelbaren, der volksunmittelbaren direkten Demokratie unterfüttert von einer mehr oder weniger ausgeprägten Abneigung – das ist nicht einfach nur eine Distanz – gegenüber dem sogenannten "Parteienbetrieb". Das ist dann aber eine prekäre Konstellation. Denn so wichtig und notwendig es einerseits ist, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Dinge selbst in die Hand nehmen – das ist ja auch das Urelement der Demokratie schlechthin –, so unverzichtbar sind andererseits aber auch die Parteien. Die von Ihnen erwähnten NGOs sind ja so etwas wie ein Hybrid zwischen bürgerschaftlicher, unmittelbarer, individueller Partizipation auf der einen und parteienstaatlich organisierter Politik auf der anderen Seite. Das kommt auch dadurch zustande, dass in bestimmten Politikfeldern die Problemlagen komplexer geworden sind: Da bedarf es eben eines Expertenwissens. Dieses Expertenwissen – und das ist ja, wenn man so will, einer der Keimimpulse für die NGOs – sucht sich dann nicht zuletzt auch seinen Ort, und zwar in der Tätigkeit von solchen Nichtregierungsorganisationen. Kölsch: Die Menschen nicht nur in Deutschland, aber hier im Besonderen haben ja eine große Sehnsucht nach der sogenannten Sachpolitik. Das ist diese Vorstellung, man könnte Politik fern dieser Konflikte und Streitereien, wie sie unter Parteien üblich sind, betreiben, es könne eine rein an der Sache orientierte Politik geben. Mir kommt das vor wie der Wunsch nach einem Obrigkeitsstaat, der von sachlich orientierter Politik befeuert wird. Denn das ist doch eigentlich eine Chimäre. Holtmann: Ich stimme Ihnen da zu. Die Sehnsucht nach der Sachpolitik ist auf der einen Seite in der deutschen Kultur historisch sehr stark verankert. Auf der anderen Seite ist sie aber, wenn man das nüchtern betrachtet und sachlich überprüft, ein Trugbild. Denn es sind kaum Problemlagen denkbar, bei denen es darum ginge, die eine mögliche bzw. die einzig sinnvolle Lösung zu ermitteln. Stattdessen sieht der Normalfall so aus, dass es alternative Lösungen für ein Problem gibt und dass diese Lösungen jeweils in einem hohen Maße an Interessen orientiert sind. Das heißt, es geht bei Sachentscheidungen und muss bei Sachentscheidungen immer um einen kontrollierten Ausgleich der Konfliktlagen und der Präferenzentscheidungen gehen. Kölsch: Es gibt zu dieser Vorstellung einer reinen Sachpolitik ja eine literarische Vorlage, nämlich die "Betrachtungen eines Unpolitischen" von Thomas Mann aus dem Jahr 1915. Das heißt, es gibt in Deutschland eine lange Tradition des unpolitischen Denkens und Fühlens. Holtmann: Genau. Wobei man aber Thomas Mann zugutehalten muss, dass er sich in diesem Punkt in der Weimarer Republik doch anders orientiert hat. Er ist dann nämlich im Grunde genommen als ein Verteidiger der bereits parteienstaatlich gelenkten Demokratie aufgetreten. Kölsch: Das heißt, das, was wir heute als normal empfinden – ein auf dem Feld der Politik parteipolitisch organisierter Staat – ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Holtmann: Ja, das ist durchaus nicht selbstverständlich. Das ist zum einen deshalb nicht selbstverständlich, weil die deutsche politische Tradition, wie erwähnt, historisch doch sehr stark und sogar durch den mehrfachen Wechsel der politischen Systeme hindurch auch obrigkeitsstaatliche Rudimente beibehalten hat – und das bis weit in die Zeit der Bundesrepublik Deutschland hinein. Zum anderen ist das nicht selbstverständlich, weil ja in der Tat teilweise neue Probleme auftauchen, die sehr wohl nach sachlich fundierten Lösungen rufen. Es ist ja nicht so, dass man sich von Sachentscheidungen verabschieden müsste, wenn man von Politik oder von Parteientscheidungen spricht. Nein, die Politik muss sich fraglos an der Sache orientieren: Die Zypernkrise ist dafür ein schlagendes Beispiel. Aber, und auch das zeigt die Zypernkrise, es geht letztlich darum, einen politisch legitimierten Interessenausgleich zu finden. Kölsch: Diese Haltung wäre ja gar nicht so schlimm, wenn da nicht auch Profiteure auf der politischen Bühne auftreten würden, wenn da nicht auch Gestalten auftauchen würden, die von der Frustration über die Parteienpolitik profitieren wollten. Sie haben das mal in einem Buch mit dem Titel "Die Droge Populismus" zusammengefasst. Sie beschreiben darin die Risiken und Nebenwirkungen, wenn sich Politik nicht mehr ausreichend gut vermitteln kann. Wo ist hier sozusagen der Kernpunkt? Holtmann: Einer der Ansatzpunkte für den Erfolg populistischer Parolen und populistischer Szenarien ist psychologisch darin zu suchen, dass viele Menschen die Umwelt und auch die in die Umwelt hineingreifende Politik als eine diffuse Bedrohung empfinden – und auch empfinden müssen, weil ihnen ja auch häufig genug z. B. qualifizierte Informationen fehlen, um zu einer sicheren Einschätzung von sich selbst in dieser Umwelt kommen zu können. Das ist gewissermaßen der Humus, auf dem populistische Angebote gedeihen: Man operiert mit Angstparolen, man appelliert an untergründige Affekte. Und von diesen Affekten ist dann der Weg nicht weit zu Feindbildern: Die Feinbilder wiederum bieten einfache Erklärungsmuster an, die vor allem einen selbst entlasten. Kölsch: Das heißt, der Populismus bietet den Menschen etwas an, wonach sie Sehnsucht haben: eine einfache, klare Erklärung der Welt, einfache, klare Lösungen und das Gemeinschaftsgefühl einer unpolitischen Masse. Diese Masse ist natürlich letztlich keineswegs unpolitisch, sondern sogar hoch politisch. Holtmann: Und damit ist eben auch eine zumindest punktuelle vermeintliche Entlastung verbunden: Man glaubt also, etwas Sicherheit bekommen zu haben, und merkt nicht, dass das nur ein Illusionstheater ist. Man könnte das auch mit einer Jahrmarktaufführung vergleichen: Man geht hinein und hinterher wieder hinaus und ist zunächst einmal zufrieden oder auch euphorisiert – aber letztlich ist man dann doch wieder sehr schnell in der Realität angelangt. Kölsch: Diese Droge namens Populismus ist ja im Moment in Deutschland vielleicht auch deswegen nicht so weit verbreitet, weil es uns wirtschaftlich im Vergleich zu anderen relativ gut geht. Aber ansonsten finden sich überall in Europa populistische Strömungen: In den Niederlanden, in Frankreich und auch in Italien gibt es sie. Nicht nur die letzten Wahlen in Italien waren ungeheuer geprägt von dieser populistischen Art von Politik. Holtmann: Ja. Hier zeigt sich dieses Wechselspiel zwischen sozialer Verunsicherung auf der einen Seite, die, wie in Italien, auch teilweise einhergeht mit, vorsichtig ausgedrückt, dem suboptimalen Funktionieren der politischen Parteien und der sogenannten politischen Klasse. Auf der anderen Seite hat sie den wachsenden Zulauf für populistische Erklärungsmuster zur Folge. Neben Deutschland bleibt da eigentlich nur ein Teil von Skandinavien, von dem man sagen könnte: Das ist nach wie vor so etwas wie eine Insel der Seligen im Sinne einer stabilen und auch parteienstaatlich gesteuerten Demokratie. Kölsch: Die Gründung der sogenannten Anti-Parteien signalisiert ja diesen massiven Rückgang des Vertrauens in die etablierte Politik. Man sollte vielleicht noch einmal hervorheben, dass Vertrauen eigentlich den Kernbegriff der Politik überhaupt darstellt. Holtmann: Ja, Vertrauen ist deshalb ein Kernbegriff, weil sich die Demokratie in modernen Großflächenstaaten und komplexen Gesellschaften wie der unseren nur über repräsentative Mechanismen vermitteln kann, also über Verbände, über Parteien, über NGOs und meinetwegen auch über Bürgerinitiativen. Der Bürger ist hierbei immer angehalten, den Politikern, an die er mittels Wahlen die Macht und Entscheidungsbefugnis delegiert, einen gewissen Vertrauensvorschuss mitzugeben. Dieser Vorschuss auf etwas, was hoffentlich so sein wird, wie sich das der Bürger wünscht, macht den Kern dieser Vertrauensbeziehung aus. Deshalb ist Vertrauen in der Tat eine Schlüsselgröße für jede Demokratie. Kölsch: Was kann man denn tun, um dieser Droge "Populismus" etwas entgegenzusetzen? Man sieht ja in Frankreich, wo die beiden großen politischen Lager ein ungeheuer schlechtes Image haben, dass eine rechtsnationale Partei immer größere Wahlerfolge einfährt und die Politik immer stärker prägt. Was kann man dagegen tun? Holtmann: Man darf nicht nachlassen, Problemlagen zu erklären, auch wenn man nicht immer gleich durchschlagenden Erfolg mit seiner Botschaft hat. Und man darf sich nicht vom Populismus dahingehend anstecken lassen, dass man den Menschen etwas Falsches erzählt, dass man den Menschen Honig um den Mund schmiert oder versucht, sie mit falschen Botschaften zu füttern. Denn das wird im Laufe der weiteren politischen Ereignisse sehr schnell als eine Chimäre entlarvt und ist daher keinesfalls hilfreich. Im Grunde genommen müssen also Politiker manchmal in gewisser Weise auch eine unpopuläre Vorbildfunktion übernehmen. Wenn z. B. aus Haushaltskonsolidierungsgründen gespart werden muss, dann kann man nicht den einen, die einem vielleicht nahe stehen, eine Schonung versprechen, während man auf der anderen Seite die Fahne der massiven Konsolidierung zum Fenster hinaus hängt. Kölsch: Das heißt, Politik muss für die Breite der Bevölkerung ausreichend gerecht sein. Holtmann: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und genau das ist es, was auch den Zustand der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland kennzeichnet, die ja im europäischen Maßstab noch bemerkenswert stabil ist. In den Umfragekurven sehen wir jedoch, dass seit Längerem eine mehr oder weniger große Mehrheit der Bevölkerung – in Ostdeutschland ist das noch einmal stärker ausgeprägt als in Westdeutschland – der grundsätzlichen Auffassung ist, dass es hierzulande nicht gerecht zugeht. Kölsch: Sind das die Empfänger von Hartz IV? Holtmann: Nein, das sind nicht nur die, sondern das sind auch viele andere – weil das ja die Mehrheit der Bevölkerung ist. Denn die Quote der Menschen, die dieser Ansicht sind, schwankt zwischen 50 und 60 Prozent und liegt manchmal sogar bei mehr als 60 Prozent. Das ist also ein Grundgefühl, das sich durch alle Schichten der Gesellschaft zieht. Das hat sicher jeweils ganz spezielle und unterschiedliche Motivationen, aber dieses Gefühl ist da. Hier muss die Politik versuchen anzusetzen, auch wenn das nicht von heute auf morgen geht. Kölsch: Handelt da die Politik schlicht falsch, weil sich die politischen Eliten, weil sich die sogenannte politische Klasse zu weit entfernt von der Bevölkerung? Holtmann: Es gibt eine strukturell bedingte Tendenz, dass sich Berufspolitiker von ihrer Wählerschaft entfernen. Das aber nicht, weil sie machtversessen oder weil sie zynisch sind, sondern weil das schlicht und einfach der professionelle Politikbetrieb so mit sich bringt. Das heißt, diese Berufspolitiker verfügen über ein Spezialwissen und müssen auch, wenn Entscheidungen anstehen, verhandeln können – zumal dann, wenn wichtige Entscheidungen anstehen, wenn Entscheidungen anstehen, die innerhalb der Bevölkerung kontrovers diskutiert werden. Berufspolitiker müssen solche Entscheidungen dann vorbereiten und entscheidungsreif machen: und das geht nur über Verhandlungen. Sie müssen dazu z. B. mit Minderheiten verhandeln. Im Föderalismus müssen sie meinetwegen auch mit einer gegenläufigen Mehrheit im Bundesrat verhandeln. Das bedeutet aber, dass so eine Entscheidung intransparent wird: Man kann komplizierte Verhandlungen nicht öffentlich auf dem Markt betreiben. Kein Unternehmerverband, keine Gewerkschaft käme z. B. auf die Idee, Tarifverhandlungen öffentlich zu führen. Aber weil diese Verhandlungen nicht öffentlich sind, stärkt das eher das Misstrauen in die Politik und sorgt mit dafür, dass die gefühlte Distanz zwischen dem Gros der Bevölkerung einerseits und andererseits den Politikern, die professionell handeln sollen und handeln müssen, vergrößert wird. Das ist übrigens auch eine Tendenz, die in Ost- wie in Westdeutschland inzwischen gleichermaßen ausgeprägt ist. Kölsch: So etwas wie die Eurokrise zu managen, versteht ja ohnehin kaum noch jemand und auch die Wirtschaftswissenschaftler sind hier ja in der Regel überfordert. Aber auch hier gibt es immer wieder den Wunsch nach ganz einfachen Lösungen. Da heißt es z. B.: "Wir wollen unsere D-Mark wieder haben, weil wir damit das ganze Problem nicht hätten." Die Leute, die so etwas fordern, bedenken natürlich die ganzen Implikationen nicht mit. Die Politik muss einerseits die Stimmungslage dieser Menschen verstehen können, sie muss das aber auch bearbeiten und vermitteln. Holtmann: Sie muss das, was sie macht, vor allem erklären können. Hierbei macht die Politik aber gelegentlich auch sogenannte Stockfehler, wie die Zypernkrise ebenfalls gezeigt hat. Es war von Anfang an eigentlich klar, das hätte den Finanzministern auch klar sein müssen, dass es eine Garantie für Guthaben der Bankkunden unterhalb von 100000 Euro gibt. Das ist ja nicht zuletzt auch das, was damals Frau Merkel und auch Peer Steinbrück öffentlich kommuniziert haben. Gut, man kann sagen, solche Stockfehler passieren unter extremen Belastungen. Aber das zeigt noch einmal, wie wichtig Erklärungen sind. Kölsch: Sie haben jetzt schon mehrmals diesen Vergleich Ost – West gebracht. Sie sind Professor an der Universität Halle-Wittenberg, stammen aber aus Nordrhein-Westfalen und haben sich in Bayern, genauer gesagt in Erlangen in Politischer Wissenschaft habilitiert. Danach sind Sie nach Halle-Wittenberg gegangen, d. h. Sie selbst haben einen relativen Systemwechsel vollzogen, indem Sie in eine Umgebung gegangen sind, die 40 Jahre lang vom Sozialismus geprägt war. Wie haben Sie das erlebt? Holtmann: Das war eine zunächst einmal weitgehend unvorbereitete Erfahrung. Für uns Politologen ist die deutsche Einigung genauso unerwartet gekommen wie für alle anderen Wissenschaftler. Es gab daher dafür keine Blaupausen in der Schublade, die man hätte nehmen und sie dann anwenden können – ganz abgesehen davon, dass sich das die Menschen in der dann ehemaligen DDR nicht hätten gefallen lassen. Das war im Rückblick und ohne jede Nostalgie doch eine sehr aufregende Zeit, weil eben auch viel Neues probiert werden konnte und musste. Das war ein Handeln unter Bedingungen der Unsicherheit, weil wir ja auch immer auf die nicht intendierten Folgen unseres Handelns achten mussten. Als Universitätsmenschen waren wir damals dabei freilich in einem ungleich bescheideneren Maße gefordert als beispielsweise Politiker. Kölsch: Sie sind wann nach Halle gegangen? Holtmann: Ich bin 1992 nach Halle gewechselt. Kölsch: Also ziemlich unmittelbar nach der Vereinigung. Holtmann: Ja, wobei aber spätestens zu diesem Zeitpunkt, und das wissen wir heute ja, gewisse Strukturentscheidungen fast schon abgeschlossen waren. Nehmen Sie z. B die Tätigkeit der Treuhand, die ja noch zu DDRZeiten von der ersten frei gewählten Volkskammer gesetzlich eingerichtet worden war. Die Treuhand war etwas, was auch die Bürgerrechtler der DDR als Begriff sympathisch finden konnten. 1992 waren die von der Treuhand zu verantwortenden Strukturentscheidungen ja schon weitgehend umgesetzt worden – mit den enormen Folgen und Umbrüchen, die das für die Menschen in der ehemaligen DDR hatte. Kölsch: Das war damals ja eine äußerst triste Umgebung, in die Sie da gekommen sind. Ich war 1990 selbst mal in Halle und auch in Wittenberg und habe mir das angesehen: Das war ja doch eine sehr graue Welt, die ganz nach "klassischer" DDR aussah. Holtmann: Ja, das stimmt auf der einen Seite. Wir hatten aber andererseits damals nicht so sehr viel Zeit, uns architektonisch zu orientieren. Halle hieß ja zu DDR-Zeiten aufgrund des fortschreitenden Verfalls die "Diva in Grau" und uns war schon auch klar, dass es in dieser Stadt ein ungeheures bauliches Potenzial gab. 20 Jahre später sieht es nun auch ganz anders aus als damals. Das hatte sich damals auch schon angekündigt, obwohl wir natürlich nicht wussten, wie lange das dauern würde. Die meisten Prognosen, wie sich eine Gesellschaft, die aus zwei Gesellschaften zusammenwachsen sollte, entwickeln würde, waren ja im Hinblick auf den Zeitkorridor viel zu optimistisch. Kölsch: Das heißt, das dauerte und dauert alles viel, viel länger, als damals alle gedacht haben. Sie haben dort dann auch irgendwann einmal einen Sonderforschungsbereich etabliert: Es liegt ja auch nahe, dass man als aus dem Westen stammender Politologie genau diesen Transformationsprozess untersucht. Holtmann: Ja, das haben wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Universität Jena über elf Jahre in eineinhalb Dutzend Teilprojekten interdisziplinär erforscht. Das war eine, wie ich meine, sehr fruchtbare Kooperation, die wir da gemacht haben. Wir haben allerdings erst zehn Jahre nach der Einigung damit angefangen, also zu einem Zeitpunkt, an dem wir vor allem über die langfristigen Folgen der Einheit forschen konnten. Kölsch: Was sind denn die wesentlichen Themen, Fragen und Ergebnisse, auf die Sie dabei gestoßen sind? Holtmann: Ein gut begründetes Arbeitsfeld war z. B. die Entwicklung von Arbeitsmarkt und Beschäftigung. Wir konnten dabei nachzeichnen, was die Zerschlagung und der Zerfall der großen DDR-Kombinate mit sich gebracht hat: nicht nur eine flächendeckende Deindustrialisierung vormals großindustrieller Gebiete, sondern auch den Wegfall einer ganzen Reihe von sozialen und wirtschaftlich wichtigen Funktionen. Die DDR-Kombinate waren damals, wie man sagen kann, so etwas wie ein "Mädchen für alles". Die frühere Arbeiterbewegung hatte ja den Spruch: "Du bist Mitglied in der Arbeiterbewegung von der Wiege bis zur Bahre." Das kann man in gewisser Weise analog auch auf die Funktionen eines großen Kombinats übertragen: Diese Kombinate waren ebenfalls für alles da: Das ging bis zum Schulbus für die Kinder. All das fiel dann natürlich weg mit dem Untergang der Kombinate und verstärkte neben dem ökonomischen Strukturbruch auch die Lebenssituation in einem verunsichernden Maße. Damit einher ging aber noch etwas, unter dessen Folgen wir bis heute als Marktwirtschaft leiden: Die betrieblichen Ausbildungsfunktionen wurden weitgehend abgebaut. Das heißt, man delegierte diese Ausbildungsfunktionen an den Staat, an den sogenannten zweiten oder dritten Arbeitsmarkt. Dies wiederum hatte langfristige Folgen, denn das macht sich derzeit in einem fast schon dramatisch steigenden Fachkräftemangel in der ostdeutschen Industrie bemerkbar, obwohl diese sehr viel kleiner strukturiert ist als die westdeutsche. Kölsch: Es ist ja so, dass sich die Menschen in den neuen Bundesländern bei den Wahlen ganz anders verhalten als die Menschen in den alten. Denn in den neuen Bundesländern gibt es eine Ostalgie, die nicht nur die älteren Menschen betrifft. Das, was Sie soeben von den Kombinaten gesagt haben, traf in gewisser Weise ja auch für die DDR als Staat zu: Es wurde für alles gesorgt. Genau das fiel dann aber weg. Die Menschen sehnen sich daher nach dieser Heimat, nach dieser Sicherheit usw. zurück. Bleibt das so oder gibt es da nun doch eine Entwicklung? Holtmann: Ich denke, das wird nicht so bleiben, wie es war und wie es ist, zumal ja die jüngere Generation in vielem doch eine deutlich gewandelte Einstellung hat. Sie hat z. B. auch ein tendenziell kritischeres DDR-Bild – wenn sie überhaupt ein DDR-Bild hat, wie man allerdings einschränkend hinzufügen muss. Denn hier gibt es in der Tat auch durchaus bedenkliche Informationsdefizite. Aber wenn die jüngere Generation ein DDR-Bild hat, dann ist das doch deutlich distanzierter als dasjenige der Erfahrungsgeneration der DDR. Das heißt, da bewegt sich etwas. Bestimmte Strukturschwächen und Strukturprobleme der Politiklandschaft in Ostdeutschland verlängern sich andererseits aber noch bzw. dauern noch an. Die politischen Parteien sind nach einem kurzen Aufschwung, bei dem sie so etwas wie einen Massenzulauf hatten, teilweise in die Marginalität abgeglitten. Die FDP war ja z. B. nach der Vereinigung der Partei in den Jahren 1990/91 für einige Monate sogar eine Massenpartei mit mehren 100000 Mitgliedern. Ende 1992 war sie das dann schon nicht mehr und war mit 60000, 70000 Mitgliedern im Grunde genommen komplett auf das Format des westdeutschen Standards zusammengeschrumpft. Die ostdeutsche Parteienlandschaft war also von Anfang an anders, und das nicht nur dadurch, dass es die PDS als SED-Nachfolgepartei gab. Die PDS stellte ja zunächst einmal diesen Sonderfall einer ostdeutschen regionalen Interessenpartei dar. Dann aber schaffte sie es eben doch auch in das gesamtdeutsche Parteiensystem. Die ostdeutsche Parteienlandschaft war also nicht nur wegen der PDS anders, sondern sie war auch deswegen anders, weil die aktiven Kerne der Parteien von Anfang an sehr viel kleiner gewesen sind. Es fehlten also die historisch gewachsenen Milieus, die in Westdeutschland nach 1945 die großen Volksparteien mit einer lange Zeit stabilen Trägerbasis und einem lange Zeit auch verlässlichen Personalreservoir ausgestattet hatten. Vereinfacht gesagt: die Gewerkschaften bei der SPD und ebenso vereinfacht gesagt, die Kirchen bei den Unionsparteien. Diese Milieu-gestützte Parteitradition war durch Abfolge von NS-Staat und dann DDR-Staat 55 Jahre lang nachhaltig unterbrochen worden. Deshalb waren die Parteien schon 1990 in ihrem Personalreservoir sehr viel bescheidener aufgestellt gewesen. Kölsch: Ich denke, einen Punkt muss man hier unbedingt auch erwähnen: dass gerade in diesem Teil Deutschlands, der langjährig kommunistisch gewesen ist, die Rechtsradikalen so viel Zulauf bekommen haben und auch weiterhin noch haben. In den neuen Bundesländern gibt es die einzigen Regionen in Deutschland, die tatsächlich ernsthaft mit diesem Problem zu kämpfen haben. Holtmann: Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann stellt man fest, dass das kein ostdeutsches Alleinstellungsmerkmal ist. Wenn man sich das mal in den 60er, 70er, 80er und 90er Jahren im Westen anschaut, dann sehen wir, dass die NPD und die Partei "Die Republikaner"(REP) in Westdeutschland in die Parlamente eingezogen sind: In BadenWürttemberg kamen die "Republikaner" sogar zwei Mal in Folge in den Landtag. Der Rechtspopulismus und der Rechtsextremismus ist also kein singulär ostdeutsches Problem. Gleichwohl sind Rechtsextreme im ostdeutschen Parteienspektrum auch und wegen der vergleichsweise schwächeren Ausgangsposition der demokratischen Parteien ein Faktor, der verstärkt ins Auge fällt. Wir kommen hier bei diesem Punkt vielleicht noch einmal auf den Anfang zurück: Das liegt eben auch daran, dass sich in Lebenslagen, die durch Verunsicherung und Zukunftsängste gekennzeichnet sind, die populistischen und in diesem Fall auch die rechtspopulistischen Angebote verschärft Geltung verschaffen können. Kölsch: Ist das etwas, das bleiben wird? Im Jahr 2019 wird ja die besondere Unterstützung der neuen Bundesländer auslaufen. Das heißt, nach 30 Jahren wird diese Gegend Deutschlands wirtschaftlich nicht mehr besonders gefördert werden. Möglicherweise wird dann in wirtschaftlicher Hinsicht sogar einiges wieder wegbrechen, was wiederum bedeutet, dass die Menschen dann noch stärker verunsichert werden, weil es noch weniger Arbeitsplätze geben wird. Das heiß, die Situation in den neuen Bundesländern wird dann noch schwieriger werden. Oder wird sich die dortige Situation in den noch verbleibenden sechs Jahren doch weitgehend konsolidieren? Holtmann: Das wird in der Tat eine sehr schwierige Gratwanderung sein. Die Politik ist sich parteiübergreifend im Grundsatz einig, dass es keinen Solidarpakt III – einfach nur als schlichte Verlängerung des Solidarpakts II – mehr geben kann und geben wird. Aber auf der anderen Seite wird es auch noch nach 2019 strukturelle Hilfen und Transferleistungen geben müssen. Ein Beispiel dafür: Die eigene Steuerkraft der ostdeutschen Gebietskörperschaften, also der Länder und der Kommunen, wird auch 2019 noch um etwa 30 Prozent hinter der von vergleichbaren westdeutschen Gebietskörperschaften zurückbleiben. Das heißt, es wird hier auch fürderhin ein strukturelles Gefälle geben. Unter solchen Bedingungen für die verfassungsrechtlich festgeschriebene Vergleichbarkeit der Lebensbedingungen zu sorgen, wird sehr schwierig sein. Das heißt, das wird Ostdeutschland auch noch nach 2019 nicht aus eigener Kraft stemmen können. Ostdeutschland wird das aber auch trotz zurückgenommener Transferleistungen ab dem Jahr 2019 nicht müssen, denn z. B. die EU-Hilfen werden nicht alle bis dahin ausgelaufen sein. Aber es wird schon jetzt darauf ankommen, und das machen ja auch jetzt die ostdeutschen Länder, die Haushalte zu konsolidieren, also – Stichwort "Schuldenbremse" – keine weiteren Schulden mehr aufzunehmen. Und es wird darauf ankommen, z. T. auch schmerzhafte und in ihren Folgen manchmal nicht vorausberechenbare Entscheidungen zu treffen. Wir diskutieren in Sachsen-Anhalt derzeit z. B. über drastische, um nicht zu sagen fast schon dramatische Kürzungen im Bereich des Hochschulsektors. Kölsch: Wenn man durch Ostdeutschland fährt, dann glaubt man das schier gar nicht, denn es gibt dort überall neue Straßen und wunderbar restaurierte Häuser. Das heißt, optisch ist das alles gar nicht so zu erkennen. Ich weiß aber nicht, wie es in den Menschen dort aussieht – das wissen Sie vielleicht besser. Ist dieser Transformationsprozess, diese quasi Verwestlichung, diese Selbstverständlichkeit einer westlichen Kultur in den Menschen selbst bereits angekommen? Holtmann: Es ist völlig klar und eindeutig, dass die Infrastrukturlücke, die es 1990 in Ostdeutschland gegeben hat, inzwischen so gut wie geschlossen ist. Hierüber gibt es auch unter den Experten keinerlei Dissens. Ebenso klar und eindeutig ist, dass sich die überwältigende Mehrheit der Ostdeutschen quer durch alle Schichten und Altersgruppen die DDR nicht zurückwünscht. Man ist also auch grundsätzlich angekommen im vereinten Deutschland. Aber wenn man auf die individuelle Ebene geht und wenn man sich vor allem auch sogenannte Problemregionen anschaut, die im gesamtdeutschen Maßstab immer noch durch überdurchschnittliche Formen der Abwanderung gekennzeichnet sind, also des demografischen Wandels, der sich eben auch in Westmobilität bemerkbar macht, dann stellt man fest, dass dort immer noch vergleichsweise viel Unsicherheit und Verunsicherung anzutreffen ist. Da mögen teilweise auch Depression, Lethargie und Gleichgültigkeit vorhanden sein. Wir erforschen das ja z. T. auch, denn wir fragen, wie Menschen unter solchen Bedingungen gewissermaßen ihre eigenen persönlichen Entwicklungsguthaben einschätzen und an was sie das festmachen und ob und inwieweit sie unter vielleicht auch manchmal prekären Bedingungen doch in der Lage sind, so etwas wie Optimismus zu entwickeln. Denn auch dafür gibt es, glücklicherweise, wie man sagen kann, nicht nur vereinzelte Anhaltspunkte. Kölsch: Nun ist ja das Thema "Politik", um unser Gespräch auch mal wieder auf Gesamtdeutschland zu beziehen, doch eine große Herausforderung: sowohl für die praktische Politik und die Politiker wie vielleicht auch für die Politologen, die da Anregungen und Handreichungen geben können bzw. könnten. Wohin sollte man sich denn politisch entwickeln, um diese vorhin schon erwähnten und für Gesamtdeutschland geltenden Defizite im Hinblick auf die politischen Parteien abzubauen? Sollte es auch bei uns so etwas wie Urwahlen geben oder gar Primaries? Holtmann: Man kann ein Stück weit versuchen, das durch innerparteiliche Flexibilität aufzufangen. Sie haben die Stichworte dafür bereits genannt. Aber wenn man sich das genauer anschaut, dann ist das ja fast schon grotesk. Es ist nämlich nicht so, dass die sogenannten etablierten Parteien gewisse Sperren gegenüber Neumitgliedern oder potenziellen Interessenten aufrichten würden. Im Gegenteil, sobald jemand kommt und seine Nase in die viel verschrienen Hinterzimmer der Ortsvereinssitzungen steckt, schlägt ihm eine Art von Erwartungshaltung entgegen: Man serviert ihm gewissermaßen bestimmte Parteifunktionen und -ämter auf dem Tablett. Das macht man schlicht auch deswegen, weil nur so wenig Leute da sind, die das machen wollen. Das ist natürlich auch eine Chance für Jüngere. Und wenn wir uns die Daten der Parteimitgliederstatistik anschauen, dann stellen wir fest, dass zwar auf der einen Seite immer noch – wenngleich in den letzten Jahren in abgeschwächter Form – die Gesamtzahl der Parteimitgliedschaften zurückgeht. Bei den Grünen ist sie relativ stabil, die Piraten haben einen relativ kurzen Aufschwung erlebt, sind aber inzwischen auch wieder vergleichsweise zurückgestutzt worden. Aber wenn man das mal nach Generationen, nach Altersgruppen aufschlüsselt, dann erkennt man, dass in den letzten drei, vier Jahren bezogen auf die Gesamtmitgliedschaft prozentual doch wieder vermehrt jüngere Leute in den Parteien aktiv werden, jüngere Männer wie Frauen. Denn auch das ist ja noch ein weiterer Punkt: Die deutschen demokratischen Parteien leiden ja, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung, nach wie vor auch an einer zumindest numerischen Dominanz der Männer. Kölsch: Der Parteienkritiker Hans Herbert von Arnim hat nachgewiesen, dass die Parteien im Wesentlichen entscheiden, wer bei uns im Land Machtpositionen einnimmt, d. h. die Bevölkerung hat ja nicht ganz zu unrecht dieses Ohnmachtsgefühl: Die Bevölkerung kann zwar wählen, aber nur das, was ihr von den Parteien serviert wird. Denn man kann ja noch nicht einmal die Liste verändern – zumindest nicht bei Landtagsund Bundestagswahlen. Das heißt, die Parteien behalten sich hier sehr viel Machtkompetenz im eigenen Bereich. Holtmann: Ich glaube, das sind eigentlich zwei Punkte, die Sie da ansprechen. Da gibt es auf der einen Seite die Frage, ob man die Listen bei Landtagsoder auch Bundestagswahlen etwa nach dem Beispiel der bayerischen Kommunalwahlen flexibilisieren sollte, ob man also innerhalb der Liste einer Partei häufeln könnte und damit auf die Reihung Einfluss nehmen könnte. Darüber kann man diskutieren. Aber ich möchte hier zu bedenken geben, dass diese Landeslisten der Parteien – die ja nebenbei auch demokratisch legitimiert sind, weil sie auf Parteitagen diskutiert und abgestimmt werden, nachdem die Ortsvereine ihre entsprechenden Vorschläge gemacht haben – auch den Zweck haben, für die Parteiarbeit, für die Fraktionsarbeit unverzichtbaren Experten sichere Plätze zu geben. Es braucht in einer Fraktion eben auch den Haushaltsexperten oder die Verkehrsexpertin usw. Wenn das alles dann aber total durcheinander geworfen wird und solche Experten nicht zum Zuge kommen, dann kann das eben nachteilige Folgen für die Fraktionsarbeit haben. Und genau das kann dann wiederum beim Bürger den Eindruck erwecken, dass die Politiker im Bundestag und in den Landtagen nichts taugen, weil sie nichts zustande bringen. Das heißt, auch dieser Vorschlag hat, wie so häufig, zwei Seiten. Nun noch eine Bemerkung zu diesem vielberufenen Popanz der Parteipatronage, also zur Ansicht, es seien die Parteien, die ihre Leute in die Machtpositionen bringen. Wir haben empirische Studien darüber und diese Studien zeigen sehr nüchtern, dass Parteipatronage, also die Förderung eines Parteimitglieds, heute nicht möglich ist, ohne dass es sich zumindest um entsprechende professionelle Kandidaten handelt. Die Vorstellung, dass da altgediente Funktionäre, die 30 Jahre lang sozusagen ihre Marken geklebt haben, aber von der Sache überhaupt keine Ahnung haben, mit irgendwelchen Austragsstüberl-Posten in Wohnungsgesellschaften oder wo auch immer versorgt werden, ist empirisch nicht haltbar. Wir wissen das, wie gesagt, aus empirischen Studien, die z. B. von unseren Düsseldorfer Kollegen gerade neu gemacht worden sind: Professionalität, d. h. die sachkundige Qualifikation, ist auch dort unabweisbar, wo Parteien sozusagen einen politischen Zugriff auf die Ämter haben. Kölsch: Um das gegen Ende unserer Sendung noch einmal ein wenig zusammenzufassen: Wir leben also politisch gesehen in der besten aller möglichen Welten? Holtmann: Mit dieser Behauptung würde ich nicht unbedingt d'accord gehen wollen, denn das hieße ja, dass wir uns ab sofort unsere kritischen Anmerkungen versagen und verkneifen müssten. Nein, so ist das nicht, und es ist ja auch gut so, dass darüber immer wieder diskutiert wird. Aber aus solchen Diskussionen entstehen dann ja auch konstruktive Vorschläge. Und genau das macht ja nicht nur gesellschaftlichen, sondern auch politischen Wandel aus. Kölsch: Und diesen sehen Sie in einer konstruktiven Weise in unserem Lande gegeben. Holtmann: Es gibt zumindest viele Kräfte und Faktoren, die diesen Wandel kritisch begleiten und auch konstruktiv vorantreiben. Nehmen Sie z. B. die Tatsache, dass es die Bundesrepublik, wenn man das in längeren Zeiträumen betrachtet, ja mehr als einmal vermocht hat, zunächst einmal systemoppositionelle Parteien wie z. B. die Grünen oder auch die Linkspartei in das etablierte Parteiensystem zu integrieren. Das zeigt ja doch eine bemerkenswerte Anpassungs- und auch Reformfähigkeit unseres Parteiensystems. Kölsch: Um den Anfang noch einmal aufzunehmen: Demokratie ist eine schlechte Regierungsform – ausgenommen alle anderen. Insofern ist zwar vieles ärgerlich, aber eben auch letztlich das beste Mögliche, was wir haben können. Herr Professor Holtmann, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, auch Sie haben aus dieser Lehrstunde für die Demokratie ein wenig für sich profitieren können. Vielen Dank fürs Zuschauen. © Bayerischer Rundfunk