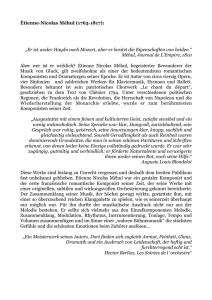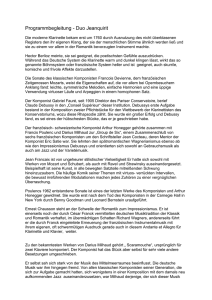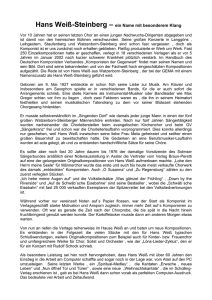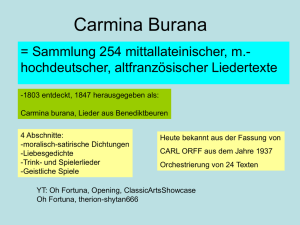NZfM 04/05 Teil 1
Werbung

die technik, der neue akademismus von konrad boehmer f e t i s c h Einer der Gründe für den letztendlichen Untergang der Sowjet-Union war ihr undialektischer Glaube an technischen Fortschritt. Um den Kapitalismus – namentlich den dynamischen amerikanischen – überholen zu können, wurden in rasendem Tempo moderne Fabriken gebaut und mit einem Maschinenpark versehen, dessen Modelle aus den USA importiert oder abgekupfert waren. Was hierbei vollkommen außer Acht gelassen wurde, war, dass die Struktur der gesam- ten Technologie, wie sie in den USA von Ford und Taylor vorgezeichnet war, den avanciertesten kapitalistischen Produktionsformen und somit auch Herrschaftsverhältnissen perfekt entsprach. Und so entstand schon zu Stalins Zeiten die totale Schizophrenie eines Staatsapparats, der den Sozialismus propagierte, selbst jedoch schon längst kapitalistische Verhältnisse eingeführt hatte. Der Name der paranoiden Schizophrenie: Staatskapitalismus. 18 u n d Eine andere Perspektive. Kürzlich berichtete der amerikanische Wissenschaftsphilosoph Daniel C. Dennett eine amüsante Anekdote : «Vor einigen Jahren nahm ich in England an einer Konferenz über cognitive robotics teil, die durch British Telecom gesponsert war. Warum? Weil dieser Betrieb ein fabelhaft kompliziertes Netzwerk entwickelt hat, welches es selber nicht mehr versteht. Man wollte untersuchen, ob es möglich sei, einen Roboter zu entwickeln, der foto: rolf w. stoll thema p r i e s t e r t r u g menschlich genug wäre, um mit uns zu kommunizieren und gleichzeitig genug Computer, um das Netzwerk verstehen zu können. Dass sie dieses Thema wichtig genug fanden, um ein paar Tage darüber zu reden, weist darauf hin, dass man sich unbehaglich fühlt über das Ausmaß, in dem man seine eigenen Erfindungen noch beherrschen kann.» Beide Beispiele konvergieren in demselben Schluss: Es gibt keine Technologie ohne gesellschaftliche Implikationen. Umgekehrt: Jede Technologie zeugt gesellschaftliche Verhältnisse. Auch dann, wenn ihre Adepten sich einbilden, diese fänden nur im Kopf statt. Wo die Folgelogik von Technologie nicht mehr verstanden wird, setzt man neue Technologie obendrauf. Nicht anders verhält es sich mit der musikalischen Technologie. Wo sie – als Beherrschungsform des Materials durch den Komponisten – gewissermaßen direkt auf das 19 ästhetische Resultat einwirkt, erzeugt sie unmittelbar gesellschaftliches Verhalten (Konzertbesuch, Tanz, Gefühle, Musikwissenschaft), wiewohl dem Komponisten, der solcherlei verursacht, oftmals nicht bewusst ist, wieweit er Teil dessen ist, was er da lostritt. Dieser Komponist ist traditionell und von vornherein abhängig von einer Technik, die er zu bedienen anweist, die er jedoch selber nicht beherrscht: der des Instrumentenbaus. Doch unterliegt auch dieser den Normen derselben Technik, die auch der Komponist beherrscht. Zumindest war das so seit dem Beginn der europäischen Kunstmusik vor etwa einem Jahrtausend. Das Verhältnis von Komponist und Technik hat sich in jüngerer Zeit grundlegend geändert; seine gesellschaftlichen Implikationen jedoch nicht im Geringsten. Was in die historische Entwicklung der Musik einging, war schon auf Musik zugeschnittene Technik, wohingegen die Technologie der jüngsten Zeit gewissermaßen von außen an sie herangetreten ist. Wo einst die Technik dem folgte, was gewissermaßen über die avanciertesten Kompositionen hinausschoss, erfindet heutige Technologie zahllose Verlockungen, denen (auch) der Komponist hinterherläuft, sich darin in nichts vom allgemeinen gesellschaftlichen Trend unterscheidend. Das Heil rast der Heilsbotschaft ewig voraus, wie der Igel dem Hasen. Seinen Grund mag das in der naiven positivistischen Wissenschaftsgläubigkeit mancher junger Komponisten nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben, doch darf man die damals neuen musikalischen Vorstellungen von Klangkompositon nicht unterschätzen. Das Problem ist nur, dass diese nicht ihre eigene Technologie hervorgebracht haben, sondern dass diese eine eigene Dynamik neben – oder: über – den musikalischen Problemstellungen entwickelt hat. Schon in den Kinderjahren der elektrischen Muse ergab sich aus diesem Zwiespalt eine Arbeitsteilung wie sie Don Quixote und Sancho Pansa nicht besser sich hätten ausdenken können. Wo der Komponist – beflügelt von hehren Ideen – im Studio verzweifelte, nutzte der Techniker, der sich in allen Knöpfen und Schiebern brillant auskannte, die frei gekommenen Stunden, um selber zu komponieren. So hat sich im neuen Genre ein gigantischer Berg von – oftmals brillant realisierten – Stücken angesammelt, die in Konzerten, Sendungen oder Festivals einen wahrhaften Feldzug gegen ästhetisch interessante Kompositionen antraten. Substanziell hat sich daran mit dem Einzug digitaler Techniken nichts geändert. Im Gegenteil: Der Vorsprung verlagerte sich in die Richtung derjenigen, die sich – was ja mit musikalischem Denken nichts zu tun hat – zu Architekten von Programmen, Soft- oder Hardware spezialisiert haben. Dass diese Konfigurationen in Hinsicht auf musikalische Produktion ent- wickelt wurden, steht außer Zweifel. Doch ist gerade dies einer der Gründe dafür, dass der Komponist zu einer doppelten Abhängigkeit von ihnen gehalten ist. Es ist nicht nur die Abhängigkeit von einer Logistik, die keinerlei musikalische Implikationen enthält, sondern es geht auch um die Zuspitzung dessen, was sich durch die gesamte Geschichte der musikalischen Komposition seit mehr als 50 Jahren hindurchzieht: das Auseinanderklaffen kompositorischer Arbeit und materialorganisatorischer Anstrengungen. Je avancierter die Technik, umso mehr ist der Komponist dazu gezwungen, sich diesen organisatorischen Techniken zu widmen. Sofern er überhaupt eins hat, hat jedoch auch der Komponist nur ein Gehirn. In dem Maße, in dem dieses durch technisch-organisatorische Probleme absorbiert wird, wird der Raum für die Entwicklung der eigentlichen kompositorischen Arbeit immer geringer. Und aus dem Fenster, in die Welt hinein, schaut ohnehin keiner mehr. Der zunehmende Konformismus der Resultate, der immer krassere Widerspruch zwischen technischer Eleganz und absolutem Mangel an kompositorischem Vorstellungsvermögen, zeugen von einer Tendenz, die – wie Pierre Bourdieu es für neue Kunst insgesamt analysierte – auch das Feld der elektrischen Muse soweit einengt, bis seine Urheber ihr ausschließliches Publikum werden. Kein Mensch außer ihnen selbst ist interessiert an – wenn auch perfekten – akustischen Demonstrationen, die vielleicht den neuesten Stand von Technologie unter Beweis stellen, nicht jedoch irgend einen Stand musikalischen Denkens, – und die oftmals wie ihre eigenen Lehrbücher oder Gebrauchsanweisungen klingen. Wo die Vernarrtheit in technische Aspekte der elektrischen Musik dahin führt, mathematische oder naturwissenschaftliche Modelle naiv 1:1 auf Musik zu übertragen – selbst dafür haben die Amerikaner einen neuen Begriff gefunden, das schauderhafte Wort «sonification» – wird die musikalische Regression erschreckend evident. Als das vor etwa 20 Jahren mit dem Fetisch der «Fractals» einsetzte, tanzten plötzlich leere Quinten und Oktaven in die elektrische Musik hinein, die wie avanciertes Gregorianisch zu klingen begann. Hochgestochener Formelkram als Deckmantel ästhetischer Regression … 20 Es geht nicht im Geringsten darum, die Technik zu dämonisieren, sie – wie Heidegger – zu einem «Gestell» zu erklären, oder – wie Deleuze – zu einem «organlosen Körper», die uns schicksalhaft umfassen. Solcherlei kindische Metaphern tragen zur Lösung der wirklichen Probleme nicht das Geringste bei. Deren Kern liegt, wie Pierre Schaeffer schon vor etwa 40 Jahren feststellte, in einem Widerspruch, den es mehr denn je zu meistern gilt: Er wurzelt in jenem neuen «wissenschaftlichen» Paradigma, welches die Musik seit einem halben Jahrhundert besetzt. Schaeffer hat die beiden Seiten dieses Widerspruchs in den Figuren des «Akustikers» (des Wissenschaftlers) und des «Musikers» (des Künstlers) personifiziert, die, wenn sie beide denselben Klang hören, dies auf vollkommen unterschiedliche Weise tun. Wo der Akustiker ihn ‹reduktionistisch› hört und zwar in Hinsicht auf dessen Quantifizierung, hört der Musiker ihn ‹morphologisch› in Hinsicht auf seine musikalische Relevanz. Der Widerspruch wird zur Kluft, wenn der Wissenschaftler eine Armada technischer Funde und Geräte in Richtung des Komponisten schiebt, die dieser nur allzu leichtfertig für die Sache selbst hält. Er sieht dabei weder die Nivellierungstendenzen, die sich unmittelbar in den Stücken niederschlagen, noch deren Ursache: Alles, was er verwendet, hat seine eigene, vorgegebene Struktur, aus der sich nur befreien kann, wer sie zuvor gründlich durchschaut hat. So einfach ist das nicht, denn diese Struktur ist selbst nur Teil einer viel umfassenderen gesellschaftlichen Wirklichkeit, die weit über musikalische Angelegenheiten hinausgreift und von der man wahrhaftig nicht mehr behaupten kann, sie stünde uns gegenüber: Wir leben mittendrin. Es mutet an, als lebten wir im Würgegriff von Technokraten, die unsere Welt zur Stromlinienform verengen und von Intellektuellen, die sie zerreden. Gesellschaftliche – also auch technische – Strukturen implizieren Handlungsformen, und diese wiederum bestimmen das Resultat der Handlungsabläufe, das Produkt. Auch das Ästhetische. So mündete etwa die Struktur der mittelalterlichen «Modalität» in zahlreiche fromme Traktate, … … mehr erfahren Sie in Heft 4/2005