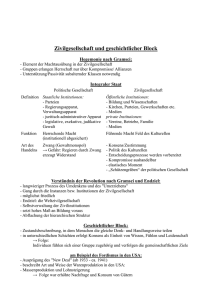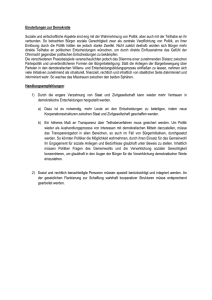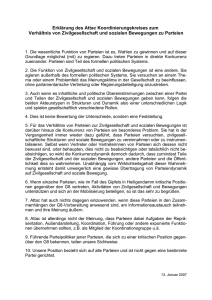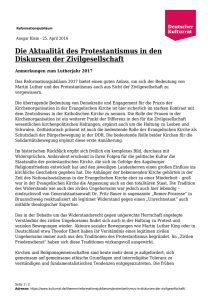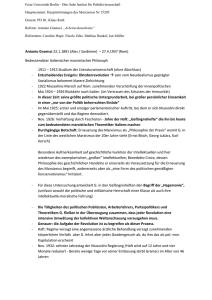The good, the bad and the ugly
Werbung

# 2000/39 Dossier https://www.jungle.world/artikel/2000/39/good-bad-and-ugly Bürger, reih' dich ein The good, the bad and the ugly Von roland atzmüller Normativ-moralisch, kritisch-materialistisch oder ganz anders? Zur Zivilgesellschafts-Diskussion in Österreich. I. Als vor einigen Wochen die so genannten Drei Weisen der EU Österreich besuchten, um die Aktivitäten der Regierung zu untersuchen und das Wesen der FPÖ zu ergründen, wurde mit Nachdruck, zu diesem Zeitpunkt aber vergeblich, von der liberalen Öffentlichkeit gefordert, die Weisen mögen sich doch auch mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft treffen. Damit war aber offensichtlich nicht gemeint, dass die Experten der EU an der wöchentlichen Donnerstags-Demo oder vielleicht an der nächsten, für Herbst geplanten Großkundgebung teilnehmen sollten. Damit war noch weniger gemeint, dass es den DemonstrantInnen zu gestatten sei, zum Hotel, in dem die Weisen untergebracht waren, vorzudringen. Im Gegenteil wurden sie von einem massiven, wenn auch relativ zurückhaltenden Polizeiaufgebot daran gehindert, den EU-ExpertInnen ihre Meinung zur neuen Regierung und zum Wesen der FPÖ kundzutun. Auch die liberale Öffentlichkeit war wohl der Meinung, dass die Drei Weisen vor zuviel Zivilgesellschaft zu schützen seien. Gestört hat das wie immer nur die üblichen Verdächtigen, die »radikalen und gewaltbereiten Extremisten«, die sich ja angeblich zunehmend - sicher aus dem Ausland kommend, mit Fahrrädern und Kinderwagen - unter die DemonstrantInnen mischen. VertreterInnen der Zivilgesellschaft wurden vor der Fertigstellung des Berichts der Weisen schließlich doch noch angehört, mussten zu diesem Zweck aber nach Heidelberg reisen. Gegen die prinzipiell positive Beurteilung der neuen Regierung konnten sie, anscheinend mit Ausnahme der im Bericht geäußerten Kritik an Justizminister Dieter Böhmdorfer und dessen Klagen gegen FPÖ-kritische Intellektuelle, wenig ausrichten. Um den Begriff der Zivilgesellschaft fokussieren und polarisieren sich wichtige inhaltliche und strategische Fragen und Deutungskämpfe zur außerparlamentarische Opposition gegen die FPÖVP-Regierung. Das Ziel ist es, gewisse Absichten und Praxisformen, gewisse Identitäten und soziale Verortungen vorzugeben oder sie abzuwehren. Im Diskurs um Widerstand und Zivilgesellschaft, in den unterschiedlichen theoretischen Bezügen, die dabei hergestellt werden, konzentrieren sich daher strategische Fragen der außerparlamentarischen Opposition gegen Blau-Schwarz. Wegen der Vielstimmigkeit der verwendeten Konzeptionen, also weil immer mehr Personen und Gruppen sich darauf bezögen, sieht etwa Oliver Marchart im Zivilgesellschaftsbegriff einen neutralen oder inhaltsleeren Signifikanten (Marchart 2000, 18). Daher sei die dominante Verwendung des Zivilgesellschaftsbegriffs in der »medialen Öffentlichkeit« als Deutungsgewinn zu sehen. Zivilgesellschaft »wird (...) als Kampfbegriff, als Slogan eingesetzt, mit dem immer gerade die ðfreieÐ, d.h. parteiungebundene Opposition zur Regierung bezeichnet werden soll« (ebda., 17). Kurz, er bezeichnet als »politischen Kampfbegriff« »alles, was der Regierung entgegensteht und durch sie negiert wird« (ebda., 18). Dieses vorgeblich neutrale Verständnis der Zivilgesellschaft unterliegt einer in letzter Konsequenz instrumentellen Konzeption politischer Begrifflichkeit. Der Begriff der Zivilgesellschaft wird nicht etwa wegen seinen kritischen oder rationalen Gehalts, sondern weil sich eine Kette politischer Positionen, Gruppen und Forderungen damit verbindet und v.a. verbinden soll. Kriterium für die Relevanz des Begriffs wird der Deutungserfolg in der medialen Öffentlichkeit, welche von den Intellektuellen der Bewegung mit größerem normativen und demokratiepolitischen Potenzial zu füllen sei (ebda). Zivilgesellschaft erscheint als eine Deutung des Widerstandes, die von einigen »großen« Intellektuellen und Organisationen der so genannten freien Opposition aufbereitet und von der medialen Öffentlichkeit (und den Grünen) gern aufgenommen wurde. Gerade in den kritischen Positionen wird hingegen diese Definitionsmacht angezweifelt und es wird gegen Medien und öffentliche Redner um eine eigenständige Sprechposition gestritten. Die vielfältigen Initiativen und deren AktivistInnen sehen sich gerade auch in ihren Auftritten im Internet, in Printmedien oder auf Kulturveranstaltungen aller Art als Widerstand oder Résistance, wie diffus und unklar diese Begriffe im Einzelnen auch immer verwendet werden. Wenn überhaupt von einem Bedeutungsgewinn gesprochen werden kann, dann gilt er für den Widerstandsbegriff, auf den sich in Österreich wohl noch nie so viele positiv bezogen haben. Ein näherer Blick auf verschiedene theoretische Positionen zum Zivilgesellschaftsbegriff und ihre strategischen Implikationen für den Widerstand gegen Blau-Schwarz erscheint somit notwendig. Grob gesprochen stehen sich zwei Konzeptionen gegenüber: eine normativ-moralische, die sich an modernen Demokratie-Theorien orientiert, und eine kritisch-materialistische, die sich auf Antonio Gramsci beruft. Insbesondere in der Kunstund Kulturszene, um die sich große Teile des Widerstandes organisieren, zeigt sich außerdem der Einfluss der postmarxistischen Konzeptionen von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (vgl. Laclau/Mouffe 1991; Laclau 1990). Ihr Theorieprojekt wird dazu verwendet, sich mit den normativ-moralischen Fassungen des Zivilgesellschaftskonzept als offensives Projekt so genannter radikaler Demokratie zu verknüpfen. II. Ernesto Laclau und Chantal Mouffe (1991) beabsichtigen eine Radikalisierung des Hegemoniebegriffs, um für die Linke die Möglichkeit neuer Strategien zu eröffnen. Dazu wollen sie neue soziale Bewegungen und pluralisierte Lebensstile durch eine adäquate Theoretisierung des Gesellschaftlichen in ein Projekt radikal-demokratischer linker Politik einbetten. Insbesondere Ernesto Laclau führte damit eine Argumentation an ihr logisches Ende, die sich bereits in seinen ideologie-theoretischen und politisch-strategischen Arbeiten der siebziger Jahre abzeichnete (vgl. ebda. 1981). Darin wandte er sich gegen klassen-reduktionistische Konzeptionen von Ideologien, die ökonomisch definierten Gruppen bestimmte Bewusstseinsformen und Interessen zuschrieben. Dies war nicht nur problematisch, weil das Proletariat sich nur selten nach seinen vorgeblich objektiven Interessen verhielt, sondern weil sich darin auch ein strategisches Hindernis für eurokommunistische Parteien auftat, die neuen Mittelschichten einzuschätzen und für eine sozialistische Transformation zu gewinnen (vgl. Meiksins-Wood 1986). Daher entwickelte er ein Konzept »popular-demokratischer« Ideologien, die quer zu den sozialen Klassen - und wie zu ergänzen wäre: rassistischen und patriarchalen Verhältnissen - liegen und Individuen eher als »Volk« (im Gegensatz zum Machtblock) ansprechen würden. Da diese Ideologien kein wie auch immer vermitteltes Verhältnis zu grundlegenden gesellschaftlichen Verhältnissen hätten, seien sie autonom und unabhängig. Sie könnten daher aus hegemonialen Artikulationen gelöst und für ein emanzipatorisches Projekt verwendet werden. Dadurch würden sie abstrahiert, ihrer besonderen gesellschaftlichen und historischen Inhalte entleert und zu Propositionen universeller Ausrichtung (vgl. Meiksins-Wood 1986, 51) gemacht. Dies führte die Möglichkeit neutraler gesellschaftlicher Phänomene in die marxistischen Diskussionen, die etwa in den Diskussionen zum Staat kritisiert worden war, wieder ein. Diese Überlegungen erweiterten den Raum für ideologische Auseinandersetzungen immens. Jedoch blieb die Bedeutung sozialer Widersprüche jenseits der Sphäre des Diskursiven und damit die Frage nach dem Bewusstsein und der Organisation etwa der ArbeiterInnenklasse, so denn diese klar zu identifizieren ist, für emanzipatorische Politik noch unangetastet. Mitte der achtziger Jahre führten Laclau und Mouffe diese Überlegungen zu ihrem logischen Ende. Fokus dieses theoretischen Konzepts wurde eine Radikalisierung des Hegemoniebegriffs von Antonio Gramsci, die vor allem darin bestand, ihn aus seinem Verhältnis zur Organisation der gesellschaftlichen Arbeit zu lösen und zu einer allgemeinen Erscheinung von Gesellschaftlichkeit zu machen. Hegemonie ist für sie »ganz einfach ein politischer Typus von Beziehung, eine Form (...) von Politik« (ebda. 1991, 198). Essenzialistische Konzeptionen von Gesellschaft, wie sie etwa dem Marxismus oder dem Feminismus zu Eigen seien, werden zurückgewiesen. Denn sie versuchten, die Kritik und Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse einem totalisierenden Verständnis von Gesellschaftlichkeit zu unterwerfen, weil sie diese aus einem vereinheitlichenden Prinzip (Logik des Kapitals, Klassenkampf, Patriarchat ...) begründen. Dagegen betonen Laclau und Mouffe den konstitutiv offenen und vorübergehenden Charakter des Gesellschaftlichen. Es bestehe aus frei fließenden Elementen, die erst in der stets vorläufigen und unvollständigen Artikulation - also Verknüpfung - zu bedeutungsvollen Momenten von Diskursen werden können. Keinem Moment eines Diskurses kommt daher eine essenzialistische Bedeutung jenseits seiner kontingenten Verknüpfung mit anderen zu. Damit soll sich ein weites Feld der politischen Auseinandersetzungen um die jenseits ihrer Einbettung unbestimmten sozialen Elemente eröffnen. Hegemonie ist daher jenes politische Prinzip, das wirksam werden kann, wenn der unvollständige und offene Charakter des Gesellschaftlichen als grundlegend angesehen wird und dieses als ein von Antagonismen durchzogenes Feld gegeben ist. Hegemoniale Praxen entstehen für Laclau/Mouffe in der antagonistischen Artikulation einander gleichzeitig bedingender wie ausschließender Prozesse. »Die beiden Bedingungen einer hegemonialen Artikulation sind also einmal die Präsenz antagonistischer Kräfte und zum zweiten die Instabilität der sie trennenden Grenzen. Nur die Präsenz eines weiten Bereichs flottierender Elemente und die Möglichkeit ihrer Artikulation zu entgegengesetzten Lagern - was eine beständige Neudefinition der letzteren impliziert konstitutiert das Terrain, das uns erlaubt, eine Praxis als hegemonial zu definieren.« (Laclau / Mouffe 1991, 194) Ihre Position in »Hegemonie und radikale Demokratie« ist nicht eindeutig, da mitunter diese Fassung des Sozialen als Eigenschaft der bürgerlichen Gesellschaft im Allgemeinen oder ihrer Krisen im Besonderen erscheint. Laclau/Mouffe müssen jedoch ihr Verständnis des Gesellschaftlichen, auf dem ihr Hegemoniebegriff beruht, überhistorisch verallgemeinern, um die Dekonstruktion totalisierender Positionen des Gesellschaftlichen begründen zu können. Würden sie ihr Verständnis des Gesellschaftlichen etwa auf die bürgerliche Gesellschaft beschränken oder als Ergebnis evolutionärer Prozesse darstellen, wären sie im historischen Sinne höchst spezifisch und voraussetzungsvoll. Das würde die Frage aufwerfen, womit die grundlegende Offenheit und Unvollständigkeit, die Multiplizierung des flottierenden Systems von Identitäten des Gesellschaftlichen zusammenhängt. Dieser Frage wollen Laclau/Mouffe aber nicht nachgehen, da sie durch die Pluralisierung des Sozialen die Unmöglichkeit einer totalisierenden und privilegierten Position einer Gruppe und eines gesellschaftlichen Widerspruchs begründen wollen. Emanzipatorische Kämpfe sollen daher nicht ihre Problemlagen in grundlegenden sozialen Herrschaftsverhältnissen, sondern in der Artikulation bestimmter Diskurse in einer prizipiell offenen Gesellschaftlichkeit finden. Da der Relativismus dieser Argumentation Gefahr läuft, emanzipatorische Projekte kollabieren zu lassen, wird die Rekonstruktion einer Linken im Begründungszusammenhang der bürgerlichen »demokratischen Revolution« verortet, durch deren stets überschießendes Moment gesellschaftliche Antagonismen erst als Unterdrückung erkennbar würden. Laclau/Mouffe empfehlen der Linken ein Konzept radikaler Demokratie, das darauf zielt, die liberal-demokratische Ideologie auszuweiten und zu vertiefen (vgl. ebda., 240). Sie wollen ganz sozialdemokratisch mehr Demokratie wagen, blenden aber die Frage aus, inwieweit dies einen qualitativen Bruch mit dominanten Vergesellschaftungsmustern bürgerlicher Gesellschaften bedeuten würde. Da ein Zusammenhang zwischen emanzipatorischen Bewegungen und sozialen Verhältnissen abgelehnt wird, bleibt unklar, warum das Interesse an »radikaler Demokratie« entstehen könnte. Die postmarxistische Konzeption erscheint somit als voluntaristisch. Da auch nicht klar ist, ob die behauptete Offenheit des Sozialen einen Ist- oder einen Sollzustand beschreibt, ist sie auch als normativ einzuschätzen. Es ist daher offensichtlich, weshalb der Brückenschlag zu normativ-moralischen Zivilgesellschafts-Diskussionen so leicht gelingt. III. Der normativ-moralische Zivilgesellschafts-Diskurs gewann insbesondere in den achtziger Jahren an Aktualität. Er speist sich aus mehreren theoretischen wie politisch-praktischen Bezügen. Im deutschsprachigen Raum muss besonders auf Jürgen Habermas und die demokratie-theoretischen Arbeiten des Frankfurter Institutes für Sozialforschung (vgl. Rödel et al. 1989; kritisch Demirovic 1997) verwiesen werden. Zu nennen sind aber auch die im angelsächsischen Raum bedeutsamen kommunitaristischen Diskurse, die auf eine Kritik des radikal-individualistischen Liberalismus und der Herrschaft des ungezügelten Marktes abzielen. Dem stellen sie eine Rekonstitution des sozialen Gemeinsinns und eine moralische Erneuerung auf der Basis von Familie, Gemeinschaft und solidarischen Bindungen entgegen (vgl. Hirsch 1995). Auf der politisch-praktischen Ebene ist auf das Selbstverständnis von und die theoretische Auseinandersetzung mit den osteuropäischen DissidentInnenbewegungen und den zivilen demokratischen Bewegungen in den lateinamerikanischen Militärdiktaturen zu verweisen (vgl. Habermas 1992). In der links-liberalen Demokratie-Debatte erscheinen auch die Neuen Sozialen Bewegungen als westeuropäische Ausdrucksform der Zivilgesellschaft (vgl. Rödel et al. 1989). Die normativ-moralischen Diskurse definieren sich daher explizit als eine Selbstkritik der Linken. Sie habe ihre Lektion gelernt und sich von totalisierenden Gesellschaftkonzeptionen und der damit verbundenen Bedrohung bürgerlicher Freiheiten und gesellschaftlicher Pluralität abgewendet. Im normativ-moralischen Verständnis wird mit der Zivilgesellschaft auf alle Institutionen und Assoziationen jenseits des Staates und der traditionellen, bürokratischen Organisationen politischer Willensbildung und Entscheidungsfindung (Parteien, Verbände ...) verwiesen - auch wenn die Zuordnungen dabei mitunter verschwimmen. »Die Zivilgesellschaft setzt sich aus jenen mehr oder weniger spontan entstandenen Vereinigungen, Organisationen und Bewegungen zusammen, welche die Resonanz, die die gesellschaftlichen Problemlagen in den privaten Lebensbereichen finden, aufnehmen, kondensieren und lautverstärkend in die politische Öffentlichkeit weiterleiten.« (Habermas 1992, 443) Dadurch erweitern sie den Raum des Demokratischen und schaffen indirekt problemlösende Kompetenzen zur Steigerung gesellschaftlicher Rationalität. Zivilgesellschaftliche AkteurInnen nutzen diesen Raum nicht nur offensiv, um Einfluss, etwa im parlamentarischen System, zu gewinnen. Sondern sie sind auch - defensiv daran interessiert, Strukturen der Öffentlichkeit zu rekonstituieren und zu erhalten, also subkulturelle Gegenöffentlichkeiten und Gegen-Institutionen zu erzeugen und neue kollektive Identitäten zu festigen (ebda., 448). »In normativen Theorien der Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft stellt Öffentlichkeit gegenüber einer Gesellschaft, die strukturell als irrational gedacht ist, eine kommunikative Macht dar, insofern der öffentlich- kommunikative Gebrauch der Vernunft die Kommunikationsbeteiligten durch rationale Argumente bindet. (...) Die aktive Inanspruchnahme der Norm der öffentlichen Kommunikation (führt) zu einer zunehmenden Öffnung des öffentlichen Raumes.« (Demirovic 1997, 169) All das soll zur Reformulierung eines Programms radikaler Demokratie beitragen und den Spielraum für die dynamische Erweiterung bestehender Rechte vergrößern. In dieser Öffentlichkeit artikulieren sich soziale Bewegungen, die durch ihre Protestformen die Teilnahme an den öffentlichen Auseinandersetzungen erzwingen (können) und so zuvor als naturhaft oder privat erscheinende soziale Verhältnisse diskursivieren. Manche Zivilgesellschaftstheoretiker binden auch außerlegale - aber nicht gewaltförmige Protestformen des zivilen Ungehorsams in die Überlegungen zur Konstitution einer kritischen Öffentlichkeit ein. Dies »zielt darauf ab, dem Dissens und den Dissidenten im Rahmen der Verfassung Anerkennung zu verschaffen.« (Rödel et al. 1989, 73) Die Konflikte sind nie abgeschlossen und stoßen gerade auch im öffentlichen Raum permanent auf Widerstand - also auf Kräfte, die an einer Diskursivierung privater Verhältnisse kein Interesse haben. Im öffentlichen Raum prozediert daher permanent die Auseinandersetzung um die »demokratische Revolution« (vgl. Rödel et al. 1989). Mehr noch, Konflikte werden zum Dreh- und Angelpunkt der Vergesellschaftung. Erst über Konflikte kann soziale Integration und Kohäsion hergestellt werden, weil in ihnen erst den Individuen die Frage nach der »Ordnung des Gemeinwesens« bewusst wird und sie dadurch ihre »zivilisatorische Wirkung« entfalten können. »Am Beispiel des Klassenantagonismus zwischen Lohnarbeitern und Produktionsmitteleignern lässt sich zeigen, wie selbst dieser Extremfall eines sozialen Konflikts die Erfahrung der Zugehörigkeit zu derselben Gesellschaft vermitteln kann, wenn er offen ausgetragen wird und sich die Kontrahenten so in ihrer Ähnlichkeit erkennen und anerkennen können.« (ebda., 110) Ziel dieser Konzeptionen ist eine »inklusive Demokratie«, in der etwa auch Antirassismus als notwendige zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung um die Zugehörigkeit zur jeweiligen Gesellschaft erscheint. Diese Argumentation kann aber die Überwindung des Rassismus nicht mehr denken. Die KonfliktgegnerInnen dürfen nicht zum exterritorialen Feind abgestempelt werden, trotzdem könne nicht jede/r nach Beliebem seine/ihre politischen Ziele verfolgen, da auch in der »demokratischen Republik die Freiheit nicht grenzenlos sei« (ebda., 177). Diese Grenzen aber ergäben sich aus der wechselseitigen Anerkennung und Verpflichtung der BürgerInnen. Für alles könne daher öffentlich demonstriert werden, solange die Durchsetzung nicht gewaltsam erfolge. Da die Grenzen aber trotzdem nicht vorab bestimmbar sind und nicht dem Staat überlassen werden sollen, wird ein »öffentliches Monopol« gefordert, »das zur Sicherung öffentlicher Freiheit in der Zivilgesellschaft alle Formen der Gewaltsamkeit externalisiert« (ebda., 180). Letztlich ist dieses Konstrukt und die Uneindeutigkeit des Gewaltbegriffs aber keine Antwort, wie mit dem »öffentlichen Monopol« etwa gegen Nazi-Aufmärsche vorgegangen werden könnte, bzw. welche Instanz mit welchen Mitteln die »öffentliche Freiheit« gegen die Besetzung des öffentlichen Raumes durch faschistische Organisationen aufrechterhalten solle. Die Problematik dieser Argumentationen liegt aber noch tiefer. Wenn nämlich dem Konflikt eine zivilisatorische Wirkung zukommt, da sich nur so die Anerkennung der Gleichheit aller entfaltet, könnten etwa die Überfremdungsplakate der FPÖ im Wahlkampf 1999 als Förderung der sozialen Integration und Kohäsion verstanden werden. Außerdem stellt sich die Frage, warum es zur normativen Bestimmung der Zivilgesellschaft ausreicht, dass sich bestimmte Gruppen (Frauen, MigrantInnen, Schwule und Lesben, ArbeiterInnen ...) gegen Unterdrückungsverhältnisse organisieren können. Gleichzeitig wird ausgeblendet, dass sie dies auch tun müssen, um gesellschaftliche Anerkennung und Gleichheit zu erlangen, wenn doch ihre Kritik auf die dauernde Überwindung von Herrschaftsverhältnissen und damit des Grundes ihrer Organisierung abzielt (vgl. Demirovic 1997). Im normativen Verständnis werden auf diese Weise Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit zum heimlichen Souverän der Gesellschaft, an den nicht-entscheidbare, konflikthafte Fragen delegiert werden. Zivilgesellschaft und Öffentlichkeit, sowie die sie konstituierenden Organisationen und Praxisformen selbst, brauchen dann in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft nicht mehr analysiert oder selbst zum Gegenstand der Kritik gemacht zu werden. IV. Der Zurückweisung des normativen Zivilgesellschaftsbegriffs zur Definition und strategischen Ausrichtung des Widerstandes liegen zwei fundamentale Problemstellungen zu Grunde. Diese werden gerade durch die theoretische Fundierung, welche ZivilgesellschaftstheoretikerInnen diesem Begriff geben, sichtbar. Dies führt zum einen dazu, dass die Verbindung von politischen und ideologischen Prozessen in der Zivilgesellschaft und die gesellschaftliche Organisation von Arbeit, Reproduktion und Subjektivität und deren Veränderungen (Prekarisierung und Feminisierung der Lohnarbeit, Migration etc.) ausgeblendet wird. Auch die soziale Position der Zivilgesellschaft und ihrer AktivistInnen in eben diesen Verhältnissen bleibt somit tendenziell unterbelichtet. Die AktivistInnen können dadurch ihre Praxis verallgemeinern und interesselos erscheinen lassen und daher auf nicht weniger als einen neuen gesellschaftlichen Konsens und das Allgemeinwohl, also auf moralische, intellektuelle und politische Führung, abzielen. Die kritisch-materialistische, an Gramsci orientierte Konzeption des Zivilgesellschaftsbegriffs könnte demgegenüber diese beiden Problemstellungen in den Blick rücken. Sie könnte zum einen zeigen, wie es der FPÖ auf dem zivilgesellschaftlichen Terrain gelungen ist, auf die sozio-ökonomischen Veränderungen zu reagieren und die dominanten Ideologien der Zweiten Republik zu desartikulieren und in ein neues politisches Projekt auf rassistischer Basis zu verwandeln. Dadurch würden aber die alltäglichen Lebensverhältnisse der Menschen, welche zum Angriffspunkt der autoritären Regierung werden, als Feld der politischen Auseinandersetzung sichtbar. So könnte eine mögliche Isolation des Widerstandes vermieden werden. Zum anderen aber könnte die in den postmarxistischen / diskursanalytischen Konzeptionen vorhandene Tendenz, die Intellektuellen zum Subjekt der politischen Prozesse zu machen, einer Kritik unterzogen werden (vgl. Meiksins-Wood 1986). Gerade wegen der immer wieder vorgebrachten Hinweise, dass auch in der Widerstandsbewegung bestimmte Gruppen wie Frauen oder MigrantInnen marginalisiert werden, die normative Zivilgesellschaft also ausschließende Effekte zeitigt, könnte sich die politische Relevanz eines kritischen Verständnisses von Zivilgesellschaft entfalten. Dieses könnte dazu beitragen, derartige »Dysfunktionalitäten« nicht einfach der weiteren Gesellschaft zuzuordnen, sondern sie als immanentes Problem des zivilgesellschaftlichen Feldes, auf dem auch der Widerstand operiert, zu kennzeichnen. Bei Gramsci und den sich an ihm orientierenden Auseinandersetzungen im westlichen Marxismus (vgl. Hall 1989) steht die Frage im Mittelpunkt, wie es in der modernen bürgerlichen Gesellschaft gelingt, den spontanen und freiwilligen Konsens der subalternen Gruppen zur Aufrechterhaltung und Reproduktion der Herrschaftsverhältnisse zu erreichen. Gramsci sah sich mit dieser Frage nach 1918 konfrontiert, als im Westen die revolutionären ArbeiterInnenbewegungen eine Niederlage erlitten hatten, in der Folge dem Faschismus wenig entgegensetzen konnten, als auch ihre AktivistInnen und Organisationen physisch fast zerstört wurden. Zu dieser Niederlage war es gekommen, obwohl mit den antimonarchischen Revolutionen nach dem Ersten Weltkrieg in zahlreichen europäischen Staaten auch ein Kollaps der Staatsapparate im engeren Sinne einhergegangen war. Während in Russland eine Revolution mit sozialistischem Anspruch erfolgreich war, konnten sich die Systeme im Westen ziemlich rasch reorganisieren. »Im Osten war der Staat alles, die Zivilgesellschaft war in ihren Anfängen und gallertenhaft. Im Westen bestand zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis, und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine robuste Kette von Festungen und Kasematten befand.« (Gramsci 1991ff., 874) Zivilgesellschaft beschreibt hier ein Geflecht von im engeren Sinne nicht-staatlichen Organisationen und Institutionen wie Zeitungen, Kirchen, Universitäten, privaten Vereinen und Assoziationen sowie Parteien. Damit hat sich die Reproduktion der Herrschaftsverhältnisse erweitert. Der politischen Gesellschaft, also dem Staat im engeren Sinne, ist eine zivile Gesellschaft (società civile) an die Seite getreten, in der die Herrschaft der dominanten Gruppen durch Hegemonie abgesichert wird. Der Kampf um Hegemonie ist der Kampf um die spontane und freiwillige Zustimmung der subalternen Gruppen und die Erzeugung der damit verbunden Machtblöcke und Kompromisse. In diesem Kampf geht es um die Konstitution politischer, intellektueller und moralischer Führung (vgl. Jessop 1990). Nach diesem Verständnis kann also Herrschaft im Kapitalismus nicht auf die repressive Funktion des Staates reduziert werden, vielmehr muss das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft als Hegemonie (wenn auch gepanzert mit Zwang) verstanden werden. »Die historische Vereinigung der führenden Klassen geschieht im Staat (...). Diese Einheit muss konkret sein, also das Ergebnis der Beziehungen zwischen Staat und ðZivilgesellschaftЫ (Gramsci 1991ff., 410). Für Gramsci erforderte diese Analyse eine Adaptation der Strategien revolutionärer Bewegungen, die sich nicht mehr als Sturm auf das Winterpalais, als Angriffskrieg auf den Staat im engeren Sinne verstehen können. Vielmehr wird es notwendig, sich auf lange politische und ideologische Auseinandersetzungen um und gegen die Hegemonie im erweiterten Geflecht von Staat und Zivilgesellschaft einzustellen. V. Hier wird nun sichtbar, was in der österreichischen Diskussion konsequent ausgeblendet wird, nämlich die Frage, wer verknüpft und erzeugt Diskurse in den Hegemoniekämpfen. Bei Gramsci ist dies wesentlich das Feld, auf dem Intellektuelle ihre gesellschaftliche Funktion ausüben. Diese müssen daher in ihrer gesellschaftlichen Position analysiert werden. Der Bezug auf den gramscianischen Intellektuellenbegriff erfordert außerdem eine Rückbindung der Argumentationen auf die Organisation der gesellschaftlichen Arbeitsteilungen aus kapitalismus-, patriarchatskritischer und antirassistischer Perspektive, da sie den jeweiligen Gruppen in diesen Verhältnissen Homogenität und Bewusstheit ihrer Position geben. Insofern die Zivilgesellschaft in Österreich auf einen neuen Konsens und neue Werte abzielt, versucht sie eben die gramscianische Intellektuellen-Funktion einzunehmen. »Die Intellektuellen haben eine Funktion bei der ðHegemonieÐ, welche die herrschende Gruppe in der ganzen Gesellschaft ausübt, und bei der Herrschaft über sie, die sich im Staat verkörpert, und diese Funktion ist eben ðorganisierendÐ oder verbindend: Die Intellektuellen haben die Funktion, die gesellschaftliche Hegemonie einer Gruppe und ihre staatliche Herrschaft zu organisieren (...).« (ebda., 515). In diesem Verständnis definieren sich Intellektuelle nicht nach dem Kern ihrer Tätigkeit, also etwa Bücher zu lesen, Texte zu schreiben oder Symbol-Analytiker zu sein. Sie sind »vielmehr im System der Verhältnisse, in dem sie (oder die Gruppierung, die sie verkörpert) sich im Gesamtkomplex der gesellschaftlichen Verhältnisse wiederfindet« (ebda.) zu suchen. Gramsci verbindet die Funktion der Intellektuellen explizit mit der Form der Arbeitsteilung im Kapitalismus. Diese besteht in der Spaltung von ausführenden und planenden oder intellektuellen Tätigkeiten in der Produktion, die ebenfalls als eine Form der Interpretation und verbindlichen Organisation der Realität erscheint. Techniker, aber auch die Unternehmer selbst, sind für Gramsci Intellektuelle der bürgerlichen Gesellschaft, die sich aus ihrer Position in den gesellschaftlichen Verhältnissen bestimmt. Da diese aber als widerspüchlich und konflikthaft aufgefasst werden, ist die Frage der Reproduktion der gesellschaftlichen Arbeitsverhältnisse im Produktionsprozess, nach der Kohäsion des Gesellschaftlichen, eben nicht auf der Ebene der Produktion zu lösen, sondern verlagert sich in die Ebene der Zivilgesellschaft und den Staat. Da aber die gesellschaftlichen Interaktionen und Verkehrsformen (Produktion, Sexualität, Familie) wesentlich Inhalt und Problem der Kämpfe um Hegemonie sind, bleiben die Intellektuellen an die Fragen der gesellschaftlichen Arbeitsteilungen rückgebunden. Dies wird aber im postmarxistischen Diskurs zur Zivilgesellschaft weitgehend ignoriert. Es kann daher kein Bewusstsein der Widersprüche (ebda., 1 474) entwickelt werden, in denen der Theoretisierende sich selbst »als individuelle oder als ganze gesellschaftliche Gruppe genommen (...), als Element des Widerspruches setzt, dieses Element zum Prinzip der Erkenntnis und folglich des Handelns erhebt.« (ebda., 1474) Daher wollen die (Zivilgesellschafts-)Intellektuellen in Österreich, wie auch manche Teile der außerparlamentarischen Opposition wenig von ihrer Position in den gesellschaftlichen Arbeitsteilungen rassistischer, sexistischer oder klassenspezifischer Natur - also jenseits der Ebenen der Öffentlichkeit, des Allgemeinwohls und der Politik - wissen. Sichtbar wurde dies in der vom Philosophen Konrad Paul Liessmann im Standard unter dem Titel »Die Intellektuellen und ihr Volk« vom Zaun gebrochenen Debatte über den Erfolg Jörg Haiders und dem Versagen der kritischen Intellektuellen (Der Standard, 30. Oktober 1999). In dieser Debatte hielt Liessmann den »kritischen Intellektuellen« vor, sich vor dem »Volk zu ekeln« und es mit ihrer moralisierenden und alarmistischen Kritik zu traktieren, anstatt auf die »objektiven Grundlagen« (die er etwa im »Asylmissbrauch« verortete) der rassistischen Mobilisierung einzugehen. Diese bewusst mit neu-rechten Ideologemen spielende Provokation Liessmanns zog natürlich eine Reihe von kritischen Antworten nach sich. Diese beschränkten sich aber vor allem auf die Zurückweisung der Anmaßungen Liessmanns aus ideologiekritischer Perspektive und der Verteidigung einer kritisch moralischen Position in der Auseinandersetzung mit der FPÖ und dem Rassismus. Letztlich wurde aber das von Liessmann eröffnete Terrain, die Frage nach dem Verhältnis von »kritischen Intellektuellen und Volk«, nicht verlassen und als Feld der Auseinandersetzung akzeptiert. Anstatt also die Gegenüberstellung von »Intellektuellen und Volk« als eine hegemoniale Artikulation zu begreifen, die auf »moralische, politische und intellektuelle Führung« abzielt, verblieben die »kritischen Intellektuellen« in der Ecke der »moralischen Alarmisten«, die nur in dieser Anordnung existiert, in die Liessmann sie gestellt hatte. VI. Anstatt also jene gesellschaftlichen Verhältnisse anzugreifen, welche die hegemoniale Sicherung herrschaftlicher Verhältnisse bedingen, konzentriert sich die zivilgesellschaftliche Diskussionen auf die Erneuerung des gesellschaftlichen Konsens, die Erzeugung von gesellschaftlich allgemeinen (Gegen-)Identitäten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Widerstand sich immer wieder selbst als »interesselos«, also auf das Allgemeinwohl, jenseits materieller Lebensverhältnisse abzielend, darstellt, so als stünden die Demonstrierenden außerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse. Trotz des ganzen post-marxistischen Wortgeklingels verbindet sich dieses Verständnis daher eher mit dem Habermasschen Intellektuellenbegriff. »Da der Intellektuelle - in normativer Hinsicht, nicht unbedingt empirisch - Rationalität und herrschaftskritisches Verhalten verkörpert, (...) emanzipiert er sich von als selbstverständlich unterstellten, traditonalen Normen und Klassenstrukturen. Anders als bei Gramsci bleibt diese Emanzipation auf den Intellektuellen beschränkt.« (Demirovic 1991, 45) Daher erübrigt sich also die selbstkritische Verortung der intellektuell Tätigen in der sexistischen und rassistischen Klassengesellschaft. Beim Widerstand gegen die blau-schwarze Regierung aber kann dies gravierende Folgen haben. Es ist zu befürchten, dass die Zivilgesellschaft, sowie Intellektuelle und Künstler des Widerstandes ihre Kämpfe nicht auf den zu erwartenden Angriff auf die Lebensverhältnisse der Subalternen beziehen können. Das aber, obwohl durch die Kürzung von Fördergeldern und die Verschärfung des gesellschaftlichen Klimas schon in der Frühphase des blau-schwarzen Projektes ihre eigenen Lebens- und Arbeitsverhältnisse angegriffen werden. Die mögliche Isolation von Teilen des Widerstandes von den zu erwartenden Kämpfen könnte zum Niedergang der Bewegung führen, ohne dass die neue Regierung besonders repressiv vorgehen müsste. Der Widerstand gegen die neue Regierung müsste sich also die Frage stellen, ob die permanente Mobilisierung für Neuwahlen als Ausdruck und Strategie des Widerstandes und der Anspruch für einen neuen gesellschaftlichen Konsens zu kämpfen, das Durchgreifen der Regierung und die autoritäre Transformation auf die Lebensverhältnisse der Menschen wird verhindern können. Es wäre daher in der gegenwärtigen Phase der Konsolidierung des neuen Regimes notwendig, die »Befestigungen« und »Kasematten« aufzubauen und zu vervielfältigen, welche die konkreten Angriffe der rechten Regierung (auf das Gesundheits-, Sozial- und Pensionssystem, auf die Arbeitsverhältnisse etc.) abwehren könnten. Dies aber würde bedeuten, über die feierliche, weihevolle Ebene des Staatspolitischen, der Konzentration auf das Gesellschaftlich-Allgemeine, den Konsens zu überschreiten und den Widerstand in den Alltag zu tragen. Literatur Demirovic, Alex (1997): Demokratie und Herrschaft. Aspekte kritischer Gesellschaftstheorie. Münster. Gramsci, Antonio (1991ff.): Gefängnishefte. Kritische Gesamtausgabe, herausgegeben von Wolfgang F. Haug, Hamburg. Habermas, Jürgen (1992): Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt/Main. Hall, Stuart (1989): Antonio Gramscis Erneuerung des Marxismus und ihre Bedeutung für die Erforschung von »Rasse« und Ethnizität. In: ders.: Ausgewählte Schriften. Hg. von Nora Räthzel. Hamburg Hirsch, Joachim (1995): Der nationale Wettbewerbsstaat. Staat, Demokratie und Politik im globalen Kapitalismus. Jessop, Bob (1990): State Theory. Putting Capitalist States in their Place. Pennsylvania. Laclau, Ernesto (1981): Politik und Ideologie im Marxismus. Kapitalismus - Faschismus Populismus. Hamburg. Laclau, Ernesto (1990): New Reflections on the Revolution of our Time. London. Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal (1991): Hegemonie und radikale Demokratie - Zur Dekonstruktion des Marxismus. Wien. Marchart, Oliver (2000): Drei Formen der Zivilgesellschaft - Radikale Demokratie und die politische Rolle der Philosophie. in: Stoller, Sylvia; Nemeth, Elisabeth; Unterthurner, Gerhard: Philosophie in Aktion. Wien. Meiksins Wood, Ellen (1986): The Retreat from Class. A New »True« Socialism. London/New York. Rödel, Ulrich; Frankenberg, Günther; Dubiel, Helmut (1989): Die demokratische Frage. Ein Essay. Frankfurt/Main. © Jungle World Verlags GmbH