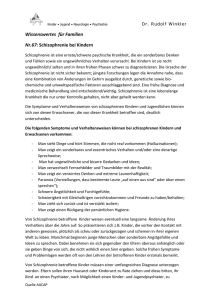lesen - Pro Mente Tirol
Werbung

Schizophrenie... „bedeutet für mich gespaltene Persönlichkeit“: Ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophrenie in Schulen H. Sulzenbacher, R. Schmid, G. Kemmler, Ch. De Col, U. Meise 93 Jahrgang 16 Nummer 1 + 2 – 2002 1. + 2. Quartal Behandlungsvorstellungen der Bevölkerung zu Depression und Schizophrenie Ch. Lauber, C. Nordt, L. Falcato, W. Rössler Editorial „Es ist leichter, ein Atom zu zerstören, als ein Vorurteil“ U. Meise, W.W. Fleischhacker, W. Schöny 1 Übersichtsarbeiten Eines der letzten Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankungen N. Sartorius 5 Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts in Kraepelins, Bleulers und Schneiders Werk H. Katschnig 11 Organ der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie 99 Die Bewertung von Depression und Schizophrenie als psychische Krankheit und deren Einfluss auf die Hilfeempfehlung C. Nordt, L. Falcato, Ch. Lauber, W. Rössler 103 Ist das www für die Anti-StigmaKampagne nutzbar? H. Sulzenbacher, Ch. De Col, K. Lugger, U. Meise Kommentare Stigma-Erfahrungen aus erster Hand Ch. Horvath 26 Stigmatisierung als Folge intrapsychischer Abwehrprozesse – der psychotherapeutische Gesichtspunkt H. Meller 35 22 Angehörige – Parias am Rande der Psychiatrie ? I. Rath „Die Psychiatrie braucht Menschen, keine Leute“ W. Kantschieder 109 29 Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Überlegungen M. C. Angermeyer, B. Schulze Stigma – ein Kommentar aus gerontopsychiatrischer Perspektive J. Wancata 115 39 Originalarbeiten Einstellungen der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie A. Grausgruber, H. Katschnig, U. Meise, W. Schöny 54 Das Image der Psychopharmaka in der österreichischen Bevölkerung U. Meise, A. Grausgruber, H. Katschnig, W. Schöny 68 Perspektivenwechsel: Stigma aus der Sicht schizophren Erkrankter, ihrer Angehörigen und Mitarbeitern in der psychiatrischen Versorgung B. Schulze, M.C. Angermeyer 78 Soziale Distanz von an Schizophrenie Erkrankten gegenüber psychisch Kranken Ch. De Col, P. Gurka, E. Madlung-Kratzer, G. Kemmler, H. Meller, U. Meise 89 1+2 02 110 Rechtliche Benachteiligung psychisch Kranker in Österreich K. Gutiérrez-Lobos Schizophrenie hat viele Gesichter: Die österreichische Kampagne zur Reduktion des Stigmas und der Diskriminierung wegen Schizophrenie W. Schöny 48 Klinik, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation Schriftleitung F. Gerstenbrand, Wien H. Hinterhuber, Innsbruck K. Jellinger, Wien Stigma hat Tradition: Zum historischen Hintergrund der Stigmatisierung H. Hinterhuber 117 Rezensionen Katschnig H., Donat H., Fleischhacker W. W., Meise U.: 4 x 8 Empfehlungen zur Behandlung von Schizophrenie J. Wancata 21 A. Finzen: Psychose und Stigma. Stigmabewältigung – zum Umgang mit Vorurteilen und Schuldzuweisungen R. Schmid 37 U. Hoffman-Richter: Psychiatrie in der Zeitung. Urteile und Vorurteile A. Grausgruber 47 J. Guimón, W. Fischer, N. Sartorius: The Image of Madness – the public facing mental illness and psychiatric treatment U. Meise 88 Laudatio Hans Georg Zapotoczky 121 In Memoriam Univ.-Prof. Dr. W. Pöldinger 123 Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle http://www.dustri.de (1) Verantwortliche Herausgeber L. Deecke, Wien F. Gerstenbrand, Wien/Innsbruck H. Hinterhuber, Innsbruck K. Jellinger, Wien W. Poewe, Innsbruck H. G.Zapotoczky, Graz Schriftleiter F. Gerstenbrand, Wien (Neurologie) H. Hinterhuber, Innsbruck (Psychiatrie) K. Jellinger, Wien (Grundlagenforschung) Redaktionsdirektorin F. S.Tschabitscher,Wien Redaktionssekretäre H. G. Blecha, Innsbruck G. Luef, Innsbruck M. M. Pinter, Wien Beirat F. Aichner, Innsbruck E. Auff, Wien G. Bauer, Innsbruck W. Biebl, Innsbruck H. Binder, Wien R. Danzinger, Graz E. Deisenhammer, Linz W. W. Fleischhacker, Innsbruck M. Friedrich, Wien E. Gabriel, Wien W. Grisold, Wien Ch. Haring, Hall H. P. Hartung, Graz S. Kasper, Wien H. Katschnig, Wien D. Klingler, Linz P. König, Rankweil G. Ladurner, Salzburg H. Lechner, Graz B. Mamoli, Wien U. Meise, Innsbruck C. H. Miller, Kufstein E. Ott, Graz W. Pieringer, Graz Th. Platz, Klagenfurt F. Reisecker, Graz St. Rudas, Wien E. Rumpl, Klagenfurt B. Saletu, Wien G. Schnaberth, Wien W .Schöny, Linz H. Scholz, Villach H. Schubert, Hall E. Sluga, Wien Ch. Stuppäck, Salzburg Internationaler Wissenschaftlicher Beirat O. Abramsky, Jerusalem M. Ackenheil, München Y. Agid, Paris J. Angst, Zürich A. Balestrieri, Verona G. S. Barolin, Rankweil D. Bartko, Bratislava L. Battistin, Padova H. Beckmann, Würzburg P. Berner, Wien P. Bramanti, Messina Th. Brandt, München G. B. Cassano, Pisa E. Csanda, Budapest A. Delini-Stula, Basel P. Delwaide, Liège K. Einhäupl, Berlin P.-A. Fischer, Frankfurt H. J. Freund, Düsseldorf B. Gallhofer, Gießen N. Grcevic, Zagreb W. Hacke, Heidelberg D. Hadjiev, Sofia W.-D. Heiss, Köln S. R. Hirsch, London G. E. Hogarty, Pittsburgh D. Kömpf, Lübeck W. Koos, Wien A. Korczyn, Tel Aviv H. P. Ludin, St.Gallen C. H. Lücking, Freiburg W. Maier, Bonn J. M. Martinez-Lage, Pamplona K. Maurer, Frankfurt H. J. Möller, München B. Müller-Örlinghausen, Berlin F. Müller-Spahn, Basel J. Olesen, Kopenhagen G. Pendl, Graz F. Poustka, Frankfurt H. Reichmann, Dresden F. Resch, Heidelberg B. Richling, Salzburg P. Riederer, Würzburg N. Sartorius, Genf W. Spiel, Wien G. Stern, London E. Tolosa, Barcelona J. Toole, Winston-Salem K. Twerdy, Innsbruck N. V. Vereshchagin, Moskau M. Yahr, New York Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie Präsident: W. Schöny, Linz (2) »Neuropsychiatrie« veröffentlicht Übersichten, Originalarbeiten, Kasuistiken, aktuelle, kurze wissenschaftliche Mitteilungen, Fragen aus der Praxis, Briefe an die Herausgeber, Leseranfragen aus der Praxis mit Antworten, Newsletters (Berufspolitik, Standesfragen) und Personalien, Kongreßankündigungen, Buchbesprechungen etc. aus allen Bereichen der Neurologie und Psychiatrie. Sämtliche Manuskripte unterliegen, soweit sie nicht als Anzeigen kenntlich gemacht sind, der wissenschaftlichen und redaktionellen Begutachtung durch Schriftleitung bzw. Beirat. Ein Original, zwei Kopien sowie die Diskette sollen der Schriftleitung zugesandt werden. Schriftleitung: Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. F. Gerstenbrand, Ludwig Boltzmann Institut für Restorative Neurologie, Neurologisches Krankenhaus Maria Theresien Schlössel, Hofzeile 18 –20, A–1190 Wien, Tel.: (00 43/1) 36 83 45 52 20, Fax: (0043/1) 3 68 34 55 19, E-mail: [email protected] Univ. Prof. Dr. H. Hinterhuber, Universitätsklinik für Psychiatrie, Anichstraße 35, A–6020 Innsbruck, Tel.: (00 43/5 12) 5 04 36 30, Fax: (00 43/5 12) 5 04 36 28, E-mail: [email protected] Univ. Prof. Dr. K. Jellinger, Ludwig Boltzmann Institut für Klinische Neurobiologie, Psychiatrisches Krankenhaus, Baumgartner Höhe 1, A-1140 Wien,Tel.: (00 43/1) 9 10 60 14 24 24 44, Fax: (00 43/1) 91 06 04 98 62, E-mail:[email protected] Anschrift der Schriftleitung: Redaktion Neuropsychiatrie, Frau Dr. F. S. Tschabitscher, NKH Rosenhügel, Riedelgasse 5, A-1130 Wien, Tel.: (00 43/1) 8 80 00-2 70, Fax: (00 43/1) 8 89 25 81, E-mail:[email protected] Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle, Postfach 1351, D-82032 München-Deisenhofen, Tel. (089) 61 38 61-0, Telefax (089) 6 13 54 12 e-mail: [email protected] Bankkonto: ©2002 Jörg Feistle. Verlag: Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle. ISSN 0948-6259 Deutsche Apotheker-und Ärztebank,München Konto 0 201 282 697, BLZ 700 906 06 Regularly listed in Current Contents/Clinical Practice and EMBASE/Excerpta Medica Volksbank Oberndorf,Österreich Konto-Nr. 9440 BLZ 44480 Postbank München Konto-Nr. 131070-806, BLZ 700 100 80 Verantwortlich für Anzeigen: Ch. Graßl Gültig Anzeigenpreisliste Nr. 15 Herstellung: Bosch-Druck, Landshut/Ergolding Mit der Annahme des Manuskriptes und seiner Veröffentlichung durch den Verlag geht das Verlagsrecht für alle Sprachen und Länder einschließlich des Rechts der photomechanischenWiedergabe oder einer sonstigen Vervielfältigung an den Verlag über. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in dieser Zeitschrift berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, daß solche Namen im Sinne der Warenzeichen-und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen wird vom Verlag keine Gewähr übernommen.Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Neuropsychiatrie erscheint vierteljährlich. Bezugspreis jährlich € 72,–. Preis des Einzelheftes € 21,– zusätzlich Versandgebühr, inkl. Mehrwertsteuer. Einbanddecken sind lieferbar. Bezug durch jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag. Die Bezugsdauer verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn nicht eine Abbestellung bis 4 Wochen vor Jahresende erfolgt. (3) Hinweise für Autoren Sämtliche Manuskripte unterliegen der wissenschaftlichen und redaktionellen Begutachtungdurch Schriftleitung und Beirat. Manuskript Die Manuskripte (Texte bitte – wenn möglich –zusätzlich auf Diskette in Word Perfect 5.0 oder als ASCII-File; Betriebssystem MS-DOS) sollen leicht lesbar in deutscher Sprache verfaßt sein und einen Umfang von 15 Schreibmaschinenseiten mit 1 1/2 zeiligem Abstand nicht überschreiten – Tabellen, Abbildungen und Literaturverzeichnis eingeschlossen.Abbildungen, Legenden, Tabellen und Literaturverzeichnis sollen auf gesonderten Seiten eingereicht werden. Zu jedem Manuskript gehören eine Zusammenfassung (nicht über 15 Schreibmaschinenzeilen) in deutscher und englischer Sprache (ausführlicher) einschließlich der Titelzeile (möglichst kurz und prägnant, eventuell mit Untertitel) sowie die Schlüsselwörter bzw. Key words. Diese Zusammenfassung sollte vor allem auf die Ergebnisse eingehen. Die wesentliche Aussage einer Arbeitsollte in einem abschließenden Satz (EssentialSentence) zusammengefaßt werden. Verlag und Schriftleitung bemühen sich umderen Anpassung an die gängigen Datenbanken. Abkürzungen und hochspezialisierte Begriffe sollen möglichst vermieden und müssen in jedem Falle auf gesondertem Blatt aufgelistet und erklärt werden. Die Erklärungen werden als Fußnote der Arbeit vorangestellt. Arzneimittel müssen mit ihren internationalen Freinamen angegeben werden. Eingetragene Handelsnamen werden als solche nicht besonders kenntlich gemacht. Zu jeder Arbeit benötigen wir Namen und Ort der Institution, in welcher der Autor während der Erarbeitung der Untersuchungsergebnisse tätig war. Am Schluß der Veröffentlichung soll die vollständige Anschrift des Verfasser,evtl.auch seine Telefonnummer, stehen. Methoden Die angewendeten Methoden sollen mit den relevanten Literaturbelegen präzise beschrieben werden. Schreibweise Es wird die eingedeutschte Orthographie verwendet. Soweit es sich um Spezialnamen, Arzneibezeichnungen,Termini technici und Nomina anatomica handelt, werden diese nicht eingedeutscht. Abbildungen und Tabellen Abbildungen und Tabellen bitten wir in reproduktionsfähigem Zustand gesondert und durchgehend numeriert dem Manuskript beizulegen. Farbige Abbildungen (am besten von Farbfotos) gehen zu Kosten des Autors. Der Kostenvoranschlag ist auf Wunsch vom Verlag erhältlich. Legenden zu Abbildungen und Tabellen werden auf einem gesonderten Blatt erbeten.Hinweise auf die entsprechenden Textstellen erleichtern die Arbeit der Schriftleitung. Zitate Namen von Autoren sollen im Text nicht aufgeführt werden; es genügt als Zitat die entsprechende Ziffer des Literaturverzeichnisses. Literaturverzeichnis Literaturangaben sollen auf etwa 20 grundlegende Werke und Übersichtsarbeiten beschränkt werden. Das Literaturverzeichnis soll alphabetisch geordnet und fortlaufend numeriert sein. Arbeiten, die in Zeitschriften erschienen sind: [1] Rittmannsberger H., W. Sonnleitner, J. Kölbl, W. Schöny: Plan und Wirklichkeit in der psychiatrischen Versorgung.Ergebnisse der Linzer Wohnplatzerhebung. Neuropsychiatrie 15, 5-9 (2001). Bücher: [2] Hinterhuber H., W. Fleischhacker: Lehrbuch der Psychiatrie. Thieme, Stuttgart 1997. Beiträge in Büchern: [3] Albers M.: Kosten und Nutzen der tagesklinischen Behandlung. In: Eikelmann B., T. Reker, M. Albers: Die psychiatrische Tagesklinik. Thieme, Stuttgart 1999. Korrekturabzüge Nach Anfertigung des Satzes erhält der verantwortliche Autor einen Fahnenabzug des Textes, der Tabellen und Abbildungen. Die Korrekturfahnen sind auf Druckfehler und sachliche Fehler durchzusehen.Abbildungen sowie Tabellen sind auf richtige Numerierung, Stellung und Legenden zu überprüfen. Die Rücksendung der Korrekturfahnen in der vom Verlag gegebenen Frist ist notwendig, ansonsten wird die Zustimmung des Autors zur Druckfreigabe vorausgesetzt. (4) EDITORIAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, Seite 1 – 4 „Es ist leichter, ein Atom zu zerstören, als ein Vorurteil“* Ullrich Meise1, W. Wolfgang Fleischhacker1 und Werner Schöny2 1Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck 2Landesnervenklinik Wagner-Jauregg, Linz Bereits eine Ausgabe der „Psychiatrischen Praxis“ (Oktober 2000) wurde der Stigmathematik gewidmet [2, 4, 7, 12, 17, 18, 23, 32]. Dieses Themenheft der „Neuropsychiatrie“ beinhaltet in erster Linie jene Referate, die anlässlich des Workshops „Es ist leichter, ein Atom zu zerstören, als ein Vorurteil – Schizophrenie und Stigma“ am 19. Donausymposium für Psychiatrie (Linz, 15–17 Juni 2000) präsentiert wurden. Mit diesem Workshop wurde die österreichische Anti-Stigma-Kampagne „Schizophrenie hat viele Gesichter“ eingeläutet [30]. Da das Stigma zu einem wesentlichen Anteil die Behandlung und Genesung von psychisch Kranken behindern kann, wurden seitens verschiedener NGO’s und großer Organisationen, wie der WHO oder der Weltpsychiatrischen Vereinigung (WPA), Anti-Stigma-Kampagnen initiiert. Österreich gehört zu den ersten Ländern, die sich dem weltweiten WPA-Programm „Against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia“ [29] angeschlossen haben. Auf Grundlage der WPARichtlinien [17, 35] und den Erfahrungen, die in der Provinz Alberta (Kanada) mit der Anti-Stigma-Kampagne gemacht wurden, fanden bis Ende letzten Jahres entsprechende Aktivitäten im gesamten Bundesgebiet statt**[28]. Wären Anti-Stigma-Kampagnen so angelegt, dass sie allein durch breite Aufklärung meinen, festgelegte Überzeugungen der Gesellschaft verändern zu können, hätten jene recht, die dies als utopisch erachten und diesen Aktivitäten kritisch gegenüberstehen [8]. Würde sich die Anti-Stigma-Arbeit ausschließlich auf den Zeitraum der Kampagne begrenzen, werden jene Skeptiker bestätigt, die meinen, dass auch dieser wichtigen Thematik das Schicksal kurzlebiger und luftiger Zeitgeistigkeit beschieden sei. Befasst man sich mit dieser Materie, so wird relativ rasch deutlich, dass diese Aktivitäten über viele Jahre fortgeführt werden müssen und es in erster Linie notwendig ist, ausreichend Mitstreiter zu gewinnen. Daher richtet sich die Anti-StigmaKampagne nicht nur an die Allgemeinbevölkerung, sondern vor allem an Gruppen, die als Schlüsselpersonen für die angestrebten Einstellungsänderungen wichtig sind [10, 13]. Durch die Vermittlung von Techniken zum „Stigma-Management“ sind auch Patientinnen und Patienten Zielgruppe dieser Aktivitäten [7, 8, 9]. Die „Kampagne“ [30] dient dazu, Aufmerksamkeit zu wecken. Sie ist ein erster Schritt, dem langfristig angelegte Aktivitäten folgen müssen. Ein Schwerpunkt der Österreichischen Kampagne wurde auf die Prävention des Stigmas gelegt. Dabei wurden im Rahmen der Gesundheitserziehung Schülerinnen und Schüler mit einer von schizophrener Erkrankung Betroffenen konfrontiert. In diesem Unterricht wurde Information durch Patienten und Experten gemeinsam vermittelt [23, 33]. Insgesamt erfreuten sich diese Schulprogramme einer hohen Akzeptanz und haben zu weiteren Projekten im Schulbereich geführt. Repräsentative Bevölkerungsumfragen verdeutlichen, dass es sich bei den Bemühungen zur „Entstigmatisierung“ psychischen Krankseins um ein langfristiges Projekt handelt. Die Einstellung der Bevölkerung gegenüber psychisch Kranken, ist nach wie vor von mangelndem Wissen, Irrationalität und Emotionalität geprägt. Vor dem Beginn der Anti-Stigma-Kampagne führten wir eine Untersuchung zu den Einstellungen der österreichischen Bevölkerung gegenüber Schizophrenie und Psychopharmaka durch [11]. Ein Ergebnis dieser Befragung war, dass immerhin ein Fünftel der Bevölkerung mit dem Begriff „Schizophrenie“ nichts anzu- * Das dem Titel zugrundeliegende Zitat – „It is harder to crack a prejudice than an atom“ – wird Albert Einstein zugeschrieben. ** Die Organisatoren der Österreichischen Anti-Stigma-Kampagne sind die Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (ÖGPP), die Österreichische Schizophreniegesellschaft (ÖSG) sowie pro mente austria. Dem Steering Comittee gehören an: M. Chmela, H. Fabisch, W. W. Fleischhacker, Ch. Horvath, H. Katschnig, B. Kofler, H. Kuna, M. Lehofer, U. Meise, I. Rath, B. Rupp, F. Schleicher, W. Schöny (Koordinator). 2 Meise, Fleischhacker und Schöny fangen weiss. Überraschenderweise werden in dieser Umfrage an Schizophrenie leidende Personen einigermaßen akzeptiert. Dieses erfreuliche Ergebnis steht jedoch im Widerspruch zu einer hohen sozialen Distanz gegenüber diesen Menschen. Zudem sind etwa die Hälfte der Befragten der Meinung, dass von an Schizophrenie Erkrankten eine Gefahr ausgehe. Obwohl der Wissensstand über Schizophrenie in der Bevölkerung gering ist, (nur wenige gaben an, mit an Schizophrenie Erkrankten in Kontakt gekommen zu sein) sind 86 %!! der Interviewten an Informationen über diese Erkrankung nicht interessiert. Auch Behandlungsverfahren wie die Psychopharmakotherapie haben ein schlechtes Image [14, 24]. Zwischen der Sicht der Psychiatrie und jener der Bevölkerung besteht offensichtlich auch hierzulande eine hohe Diskrepanz. Solche Unterschiede der Sichtweisen werden von der Arbeitsgruppe aus Zürich in Hinblick auf Hilfe- und Behandlungsempfehlungen der Schweizer Bevölkerung bestätigt [19, 27]. Das Stigma psychischer Erkrankungen ist ein soziokulturell tief verwurzeltes Phänomen [6]. Es durchdringt alles, was im „Halo“ psychischen Krankseins anzutreffen ist. PatientInnen, Angehörige, BehandlerInnen, Behandlungsmethoden und Institutionen sind davon betroffen. Das Stigma führt, wie Christian Horvath aus eigenen Anschauungen beschreibt [15], zu einem „Teufelskreis“ der in Rückkoppelungsprozessen mit der Erkrankung „seelische Wunden“ verstärkt. Das Stigma erzeugt eine Spirale der Benachteiligung [29], die es zu durchbrechen gilt. Direkte Diskriminierungen, strukturelle Diskriminierungen, aber auch „Selbststigmatisierung“ von Patientinnen und Patienten wirken sich negativ auf die Qualität der Behandlung, den Krankheitsverlauf, die Integration und Lebensqualität von Betroffenen aus [3, 17]. Verspätete Behandlung, Behandlungsabbrüche wie auch Mängel in der psychiatri- schen Versorgung tragen zu schlechten Behandlungsergebnissen bei. So wird der Mythos der Unheilbarkeit, der an manchen psychischen Erkrankungen klebt, immer wieder bestätigt. Dabei könnte dem Stigma psychischer Erkrankungen am raschesten begegnet werden, wenn die Behandlung von der Bevölkerung als effektiv angesehen würde. Heute verfügt die Psychiatrie über wirksame psychopharmakologische, psycho- und soziotherapeutische Behandlungsund Rehabilitationsverfahren, durch die – somatischen Erkrankungen vergleichbar – der Großteil psychisch Kranker genesen könnte [16a]. In der alltäglichen Behandlungspraxis wird (oder kann) jedoch nur ein Teil der verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten genutzt (werden) [21, 22]. Menschen mit einer psychischen Erkrankung – oder einer solchen in ihrem Curriculum – neigen dazu, sich selbst auszugrenzen; dabei internalisieren sie die mit der Stigmatisierung vergesellschaftete Geringschätzung [3, 15], da sie u.a. aus ihrem „gesunden Vorleben“ die abwertenden Einstellungen in ihre Erkrankung mitnehmen [5]. Dies kann zu unzureichender Behandlung oder zu Erkrankungsrezidiven führen. Das Stigma beschädigt die Identität der von psychischer Erkrankung Betroffenen [9]. Entmutigung, Selbstentwertung, sozialer Rückzug können eine „zweite Erkrankung“ bewirken, die mit der ursprünglichen Erkrankung nichts zu tun hat, jedoch die soziale Integration und die Lebensqualität der Betroffenen negativ beeinflusst [8]. Bereits vor etwa einem halben Jahrhundert hat der Soziologe Goffman darauf hingewiesen, dass dem „Stigma-Managment“, d.h. der individuellen Bewältigung des Stigmas eine große Bedeutung zukommt [7, 9]. Die „Behandlung“ des Stigmas und seiner persönlichen Folgen muss – als eine wichtige AntiStigma-Strategie – in der Therapie berücksichtigt werden [5]. Anti-Stigma-Aktivitäten müssen auch „zu Hause“, d.h. in der Psychia- trie gesetzt werden [28]. Ein Teil der von Patienten und Angehörigen berichteten Stigmaerfahrungen geht zurück auf das Verhalten des in der Psychiatrie tätigen Personals sowie auf strukturelle Mängel in der Versorgung. [28, 31]. Wir müssen uns ehrlich eingestehen: Am Stigma psychischer Erkrankungen hat die Psychiatrie selbst mitgewirkt. So ist der Mythos der Unheilbarkeit der Schizophrenie auch auf die Beschreibungen von Emil Kraepelin zurückzuführen. „Die Vorurteile von heute waren die Lehrmeinungen von gestern oder vorgestern“ [16]. Es wird notwendig sein, in der Psychiatrie Tätige von der Bedeutung dieses Anliegens zu überzeugen. Zusätzlich wird eine veränderte Kommunikation erforderlich sein, damit alle von psychischer Erkrankung „Betroffenen“, d.h. PatientInnen, Angehörige und Behandler trotz der Unterschiedlichkeit ihrer Standpunkte in der Lage sind, in der Begegnung des Stigmas „an einem Strang zu ziehen“ [1]. Auch sollten wir uns mit den theoretischen Hintergründen von Stigma und Diskriminierung, wie sie seitens der Soziologie und Psychologie erarbeitet wurden, vertraut machen [3, 20]. Dies könnte dazu beitragen, negativen Stereotypen, Vorurteile, Ausgrenzungen und Diskriminierungen, die mit psychischem Kranksein vergesellschaftet sind, gezielter zu begegnen. Stigmabewältigung sollte sich nicht nur darauf beschränken, Medien oder die Bevölkerung zu überzeugen, dass sie ihre Einstellungen und Haltungen gegenüber psychisch Kranken verändern sollten. Auch die Therapeutinnen und Therapeuten müssen einen Perspektivenwechsel vollziehen [28, 31], wollen sie einem professionellen Anspruch gerecht werden; denn – und das sollte noch einmal ausdrücklich hervorgehoben werden – Patienten und Angehörige geben an, dass sie einen Teil der zwischenmenschlichen Diskriminierung durch Personen, die für ihre Behandlung zuständig sind erfahren. 3 Editorial Das Stigma ist von einer gesundheitspolitischen Perspektive aus gesehen mitverantwortlich, dass innerhalb der Gesundheitsversorgung psychische Erkrankungen nach wie vor ein Randthema darstellen. Während reiche Staaten ihre Prioritäten auf die Prävention und Behandlung somatischer Erkrankungen, wie Herzkreislauf-Erkrankungen oder Malignome setzen, konzentrieren sich arme Staaten auf die Bekämpfung von Unterernährung oder AIDS. Während bei uns die Psychiatrie, in den letzten Jahrzehnten doch einen gewissen Aufschwung erlebt hat, sind in den armen Staaten für psychisch Kranke nach wie vor kaum Behandlungsmöglichkeiten existent [26]. Jedoch hier wie dort stehen psychisch Kranke sozial im Abseits; Stigma und Diskriminierung wegen psychischer Erkrankung sind ein an jedem Ort unserer Erde anzutreffendes Phänomen. Diese Randposition des psychisch Kranken und der Psychiatrie steht im Widerspruch zu den Ergebnissen der „Global-Burden-Forschung“ [25, 34]. Demnach werden weltweit 11,5 % der erkrankungsbedingten Belastungen (Mortalität plus Behinderung) durch psychische Erkrankungen verursacht. 28 % aller Lebensjahre, die Menschen mit einer Behinderung leben müssen, sind auf psychische Erkrankungen zurückzuführen. Eine der Ursachen, warum diesen auch sozioökonomisch relevanten Erkrankungen so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, liegt im Stigma. Somit gewinnt die Meinung von Norman Sartorius an Gewicht, wenn er im Stigma ein bedeutendes Hindernis für die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung sieht [29]. Stigma-Kampagne erstellt, die im Kontext des seitens der WPA weltweit initiierten Programmes „Against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia“ durchgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.openthedoors.com. Für das Sponsering sei dem Konsortium nachfolgender in alphabetischer Reihenfolge angeführten Firmen gedankt: • ASTRAZENECA Österreich GmbH • ELI LILLY GmbH • JANSSEN-CILAG Pharma GmbH • LUNDBECK Arzneimittel GmbH • NOVARTIS Pharma GmbH Literatur [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] Hinweis Dieses Themenheft wurde im Rahmen der Österreichischen Anti- [9] Amering M., H. Hofer, I. Rath: Trialog – Ein Erfahrungsbericht nach 2 Jahren „Erster Wiener Trialog“. In: Meise U., F. Hafner, H. Hinterhuber (Hrsg): Gemeindepsychiatrie in Österreich. VIP-Verlag Integrative Psychiatrie, Innsbruck (1998). Angermeyer MC.: Das Bild von der Psychiatrie in der Bevölkerung. Psychiat Prax 7, 327-329 (2000). Angermeyer MC., B. Schulze: Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Überlegungen. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 3945 (2002). Carius D., Steinberg H.: Allgemeinsprachliche Bezeichnungen für psychisch Kranke und Auffällige im Deutschen. Psychiat Prax 7, 321-326 (2000). De Col C., P. Gurka, E. Madlung-Kratzer, G. Kemmler, H. Meller, U. Meise: Soziale Distanz schizophren Erkrankter gegenüber psychisch Kranken. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 89-92 (2002). Fabrega H.: Psychiatric stigma in the classical and medieval period: a review of the literature. Comprehensive Psych 31, 289-306 (1990). Finzen A.: Stigma, Stigmabewältigung, Entstigmatisierung. Psychiat Prax 7: 316-320 (2000). Finzen A.: Psychose und Stigma. Stigmabewältigung – zum Umgang mit Vorurteilen und Schuldzuweisung. Psychiatrie-Verlag, Bonn 2000. Goffman E.: Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität (Englisch: Stigma Notes on the Management of Spoiled Identity. Prentice-Hall: Englewood Cliffs JJ, 1963). Suhrkamp Wissenschaftsverlag, Frankfurt/Main 1975. [10] Grausgruber A., W. Schöny: Einstellung zu psychisch Kranken. Neuropsychiatrie 9, 123-129 (1995). [11] Grausgruber A., H. Katschnig, U. Meise, W. Schöny: Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie. Neuropsychiatrie 3/4, Neuropsychiatrie 16, 1/2: 54-67 (2002). [12] Gutiérrez-Lobos K, A. Holzinger: Psychisch krank und gefährlich? Psychiat Prax 27: 336-339 (2000). [13] Gutiérrez-Lobos K: Rechtliche Benachteiligung psychisch Kranker in Österreich. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 22-26 (2002). [14] Hoffmann-Richter U.: Psychiatrie in der Zeitung. Edition das Narrenschiff, Bonn 2000. [15] Horvath C.: Stigma-Erfahrungen aus erster Hand. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 26-27 (2002). [16] Katschnig H.: Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts in Kraepelins, Bleulers und Schneiders Werk. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 11-19 (2002) [16a] Katschnig H., H. Donat, W. W. Fleischhacker, U. Meise: 4 x 8 Empfehlungen zur Behandlung von Schizophrenie. edition pro mente, Linz 2002. [17] Kissling W: Die Stigmatisierung psychisch Kranker: Unser Problem? Psych Prax 27: 313-315 (2000). [18] Lauber C., C. Nordt, L. Falcato, W. Rössler: Bürgerhilfe in der Psychiatrie: Determinanten von Einstellung und tatsächlichem Engagement. Psych Prax 27: 347-350 (2000). [19] Lauber C., C. Nordt, L. Falcato, W. Rössler: Behandlungsvorstellungen der Bevölkerung zu Depression und Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 99-102 (2002). [20] Link B., E. Struening, M. Rahav, J. Phelan, L. Nuttbrock: On stigma and its consequences: Evidence from a longitudinal study of men with dual diagnosis of mental illness and substance abuse. Journal of Health and Social Behavior 38, 177-190 (1997). [21] Lehmann A., D. Steinwachs: PORT Project: Patterns of Usual Care for Schizophrenia: Initial Results From the Schizophrenia Patient Outcomes Research Team (Port) Client Survey. Schizophrenia Bulletin, 24: 11-20 (1998). [22] Meise U.: Zur Qualitätsentwicklung der Behandlung von Menschen mit schi zophrenen Störungen – Ziele und Prinzipien. In: G. Klug (Hrsg) Versorgung und Qualität – Qualität der Versorgung. edition pro mente, Linz (1999). [23] Meise U., H. Sulzenbacher, G. Kemmler, R. Schmid, W. Rössler, V. Günther: „... nicht gefährlich, aber doch furcht- 4 Meise, Fleischhacker und Schöny [24] [25] [26] [27] [28] erregend“. Ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophrenie in Schulen. Psychiat Prax 27, 230-346 (2000). Meise U., A. Grausgruber, H. Katschnig, W. Schöny: Das Image der Psychopharmaka in der Österreichischen Bevölkerung. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 68-77 (2002). Murray C., A. Lopez: Alternative projections of mortality and disability by cause 1990 – 2020: Global Burden of Disease study. Lancet 349, 1498-1504 (1997). Okasha A: Mental health in Africa: the role of the WPA. World Psych 1:1: 32-35. Nordt C., L. Falcato C. Lauber, W. Rössler: Die Bewertung von Depression und Schizophrenie als psychische Krankheit und deren Einfluss auf die Hilfeempfehlung. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 103-107 (2002). Rath I.: Angehörige – Parias am Rande der Psychiatrie? Neuropsychiatrie 16, 1/2: 29-33 (2002). [29] [30] [31] [32] [33] Sartorius N.: Eines der letzten Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankung. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 5-10 (2002). Schöny W.: Schizophrenie hat viele Gesichter. Die österreichische Kampagne zur Reduktion des Stigmas und der Diskriminierung wegen Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 48-53 (2002). Schulze B., Angermeyer MC.: Perspektivenwechsel: Stigma aus der Sicht schizophren Erkrankter, ihrer Angehörigen und von Mitarbeitern in der psychiatrischen Versorgung. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 78-86 (2002). Stengler-Wenzke K., MC. Angermeyer, H. Matschinger: Depression und Stigma. Psychiat Prax 27: 330-335 (2000). Sulzenbacher H., Ch. De Col, R. Schmid, G. Kemmler, U. Meise: „Schizophrenie...bedeutet für mich gespaltene Persönlichkeit“. Ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophre- [34] [35] nie in Schulen. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 93-98 (2002). Üstün T., Chisholm D.: Global „Burden of Disease“-Study for psychiatric Disorders. Psychiat Prax 28 (1), 7-11 (2001). WPA: The WPA Global Programme against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia; Deutsche Übersetzung: pro-mente-Oberösterreich, Linz 1999. A. Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise Arbeitsgemeinschaft „Stigma“ der ÖGPP Univ.-Klinik für Psychiatrie Anichstraße 3, A-6020 Innsbruck e-mail: [email protected] ÜBERSICHT Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 5 – 10 Eines der letzen Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankung* Norman Sartorius Hôpitaux Universitaires de Genève Schlüsselwörter Schizophrenie – Stigma – Diskriminierung – Anti-Stigma-Programm – World Psychiatric Association Key words schizophrenia – stigma – discrimination, anti-stigma-program – Word Psychiatric Association Eines der letzen Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankung Das psychischen Erkrankungen anhaftende Stigma und die negative Diskriminierung, die gewöhnlich mit der Stigmatisierung vergesellschaftet ist, sind bedeutende Hemmfaktoren für die Entwicklungen der psychiatrischen Versorgung. Sie könnten gemindert oder gar vermieden werden. Sowohl für Programme im Bereich der psychischen Gesundheit wie auch für das Fach Psychiatrie ist die Bearbeitung des Stigma von vorrangiger Bedeutung. Gezielte Aktivitäten müssen aber „zu Hause“ – in der Psychiatrie – gesetzt werden; sie sollten dann in andere medizinischen Bereiche Eingang finden, damit schließlich breitere Bevölkerungsschichten erreicht werden können. Wenn der Befreiung vom Stigma psychischer Erkrankungen jene notwendige Priorität eingeräumt wird, erfordert dies für die psychiatrische Praxis konzeptuelle Änderungen. Für die Entwicklung entsprechender AntiStigma-Programme ist die internatio* nale Zusammenarbeit sinnvoll. Das Programm „Gegen Stigma wegen Schizophrenie“, das kürzlich von der World Psychiatric Association (WPA) initiiert wurde, zielt auch auf die Entwicklung von Arbeitsgrundlagen ab, die im Rahmen nationaler Aktivitäten verwendet werden können. Darüber hinaus soll mit diesem Programm ein gemeinsames Vorgehen und gegenseitiges Lernen gefördert werden. One oft the Last Obstacles to Better Mental Health Care: The Stigma of Mental Illness Stigma attached to mental illness and the negative discrimination that is usually associated with stigmatization are significant obstacles to the development of mental health programs. They can be diminished and perhaps even avoided. Work in this field is of primary importance for mental health programs and for psychiatry as a discipline. Relevant activities have to start ’at home’ within the psychiatric profession, and continue through the mobilization of other branches of medicine to finally encompass the broader structure of society. Conceptual modifications and changes in the practice of psychiatry will be necessary if the fight against the stigma of mental disorders is given the priority that it deserves. International collaboration is likely to be useful in the development of relevant programs. The program against stigma and discrimination resulting from schizophrenia launched recently by the (World Psychiatric Association) aims to develop material for use in national programs and thus facilitate joint action and learning from each other. Die Qualität der psychiatrischen Versorgung läßt sich anhand verschiedener Kriterien bewerten. Aus der Sicht der Patienten ist die Behandlung oder Rehabilitation dann gut, • wenn der Zugang zur Behandlung nicht begrenzt ist, • wenn sie mit Respekt behandelt werden, • wenn sie unvoreingenomme, belegbare und verständliche Aufklärung über die in ihrem Fall angebrachten Behandlungsmöglichkeiten erhalten, • wenn ihnen Mitsprache und eine Wahlmöglichkeit in der Behandlung eingeräumt wird, • wenn die Behandlung fachgerecht erfolgt, wodurch möglicher Schaden vermieden und der maximale Nutzen gefördert wird, • wenn Informationen über sie und ihre Erkrankung vertraulich behandelt werden, • wenn sie sich die Kosten der Behandlung leisten können, ohne Modifizierte Fassung des Artikels von Norman Sartorius „One of the Last Obstacles to Better Mental Helath Care: The Stigma of Mental Illness“ Erschienen in J. Guimón, W. Fischer, N. Sartorius, Hrsg (1999) The Image of Madness. Mit freundlicher Genehmigung des Karger-Verlages, Basel. Übersetzung: Rosi Schmid und Ullrich Meise, Gesellschaft für Psychische Gesundheit Tirol 6 Sartorius • andere Bedürfnisse wesentlich einschränken zu müssen und wenn die Menschenrechte über die Behandlungsdauer hinweg gewährleistet sind. Vom Standpunkt der in der Medizin tätigen ist die Behandlung dann gut, • wenn sie durch eine qualifizierte Person erfolgt, • wenn sie in geeignete Rahmenbedingungen eingebettet ist, • wenn ausreichende Belege und Erfahrungen über die Wirksamkeit und Sicherheit der vorgeschlagenen Behandlungsverfahren vorliegen, • wenn sich eine vom Vertrauen und Respekt getragene Beziehung zwischen Patient und den Behandlern entwickeln kann, • wenn die Rechte und Forderungen des Personal in psychiatrischen Einrichtungen beachtet werden und • wenn die Evaluation der Qualität der Behandlung auf eine transparente und gut dokumentierte Weise erfolgt. Die Behörden, die für die psychiatrische Versorgung zuständig sind, beurteilen die Qualität der Behandlung, indem sie vergleichen inwieweit die auf Evidenz und praktischer Erfahrung basierenden Regeln und Standards in der Alltagspraxis Eingang finden konnten. Um dies beurteilen zu können müssen Qualitätsmerkmale definiert werden. Diese beinhalten • Input-Indikatoren in Hinblick auf Investitionen in diesem Bereich der Gesundheitsversorgung, • Prozess-Indikatoren, die den Ablauf der Behandlung bestimmen, • Output-Indikatoren, die die Anzahl der durchgeführten Interventionen erfassen, • Ergebnis-Indikatoren, die Änderungen des Gesundheitszustandes von Einzelnen oder von Bevölkerungsgruppen erheben bzw. die Auswirkungen dieser Interventio- nen auf die Gesundheitsversorgung und die Gesellschaft belegen. Für jeden dieser Indikatoren gibt es eine qualitative (wie gut?) und eine quantitative (wieviel?) Antwortmöglichkeit. Das Stigma, das mit psychischen Erkrankungen einhergeht, berührt jede der oben genannten Forderungen nach einer qualitativ hochstehenden Versorgung. Der Zugang zur Behandlung hängt davon ab, wie sehr die Erkrankung von den Behörden und von der Öffentlichkeit als solche akzeptiert wird. Wenn Menschen mit psychischen Erkrankungen für gefährlich, faul, unzuverlässig und arbeitsunfähig gehalten werden oder nicht anzunehmen ist, dass sie sich jemals von ihrer Erkrankung erholen, dann wird es Widerstände, z.B. bei der Errichtung psychiatrischer Einrichtungen in guten Wohnbezirken geben. Die Zugänglichkeit von Behandlung hängt auch von der Zahlungsfähigkeit ab: Das Stigma psychischer Erkrankung verringert die Bereitschaft der Behörden, finanzielle Ressourcen in jenem Ausmaß bereitzustellen, die allen Betroffenen eine entsprechende Qualität der Behandlung gewährleisten würde. Den Betroffenen selbst fehlen häufig die entsprechenden Mittel, sich eine gute Behandlung leisten zu können. Die Folge ist, dass ihnen der Zugang zur bestmöglichen Behandlung verwehrt wird und stattdessen Behandlungsalternativen von geringerer Qualität angeboten werden, was zudem häufig mit einem erheblich administrativen Aufwand verbunden ist. Eine suboptimale Versorgung führt jedoch zwangsläufig zu schlechteren Behandlungsergebnissen, was wiederum den Mythos der Unheilbarkeit psychischer Erkrankungen verfestigt. Darüber hinaus verstärkt sich sowohl bei den Patienten als auch bei den Professionellen, die für die Behandlung verantwortlich sind, das Gefühl, keine Wahlmöglichkeit zu haben. Ebenso beeinträchtigen schlechte Arbeitsbedingungen die Qualität der Bewerber für diverse Stellen im psychiatrischen Versorgungssystem. Obwohl solche Bedingungen zweifellos als lohnende Herausforderung angesehen werden, zögern manche Kandidaten, die in diesen Beruf einsteigen wollen, und wählen schlussendlich ein anderes Betätigungsfeld innerhalb der Medizin. Unzureichende Ressourcen verringern das Spektrum der angebotenen Behandlungsmethoden (was wiederum die Wahlmöglichkeit der Patienten einschränkt) und erschweren es Fachkräften, ihr Wissen durch zusätzliche Fortbildung zu vertiefen und auf dem neuesten Stand zu halten. Paradoxerweise trägt das Stigma, das zur schlechteren Qualität psychiatrischer Dienste führt auch dazu bei, dass Informationen über Patienten und ihre Erkrankungen keinem ausreichenden Schutz unterliegen. Das Stigma psychischer Erkrankung ist allgegenwärtig und nimmt zu In allen Kulturen haftet psychischen Erkrankungen ein Stigma an. Manchmal führt dies zu einer positiven Diskriminierung, z. B. wenn Symptome einer psychischen Erkrankung als Zeugnis göttlicher Besessenheit gedeutet werden. Meistens jedoch führt das Stigma zu einer negativen Diskriminierung der Erkrankten, mehr noch; auch ihre Familien sind sowohl in der gegenwärtigen wie auch in den nachfolgenden Generationen von Benachteiligungen und Stigmatisierung betroffen. Das mit psychischer Erkrankung einhergehende Stigma und die negative Diskriminierung betreffen auch das psychiatrische Versorgungssystem, psychiatrische Krankenhäuser, Psychopharmaka, Psychiater Das Stigma psychiatrischer Erkrankungen und andere in der Psychiatrie Tätige. Grundsätzlich durchdringt das Stigma alles und wirkt schädigend. Das Stigma und die Intoleranz gegenüber dem „Anderssein“ (im speziellen jenem, das im Gefolge einer psychischen Erkrankung auftreten kann) haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich: Eine zunehmende Verstädterung und die steigende Bevölkerungsdichte in den Städten erhöhen beispielsweise die Bereitschaft, dass Menschen nicht mehr fähig (oder bereit) sind, in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft jemanden zu tolerieren, der fallweise oder öfters ein störendes Verhalten an den Tag legt. Die steigende Komplexität der Arbeitswelt senkt die Chance, dass Menschen, die schlechter qualifiziert sind, eine Anstellung finden. Dies gilt auch für jene, bei denen eine Erkrankung den Verlust bestimmter Fähigkeiten oder bleibende Beeinträchtigungen nach sich zieht. Arbeitslosigkeit wirkt sich auf die psychische Gesundheit negativ aus und führt zu einem zusätzlichen Stigma. Die Medien haben seit langem (auf Grund ihres wachsenden Einflusses in den letzten Jahren verstärkt) ein negatives Bild psychisch erkrankter Menschen gezeichnet. Bösewichte in Fernsehfilmen werden sehr oft als geistig abnorm oder psychisch krank dargestellt. Gewalttätigkeit gilt als beinahe sicherer Hinweis für eine psychische Erkrankung (obwohl die meisten Gewalttaten von Personen begangen werden, die nie an einer nachweisbaren psychischen Störung erkrankt waren). Mit Vorliebe werden in Zeitungsberichten und auch in Spielfilmen dunkle und negative Eigenschaften psychiatrischer Institutionen gezeigt. Im Gegensatz dazu wird über andere medizinische Bereiche positiv berichtet und ihre Leistungen werden gewürdigt. Natürlich gibt es in der Geschichte der Psychiatrie viele Gründe für eine negative Einstellung gegenüber jenen Systemen, die psychisch erkrankte Menschen häufig nur verwahrten. Obwohl viele dieser Ursachen nicht mehr existent sind – heute gibt es beispielsweise effiziente Behandlungsmöglichkeiten, der Schutz psychisch erkrankter Menschen ist hinsichtlich der Menschenrechte so gut wie noch nie – haftet den psychiatrischen Institutionen immer noch ein negatives Image an. Seitens antipsychiatrischer Gruppierungen wird dies immer wieder in Form von Medienberichten, in Bildern oder Schriften verstärkt. Das Anwachsen der Mittelschicht in vielen Ländern trägt zur Gleichschaltung eines bestimmten Verhaltens bei und fördert die Abneigung, Ausnahmen zu machen und Unterschiede zu tolerieren. Das Ineinandergreifen der Kulturen – nämlich weltweit – zeigt sich auch an einer bemerkenswert zunehmenden Angleichung in Bekleidung, musikalischen Vorlieben, Ernährungsgewohnheiten sowie in den Unterhaltungs- und Freizeitaktivitäten. So wird das Leben für jene, die in irgendeiner Weise anders sind, immer schwerer. Die Spirale der Benachteiligung durchbrechen Es ist ein vordringliches Ziel, die Spirale der Benachteiligung, die auf Grund eines Stigmas entsteht, zu unterbrechen. Kürzlich erschienene Berichte [1] belegen, dass weltweit psychische Störungen für eine Großteil der Behinderungen verantwortlich sind. Es gibt Hinweise dafür, dass sich in Zukunft diese Situation verschärft. Anhand einer Vielzahl von Untersuchungen kann eindeutig nachgewiesen werden [2], dass die Behandlung psychischer Störungen erfolgreich, effektiv und kostengünstig ist. Differenzierte Behandlungsprogramme können psychisch erkrankte Menschen und ihren Familien helfen: Für den Großteil der Personen, die davon profitieren könnten, stehen jedoch derzeit weder die 7 gesamten Behandlungsoptionen, noch ein ausreichendes Versorgungssystem zur Verfügung. In Entwikklungsländern (aber auch in anderen Ländern) sind die Mittel, die für psychische Gesundheit zur Verfügung gestellt werden, äußerst gering. Die zuvor beschriebene Situation wird nicht unbedingt dazu beitragen, dass psychiatrischen Diensten und Behandlungsprogrammen in Zukunft eine höhere Priorität eingeräumt wird. Aus diesem Grund müssen entschlossen Gegenmaßnahmen getroffen werden. Tabelle 1 gibt die Abfolge in der Spirale der Benachteiligungen wider: An jeder Stelle können entsprechende Gegenmaßnahmen wirksam sein und sie sollten auch ergriffen werden. In der Psychiatrie empfiehlt sich eine primäre Prävention für jene Störungen, die sich auf eine bekannte Pathogenese zurükkführen lassen. Ein eindrucksvolles Beispiel für die Möglichkeit der primären Prävention ist der Kretinismus, der auf einen Jodmangel beruht: Die Korrektur dieses Mangels würde das Auftreten schwerer geistiger Behinderungen verringern. Die Rolle der Psychiater i. R. dieser Intervention liegt darin, Maßnahmen im öffentlichen Gesundheitswesen einzufordern, die dann von anderen Bereichen des Gesundheitssystems implementiert werden sollten; eine Rolle, die ebenso für andere primäre Präventionsmaßnahmen gilt [3]. Für eine Reihe psychischer Störungen sind die Möglichkeiten der primären Prävention beschränkt oder gar nicht vorhanden. Eine erfolgreiche Behandlung kann in diesem Fall die Dauer einer psychischen Störung verkürzen, bleibende Behinderungen vermindert und die Gleichstellung psychischer Erkrankungen mit anderen Erkrankungen fördern. Wo die Behandlung nicht so erfolgreich ist und dadurch Behinderungen nicht vermieden werden können oder wenn die Erkrankung über einen längeren Zeitraum andauert, sollten die Interventionen auf eine Reduzierung des an die Krankheit gebunden Stigmas 8 Sartorius • Tab. 1. Schritte, die zur Benachteiligung führen Erkankung Interventionen Prävention oder Gesundung durch Behandlung Behinderung Verminderung von Behinderung An Erkrankung oder Behinderung gekoppeltes Stigma Trennung von Stigma und Erkrankung bzw. Behinderung An Stigma gekoppelte Diskriminierung Abbau von Diskriminierung, auch wenn Stigma fortbesteht Reduktion der Rehabilitationsmöglichkeiten zusätzliche Optionen für Berufstätigkeit und neue soziale Rollen • • • Versagen in sozialen Rollen verschlechtert Erkrankung und Behinderung hinzielen; durch Gesundheitserziehung, Medienberichte, geeigneter Weiterbildung von im Gesundheitswesen Tätigen und ähnlichen Maßnahmen. Manchmal wird es dennoch nicht möglich sein, die Krankheit von ihrem Stigma zu trennen: Wenn dies der Fall ist, sind Interventionen im öffentlichen Gesundheitswesen mit gesetzlichen Interventionen zu koppeln um die negative Diskriminierung zu verringern oder gar zu eliminieren. Stigma und Diskriminierung erschweren die Möglichkeit der Rehabilitation und den normalen Zugang zu verschieden sozialen und individuellen Rollen: Dazu wäre die Entwicklung von alternativen und zusätzlichen Arbeitsmöglichkeiten unter Einbeziehung jener, die an psychischen Störungen leiden, eine wichtige Maßnahme. Letztlich wird in manchen Fällen eine Behandlung nicht erfolgreich sein und die Erkrankung wird zu Behinderung und zu Fähigkeitsstörungen führen, von der Arbeit angefangen bis hin zur Fähigkeit sich selbst zu versorgen. In diesem Fall müssen die Interventionen darauf abzielen, das Fehlverhalten und die Diskriminierung zu entkop- Entstigmatisierung des Versagens in sozialen Rollen peln, da letzere sich im Gefolge eines abweichenden Verhaltens entwickeln kann. Die Entscheidung, die oben beschriebene Benachteiligungs-Spirale durch mehr Engagement zu durchbrechen, ist sowohl vor einem konzeptuellen als auch praktischen Hintergrund zu befürworten. Die Vorstellung, dass eine psychische Störung ein dauerhafter Zustand ist, sie immer mit ausgeprägten Beeinträchtigungen individueller und sozialer Fertigkeiten vergesellschaftet ist, muss korrigiert werden. So müssen im Gesundheitswesen Tätige wie auch die Bevölkerung, psychisch Erkrankte inbegriffen, akzeptieren, dass • psychische Erkrankungen nicht immer langandauernd sind, • eine Erkrankungsepisode nicht bedeutet, dass die betroffene Person von nun an für immer als psychisch krank gelten kann, • die meisten psychischen Erkrankungen zu keinen wesentlichen Störungen im sozialen Verhalten führen und selbst wenn es so ist, diese Störungen zumeist reversibel sind, auch das Sozialverhalten der meisten Menschen nicht immer vollkommen ist, und es daher richtig und gerechtfertigt ist, gegenüber abweichendem Verhalten und nonkonformistischer Lebensgestaltung toleranter zu sein, die Tatsache, einen Arbeitsplatz zu haben oder aus ökonomischer Sicht produktiv zu sein nicht das einzige oder wichtigste Kennzeichen für psychische Gesundheit darstellt, im Falle einer Komorbidität von psychischen und körperlichen Erkrankungen eine Behandlung auf beiden Ebenen ansetzen muss und die Behandlung einer psychischen Erkrankung die Prognose einer körperlichen Erkrankung signifikant verbessert, was vice versa ebenso zutrifft. In Übereinstimmung mit konzeptuellen Veränderungen müssen auch die Planung und Praxis der psychiatrischen Behandlung neu überdacht werden. Neben dem notwendigen Respekt gegenüber den Patienten und dem Schutz ihrer Rechte sollte jene Behandlung bevorzugt werden, die eine Stigmatisierung nicht noch zusätzlich fördert. So sollte der Patient beispielsweise eher im Rahmen allgemeiner Gesundheitseinrichtungen behandelt werden als in psychiatrischen Institutionen, denen ein zweifelhafter Ruf anhaftet. Behandlungen, die keine Nebenwirkungen nach sich ziehen, sind zu bevorzugen (oder Dosierungen sollten so angepasst werden, dass Nebenwirkungen gering gehalten werden, selbst wenn dadurch Erkrankungssymptome langsamer oder unvollständig remitieren). Auch die Beziehung zwischen Arzt und Patient muss beachtet werden: Dazu gehören das sich Zeit-nehmen und das aufmerksame Hinhören auf die Ausführungen der Patienten, wie sie mit der Erkrankung ihr Leben bewältigen. So kann der Behandler wertvolle und neue Erkenntnisse Das Stigma psychiatrischer Erkrankungen gewinnen, von denen auch andere Patienten profitieren und die für die Ausbildung von Psychiatern, Allgemeinärzten oder anderen Gesundheitsberufen wichtig sind. Programme, die zum Ziel haben Stigma und Diskriminierung psychisch erkrankter Menschen zu verringern Der Umstand, dass eine psychische Erkrankung gleichzeitig zum Stigma und zur Diskriminierung führt, behindert sehr wesentlich eine qualitativ angemessene psychiatrische Versorgung. Dies wurde in einigen Ländern, wie Schweden oder Australien erkannt. Hier wurden von der Regierung oder von NGO’s AntiStigma-Kampagnen durchgeführt. Auch die Word Psychiatric Association (WPA) hat ein internationales Programm, das sich gegen das Stigma und die Diskriminierung wegen Schizophrenie richtet, ins Leben gerufen. Aus mehreren Gründen wurde dieses Programm auf die Schizophrenie fokusiert. Es handelt sich dabei um schwere psychische Erkrankungen mit Symptomen, die die Öffentlichkeit üblicherweise mit psychischen Störungen in Verbindung bringt, wie z.B. Halluzinationen, Wahnvorstellungen (die häufig bizarr und unverständlich erscheinen), psychomotorischen Auffälligkeiten oder Inkohärenz. Diese Störungen sind oft langwierig und führen oft zu psychischen Behinderungen. Eine Rehabilitation kann aufwendig und langwierig sein. Ihr Erfolg hängt in hohem Maße von der Einstellung und dem Verhalten der Umgebung und nicht zuletzt von dem Patienten selbst ab. Ein Abbau des Stigmas, das die Schizophrenie 1 umgibt, ist eine besonders hohe Herausforderung. Es ist zu hoffen, dass, wenn dieses Programm erfolgreich ist, sich die Lebensqualität der Betroffenen (und ihrer Angehörigen) deutlich verbessert, und in der Folge ähnliche Programme für andere Erkrankungen entwickelt werden. Das Programm der WPA unterscheidet sich in vieler Hinsicht von anderen Initiativen. Zunächst ist es international und es wird weltweit durchgeführt. Weiters ist es in akkumulativer Art und Weise organisiert: Erfahrungen, die im ersten Land mit diesem Programm gemacht wurden, werden Jenen, die in einem zweiten Land damit beginnen, zur Verfügung gestellt. Die Erfahrungen beider Länder dienen wiederum dem dritten Land als Quelle der Inspiration und so weiter. Mit dem Programm gegen Stigma wegen Schizophrenie wurde in der Provinz Alberta in Kanada begonnen: In der Folge wurde das Programm 1999 in Spanien – zuerst in einem Bezirk von Madrid und in der Folge im gesamten Land – sowie in Österreich [4] eingeführt. Nachdem die Kampagne in diesen drei Ländern in Gang gesetzt wurde, wurden sie von anderen europäischen Ländern – Griechenland, Deutschland und Italien – sowie von zwei Entwicklungsländern – Ägypten und Indien – übernommen. In Deutschland und in Indien werden die Programme an verschiedenen Orten durchgeführt: In Indien benützen alle Zentren dasselbe Programm, während in Deutschland von jedem Zentrum unterschiedliche Schwerpunkte wahrgenommen werden, die natürlich untereinander kompatibel sind. Kürzlich traten dem Programm zwei Länder in Lateinamerika – Brasilien und Chile – andere europäische Länder – Polen, Rumänien, Slowakei – wie auch Marokko bei. Das Programm wird durch eine Steuerungsgruppe1 geleitet, die eng mit jenen 9 Gruppen zusammenarbeitet, die in den teilnehmenden Staaten dafür verantwortlich sind. Das WPA-Programm geht die Probleme mit dem Stigma und der Diskriminierung nicht lautstark an – indem etwa alle Menschen gleichzeitig mit Botschaften beschallt werden. Es ist selektiv und richtet seine Aktivitäten auf Gruppen, die für den Prozess der gewünschten Verhaltensmodifikation wichtig sind. Das Programm geht primär nicht von der Theorie aus, vielmehr basiert es auf den Erfahrungen von Betroffenen und zielt auf die Beseitigung jener Probleme ab, die diese am meisten belasten. Die Leitung des Programmes obliegt nicht Psychiatern, vielmehr versuchen diese, nützliche Partner in einem Team zu sein, das aus Personen unterschiedlicher kommunaler Organisationen, Fachleuten aus unterschiedlichen Disziplinen, Vertretern von Patienten- und Angehörigenorganisationen, Journalisten, Politikern etc. zusammengesetzt ist. Das Programm ist vom Grundsatz geleitet, dass das Erreichbare umzusetzen besser ist, als einen Idealzustand herstellen zu wollen. Dort wo das Stigma beispielsweise nicht rasch veränderbar ist, versucht das Programm zuerst die Diskriminierung zu verringern. Wo Diskriminierung schwer zu verändern ist, versucht es, Alternativen für jene Situationen zu eröffnen, in welchen diese besonders schädigend und schmerzvoll ist. Dieses Anti-Stigma-Programm wird von unterschiedlichen Organisationen gefördert. Eine großzügige Unterstützung durch die Firma Eli Lilly half besonders am Anfang und ermöglicht nachwievor die Entwicklung von Arbeitsunterlagen. Lokale Förderungen werden durch staatliche und nicht-staatliche Organisationen, Zuschüssen seitens der Industrie und Spenden geleistet. Keiner, der am Programm Die Mitglieder des Steering-Comitees sind Professor J. Lopez-Ibor, Präsident des WPA (Vorsitzender), J. Arbuleda-Flores, N. Sartorius (Wissenschaftlicher Direktor des Programms), N. Stefanis und N. N. Wig. Die Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, die sich mit spezifischen Aspekten des Programmes beschäftigten, sind Professor W. W. Fleischhacker, Professor H. Häfner, Professor J. Leff und Professor R. Warner. 10 Satorius mitarbeitet, erhält ein Honorar. Die Belohnung soll durch das Gefühl erfolgen, an einem wichtigen und sinnvollen Projekt mitzuarbeiten. Die bisher vorliegenden Arbeitsunterlagen beinhalten die Beschreibung des Ablaufes jener Maßnahmen, die in jedem am Programm teilnehmenden Land gesetzt werden sollten. Für jeden dieser Schritte wird der dafür erforderliche Zeitrahmen angegeben. Natürlich können die einzelnen Länder die veranschlagte Zeit variieren, die sie für die einzelnen Umsetzungsschritte benötigen. Die Unterlagen beinhalten den gegenwärtigen Stand des Wissens über schizophrene Störungen und jene Fakten, die für das Anti-StigmaProgramm von besonderer Bedeutung sind. Diese zwei Publikationen – die Richtlinien für die Programmentwicklung und die Zusammenfassung des Wissens über Schizophrenie – die für das WPA-Programm entwickelt wurden [5] erstellten Arbeitsgruppen, an denen Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und Ländern teilnahmen. Drei weitere Arbeitsunterlagen sind in Vorbereitung: Eine Beschreibung wie jene Orte, die in der ersten Phase am Programm teilgenommen haben dieses weiterenwickelten (Band 3), sowie die Darstellung ähnlicher oder verwandter Programme, die bereits in der Vergangenheit durchgeführt wurden (Band 4). Weiters wird ein „Baukasten“ erarbeitet, der Unterlagen wie Videos, Poster, Filme und Bücher enthält, die jenen die Programme ausführen, nützlich sein können (Band 5). Alle Unterlagen, die im Band 5 enthalten sind, wurden durch eine eigene Arbeitsgruppe geprüft. Es wird auch darauf verwiesen, für welchen Anlass, und in welcher Weise diese Arbeitsunterlagen verwendet werden können. Die Erfahrungen, mit dem bisherigen Verlauf des Anti-StigmaProgrammes, sind bereits sehr reichhaltig und die Fülle der Arbeitsunterlagen, die von den Arbeitsgruppen der teilnehmenden Ländern erstellt wurden, ist eindrucksvoll. Mitglieder dieser Arbeitsgruppen beraten jene, die in anderen Ländern neu beginnen. Es ist zu erwarten, dass dieses System der kaskadenartigen Weitergabe von Wissen nicht nur jenen nützt, die neu beginnen, sondern auch die ermutigt, welche in ihrer Arbeit bereits fortgeschritten sind. Die Auswirkungen der Programme werden evaluiert, wobei sowohl Veränderungen in der Wahrnehmung sowie den Einstellungen und Verhalten, sowie Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen in einzelnen Ländern erhoben werden. Die Richtlinien des Programmes und die dazugehörigen Arbeitsunterlagen werden laufend überarbeitet. Dies unterstreicht das wichtigste Merkmal dieses Programmes: Es soll sich nicht um eine kurzfristige Kampagne handeln sondern das Programm soll Flexibilität aufweisen und über einen längeren werden. Zeitraum durchgeführt Literatur [1] Murray CJL, Lopez AD: The Global Burden of Disease. Boston, Harvard School of Public Health (1996). [2] Sartorius N, deGirolamo G, Andrews G, German A, Eisenberg L (eds): Treatment of mental disorders. A review of effectiveness. Washington, American Psychiatric Press (1993). [3] Sartorius N, Henderson AS: The neglect of prevention in psychiatry, Aust NZ J Psychiatry: 26:550 (1993). [4] Schöny W.: Schizophrenie hat viele Gesichter: Die Österreichische Kampagne zur Reduktion des Stigmas und der Diskriminierung wegen Schizophrenie. Neuropsychiatrie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 48-53 (2002). [5] World Psychiatric Association: Fighting Stigma and Discrimination because of Schizophrenia, New York, World Psychiatric Association. Vol 1 and 2 (1998). Univ.-Prof. Dr. Norman Sartorius Hôpitaux Universitaires de Genève Belle-Idée, Bâtiment Saleve 4, chemin du petit-Bel-Air CH-1225 Chêne-Bourg www.openthedoors.com ÜBERSICHT Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 11 – 19 Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts in Kraepelins, Bleulers und Schneiders Werk* Heinz Katschnig Universitätsklinik für Psychiatrie, Wien Schlüsselwörter Bleuer – Kraepelin – Schneider – Stigma – Schizophrenie – Dementia praecox – Entstigmatisierung – Syptome ersten Ranges Key words Bleuer – Kraepelin – Schneider – stigma – Schizophrenia – Dementia praecox – diminishing stigma – first rank symptoms Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts in Kraepelins, Bleulers und Schneiders Werk Die in der Öffentlichkeit bestehenden falschen Vorstellungen über psychische Krankheiten werden im Fall der Schizophrenien durch spezifische Inhalte verschlimmert: durch die Ideen der „Unheilbarkeit“, der „gespaltenen Persönlichkeit“ und der „Verrücktheit“, deren Wurzeln in diesem Beitrag bei Emil Kraepelin, Eugen Bleuler und Kurt Schneider aufgespürt werden. Emil Kraepelins Konzept der „Dementia praecox“ als unweigerlich zu seelischem Siechtum führende Geisteskrankheit entstand auf der Basis einer auf psychiatrische Anstalten eingeschränkten Erfahrungsbasis. Zwar gibt es derartige „chronische“ Verläufe, sie stellen aber keineswegs die häufigste Form der Krankheit dar, die ausserdem heute gut behandelbar geworden ist. Eugen Bleulers Terminus technicus „Schizophrenie“ hat durch falsche Rückübersetzung als „gespaltene Persönlichkeit“ ein Eigenleben entwickelt, das weder Bleulers Intentionen entsprach (er stellte kognitive und affektive Störungen in den Vordergrund), noch mit der Krank- * Erscheint auch in Psychiatria danubina heitsrealität etwas zu tun hat. Schliesslich hat Kurt Schneider mit seinen „Symptomen 1. Ranges“ Wahnideen und Halluzinationen als für die Schizophreniediagnostik zentral dargestellt, ausschliesslich mit der Absicht, Symptome, die auch von Nicht-Fachleuten (wie praktischen Ärzten und Amtsärzten) leicht erkannt werden können, in den Vordergrund zu rücken, und nicht mit einer theoretischen Begründung. Gerade Schneiders „Symptomen 1. Ranges“, die allesamt „Verrücktheit“ signalisieren, wird in den modernen psychiatrischen Diagnoseschemata – im Vergleich zu kognitiven und affektiven Störungen – ein überdimensionaler Stellenwert zugeschrieben, und die Laienkonzepte spiegeln dies wider. Was ist angesichts dieser Inhalte im Sinne der Stigmareduktion zu tun? Zum ersten müssen offenkundig falsche „Wissensbestände“ in der Allgemeinbevölkerung („Unheilbarkeit“, „gespaltene Persönlichkeit“) durch entsprechende Kampagnen, nicht zuletzt auch bei psychiatrisch nicht ausgebildeten Ärzten, korrigiert werden. Zusätzlich gilt es, innerhalb der Psychiatrie die Diagnosedefinitionen zu revidieren und allzu leichtfertig „vereinbarte“ Kriterien theoretisch zu hinterfragen. Dabei könnte das Abgehen von Halluzinationen und Wahnideen und die Rückbesinnung auf Bleulers Assoziations- und Affektstörungen sowie die Berücksichtigung des Vulnerabilitäts-StressCoping-Modells nützlich sein. Dies könnte zu einer prinzipiellen Neuorientierungen führen, zum Abgehen von kategorialen und zur Hinwen- dung zu dimensionalen Einteilungen und zur Hervorhebung von dysfunktionalen Prozessen im Gegensatz zu starren Krankheitsentitäten. Eine solche Entwicklung wäre einer Entstigmatisierung förderlich. Kraepelin’s, Bleuler’s and Schneider’s concepts of Schizophrenia – their relevance for the stigma process In the case of schizophrenia the negative public stereotype of mental illness is aggravated by the more specific preconceptions of „chronicity“, „split personality“ and „madness“ (in the sense of hallucinations and delusions). These elements of the public stereotype of schizophrenia can be traced back to Emil Kraepelin, Eugen Bleuler and Kurt Schneider respectively. „Chronicity“ and „deterioration“ were the essence of Kraepelins concept of „dementia praecox“, which, as can be shown today, was biased due to the more severely ill patients Kraepelin saw in the mental hospitals of his time. While Bleuler corrected this concept of chronicity by pointing out that several subtypes exist and that the defining criterion should be psychopathology and not the course, he unwittingly created another misunderstanding by introducing the term of „schizophrenia“. This term served for capturing the basic symptomatolgy – the dissociation of the different psychological functions (cognitive, affective) –, but was wrongly re-translated as „split personality“, as which it is used in the public domain. Kurt Schneider, final- 12 Katschnig ly, insisted on delusions and hallucinations as diagnostically leading symptoms, which he therefore called „first rank symptoms“. While Schneider pointed out that he had not intended to relate this proposal to any theory of schizophrenia, but that he had mainly chosen these symptoms because of their easiness of recollection (his first publication on the „first rank symptoms“ addressed itself to general practitioners and public health physicians), his followers raised them to the leading diagnostic criterion, as which they figure in all newer DSM and ICD revisions. It is suggested that the wrong content of the public stereotype of schizophrenia justifies antistigma campaigns as far as „chronicity/untreatabiltiy“ and „split personality“ are concerned, but that in the case of the „madness“ symptoms of hallucination and delusions a revision of the psychiatric diagnostic definitions themselves might be more appropriate. Newer conceptions of schizophrenia put more emphasis on cognitive and affective processes and on a dimensional vulnerability rather than a categorical disease concept. It is suggested that such a change in orientation will probably also contribute to diminishing the stigma of schizophrenia. Dass sich Menschen auch schon vor der “Schizophrenie-Ära” geweigert haben, in ein psychiatrisches Krankenhaus zu gehen, ist in einem „Fragebogen für die Aufnahme in die psychiatrische Klinik zu Dorpat“ aus dem Jahre 1890 ersichtlich. Dort heisst es gleich zu Beginn, bevor noch die Angehörigen nach Personalien und Lebensumständen des Aufzunehmenden gefragt werden: „Es wird gerathen bei der Ueberführung des Kranken in die Anstalt keine List anzuwenden, sondern ihm einfach zu erklären, dass eine Behandlung für ihn jetzt nöthig sei“. Wie erfolgreich diese Strategie war, wissen wir nicht. 1 Auf jeden Fall ist deutlich, dass die Betroffenen, ihre Angehörigen und die Fachleute schon damals mit vorhersehbaren negativen Folgen rechnen mussten, wenn jemand in die Psychiatrie aufgenommen werden sollte. Die psychiatrische Klinik in Dorpat war nicht irgendeine Klinik. Dorpat heissst heute Tartu und ist die einzige Universitätsstadt Estlands. Das schöne Holzgebäude der Klinik aus dem Jahre 1880 steht noch heute. Von 1886 bis 1891 leitete sie der deutsche Psychiater Emil Kraepelin (18561926), der bekanntlich 1899 – inzwischen war er nach Heidelberg übersiedelt – die Krankheitsdefinition der späteren „Schizophrenie“ grundgelegt hat (Kraepelin, 1899). Dass er die Krankheit damals noch „Dementia praecox“ genannt hat, wird uns gleich noch beschäftigen. Auf jeden Fall geht die Unterteilung der „grossen Psychosen“ in das „Manisch-depressive Irresein“ (heute Manisch-depressive Krankheit = MDK oder Bipolare Störung) und die „Dementia praecox“ (heute Schizophrenie) auf Kraepelin zurück. Seit damals sind über 100 Jahre vergangen. Obwohl sich die Kraepelinsche Zweiteilung der großen Psychosen als konstanter roter Faden durch das 20. Jahrhundert bis heute in den psychiatrischen Klassifikationsschemata erhalten hat, hat sich das Konzept der Dementia praecox selbst inhaltlich verändert. Wie man jedem Psychiatrielehrbuch entnehmen kann, waren die diesbezüglich einflussreichsten Personen Eugen Bleuler (1857–1939) und Kurt Schneider (1887–1967)1. Alle heute in den relevanten internationalen Klassifikationsschemata enthaltenen Schizophreniedefinitionen gehen auf Elemente zurück, die Emil Kraepelin, Eugen Bleuler oder Kurt Schneider eingeführt haben. Ihre Leistung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, haben sie doch auf einem Gebiet, das gedanklich äußerst schwierig zu fassen ist, Ordnungsversuche unternommen, die aus der allgemeinen Irrationalität, die das Thema der Geisteskrankheiten kennzeichnet, zu einer Wissenschaftlichkeit geführt haben, die zwar manchen als distanziert erscheint, insgesamt aber zu einer Humanisierung dieses Gebietes beigetragen haben. Unabhängig davon ist die Tatsache zu sehen, dass ihre Konzepte zu einigen heute als falsch einzustufenden Inhalten des öffentlichen Vorurteils über die Schizophrenie beigetragen haben, was aber eher damit zusammenhängt, dass die Nachfolger und die Laien einzelne Aspekte über Gebühr in den Vordergrund gerückt haben. Kraepelin hat die Idee der Unheilbarkeit eingeführt, auf Bleuler geht das meist als „gespaltene Persönlichkeit“ missverstandene Wort „Schizophrenie“ zurück, und Kurt Schneider hat mit seiner Hervorhebung von Halluzinationen und Wahnideen als „erstrangig“ die Idee der Verrücktheit (im Sinne von Wahnideen und Halluzinationen) in den Vordergrund gestellt. Das allen psychisch Kranken gemeinsame Stigma – das offensichtlich schon vor der Schizophrenie-Ära vorhanden war – wird durch diese drei spezifischen Elemente der Diagnose „Schizophrenie“ de facto potenziert. Dabei hat sich heute ergeben – und darauf werden wir am Ende dieses Aufsatzes zurückkommen – , dass es wissenschaftlich nicht gerechtfertigt ist, auch nur eines der genannten Kriterien – „unheilbar“, „gespaltene Persönlichkeit“, „verrückt“ – als konstituierend für das anzusehen, was man seit Bleuler Schizophrenie nennt. Im Gegenteil: Etwas völlig anderes, nämlich Bleulers vergleichsweise vernachlässigtes Konzept der „Assoziationsstörungen“ und der „Affektstörungen“, die er als „Grund- Dies gilt für Europa; in den USA war bis zum Erscheinen des DSM-III im Jahre 1980 der emigrierte Schweizer Psychiater Adolf Meyer (18661950) mit seinem „biopsychosozialen Konzept“ am einflussreichsten; dann schwenkte die amerikanische Psychiatrie auf die hier dargestellte europäische Linie ein, und nannte ihren Ansatz sogar „neo-kraepelinianisch“. Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts ... symptome“ der Schizophrenie ansah, erfährt offensichtlich eine wissenschaftliche Wiederbelebung (Sachs und Katschnig, 2001). Emil Kraepelins Beobachtungen in einem fernen Land und die Idee der Unheilbarkeit der „Dementia praecox“ Es war schon seltsam. Da wurde im Jahre 1886 – die universitäre Psychiatrie war kaum zwanzig Jahre alt ein aufstrebender junger Psychiater aus Deutschland auf den Psychiatrielehrstuhl eines Ortes berufen, an dem die meisten Menschen im Alltag Sprachen verwendeten, die er nicht verstand und sich auch nicht rasch aneignen konnte – nämlich estnisch, russisch und lettisch. Während in Wien der gleichaltrige Sigmund Freud (1856–1939) im selben Jahr seine Praxis eröffnete und seine Methode auf das „Verstehen“ dessen aufbaute, was ihm seine Patienten über ihr Innenleben mitteilten, musste sich Kraepelin in Estland (das damals Teil des zaristischen Russland war) von seinen Assistenzärzten dolmetschen lassen, was die Kranken sprachen. Er machte aus der Not eine Tugend und wurde ein präziser Beobachter des äusseren Krankheitsverlaufes (Katschnig, 1998 und 2001). Manche von Kraepelins Patienten – sie litten entweder an schweren depressiven oder schweren manischen Verstimmungszuständen – konnten nach mehreren Monaten Klinikaufenthalt wieder gesund entlassen werden (wobei es ja damals die heute verfügbaren Therapiemethoden noch nicht gab), kamen aber im Laufe Ihres Lebens immer wieder, wobei sie nach den Entlassungen oft viele 2 Jahre gesund waren. Die Krankheit dieser Patienten nannte Kraepelin „Manisch-depressives Irresein“. Eine andere Gruppe von Patienten wurde überwiegend im jugendlichen Alter erstmals krank und in der Psychiatrie aufgenommen; die Betroffenen litten an einem eigenartigen geistigen Schwächezustand, an Wahnideen und Halluzinationen und wurden nicht mehr gesund. Da Kraepelin hier eine Analogie zu der unheilbaren senilen Demenz und zu der ebenfalls irreversiblen Demenz der progressiven Paralyse gegeben schien, nannte er diese Krankheit „Dementia praecox“, die im Gegensatz zu den anderen Demenzformen eben „vorzeitig“ im Leben auftrat, aber für Kraepelin genauso unheilbar war wie diese (Kraepelin, 1899)2. Es ist heute klar – und Eugen Bleuler hat schon wenige Jahre nach Kraepelins Publikation darauf hingewiesen –, dass Kraepelin aus dem gesamten Spektrum des Krankheitsbildes der Schizophrenie gleichsam nur einen „Zipfel“ gesehen und beschrieben hat: die Patienten – und sie gibt es bei vielen, auch körperlichen Krankheiten – , deren Krankheit sich nicht mehr bessert oder sogar einen progredienten Verlauf aufweist. Nach heutigen Erkenntnissen sind dies etwa 15 – 20 % aller an Schizophrenie erkrankten Personen. Kraepelin sah vermutlich deshalb vorwiegend diese Gruppe von Kranken, weil es damals noch sehr wenig psychiatrische Betten gab und folglich nur die am schwersten gestörten und am meisten störenden Patienten überhaupt in eine Anstalt kamen und dort blieben. Dies war schon in Dorpat so, besonders aber dann in Heidelberg, wo Kraepelin von 1891 bis 1904 wirkte und in seiner Klinik nur zwangseingewiesene Patienten aufnehmen konnte, also eine noch selektiertere Patientengruppe. Ein zweiter Grund für diese „Einschränkung“ der Erfahrungsbasis 13 Kraepelins war wohl, dass sich die träge Anstaltsatmosphäre gerade auf Patienten mit einer Schizophrenie negativ auswirkt und „Hospitalismusphänomene“ erzeugte, die eine Entlassung unwahrscheinlich machten (Wing und Brown, 1970). Somit blieben gerade Patienten mit Schizophrenie im Krankenhaus – oft für den Rest ihres Lebens – und wiesen somit einen „chronischen“ Verlauf auf und erschienen als „unheilbar“. Auch wenn Kraepelins Begriff der „Dementia praecox“ obsolet ist, auch wenn durch Forschung klar belegt ist, dass nur ein Bruchteil der Patienten „chronisch“ wird – die Idee „einmal schizophren, immer schizophren“, also Kraepelins Idee der Chronizität und Progredienz, ist noch weit verbreitet. Und die Eigenschaft der Unheilbarkeit haftet dann jedem an, der einmal die Diagnose „Schizophrenie“ erhalten hat. Damit zieht dann gleich Hoffnungslosigkeit und mangelnde Initiative auf Seiten der professionellen Helfer ein, so dass die Diagnose im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung wirkt. Das reicht bis in die Versorgungsstrukturen, wenn etwa an Schizophrenie erkrankte Personen von den Leistungen der sozialen Krankenversicherung ausgeschlossen und „asyliert“ werden. Kraepelin hat zwar nicht nur den Verlauf beschrieben sondern auch die Symptome, die er bei der Dementia praecox beobachtet hat. Er hat diese allerdings nur unsystematisch dargestellt (Berner et al, 1992), was mit seinem Ansatz der Beobachtung des Längsschnittverlaufes (gleichsam aus der Ferne mit einem Teleskop) zusammenhängt, der bei ihm gegenüber einer detaillierteren „mikroskopartigen“ Beschreibung der psychopathologischen Erlebnisse und Auffälligkeiten des Patienten dominiert. Mayer-Gross (1932) hat Kraepelin gerade deshalb kritisiert und ihm schlichtweg die Vernachlässi- „Dementia praecox“ wurde als Begriff allerdings schon 40 Jahre vor Kraepelin von der französischen Psychiatrie als „demence precoce“ eingeführt. 14 Katschnig gung der psychopathologischen Theorienbildung vorgeworfen: Kraepelin biete nur ein „unstrukturiertes Mosaik von Symptomen“ dar. Eugen Bleulers Terminus technicus „Schizophrenie“ und das Missverständnis von der „Gespaltenen Persönlichkeit“ Der von Kraepelin vernachlässigten Aufgabe der systematischen Beschreibung der psychopathologischen Erscheinungen des Krankheitsbildes widmetet sich der gleichaltrige Schweizer Psychiater Eugen Bleuler (1857–1939) umso intensiver. Er bearbeitete diese Aufgabe so gründlich, dass er gleich einen neuen Terminus technicus für die Krankheit prägte, der sich ausdrücklich auf die psychopathologischen Erscheinungen und nicht auf den Verlauf bezog (Bleuler 1911). Ja, es war ihm geradezu ein Anliegen, die Kraepelinsche Idee der Chronizität durch seine Idee der Definition mittels psychopathologischer Symptome zu ersetzen. Vielleicht kam es deshalb dazu, weil er in der Großstadt Zürich (wo Bleuler von 1898 bis 1927 die Psychiatrische Universitätsklinik, das sogenannte „Burghölzli“ leitete) auch viele Patienten sah, die wieder gesund wurden oder an leichteren Ausprägungsformen der Krankheit litten. Schon der Titel von Eugen Bleulers (1911) berühmter Monographie „Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien“ bringt zwei Neuerungen deutlich zum Ausdruck. Erstens: Es handelt sich um eine „Gruppe“ von Krankheiten, die unterschiedliche Verläufe haben können. Zweitens: Der Begriff „Dementia praecox“ soll durch den neuen Begriff der „Schizophrenie“ ersetzt werden, was auch prompt geschah; 3 der Begriff der Schizophrenie hat sich dauerhaft durchgesetzt. Mit „Schizophrenie“ meinte Bleuler nicht „gespaltene Persönlichkeit“ – das ist eine spätere falsche Rückübersetzung des Wortes – sondern das Gemeinsame der zentralen psychopathologischen Phänomen der Schizophrenie, nämlich die Auflockerung der inneren Zusammenhänge der seelischen Vorgänge. Was das genau heisst, ist nicht kurz zu sagen und wird uns gleich noch beschäftigen. Leider hat der Begriff „Schizophrenie“ ein Eigenleben entwickelt und in der Öffentlichkeit eine andere Bedeutung erhalten als die, die ihm Bleuler gab. Bleuler konnte das nicht vorhersehen. Im Gegenteil: Er meinte sogar, durch die Wahl dieses ganz besonderen Begriffes Missverständnissen vorbeugen zu können. In der Einleitung zur genannten Monographie aus dem Jahre 1911 schreibt er (S. 5): „So blieb nichts anderes übrig, als hier die Krankheit mit einem Namen zu bezeichnen, der weniger missverständlich ist.“ Leider weit gefehlt, wie wir heute wissen! Und gleich darauf verwirft er den Vorschlag eines anderen Psychiaters, die Krankheit mit dem Begriff „Dysphrenie“ zu bezeichnen, mit der Begründung, „dass die Versuchung, ihm einen unpassenden Sinn unterzuschieben, zu gross wird“. Genau das ist aber das Schicksal des Wortes „Schizophrenie“ geworden. Zumindest seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts hat das Wort einen „einen unpassenden Sinn“, in Form einer zweitem Bedeutungen erhalten (Pfeifer, 1995): neben der genannten fachlichen Definition der „Auflockerung der seelischen Zusammenhänge“ nämlich die Laienbedeutung der „Zwiespältigkeit“ und „Widersprüchlichkeit“, die man gut dokumentiert in der Zeitung findet (Hoffmann-Richter 2001). Seit damals wirkt diese bildungssprachliche Alltagsverwendung unbarmherzig auf die Kranken zurück, denen man unterstellt, sie hätten zwei oder auch mehr Persönlichkeiten. Robert Louis Stevensons Roman „Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ ist der allgemein bekannte Prototyp für diese „gespaltene Persönlichkeit“ – in diesem Fall einmal Helfer der Menschheit, dann wieder mordende Bestie. Vor jemandem, der unvorhersehbar und plötzlich jemand anderer wird, muss man sich nicht nur fürchten, er stellt auch die Grundregeln menschlichen Zusammenlebens prinzipiell in Frage, die ja auf dem Vertrauen in die Kontinuität des Verhaltens anderer beruhen. Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit, Eigenschaften, die „Geisteskranken“ in der Öffentlichkeit ohnehin unterstellt werden, gelten im besonderen Masse für jemanden, der plötzlich wer anderer ist. In einer Umfrage in Österreich (Grausgruber et al in diesem Heft) gab es übrigens einen klaren Bildungsgradienten: je höher der Schulabschluss war, desto eher assoziierte die befragte Person mit dem Wort Schizophrenie eine „gespaltene Persönlichkeit“. Dieser Befund ist politisch nicht irrelevant – Regelungen und Gesetze, die Diskriminierung psychisch Kranker beinhalten können, werden ja gerade von Personen mit höherer Schulbildung erstellt. Nun ist es nicht ganz unverständlich, dass der Begriff von Laien so verwendet wird: auf Griechisch heisst „schizein“ immerhin “spalten”. Und der Begriff „phrene“, auf Griechisch eigentlich „Zwerchfell“3, wird schon seit Homers Zeiten auch als Bezeichnung für die „Seele“ bzw. den „Geist“ verwendet. So rückübersetzt heisst dann „Schizophrenie“ tatsächlich „gespaltene Seele“. „Schizein“ heisst aber nicht nur „spalten“, sondern auch „in mehrere Teile zerfallen“, und zwar auch in dem Sinn, dass die Teile eines ursprünglich Ganzen nicht mehr zusammenhängen. Und das ist der Kern von Bleulers psychopathologischer Schizophre- Im „Nervus phrenicus“ ist diese Bedeutung in die medizinische Terminologie übernommen werden. Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts ... niedefinition: Die verschiedenen seelischen Funktionsbereiche (wie etwa Denken, Fühlen, Wahrnehmen) arbeiten nicht mehr harmonisch zusammen und sind auch in sich zusammenhanglos (ohne dass eine hirnorganische Störung dafür verantwortlich gemacht werden kann). Im Detail äußerst sich diese Zusammenhanglosigkeit in formalen Denkstörungen (wie Inkohärenz, Gedankenabreissen, Sperrung, Entgleisung, Faseln), in Affektstörungen (Affektdissoziation, Parathymie), und auch in anderen als kognitiv einzustufenden Störungen (etwa der Aufmerksamkeit; der Körperwahrnehmung; der Handlungsroutinen – auch als Automatismenverlust bezeichnet; der Fähigkeit, den Kontext für die Interpretation einer Wahrnehmung zu nutzen). Der Wiener Psychiater Stransky (1903) hat – in Analogie zu dem in der Neurologie für einen unkoordinierten Gang verwendeten Begriff „Ataxie“ – für diese seelische Zusammenhanglosigkeit damals den treffenden Begriff „intrapsychische Ataxie“ vorgeschlagen, der aber von der Fachwelt nicht aufgegriffen wurde. Der gesamte Komplex der kognitiven und affektiven Störungen wurde – entsprechend der ihm zugeschriebenen zentralen Rolle für die Diagnose der Krankheit – von Bleuler als „Grundstörungen“ bezeichnet. Halluzinationen und Wahnideen waren für Bleuler hingegen nur „akzessorische“, also randständige Symptome der Schizophrenie, die zwar nicht selten sind, aber diagnostisch keine Relevanz besitzen. Wie wir gleich sehen werden, hat sich diese Auffassung in den Algorithmen der modernen Diagnosesysteme DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) und ICD-10 (World Health Organization, 1992) nicht niedergeschlagen. Denkstörungen kommen dort zwar vor, spielen aber für die Diagnose der Schizophrenie nur eine marginale Rolle und sind dort den Halluzinationen und Wahnideen untergeordnet. Die „Gespaltenheit“ – als reines Laienkonzept – findet sich in keinem der offiziellen Klassifikationssysteme. Kurt Schneiders „Symptome 1. Ranges“: „Verrücktheit“ als leicht zu erkennende Auffälligkeit Eine völlige Kehrtwendung – mit beträchtlichen Folgen, wie wir gleich sehen werden – vollzog Ende der 30er Jahre der deutsche Psychiater Kurt Schneider (1887–1967). Bei ihm stehen plötzlich Halluzinationen und Wahnideen, also „psychotisch“ genannte Symptome, im Zentrum der Schizophrenie-Diagnostik, die er in eine Liste von acht „Symptomen 1. Ranges“ zusammenfasste. „Unter den zahlreichen bei der Schizophrenie vorkommenden abnormen Erlebnisweisen“, so schreibt er in seinem berühmt gewordenen Aufsatz ‚Schizophrenie und Zyklothymie‘, „gibt es einige, die wir Symptome 1. Ranges heißen, nicht weil wir sie für die „Grundstörungen“ hielten, sondern weil sie für die Diagnose sowohl gegenüber nichtpsychotisch seelisch Abnormem, wie gegenüber der Zyklothymie ein ganz besonderes Gewicht haben. Diese Wertung bezieht sich also nur auf die Diagnose. Nicht aber ist damit etwas zur Theorie der Schizophrenie gesagt, wie das Bleulers „Grundsymptome“ und „akzessorische“ Symptome meinen ...“ (K. Schneider 1959, S. 129). Und gleich darauf heisst es: „Man könnte vielleicht noch andere schizophrene Symptome 1. Ranges anerkennen. Wir beschränken uns aber auf solche, die begrifflich und bei der Untersuchung ohne allzu große Schwierigkeit zu fassen sind“. „... ohne allzu grosse Schwierigkeit zu fassen ...“ ist die Schlüsselwendung zum Verständnis von Schneiders Überlegungen. Kurt Schneider ging es darum, dem Prakti- 15 ker im Alltag ein einfach anzuwendendes diagnostisches Instrumentarium zur Verfügung zu stellen. Und die Symptome, die am einfachsten zu erfassen sind – vorausgesetzt natürlich, dass der Betroffene über diese Erlebnisse offen berichtet – sind eben Halluzinationen und Wahnideen. Mit einem Mal war es anscheinend nicht mehr notwendig, ganze Lehrbücher und Monographien zu studieren und über jahrelange Erfahrung zu verfügen, wenn man die Diagnose einer Schizophrenie stellen wollte. Berichtete ein Patient über seine Erlebnisse, dann musste der Psychiater „nur mehr“ eine Liste von acht Symptomen durchgehen. Lag mindestens eines dieser Symptome vor, dann, so meinte Kurt Schneider, spreche er „in aller Bescheidenheit“ von Schizophrenie. Für den Alltag war dies recht praktisch, besonders dann, wenn man noch nicht sehr erfahren war. Als Symptome ersten Ranges führt Kurt Schneider an: • Gedankenlautwerden • Hören von Stimmen in Form von Rede und Gegenrede • Hören von Stimmen, die das eigene Tun mit Bemerkungen begleiten • leibliche Beeinflussungserlebnisse • Gedankenentzug und andere Gedankenbeeinflussungen • Gedankenausbreitung • Wahnwahrnehmung • alles von anderen Gemachte und Beeinflusste auf dem Gebiet des Fühlens, Strebens (der Triebe) und des Willens Die Mehrzahl dieser Phänomene wird wohl von jedem Laien sofort als „verrückt“ eingestuft; es sind allesamt „psychotische“ Symptome, wie man sagt (oder auch „Plus-“, „positive“ oder „produktive“ Symptome). Von den Assoziations- und Affektstörungen, wie sie Eugen Bleuler in den Vordergrund gestellt hatte, ist hier nichts mehr zu sehen. Kurt Schneider leitete seit 1931 das Klinische Institut der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in 16 Katschnig München (das spätere Max-PlanckInstitut) und war gleichzeitig Chefarzt der Psychiatrischen Abteilung des Städtischen Krankenhauses München-Schwabing. Die „Symptome ersten Ranges“ hat er 1938 im Nervenarzt publiziert, dann 1939 in einer 27 Seiten langen Broschüre „Psychischer Befund und psychiatrische Diagnose“, schließlich fanden sie in sein Buch „Klinische Psychopathologie“ Eingang (5. Auflage 1959).4 1959 erschien dieses Buch auch auf Englisch, wodurch Symptome ersten Ranges weltweit Verbreitung fanden. Es ist bemerkenswert, dass alle genannten Schriften wenig umfangreich sind, aber grossen Einfluß gewannen. So sind einzelne „Symptome 1. Ranges“ zum Teil wörtlich in die Schizophreniedefinitionen der sogenannten operationalen Diagnosesysteme übernommen worden.5 Man geht vermutlich nicht sehr fehl, wenn man annimmt, dass gerade die von Kurt Schneider betonte Theorielosigkeit und der Listencharakter die „Symptome 1. Ranges“ für die Autoren dieser operationalen Diagnosesystem so attraktiv machten. In gewisser Weise ist Schneiders Liste der Wegbereiter von ihnen allen. Schneider betont, wie wir gesehen haben, dass er den genannten Symptome den 1.Rang nur bezüglich der Diagnose, nicht aber bezüglich der Theorie zugesteht. Was er mit dieser Formulierung wirklich gemeint hat, bleibt dunkel – ähnliches gilt für analoge Äusserungen der Autoren der operationalen Diagnosesysteme. Genau so wie diese, strebt Schneider nur eine Verlässlichkeit der Diagnose – heute Reliabilität genannt – an; eigentlich handelt es sich um nicht viel mehr als eine Sprachregelung. Ob diese Sprachregelung im Hinblick auf verstehbare Mechanismen der Krankheitsentstehung und der Behandlung einen Sinn machen und eine Bedeutung haben, bleibt offen. 4 5 In diesem Zusammenhang ist das wenig bekannte Faktum erwähnenswert, dass Kurt Schneiders frühe Publikation der Symptome ersten Ranges (K. Schneider, 1939) nicht für Psychiater sondern für praktische Ärzte und Amtsärzte gedacht war (Peters, 1991), also notgedrungen eine Vereinfachung darstellte. Wie hätten praktische Ärzte und Amtsärzte Denk- und Affektstörungen erfassen sollen, benötigt man doch für die Feststellung des Vorliegens dieser „Beobachtungssymptome“ grosse klinische Erfahrung, während es im Vergleich dazu wesentlich einfacher ist, die von einem Patienten berichteten Wahnideen und Halluzinationen zu erfassen. Für unser Thema der stigmarelevanten Inhalte des Schizophreniekonzeptes ist festzuhalten: Dass von den modernen Diagnosesystemen gerade die von Laien am ehesten als „verrkckt“ eingestuften Wahnideen und Halluzinationen als essentiell angesehen werden – obwohl es dafür keine Begründung außer der einfacheren diagnostischen Handhabbarkeit gibt – , ist aus der Perspektive der Stigmavermeidung genauso verhängnisvoll wie Kraepelins Unheilbarkeitsspostulat und Bleulers von den Laien falsch verstandener Schizophreniebegriff. Welche Möglichkeiten gibt es, vom Schizophreniekonzept her einen Beitrag zur Entstigmatisierung zu leisten? Im Hinblick auf mögliche Aktivitäten zur Reduktion des Stigmas, das psychisch Kranke und speziell an Schizophrenie leidende Personen im Alltag erfahren, ist es nützlich, vier Stufen bzw. Ebenen des Stigmatisie- rungsprozesses zu unterscheiden: (1) die Ebene des Inhaltes des Vorurteils; (2) die Ebene der Identifizierung einer konkreten Person, auf die das Vorurteil angewandt wird; (3) die Ebene der tatsächlich stattfindenden Diskriminierung und Benachteiligung der betroffenen Person; und (4), die Ebene der psychologischen Internalisierung des Vorurteils durch die betroffene Person. Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der ersten Ebene, also mit den Inhalten des öffentlichen Vorurteils über die Schizophrenie und seiner möglichen Veränderung. Diese Inhalte hängen aber mit den anderen drei Ebenen eng zusammen, so dass diese hier kurz angesprochen werden müssen. Der zweite und für einen Betroffenen persönlich entscheidende Schritt ist der seiner Identifikation als zu diesem Stereotyp passend – häufig geschieht dies dadurch, dass bekannt wird, dass jemand in psychiatrischer Behandlung war oder ist. In diesem Moment wird seine Individualität vergessen und es werden ihm vorwiegend die negativen Eigenschaften des Stereotyps zugeschrieben. Die Diskussion darüber, wie die potentiell und tatsächlich Betroffenen damit umgehen, ob psychiatrische Hilfe gar nicht oder zu spät aufgesucht oder vorzeitig abgebrochen wird, welche Techniken der Verheimlichung oder der Bewältigung verwendet werden (z.B. Aufklärung anderer über die falschen Vorstellungen), ist nicht Gegenstand dieses Beitrages. Ebenfalls nicht diskutiert wird hier die dritte Ebene, auf der es darum geht, welchen Diskriminierungen psychisch Kranke durch gesetzliche oder andere offizielle und halboffizielle Regelungen ausgesetzt sind, und wie diese Diskriminierungen verringert oder abgeschafft werden können. Zweifellos hängen viele gesetzlich begründete Diskriminierungen mit falschen Vorstellungen bei den Kurt Schneider war nach dem 2.Weltkrieg noch einige Jahre Leiter der Heidelberger Psychiatrisch-Neurologischen Universitätsklinik . Z.B das Present State Examination (PSE)–CATEGO-System (Wing et al, 1974), die Research Diagnostic Criteria (RDC) (Spitzer et al, 1978) und das DSM-III (American Psychiatric Association, 1980) etc., sowie auch die ICD-10 (World Health Organization, 1992) Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts ... Personen, die diese Regelungen produzieren, zusammen. Das falsche öffentliche Stereotyp hat sehr viel mit diesen Diskriminierungen zu tun, so daß sich für Aktivitäten auf dieser dritten Ebene aus den Diskussionen über das öffentliche Stereotyp ein gewisser Nutzen ziehen lässt. Die vierte Ebene ist die der Internalisierung des Stereotyps durch den Betroffenen. Besonders bei langen Aufenthalten in psychiatrischen Einrichtungen kann es dazu kommen, wobei sich das Phänomen des „Hospitalismus“ damit zum Teil überschneidet. Ähnliches geschieht heute auch bei Langzeitpatienten ausserhalb des Krankenhauses. Manchmal wird – im Unterschied zur de-facto Diskriminierung und Benachteiligung im Alltag – der psychologische Vorgang der Identifizierung mit dem Stereotyp als „Stigmatisierung“ im engeren Sinn bezeichnet. Es gibt Ansätze zur Antistigmatherapie, in denen versucht wird, den Patienten zu einer realistischen und lebbaren Selbstdefinition zu verhelfen, anstatt die negative Rolle des psychisch Kranken anzunehmen. Das Konzept des Empoverment ist dabei zentral. Kehren wir zur ersten Ebene zurück und zum öffentlichen Stereotyp der Schizophrenie. Nach dem bisher Gesagten könnte man überspitzt formulieren, dass das öffentliche Stereotyp einer an Schizophrenie erkrankten Person darin besteht, dass angenommen wird, dass die Krankheit unheilbar ist (Kraepelin); dass der Betroffene plötzlich jemand ganz anderer (vielleicht gefährlicher) sein kann, weil er an einer „Persönlichkeitsspaltung“ leidet (falsch verstandenes Schizophreniekonzept Bleulers); und dass er ein „Verrückter“ mit Wahnideen und Halluzinationen ist (K. Schneider).6 Für die meisten unserer Patienten stimmt das so nicht und niemand 6 kann wollen, dass Laien so über Personen denken, die an Schizophrenie leiden. Der Großteil der Patienten mit der Diagnose Schizophrenie hat keinen chronischen und progredienten Krankheitsverlauf (natürlich gibt es auch ungünstige Verläufe); die gespaltene Persönlichkeit ist überhaupt eine Erfindung; und die zentrale Stellung von Halluzinationen und Wahnideen für die Diagnose einer Schizophrenie wird heute stark in Zweifel gezogen, worauf wir gleich noch zurückkommen werden. Wie steht es nun mit der Möglichkeit, diese Inhalte im öffentlichen Stereotyp der Schizophrenie zu korrigieren, was ja – neben dem Abbau der Diskriminierung im Alltag – der Hauptzweck der heute in vielen Ländern stattfindenden Antistigmakampagnen ist. Als erstes stellt sich die Frage, wie man mit dem Kraepelinsche Erbe der Chronizität, damit auch der Idee der Unheilbarkeit, umgehen soll, mit Konzepten, die auch bei psychiatrisch nicht ausgebildeten Ärzten weit verbreitet sind. Im DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) ist für die Diagnose „Schizophrenie“ eine Mindestdauer der Symptomatik von 6 Monaten vorgeschrieben, womit schon einmal in Richtung einer längeren Krankheitsdauer vorselektiert wird. Dauert ein den aufgezählten Symptomen entsprechendes Syndrom kürzer, dann wird von „schizophreniformer Störung“ gesprochen. Während hier also eine gewisse Betonung einer längeren Krankheitsdauer für die „echte“ Schizophrenie zu finden ist, so ist doch auch die ganze Palette der Subtypen der Schizophrenie zu finden, auch derer mit guter Prognose. In der ICD10 (World Health Organization, 1992) sind ebenfalls alle Subtypen zu finden, darüber hinaus fehlt in der ICD-10 das 6-Monats-Kriterium. Fazit: Die modernen psychiatrischen 17 Diagnoseschemata reflektieren heute nicht mehr die Idee der Chronizität und Unheilbarkeit. Sie ist vielmehr in den Köpfen der Menschen, auch vieler nicht-psychiatrischer Ärzte, wie die schon genannte Umfrage in Österreich gezeigt hat. Hier sollte tatsächlich Aufklärung helfen; Antistigmakampagen können hier zurecht Informationen über die Erfolge der Kombination von neuen pharmakotherapeutischen, psychotherapeutischen und sozialpsychiatrischen Massnahmen verbreiten. Dies kann nicht oft genug geschehen. „Einmal schizophren“ heisst keinesfalls „immer schizophren“. Was tun mit der „gespaltenen Persönlichkeit“, dem von Eugen Bleuler nicht beabsichtigten Erbe seiner Wortschöpfung „Schizophrenie“? Sie kommt ja in keiner der existierenden Schizophreniedefinitionen vor, ist aber im Alltag um so unausrottbarer (Finzen, 2000). Ob es gelingt, die metaphorische Bedeutung der „Gespaltenheit“ aus der Alltagssprache zum Verschwinden zu bringen, bezweifle ich. Besonders Journalisten finden die Schizophrenie-Metapher offenbar sehr nützlich, ja sie lieben sie geradezu, wenn sie Politiker der Widersprüchlichkeit und Inkonsistenz in ihren Äusserungen „überführen“ (Hoffmann-Richter, 2000). Ob der Vorschlag, die Schizophrenie mit einem völlig neuen Namen zu versehen, zielführend ist, ist schwer zu beurteilen (z.B. mit dem von Bleuler verworfenen Begriff „Dysphrenie“?). Diesbezüglich soll es ja schon Preisausschreiben gegeben haben und die Frage verträgt sicher noch die eine oder andere Diskussion, in der auch zu erörtern wäre, ob die zunehmende Verbreitung des neuen Terminus technicus „Bipolare Störung“ für die Manischdepressive Krankheit im Hinblick auf die Entstigmatisierung etwas gebracht hat - weil sie ja für Laien Andere Aspekte des Vorurteils, die vorwiegend von außerhalb der Psychiatrie stammen, wie etwa der in manchen Untersuchungen aufscheinende Faktor der Eigenverantwortlichkeit der Betroffenen für ihr Schicksal oder der Aspekt der Gefährlichkeit, werden hier nicht weiter diskutiert, da der Focus der Überlegungen dieses Beitrages auf der Beeinflussung des Vorurteils durch Konzepte, die aus der Psychiatrie stammen, liegt. 18 Katschnig undurchschaubarer ist als die alte Diagnose „manisch-depressiv“. Außer in dem Fall, dass „Gebildetete“ einen Terminus technicus falsch rückübersetzen (wie dies bei der Schizophrenie geschehen ist), hat dieser ja die Eigenschaft, dass sich niemand ausser den Fachleuten darunter etwas vorstellen kann, so dass der Begriff auch nicht falsch verwendet werden kann – etwa wie der Krankheitsbegiff „Lupus erythematodes“, von dem ich mich nicht entsinne, dass er von einem Journalisten je als Metapher oder Schimpfwort verwendet worden wäre, obwohl die konfluierenden roten und blauen Flecken dieser Krankheit einiges an politischen Assoziationen zuliessen. Und was ist schliesslich mit den psychotischen Symptomen, den Wahnideen und Halluzinationen, die Bleuler als „akzessorisch“ eingestuft hatte und die über Kurt Schneider eine dominierende Stellung in den Definitionen der Schizophrenie in den heute üblichen Diagnosesystemen erhalten haben, in denen sie die kognitiven und affektiven Störungen durchwegs ausstechen? Das Dominieren psychotischer Symptome in den Schizophreniedefinitionen wird heute zunehmend kritisiert (Tsuang et al, 2001). Zum einen, weil Halluzinationen und Wahnideen die „gemeinsame Endstrecke“ vieler verschiedener psychiatrischer Störungen sind und derartige mehrdeutige Phänomene jede Art von krankheitsspezifischer kausaler Forschung torpedieren; zum anderen, weil die von Bleuler beschriebenen kognitiven und affektiven Symptome viel mehr als Halluzinationen und Wahnideen für die spezifischen Alltagsbehinderungen verantwortlich sind, und weil es ohne ihre Beachtung keine wirksame Therapie und Rehabilitation der Schizophrenie gibt (Sachs und Katschnig, 2001). Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die derzeit gebräuchlichen Schizophreniedefinitionen – mit dem hohen Stellenwert, den sie Wahnideen und Halluzi- nationen geben – zu den bisher verwendeten „alten“ oder „klassischen“ Neuroleptika passen, die ja in erster Linie auf diese Symptome wirken (auch die Unterscheidung in „Plusund Minussymptome“ wurde von dorther beeinflusst). Bei den „neuen“ oder „atypischen“ Antipsychotika wird hingegen gerne hervorgehoben, dass sie u.a. auch auf kognitive Symptome wirken. Das ständig wachsende Interesse an den kognitiven Störungen der Schizophrenie betrifft so verschiedenen Bereiche wie die psychiatrische Genetik, die Neuropsychologie, die Pharmakotherapie, die Psychotherapie und die Sozialpsychiatrie. Dass heute zunehmend vorgeschlagen wird, Schizophrenie als „Informationsverarbeitungsstörung“ zu verstehen und diese nicht als „Krankheit“ sondern als „Verletzlichkeit“ oder „Vulnerabilität“ zu sehen, die sich in der Interaktion mit der Umwelt je nach Stressbelastung manifestiert oder nicht manifestiert, legt nahe, dass dieser Denkrichtung eines „Vulnerabliltäts-Stress-Coping-Konzeptes“ auch in der Definition der Schizophrenie mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte (Katschnig, 2002; Katschnig et al. 2002). Ausblick Das Schizophreniekonzept ist heute fast unmerklich in Bewegung geraten. Zwar dominieren im klinischen und Forschungsalltag noch die „operationalen“ Definitionen des DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) und der ICD-10 (World Health Organization, 1992) – und da neigt man dazu, die einmal gegebenen Beschreibungen undiskutiert anzuwenden, nicht nur im Hinblick auf den Inhalt, also auf bestimmte Symptome, sondern auch im Hinblick auf die eher mechanisch- deskripitive aber „praktische“ Art, wie eine Krankheit aus Symptomen zusammengesetzt ist, deren Einbau in einen „Algorithmus“ dann eine Diagnose ergibt. In der Konzeptdiskussion werden heute nicht nur die Inhalte dieser Definitionen in frage gestellt – die Tage der Wahnideen und Halluzinationen in der Schizophreniedefiniton erscheinen gezählt – sondern auch die Art der „Diagnosekonstruktion“. Die Idee der „Informationsverarbeitungsstörung“ und des „VulnerabilitätsStress-Coping-Modells“ weisen in eine prinzipiell neue Richtung: Nicht mehr Symptome und deskriptive kategoriale Krankheitseinheiten (die sich ja besonders gut für die Diskriminierung und Stigmatisierung eignen), sondern die pathologischen Prozesse und Dysfunktionen hinter den Symptomen werden interessant, für die man dann (diagnoseunabhängig) ätiologische Faktoren und pathogenetische Prozesse identifizieren könnte (Gaebel, 2001). Bei der Schizophrenie leiten kognitive Funktionsstörungen, die eine Entsprechung in dysfunktionalen Denkstilen und/oder dysfunktionalen biologischen Funktionsbläufen haben (die man auch Vulnerabilität nennen kann), zunehmend das Erkenntnisinteresse (Sachs und Katschnig, 2001). Auch eigene Termini tauchen für diese Vulnerabilität auf, wie etwa der Begriff der „Schizotaxie“, der von Meehl schon 1962 vorgeschlagen wurde und jetzt wieder aufgegriffen wird (Tsuang et al, 2000). Im übrigen dachte bereits Eugen Bleuler (1911) in Krankheitsprozessen und nicht einfach in deskriptiven Symptommustern – und ging noch darüber hinaus, indem er viele „Symptome“ (er nannte sie sekundär) als Resultat der geglückte oder missglückten Anpassungsversuche der Person an die Erscheinungen des primären Krankheitsprozesses ansah. Wohin diese Entwicklung führen wird, ist noch nicht sicher erkennbar. Auf jeden Fall kann sie, wie sehr sie auch auf einer inneren wissenschaft- 19 Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts ... lichen Notwendigkeit der Weiterentwicklung der Psychiatrie beruht, auch aus der Sicht der Stigmavermeidung begrüsst werden. Das Verständnis von einer an „Schizophrenie“ leidenden Person wird durch diese Ansätze differenzierter und individualisierter. Das Anlegen verschiedener „Dimensionen“ der Dysfunktion anstelle des „Schubladisierens“ in eine diagnostische Kategorie, ermöglicht ein nuancierteres Herangehen an die erkrankte Person. Allerdings gilt das nur prinzipiell – die große Unbekannte ist, ob selbst dann, wenn die Psychiatrie diese neuen „dimensionalen“ und „funktionalen“ Konzepte entwickelt und anwendet, bei Nicht-Fachleuten immer noch das Bedürfnis nach Einordnung von Menschen mit psychischen Auffälligkeiten in Kategorien von Vorurteilen besteht. Vielleicht sind es gar nicht nur die inhaltlichen Diagnosekonzepte der Psychiatrie, die zur Diskriminierung und Stigmatisierung beitragen, sondern auch die Tatsache von der Psychiatrie behandelt zu werden? Wenn dies so wäre, dann stellt sich auch gleich die Frage, was und wie diese Psychiatrie ist. Das steht aber auf einem anderen Blatt. Ich danke Herrn Univ. Prof. Dr. Eberhard Gabriel für eine Reihe nützlicher Hinweise. DC 1994. Deutsche Version: Saß H., H.U. Wittchen & M. Zaudig : Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen. DSM-IV. 3. Auflage. Hogrefe Verlag, Göttingen-Bern-Toronto-Seattle 2001 Berner, P., E. Gabriel, H.Katschnig, W. Kieffer, K. Köhler, G. Lenz, D. Nutzinger, H.Schanda, C. Simhandl: Diagnostic Criteria for Functional Psychoses, Cambridge Univeirsity Press, Cambridge 1992 Bleuler, E.: Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Franz Deuticke, Leipzig und Wien 1911 Finzen, A.: Psychose und Stigma. PsychiatrieVerlag, Bonn 2000 (2. Auflage) Gaebel, W.: Krankheitstheorie und Identität der Psychiatrie. Nervenarzt 72 (2001) 329-330 Hoffmann-Richter, U.: Psychiatrie in der Zeitung. Urteile und Vorurteile. Psychiatrie-Verlag, Bonn 2000 Katschnig H.. Hundert Jahre wissenschaftliche Psychiatrie – Sigmund Freud, Emil Kraepelin, Emil Durkheim und die moderne Psychiatrie. Wiener Klinische Wochenschrift 110 (1998) 207-211 Katschnig, H.: Was ist manisch-depressiv und was kann man dagegen tun. In: Vasak, G. und H. Katschnig: Sturzfliegen – Leben in Manien und Depressionen. Rüffer und Rub Sachbuchverlag, Zürich 2001 Katschnig, H.: Nicht ohne Netz – Vorlesungen zur Einführung in die Sozialpsychiatrie. Facultas, Wien 2002 Katschnig, H., W. W. Fleischhacker, H. Donat, U. Meise: 4 x 8 Empfehlungen zur Behandlung von Schizophrenie. edition pro mente. Linz 2002 Kraepelin, E.: Psychiatrie. 6.Auflage. Barth, Leipzig 1899 Mayer-Gross, W.: Klinik, Erkennung und Differentialdiagnose. In: Wilmans, K. (Hrsg.): Die Schizophrenie. Springer, Berlin 1932 Schneider, K.: Psychischer Befund und psychiatrische Diagnose. Thieme, Leipzig 1939 Schneider, K.: Klinische Psychopathologie. Fünfte, neu bearbeitete Auflage der Beiträge zur Psychopathologie. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1959 Spitzer, R.L., J.Endicott & E.Robins: Research Diagnostic Criteria: Rationale and Reliability. Archives of General Psychiatry 35 (1978) 773782 Stransky, E.: Zur Kenntnis geheim erworbener Blödsinnsformen (zugleich eine Lehre der Dementia praecox). Jahrbücher der Psychiatrie/Neurologie. Österr. Zeitschrift Band 24 (1903) 1-149 Tsuang, M.T., W.S.Stone & S.V.Faraone: Toward reformulating the diagnosis of schizophrenia. American Journal of Psychiatry 157 (2000) 1041-1050. Wing, J.K. & G. Brown: Institutionalism and Schizophrenia. A comparative study of three mental hospitals 1960 – 1968. Cambridge University Press, Cambridge 1970 Wing, J.K., J.E. Cooper & N.Sartorius: Measurement and classification of psychiatric symptoms. Cambridge University Press, Cambridge 1974 World Health Organisation: The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical Descriptions and Diagnostic Guidelines. World Health Organization, Geneva (1992). Deutsche Version: Dilling H., Mombour W., Schmidt M.H.: Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10 Kapitel V. Klinisch-diagnostische Leitlinien. 3. Auflage. Verlag Hans Huber, Bern-GöttingenToronto-Seattle 1999 Meehl, P.E.: Schizotaxia, Schizotypy., Schizophrenia. American Psychologist 17 (1962) 827-831 Literatur American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition, American Psychiatric Association, Washington DC 1980. Fourth Edition, American Psychiatric Association, Washington Peters, U.: The German classical concept of schizophrenia. In: Howells, J. (ed.): The conception of schizophrenia – historical perspectives. American Psychiatric Press, Washington 1991 Pfeifer, Wolfgang (Hrsg.): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Deutscher Taschenbuchverlag, 1995 Sachs, G., H. Katschnig: Kognitive Funktionsstörungen bei schizophrenen Psychosen. Psychiatrische Praxis 28 (2001) 60-68 Univ.-Prof. Dr. Heinz Katschnig Universitätsklinik für Psychiatrie Währingergürtel 18 – 20 A-1090 Wien, Österreich 21 REZENSION Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002 Katschnig H., Donat H., Fleischhacker W. W., Meise U.: 4 x 8 Empfehlungen zur Behandlung von Schizophrenie. Edition pro mente, Linz 2002 Die Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie hat vier renommierte Psychiater und erfahrene Experten ersucht, Behandlungsempfehlungen für Schizophrenie-Kranke zu erarbeiten. Diese Empfehlungen sind primär für Fachärzte für Psychiatrie bestimmt. Es ist aber von den Autoren beabsichtigt, dass sie auch für die zahlreichen anderen Berufsgruppen, die in der Behandlung und Versorgung von SchizophrenieKranken tätig sind, von Nutzen sind. Die Autoren betonen, dass sie bewusst von „Empfehlungen“ und nicht von „Leitlinien“ sprechen, da das Wort „Empfehlungen“ einen geringeren Verbindlichkeitsgrad habe. Sie heben auch hervor, dass nicht jede Empfehlung auf jeden Patienten zutreffe. So fällt beim Durcharbeiten auch auf, dass manche Empfehlungen einen recht großen Spielraum lassen. Auf diese Weise wird berücksichtigt, dass die unterschiedlichen Lebenssituationen, die verschiedenen Krankheitsverläufe und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kranken und ihrer Angehörigen individuell angepasste Behandlungsmaßnahmen erfordern. Es ist auch ungewöhnlich, dass diese Empfehlungen nicht nur auf Basis der wissenschaftlichen Literatur erstellt wurden, sondern Vor-Versionen auf Tagungen und Kongressen vorgestellt wurden und die Autoren sich der kritischen Diskussion gestellt haben. Die dabei gesammelten Anregungen und Kritikpunkte wurden in der endgültigen Version berücksichtigt. Durch das ganze Buch ist der klinisch-praktische Bezug festzustellen. Alle Empfehlungen sind trotz des Herausarbeitens der wissenschaftlichen Evidenz praxisorientiert und im klinischen Alltag umsetzbar. Es ist den Autoren gelungen, die Spannung zwischen klinischer Erfahrung und wissenschaftlich anerkanntem Wissen weitgehend aufzulösen. Die Darstellung der Empfehlungen ist nach den drei vorherrschenden Richtungen der Interventionsmethoden in der Psychiatrie gegliedert: der Intervention mit biologischen Mitteln (medikamentöse Therapie), der mit psychischen Mitteln (Psychotherapie) und der Intervention an der Umwelt und dem sozialen Kontext des Kranken (Soziotherapie). Für jeden dieser drei Bereiche wurden jeweils acht Empfehlungen formuliert. Den Empfehlungen zu diesen Therapieformen wurden acht allgemeine Empfehlungen vorangestellt, die von der Art der Intervention unabhängig sind und generell für den therapeutischen Umgang mit Schizophrenie-Kranken gelten. Da für pharmako-, psychound soziotherapeutische Techniken jeweils 8 Empfehlungen formuliert wurden, signalisieren die Autoren deren Gleichgewichtung und betonen den integrativen Ansatz für das „Management“ dieser komplexen und vielgestaltigen Gruppe von psychischen Erkrankungen. Als gemeinsame Basis wird das „VulnerabilitätsStress-Coping Paradigma“ für das Verständnis schizophrener Erkrankungen zu Grunde gelegt. All dies unterscheidet die vorliegenden Behandlungsempfehlungen von ähnlichen in den letzten Jahren für der Schizophreniebehandlung publizierten Guidelines oder Leitlinien. Letztere vermitteln oft den Eindruck, dass psycho- oder soziotherapeutischen Behandlungsansätzen eine randständige Wertigkeit zugeordnet wird. Jede der insgesamt 32 Empfehlungen umfasst etwa zwei Druckseiten, wobei die eigentliche Empfehlung durch einen Kasten hervorgehoben wird. Erläuterungen zu den wichtigsten Aspekten, die Angabe des Evidenzgrades und (häufig deutschsprachige) Literaturhinweise ergänzen jede Empfehlung. Die „4 x 8 Empfehlungen zur Behandlung der Schizophrenie“ umfassen alle wesentlichen Aspekte der Schizophrenie-Behandlung. Darin finden sich auch moderne Ansätze, wie „Empowerment“ und „Salutogenese“; Sichtweisen, die auch für andere Bereiche der Gesundheitsversorgung zunehmend Gültigkeit gewinnen. Der internationale Stand der wissenschaftlichen Literatur wird auf übersichtliche und leicht lesbare Weise zusammengefasst. Der hohe Praxisbezug gibt Grund zu der Hoffnung, dass diese Empfehlungen im klinischen Alltag auch wirklich umgesetzt werden und auf diese Weise die Behandlung Schizophrenie-Kranker positiv beeinflussen. Zu guter Letzt sollte nicht unerwähnt bleiben, dass diese Publikation auch ein sehr ansprechendes Layout aufweist. Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata, Wien ÜBERSICHT Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 22 – 26 Rechtliche Benachteiligung psychisch Kranker in Österreich Karin Gutiérrez-Lobos Universitätsklinik für Psychiatrie, Wien Schlüsselwörter psychisch krank – Stigmatisierung – Gefährlichkeit – Unterbringungsgesetz – Soziale und private Krankenversicherung – Ehegesetze Key words Stigma – mental disorders – civil commitment – dangerousness – social insurance – law – marriage acts Rechtliche Benachteiligung psychisch Kranker in Österreich Die Einstellung der Öffentlichkeit sowie der politischen Entscheidungsträger gegenüber psychisch Kranken ist nach wie vor von Mythen und Stereotypen geprägt. Das spiegelt sich sowohl in gesetzlichen Bestimmungen als auch in der Interpretation und Durchführung bestimmter Gesetze wider. Deswegen wurde als Teil der österreichischen Antistigmakampagne eine Untersuchung über potentielle diskriminierende Inhalte von Gesetzen (Sozialversicherung, Unterbringungsgesetz, Straf- und Zivilgesetzgebung etc.) initiiert. Es gibt Gesetze, die direkt und offen psychisch kranke Personen diskriminieren, aber auch Gesetze, die zwar nicht ihrem Wesen nach stigmatisierend sind, wo aber gesetzliche Bestimmungen im Fall psychischer Erkrankung unterschiedlich und in den meisten Fällen nachteilig angewendet werden. Diskriminierende Paragraphen finden sich aber auch in gesetzliche Vorschriften, die primär zum Schutz von psychisch kranken Personen erlassen wurden. Im folgenden Artikel werden Beispiele gesetzlicher Benachteiligungen und Stigmatisierung aufgezeigt und diskutiert. Legal discrimination of mentally disordered persons in Austria The attitudes of the public as well as of the political authorities towards mentally disordered persons, their needs and issues of integration are still influenced by myths and misconceptions. This is reflected in legal provisions as well as in the interpretation and administration of rules. Therefor, as part of the Austrian anti-stigma campaign an investigation about potential discriminating sections of the relevant laws (social security system, civil commitment, penal and civil code, etc.) was initiated with the aim to identify rules that contribute to discrimination and to disadvantages and to test the consumer orientation of access and assertion of claims. There exist rules directly and overtly discriminating mentally disordered persons as well as laws that do not fundamentally differentiate between mentally and somatically ill persons, but where rules are differently and – in most of the cases – adversely applied. Also, legal provisions basically enacted to protect the rights of mentally disordered persons may include some sections resulting in discrimination. Certain provisions such as the claim on sufficient and needs-orientated community care and rehabilitation facilities and on the legally warranted support of relatives are even entirely lacking. Some examples of legal stigmatisation and discriminations will be presented and discussed. Einleitung Das Wissen über und die Einstellung der Öffentlichkeit und der politischen Entscheidungsträger zu psychischen Krankheiten, ihre Implikationen und geeignete Behandlungsmöglichkeiten sind weiter von Mythen und Stigmatisierung geprägt, die ihren Niederschlag sowohl in rechtlichen Bestimmungen als auch in der Auslegungs- und Durchführungspraxis von Rechtsnormen finden. Aus diesem Grund wurde eine Untersuchung initiiert, die Bereiche der rechtlichen Diskriminierung psychisch Kranker erheben und aufzeigen sollen. Ziel dieses Projektes ist die Erfassung jener Rechtsmaterien, die mittelbar oder unmittelbar zur Benachteiligung psychisch Kranker führen. Durchleuchtet werden sollen unter anderem Führerscheinverordnungen, Familien- und Kindschaftsrecht, sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, das Erbrecht, das Kirchenrecht, sicherheitspolizeirechtliche Bestimmungen, privatrechtliche Regelungen etc. Die entsprechenden Rechtsmaterien sollen sowohl auf ihr Diskriminierungspotential als auch auf ihre Benutzerfreundlichkeit überprüft werden. Im Anschluss daran sollen konkrete Vorschläge für Änderungen der identifizierten Rechtsmaterien und Umsetzungspraktiken entwickelt werden, die den zuständigen Entscheidungsträgern – unter Einbeziehung von Patienten, Angehörigen 23 Gutiérrez-Lobos und Experten präsentiert werden, um so auf eine konkrete Umsetzung der Vorschläge hinzuarbeiten. Das Ziel soll eine Verbesserung der gesetzlichen Situation von psychisch Kranken sein. „Unbehandelbar und chronisch“ – soziale und private Krankenversicherung Gemäß dem österreichischen Sozialversicherungsrecht wird Krankheit definiert als „regelwidriger Körper- oder Geisteszustand, der eine Krankenbehandlung notwendig macht“. Krankenbehandlung ist dann indiziert, wenn dadurch die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder Fähigkeit für lebenswichtige persönliche Bedürfnisse zu sorgen, voraussichtlich wieder hergestellt oder verbessert wird. Offensichtlich findet sich hier eine gesetzliche Gleichstellung von psychisch und physisch Kranken, die durch die Einbeziehung der Kriterien Arbeitsfähigkeit und Erfüllung persönlicher Bedürfnisse noch akzentuiert und dem Anliegen der Integration psychisch Kranker entgegenzukommen scheint. Die Realität – d.h. die Umsetzung dieses Gesetzes- sieht jedoch anders aus. Die strenge Dichotomie entweder krank oder gesund, die schon bei organischen Erkrankungen nicht immer sinnvoll ist, wirkt sich besonders nachteilig auf die Behandlung und Rehabilitation psychisch Kranker aus. Schon der Weg zur Behandlung kann mitunter erschwert sein. Wie Medienberichten zu entnehmen war, werden Krankentransporte in einigen Fällen, u.a. bei Panikstörungen, nicht von der Krankenkasse bezahlt ( zit. n. Dr. F. Fuchs, stellv. Ärztlicher Direktor der Wiener Gebietskrankenkasse, Die Presse 2.4.2001). Natürlich ist der formale Anspruch psychisch Kranker auf Behandlung gewährleistet. Behandlung bedeutet aber in diesem Fall meist die Beschränkung auf medizinische Therapie im engeren Sinn, d.h. besonders auf pharmakologische Behandlung. Selbst die Pharmaindustrie ist aber kaum mehr der Ansicht, dass dies alleine wirkt. Immer dann, wenn nach der akuten Behandlungsphase zur weiteren Stabilisierung zusätzliche, aber der erwähnten Dichotomie scheinbar widersprechende Behandlungsschritte unternommen werden, sind psychisch Kranke benachteiligt. Komplementäre Einrichtungen vergleichbar denjenigen, die somatisch Kranken zur Verfügung stehen, gibt es für psychisch Kranke kaum, Kur- und Rehabilitationsaufenthalte werden erst gar nicht angeboten. Zwar ist im Sozialversicherungsrecht grundsätzlich auch die Rehabilitation psychisch Kranker vorgesehen, doch fehlen für diesen Bereich im Gegensatz zu körperlichen Erkrankungen Durchführungsrichtlinien, wodurch die rechtlichen Grundbestimmungen totes Recht darstellen, was zu einer klaren Diskriminierung psychisch Kranker führt. Bei der Rehabilitation wird häufig auf die angeblich insgesamt nicht sehr günstigen Erfolgsprognosen bei psychisch Kranken verwiesen. Vergessen wird dabei, dass diese ungünstige Prognose aber zumeist von der mangelnden und nicht den Bedürfnissen der Patienten angepassten Infrastruktur bestimmt wird. Die Folge sind Frühpensionierungen, Invaliditätspension und Aussteuerung, die zu materieller, sozialer und leistungsmäßiger Verelendung führen. Auch Pflegerichtlinien berücksichtigen psychisch Kranke meist nur auf dem Papier, in der Praxis wird in der Regel die besonders auf die Bedürfnisse der psychisch Kranken abgestimmte Pflege nicht existent. Psychisch Kranke haben Anspruch auf eine zumindest teilweise Refundierung von Psychotherapie durch die Krankenkassen. Viele Patienten sind aber aufgrund ihrer geminderten Erwerbsfähigkeit dann gar nicht in der Lage, die oft beträchtlichen Selbstbehaltkosten zu leisten und bleiben somit von dieser Behandlungsmethode ausgeschlossen. Jüngst ließ eine Meldung im Zuge der Verhandlungen mit der Wiener Gebietskrankenkasse zur vollen Kostenübernahme („Psychotherapie auf Krankenschein“) aufhorchen, dass nämlich im Fall einer Erkrankung mit psychotischen Symptomen nur 30 Stunden, bei anderen Störungen aber zumindest 70 Stunden voll refundiert werden sollen. Diese Ungleichbehandlung wird nun auf ihre Zulässigkeit geprüft. Das alles bedeutet, dass Behandlungsmaßnahmen, die bekannterweise und entsprechend dem ASVG "die Gesundheit, die Arbeitsfähigkeit oder Fähigkeit für lebenswichtige persönliche Bedürfnisse zu sorgen” wieder herstellen oder verbessern können, im Falle psychischer Erkrankungen weder adäquat angeboten noch finanziert werden. Die Diskriminierung basiert auf den auch im Gesundheitssystem weiter vorherrschenden üblichen stigmatisierenden Einstellungen "unheilbar und chronisch” und wird durch eine erstaunliche Missachtung der Ergebnisse der klinischen Forschung über wirksame Behandlungsmethoden in der Psychiatrie verursacht. Auch hinsichtlich der Erfüllung von Patientenrechten und dem Recht auf Selbstbestimmung finden sich bei psychisch Kranken Unterschiede zu somatisch erkrankten Personen. Nicht nur ist die freie Wahl von Hilfsangeboten kaum gegeben, in praktisch allen Verträgen privater Zusatzversicherungen findet sich der Passus, dass Leistungen für psychische Störungen nicht bzw. nur in deutlich geringerem Umfang gewährt werden. Entsprechend den allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (Abschnitt c, Artikel 16 unversicherbare Personen) heißt es, dass unversicherbar und jedenfalls nicht versichert jene Personen sind, die dauernd vollständig arbeitsunfähig oder von 24 Rechtliche Benachteiligung psychisch Kranker in Österreich schweren Nervenleiden befallen sind sowie Geisteskranke. Diese pauschale Ablehnung der Versicherung behinderter Menschen hat eindeutig und direkt diskriminierenden Charakter. Auch in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen anderer privater Krankenversicherungen finden sich ähnliche Bestimmungen. Betroffen davon sind in der Regel die Gewährung von Taggeld für Krankenhausaufenthalte, Pflegeunterstützung aber auch Auslandsversicherungen und Reiserückholversicherungen. Anfragen bei verschiedenen Versicherungsunternehmungen haben ergeben, dass die Meinung vorherrscht, psychische Erkrankungen würden im frühen Erwachsenenalter entstehen, zu wiederholten und langen Spitalsaufenthalten führen und regelhaft in Chronizität münden. In Einzelfällen würden durchaus nach vorheriger Rücksprache mit dem Versicherungsträger Krankenhausaufenthalte in psychiatrischen Abteilungen, vorzugsweise an den Universitätskliniken, gewährleistet sein. Auch hier finden sich aber ähnliche Verständnisschwierigkeiten wie in der sozialen Krankenversicherung: in letzter Zeit häufen sich beispielsweise jene Fälle, wo die Kosten dann nicht mehr übernommen werden, wenn der Patient zwar weiter im Krankenhaus ist, aber Ausgänge hat. Jemand der in klassischem Sinne krank ist, hat im Bett zu liegen; dass Ausgänge durchaus ein relevanter Teil der Behandlung und Rehabilitation in der Psychiatrie sind, wird nicht berücksichtigt. „Unvernünftig und verantwortungslos“ – Ehegesetze Zivilrecht und Kirchenrecht enthalten direkt diskriminierende Bestimmungen. Diese sind zwar meist der Öffentlichkeit kaum bekannt und haben dementsprechend wahrschein- lich wenig Einfluss auf die Meinungsbildung, da sie aber den persönlichsten Bereich eines Menschen betreffen und einschränken, werden sie von den Betroffenen als besonders diskriminierend erlebt. So findet sich in einem aktuellen Kommentar zum Kirchenrecht über die Ehefähigkeit folgende Auslegung: „Auch bei Geisteskrankheiten kann es lichte Augenblicke geben. Im Falle der Schizophrenie ist allerdings in der Regel nicht damit zu rechnen, dass in solchen Remissionszeiten Ehefähigkeit besteht, weil die Krankheit tatsächlich auch in diesen Zeiten andauert. Wenn die schizophrene Erkrankungen für die Zeit vor und für die Zeit nach der Eheschließung erwiesen ist, wird vermutet, dass sie auch bei der Eheschließung bestand.“ Aber auch im Zivilrecht finden sich ähnlich diskriminierende Bestimmungen: Eine Ehe ist nichtig, wenn einer der Ehegatten zur Zeit der Eheschließung geschäftsunfähig war oder sich ... im Zustand einer vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit befand (§ 22 Abs. 1 Ehegesetz). In § 37 Abs. 2 heißt es weiter: Ein Ehegatte kann die Aufhebung der Ehe begehren, wenn er sich bei der Eheschließung über solche die Person des anderen Ehegatten betreffende Umstände geirrt hat, die ihn bei Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigung des Wesens der Ehe von der Eingehung der Ehe abgehalten hätten. Zu diesen Umständen gehören auch psychische Störungen bzw. deren „Anlage“ mit späterem Ausbruch. Gemäß § 51 Ehegesetz kann ein Ehegatte auch die Scheidung begehren, wenn der andere geisteskrank ist, die Krankheit einen solchen Grad erreicht hat, dass die geistige Gemeinschaft zwischen den Ehegatten aufgehoben ist und eine Wiederherstellung nicht mehr erwartet werden kann. Aber auch Personen, die – wenn auch nur für eine Angelegenheit – besachwaltert sind, benötigen aufgrund der mangelnden Geschäftsfähigkeit, für die Eheschließung die Zustimmung des Sachwalters. „Unberechenbar und gefährlich“ – Unterbringungsgesetz und Maßnahmenvollzug Bei Einführung des Unterbringungsgesetzes 1991 war es die Absicht, die Persönlichkeitsrechte von zwangsweise aufgenommenen Patienten zu schützen und gleichzeitig die Anzahl von Zwangsunterbringungen zu reduzieren. Obwohl der strikte Schutz der Persönlichkeitsrechte und die Einführung des Rechtsinstrumentes der Patientenanwaltschaft eine notwendige Entwicklung darstellen, beinhaltet dieses Gesetz zwei wesentliche nachteilige Effekte für psychisch Kranke. Erstens ist aus diesem Gesetz kein Recht auf optimale Behandlung ableitbar. Zweitens – und das ist die wahrscheinlich am meisten stigmatisierende Konsequenz – wird im Unterbringungsgesetz das Kriterium „Gefährlichkeit“ überbetont. Die Existenz von Gesetzen, die eine bestimmte Gruppe von Menschen ganz allgemein nicht nur als „anders“, sondern darüber hinaus als potentiell gefährlich ausweist, so dass Maßnahmen ähnlichen jenen der Strafjustiz gerechtfertigt sind (Unterbringung ja – Behandlung nein), mögen zwar aus juristischer Sicht korrekt sein, verstärken jedoch gerade jene Befürchtungen und Stigmatisierungen in der Öffentlichkeit, denen mit Anti-Stigma Aktionen entgegengetreten werden soll. Die Koppelung einer Zwangsmaßnahme an die vermutete Gefährlichkeit psychisch Kranker hat bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass Patienten, die nach Kontakt mit dem Amtsarzt und den Sicherheitsbehörden zur Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurden, in der sogenannten „Geisteskranken-Kartei“ registriert wurden. 25 Gutiérrez-Lobos Es hat dies zum einzigartigen Fall der Speicherung von Gesundheitsdaten im Rahmen des Polizeisystems geführt. Die Folgen waren, dass Informationen aus der GeisteskrankenKartei unkontrolliert und ohne das Wissen der Betroffenen weitergeben werden konnten, psychisch kranke Personen befürchteten, dass prinzipiell jeder – auch der freiwillige – Kontakt mit der Psychiatrie von den Sicherheitsbehörden registriert werden würde und dies in der Folge möglicherweise viele Patienten davon abgehalten hat, sich überhaupt in psychiatrische Behandlung zu begeben. Darüber hinaus war die Existenz einer derartigen Kartei natürlich dazu geeignet, auch in der Öffentlichkeit weiter den Eindruck zu verstärken, dass psychisch kranke Personen tatsächlich gefährlicher sind als andere. Nach jahrzehntelangen Bemühungen wurde die GES- Kartei schließlich 1997 vernichtet. Wie man jedoch Zeitungsberichten (Polizei sammelt Gesundheitsdaten, „Der Standard“, 17.7. 2001; Angst vor GesundheitsEkis? „Die Presse“ 3.11.2000) und parlamentarischen Anfragen entnehmen kann, scheint sich diese Tradition im Rahmen des Sicherheitspolizeigesetzes weiter fortzusetzen. Entgegen den Erwartungen sind die Unterbringungen in den letzten Jahren gestiegen. So mag in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, dass psychisch Kranke nicht nur immer schon gefährlich waren, sondern auch noch gefährlicher geworden sind. Ein weiterer Fallstrick der Gesetzgebung: Die vom Gesetz verlangten weniger restriktiven Maßnahmen zur Vermeidung einer Unterbringung sind nämlich kaum oder nicht im benötigten Sinne vorhanden. So fehlen beispielsweise Einrichtungen für psychiatrische Notfälle, die auch Hausbesuche anbieten. Darüber hinaus werden Patienten oft sehr schnell wieder aus dem Spital entlassen, sobald eine der zur Unterbringung erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr vorliegt. Auch die Einführung des „Leistungsorientierten Kranken- hausfinanzierungssystem“ 1997 hat den Druck, stationäre Aufenthalte so kurz wie möglich zu halten, weiter verstärkt. Nicht die Patienten sind gefährlicher geworden, sondern die Umsetzung von Gesetzen wird auf Kosten der Patienten gefährlich vernachlässigt. 1975 wurde im Rahmen der großen Strafrechtsreform der Maßnahmenvollzug für zurechnungsfähige und zurechnungsunfähige geistig abnorme Rechtsbrecher etabliert, der ebenso die Gefährlichkeit als zentralen Aspekt einbezieht. Die Einweisung erfolgt auf unbestimmte Zeit, eine bedingte Entlassung ist erst dann möglich, wenn die mit der Störung verbundene Gefährlichkeit abgebaut ist. Die Einführung des Maßnahmenvollzuges bewirkte gleichzeitig eine Ausgliederung der Betreuung von psychisch kranken Rechtsbrecher aus dem Gesundheitssystem. Die Nachteile für psychisch kranke Täter sind evident: Der Maßnahmenvollzug ist in erster Linie eine auf die Wahrung der Sicherheit eingerichtete Institution des Justizsystems, wo therapeutische Fragen nur nachrangige Bedeutung haben und dementsprechend in deutlich geringerem Maß finanziert werden. Es gibt keine Patientenanwälte, die sich um die Durchsetzung der Patientenrechte kümmern könnten. Darüber hinaus bedeutet die unbestimmte Zeit der Anhaltung eine deutliche Erschwerung für die Planung der Entlassung und folglich auch für die Rehabilitation. Spezielle Nachbetreuungseinrichtungen bzw. betreute Wohnheime für diese Patienten existieren kaum, allgemeinpsychiatrische Einrichtungen lehnen die Behandlung solcher Patienten oft ab. Die Folge ist, dass die im Maßnahmenvollzug untergebrachten psychisch kranken Rechtsbrecher auch bei weniger gefährlichen Delikten meist deutlich länger angehalten werden als Täter des Strafvollzuges, schlechtere Rehabilitationschancen haben und so das Risiko eines Rükkfalls nicht ausreichend minimiert werden kann. Auch hier gilt: nicht die Prognose ist generell schlecht, sondern die Bedingungen die zur Verbesserung der Prognose beitragen würden, fehlen. Unterbringungsgesetz sowie die gesetzlichen Bestimmungen zur Einweisung in den Maßnahmenvollzug sind gute Beispiele dafür, wie die Gesetzgebung im Bereich der Psychiatrie üblicherweise Elemente von Gewalt und Gefährlichkeit betont und dies ist in der modernen Gesetzgebung noch mehr der Fall als früher. Die dahinter steckende Absicht ist einerseits Patienten vor willkürlicher Zwangsanwendung zu bewahren und ihre Persönlichkeitsrechte zu sichern und andererseits die Öffentlichkeit vor eben diesen Personen zu schützen. Die undifferenzierte Überbetonung des Kriteriums Gefährlichkeit führt zu weiterer Diskriminierung und zu neuen Gesetzen, die diese vermutete Gefährlichkeit bekämpfen sollen. Die weitverbreitete Meinung, dass psychisch kranke Personen generell gefährlich sind und dazu neigen, gewalttätige Delikte zu begehen, hat eine lange Tradition und wird durch die Medienberichterstattung verstärkt. Tatsächlich zeigen neuere epidemiologische Daten, dass akute psychotische Symptome das relative Risiko für gefährliches Verhalten erhöhen. Obwohl diese Ergebnisse signifikant sind, wird aber nur ein verschwindend kleiner Teil von psychisch kranken Personen tatsächlich gewalttätig. Charakteristika, die wesentlich aussagekräftiger hinsichtlich gewalttätigem Verhalten sind als das Vorliegen einer psychischen Erkrankung sind Merkmale wie junges Erwachsenalter, männliches Geschlecht, niedriger Sozialstatus und Substanzabhängigkeit. Zurecht würde niemand in diesen Fällen spezielle gesetzliche Vorkehrungen fordern. Psychiater haben bei der Akzeptanz der Etikettierung von psychisch Kranken als „gefährlich“ und bei der Definition von „Gefährlichkeit“ über lange Zeit mitgewirkt, wodurch der Eindruck entstanden sein mag, dass Gesetzte, die sich auf das Kriterium 26 Rechtliche Benachteiligung psychisch Kranker in Österreich „Gefährlichkeit“ stützen, auf einer wissenschaftlichen Basis beruhen. Wir sind jetzt aufgerufen, dieses Konzept zu überdenken und auf seine Unwissenschaftlichkeit hinzuweisen. Schlussfolgerungen Anhand der skizzierten Beispiele wird klar, dass es keine lineare Beziehung zwischen Stigma und Gesetzen gibt. Es finden sich sowohl direkt und unmittelbar diskriminierende Rechtsnormen als auch Rechtsnormen, die zwar grundsätzlich keinen Unterschied zwischen psychisch Kranken und Gesunden treffen, bei denen aber auf breiter und regelmäßiger Basis in der Anwendungspraxis psychisch Kranke benachteiligt werden. Selbst in Gesetzen, die zum Schutz von psychisch Kranken im engeren Sinn erlassen wurden, können diskriminierende Ansätze enthalten sein. Als wichtige Frage wird weiters diskutiert, inwieweit überhaupt Gesetze für bestimmte Bevölkerungsgruppen zum Abbau von Diskriminierung beitragen und nicht im Gegenteil zu weiterer Stigmatisierung führen. Angesichts der Tatsache, dass zwischen 25 – 50 % der Menschen im Laufe ihres Lebens an einer behandlungsdürftigen psychischen Störung erkranken, psychische Störungen weiter zunehmen und schon bald an erster Stelle für Arbeitsunfähigkeit und Frühpensionierungen stehen werden, ist die gesetzlich verankerte Gleichstellung und Aufhebung von diskriminierenden Bestimmungen eine dringend notwendige Maß- nahme. Bei der Vorbereitung von Gesetzen ist die Einführung neuer Standards zu fordern. Diese beinhalten die Beteiligung von Betroffenen, Angehörigen und Experten, eine regelmäßige Evaluierung und ein Monitoring der Auswirkung von Gesetzen sowie die Zunahme der Betonung von Behandlungs- und Rehabilitationsaspekten und die Abnahme der Betonung von Gefährlichkeitsaspekten. Univ. Prof. Dr. Karin Gutiérrez-Lobos Universitätsklinik für Psychiatrie Abteilung für Sozialpsychiatrie und Evaluationsforschung Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien email: [email protected] KOMMENTAR Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 26 – 27 Stigma-Erfahrung aus erster Hand Christian Horvath „Crazy Industries“, Wien Roterdstraße 12/27/1 1160 Wien Bis heute werden in der psychiatrischen Behandlung die Folgen, die Betroffenen aus der Stigmatisierung erwachsen, sehr oft unterschätzt beziehungsweise überhaupt nicht berücksichtigt; entweder aus mangelndem Interesse oder aus der alleinigen Konzentration auf die Krankheit. Bei schweren Erkrankungen kommt der Beeinträchtigung bzw. Schädigung und dem krankmachenden Einfluss des Stigmas eine große Bedeutung zu, sodass man von einer sekundären Erscheinung in der Erkrankung sprechen kann. In Rückkopplungsprozessen verstärken Stigma und Erkrankung die seelischen Wunden. Das Stigma als Bann wird aber nicht nur über Psychiatrieerfahrene geworfen, sondern trifft auch die Institution Psychiatrie als eine im Ansehen eher gering geschätzte medizinische Disziplin mit unanständigen Patienten. Die Medien – und die Gesellschaft, die aus diesen ihre Informationen zieht – ist wesentlich daran betei- ligt, dass es ein Stigma gibt und dieses sich noch immer hartnäckig zu behaupten weiss. Die mediale Darstellung weist dem psychisch Kranken oft in der Rolle des Unberechenbaren, Gefährlichen zu; die mediale Aufarbeitung von Fehlern der Psychiatrie schüren Ängste, die aus dem Thema Psychiatrie eines der letzten Tabus machen. Die Psychiatrie als das eigentliche Übel zu betrachten, ist ebenso einseitig, wie die Schuld ausschließlich bei Medien und Gesell- 27 Horvarth schaft zu suchen. Die antipsychiatrische Bewegung übersieht diesen Punkt in ihrer einseitigen Protesthaltung. Die Situation ist komplexer und verlangt nicht nach einseitigen Schuldzuweisungen, sondern nach Aufklärung, weiterem Bemühen um mehr Verständnis und Information. Die Entstigmatisierung wird also zu einem Prozess, der von Psychiatrieerfahrenen sowie der Psychiatrie im ureigensten Interesse gemeinsam getragen werden könnte. Wenn also die Stigmatisierung wesentlichen Einfluss auf seelische Erkrankungen und deren Therapie hat, so hat sie weitläufige Konsequenzen, wie z.B. größeres Leid und erhöhter Behandlungskosten. Dies hat v.a. vermehrte Krankenhausaufenthalte und intensivere Therapien zur Folge, ohne dass das eigentliche Problem wesentlich verändert wurde. Aus meiner persönlichen Erfahrungen weiss ich, dass viele therapeutische Gespräche das Stigma in der einen oder anderen Form jedoch eher unstrukturiert zum Inhalt haben. Hier könnte durch eine konsequente Anti-Stigma-Arbeit viel Geld eingespart, oder noch besser, für Sinnvolles verwendet werden, wenn es dadurch gelingt, den Teufelskreis Stigma sowie Diskriminierung und die daraus sich folgernde seelische Schädigung abzuschwächen. Dass es auch ohne Stigmatisierung geht, bewiesen mir die Reaktionen einiger Freunde, die nichts von meinen psychiatrischen Episoden wussten. Sie sahen mich als sozialkommunikativen, klar orientierten verlässlichen Freund. In ihren Augen war ich einer von ihnen, ohne auffallendes Makel. Die andere Erfahrung, die ich machen mußte ist, dass ich von Menschen, die von meiner Psychiatrie- und Psychoseerfahrung wußten, mich mit anderen Augen gesehen wurde, wodurch sehr oft Beziehungen erschwert wurden. Stigmatisierung ist eine allgemeine Grundhaltung, die Fremdes, Unverständliches durch Leugnung, Verdrängen oder Verurteilung in Schach zu halten versucht. Stigma und Angst hängen aufs tiefste zusammen, im Sinne „Was ich nicht verstehe, beunruhigt mich“. Dies löst jene Verurteilungsspirale aus, die in den Medien und somit auch in weiten Bereichen der Gesellschaft auf fruchtbaren Boden fällt. Die Angst vor dem Unverständlichen ist gerade dort anzutreffen ist, wo eine hohe Angstbereitschaft eine Auseinandersetzung verhindert. Fast könnte man meinen , dass in einer Gesellschaft der schwindenden Sündenböcke psychisch Kranke als eine der letzten Projektionsflächen herhalten müssen. Der Homosexuelle vor dem man noch vor 50 Jahren Abscheu empfand, ist zum lieben Nachbarn geworden, der obdachlose Sandler ist durch eine gutgemachte Zeitung, dem „Augustin“ zum freundlichen Verkäufer geworden – zumindest in Wien. Das Wissen um Randgruppen und Subkulturen in unserer Medien- und Informationsgesellschaft ist stark angewachsen. Liberale Einstellungen gegenüber dem Abweichenden und früher Tabuisierten haben leider noch nicht die von Psychiatrie Betroffenen erreicht. Was nach oberflächlichem hinsehen als Unwille zum Verständnis erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als zutiefste Verunsicherung und Abwehr des als fremd Empfundenen. Es besteht aber auch das Phänomen der Selbststigmatisierung – also die Bereitschaft von Psychiatrieerfahrenen sich selbst auszugrenzen, oft ohne Zutun anderer, sondern aus der Bewertung ihrer selbst heraus. Hier wird offensichtlich, dass die Entstigmatisierung auf verschiedenen Ebenen anzusiedeln ist: Auf einer gesellschaftlichen Ebene mit Medien- und Pressearbeit und Informationsbereitstellung. Dann wäre die medizinische Ebene zu nennen; denn auch Ärzte diskriminieren Psychiatrieerfahrene häufig, indem sie diese nur vor dem Hintergrund der Diagnose beurteilen. Hier wäre die rein medizinische diagnostizierte Sichtweise durch weitere Dimensio- nen des Menschseins zu erweitern. Schließlich auf der Ebene der Eigenstigmatisierung, die aus der medizinisch und gesellschaftlichen Stigmatisierung erwächst, aber auch eine persönliche Färbung trägt, die tiefer in individuelle Lebenssituationen reicht, wo seelische Wunden nicht immer nur von außen geschlagen wurden. Für eine Anti-Stigma Kampagne hätte die Homosexuellenbewegung Vorbildfunktion, da sie es geschafft hat, aus einem absoluten Rand- und Tabuthema ein Thema zu machen, das an Schärfe und Interessantem viel zu bieten hat; eine eigene kulturelle Identität, die Subkulturcharakter hat und der heute jegliche subversive und zerstörerische Absicht nicht mehr nachgesagt wird. Ein Vorbild, von dem wir lernen können. Verständnis, Toleranz und Akzeptanz als Ergebnis der Anti-StigmaArbeit von Homosexuellen könnten auch Psychiatrieerfahrene ermutigen. Vielleicht gelingt es uns Psychiatrieerfahrenen damit nicht nur das psychische Leiden zu mildern, sondern auch eine Subkultur aufzubauen. Eine Psychiatrieerfahrenen-Identität zu finden, die uns selbstbewusst einen Platz in dieser Gesellschaft bietet; nicht gegen diese, sondern in dieser, mit eigenen schöpferischen Möglichkeiten und Entfaltungsbereichen, deren Output in etablierte Bereiche der Gesellschaft einfließen kann, sodass ein Austausch mit diesen entsteht. Kein Aus- oder Abkoppeln, sondern ein Einfließen und Nützen jener Kräfte und Möglichkeiten der Gesellschaft, die ohne Stigma dann zugänglich werden; dies führt zu Chancen in der Erweiterung des Lebenssinnes, Glück durch Entfaltung von Selbstverwirklichung. Eine eigene Kultur als Bereicherung und Keimzelle für weitergehende Wünsche und Visionen. Um diese Ziel zu erreichen ist es notwendig, dass eine Antistigma-Kampagne erst nach Auflösung des Stigmas beendet wird, denn das erste Opfer des Stigmas ist die Gerechtigkeit. ÜBERSICHT Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 29 – 33 Angehörige – Parias am Rande der Psychiatrie? Ingrid Rath HPE-Österreich, Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter, Wien „Jede ärztliche Situation umfasst grundsätzlich nie nur zwei sondern stets drei Menschen. Es sind dies einmal der Arzt, zum anderen der Patient und zum Dritten die Angehörigen. Das nimmt weniger Bezug darauf, dass Familienangehörige gelegentlich bei der Entstehung einer Erkrankung eine Rolle spielen, mehr schon darauf, dass das Leben mit einer Krankheit sowie ihr Ausgang wesentlich von der Einstellung und dem Verhalten der Angehörigen geprägt ist; vor allem aber darauf, dass unter einer schweren, insbesondere chronischen Krankheit alle Mitglieder einer Familie zwar unterschiedlich, aber gleichviel leiden..“ [2] Die in unserer Gesellschaft kolportierten und nach wie vor festverankerten Urteile – Vorurteile – Mythen psychische Krankheiten betreffend ziehen vor allen in Zeiten der Eskalation unweigerlich Ablehnung des Erkrankten und Integrationsverweigerung durch das soziale Umfeld nach sich und treffen auch die Angehörigen mit großer Intensität. Warum werden „die Angehörigen zu Ungehörigen“? [4] Mit der Zementierung der modernen Kernfamilie als gesamtgesell- schaftliche Norm im 19. und 20. Jhdt. war auch eine emotionale Aufwertung der Familie verbunden. Die mit großen Erwartungshaltungen überfrachtete Gemeinschaft Familie als Hort von Harmonie und Glück verliert aber durch den Einbruch einer psychischen Krankheit die selbstverständliche Tragfähigkeit ihres bisherigen familiären Daseins. Es werden nicht nur ev. Selbsttäuschungen bezüglich des tatsächlichen Zustandes der Beziehungen spürbar, sondern ein eindeutig nicht zu verbergendes pathologisches Geschehen wird auch für Außenstehende sichtbar. Es lässt sich in seiner oft sehr dramatischen Form dem sozialen Umfeld nicht nur als „Dopaminmangelerscheinung“ erklären, sondern bleibt vorerst einmal an der Familie als „Versagen“ hängen. Die Familie muss um die Neubestimmung des mehr oder weniger gemeinsamen Lebens ringen, um die Einbettung in ihr soziales Umfeld zittern und jedes Familienmitglied für sich muss seine Stellung in diesem Drama und seine Möglichkeiten und Grenzen neu ausloten. Dass dies nicht von heute auf morgen möglich sein wird und dass dies auch nur in den seltensten Fällen ohne Hilfe gehen kann, auch weil sich Anforderungen erst im Laufe der Geschehnisse zeigen, ist wohl selbstverständlich. Zum Zweiten haben wir alle – auch natürlich die Angehörigen – als Kinder unserer Zeit, unseres Kultur- kreises, unserer Geschichte, die bekannten Vorurteile psychischen Störungen gegenüber verinnerlicht und sind auch keiner Notwenigkeit unterworfen worden, sie zu hinterfragen – bis eben zum Einbruch einer psychischen Krankheit in unserer unmittelbaren Umgebung. Es handelt es sich bei diesen vorgefassten und als „Volkesstimme“ weitergegebenen Annahmen unter anderem um vereinfachte Schlussfolgerungen aus den naturwissenschaftlichen Theorien des 19., und 20. Jahrhunderts, die ihre Spuren noch immer ziehen, (z.B. unentrinnbare Vererbung, Unheilbarkeit, Demenz als Endstation, Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit der Erkrankten usw.) Sie werden selbstverständlich nicht von neueren therapeutischen Erkenntnissen und Möglichkeiten korrigiert, weil diese in der Bevölkerung weithin unbekannt sind. Auch uralte, religiös motivierte Ängste mögen im Spiel sein: Dämonenglaube z.B. wie er in Exorzismen, oder göttlichen Strafexpeditionen sichtbar wird. Die Abwehrhaltung der Gesellschaft hat sicher auch eine Wurzel in den inneren Befindlichkeiten, die Arno Gruen in seinem Buch „Der Fremde in uns“ herausgearbeitet hat: „Diesen Teil von uns wollen wir zum Schweigen bringen, indem wir den Fremden, der uns daran erinnert, weil er uns ähnelt, vernichten.“... (Ausgrenzen, an den Rand drängen, wegsperren ...) 30 Rath Heinz Häfner bestätigt diese Aussage auf eine sachliche Weise. Er spricht davon, dass es „für die Menschen, die von Schizophrenie betroffen sind, hilfreich ist, zu wissen, dass sie nicht an einer geheimnisvollen, von ihren Ursachen her unbekannten Krankheit leiden, sondern an einer Disposition, die sie mit vielen Menschen gemeinsam haben, und zudem an einem Reaktionsmuster, das durch diese Disposition, aber nicht allein durch sie, hervorgerufen wird. Dieses Reaktionsmuster Psychose ist nicht nur geeigneten medikamentösen oder kognitiv therapeutischen Maßnahmen, sondern auch der eigenen Einsicht wesentlich besser zugänglich ...“ [6] Auch der Einsicht der Angehörigen – die wie die Betroffnen (die „psychisch Außerordentlichen“, wie sie sich neuerdings nennen) aus dieser Aussage erkennen können, dass durch Reflexion und Verhaltensänderung einiges zu erreichen ist – nicht leicht und nicht gleich und nicht alles – eben einiges. Aber schon die Aussicht etwas tun zu können, gibt Hoffnung und fördert die Bereitschaft, Bewältigungsstrategien zu erarbeiten und gegen Stigmatisierung anzukämpfen. Dazu gehört in erster Linie die Erkenntnis, dass wir von unserem eindimensionalen Ursache – Wirkungsdenken abgehen müssen, welches im Fall der Angehörigen psychisch Erkrankter meist in der Suche nach einem Sündenbock gipfelt. Der Lieblingssündenbock der Angehörigen ist völlig undifferenziert „die Psychiatrie“ und umgekehrt von außen her wird der Familie der Schwarze Peter zugeschoben. Einige der Hypothesen des vergangenen Jahrhunderts haben ja bekanntlich die Verursachung der psychiatrischen Schwierigkeiten des betroffenen Familienmitgliedes direkt der Familie als Schuld angelastet – dies als Ausfluss der Achtundsechziger-Meinung, dass Gesellschaft und insbesondere die Familie die Wurzel allen Übels sei. Insbesondere die „schizophrenogene“ Mutter war Ziel von höchst einseitigen Anschuldigungen, die unendlich viel Unglück in die ohnehin belasteten Familien gebracht haben und noch heute gibt es ältere Frauen, die ein Leben lang fast ohne jede Hilfe für ihren Kranken gesorgt haben (vielleicht ein wenig zuviel – aber wie hätten sie dies wissen sollen?) und noch immer unter Schuldgefühlen leiden. In jüngster Zeit vermehrt artikuliert wird als Ursache von psychischen Störungen der sexuelle Missbrauch in der Familie. Nicht dass es dies alles – leider – nicht wirklich gäbe, aber gerade in unserer voyeuristischen Zeit liegt die Gefahr in der Verallgemeinerung und den sich daraus ergebenden Pauschalverdächtigungen aller Familien mit psychisch Erkrankten. Manche Angehörige sind ausschließlich in rein biologische Erklärungsmuster der Krankheitsursache (z.B. Stoffwechselstörung) geflüchtet, die entlastend einfach die Notwendigkeit der Selbstreflexion und einer Veränderung der Verhaltensmuster in der Familie zuwenig deutlich macht. Kann man denn wirklich von „Schuld“ sprechen? Wenn man einzig eine biologisch Anomalie als Verursachung von psychischen Krankheiten gelten lässt, muss man über eine Entkräftung der Schuldzuweisung nicht weiter nachdenken. Da aber unter anderen Ursachen auch der Einfluss des sozialen Umfeldes als eine mögliche Wurzel von psychischer Krankheit feststeht, geht es uns als Angehörigenorganisation um eine Definition des Begriffes „Schuld“. Nach philosophisch/theologischen Kriterien ist der Begriff der Schuld in der europäischen Tradition stets an Vorsätzlichkeit gebunden und aus diesem Grund auf Angehörige selten anwendbar. Denn im familiären Zusammenleben wird aus dem eigenen biografischen und charakterlichen Background heraus gehandelt, so gut es eben in der gegebenen Situation möglich ist unter ungewollter Einbeziehung aller Defizite in den Voraussetzungen und aller Fehlhaltungen. Vorsätzlich schlecht oder böse handeln Angehörige, z.B. Eltern, sehr selten an ihren Kindern. Unqualifizierte Schuldvorwürfe sind begrifflich falsch und belasten die ohnehin verunsicherten Angehörigen schwer, sie rauben Kraft, die dringend gebraucht wird. Ein „Freispruch der Familien“ (Dörner) im oben erläuterten Sinn erleichtert erfahrungsgemäß eine tiefgehende Reflexion über das eigene Verhalten, erleichtert Veränderungsversuche der einzelnen Familienmitglieder und Versuche, die Familienatmosphäre zu verbessern. Stigmatisierung der Angehörigen durch ihre von psychischen Störungen betroffenen Familienmitglieder Es ist naheliegend, dass Menschen mit einem so großen Leidensdruck, dem Jugendalter oft kaum entwachsen, die Schuld für das Unerklärbare bei den Menschen suchen, die ihnen am nächsten stehen. Es gehört zum Krankheitsbild, dass es dabei oft zu massiven Vorwürfen kommt, die sehr treffen. Im Sinne einer Entstigmatisierung der Angehörigen – Eltern, Partner, Geschwister usw. bitten wir die Psychiatrieerfahrenen, so es ihnen wieder besser geht, über eindimensionale Anschuldigungen an ein Familienmitglied oder die ganze Ursprungs- Angehörige – Parias am Rande der Psychiatrie? familie nachzudenken – ev. mit Hilfe eines Therapeuten. Oftmals gelingt es, über differenziertere Urteile in wieder beruhigten Zeiten zu gerechteren Folgerungen und zu einem entkrampfteren Zusammenleben zu finden, was für alle Beteiligten gleichermaßen wichtig ist. In unserer Beratungsstelle können wir ein Lied davon singen, wie nötig es ist, durch Schuldzuweisungen verletzte Angehörige aufzufangen und aus dem Schock die Bereitschaft herauszufiltern, Geduld zu haben, die Sympathie für den Erkrankten zu bewahren und die Chance zur Reflexion und zur eigenen Veränderung zu erkennen. Und wenn es sich herausstellen sollte, dass es für beide Teile (Angehörige und Betroffene) besser ist, mit mehr Distanz zu leben, sich also bezüglich Wohnen zu trennen, muss auch das möglich sein, ohne dass seitens der Professionellen massiv Druck auf die Familie ausgeübt wird, ihr krankes Mitglied nicht zu „verstoßen“. Davon ist keine Rede – aber die Trennung ist oft für beide Teile „Überlebenschance“ und der emotionale Background kann besser erhalten werden. Stigmatisierung der Angehörigen durch Professionelle Auch dieses Kapitel muss geschrieben werden .Nicht um billiger Anklagen willen, sondern um Überheblichkeiten und Gedankenlosigkeit aufzuzeigen und um Grenzen abzustecken. Denn Professionelle haben ein umfassendes Expertenwissen – natürlich – aber das ist nicht alles, was gebraucht wird. Ein sehr bekannter Psychiater, der plötzlich in seiner engsten Familie eine psychisch Kranke hatte, sagte mir einmal, dass er nun den Ange- hörigen ganz anders gegenüberstünde und dass seine ganze Theorie bezüglich Angehörigenarbeit nun erst „geerdet“ sei ... Gott sei Dank müssen nicht alle Menschen, die gute Fachleute sind, auch „echte“ Angehörige sein. Es ist aber zu hoffen, dass sie, um ihr Wissen optimal einsetzen zu können, ihre Verantwortung zur Selbstreflexion wahrnehmen, dass sie z.B. ihre Probleme mit den eigenen Eltern kennen, dass sie Alfred Adlers Theorie vom Stellenwert des Geltungsdranges und das Streben nach Überlegenheit, nach Macht, richtig ausbalancieren, dass sie nicht vergessen, dass auch die heutige wissenschaftliche „Wahrheit“ und der darauf beruhende „state of the art“ nur ein Durchzugsstadium sein kann. Bekanntlich ist „die Wahrheit von heute der Irrtum von morgen.“ Dass Fachleute also bereit sind, ihre eigene wissenschaftliche Weltanschauung immer wieder zu hinterfragen und neu anzureichern. Und dass sie dazu auch um ihre Verführbarkeit wissen müssen. Auch die Beurteilung des Stellenwertes von Angehörigen im jeweiligen Drama ist schwierig aber notwendig. Mit Klischees kommt man nicht aus, auch nicht mit wissenschaftlichen, denn um das Agieren einer z.B. Overprotektion-Mutter ein wenig ausloten zu können, braucht es – neben schlichter Menschlichkeit und Kenntnis ihrer Biografie auch eine Portion kulturhistorisches Wissen. Als naseweiser Laie bin ich ja überhaupt der Meinung, dass ein guter Psychiater neben seinen medizinischen Kenntnissen und dem ganzheitlichen Wissen vom Menschen noch Philosophie, Kulturgeschichte und auch Religionswissenschaft in Grundzügen erlernt haben sollte. Wenn Angehörige besonders lästig sind, ist auch ihr Leidensdruck besonders groß – sie müssen nicht „vom Halse geschafft“ werden, sie brauchen um ihrer selbst willen ehrliche professionelle Zuwendung. Sie „links“ liegen zu lassen, ist Missach- 31 tung von menschlichem Leid, ein Verstoß gegen die ärztliche Pflicht und kann nicht nur mit Zeitdruck entschuldigt werden. Diese Unarten haben sich aber in den letzten Jahren spürbar gebessert. Und noch eines: Kraft ihres Expertentums und der daraus resultierenden Autorität sollten sich Ärzte die Treffsicherheit ihre Worte überlegen und bedenken, dass es Situationen gibt, in welchen das Leben einer Familie tatsächlich die Ausmaße einer griechischen Tragödie annehmen kann. Wenn z.B. einer an sich sehr vernünftigen Mutter ganz objektiv beurteilt aus heiterem Himmel eine massive Gesichtsverletzung zugefügt und der Betroffene nach einem recht kurzen Krankenhausaufenthalt wieder zu ihr nachhause geschickt wird mit der Begründung: „Wo soll er denn sonst hingehen, sie sind doch seine Mutter“..., oder wenn eine 25 jährige drogenabhängige, äußerst schwierige psychisch Kranke im zuständigen Krankenhaus nicht aufgenommen wird, weil „sie sich ohnehin nicht behandeln lässt“ und die Mutter mit den Worten „keine Mutter lässt ihr Kind im Stich“ weichgeklopft wird, sie wieder aufzunehmen, dann vermuten wir unter anderem eine gedankenlose Bequemlichkeit hinter therapeutisch sinnlosen Aktionen. (Übrigens – in beiden Fällen haben sich andere medizinische Institutionen gefunden, die geholfen haben!) Aber der Verdacht bleibt bestehen, dass es auch einer eigenen Entstigmatisierungskampagne für Angehörige, speziell für Mütter bedarf. Ich habe Angehörigenerfahrung nun durch rund 30 Jahre, davon 11 Jahre Arbeit in der österreichischen Angehörigenorganisation. Ich kenne sehr wohl, was sich auch in der Miteinbeziehung der Angehörigen in persönliche und politische Entscheidungen zum Besseren gewandelt hat, aber zwischen „Ist“ und „Soll“ einer trialogisch ausgerichteten Psychiatrie gibt es noch große Defizite. Vieles daran ist weiter theoretisch und nicht 32 Rath eigentlich mit Leben erfüllt, dient demokratischer Selbstbefriedigung. Aber auch auf der anderen Seite gibt es Nachholbedarf: z.B. die Erkenntnis, dass auch Betroffene und Angehörige für die Professionellen eine gewisse Verantwortung haben in Richtung Achtung vor guter Arbeit, dort wo sie geleistet wird und Achtung vor einem fallweise sehr schweren Beruf, in dem aufgrund verknöcherter Strukturen viele gute Leute nicht immer tun können, was ihnen wirklich als das Beste zu tun erscheint. Die Frage Ulrich Becks - in anderem Zusammenhang gestellt – hat auch in der Angehörigen/ Professionellenbeziehung Berechtigung: „Die alten Autoritätsstrukturen mögen beschädigt sein, jedenfalls ist ihr Lack ab; Verhandlung wird zum dominanten Muster. ... Die Prinzipien des Gespräches aber, des virtuellen Rollentausches, des Zuhörens, Verantwortung-für-einander-Übernehmens bleiben uneingelöst. Sind sie vielleicht nicht lebbar?“ [1] Die Antwort auf diese Frage ist wohl die Feststellung, dass hier der Weg das Ziel ist, welches vielleicht nie wirklich befriedigend erreicht werden kann, aber der Weg muss unbeirrbar auch gegen Widerstände in Zeiten der „Gegenreformation“ weitergegangen werden. Dies fordert auch den Angehörigenorganisationen einiges ab. Aber unbeirrt gegangen führt dieser Weg auch aus dem stigmatisierten „Tschapperldasein“ der Angehörigen.. Angehörige psychisch Erkrankter und Öffentlichkeit Bekanntlich gibt es viele Studien, die Wissen und Einstellung der Öffentlichkeit über psychische Störungen, v.a. aus dem schizophrenen Formenkreis, untersucht haben. „Das Ergebnis war, kurz gesagt nicht optimistisch. Nach wie vor besteht hinsichtlich der nahen sozialen Beziehungsebenen ... überwiegend Ablehnung.“ [6] Bei der jüngeren und gebildeteren Bevölkerungsschicht sei die Ablehnung allerdings in letzter Zeit zurükkgegangen. Das gibt ein wenig zu Hoffnung Anlass und findet in der Evaluierung der in Österreich durchgeführten Schulaktionen ihren Niederschlag. Leider darf man den Einfluss von Stereotypen, wie schon ausgeführt, nicht unterschätzen – bekanntlich lebt nichts so lange wie ein Vorurteil. Außerdem – einige davon sind sehr leicht zu entkräften andere wieder schwer oder gar nicht, auch deshalb, weil ihre differenziertere Betrachtung ein beachtliches Fachwissen voraussetzt, das natürlich bei Durchschnittsbürgern nicht gegeben ist. Dazu kommt die häufig sensationslüsterne Aufmachung der Berichterstattung in den Medien, oft auch missbraucht zur Verstärkung politischer Tagestendenzen. Leider sind die Folgen auf den sozialen Verlauf der Krankheit besonders tragisch in einer Zeit, in der Mauern fallen und Krankenhausbetten dezimiert und die Erkrankten ja auf eine gewisse Integrationsbereitschaft der Allgemeinheit angewiesen sind. Einiges an Einsicht kann man wohl in der Öffentlichkeit fordern, aber es wäre naiv, eine rasche Veränderung der Einstellung sozusagen von heute auf morgen als Wunder zu erwarten. Das soziale Umfeld darf nicht überfordert werden. Je „normaler“ und unauffälliger das Leben von „psychisch Außergewöhnlichen“, wie sie sich selber nennen, geführt werden kann, je weniger sie aus dem Rahmen des sogenannten Üblichen fallen, desto weniger wird sie das Umfeld stigmatisieren. Dazu gehören Medikamente, die das Äußere nicht auffällig verändern, gehört eine gewisse Körperpflege, gehört eine materielle Basisgrundla- ge, auch wenn keine Anbindung an die Berufswelt möglich war usw. Dafür könnte u. a. eine nachgehende Begleitung, ein sogenannter Casemanager sorgen. Falls der oder die Betroffene einverstanden ist – ansonsten beginnt die niemalshoffnungslose aber unter Umständen langwierige Arbeit eines Beziehungsaufbaues. Casemanagement ist auch in mehreren österreichischen Bundesländern geplant, aber noch nicht in die Praxis übergeführt. Die Angehörigenorganisation fordert diese Maßnahme schon lange, zum derzeitigen Stand der Psychiatriereform ist sie aber unverzichtbar geworden. Nur durch sie kann ein Absinken vieler psychisch Erkrankter in die beziehungslose Verelendung oder ein Mehr an gesetzlich erlaubter Gewalt verhindert werden. Sie ist die Gretchenfrage an die Politik: „Wie hältst Du es wirklich mit Deiner Sorgepflicht?“ Denn wie Klaus Dörner richtig sagt, muss die Respektierung der eigenen Entscheidung des anderen und sein Selbstbestimmungsrecht eingebettet sein in eine Beziehung zu ihm und in die Sorge für ihn. [2] Ich verstehe diese Auflage so, dass von der Öffentlichkeit, von den Mitmenschen (Nachbarn etc) und v.a. von den Angehörigen her unter Wahrung von der die Menschenwürde erst möglich machenden Distanz alles getan werden muss, um ein Leben „draußen“ mit Qualität anzubieten. Dazu gehört alles, was eine gute Sozialpsychiatrie weiß, aber sie sollte auch die nervlichen Grenzen des sozialen Umfeldes kennen. Durch all diese Maßnahmen würde auch die Stigmatisierung der Familie auf ein Mindestmaß zurükkgeführt werden, der Rest könnte durch ein wieder intaktes Selbstwertgefühl der Angehörigen halbwegs bewältigt werden, das zu einem sicher nicht einfachen Schicksal steht und es nicht verleugnet. (Und dass die Hilfe der Gemeinde und ihrer Einrichtungen selbstverständlich anfordert.) 33 Angehörige – Parias am Rande der Psychiatrie? Selbst – Stigmatisierung ? Michel Montaigne (1533 – 1592) erzählt die Geschichte des Königs von Mazedonien, der in römische Gefangenschaft geraten war und an Aemilius Paulus einen Boten sandte mit der untertänigen Bitte, ihm die Schmach des Triumphzuges zu ersparen. Dieser antwortete: „Dies Gesuch soll er an sich selber richten“. [7] Dies kann im Ehrenkodex alter Zeiten eine Aufforderung zum Selbstmord sein, in unserer Angehörigenproblematik aber ist es als Hinweis auf die wiederhergestellte Kraft des eigenen Selbstwertgefühles zu verstehen, frei nach einem Leitspruch unserer Organisation: Keine Schuld, keine Schande, ein Schicksal – das angenommen und bewältigt werden muss! Angehörige brauchen dazu vor allem Information, mehr abgesichertes Wissen und das Gefühl, zusammen mit den Freunden in der Selbsthilfe durch Gespräch und Schulung Bewältigungsstrategien entwickeln zu können, die ihnen aber auch den Betroffenen nützlich sind. Die Lösung kann nicht in der Hoffnung auf ein „Wunder“ liegen, sondern im Annehmen des erkrankten Familienmitgliedes, so wie es ist. Und in Strategien von Distanz und Nähe, von der Respektierung der beidseitigen Grenzen und der Be- dachtnahme auch auf die eigene Lebensqualität. Dies bedingt Kampf gegen die innere Versuchung des totalen Rückzuges aber doch die Freiheit, sich seine Freunde nach neuen Kriterien auszuwählen – nach seelischer Tiefe, Menschlichkeit und Fähigkeit zum Loslassen. Die Ermutigung zur Selbsthilfe meint ein sich Lösen aus der „Opferrolle“ – meint auch, sich durch Dummheit und Unwissenheit nicht verwunden zu lassen, meint Kraft zum Einfordern aller möglichen Hilfen, die längst versprochen aber noch nicht verwirklicht sind, zieht also die Grenzen der Subsidiarität. Selbsthilfe heißt auch Ermutigung zur Mithilfe an der Entstigmatisierung der Psychiatrie als Institution – unsere betroffenen Angehörigen sind oder waren nicht mehr „im Irrenhaus“ sondern im Krankenhaus für seelische Ausnahmezustände, wie sie jedem Menschen widerfahren können. Nach all dem Gesagten ist klar – Angehörige dürfen sich nicht ausliefern, auch nicht der eigenen Verzweiflung – sie müssen gegen Stigmata inneren Widerstand leisten. Als Angehörigenorganisation werden wir alles tun, um das Stigma, das psychischen Störungen anhaftet auf allen Linien zu bekämpfen – dazu dient auch unsere aktive Mitwirkung an der derzeit laufenden Antistigmakampagne. Literatur: [1] Beck U. (Hg): Kinder der Freiheit. (S. 215 ff), Suhrkamp, Frankfurt Main 1997 [2] Dörner K.: Der gute Arzt. Schattauer, Stuttgart 2001. [3] Finzen A.: Psychose und Stigma. Psychiatrieverlag Bonn 2000. [4] Finzen A: Die „schizophrenogene Mutter“. „Kontakt“ 4, 1994. [5] Goffmann E., Stigma. Suhrkamp, Frankfurt Main 1975. [6] Häfner H.: Das Rätsel Schizophrenie: (S. 175 u. 408). Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 2oo1. [7] Montaigne M.: Essais, Philosophieren heißt sterben lernen. [8] WPA: Global Programme against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia, Dt. Übersetzung, promente Linz 2000. Mag. Ingrid Rath HPE – Österreich, Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter Bernardg.36/14, A-1070 Wien KOMMENTAR Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 35 – 36 Stigmatisierung als Folge intrapsychischer Abwehrprozesse – der psychotherapeutische Gesichtspunkt Harald Meller Gesellschaft für Psychische Gesundheit Tirol, Innsbruck Zu den bestehenden umfangreichen Bemühungen, Stigmatisierung zu benennen, sie kenntlich zu machen und gegen sie zu arbeiten ("Entstigmatisierung"), sollen im folgenden einige Überlegungen aus psychotherapeutischer Sicht beitragen. Dieser Beitrag ist allerdings – soviel läßt sich schon vorab sagen – unbequem, da er „Schuld und Sühne“ für die Stigmatisierung psychiatrisch Betroffener nicht ausschließlich in vermeintlich veränderbaren gesellschaftlichen Zuständen ortet, sondern an anderer Stelle, nämlich in den eigenen intrapsychischen Stabilitätsmechanismen. Aus psychotherapeutischer Sicht sind zunächst drei grundlegende Dinge zu akzeptieren: • Psychotherapie und psychotherapeutisches Wahrnehmen und Handeln stellen eine maßgebliche Erweiterung der psychiatrischen Handlungskompetenz dar. Dass klassische psychotherapeutische Settings für die Behandlung im psychiatrischen Bereich vielfach nur modifiziert verwendbar sind, heißt nicht, dass angewandte Psychotherapie nicht einen hohen Stellenwert in der Organisation und Durchführung (sozial-)psychiatrischer Komplexleistungsprogramme hat und haben muss. • Die aus der psychotherapeutischpsychoanalytischen Praxis und Forschung kommenden Begriffe Übertragung und Gegenübertra- • gung stehen für Phänomene, welche im psychiatrischen Kontext gerne übersehen werden, obwohl oder gerade weil sie dort in besonderer Weise und stark ausgeprägt sind. Gerade ein gesichertes Bewusstsein über diese Phänomene wäre jedoch die Voraussetzung für eine menschenwürdige Gestaltung psychiatrischer Verhältnisse. Es gibt zwar eine reichhaltige Forschung und eine höchst kontroversielle Diskussion über die Ursachen von Psychosen und psychosewertigen Störungen, der praktische Umgang mit Menschen, die solche Störungen zeigen (das heißt im wesentlichen Beziehungsarbeit), scheint jedoch weit weniger attraktiv zu sein. Die dazugehörige Praxisforschung ist im Verhältnis zur Ursachenforschung stark unterrepräsentiert. Unter Berücksichtigung dieser drei Grundannahmen läßt sich in aller Vorsicht folgende Hypothese postulieren: Es scheint, als ob größere seelische Funktionsstörungen, wie sie mit den diagnostischen Bezeichnungen Psychose und psychosewertige Störungen gemeint sind, ein ihnen innewohnendes Gefahrenpotential besitzen würden. Gefahr allerdings nicht in dem Sinn, wie es uns der Vorgang der Stigmatisierung nahelegen will, bei dem wir einen Menschen über den äußeren Vorgang der Etikettierung mit negativen Eigenschaften belegen – im Fall von sogenannten „psychischen Kranken“ etwa mit der Eigenschaft unberechenbar, asozial, kriminell oder gefährlich. Vielmehr scheint es so zu sein, als ob der Kontakt mit Menschen mit seelischen Störungen auch in anderer Hinsicht „gefährlich“ wäre, nämlich hinsichtlich der eigenen inneren Stabilität. Das psychotische Geschehen repräsentiert nicht nur eine schwere Gefährdung des seelischen Gleichgewichts des von ihr unmittelbar betroffenen Menschen. Es gefährdet auch jeden, der mit einer Person, die Zeichen einer psychotischen inneren Organisation zeigt, zu tun hat, also im engeren Kontakt oder in Beziehung zu dieser Person steht. Diese Gefährdung bleibt großteils unbewusst, da die eigene seelische Integrität und „Normalität“ für jeden Menschen einen sehr hohen – auch narzisstischen – Stellenwert besitzt. Dies gilt ganz besonders für Menschen, welche in psychiatrischer Professionalität arbeiten müssen. Hier dient das „ICH bin NICHT verrückt“ nicht nur als Konstituente eines stabilen Ich und Selbst – wie bei jedem anderen –, sondern zusätzlich als Differenzierung und Unterscheidungskriterium zu den betroffenen Menschen oder zu Berufskollegen ... Man will keinesfalls Subjekt einschlägiger Witze sein, welche z.B. Psychiater und Patienten auf eine Ebene der Verrükktheit stellen, oder Gegenstand von Redewendungen wie „Wer Psychologe wird, braucht selber einen“. 36 Kommentar Um die seelische Stabilität aufrecht zu erhalten, muss die Gefährdung des eigenen Funktionierens unbewusst bleiben. Die psychotherapeutische Forschung hat dazu ausführliche Konzepte entwickelt und ein ganzes Arsenal von sogenannten Abwehrmechanismen beschrieben. Der Kontakt zu psychosebetroffenen Menschen führt also dazu, dass sich bei den „Gesunden“ die jeweiligen „gesunden“ Abwehrmechanismen verstärken. Gleichzeitig bleiben diese psychischen Geschehnisse weitgehend unbewusst. In der Folge und im Lauf der Zeit bilden sich aus den vielen individuellen Abwehrhaltungen kollektive spezifische Abwehrmuster. So kann die Summe zunächst persönlicher Abwehrhaltungen zu einer Gemeinschaftshaltung werden. Einige typische Abwehrmuster lassen sich herausarbeiten im Sinn von Haltungen oder Verhaltensweisen Betroffenen gegenüber. Diese Haltungen können durchaus zuwiderlaufend oder gegensätzlich sein, in der gesellschaftlichen Gesamtorganisation führen sie als Summenfaktor der Haltungen von Subsystemen zum Gesamtphänomen der Stigmatisierung. Einige dieser typischen Abwehrhaltungen (Gegenübertragungsfixierungen) und daraus resultierende Verhaltensweisen psychotischen Menschen gegenüber sind folgende: • Die allgemeine „geographische“ Abwehrhaltung: „Bei uns soll es keine solchen geben. Hauptsache, sie sind woanders, wo sie uns nicht stören.“ • Die antipsychiatrische Abwehrhaltung: „Es gibt keine Psychose. Empfindliche Menschen werden zu Opfern gemacht. Täter sind • • • • gesellschaftliche Machtstrukturen, allen voran die Psychiatrie.“ Die sozialutopische Abwehrhaltung: „Menschen mit Psychosen sind die wahren Menschen. Früher wären sie heilig gesprochen worden.“ Die soziotherapeutische Abwehrhaltung: „Man muß alles tun um zu helfen. Schuld sind unzureichendes Verständnis für soziale Angelegenheiten. Man bräuchte viel mehr Geld.“ Die naturwissenschaftliche Abwehrhaltung: „Psychotische Menschen sind grundsätzlich anders. Ihre „vererbbare Stoffwechselstörung“ behindert ihr seelisches Funktionieren. Allenfalls können Medikamente die Funktion verbessern.“ Die entwicklungspsychologischpsychoanalytische Abwehrhaltung: „Tiefe Störungen des seelischen Erlebens sind in frühester Kindheit durch Fehlbehandlung verursacht. Frühe Störungen sind schlecht behandelbar und äußerst mühsam in der konkreten Praxisarbeit.“ Die beschriebenen Abwehrhaltungen betreffen in exemplarischer Weise vor allem den Bereich Psychiatrie und damit die in diesem Bereich tätigen Personen. Man könnte noch einige weitere Haltungen herausarbeiten, wollte man die Liste vollständig machen. Bedeutsam scheint, wie unterschiedlich einerseits, wie effektiv und relevant andererseits Denkmuster und Überzeugungen dazu führen, den von den Betroffenen so dringend benötigten menschlichen Kontakt in irgendeiner Weise zu vermeiden, ihn zu reduzieren oder unter extreme Vorgaben zu stellen, sodass im Endeffekt menschliche Abwertung die Folge ist. Der Prozess der Stigmatisierung ist so gesehen ein sehr grundlegendes psychisches Phänomen und eines, an dem man sehr schnell tätigen Anteil hat, ohne es je selbst zu merken. Heiler, Planer, Helfer, Reformateure, Verantwortliche und gesellschaftliche Größen glauben sich ja durchaus in bester Absicht, wenn sie heilen, planen, helfen, reformieren usw. Da es sich großteils um unbewusste und in der intrapsychischen neurotischen Organisation ja durchaus um normale Vorgänge handelt, ist dies auch niemandem persönlich zum Vorwurf machen. Die Psychotherapie könnte zur Entstigmatisierung einen Beitrag leisten, indem sie soziologische und historische Betrachtungsweisen um die Benennung jener innerpsychischen Prozesse bereichert, die das was wir Stigmatisierung nennen, ausmachen und die letztlich immer dazu führen, den Kontakt, die Begegnung und Beziehung zu anderen Menschen zu reduzieren oder zu verunmöglichen. Um die Entwicklung in diese Richtung zu lenken, ist es notwendig, Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis zu fördern. Im Bewusstsein eigener Anteile kann sich eine Reflexionskultur etablieren, die eine offene konstruktive und wertschätzende Auseinandersetzung ermöglicht – im Sinne eines letztlich kulturellen und damit auch mühsamen Prozesses. OA Dr.Harald Meller Institut für sozialpsychiatrische Rehabilitation GPG-Tirol Karl Schönherrstr. 3 A-6020 Innsbruck 37 REZENSION Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002 Asmus Finzen: Psychose und Stigma. Stigmabewältigung – zum Umgang mit Vorurteilen und Schuldzuweisungen Psychiatrie-Verlag, Bonn 2000. ISBN 3-88414-254-2 „Alle reden von Entstigmatisierung. Was aber ist Stigma?“ fragt Asmus Finzen in der überarbeiteten Neuauflage von „Psychose und Stigma“. Kein Zweifel, dieses Buch liegt im Trend, den der Autor im deutschen Sprachraum wohl selbst mitinitiiert hat: Keine Zeitschrift, keine Tagung, die dieses Thema nicht aufgreift, zusätzlich gefördert durch die in zahlreichen Ländern breit angelegten Antistigmakampagnen. Doch Asmus Finzen verweigert sich dem psychiatrischen Zeitgeist, er führt uns – wie so oft – weiter. Er holt die allzu hehren Ziele hochgeschraubter Kampagnen auf den spröden Boden der Realität, er macht uns mit viel Geduld klar, wieso „dem Stigma-Management (Goffman) der Vorrang gegenüber dem langfristigen – und utopischen – Ziel der Entstigmatisierung gebührt“. Eine Enttäuschung für alle idealistisch an der Psychiatrie-Entwicklung werkelnden Menschen. Aber eine gesunde. Anhand einer prägnanten Zusammenfassung des Goffman-Klassikers aus den 60er Jahren erhalten wir Grundinformationen über das soziologische Phänomen der Stigmatisierung und ihre Auswirkungen auf psychisch Kranke. Gerade anhand des Begriffs der Schizophrenie wird klar, was Stigma ist und wie es zu einer „zweiten Krankheit“ führt: „Schizophrenie ist nicht nur eine Krankheitsbezeichnung. Schizophrenie ist, wie Krebs und Aids und früher die Tuberkulose, zugleich eine Metapher. Der Begriff steht für alles mögliche andere; und nichts davon ist gut.“ – „Man kann die Krankheit Schizophrenie nicht behandeln – wenn man sich nicht zugleich mit den Folgen des öffentlichen Umgangs mit ihr befasst.“ Der Autor zeigt uns, was unsere Bilder und Vorstellungen anrichten können. Er setzt sich auseinander mit den Nöten Betroffener und Angehöriger, für die eine psychiatrische Diagnose zunächst einmal „eine Katastrophe“ darstellt und beschreibt, wie Vorurteile wirken und zu sozialer Ausgrenzung führen. Er diskutiert die häufigen Fragen nach Ursache, Verantwortung und Schuld und geht im besonderen auf die Vorurteile „gefährlich“ und „unberechenbar“ ein. Ein zusätzliches Kapitel widmet sich den noch zu wenig beachteten Kindern psychisch erkrankter Eltern. Im besonderen macht er auf die Schwierigkeiten, aber auch auf die Leistungen und die Bedeutung der Angehörigen aufmerksam und auf das Unrecht, das den Familien widerfährt. Doch „was ist zu tun“? Erst wenn die Beteiligten den sozialen Mechanismus der Ausgrenzung „begreifen, sind sie im Stande, das Stigma zurückzuweisen und zu bewältigen“: Der Autor plädiert dafür, „sich selbst und anderen immer wieder zu bekräftigen: An Schizophrenie ist niemand Schuld!“ Er fordert uns auf, „ein nüchternes Verhältnis zur Krankheit ‚Schizophrenie‘“ zu entwickeln und regt uns an, furchtlos zu sein, an unseren individuellen, jeweiligen Umgang zu glauben und notfalls auch mal zu lügen: „Moralische Überlegungen sind hier fehl am Platz. Die Moral der Gemeinschaft der Gesunden im Umgang mit an Schizophrenie Erkrankten lässt mehr zu wünschen übrig als umgekehrt.“ Er ermutigt uns zum „Blick nach vorn. Denn der Verlauf der Krankheit ist durch eigenes Verhalten – der Kranken wie der Angehörigen – zu beeinflussen“. Ein Appell an die eigene Verantwortlichkeit. Ein Appell an die Kraft der kleinen Schritte und eine Absage an den Größenwahn gesellschaftsverändernder Maßnahmen, die uns höchstens als Utopie die Richtung angeben können. Wer immer noch keine Kampagne geplant hat, kann mit der Lektüre dieses Buches einige Fehler vorweg vermeiden ... Finzens Buch bestärkt und ermutigt jene, die es unmittelbar betrifft und hilft allen anderen zu verstehen. Aus den Ausführungen sprechen Empathie, Respekt und die langjährigen Erfahrungen eines Profis, der eine wohltuende Bescheidenheit pflegt. Dazu kommt, dass Herr Finzen einfach gut schreibt. Komplexe Sachverhalte werden verständlich, wir haben das Gefühl, als ob uns grade eben unser Nachbar das alles erzählen würde. Und er verleiht dem luftigen Zeitgeist-Thema „Stigma“ wieder Gewicht. Mag. Rosi Schmid, Salzburg ÜBERSICHT Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 39 – 45 Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Überlegungen Matthias C. Angermeyer und Beate Schulze Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Leipzig Schlüsselwörter Stigma Konzept – Schizophrenie – AntiStigma Interventionen Key words stigma concept – schizophrenia – antistigma interventions Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Überlegungen Im Rahmen eines von der World Psychiatric Association initiierten Programms werden in verschiedenen Ländern, darunter auch in Österreich, Interventionen zur Reduzierung der Stigmatisierung und Diskriminierung schizophrener Kranker durchgeführt. In Anlehnung an das von Link et al. entwickelte Konzept des Stigmaprozesses wird versucht die Vielzahl der gewählten Strategien in eine systematische Ordnung zu bringen. Für die einzelnen Etappen des Stigmaprozesses (Wahrnehmung und Benennung eines Unterschieds – Verknüpfung mit negativen Stereotypen – Abgrenzung von anderen Menschen – Diskriminierung) werden Ergebnisse der Stigmaforschung dargestellt und darauf aufbauend Ansätze für Interventionen diskutiert. Schließlich werden die Grenzen angesprochen, die den Bemühungen um eine Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie gesetzt sind. Interventions to reduce stigma related to schizophrenia: A conceptual discussion In the context of an international programme initiated by the World Psychiatric Association, interventions aimed at reducing stigma and discrimination because of schizoph- renia are being developed in many countries, including Austria. Drawing on Link’s et al. concept of the stigma process (distinguishing and labelling differences – associating differences with negative stereotypes – separating ”us” from ”them” – discrimination ), results of stigma research will be presented and opportunities for anti-stigma interventions will be discussed for each step of the process. Finally, the limitations of attempts to reduce stigma and discrimination will be pointed out. Einleitung Im Jahr 1996 initiierte die World Psychiatric Association ein Programm zur Reduzierung der Stigmatisierung und Diskriminierung schizophrener Kranker [55]. Es nahm seinen Ausgangspunkt in Alberta (Canada), später kamen Spanien und Österreich hinzu. Inzwischen sind 20 Länder rund um die Erde daran beteiligt. Im Rahmen dieses Programms wurden, ausgehend von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten, eine Vielzahl von Interventionen initiiert. Das Spektrum reicht von MedienKampagnen über gesetzliche Regelungen bis hin zum Empowerment von Kranken und ihren Angehörigen. Im folgenden soll versucht werden, die verschiedenen Ansätze, die das Ziel verfolgen, das Stigma der Schizophrenie zu reduzieren, in eine systematische Ordnung zu bringen. Dies soll die Orientierung innerhalb der Vielfalt der gewählten Strategien erleichtern. Als theoretischer Rahmen dient uns hierfür das von Link et al. [40] (vergleiche auch [38]) entwikkelte Konzept des Stigmaprozesses. Er nimmt seinen Ausgang damit, dass bei einer Person ein Unterschied zu anderen Menschen festgestellt wird und dieser benannt wird. Er findet seine Fortsetzung darin, dass die so bezeichnete Person mit negativen Stereotypen in Verbindung gebracht wird, die über diesen Personenkreis in der Gesellschaft vorherrschen. Damit fällt die so bezeichnete Person in eine distinkte Kategorie von Menschen, von denen man sich abgrenzt. Der Stigmaprozess kulminiert darin, dass die Person verschiedenen Formen der Diskriminierung ausgesetzt ist mit den entsprechenden negativen sozialen Konsequenzen. Für die einzelnen Stufen des Stigmaprozesses sollen die Ergebnisse der in jüngerer Zeit durchgeführten Forschung dargestellt werden und darauf aufbauend Möglichkeiten der Intervention diskutiert werden. Wahrnehmung und Benennung eines Unterschieds Der Stigmaprozess wird dadurch eingeleitet, dass bei jemandem ein unterscheidendes Merkmal festge- 40 Angermeyer und Schulze stellt und dieses mit einem Label versehen wird. Durch was sind nun schizophrene Kranke von anderen Menschen unterscheidbar? Als erstes sind hier die akuten psychotischen Symptome zu nennen, durch die die Kranken die Aufmerksamkeit ihrer Umwelt auf sich ziehen. Hinzu kommen die auf den ersten Blick weniger auffallenden Negativsymptome und krankheitsbedingten Behinderungen. Weiterhin sind hier die unerwünschten Effekte der psychopharmakologischen Behandlung bedeutsam. Vor allem durch die extrapyramidalmotorischen Nebenwirkungen der konventionellen Neuroleptika werden die Kranken für ihre Umwelt als solche erkennbar. Aus „Diskreditierbaren“ [26], die es selbst in der Hand haben, ob sie sich als psychisch Kranke „outen“ oder nicht, werden „Diskreditierte“, die wegen des medikationsbedingten Parkinsonoids als psychisch Kranke identifiziert werden können – ob sie es wollen oder nicht. Aber nicht nur diese sichtbaren Unterschiede sind von Bedeutung. Allein durch das Bekanntwerden der Diagnose „Schizophrenie“ wird der Stigmaprozess in Gang gesetzt – unabhängig davon, ob die Betroffenen im Moment Symptome der Krankheit aufweisen oder nicht. Ja schon allein die Tatsache, dass jemand in psychiatrischer Behandlung ist (oder war), genügt. Von großer Bedeutung dafür, ob der Stigmaprozess in Gang kommt und welche Auswirkungen er nach sich zieht, ist die Sichtbarkeit des unterscheidenden Merkmals [17]. Je wirksamer die psychiatrische Behandlung in der Reduzierung der Krankheitssymptome und der krankheitsbedingten Behinderungen ist, um so geringer dürfte das Stigmatisierungsrisiko sein. Und je geringer die sichtbaren Nebenwirkungen der Psychopharmakotherapie sind, desto weniger laufen die Kranken Gefahr, stigmatisiert zu werden. Die Einführung der atypischen Neuroleptika bedeutet hier sicher einen Fortschritt, führen sie doch seltener zu extrapyra- midal-motorischen Nebenwirkungen. Was den stigmatisierenden Effekt der psychiatrischen Diagnose und die Tatsache, ein psychiatrischer Patient zu sein, betrifft, so lassen sich zwei gegenläufige Strategien unterscheiden: die Medikalisierung und die Normalisierung. Befürworter der Medikalisierung versprechen sich von einer möglichst engen Annäherung der Psychiatrie an die Medizin eine entstigmatisierende Wirkung. Sie plädieren für die Anwendung des medizinischen Krankheitskonzepts auf psychische Störungen und dafür, psychische Krankheiten wie andere medizinische Krankheiten zu betrachten. Sie propagieren eine klare Grenzziehung zwischen Normalität und psychischer Krankheit, die in ihren Augen zwei verschiedene Kategorien darstellen. Es besteht die Tendenz, den Krankheitsbegriff weit zu fassen und viele psychische Störungen darunter zu subsumieren. Man spricht sich klar für den Gebrauch der psychiatrischen Diagnose aus. Patienten werden als solche bezeichnet. Die Psychiatrie wird als eine Disziplin der Medizin begriffen. Die Verankerung der klinischen Psychiatrie in der neurowissenschaftlichen Grundlagenforschung wird betont. Räumlich wie organisatorisch bemüht man sich um die Integrierung der Psychiatrie in die Medizin. Die Strategie der „Normalisierer“ verfolgt genau das Gegenteil: Sie gehen möglichst auf Distanz zur Medizin. Man vermeidet es, psychische Störungen als Krankheit zu bezeichnen und spricht lieber von einer „Krise“. Zwischen Normalität und psychischen Störungen bestehen in ihren Augen fließende Übergänge. Der Normalitätsbegriff ist sehr breit gefasst. Man ist gegen die Verwendung psychiatrischer Diagnosen. Dies gilt ganz besonders für die Schizophrenie wegen des ihr anhaftenden Stigmas. Psychosoziale Erklärungsmodelle werden präferiert. Einer psychopharmakologischen Behandlung steht man eher skeptisch bis ablehnend gegenüber. Die Benen- nung als psychiatrischer „Patient“ wird peinlich vermieden. Vielmehr ist von „Klienten“, „Psychoseerfahrenen“ oder „Psychiatrieerfahrenen“ die Rede, oder man wählt die eher kryptische Bezeichnung „Betroffene“. Räumlich und organisatorisch geht man möglichst auf Distanz zu Institutionen der Psychiatrie. Der Medikalisierungsansatz findet vor allem bei professionellen Helfern medizinischer Provenienz Anklang, daneben auch bei vielen Angehörigen. Dagegen tendieren v.a. in Selbsthilfegruppen organisierte Kranke, aber auch Vertreter paramedizinischer Berufsgruppen, eher zum Normalisierungsansatz. Welche der beiden hier idealtypisch dargestellten Strategien erfolgreicher ist bezüglich der Vermeidung der Stigmatisierung schizophrener Kranker, ist eine offene Frage. Bislang existieren nur einige wenige Studien zu diesem Thema, deren Ergebnisse zudem recht widersprüchlich sind. Für die Medikalisierungsstrategie sprechen beispielsweise die Ergebnisse von Socall und Holtgraves [59] und Mechanic et al. [42], eher dagegen die von Farina et al. [22], Fisher und Farina [23] und Rothaus et al. [54]. Verknüpfung mit negativen Stereotypen Im nächsten Schritt des Stigmaprozesses werden mit jemandem, der als „psychisch krank“, „psychiatrischer Patient“ oder „schizophren“ identifiziert wurde, negative Vorstellungen verknüpft, die in der Gesellschaft über diesen Personenkreis vorherrschen. Für das Stereotyp vom psychisch Kranken sind Hayward und Bright [29] vor allem die folgenden vier Aspekte bestimmend: die Vorstellung, dass psychisch Kranke gefährlich seien; dass sie selbst für ihre Erkrankung verantwortlich seien; dass die Krankheit chronisch Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Überlegungen verlaufen würde, schwer zu behandeln sei und eine schlechte Prognose hätte; schließlich dass psychisch Kranke gegen die Normen sozialen Rollenverhaltens verstoßen und unberechenbar seien. Was schizophrene Kranke betrifft, so dominiert hier die Vorstellung der Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit [16, 49]. Damit kongruiert das Ergebnis, dass mit Abstand am häufigsten mit Schizophrenie eine Spaltung der Persönlichkeit assoziiert wird [32]. Auf die ablehnende Haltung der Bevölkerung gegenüber psychisch Kranken allgemein und gegenüber schizophrenen Kranken im besonderen scheint die Vorstellung von deren Gefährlichkeit den stärksten Einfluss zu haben. Krankheitsdefinition, Kausalattributionen und Prognosevorstellungen treten dahinter an Bedeutung zurück. Zu diesem Ergebnis kommen übereinstimmend in jüngster Zeit in den USA und in Österreich durchgeführte Bevölkerungsumfragen [27, 41]. Nun ist das relative Risiko einer Gewalttat bei schizophrenen Kranken im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung tatsächlich mäßig erhöht. Darin stimmen praktisch alle in jüngerer Zeit durchgeführten epidemiologischen Studien überein [18]. Dagegen ist das attribuierbare Risiko, d.h. der Anteil der von schizophrenen Kranken begangenen Gewaltdelikte am Gesamt der innerhalb eines bestimmten Zeitraums begangenen Gewaltdelikte, äußerst gering. Es gibt auch keine eindeutigen Belege dafür, dass der Anteil der von psychisch Kranken begangenen Gewalttaten in den letzten Jahren zugenommen hat [3]. Das bedeutet, dass die von schizophrenen Kranken für die Allgemeinheit ausgehende Gefahr äußerst gering ist. Im Gegensatz dazu wird aber in den Medien der Eindruck erweckt, als ob schizophrene Kranke für die Gesellschaft eine große Bedrohung darstellten. Dieser Eindruck entsteht zum einen durch die selektive Berichterstattung über diese Kranken. So ergab eine Inhaltsanalyse des größten deutschen Boulevardblatts, dass die Hälfte der zwischen Januar und September 1997 erschienenen Berichte über psychisch Kranke von diesen begangene Straftaten zum Thema hatten. Bei schizophrenen Kranken waren es sogar zwei Drittel. Meist handelte es sich dabei um Gewaltverbrechen [10]. In die gleiche Richtung verweist das Ergebnis einer Auswertung überregionaler deutschsprachiger seriöser Tages- und Wochenzeitungen [31]. Auch Medienanalysen, die in Großbritannien, in den USA und in Australien durchgeführt wurden, belegen, dass über psychisch Kranke überproportional häufig im Kontext von Gewaltdelikten berichtet wird [1, 12, 30, 50, 56, 58]. Dass die Berichterstattung über Gewaltdelikte psychisch Kranker tatsächlich die Einstellung der Bevölkerung negativ beeinflussen kann, konnten wir anhand der Auswirkungen dreier Attentate demonstrieren, die in Deutschland von psychisch Kranken auf prominente Persönlichkeiten begangen wurden [5]. Das Stereotyp der Gefährlichkeit und Bedrohung für die Umwelt wird darüber hinaus durch die Darstellung psychisch Kranker im Unterhaltungsfilm verstärkt. Auch hier sind psychisch Kranke in der Rolle des Gewalttäters und Gewaltverbrechers überrepräsentiert [33, 57, 64]. Wie stark dadurch die Vorstellungen über psychisch Kranke geprägt werden können, zeigt das Ergebnis einer Fokusgruppenstudie [51]. Durch ihren Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung stellen die Medien jedoch auch eine wichtige Ressource für die Veränderung negativer Stereotypen über psychisch Erkrankte dar. Durch Kooperation mit Journalisten, besonders mittels Unterstützung bei Recherche und Themenfindung und der Vermittlung von kompetenten Interviewpartnern (sowohl psychiatrischen Experten als auch Patienten und Angehörigen) sowie durch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit seitens psychiatrischer Institutionen kann darauf hin gewirkt 41 werden, dass psychische Erkrankungen auch außerhalb der Verbrechensberichterstattung als unabhängiges Thema in den Medien etabliert werden. Gleichermaßen ist es wichtig, negative Mediendarstellungen herauszustellen und kritisch zu diskutieren. Dazu können z.B. Stigma-Warnsysteme im Internet wie bereits von der National Association of the Mentally Ill in den USA und SANE Australia betrieben oder Leserbriefe genutzt werden. In der Medienarbeit sollte Faktenwissen zu psychischen Erkrankungen mit Porträts psychisch erkrankter Menschen kombiniert werden. Berichte über Alltagserfahrungen der Erkrankten, die zeigen, wie sie ihren Alltag erfolgreich meistern und die sie auch in anderen sozialen Rollen als der Krankheitsrolle darstellen, können dazu beitragen, die soziale Distanz zwischen Menschen mit psychischen Erkrankungen und der Allgemeinbevölkerung zu reduzieren. Besonders geeignet erscheint dieser Ansatz für eine realistischere Darstellung psychisch Erkrankter in Film und Fernsehen, was in Australien durch die Einführung einer schizophren erkrankten Person in die daily soap „Home and Away“ bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Die Ausschreibung von Journalistenpreisen für Arbeiten zu psychischen Krankheiten hat sich als zusätzlicher Anreiz für eine Beschäftigung mit dem Thema erwiesen. Schließlich kann ein Medientraining psychiatrische Experten, Erkrankte und Angehörige dabei unterstützen, die für eine erfolgreiche Medienarbeit erforderlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Workshops für Journalisten können gleichermaßen dazu beitragen, diesen Multiplikatoren Wissen über psychische Erkrankungen zu vermitteln und sie im Umgang mit diesem sensiblen Thema zu schulen. Eine weitere Quelle, aus der das Stereotyp der Gefährlichkeit psychisch Kranker gespeist wird, ist die Psychiatrie. Während in Italien und in Großbritannien das Gros der psychiatrischen Großkrankenhäuser inzwi- 42 Angermeyer und Schulze schen geschlossen wurde, haben in Deutschland mit einer einzigen Ausnahme alle überlebt. Zwar wurden sie gründlich renoviert und die Bettenzahl drastisch reduziert. Dennoch haftet diesen Einrichtungen nach wie vor die Aura der Anstalt an, in die man zumeist gegen seinen Willen eingewiesen wird, in der der Einsatz von Zwangsmaßnahmen an der Tagesordnung ist und aus denen man nur schwer wieder herauskommt. So war beispielsweise bei einer 1993 in den neuen deutschen Bundesländern durchgeführten Umfrage über die Hälfte der Befragten davon überzeugt, dass in psychiatrischen Krankenhäusern Zwangsjacken und Gummizellen nach wie vor in Gebrauch seien [2]. Der Eindruck, dass es in diesen Einrichtungen primär um die Kontrolle aggressiver und gefährlicher Menschen geht, wird noch dadurch verstärkt, dass in Deutschland innerhalb zahlreicher psychiatrischer Krankenhäuser Einrichtungen des Maßregelverzugs installiert wurden. Das Laienpublikum dürfte schlicht überfordert sein zu differenzieren zwischen den "normalen” psychisch Kranken und solchen, die straffällig geworden sind. Unter dem Gesichtspunkt der Stigmatisierung ergibt sich daraus als Konsequenz für die Planung der psychiatrischen Versorgung, dass der Einrichtung von psychiatrischen Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern der Vorzug gegeben werden sollte. Auch dass die Einrichtungen des Maßregelvollzuges lokal separiert von denen der Allgemeinpsychiatrie etabliert werden sollten. Abgrenzung von anderen Menschen Die Verknüpfung des Labels „Schizophrenie“ mit den beschriebenen negativen Attributen liefert die Grundlage für die Überzeugung, dass der Träger dieses Labels sich von den Menschen, denen dieses Label nicht anhaftet, grundsätzlich unterscheidet und einer speziellen Kategorie zugehört. Er wird zu dem, als was er bezeichnet wird [19]. Er ist nicht jemand, der an Schizophrenie erkrankt ist, sondern er ist „schizophren“. Wie kann nun der Tendenz zur Reduzierung einer Person auf das Stereotyp und der Abgrenzung gegenüber dieser Person entgegengewirkt werden? Am wirksamsten dürfte hier der persönliche Kontakt mit psychisch Kranken sein. Denn dieser gestattet es, den Kranken als Person mit allen ihren Facetten kennen zu lernen. Vieles spricht dafür, dass möglichst frühzeitig, z.B. in der Schule, Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit geboten werden sollte, persönlich Erfahrung im Umgang mit psychisch Kranken zu sammeln [43]. Im Prinzip verfolgten auch die gemeindepsychiatrischen Reformen das Ziel, mehr Kontakt zwischen den Kranken und der Bevölkerung zu ermöglichen in der Hoffnung, damit zum Abbau von Vorurteilen beizutragen. Inwieweit dies realiter gelungen ist, bleibt in Ermangelung einschlägiger Daten eine offene Frage. Immerhin kommt die Mehrzahl der Studien, die den Zusammenhang zwischen persönlicher Erfahrung mit psychisch Kranken und der Einstellung diesen gegenüber untersuchten zu einem positiven Ergebnis: man vertrat seltener die Ansicht, dass diese gefährlich seien, und der Wunsch nach sozialer Distanz war etwas geringer ausgeprägt [6, 28, 36, 44, 47, 60, 61, 63]. In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig, dass der Effekt der persönlichen Erfahrung offenbar vorrangig emotional vermittelt wird, d.h. dass man seltener ängstlich-verunsichert und häufiger prosozial reagiert [7]. Eine Voraussetzung dafür, dass die psychiatrische Reform überhaupt ihr Ziel erreichen kann, ist, dass anstelle der stationären ausreichend komplementäre und ambulante Einrichtungen geschaffen werden. Andernfalls droht, siehe Beispiel USA, dass psychisch Kranke sprichwörtlich auf der Straße landen und doppelt stigmatisiert sind: als psychisch Kranke und als Obdachlose. Diskriminierung Der Stigmaprozess gipfelt in der Diskriminierung des Stigmaträgers. Prinzipiell lassen sich drei Formen von Diskriminierung unterscheiden: direkte Diskriminierung, strukturelle Diskriminierung und Diskriminierung durch Selbststigmatisierung [38]. Dass psychisch Kranke allgemein und schizophrene Kranke im besonderen auch heute noch direkten Diskriminierungen ausgesetzt sind, dafür sprechen die Ergebnisse der in den zurückliegenden 10 Jahren durchgeführten Repräsentativerhebungen bei der Allgemeinbevölkerung [z.B. 7, 14, 39]. In die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse sozialpsychologischer Experimente [z.B. 20, 21, 45). Schließlich deuten auch Studien, in denen die subjektiven Stigmaerfahrungen der Kranken exploriert wurden, auf ein substantielles Ausmaß an direkter Diskriminierung hin. Betroffen sind davon insbesondere die Beziehungen zu anderen Menschen und der Zugang zu Arbeit [9, 62]. Die Kranken berichten, dass sie nicht nur in ihrem persönlichen Umfeld Diskriminierungen ausgesetzt sind. Auch als Patienten machen sie einschlägige Erfahrungen. Dies gilt für die Psychiatrie sowie (womöglich in noch stärkerem Maß) für die übrige Medizin [9]. Maßnahmen zur Qualitätssicherung könnten hier Abhilfe schaffen. Ein Maßstab sollte dabei sein, wie die Qualität der professionellen Dienstleistungen durch die Patienten beurteilt wird. Derartige Maßnahmen würden sich dann als besonders wirksam erweisen, wenn sie mit positiven bzw. negativen Sanktionen bei der Kostenerstattung durch die Krankenkassen Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Überlegungen verknüpft würden. Eine andere Möglichkeit, die Kranken vor Diskriminierungen während des Aufenthalts in einer psychiatrischen Klinik zu schützen, stellt die Einrichtung des Amts des Patientenfürsprechers dar (wie es in Sachsen gesetzlich vorgeschrieben ist) [25]. Strukturelle Diskriminierung beschreibt die negativen Folgen für psychisch Erkrankte, die aus Ungleichgewichten und Ungerechtigkeiten in sozialen Strukturen, politischen Entscheidungen und gesetzlichen Regelungen resultieren. Selbst bei Abwesenheit konkreter Diskriminierungen auf individueller Ebene können institutionelle Praktiken zum Nachteil psychisch Erkrankter wirken. So sind psychische Krankheiten innerhalb des Gesundheitssystems marginalisiert. Als Folge des Stigmas werden im psychiatrischen Bereich weniger Forschungsmitteln ausgegeben, und die psychiatrische Versorgung ist mit geringeren Ressourcen ausgestattet als Versorgungsangebote für körperliche Erkrankungen [vgl. 38]. Darüber hinaus erleben psychiatrische Patienten Benachteiligungen bei der Kostenübernahme durch die Krankenversicherungen. Besonders schwierig erweist sich die Bewilligung von Versicherungsleistungen für speziell auf psychisch Kranke zugeschnittene Versorgungsangebote wie z. B. Psychosenpsychotherapie oder psychiatrische Pflege im Wohnumfeld. Zusätzlich sehen sich die in Deutschland niedergelassenen Nervenärzte aufgrund der Arzneimittelbudgetierung oft außerstande, die vergleichsweise teuren atypischen Neuroleptika zu verordnen. Als ebenso schwierig erweist sich die Finanzierung von Rehabilitationsmaßnahmen für psychisch Erkrankte durch die Rentenversicherungsträger. Zudem bleiben psychische Erkrankungen bei dem von Reiseversicherungen gewährten Auslandskrankenschutz ausgeschlossen [9]. Ein Abbau struktureller Diskriminierungen erfordert die Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern in Politik und Gesundheitswesen. Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt zum Thema für in der politischen Debatte werden ist eine breite öffentliche Diskussion struktureller Benachteiligungen. Lobbying durch Patienten- und Angehörigenverbände sowie durch die Berufsverbände der Psychiater könnten ein erster Schritt zum Abbau der Ungleichbehandlung psychischer und körperlicher Erkrankungen im Gesundheitssystem sein. Die dritte Form der Diskriminierung geht von den Kranken selbst aus. So wie andere auch haben sie im Zuge ihrer Sozialisation gelernt, was es in unserer Gesellschaft bedeutet psychisch krank zu sein. Sie haben eine Vorstellung davon, auf welches Ausmaß an Ablehnung psychisch Kranke in ihrer Umwelt stoßen. Je mehr sie mit negativen Reaktionen rechnen, umso stärker dürften sie verunsichert sein im Umgang mit anderen und um so ausgeprägter dürfte das Bedürfnis sein, anderen aus dem Weg zu gehen um drohende Diskriminierungen zu vermeiden [35, 37]. Die Konsequenz davon können Mangel an Selbstvertrauen [65] und Demoralisierung [37] sowie soziale Isolierung [4, 37], Arbeitslosigkeit bzw. Einkommenseinbußen [34, 37] und der Verlust an Lebensqualität [53] sein. Dieser Tendenz zur Selbststigmatisierung können alle Strategien entgegenwirken, die dem Empowerment der Kranken dienen. Beispiele sind hier die Psychoedukation, durch die die Kranken lernen, kompetenter mit der Krankheit umzugehen [13, 46]. Oder Diskussionsgruppen für Kranke, in denen diese offen über ihre Erlebnisse in der Psychose sprechen können (sog. „Psychoseseminare“) [11]. Oder kognitiv-verhaltenstherapeutische Programme, die speziell auf die Verbesserung des Stigmacopings abzielen [15]. Vielleicht am wichtigsten sind aber Selbsthilfegruppen, in denen die Kranken sich gegenseitig unterstützen, offensiver ihre Interessen vertreten und das Stigma ihrer Krankheit bekämpfen lernen [24]. 43 Nachwort Die Vielzahl der genannten Interventionsmöglichkeiten sollte uns nicht die Grenzen vergessen lassen, die den Bemühungen um eine Reduzierung der Stigmatisierung schizophrener Kranker gesetzt sind. Es beginnt bei dem Stereotyp der Gefährlichkeit. Es dürfte nicht einfach sein, die oben angesprochenen komplexen epidemiologischen Sachverhalte dem Laienpublikum so zu vermitteln, dass der angestrebte Abbau unnötiger Befürchtungen tatsächlich erreicht wird [16, 48]. Die Einstellung gegenüber psychisch Kranken darf nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist wesentlich mitbestimmt durch individuelle (wie kollektive) Wertorientierungen und politische Überzeugungen, die von uns nicht beeinflusst werden können [7, 8]. Die in den Medien vorherrschenden Gesetzmäßigkeiten und entscheidungsbestimmenden ökonomischen Interessen setzen den Bemühungen um eine adäquatere Beschäftigung mit dem Thema psychische Krankheit enge Grenzen [52]. In Zeiten knapper werdender finanzieller Ressourcen für das Gesundheitswesen stoßen Bemühungen um den Abbau struktureller Diskriminierungen schnell auf Widerstand. Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein um realistische Ziele für Programme zu formulieren, die zur Reduzierung der Stigmatisierung und Diskriminierung schizophrener Kranker führen sollen. Literatur [1] Allen, R., R. G. Nairn: Media depictions of mental illness: an analysis of the use of dangerousness. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 31, 375381 (1997). [2] Angermeyer, M. C.: Das Bild von der Psychiatrie in der Bevölkerung. Psychiatrische Praxis 27, 327-329 (2000). 44 Angermeyer und Schulze [3] Angermeyer, M.C.: Schizophrenia and violence. Acta Psychiatrica Scandinavica (im Druck). [4] Angermeyer, M. C., R. Lammers, J. Hoffmann: Sozialer Rückzug: Reaktion auf das Stigma psychischer Krankheit? Medizin Mensch Gesellschaft 10, 132136 (1985). [5] [6] Angermeyer, M. C., H. Matschinger: Violent attacks on public figures by persons suffering from psychiatric disorders. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 245, 159164 (1995). Angermeyer, M. C., H. Matschinger: The effect of personal experience with mental illness on the attitude towards individuals suffering from mental disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 31, 321-326 (1996). Narrenschiff im Psychiatrie-Verlag, Bonn 2000. of people with mental illness. British Journal of Psychiatry 177, 4-7 (2000). [17] Crocker, J., B. Major, C. Steele: Social stigma. In: Gilbert, D. T., S. T. Fiske et al. (eds.): The handbook of social psychology. McGraw-Hill, Boston, M.A 1998. [18] Eronen, M., M. C. Angermeyer, B. Schulze: The psychiatric epidemiology of violent behaviour. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 33, S13S23 (1998). [19] Estroff, S. E.: Self, identity and subjective experiences of schizophrenia: in search of the subject. Schizophrenia Bulletin 15, 189-196 (1989). [20] Farina, A., R. D. Felner: Employment interviewer reactions to former mental patients. Journal of Abnormal Psychology 82, 268-272 (1973). [32] Holzinger, A., M.C. Angermeyer, H. Matschinger: "Was fällt Ihnen zum Wort Schizophrenie ein?” Eine Untersuchung zur sozialen Repräsentation der Schizophrenie. Psychiatrische Praxis 25, 9-13 (1998). [33] Hyler, S. E., G. O. Gabbard, I. Schneider: Homicidal maniacs and narcissistic parasites: Stigmatization of mentally ill persons in the movies. Hospital and Community Psychiatry 10, 1044-1048 (1991). [34] Link, B. G.: Mental patient status, work, and income: An examination of the effects of a psychiatric label. American Sociological Review 47, 202-215 (1982). [21] Angermeyer, M. C., H. Matschinger: Social distance towards the mentally ill: results of representative surveys in the Federal Republic of Germany. Psychological Medicine 27, 131-141 (1997). Farina, A., R. D. Felner, L. A. Bourdreau: Reactions of workers to male and female mental patient job applicants. Journal of Consulting and Clinical Psychology 41, 363-327 (1973). [35] [7] Link, B. G.: Understanding labeling effects in the area of mental disorders: An assessment of the effects of expectations of rejection. American Sociological Review 52, 96-112 (1987). [22] Angermeyer, M. C., H. Matschinger: Right-wing extremism and attitude towards people with mental illness. International Journal of Social Psychiatry (in press). Farina, A., J. D. Fisher, H. Getter: Some consequences of changing people’s views regarding the nature of mental illness. Journal of Abnormal Psychology 2, 272-279 (1978). [36] [8] Link, B. G., F. T. Cullen: Contact with the mentally ill and perceptions of how dangerous they are. Journal of Health and Social Behaviour 27, 289-303 (1986). [37] [23] Fisher, J. D., A. Farina: Consequences of beliefs about the nature of mental disorders. Journal of Abnormal Psychology 3, 320-327 (1979). [24] Fontaine, N., E. Allard: Advocacy in the mental health services field. Epidemiologia e Psichiatria Sociale 6, 29-39 (1997). Link, B. G., F. T. Cullen, E. L. Struening, P. Shrout, B. P. Dohrenwend: A modified labeling theory approach in the area of mental disorders: An empirical assessment. American Sociological Review 54, 100-123 (1989). [38] Link, B. G., J. C. Phelan: Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology 27, 363-385 (2001). [39] Link, B. G., J. C. Phelan, M. Bresnahan, A. Stueve, B. A. Pescosolido: Public conceptions of mental illness: Labels, causes, dangerousness, and social distance. American Journal of Public Health 9, 1328-1333 (1999). [40] Link, B. G., E. L. Struening, M. Rahav, J. C. Phelan, L. Nuttbrock: On stigma and its consequences: Evidence from a longitudinal study of men with dual diagnosis of mental illness and substance abuse. Journal of Health and Social Behavior 38, 177-190 (1997). [41] Martin, J. K., B. A. Pescosolido, S. A. Tuch: Of fear and loathing: The role of ‘disturbing behavior’, labels, and causal attributions in shaping public attitudes toward people with mental illness. Journal of Health and Social Behavior 41, 208-223 (2000). [9] [10] Angermeyer, M. C., B. Schulze: Lo stigma dal punto di vista di chi soffre di schizophrenia e delle loro famiglie. I risultati di un gruppo di studio in Germania. In: Asioli, F., M. Bassi (eds.): Lotta allo stigma. Editrice Compositori, Bologna 2000. Angermeyer, M.C., B. Schulze: Reinforcing stereotypes: The focus on forensic cases in news reporting and its influence on public attitudes towards the mentally ill. International Journal of Law and Psychiatry (in press). [11] Bock, T., D. Buck, I. Esterer: "Es ist normal, verschieden zu sein”. PsychiatrieVerlag, Bonn 2000. [12] Barnes, R. C., S. Earnshaw: Mental illness in British newspapers. Psychiatric Bulletin 17, 673-674 (1993). [13] Brenner, H. D., B. Hodel, V. Roder, P. Corrigan: Treatment of cognitive dysfunctions and behavioural deficits in schizophrenia: Integrated psychological therapy. Schizophrenia Bulletin 18, 2126 (1992). [14] Brockington, I. F., P. Hall, J. Levings, C. Murphy: The community’s tolerance of the mentally ill. British Journal of Psychiatry 162, 93-99 (1993). [15] Corrigan, P. W.: The impact of stigma on severe mental illness. Cognitive and Behavioural Practice 5, 201-222 (1998). [16] Crisp, A. H., M. G. Gelder, S. Rix, H. I. Meltzer, O. J. Rowlands: Stigmatisation [25] Geisler, H.: Psychiatrische Versorgung im Freistaat Sachsen. Psychiatrische Praxis 27, S77-S82 (2000). [26] Goffman, E.: Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ 1963. [27] Grausgruber, A.: Attitudes of the general population concerning schizophrenia. Paper presented at 10th Congress of the Association of European Psychiatrists, Prague 2000. [28] Hall, P., I. F. Brockington, J. Levings, C. Murphy: A comparison of responses to the mentally ill in two communities. British Journal of Psychiatry 162, 99108 (1993). [29] Hayward, P., J. A. Bright: Stigma and mental illness: A review and critique. Journal of Mental Health 6, 345-354 (1997). [30] Hazelton, M.: Reporting mental health: a discourse analysis of mental healthrelated news in two Australian newspapers. Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing 6, 73-89 (1997). [42] Mechanic, D., D. McAlpine, S. Rosenfield, D. Davis: Effects of illness attribution and depression on the quality of life among persons with serious mental illness. Social Science and Medicine 2, 155-164 (1994). [31] Hoffmann-Richter, U.: Psychiatrie in der Zeitung. Urteile und Vorurteile. Das [43] Meise, U., H. Sulzenbacher, G. Kemmler, R. Schmid, W. Rössler, V. Günther: Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Überlegungen "... nicht gefährlich, aber doch furchterregend”. Ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophrenie in Schulen. Psychiatrische Praxis 27, 340-346 (2000). [51] Philo, G. (ed.): Media and mental distress. Longman, London 1996. [52] Philo, G.: Changing media representations of mental health. Psychiatric Bulletin 21, 171-172 (1997). [44] Ng, S. L., J. L. Martin, S. E. Romans: A community’s attitude towards the mentally ill. New Zealand Medical Journal 108, 505-508 (1995). [53] [45] Page, S.: Psychiatric stigma: Two studies of behaviour when the chips are down. Canadian Journal of Community Mental Health 1, 13-19 (1983). Rosenfield, S.: Labeling mental illness: The effects of received services and perceived stigma on life satisfaction. American Sociological Review 62, 660-672 (1997). [54] Pekkala, E., L. Merinder: Psychoeducation for schizophrenia (Cochrane Review). Cochrane Database Systems Review 4: CD002831 (2000). [55] Sartorius, N.: Stigma: what psychiatrists can do about it? Lancet, Sep 26, 325 (9133), 1058-59 (1998). [56] Scott, J.: What the papers say. Psychiatric Bulletin 18, 489-491 (1994). [57] Signorelli, N.: The stigma of mental illness on television. Journal of Broadcasting and Electronic Media 33, 325-331 (1989). [58] Shain, R. E., J. Phillips: The stigma of mental illness: labelling and stereotyping in the news. In: Wilkins, L., P. Patterson (ed.): Risky business: communicating issues of science, risk and public policy pp. Greenwood press, Westport, C. T 1991. [59] Socall, D. W., T. Holtgraves: Attitudes toward the mentally ill: The effect of label and beliefs. The Sociological Quarterly 3, 435-445 (1992). [46] [47] [48] [49] [50] Penn, D. L., K. Guynan, T. Daily, W. D. Spaulding, C. P. Garbin, M. Sullivan: Dispelling the stigma of schizophrenia: What sort of information is best? Schizophrenia Bulletin 20, 567-578 (1994). Penn, D. L., S. Kommana, M. Mansfield, B. G. Link: Dispelling the stigma of schizophrenia: II. The impact of information on dangerousness. Schizophrenia Bulletin 25, 437-446 (1999). Pescosolido, B. A., J. Monahan, B. G. Link, A. Stueve, S. Kikuzawa: The public’s view of the competence, dangerousness, and need for legal coercion of persons with mental health problems. American Journal of Public Health 89, 1339-1345 (1999). Philo, G.: The impact of the mass media on public images of mental illness: media content and audience belief. Health Education Journal 53, 271-281 (1994). [60] Rothaus, P., P. G. Hanson, S. E. Cleveland, D. L. Johnson: Describing psychiatric hospitalization: A dilemma. American Psychologist 18, 85-89 (1963). Trute, B., A. Loewen: Public attitude toward the mentally ill as a function of prior personal experience. Social Psychiatry 13, 79-84 (1978). 45 [61] Trute, B. et al.: Social rejection of the mentally ill: a replication study of public attitude. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 24, 69-76 (1989). [62] Wahl, O. F.: Mental health consumers’ experience of stigma. Schizophrenia Bulletin 3, 467-478 (1999). [63] Whaley, A. L.: Ethnic and racial differences in perception of dangerousness of persons with mental illness. Psychiatric Services 48, 1328-1997 (1997). [64] Wilson, C., R. Nairn, J. Coverdale, A. Panapa: Mental illness depictions in prime-time drama: identifying the discursive resources. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 33, 232-239 (1999). [65] Wright, E. R., W. P. Gonfreins, T. J. Owens: Deinstitutionalization, social rejection, and the self-esteem of former mental patients. Journal of Health and Social Behavior 41, 68-90 (2000). Univ.-Prof. Dr. Matthias C. Angermeyer Klinik und Poliklinik für Psychiatrie Universität Leipzig Johannisallee 20 D-04317 Leipzig [email protected] 47 Rezension Ulrike Hoffman-Richter: Psychiatrie in der Zeitung. Urteile und Vorurteile. Edition Das Narrenschiff, Psychiatrie-Verlag, Bonn 2000. ISBN 3-88414-295-X Studien zeigen, dass Menschen mit psychischen Problemen häufig abgelehnt werden, dass das Wissen über psychische Erkrankungen gering und oft verzerrt ist, dass die Psychiatrie – im Gegensatz zu anderen medizinischen Disziplinen – insgesamt kein besonders gutes Image hat. Es ist auch bekannt, dass die Bevölkerung ihr Wissen über die Psychiatrie und über Menschen mit psychischen Erkrankungen fast ausschließlich aus den Massenmedien bezieht. Doch: Wie stellen die Medien den Bereich Psychiatrie – psychische Erkrankungen dar? Was steht in den Zeitungen über psychisch kranke Menschen? Welches Bild wird hier gezeichnet? Ulrike Hoffman-Richter hat sich in ihrem Buch dieser zentralen Fragestellung angenommen und damit Neuland betreten. Sie hat sechs deutschsprachige renommierte Tages- bzw. Wochenzeitung aus dem Jahr 1995 dahingehend untersucht, was in diesen Medien so alles über die Psychiatrie steht, wie über psychisch Kranke berichtet wird, was über psychische Erkrankungen und über Therapieverfahren zu lesen ist, in welche Kontexte diese Berichte eingebettet sind und worin sie sich unterscheiden. Die Inhalte der sechs Zeitschriften und Zeitungen sind auf CD-ROM erhältlich und die Inhalte sind so einer tiefgreifenden quantitativen wie qualitativen Volltextanalyse zugänglich. Dadurch wurde es möglich, nicht nur jene Artikel zu untersuchen, die sich speziell mit dem Thema Psychiatrie befassen, sondern auch jene Texte zu analysieren, die psychiatrische Ausdrücke und Begriffe verwenden. Und siehe da, in diesem breiten Kontext tauchen psychiatriespezifische Termini plötzlich in allen Teilen der Zeitschriften und Zeitungen auf: In Gerichtsberichten, auf der Wissenschaftsseite, im Literatur- bzw. Feuilletonteil, im Wirtschaftsteil ebenso wie bei Veranstaltungshinweisen. Ist die Psychiatrie alltagstauglich geworden? Sind psychiatrische Begriffe in den Alltags- sprachgebrauch eingezogen? Wissen nun die Leserinnen und Leser bescheid? Die weitergehenden Analysen von Hoffman-Richter zeigen jedoch bald ein sehr ernüchterndes Bild: Viele Begriffe werden in völlig sach- und fachfremden Kontexten verwendet und führen so zu weitreichenden Bedeutungsveränderungen im sprachlichen Alltag. Psychiatrische Fachbegriffe werden vielfach als Metapher verwendet und – was noch schwerwiegender ist – mit einer negativen Bedeutung versehen. Psychiatrische Themen werden im Kontext gesellschaftlicher Probleme angesiedelt: Im Umfeld von Gewalttaten, sexuellem Mißbrauch, unerträglichen Familiensituation etc. „Die auffallend häufig verwendeten psychiatrischen Begriffe meinen ... nicht mehr das Ursprüngliche. Sie haben außerhalb des Fachgebietes eine Bedeutungsänderung durchgemacht.“ fasst die Autorin zusammen (S. 376). Nicht zuletzt dadurch kommt es zu einer ungewöhnlichen Verdichtung und Vereinfachung der Vorstellungen über Psychiatrie und psychische Erkrankungen. „Psychiatrie ...“ – so fährt die Autorin fort – „ (ist) in den Printmedien kein medizinisches Fachgebiet, sondern verfeinertes Alltagswissen“ (S. 379). Das vermittelte Bild ist simpel: Wer den Alltag nicht mehr bewältigen kann, muß in eine psychiatrische Klinik. Aber: Medikamente alleine können auch nicht wirklich helfen. Das weiß heutzutage jeder, daher gibt es auch kein besonderes Bedürfnis nach mehr Information. So schließt sich der Teufelskreis werden manche resigniert feststellen. „Die Arbeit ist sehr umfangreich“ meint die Autorin im Vorwort. Mit fast 400 Seiten ist es auch ein ansehnliches Werk geworden. Doch Fragestellung und Breite der Untersuchung erfordern dies. In vier Teilen werden schwerpunktmäßig die Befunde dargestellt: Psychiatrie und Psychotherapie in der Zeitung; Schizophrenie in der Zeitung; Psychopharmaka und Elektrokrampftherapie; Medizin in der Zeitung. In einem vorangestellten Teil werden Fragestellung und Vorgehensweise, der theoretische Hintergrund sowie themenrelevante Forschungsarbeiten kurz vorgestellt. Im abschließenden Teil wird eine vergleichende Darstellung von Medizin und Psychiatrie vorgenommen. Die daran angeschlossene Diskussion faßt die zentralen Ergebnisse der „Psychiatrie in der Zeitung“ nochmals pointiert zusammen. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis ergänzt die Berichtlegung. Zahlreiche Tabellen und Beispiele aus den Textanalysen, kurze Einführungen am Beginn und eine zusammenfassende Diskussion jeweils am Ende jedes Kapitels vermitteln nicht nur Einund Überblicke, sie helfen auch beim Durchblick dieser umfangreichen und schwierigen Materie. Nicht zuletzt durch die Lektüre des Werkes werden aber zahlreiche Fragen auftauchen: Wie wirkt sich diese Art der Berichterstattung bei den Leserinnen und Lesern aus? Was bewirken diese Darstellung tatsächlich? Welchen Einfluß hat die Lektüre der geschilderten Artikel auf die Urteile und Vorurteile über Psychiatrie und psychisch Kranke? Wie kann eine Änderung der Berichterstattung über Psychiatrie erreicht werden? Was kann zur „Entstigmatisierung“ psychisch kranker Menschen unternommen werden? Darauf gibt das Buch keine Antworten, und kann es im Untersuchungskontext auch nicht. Aber es regt zu wichtigen Überlegungen und Fragen an – und dies ist ein besonderer Verdienst. Deshalb ist auch die Einschätzung von Asmus Finzen im Geleitwort zu unterstreichen. „Aus diesem Grunde ist das Buch ein Meilenstein auf dem Wege zur Erforschung der komplexen Beziehung zwischen der Psychiatrie und Öffentlichkeit und dem Bild der Gesellschaft von psychisch Kranken und psychischer Krankheit“. Dr. Alfred Grausgruber, Linz ÜBERSICHT Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 48 – 53 Schizophrenie hat viele Gesichter Die österreichische Kampagne zur Reduktion des Stigmas und der Diskriminierung wegen Schizophrenie Werner Schöny Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Österreichische Schizophreniegesellschaft, pro mente austria Schlüsselwörter Stigma – psychische Erkrankung – Schizophrenie – Diskriminierung Key words stigma – mental disease – schizophrenia – discrimination Schizophrenie hat viele Gesichter: Die österreichische Kampagne zur Reduktion des Stigmas und der Diskriminierung wegen Schizophrenie Die Vorurteile gegenüber allem, was mit psychischer Krankheit zu tun hat und das damit verbundene Stigma sind eine der wesentlichen Barrieren für die Integration psychisch kranker Menschen sowie die rechtzeitige Inanspruchnahme von Therapie und Hilfe. Die Welt- psychiatrieorganisation (WPA) hat zu diesem Zweck eine weltweite Kampagne initiiert, der sich Österreich sehr früh angeschlossen hat. Es werden im Rahmen dieser Kampagne eine Reihe von Maßnahmen gesetzt, die der Allgemeinheit und auch gezielte Meinungsbilder in der Bevölkerung für die Problematik psychisch Kranker und vor allem an Schizophrenie Erkrankter sensibilisieren sollen. Das Ziel dieser Kampagne ist Aufklärung, Information, Reduzierung von Stigma, Hilfe für Betroffene und Angehörige sowie Erleichterung der Reintegration von Betroffenen. Eine Reihe von Broschüren wurden erarbeitet, um über die Kampagne, über Schizophrenie und über die allgemeinen Vorurteile zu informieren. Weiters werden allgemeine Sets für Information und Vorträge erarbeitet sowie gezielte Medienarbeit über Fernsehspots, Pressekonferenzen und persönlichen Austausch eingeleitet. Die ersten Ergebnisse geben Zeugnis über die Intensität dieser Maßnahmen und die weite Verbreitung der Ergebnisse. Schizophrenie has many faces: The Austrian Campaign to Reduce Stigma and Discrimination because of Schizophrenia The prejudice against everything concerning mental disease and the connected stigma is a main barrier for integration of mentally ill people. They also prevent the search for therapy and help in right time. The World Association for Psychiatry (WPA) has iniciated a world wide campaign in which Austria was integrated very early. In the frame of this campaign special acts of information for the general population, for opinion-leaders as well as for users and relatives. The aim of this campaign is to inform, clarificate, reduce stigma and discrimination and to help users and relatives. Several brochures were produced informing about the campaign, about schizophrenia and its myth. It includes sets for information and a lot of talks. For targeted work with media we had a spot on TV, several press conferences and very much personal information. The first results lead us to an optimistic opinion concerning the performance of this campaign. Einleitung Eine der wesentlichen Barrieren für die Eingliederung und Rehabilita- tionsmaßnahmen psychisch kranker Menschen – insbesondere an Schizophrenie erkrankter Menschen – ist das Stigma, dh die negativen Vorurteile, die diesem Personenkreis entgegengebracht werden. Dementsprechend beschäftigt sich die Wissenschaft seit langem mit Hintergründen und Ausmaß dieser negativen Einstellungen und vor allem auch mit Maßnahmen, um diese zu verändern. Das negative soziale Stigma trägt nämlich wesentlich zum unglücklichen Lebensschicksal vieler an Schizophrenie leidenden Menschen und zur seelischen Belastung für ihre Angehörigen und Helfer bei. Die Folgen von Stigma sind: • falsche Darstellungen in den Medien (Film, Zeitung) • negative Auswirkungen auf Betroffene: – Verzögerung der Behandlung, – Einfluss auf Krankheitsverlauf – Beeinträchtigung des Selbstwerts – Soziale Isolation • negative Auswirkungen auf Angehörige • Ressourcenmangel für die Entwicklung von Einrichtungen im Bereich der Psychiatrie (Behandlung, Selbsthilfe, Rehabilitation) Konkret heißt das, Diskriminierung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche, verspätetes und unzureichendes Einsetzen der Behandlung, mangelndes Wissen über Maßnahmen 49 Schöny innerhalb der Bevölkerung, vor allem auch der Gesundheitsberufe, was in Form eines Circulus Vitiosus oben genannte Diskriminierungsfolgen verstärkt. Die Vorurteile entstehen durch Unwissenheit und durch soziale Akzeptanz von falschen Bildern. Gängige Vorurteile und Missverständnisse: • unberechenbar und gefährlich • unheilbar krank • von „Persönlichkeitsspaltung betroffen“ • unzuverlässig und träge • faul und arbeitsscheu Häufig werden noch die Eltern schizophrener Menschen beschuldigt, für die Krankheit verantwortlich zu sein. Einer der wesentlichen Gründe für diese negativen Vorurteile und Einstellungen ist mangelnde Information und Aufklärung. Es ist daher eine Forderung vieler maßgebender in der Psychiatrie Tätigen, gegen das Stigma und seine Folgen anzukämpfen. Die WPA (World Psychiatric Association) hat eine große internationale Kampagne ins Leben gerufen, die sich zum Ziel gesetzt hat, dem Stigma und seinen Folgen entgegenzuwirken. Österreich war eines der ersten Länder, die sich dieser Kampagne angeschlossen haben, wobei es das erste Land ist, bei dem die Kampagne im gesamten Bundesgebiet durchgeführt wird. Aus organisatorischen und auch ökonomischen Gründen beschränkt sie sich meist nur auf definierte Regionen eines Landes. Die WPA hat ein ausführliches Grundlagenpapier über den aktuellen Stand wissenschaftlichen Wissens zum Thema Schizophrenie in zahlreichen Arbeitsgruppen erarbeitet, weiters wird eine Vorgangsweise vorgeschlagen, der man sich zwar dem Grunde nach anschließen sollte, die aber viel Freiheit in der individuellen Ausgestaltung des Programmes überlässt. Das Programm ist kumulativ aufgebaut und ergibt den jeweiligen Staaten die Möglichkeit, auf den Erfahrungen anderer aufzubauen. Die daran beteiligten Länder stehen in einem regelmäßigen Austausch, um so möglichst rasch und direkt an den Erfahrungen anderer zu partizipieren. In Österreich hat es bereits im Vorfeld zahlreiche regionale Aktivitäten zur Entstigmatisierung bzw Beeinflussung der öffentlichen Meinung gegeben. Dies war auch der Grund, warum der Entschluss zur Teilnahme am weltweiten Programm rasch gefällt werden konnte und auch von den Gremien der WPA akzeptiert wurde. Es wurde folgendes Programm durchgeführt: Das Ziel war, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, als Leitspruch wurde folgender gewählt: Jeder 5. Österreicher ist psychisch krank – pro mente für psychische und soziale Gesundheit (HELFEN STATT AUSGRENZEN) Vorprogramm-Aktivitäten In zahlreichen Bundesländern wurden Aktionen durchgeführt, wie Filmwochen, Schul- informationsprogramme, allgemeine Informationsveranstaltungen (zB Tag der offenen Tür, Schwerpunktinformationsprogramme) und Ähnliches. Hier soll kurz ein Programm beschrieben werden, welches in Oberösterreich durchgeführt wurde und den Zweck hat, den Hauptträger von psychosozialer außerstationärer Arbeit pro mente Oberösterreich bekannt zu machen, um den betroffenen Personen den Zugang zu erleichtern und allgemeine Informationen über psychische Erkrankungen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Es wurde einleitend bei einer Bevölkerungsumfrage der Bekanntheitsgrad von pro mente Oberösterreich in verschiedenen Bevölkerungsschichten abgefragt. Dabei stellte sich heraus, dass der Name einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, jedoch die Zuordnung zur psychosozialen Arbeit und zur speziellen Tätigkeit nur in einem sehr geringen Ausmaß bekannt war. Besonders bei jüngeren Personen war ein umfangreicher Informationsbedarf gegeben. Die genaueren Daten werden in (späteren) Tabellen dargelegt. Um diese Botschaft zu verbreiten, wurden folgende Maßnahmen ergriffen: • Plakataktion • Werbespot im Kino • Medienarbeit • Schulprogramm • Filmwochen Plakat Das Programm sollte das Bundesland Oberösterreich erfassen. Es wurden 600 Plakate oberösterreichweit affichiert, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. Selbstverständlich wurden beide Geschlechter berücksichtigt. Der Impact des Plakats wurde gemessen und ist in der folgende Tabelle (siehe nächste Seite) zu sehen: Es zeigt sich, dass sowohl der spontane Recall, wie auch die gestützte Plakaterinnerung einen relativ sehr hohen Wert aufwiesen. Immerhin musste man gegen sehr bekannte Marken, die langjährige Werbedurchschlagskraft aufweisen, bestehen und konnte dabei sehr ehrenvoll abschneiden. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Plakat 50 Schizophrenie hat viele Gesichter Eindruck vom Spot Frage 7,13,19: Sagen Sie mir anhand dieser Liste, welchen Eindruck Sie von dieser Werbung haben. Nennen Sie mir die entsprechenden Punkte: Medienarbeit anlässlich der Regional- wahlen in Oberösterreich in der bekanntesten Tageszeitung in einer Wahlwerbekarrikatur Eingang fand, die einen besonderen Hinweis auf die Durchdringung dieses Plakats ergab. Frage 9: Können Sie sich an einen Werbefilm für psychisch Kranke erinnern? Frage 15: Können Sie sich an einen Werbefilm für pro mente erinnern? Es wurden gezielt eine Reihe von Pressekonferenzen durchgeführt und eine vierseitige Sonderbeilage in den Oberösterreichischen Nachrichten, der wichtigsten und größten Regionalzeitung Oberösterreichs, platziert. In diesem 4-Seiter wurde intensiv auf die Belange psychisch Kranker eingegangen, wobei auch die wichtigsten Politiker zu Wort kamen. Filmerinnerung mit Hauptstichwort „Schwarz-Weiß-Film mit einzelnen Gesichtern von Menschen“ Zusätzlichem Stichwort „Psychisch Kranke“ Zusätzlichem Stichwort „pro mente“ keine Erinnerung Kinobesucher insgesamt % 60 29 3 8 100 Filmspot Der Filmspot wurde vorwiegend in Kinocenter gezeigt, die junge Menschen ansprechen. In der ebenfalls von der Firma Spectra durchgeführten Erhebung zur Erinnerung des Filmspots ergaben sich folgende Ergebnisse. Erinnerung an den Spot (gestützt) Frage 3: Unter den Werbefilmen war ein Spot in Schwarz-Weiß, wo hintereinander einzelne Gesichter von Menschen gezeigt wurden. Können Sie sich an diesen Werbefilm erinnern? Es meinen, der Spot – Spricht Gefühle an Macht betroffen Regt an zum Hinschauen Glaubwürdig Originell Spricht mich an Informativ Nette Idee Modern Sagt mir was Etwas übertrieben Sympatisch Dynamisch Spoterinnerer (n=92) % 43 40 31 21 16 16 15 14 14 10 8 7 5 240 51 Schöny Schulaktion In einer gezielten Aktion wurde gemeinsam mit dem Landesschulrat für Oberösterreich an allen höheren Schulen die Einladung ausgegeben, entweder in der Schule vortragsmäßig über psychische Krankheiten zu sprechen oder Exkursionen in psychiatrischen Krankenabteilungen bzw in externen psychosozialen Einrichtungen durchzuführen oder Workshops abzuhalten. Innerhalb der Aktion, die ein halbes Jahr dauerte, wurde mit über 100 Schulklassen Kontakt aufgenommen, um so zahlreiche Schüler, Lehrer und Angehörige zu erreichen. Diese Aktionen wurden ein halbes Jahr schwerpunktmäßig durchgeführt, soweit es möglich war auch länger. Dies betrifft besonders Schulaktivitäten sowie Informationsveranstaltungen. Nach zwei Jahren wurde mittels Meinungsumfrage der Bekanntheitsgrad von pro mente Oberösterreich erneut abgefragt. Es zeigt sich, dass sich der Bekanntheitsgrad von pro mente Oberösterreich mehr als verdoppelt hat. Waren es 1996 21 %, gaben 1999 47 % an, pro mente Oberösterreich zu kennen. Waren es 1996 5 %, so waren es 1999 28 %, die auch über den Tätigkeitsbereich von pro mente Oberösterreich Bescheid wussten. Das Imageprofil wurde klar und eindeutig und es war möglich, es auf einer inhaltlichen und themenorientierten Ebene aufzubauen. Inhaltlich gesehen konnte auch nachgewiesen werden, dass das zugeordnete Tätigkeitsprofil die Kernkompetenzen von pro mente Oberösterreich vermittelt. Besonders bedeutsam scheint zu sein, dass diese Aktivität zu einer Diskussion im Umfeld der Schüler geführt hat und damit einen wesentlichen Informationseffekt aufzuweisen schien. Filmwochen Es wurden in Linz – aber auch in Bezirkshauptstädten Oberösterreichs – Filme, die sich mit der Problematik psychisch Kranker beschäftigten, gezeigt; anschließend fanden Diskussionen mit den Besuchern statt. Die Österreich-Kampagne Die österreichische „Anti-StigmaKampagne“ betreffend Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind. Das österreichische Programm wird in enger Kooperation mit dem Programm der World Psychiatric Association (WPA) durchgeführt. Veranstalter sind die Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (ÖGPP), die Österreichische Schizophreniegesellschaft (ÖSG) und die pro mente austria (pma). Damit ist Gewähr leistet, dass eine große repräsentative Gruppe von in psychosozialen Bereich Tätigen, Angehörigen und auch Betroffenen involviert ist. Ein österreichweites Steering-Committee hat die wesentlichen Grundlagen erarbeitet. Als Ausgangslage wurde eine Studie durchgeführt (Grausgruber, Katschnig, Meise, Schöny), in welcher das aktuelle Bild der Einstellung zur Schizophrenie in der Allgemeinbevölkerung, Allgemeinärzten, allgemein und psychiatrisches Pflegepersonal, Sozialarbeitern und Journalisten sowie Angehörigen abgefragt wurde. Die Ergebnisse dieser Studie dienten auch als Entscheidungsgrundlage für Aktivitäten. Im Zentrum der Aktivitäten steht eine Kampagne. Diese beinhaltet: • • • • Anhand dieser Daten und den umfangreichen Aktivitäten konnte also innerhalb von zwei Jahren eine deutliche Veränderung des Informationsstandes der Allgemeinbevölkerung erreicht werden und das Aufgabengebiet der psychosozialen Einrichtungen bekannt gemacht werden, womit auch das Image der Betroffenen und der Zugang zur Hilfsmaßnahme wesentlich erleichtert werden konnte. Medienarbeit einzelne Projekte Meinungsforschung regionale Aktivitäten Elemente der Kampagne: • • • TV-Spot und Infoline 0810/333 222 bundesweite und regionale Aktivitäten Öffentlichkeitsarbeit Die Kampagne hat folgende Ziele: • Aufklärung • Information 52 Schizophrenie hat viele Gesichter • • • Reduzierung von Stigma Hilfe für Betroffene und Angehörige Reintegration von Betroffenen Unter anderem soll sie durch folgende Strategien umgesetzt werden: • Forcieren von Behandlungsmethoden • Initiieren von Aufklärungsaktivitäten auf lokaler Ebene • Miteinbeziehung antistigmatisierender Aufklärung in die Ausbildung von Lehrern und Gesundheitsdiensten • Miteinbeziehen von Patienten und Angehörigen in die Identifikation diskriminierender Verhaltensweisen Es wurden eine Reihe von Unterlagen erarbeitet: • Informationsbroschüre für allgemein Interessierte, Betroffene, Angehörige • Kampagnenfolder für Mitarbeiter, Aktivisten und Multiplikatoren • Folien für Vorträge • Basis-Pressemappe für Medienaktivitäten • Mythenbroschüre (Darstellung der wichtigsten Vorurteile gegenüber Schizophrenie und deren Korrektur) Das Corporate-Design der Unterlagen ist einheitlich, in der Folge werden einige Beispiele dargestellt. In einem Newsletter werden die Aktivitäten, die in den einzelnen Regionen gesetzt werden, auch allen anderen „Mitstreitern“ näher gebracht. Besonders wichtig ist, dass in dieses Programm Angehörige und Betroffene sowohl in der Planung als auch in der Durchführung umfassend eingebunden sind. Das Motto der Kampagne lautet: „Schizophrenie hat viele Gesichter – wir können etwas dagegen tun“. Verteilung der Info-Materialien: Regionale Aktivitäten Pressearbeit: Start – Pressekonferenz am 17.08.2000 mit einer Reihe von Presseaussendungen Berichte in Print-Medien: Damit sind alle wesentlichen österreichischen Print-Medien erreicht worden. Auch in den Fachmedien gab es eine sehr breite Vertretung mit ausführlichen Artikeln über Schizophrenie, Stigma, Diagnostik und Behandlungsweise. Berichte in elektronischen Medien Der Fernsehspot wurde zu PrimeTime-Zeiten in 32 Schaltungen gesendet. Der Spot wurde mit zwei Auszeichnungen bedacht: Senator 2000 für die außergewöhnliche Einzelleistung auf dem Gebiet der Werbung und Marktkommunikation in Oberösterreich Saturn 2000 in Bronze, Kategorie „Kino/TV-Spot“, für die Produktion „Sprachlosigkeit/Anrufbeantworter“. In allen Bundesländern wurden in unterschiedlichen Ausprägungen eine Reihe von Aktivitäten gesetzt, aus Platzgründen können diese nicht alle angeführt werden. Es handelt sich um Rundfunk und Print-MedienAktionen, um Schulaktionen, um Vortrags- und Diskussionsreihen. Auch wurden Seminare und Workshops mit verschiedensten Berufsgruppen, wie Exekutive, Lehrern, Ärzten, in Gesundheitsberufen tätigen Personen abgehalten. Anfang Jänner 2001 wurde als erstes Zwischenergebnis bei einer Meinungsumfrage des Fessel-Institutes die Sichtbarkeit der Aktivitäten abgefragt. Dabei ergaben sich folgende Ergebnisse: Frage 1: Ist Ihnen aufgefallen, dass in den vergangenen Monaten in der Öffentlichkeit verstärkt vom Thema Schizophrenie und von der Diskriminierung Betroffener die Rede war? Frage 2: In welcher Form haben Sie dieses Thema wahrgenommen? Frage 3: Ist Ihnen der Fernsehspot „Schizophrenie hat viele Gesichter“ aufgefallen, der im August/Septem- zu Frage 1: ja nein weiß nicht 18 % 82 % 0% männlich weiblich 15 % 85 % 0% 21 % 79 % 0% zu Frage 2: Thema ist aufgefallen 178 Fernsehspot Medienberichte anderes weiß nicht/keine Angabe männlich 40 % 58 % 14 % 2% 44 % 47 % 12 % 2% weiblich 37 % 65 % 16 % 2% 53 Schöny ber 2000 im Österreichischen Fernsehen zu sehen war? Total Ja Nein 1000 14 86 Wie Medienexperten berichten, ist dieses Ergebnis äußerst positiv zu werten, mit den eingesetzten Mitteln ist die Erreichbarkeit von 18 % der Bevölkerung als sehr hoch anzusehen. Dies ist umso bemerkenswerter, als die Abfrage drei Monate nach der Sendung des Fernsehspots durchgeführt wurde. Vorausschau Die österreichweite Antistigmakampagne soll jetzt noch im Jahr 2001 als Kampagne weitergeführt werden. Welche Aktivitäten gesetzt werden können, hängt von der Dotierung ab. In jedem Fall ist vorgesehen, die Schulaktion auf eine noch breitere Basis zu stellen. Ein weiteres Projekt umfasst die legistischen Benachteiligungen für Personen mit psychischen Erkrankungen. Dieses Projekt ist derzeit beim "Fonds Gesundes Österreich" eingereicht. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr soll die Auseinandersetzung mit gezielten Personengruppen, vor allem in den pädagogischen Berufen sowie im Exekutivebereich, sein. Wie weit es möglich sein wird, noch eine generelle Kampagne zum Wecken der Aufmerksamkeit über elektronische Medien – wie zweiter Fernsehspot oder Hörfunk – durchzuführen, ist zum jetzigen Zeitpunkt aus finanziellen Gründen noch nicht klar. Wenn die Kampagne als solche abgeschlossen ist, muss allerdings Öffentlichkeitsarbeit und Antistigmaarbeit weitergeführt werden. Eine Kampagne dient ja letztlich zum Wecken der Aufmerksamkeit und zum Bewusstseinmachen eines Problems, die Veränderung der Einstellung der Bevölkerung bzw der Abbau von Vorurteilen kann nur langfristig bewältigt werden. Die Kooperation aller am Thema beteiligten Personengruppen – wie Professionisten, Betroffene, Angehörige – ist notwendig, um die Öffentlichkeit und Allgemeinheit zu informieren und zu mobilisieren. legungen. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 3945 (2002). [2] Grausgruber A., H. Katschnig, U. Meise, W. Schöny: Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie. Neuropsychiatrie Neuropsychiatrie 16, 1/2: 54-67 (2002). [3] Meise U, A. Grausgruber, H. Katschnig, W. Schöny: Das Image der Psychopharmaka in der Österreichischen Bevölkerung. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 68-77 (2002). [4] Meise U., H. Sulzenbacher, G. Kemmler, R. Schmid, W. Rössler, V. Günther: „...Nicht gefährlich aber doch furchterregend“ Ein Programm gegen Stigmatisierung in Schulen. Psychiat. Prax. 27, 340-346 (2000). [5] Satorius N., J.J.Lopez-Ibor, C.N.Stefanis, N.N.Wig: The WPA Global Programme, Against Stigma and Discrimination Baecause of Schizophrenia, Handbuch zum internationalen WPAProgramm gegen Stigmatisierung und Diskriminierung von Schizophrenie, 1997 [6] Sartorius N.: Eines der letzten Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankung. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 5-10 (2002). [7] Sulzenbacher H., R. Schmid, G. Kemmler, Ch. De Col, U. Meise: Schizophrenie... „bedeutet für mich gespaltene Persönlichkeit“ Neuropsychiatrie 16, 1/2: 93-98 (2002). Acknowledgement WPA standard acknowledgement: This paper reports findings form the Province of Alberta, one of the sites of the World Psychiatric Association`s Global Programme against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia. A full description of the programme and listing of heads collaborating groups and of the programme´s Steering committee can be found on the programme´s Website www.openthedoors.com. w. Hofr. Univ.-Doz. Prim. Dr. Werner Schöny Ärztlicher Direktor Literatur [1] Angermeyer M. C., B. Schulze: Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Über- O. Ö. Landes-Nervenklinik Wagner-Jauregg Wagner-Jauregg-Weg 15 4020 Linz email: [email protected] ORIGINAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 54 – 67 Einstellungen der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie Alfred Grausgruber1, Heinz Katschnig2, Ullrich Meise3 und Werner Schöny4 1Institut für Soziologie der Johannes-Kepler Universität, Linz 2Universitätsklinik für Psychiatrie, Wien 3Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck 4Landesnervenklinik Wagner-Jauregg, Linz Schlüsselwörter Einstellungen – Bevölkerung – Fallvignetten – Meinungsumfragen – Schizophrenie – Persönlichkeitsspaltung – Massenmedien – Ursachen – Gefährlichkeit – Behandelbarkeit – Psychotherapie – Pharmakotherapie – Integration – soziale Distanz – Stigmatisierung Key words Attidudes – public opinion – gate keeper – schizophrenia – vignettes – personality split – mass media – causes – psychotherapy – drug treatment – dangerousness – integration – social distance – stigmatisation Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie Im Gegensatz zu anderen Ländern wurden in Österreich in letzter Zeit nur wenig Studien über die Einstellung gegenüber psychisch Kranken durchgeführt. Im Zuge der Umstrukturierung der psychosozialen Versorgung und der Enthospitalisierung kommt der Haltung der Bevölkerung jedoch besondere Bedeutung bei. 1998 konnte eine repräsentative Umfrage bei der Bevölkerung (n=1042) zum Thema Schizophrenie durchgeführt werden, wobei unter anderem zwei Fallvignetten verwendet wurden. Ziel der Studie war es neben der Erkundung der verschiedenen Einstellungsfacetten auch Ursachen für die Haltungen zu ergründen und Hinweise zur Verbesserung der Einstellungen und Verhaltensweisen zu bekommen. Die Ergebnisse zeigen, dass rd. 4 von 5 Österreichern zwar den Ausdruck Schizophrenie schon gehört haben, kaum jemand aber Personen mit der Erkrankung persönlich kennt. Unter Schizophrenie wird vor allem eine „Persönlichkeitsspaltung“ verstanden. Die Informationen werden in erster Linie aus Massenmedien bezogen. Als Ursachen der Schizophrenie werden mehrere gemeinsame Faktoren angenommen. Rd. die Hälfte der Befragten glaubt, dass Personen mit der Diagnose Schizophrenie eine größere Gefährlichkeit aufweisen als die Durchschnittsbevölkerung. Die Behandelbarkeit der Schizophrenie wird durchwegs positiv eingeschätzt, insbesondere wenn entsprechend wirksame Therapien verabreicht werden. Bei wirksamen therapeutischen Maßnahmen denkt die österreichische Bevölkerung mehr an psychotherapeutische Verfahren als an eine Pharmakotherapie. Obwohl sich rd. 4 von 5 Österreichern für eine Integration von an Schizophrenie erkrankten Menschen in die Gesellschaft aussprechen, wollen nur wenige mit solchen Menschen engere persönliche Kontakte. Konsequenzen dieser Ergebnisse im Hinblick auf eine Verringerung der Distanz und zum Abbau der Stigmatisierung werden diskutiert. Attitudes of the general Population towards Schizophrenia in Austria In contrast to other countries in Austria only view research concerning attitudes towards mental illness have been done. But in the process of the restructering of the psychosocial care and dehospitalisation knowledge of publics opinion is essential. 1998 we could conduct a nationwide representativ public survey (n=1042) concerning the attitudes towards schizophrenia, using among others two different vignettes discribing schizophrenia. Aims of the research are to get information about attitudes towards schizophrenia, about causes of these attitudes and to get ideas to reduce the stigma of schizophrenia. Results show, that about 80 % know the term schizophrenia, but only minorities know people suffering on schizophrenia personally. The dominant understanding of schizophrenia is turning around „personality split“. Information is dominantly got from mass media. Respondents show a multidimensional understanding of the causes of schizophrenia. About half of the respondents believe, that people suffering on schizophrenia are more dangerous than the average population. Treatment of schizophrenia is estimated as fairly good, especially when effectiv therapy is delivered. Austrian people believe, that psychotherapeutic treatments are more effectiv than drug treatment. Although four from five respondents agree, that people suffering on schizophrenia should be integrated into society, only view of them are willing to have closer personally contacts to them. Consequences of these results to reduce stigmatisation of schizophrenia are discussed. Einleitung Wenn man die Forschungen über die Einstellung zu psychisch Kranken in den letzten fünfzig Jahren verfolgt, wird man ein sehr buntes Bild unterschiedlicher methodischer Vorgehensweisen, Befunde und praktischer Empfehlungen zur Verbesserung der Grausgruber, Katschnig, Meise und Schöny Einstellungen bzw. zur Verringerung der sozialen Distanz gegenüber psychisch Kranken finden [19]. Kamen die ersten Studien noch zu relativ eindeutigen negativen Befunden – die Bevölkerung weiß über psychische Erkrankungen wenig Bescheid und begegnet psychisch Kranken mit Mißtrauen und Distanz – so präsentieren die Untersuchungen ab Mitte der 60er Jahre differenziertere Einschätzungen. Sie meinen, dass im Zuge der sozialen und strukturellen Änderungen und insbesondere auch durch den Zugang breiterer Schichten zu höheren Bildungseinrichtungen die Haltungen gegenüber psychisch Kranken durch eine abnehmende Distanz ihnen gegenüber gekennzeichnet sei. War die Erforschung der Einstellung zu psychisch Kranken zunächst auf den angelsächsisch-amerikanischen Raum beschränkt, so zeigt sich mit Beginn der 70er Jahre auch im deutschsprachigen Raum ein Interesse für diese Problematik. Die ersten umfassenden Studien über die Einstellung zu psychisch Kranken bzw. zur psychosozialen Versorgung wurden in Österreich zu Beginn der 80er Jahre gestartet [15]. Ziel der damaligen Studie war es, durch eine gezielte Erforschung der Einstellung bei solchen Bevölkerungsgruppen, die mit psychisch Kranken beruflichen Kontakt haben, Informationen über deren Einstellung zu psychischen Erkrankungen sowie psychisch Kranken zu bekommen, mögliche Informationsdefizite zu identifizieren und Hinweise darüber zu bekommen, wie emotionale und kontaktbezogene Widerstände sowie Vorurteile durch Aufklärung und Information abgebaut werden konnten. Der Studie wurde insofern besondere Bedeutung beigemessen, als sich gerade zu Beginn der 80er Jahre auch in Österreich erste Maßnahmen zur Umstrukturierung der psychosozialen Versorgung in Richtung Gemeindenähe und ambulante Einrichtungen beobachten ließen. Die Ergebnisse, die bei dieser Studie festgestellt werden konnten, unterschieden sich von den Befunden von Untersuchungen in anderen Ländern nur wenig. Im besonderen Maße waren hervorzuheben: • Ein Defizit an Informationen über Einrichtungen der psychosozialen Versorgung, über die therapeutische Praxis, über die Ursachen von psychischen Erkrankungen und über die Behandlungsmöglichkeiten bzw. Behandlungschancen. • Weiters zeigte sich eine weit verbreitete Unfähigkeit bzw. Abneigung, psychische Probleme bei Menschen als solche zu erkennen; und • drittens eine weit verbreiteten Haltung gegenüber psychisch Kranken, welche sich als eine stark emotional unterstützte Distanz bzw. mangelnde Kontaktbereitschaft gegenüber psychisch kranken Menschen interpretieren läßt. All diese Befunde deuten auf eine markante Distanz und auf Tendenzen von offenen Vorurteilen unter den Berufsgruppen bzw. gate-keeper hin. Im Gegensatz zu den umfangreichen Forschungsarbeiten zu den Einstellungen gegenüber psychisch Kranken etwa in der Bundesrepublik Deutschland [1, 2, 5, 6, 7, 9, 10] oder anderen Ländern [27, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 53] wurden in Österreich nur sehr wenige Studien durchgeführt. Die erste österreichweite Erhebung über die Einstellungen gegenüber psychisch Kranken wurde im Jahr 1991 von Katschnig et.al. durchgeführt [22, 24]. Im Zentrum des Interesses standen bei dieser Studie „... das Wissen um die Einstellungen der Bevölkerung im Hinblick auf die Natur psychischer Krankheiten, ihre Behandelbarkeit und die vorhandenen Behandlungsmethoden, die mit der Behandlung und Betreuung psychischer Störungen befaßten Berufsgruppen und die dafür zuständigen Dienste und Einrichtungen ...“ [22:17]. Darüber hinaus sollte auch erfaßt werden, welches Verständnis 55 die Bevölkerung sowie die zur Behandlung und Betreuung psychischer Störungen befaßten Berufsgruppen haben, und wie die dafür zuständigen Dienste und Einrichtungen beschaffen sind. Einen zentralen Stellenwert nahmen weiters Einstellungen über das Hilfesuchverhalten, sowie Vorstellungen über die Wiedereingliederung von psychisch Kranken und die Umsetzung einer gemeindenahen psychosozialen Versorgung ein. Die Arbeitsgruppe um Grausgruber/Schöny führte 1992 eine Untersuchung bei den Angehörigen von psychisch Kranken durch [18, 32]. Mit spezifischen Themen bzw. Problemstellungen im Rahmen der Einstellungsforschung gegenüber psychisch Kranken beschäftigt sich auch die Arbeitsgruppe um Meise. Neben einer Studie über die Einstellung von Ärzten zur Psychiatrie [34] wurde hier auch eine Studie bei Personen durchgeführt, die an Schizophrenie erkrankt sind. In dieser Untersuchung wurde die soziale Distanz von Betroffenen gegenüber anderen Betroffenen im besonderen erhoben. In einer jüngsten Untersuchung wurde bei Schülern geprüft, mit Hilfe welcher Maßnahmen eine Verbesserung der emotionalen Reaktionen sowie der sozialen Distanz erreicht werden kann [36]. Dass die Einstellung der breiten Bevölkerung gegenüber psychischen Erkrankungen, gegenüber Menschen, die an psychischen Problemen leiden, einen wesentlichen Einfluss auf den Ausbau einer gemeindenahen psychosozialen Versorgung haben kann, ist mittlerweile vielfach nachgewiesen [48, 49]. Da nun gerade in Österreich in den 90er Jahren die ersten großen Umstrukturierungsprozesse zu greifen begannen, sollte sowohl einer kontinuierlichen Beobachtung der öffentlichen Meinung als auch der individuellen Haltungen gegenüber psychisch Kranken permanent besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Es wäre aber zu einfach, wollte man die Ergebnisse von ausländi- 56 Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie schen Studien und die dort gemachten Erfahrungen zu einer Analyse der österreichischen Situation und im Hinblick auf zu erarbeitende Strategien und Maßnahmen gegen die Diskriminierung von psychisch Kranken eins-zu-eins übertragen. Mindestens folgende drei Gründe haben unserer Ansicht nach dafür gesprochen, eine neue und umfassende Studie über die Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu psychischen Erkrankungen sowie zu Menschen mit psychischen Problemen in Angriff zu nehmen. Zum einem war die Datenlage schon relativ veraltet bzw. bezog sie sich auf ganz spezifische Personengruppen bzw. Themenstellungen. Zum anderen können die Ergebnisse aus Studien von anderen Ländern nicht zuletzt wegen der unterschiedlichen strukturellen Rahmenbedingungen nicht übertragen werden. Zusätzlich sind in den letzten Jahren neue Aspekte im Kontext der Einstellungsuntersuchungen zu beobachten. Immer häufiger wurde in Studien auf die Bedeutung der Massenmedien in der Vermittlung von Bildern bzw. Vorstellungen über psychische Erkrankungen und psychisch Kranke festgestellt. Weiters gibt es eine Reihe von neuen Medikamenten, welche bezüglich der Behandelbarkeit von psychischen Erkrankungen besondere Erfolge versprechen. Schließlich hat die World Psychiatric Assoziation 1996 ein Programm zur Bekämpfung der Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Angriff genommen. Im Zuge dieses Programms soll die öffentliche Einstellung gegenüber Menschen, die an Schizophrenie leiden, und auch gegenüber deren Familien verbessert werden, soll das Wissen um die Erkrankung Schizophrenie verbessert werden, und die Bemühungen sollen zu Maßnahmen führen, welche Vorurteile eliminieren und die Diskriminierung abbauen. Eine besondere Herausforderung stellen die geänderten sozialstruktu- rellen Rahmenbedingungen innerhalb der Gesellschaft insgesamt sowie auch die geänderten strukturellen Gefüge der psychosozialen Versorgung im speziellen dar. Über diese Veränderungen in Österreich informieren beispielsweise Meise [33, 35] oder Forster [14]. Für Amerika wird angenommen, dass um ein Vielfaches mehr als vor 20 Jahren Menschen mit psychosozialen Problemen auch entsprechende Beratungs-, bzw. Versorgungseinrichtungen nutzen [39]. Darüber hinaus wird aus zahlreichen Einstellungsstudien der Schluß gezogen, dass die allgemeine Steigerung des Bildungsniveaus auch zu einem vermehrten Wissen über psychische Erkrankungen und zu einem breiteren Verständnis geführt haben (ebd.). Die strukturellen Veränderungen innerhalb der psychosozialen Versorgung veränderten auch die Einstellung gegenüber psychisch Kranken. Der Ausbau von extramuralen Einrichtungen sowie der Abbau von Einrichtungen für Langzeithospitalisierte führen dazu, dass psychisch kranke Menschen mehr in der Gesellschaft sichtbar werden. Studien haben in diesem Zusammenhang jedoch widersprüchliche Befunde ans Tageslicht gebracht. Bei einigen Studien stellte sich heraus, dass vermehrte Kontakte mit psychisch kranken Menschen in der Gemeinde auch ein weniger vorurteilbehaftetes Bild vom psychisch Kranken hervorrufen [beispielsweise 16, 49]. Auf der anderen Seite wurde jedoch im Zusammenhang mit der Schließung von psychiatrischen Großkliniken und der Schaffung von Wohn- und Lebensmöglichkeiten in der Gemeinde für ehemalige langzeithospitalisierte psychisch Kranke die Erfahrung gemacht, dass man bei diesem Enthospitalisierungsprozeß teilweise auch mit erheblichen Widerständen und Vorurteilen auf Seiten der Bevölkerung rechnen muß [11, 12, 53]. Zu den strukturellen Änderungen ist sicherlich auch jener Prozeß zu zählen, in dem die betroffenen psychisch Kranken und ihre Angehörigen sich zu Interessensgruppen zusammengefunden haben und immer intensiver darum bemüht sind, ihre Anliegen gegenüber der Öffentlichkeit sowie gegenüber der Gesundheitspolitik durchzubringen [44]. Nicht zuletzt im Anschluß an die umfangreiche Berichterstattung über ein Attentat auf einen deutschen Abgeordneten [9, 10] wurde auch der Vermittlung von Vorstellungen und Bildern über psychisch kranke Menschen oder psychische Erkrankungen durch die Massenmedien vermehrt Aufmerksamkeit geschenkt [20, 53]. Forschungsdefizite, geänderte Rahmenbedingungen sowie die Unmöglichkeit einer sinnvollen Übertragung von Forschungsergebnissen aus anderen Ländern ließen es ratsam erscheinen, die Chancen für eine aktuelle Erhebung der Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu psychisch Kranken, psychischen Erkrankungen und psychosozialen Versorgungseinrichtungen aufzugreifen. Dies schien umso mehr als zielführend, als 1998 sich die österreichische Gesellschaft der Nervenärzte entschlossen hatte, beim internationalen Anti-Stigma-Programm der WPA in Österreich mitzumachen. [43 in diesem Heft]. Forschungsziele und Studiendesign Den internationalen Anforderungen bzw. Ansprüchen folgend verfolgt die Untersuchung mehrere wissenschaftliche und praktische Ziele: • In wissenschaftlicher Hinsicht gilt es zunächst die Einstellung zu Menschen, die an Schizophrenie leiden, zu ergründen sowie die Haltung zu Psychopharmaka zu erfassen. • Darüber hinaus ist es auch ein besonderes Anliegen, die Ursachen bzw. die Hintergründe für die jeweiligen Ansichten und Haltungen zu ergründen. Grausgruber, Katschnig, Meise und Schöny • Schließlich gilt es auch entsprechende praktische Hinweise zum Abbau von Wissensdefiziten bezüglich Schizophrenie und Psychopharmaka zu gewinnen und Hinweise zur Verbesserung der Einstellung gegenüber psychisch Kranken und zum Abbau der Stigmatisierung von an Schizophrenie Erkrankten bzw. gegenüber der Krankheit Schizophrenie zu erarbeiten. Bei der Konzeptentwicklung zu dieser Studie wurden mehrere neue Wege beschritten. Es wurde nicht mehr die Einstellung zu psychisch Kranken allgemein, sondern die Haltung gegenüber Menschen, die an Schizophrenie leiden, ins Zentrum der Forschungen gestellt. Dies erfolgt im Einklang mit den Zielsetzungen der Anti-Stigma-Kampagne [40, 54]. Zum zweiten wurde die Haltung nicht nur der Bevölkerung ins Auge gefaßt, sondern es wurden auch sog. strategische Berufsgruppen in der Studie berücksichtigt. Unter strategischen Berufsgruppen sollen jene Professionen verstanden werden, welche im Rahmen der Beratung, Therapie und Rehabilitation von Menschen mit schizophrenen Erkrankungen eine Rolle spielen. Neben den Fachärzten für Psychiatrie wurden daher auch praktische Ärzte sowie das nicht-ärztliche Personal in der psychosozialen Versorgung sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich in die Untersuchung einbezogen. Darüber hinaus interessierte es auch, welche Ansichten bzw. Haltungen die Angehörigen von psychisch Kranken zu dieser Frage einnehmen. Darüber hinaus war es ein besonderes Anliegen, auch die Meinung von Journalisten, welche im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung eine wesentliche Rolle spielen, mit in der Studie zu berücksichtigen. Die Erforschung der Haltung gegenüber Psychopharmaka war ein besonderes Anliegen einer Gruppe von Pharmafirmen, welche die Bemühungen der österreichischen Schizophreniegesellschaft fördern. In der Auswahl der thematischen Schwerpunkte sowie bei der Formulierung der detaillierten Forschungsziele spielten mehrere Aspekte eine besondere Rolle. Zum einem sollten derzeit – an internationalen Studien orientiert – aktuelle Themen angesprochen werden. In diesem Kontext schien es sinnvoll, sich auf bereits länger zurückliegende Ergebnisse der ersten Studie über die Einstellung von gate-keeper zu psychischen Erkrankungen zu erinnern [15]. Einen besonderen Schwerpunkt stellt die spezifische Erfassung jener Vorstellungen dar, die mit der Krankheit Schizophrenie verbunden werden. Bereits Star [45] hat mit sog. Fallschilderungen von psychischen Erkrankungen versucht, die damit verbundenen Vorstellungen zu erfassen. Im Anschluß an die Arbeiten von Stumme [46] wurde auch in der österreichischen Studie [17] in vielfältiger Weise versucht, die Vorstellungsinhalte bezüglich bestimmter psychischer Erkrankungen innerhalb der befragten Gruppen zu ergründen. Als Ergebnis konnte bereits damals festgehalten werden, dass die Befragten sehr wohl in der Lage sind, zwischen den einzelnen Krankheitsbildern ziemlich genau zu differenzieren und keine stereotypen Vorstellungen von psychisch Kranken anzutreffen sind. Allerdings sind nur wenig Personen seinerzeit in der Lage gewesen, Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, als solche zu identifizieren. 1998 hat die Arbeitsgruppe um Angermeyer [4] in einer Untersuchung über die soziale Repräsentation der Schizophrenie festgestellt, dass in der Vorstellung der Befragten die Persönlichkeitsspaltung das zentrale Merkmal der Schizophrenie darstellt. In der vorliegenden Studie wurden daher im Kontext der Vorstellungsinhalte zu Schizophrenie folgende zwei Aspekte angesprochen: • Die Kenntnis des Wortes Schizophrenie überhaupt, sowie in weiterer Folge • die Vorstellungsinhalte, welche mit dem Ausdruck Schizophrenie verbunden sind. 57 Bereits in der Studie mit den gatekeeper [15] konnte festgestellt werden, dass die Kontaktbereitschaft zu den in den Fallschilderungen beschriebenen Menschen direkt davon beeinflußt wird, ob von den Befragten eine Gefährdung durch psychisch kranke Menschen vermutet wird (175ff). Die Kontaktbereitschaft zu den geschilderten Personen war umso geringer, je mehr psychisch Kranke als eine Gefahr und Belastung für die Umwelt gesehen werden, unabhängig sonstiger soziodemographischer Merkmale bzw. sonstiger Einschätzungen und Vorstellungen gegenüber psychisch Kranker. Dem Phänomen der vermuteten Gefährlichkeit wurde auch in der amerika-nischen Studie 1996 [31] besondere Beachtung geschenkt. Dies veranlaßte uns, in die Studie zwei besondere Aspekte aufzunehmen: • Die Einschätzung der Gefährlichkeit von psychisch Kranken im Vergleich zur Normalbevölkerung im allgemeinen, sowie • die Einschätzung bzw. die vermutete Gefährlichkeit von Personen, welche an Schizophrenie erkrankt sind, im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung. Auch die vermuteten Ursachen von psychischen Erkrankungen bzw. der Schizophrenie wurden in bisherigen Studien mehrfach angesprochen [6, 22, 41], um nur einige zu nennen. Auch in der Studie zu Beginn der 80er Jahre in Österreich bei den gatekeeper konnte ein indirekter Zusammenhang zwischen den vermuteten Ursachen psychischer Erkrankungen und der sozialen Distanz zu Personen, die an Schizophrenie erkrankt sind, festgestellt werden [17:177]. Wie sich mittlerweile gezeigt hat, wurde auch in der großen amerikanischen Umfrage 1996 dem Aspekt der vermuteten Ursachen besondere Aufmerksamkeit gewidmet [31]. Es schien daher sinnvoll, in der Studie folgenden Aspekt mit zu erfassen: • Vermutete Ursachen für die Schizophrenie Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie • • • Im Kontext der verschiedenen Einstellungsfacetten gegenüber psychischen Erkrankungen hat die vermutete Heilungschance bzw. die vermuteten Behandlungsmöglichkeiten immer schon eine bedeutende Rolle gespielt [24, 41, 42]. Nicht nur zu Vergleichszwecken mit der Untersuchung vor gut zwei Jahrzehnten wurde daher in der folgenden Studie auch der Aspekt der Heilungschancen bzw. Behandelbarkeit aufgenommen. Vermutete Behandelbarkeit von Schizophrenie Darüber hinaus sollten auch der Aspekt Krankheitsverlauf sowie Therapieempfehlung im Kontext der Haltungen und Einschätzungen zu den Fallvignetten separat abgefragt werden. Wie bereits oben erwähnt, haben zahlreiche Studien auf den besonderen Stellenwert der Massenmedien in den Vermittlung der Einstellungen gegenüber psychisch kranken Menschen bzw. gegenüber psychischen Erkrankungen hingewiesen. Es erschien daher im Kontext der vorliegenden Studie sinnvoll, wie bereits bei Katschnig et.al. [24] in Erfahrung zu bringen, woher die Bevölkerung bzw. die strategischen Berufsgruppen ihr Wissen über Schizophrenie bzw. über Menschen, die daran leiden, beziehen: • Wissensquellen über Schizophrenie • Neben diesen Aspekten sollte die Bevölkerung an Hand von vier Fallschilderungen, welche in knappen Worten Menschen mit der Erkrankung Schizophrenie charakterisieren, diese an Hand einer Reihe weiterer Aspekte beurteilen. Zunächst sollte der Krankheitsverlauf ohne Therapie eingeschätzt werden, dann der vermutete Krankheitsverlauf mit einer entsprechenden Therapie. Weiters wurde erhoben, welche Therapiemaßnahmen die Befragten als sinnvoll erachten. Der drit- te Punkt war die Vermutung einer wirksamen Behandlung, dem sich die Empfehlung zu einer optimalen Behandlung des beschribenen Falles anschloß. Zwei Fragen bezogen sich schließlich auf die allgemeine Integrationsbereitschaft sowie auf die Bereitschaft zu näheren persönlichen Kontakten. Schließlich sollte an Hand einer Itemliste eine allgemeine Einstellung zu psychisch Kranken erhoben werden. Beim Themenbereich Psychopharmaka wurde die Einstellung zu folgenden Punkten erhoben: • Die Kenntnis des Begriffs Psychopharmaka sowie die inhaltlichen Verständnisse dieses Begriffes, • Facetten der Einstellung zu Psychopharmaka sowie • die Bereitschaft Psychopharmaka auch einzunehmen. Darüber hinaus sind natürlich bei der Allgemeinbevölkerung noch eine Reihe von soziodemographischen Daten zur sozialen Verortung erhoben worden. Methodik und Durchführung Den allgemeinen Studienzielen folgend wurde eine Befragung bei der Allgemeinbevölkerung in Österreich durchgeführt. Darüber hinaus wurden auch noch einige gate-keeper-professions in die Untersuchung mit einbezogen. Im Kontext der Untersuchung waren dies einmal diejenigen Berufsgruppen, welche im Bereich der psychosozialen Versorgung eine zentrale Rolle spielen bzw. bei der Vermittlung von Berichten über die Thematik mitwirken bzw. eine wichtige Stellung innerhalb der Meinungsbildung im Sinne einer Meinungsführer- 58 schaft ausüben. Neben der Allgemeinbevölkerung wurden daher aus dem Bereich der ärztlichen Berufe Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie, Fachärzte für innere Medizin sowie Allgemeinmediziner in die Studie mit einbezogen. Im Bereich der psychosozialen Versorgung spielen natürlich nicht-ärztliche Berufsgruppen wie das psychiatrische Pflegepersonal bzw. Sozialarbeiter eine wesentliche Rolle. Zum einen sind sie direkt in den Karriereprozeß einer Erkrankung involviert und zum anderen kommt ihnen eine nicht zu unterschätzende Meinungsführerschaft in dieser Thematik der psychosozialen Versorgung bzw. von psychischen Erkrankungen zu. Beide Argumente treffen im übrigen auch für die Einbeziehung der Angehörigen zu. Im Kontext der Untersuchungsziele war es auch wichtig, die Einstellungen und Haltungen jener Berufsgruppen zu erkunden, welche in den Massenmedien über Fragen von Gesundheit und Krankheit berichten. Es wurden deshalb auch Journalisten, welche sich in den Massenmedien mit Gesundheitsthemen befassen, in die Untersuchung mit einbezogen. Die Einstellung der Bevölkerung in Österreich wurde im Herbst 1998 mittels face-to-face Interviews bei einer repräsentativen Stichprobe von 1042 Personen durch ein Meinungsforschungsinstitut erhoben. Als Grundgesamtheit diente die Wohnbevölkerung über 16 Jahre in Österreich. Das zugrundeliegende Auswahlverfahren war ein Quotaverfahren. Aufgrund der gegebenen zeitlichen, finanziellen und organisatotorischen Rahmenbedingungen konnten die Meinungen der Berufsgruppen nicht mittels face-to-face Interviews erhoben werden. Die Fachärzte für Psychiatrie, die praktischen Ärzte sowie die Internisten und auch die mit Gesundheitsthemen befaßten Journalisten wurden mittels Telefoninterviews durch dasselbe Meinungsforschungsinstitut befragt. Die Angehörigen sowie die in der psychosozialen Versorgung tätigen Sozialarbeiter Grausgruber, Katschnig, Meise und Schöny bzw. Pfleger wurden mittels einer postalischen Umfrage im Winter 1998/1999 um die Beantwortung gebeten. Der Fragebogen enthielt von Ausnahmen abgesehen idente Fragen für alle Gruppen. Zur differenzierten Erfassung der Einschätzung bzw. Haltung gegenüber verschiedenen Formen der Schizophrenie wurden vier Subgruppen gebildet. Die Fallschilderungen variierten einerseits nach der Symptomatik, andererseits nach dem Geschlecht. Die Fallschilderungen wurden zu Vergleichszwecken aus der Studie von Katschnig [24] übernommen. Fallvignette 1: weiblich-positiv („Positivsymptomatik“) „Stellen Sie sich bitte vor, Sie erfahren, dass eine 25 jährige Frau, die bisher ein völlig normales Leben geführt hat, plötzlich Stimmen hört, oder sich ohne ersichtlichen Grund verfolgt fühlt bzw. wirre Dinge redet.“ Fallvignette 2: männlich-positiv („Positivsymptomatik“) „Stellen Sie sich bitte vor, Sie erfahren, dass ein 25 jähriger Mann, der bisher ein völlig normales Leben geführt hat, plötzlich Stimmen hört, oder sich ohne ersichtlichen Grund verfolgt fühlt bzw. wirre Dinge redet.“ Fallvignette 3: weiblich-negativ („Negativsymptomatik“) „Stellen Sie sich bitte vor, dass eine 25 jährige Frau, die bisher ein völlig normales Leben geführt hat, sich zurückzieht, komisch wirkt, sich vor anderen Menschen fürchtet, immer alleine ist und sich für nichts und niemanden interessiert.“ Fallvignette 4: männlich-negativ („Negativsymptomatik“) „Stellen Sie sich bitte vor, dass ein 25 jähriger Mann, der bisher ein völlig normales Leben geführt hat, sich zurückzieht, komisch wirkt, sich vor anderen Menschen fürchtet, immer alleine ist und sich für nichts und niemanden interessiert.“ Durch diese Splittung reduziert sich natürlich die Stichprobengröße der einzelnen Fallschilderungen, sie schwanken jedoch alle in einem minimalen Bereich um 250 Fälle (Fallvignette 1: N=252; Fallvignette 2: N=258; Fallvignette 3: N=239; Fallvignette 4: N=266). Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Befragung der Allgemeinbevölkerung. Die Darstellung der Befragung der anderen Gruppen (Gate-Keeper, Angehörige, Journalisten) ist in Vorbereitung. Ergebnisse Im Themenbereich Verständnis von Schizophrenie und Wissensquellen zeigten sich folgende Ergebnisse. (Tabelle 1) Auf die Frage: „Was bedeutet ‚Schizophrenie‘? Können Sie mir das etwas genauer sagen, was Sie darunter verstehen?“ gaben rd. vier von fünf Befragten an, diesen Begriff schon einmal gehört zu haben. Lediglich 19 % ist der Ausdruck Schizophrenie nicht bekannt. Der Begriff Schizophrenie ist somit innerhalb der österreichischen Bevölkerung ziemlich weit bekannt. Die inhaltlichen Vorstellungen zum Begriff Schizophrenie streuen allerdings ziemlich weit. Auf die Bitte, den Begriff inhaltlich etwas genauer zu beschreiben, meint fast ein Drittel der Bevölkerung (29 %), es verstehe unter Schizophrenie eine Art „Persönlichkeitsspaltung“. Zwischen 18 % und 13 % der Österreicherinnen und Österreicher verbinden damit eine Geisteskrankheit (18 %), eine Krankheit des Gehirns (14 %) bzw. assoziieren sie damit Begriffe wie Wahn bzw. Verwirrtheit (13 %). Minderheiten assoziieren damit Begriffe wie Wahrnehmungsstörung (8 %) bzw. verwenden den allgemei- 59 nen Ausdruck „psychische Krankheit“ (7 %). Woher kommt nun dieses inhaltliche Verständnis des Ausdrucks Schizophrenie? Die Antworten auf zwei spezifische Fragestellungen können diesbezüglich wertvolle Hinweise bieten. Aus Tabelle 2 ist ersichtlich, dass nur rd. jeder sechste Österreicher Menschen, die an Schizophrenie leiden, aus dem Bereich der eigenen Familie bzw. aus der Verwandtschaft kennt bzw. in der Nachbarschaft solche Menschen kennt. Rd. vier von fünf Österreichern kennen persönlich keine Menschen, die an Schizophrenie leiden. Dies läßt bereits darauf schließen, dass die Vorstellungen über Schizophrenie bzw. die Haltungen gegenüber Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, durch andere Instanzen bzw. Mechanismen vermittelt bzw. beeinflußt sind. Dass sich kaum jemand aus der Allgemeinbevölkerung ein Bild von Personen mit der Erkrankung „Schizophrenie“ durch persönliche Kontakte und Erfahrungen formen kann, zeigt sich mit besonderer Deutlichkeit auch bei der Frage, woher sie ihr Wissen bzw. ihre Vorstellungen über Schizophrenie schöpfen. (Tabelle 3) Informationen über die Krankheit Schizophrenie bzw. über Personen, die an Schizophrenie leiden, erhalten die Österreicherinnen und Österreicher hauptsächlich über die Massenmedien. Rd. jeder zweite Befragte gab an, in Zeitungen, im Fernsehen und Radio bzw. in Spielfilmen etwas über Schizophrenie gehört oder gesehen zu haben. Gespräche mit anderen Menschen bzw. mit Betroffenen oder deren Angehörigen werden von rd. jedem fünften Österreicher genannt. Jeder Siebte gab weiters an, aus der Fachliteratur Wissen bzw. Vorstellungen über Schizophrenie zu beziehen. 8 % nannten berufliche Kontakte als Wissensquelle. Als Ursachen für Schizophrenie kommen aus Sicht der Bevölkerung eine Reihe von Faktoren in Frage. Faßt man die Antworten „sehr häufig“ und „eher häufig“ zusammen, so tre- 60 Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie Tab. 1: Kenntnis des Ausdrucks „Schizophrenie“ und Verständnisinhalte (Angaben in %) Ausdruck nicht bekannt Ausdruck „Schizophrenie“ bekannt* 18,9 81,1 *Verständnisinhalte Persönlichkeitsspaltung Geisteskrankheit Krankheit des Gehirns Wahn/Verwirrtheit Wahrnehmungsstörung psychische Krankheit 29,1 17,7 14,4 13,2 7,7 7,1 n=893 (Mehrfachnennung möglich) Tab. 2: Persönliche Kenntnis von an Schizophrenie leidenden Personen (Angaben in %) kenne keine solchen Menschen kenne solche Menschen in Nachbarschaft kenne solche Menschen in der eigenen Familie bzw. Verwandschaft berufliche Kontakte 82,9 8,1 8,8 0,2 gesamt 100,0 Tab. 3: Wissensquellen (Angaben in %) Zeitungen Fernsehen/Radio Spielfilme Gespräche mit anderen (nicht kranken) Menschen Gespräche mit Betroffenen oder Angehörigen Fachliteratur berufliche Kontakte 55,5 48,6 48,3 22,1 20,7 15,1 8,5 (Mehrfachnennung möglich) Tab. 4: Vermutete Ursachen der Schizophrenie (Angaben in %) Vererbung tiefgreifende Erlebnisse (z.B. Tod) Kopfverletzungen nervliche Überanstrengung beruflicher Stress unglückliche Familienverhälnisse Willensschwäche ausschweifendes Leben schleche Wohnverhältnisse sehr häufig eher eher häufig selten nie MW % 44,0 32,1 16,6 7,3 1,87 100,0 34,6 27,8 24,4 16,3 38,7 33,3 48,6 41,7 18,4 27,6 17,0 26,6 8,3 11,3 10,0 15,4 2,00 2,22 2,13 2,41 100,0 100,0 100,0 100,0 13,5 10,0 5,2 2,9 30,9 20,9 15,5 14,0 36,8 36,4 34,2 44,6 18,8 32,7 45,1 38,5 2,61 2,92 3,19 3,19 100,0 100,0 100,0 100,0 ten folgende drei vermutete Ursachen in den Vordergrund: Vererbung, tiefgreifende Erlebnisse sowie nervliche Überanstrengung. Allerdings wird aus den Ergebnissen der Tabelle 4 auch deutlich, dass aus Sicht der österreichischen Bevölkerung Vererbung die dominierende Rolle spielt. Gut zwei von fünf Österreicherinnen und Österreicher vermuten, dass Vererbung sehr häufig als Ursache der Schizophrenie anzusehen ist. Fast drei von fünf Befragten vermuten, dass auch beruflicher Stress häufig eine Ursache der Schizophrenie darstellt. Andere mögliche Ursachen kommen aus Sicht der Bevölkerung weniger in Frage. Bei unglücklichen Familienverhältnissen ist bereits mehr als die Hälfte der Ansicht, dass sie eher selten bzw. überhaupt nicht als Ursache anzusehen sind. Willensschwäche, ausschweifendes Leben sowie schlechte Wohnverhältnisse kommen nur für relativ kleine Minderheiten der Befragten als Ursache der Schizophrenie in Frage. Die Behandelbarkeit der Schizophrenie (Tabelle 5) wird von der österreichischen Bevölkerung durchwegs positiv eingeschätzt. Zwar geht nur eine verschwindende Minderheit von einer sehr guten Behandelbarkeit der Schizophrenie aus (4 %), der Anteil der ausgesprochenen Pessimisten ist jedoch mit rd. 27 % (Behandelbarkeit wenig: 19 %; Behandelbarkeit gar nicht gegeben: 8 %) auch nicht zu groß. Rd. zwei Drittel der Bevölkerung gehen allerdings davon aus, dass sich die Schizophrenie gut bzw. etwas behandeln läßt. Eine zentrale Frage der Einstellung gegenüber psychisch Kranken allgemein betrifft die Einschätzung der Gewalttätigkeit. (Tabelle 6) Die Ergebnisse zeigen eine ausgeprägte Meinung innerhalb der Bevölkerung, sowohl psychisch kranken Menschen allgemein als auch an Schizophrenie leidenden Personen eine überdurchschnittliche Neigung zu Gewalttätigkeit zuzuschreiben. Jeweils 55% meinen, dass psychisch kranke Menschen eher zu 61 Grausgruber, Katschnig, Meise und Schöny Tab. 5: Behandelbarkeit der Schizophrenie (Angaben in %) sehr gut gut etwas wenig gar nicht 4,3 32,7 36,1 18,8 8,1 gesamt 100,0 Tab. 6: Einschätzung der Gewalttätigkeit im Vergleich (Angaben in %) psychisch kranke Menschen an Schizophrenie erkrankte Menschen neigen eher zu Gewalttätigkeiten als psychisch gesunde Menschen 55,2 55,0 nein, neigen nicht dazu 44,8 45,0 100,0 100,0 gesamt Tab. 7: Verhaltensabsicht bei Errichtung eines Wohnheims für ehemalige Langzeitpatienten (Angaben in %) unterstützen begrüßen ist mir egal verhindern Wohnsitz wechseln gesamt Gewalttätigkeit neigen als psychisch gesunde Menschen, gleich viele meinen auch, bei an Schizophrenie erkrankten Personen von einer im Vergleich zu psychisch gesunden Menschen erhöhten Neigung zur Gewalttätigkeit ausgehen zu müssen. In Tabelle 7 ist angeführt, wie sich die befragten Österreicherinnen und Österreicher verhalten würden, sollte in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ein Wohnheim für ehemalige Langzeitpatienten errichtet werden. Nicht ganz jeder fünfte Befragte zeigt hier eine eindeutig negative Haltung. Gut 15 % meinten, aktiv etwas zur Verhinderung eines derartigen Wohnheimes unternehmen zu wollen. Eine verschwindende Minderheit von 3 % gab an, in so einem Fall den Wohnsitz wechseln zu wollen. Rd. 12 % würden ein derartiges 6,6 5,6 68,0 15,5 3,3 100,0 Vorhaben unterstützen bzw. begrüßen. Mehr als zwei Drittel (68 %) meinten, es sei ihnen egal, wenn in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ein Wohnheim für ehemalige Langzeitpatienten errichtet werden sollte. In der folgenden Tabelle 8 sind sehr dichte Informationen über die Reaktion bzw. die Haltung der österreichischen Bevölkerung gegenüber Personen, welche an Schizophrenie erkrankt sind und unterschiedliche Verhaltensweisen zeigen, enthalten. Die Einschätzungen beziehen sich zunächst auf den Krankheitsverlauf ohne entsprechende Therapie. Nur um die 5 % der österreichischen Bevölkerung glauben, dass eine derartige Erkrankung, wenn sie nicht behandelt wird, zwar einmal auftreten kann, dann aber verschwindet und nicht mehr auftritt. Zwischen 30 % und 40 % meinen, dass diese Krankheit zwar verschwinde, aber immer wieder auftreten würde. Eine dauerhafte Erkrankung auf gleichem Niveau vermuten bzw. befürchten zwischen 20 % und 30 % der Antwortenden. Die pessimistischste Sichtweise, dass die Krankheit ohne Behandlung sich verschlechtert, wird ebenfalls zwischen 30 % und 40 % von der österreichischen Bevölkerung befürchtet. Es ist bemerkenswert, dass unabhängig des beschriebenen Verhaltens bzw. der dahinter vermuteten Erkrankung bei Frauen ein optimistischerer Verlauf vermutet wird. Jeweils gut über 40 % meinen, dass bei einer derartige Erkrankung ohne Behandlung eine Remission mit Rückfällen zu beobachten ist. Bei der männlichen Fallschilderung sind es rd. 10 Prozentpunkte weniger. Gibt es nun nach Ansicht der befragten Österreicherinnen und Österreicher eine wirksame Behandlung für dieses Krankheit? Jeweils deutlich mehr als die Hälfte gehen davon aus, dass es für jemandem mit einer derartigen Erkrankung eine wirksame Behandlung gibt. Die Einschätzungen variieren allerdings zwischen den vier unterschiedlichen Fällen signifikant. Während bei der Fallbeschreibung eins (weiblich, positive Symptomatik) lediglich 51 % eine wirksame Behandlung vermuten, steigt dieser Prozentsatz bis zum Fall vier (männlich, negative Symptomatik) auf 64 %. Die Einschätzung des Krankheitsverlaufs durch die Bevölkerung ändert sich dramatisch, wenn eine derartige Erkrankung fachgerecht behandelt wird. Im Gegensatz zur Einschätzung des Krankheitsverlaufs ohne wirksame Behandlung reduziert sich der Anteil von pessimistischen Einschätzungen ungeahnt stark. Insgesamt zwischen 66 % und 76 % der österreichischen Bevölkerung gehen davon aus, dass bei einer fachgerechten Behandlung die in den Fallschilderungen charakterisierte Krankheit verschwindet und nur hie und da wieder kommt. Zwischen 62 Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie Tab. 8: Einschätzung von Krankheitsverlauf ohne Therapie, Krankheitsverlauf mit Therapie, Einschätzung einer wirksamen Behandlung, erste Verhaltensabsicht, Medikationsempfehlung, allgemeine Integrationsbereitschaft und soziale Kontaktbereitschaft in Abhängigkeit von der Symptomatik (Positiv-, Negativsymptomatik) und Geschlecht weiblich positiv männlich positiv weiblich negativ männlich negativ Krankheitsverlauf ohne Therapie1 verschwindet, tritt nie mehr auf verschwindet, kommt aber wieder bleibt dauernd wird schlechter 5,3 42,0 23,7 29,0 6,0 30,6 32,1 31,3 4,7 41,4 20,7 33,2 5,1 27,0 26,2 41,8 Krankheitsverlauf mit Therapie2 verschwindet, tritt nie mehr auf verschwindet, kommt aber wieder bleibt dauernd wird schlechter 14,4 76,5 7,0 2,1 19,9 65,5 10,1 4,5 21,8 67k3 10,0 0,9 21,3 70,5 7,0 1,1 vermutete wirksame Behandlung3 vorhanden 51,0 56,2 56,3 64,2 erste Verhaltensabsicht4 gut zureden praktischen Arzt aufsuchen Psychiater aufsuchen Psychologen/Therapeuten aufsuchen in psychiatrische Klinik schicken anderes 16,8 16,0 38,5 9,8 4,9 14,0 21,2 18,3 34,4 10,4 6,5 9,8 24,6 20,3 28,8 12,7 1,7 11,9 34,4 13,7 25,2 11,1 4,6 11,0 Medikationsempfehlung5 Medikamente vorw. Medikamente/Psychotherapie vorw. Psychotherapie/Medikamente Psychotherapie 12,1 26,6 55,7 5,6 5,4 29,5 60,4 4,7 6,4 27,2 59,2 7,2 6,7 25,2 65,0 3,1 allgemeine Integrationsbereitschaft:6 sollte mitten in der Gesellschaft leben 76,5 73,2 89,1 87,3 Soziale Kontaktbereitschaft: Kinder zur Aufsicht anvertrauen7 als Vorgesetzte/n akzeptieren8 in Familie einheiraten lassen9 als Arbeitgeber diese Person einstellen10 als Nachbarn/in akzeptieren11 10,1 16,8 29,1 29,9 68,3 7,9 19,4 33,5 33,8 66,8 11,9 17,8 35,5 41,2 77,4 13,0 25,7 33,0 41,9 79,9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chi/2=26,67 p<0.01; C.corr=0.19 p<0.01 Chi/2=19,12 p<0,05; C.corr=0.16 p<0,05 Chi/2= 9,24 p<0,05; C.corr=0.14 p<0,05 Chi/2=39,87 p<0.01; C.corr=0.22 p<0.01 Chi/2=8,92 ns Chi/2=30,69 p<0.01; C.corr=0.24 p<0.01 Chi/2=14,78 p<0.01; C.corr=0.17 p<0.01 Chi/2=4,25 ns Chi/2= 7,57 p<0,05; C.corr=0.12 p<0,05 Chi/2=2,34 ns Chi/2=10,69 p<0,05; C.corr=0.152 p<0,05 63 Grausgruber, Katschnig, Meise und Schöny 15 % und 22 % vertreten sogar die optimistische Variante, dass das Auftreten der Krankheit in der Biographie der Person ein Einzelfall bleibt. Jene Befragten, welche eine wirksame Behandlung vermuten, wurden weiters gefragt, an welche konkrete Behandlung bzw. Therapie sie denken. Die Ergebnisse zeigen, dass nur zum Teil verschwindende Minderheiten um 5 % nicht an eine kombinierte Therapie denken. Von einer Ausnahme abgesehen sehen rd. 6 % in der Behandlung durch Medikamente alleine die optimale Therapie, ebenso viele befürworten ausschließlich psychotherapeutische Verfahren. Am häufigsten wird eine Kombination von psychotherapeutischen Verfahren bzw. medikamentösen Verfahren genannt – zwischen 55 % und 65 % sprechen sich dafür aus –, wobei in erster Linie psychotherapeutische Verfahren im Vordergrund stehen. Rd. ein Viertel denkt ebenfalls an eine derartige Kombination, wobei für diese Befragten allerdings eine medikamentöse Therapie im Vordergrund steht. Es ist interessant, dass hier zwischen den einzelnen Fällen keine signifikanten Unterschiede zu beobachten sind. In weiterer Folge wurden die Befragten gebeten anzugeben, was sie tun würden, falls jemand aus ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis, plötzlich unter einer derartigen Erkrankung leidet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Österreicherinnen und Österreicher in einem derartigen Fall in einem ersten Schritt zu rd. einem Drittel einen Psychiater aufsuchen würden. Allerdings gibt es eine Reihe weiterer Verhaltensweisen, die aus Sicht der Befragten ebenfalls als eine erste Maßnahme in Frage kommen. Es ist interessant, dass zwischen 17 % und 34 % der Antwortenden meinen, als einen ersten Schritt dem/der Erkrankten gut zureden zu wollen. Zwischen 14 % und 20 % meinten, als einen ersten Schritt einen praktischen Arzt aufsuchen zu wollen. Rd. jeder Zehnte würde in erster Linie einen Psychologen bzw. Psychotherapeuten aufsuchen. Nur Minderheiten würden die erkrankte Person sofort in eine psychiatrische Klinik schicken. Zwei weitere Fragenbereiche beschäftigen sich mit der Bereitschaft zur Integration bzw. zu sozialen Kontakten. Zwischen 75 % und 90 % der Antwortenden vertreten die Ansicht, dass eine Person, so wie sie in der Fallschilderung charakterisiert worden ist, mitten in der Gesellschaft leben sollte. Mindestens 10 Prozentpunkte mehr Integrationsbereitschaft sind bei der Fallschilderung der negativen Symptomatik zu beobachten. Zum Abschluß wurde noch erhoben, ob die Befragten bereit wären, mit den beschriebenen Personen in unterschiedliche soziale Kontaktsituationen einzutreten. Es ist auffällig, dass – wie in vielen anderen Studien auch – das Spektrum der sozialen Kontaktbereitschaft differenziert ist und stark von der konkreten persönlichen Nähe bzw. von der unmittelbaren Betroffenheit des Kontaktes abhängt. Rd. drei Viertel der Befragten würden die in der Fallschilderung charakterisierte Person als Nachbarn bzw. als Nachbarin akzeptieren. Bedeutend weniger – nur mehr etwa die Hälfte – wäre als Arbeitgeber auch bereit die beschriebene Person einzustellen. Um Nuancen zurückhaltender äußern sich die Befragten bezüglich der Situation, diese Person in die eigene Familie einheiraten zu lassen. Zwischen 29 % und 35 % wären dazu bereit. Die Kontaktbereitschaft sinkt noch einmal gewaltig, wenn nach der Akzeptanz der beschriebenen Person in einer Vorgesetztenposition gefragt wird. Nur mehr zwischen 17 % und 25 % der Befragten wären nun bereit, die beschriebene Person als Vorgesetzten anzuerkennen. Besonderes Mißtrauen und besondere Distanz sind erkennbar, wenn es um Kontakte zwischen der beschriebenen Person und den eigenen Kindern geht. Durchschnittlich nur mehr jeder zehnte befragte Österreicher bzw. Österreicherin wäre bereit, von der in den Fallschilderungen charakterisierten Person die eigenen Kinder beaufsichtigen zu lassen. Einmal mehr stellt sich somit heraus, dass zwar eine überwältigende Mehrheit bereit ist, für eine Integration von Personen, die an Schizophrenie erkrankt sind, in die Gesellschaft einzutreten, die damit notwendige soziale Kontaktbereitschaft wird im engeren sozialen Handlungsfeld jedoch auf ein Minimum reduziert. Im Kontext der Untersuchung stellten wir auch die Frage, ob die österreichische Bevölkerung Interesse hat, mehr über Schizophrenie zu erfahren. Der Befund war überraschend und ernüchternd zugleich: Lediglich rd. jeder siebte Österreicher (14 %) äußerte einen Wunsch nach mehr Informationen über die Krankheit Schizophrenie. Diskussion Wenn nun in einer Zusammenfassung die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Studie diskutiert werden, so gibt es eine Reihe von Befunden, die in besonderem Maße von Interesse sind. Zunächst einmal können wir festhalten, dass der Ausdruck „Schizophrenie“ in der österreichischen Bevölkerung weit um bekannt ist. Nur jeder Fünfte kann mit diesem Begriff nichts anfangen. Inhaltliche Vorstellungen, welche mit dem Begriff „Schizophrenie“ verbunden sind, streuen weit und zeigen ein besonderes Bild. Fast ein Drittel der österreichischen Bevölkerung denkt beim Wort „Schizophrenie“ in erster Linie an eine Spaltung der Persönlichkeit. Erst an zweiter und dritter Stelle werden mit Geisteskrankheit allgemein bzw. Krankheit des Gehirns Hinweise auf eine Erkrankung gegeben. Berücksichtigt man jedoch die vierthäufigst genannten Assoziationen „Wahn“ bzw. „Verwirrtheit“, so zeigt sich, dass innerhalb der Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie Bevölkerung das Verständnis von Schizophrenie in erster Linie an Symptomen orientiert ist. Die Krankheit bzw. ein Krankheitsverständnis ist dem etwas untergeordnet. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Holzinger et.al. [21] bei ihrer Untersuchung zur sozialen Repräsentation der Schizophrenie in der Bundesrepublik Deutschland bzw. bei der Befragung von Medizinstudenten. Sie berichten, dass sowohl innerhalb der Allgemeinbevölkerung in der Bundesrepublik als auch – und hier sogar im besonderen Maße – bei den Medizinstudenten das Phänomen einer „Spaltung der Persönlichkeit“ besonders in den Vordergrund tritt. Es scheint, als ob mit dem Ausdruck Schizophrenie weniger eine konkrete Krankheit und die damit verbundenen Leiden assoziiert werden, als vielmehr ein eher abstraktes und von der konkreten Erkrankung abgehobenes Verständnis einer Persönlichkeitsspaltung. Es hat den Anschein, als ob Schizophrenie als Metapher für etwas Nicht-Nachvollziehbares, Widersprüchliches, Gegensätzliches verwendet würde. Dieses metaphorische Verständnis von Schizophrenie könnte nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass einerseits nur jeder fünfte Österreicher überhaupt persönlich Menschen kennt, die an Schizophrenie leiden, andererseits mit dem Faktum zusammenhängen, dass das Wissen über Schizophrenie in erster Linie aus Zeitungen, Fernsehen, Radio bzw. Spielfilmen bezogen wird. Inwieweit dieses massenmedial vermittelte Bild der Schizophrenie damit verknüpft ist, was über Schizophrenie, über Personen, welche an Schizophrenie erkrankt sind, berichtet wird bzw. in welcher Art und Weise das Wort „schizophren“ in den Massenmedien verwendet wird, müßte erst genauer überprüft werden. Folgt man aber den Ergebnissen der Medienanalyse von Hofmann-Richter et.al. [20] dann drängen sich bemerkenswerte Parallelitäten auf. Hofmann-Richter und die Mitarbeiter konnten in ihrer Ana- lyse der angesehenen „Neuen Züricher Zeitung“ auffallend häufig einen metaphorischen Gebrauch des Wortes „Schizophrenie“ feststellen. Sie weisen auf die widersprüchliche Verwendung des Begriffes hin. In einer unveröffentlichten Arbeit kommt Katschnig [25] bei einer Analyse österreichischer Zeitschriften bzw. Zeitungen zu einem noch höheren Anteil von Berichten, in denen der Ausdruck „Schizophrenie“ bzw. „schizophren“ in einer metaphorischen Weise verwendet wird. Wenn man in der vorliegenden Studie alle jene Antworten summiert, welche als Informationsquelle für Schizophrenie Massenmedien nennen, so machen die Massenmedien rd. zwei Drittel aller Angaben insgesamt aus. Wenn man weiters bedenkt, dass nur rd. jeder Elfte Menschen, die an Schizophrenie leiden, im engeren sozialen Umfeld kennt, dann muß man davon ausgehen, dass die Vorstellungen über Schizophrenie und auch die Haltung gegenüber Menschen, die an Schizophrenie leiden, nur in den seltensten Fällen von persönlichen Erfahrungen geprägt sind, und in den allermeisten Fällen demgegenüber ein durch massenmediale Darstellungen vermitteltes Bild bedeutet. Im besonderen Maße interessant sind weiters die Ergebnisse über die vermuteten Ursachen der Schizophrenie. Die Befunde zeigen, dass aus Sicht der österreichischen Bevölkerung offenbar mehrere Faktorenbündel eine Rolle spielen. Biologische Ursachen, Stress und andere psychosoziale Umstände spielen hierbei eine relativ große und gleich bedeutende Rolle. Persönlichkeitsdefizite wie etwa Willensschwäche oder ausschweifendes Leben spielen dem gegenüber kaum eine Rolle. Ein derart multifaktorelles Ursachenverständnis konnte bereits bei der Studie über gate-keeper in Österreich [41] festgestellt werden. Auch in der großangelegten US-amerikanischen Studie von 1996 [30] wurde ein multifaktorielles Ursachenverständnis bemerkt. 64 Ähnliche Ergebnisse berichten auch Angermeyer/Matschinger [2, 6] für die Bundesrepublik Deutschland. Allerdings wurde in der Studie von Angermeyer/ Matschinger [2], bei der die Daten bereits 1990 gewonnen wurden, Persönlichkeitsschwächen seltener als Ursachen genannt. Die österreichische Bevölkerung ist damit doch relativ weit von jenem Verständnismuster entfernt, das allgemein als das medizinische Modell bezeichnet wird. Angermeyer/Matschinger [6] konnten in ihrer Studie herausfinden, dass bei den Angehörigen von psychisch Kranken biologische Faktoren im Sinne des medizinischen Modells eine klar dominierende Rolle spielen. Das Ursachenverständnis der Erkrankung Schizophrenie ist nun in mehrerer Hinsicht von Interesse. Zum einem wird zu überprüfen sein, ob mit den unterschiedlichen Ursachenverständnis auch unterschiedliche Behandlungsempfehlungen verknüpft sind. Zum anderen wird der Frage nachzugehen sein, ob die jeweils vermuteten Ursachen der Schizophrenie auch mit einer unterschiedlichen Kontaktbereitschaft gegenüber Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind, einher gehen. Angesichts der geringen persönlichen Kenntnis von Menschen, die an Schizophrenie leiden, sowie der zentralen Funktion von Massenmedien in der Herausbildung der Vorstellungen über Schizophrenie verwundert es nicht, dass gut die Hälfte der österreichischen Bevölkerung die Ansicht vertritt, dass mit der Erkrankung Schizophrenie auch eine gewisse Gefahr für das soziale Umfeld ausgeht. Furcht und Angst vor psychisch Kranken spielen offenbar eine zentrale Rolle in der Einstellung gegenüber psychisch Kranken im allgemeinen und gegenüber Menschen, die an Schizophrenie leiden, im besonderen. Analysen haben gezeigt, dass insbesondere auch in angesehenen Zeitungen Berichte von einzelnen Gewalttaten psychisch Kranker einen überproportionalen Stellenwert einneh- Grausgruber, Katschnig, Meise und Schöny men [20, 53]. Die Frage, warum psychisch Kranke bzw. Menschen mit der Diagnose Schizophrenie als gefährlicher eingeschätzt werden als die Normalbevölkerung, kristallisiert sich immer mehr zu einem besonderen Ansatzpunkt in den Bemühungen um eine Reduzierung von Stigma und Diskriminierung. Dies ist umso mehr von Bedeutung, als bisherige Einzelbzw. Übersichtsstudien [13, 26, 47] eindeutig belegen konnten, dass ein schwacher Zusammenhang zwischen schizophrenen Erkrankungen und Gewalttätigkeit besteht, dieser allerdings nur bei bestimmten Symptomkonstellationen zu beobachten ist. Besonders aufschlußreich sind die Ergebnisse über die Einschätzung des Krankheitsverlaufs, der vermuteten Wirksamkeit einer Behandlung und der jeweiligen Vorstellung über eine optimale Behandlung sowie über die Verhaltensabsichten, falls jemand aus dem eigenen Verwandten- oder Bekanntenkreis plötzlich an einer in den Fallvignetten beschriebenen Erkrankung leiden würde. Hinsichtlich der Wirksamkeit von therapeutischen Verfahren haben wir Ergebnisse aus einer direkten Frage sowie aus den beiden Fragen zum Krankheitsverlauf mit und ohne Therapie. Beide Ergebnisse zeigen ein sehr optimistisches Bild. Zwischen der Hälfte und fast zwei Dritteln der Befragten vermuten grundsätzlich eine wirksame Behandlungsmöglichkeit für die in den Fallschilderungen charakterisierten Erkrankungen. Dabei fällt auf, dass für die Fallschilderungen mit der negativen Symptomatik tendenziell eher eine wirksame Behandlung vermutet wird als für Fälle mit einer Positivsymptomatik. Darüber hinaus ist interessant, dass der Tendenz nach unabhängig von den Fallschilderungen bei Männern eher eine wirksame Behandlung vermutet wird als bei Frauen. Diese günstige Einschätzung wird ergänzt durch die unterschiedlichen Einschätzungen des Krankheitsverlaufs mit und ohne Therapie. In allen Fällen zeigt sich eine Verdoppelung der positiven Einschätzungen des Krankheitsverlaufs bei einer entsprechenden therapeutischen Behandlung. Bei der Fallschilderung des jungen Mannes mit Negativsymptomatik kommt es sogar zu einer Verdreifachung der Remissionseinschätzung mit und ohne Rückfälle. Insgesamt sind rd. 90 % der österreichischen Bevölkerung der An-sicht, dass es bei Anwendung wirksamer Therapieverfahren zur einer Re-mission (mit oder ohne Rückfälle) kommt. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch Studien in Australien [22] sowie Angermeyer/Matschinger [2] für die Bundesrepublik Deutschland. Auch wenn die tatsächlichen Behandlungserfolge in der Durchschnittsbevölkerung überschätzt werden, bleiben doch besonders bemerkenswerte Unterschiede in der Einschätzung des Krankheitsverlaufs mit und ohne entsprechender Therapie als zentraler Befund bestehen. Worin besteht nun aber eine optimale Therapie? Die Ergebnisse zeigen deutlich auf, welch überragende Bedeutung psychotherapeutischen Verfahren in der Behandlung von schizophrenen Erkrankungen zugesprochen wird. 90 % der Österreicherinnen und Österreicher halten psychotherapeutische Verfahren als wirksame anzuwendende Therapiemaßnahmen. Zusätzlich ist bemerkenswert, dass diese Präferierung der psychotherapeutischen Verfahren unabhängig der jeweiligen Fallschilderungen erfolgt. Auch in der australischen [22] bzw. bundesdeutschen Studie [2] wird Ähnliches berichtet. Im Kontext der vorliegenden Ergebnisse tauchen allerdings einige interessante Fragestellungen auf. Zunächst wäre in einem nächsten Schritt zu überprüfen, ob mit der Präferierung von psychotherapeutischen Maßnahmen ein bestimmtes Ursachenverständnis einhergeht oder nicht. Auf den ersten Blick sind zumindest einige Ergebnisse bemerkenswert, welche sich zu einem bestimmten sinnhaften Bild zusammenfügen. Bei der Frage nach den Ursachen der Schizophrenie stellte 65 sich heraus, dass innerhalb der österreichischen Bevölkerung psychosozialen Faktoren eine wesentliche Rolle zugesprochen wird. Es ist daher durchaus verständlich, dass dem entsprechend auch psychotherapeutischen – und wohl auch soziotherapeutischen – Verfahren besondere Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Die österreichische Bevölkerung ist in ihrem Ursachenverständnis offenbar nicht am engeren medizinischen Krankheitsmodell orientiert und votiert demgemäß auch weniger stark für pharmakotherapeutische Verfahren. In diesem Zusammenhang wäre es sicherlich interessant zu überprüfen, ob spezifische Einstellungen gegenüber Psychopharmaka hier eine Rolle spielen. Ein weiterer interessanter Aspekt der vorliegenden Untersuchung bezieht sich auf die beabsichtigten Handlungen für den Fall, dass jemand aus dem Verwandten- bzw. Bekanntenkreis plötzlich an einer in den Fallschilderungen charakterisierten Erkrankung leidet. Aus den Antworten ist ersichtlich, dass einerseits ein hohes Vertrauen in professionelle Hilfe besteht, dass aber andererseits auch das Laiensystem nach wie vor eine bedeutende Rolle spielt. Vom Fall Beispiel 4 (männlich, Rückzugsverhalten, Negativsymptomatik) einmal abgesehen, wird in erster Linie die Kontaktierung eines Facharztes für Psychiatrie empfohlen. Insbesonders bei einem Rückzugsverhalten spielt aber auch „gut zureden“ eine wichtige Rolle. Aus den Antworten ist aber weiters klar ersichtlich, dass eine sofortige stationäre Behandlung nur in ganz wenigen Ausnahmefällen als erster wesentlicher Schritt ins Kalkül gezogen wird. Bereits bei der „gatekeeper-Studie“ [55] konnte der besondere Stellenwert des engeren persönlichen Umfeldes beobachtet werden. Auch in anderen Studien [2, 3, 38] zeigen sich ähnliche Ergebnisse. Überrascht hat uns allerdings das Ergebnis, dass der Wunsch nach mehr Information nur bei 14 % der Allgemeinbevölkerung bestand. Es wird 66 Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie notwendig sein im Rahmen der AntiStigma-Kampagne „Anreize“ zu schaffen, dass sich das Interesse in der Bevölkerung an dieser Thematik steigert. Die vorliegenden Befunde erhellen somit zwar wichtige Aspekte der Einstellung der österreichischen Bevölkerung zur Schizophrenie sowie gegenüber Menschen, die an dieser Krankheit leiden, einige zentrale Fragen sind allerdings noch nicht geklärt. Insbesonders im Hinblick auf Überlegungen, wie die Stigmatisierung und die Diskriminierung von Menschen, welche an Schizophrenie leiden, reduziert werden kann, sind weitere Analysen unbedingt notwendig. So muß in einem nächsten Schritt beispielsweise überprüft werden, ob und bei welchen Aspekten der Einstellung unterschiedliche Wissensquellen über Schizophrenie bzw. die persönliche Kenntnis von an Schizophrenie leidenden Menschen differenzierte Vorstellungen und Haltungen bewirken. Die Wirkungsweise der Massenmedien auf dem Gebiet der Einstellung zu psychisch Kranken allgemein und zu Menschen mit der Krankheit Schizophrenie im besonderen ist noch weitgehend unklar. In diesem Zusammenhang ist auch der Frage nachzugehen, ob und wie die Einschätzung der Gefährlichkeit von an Schizophrenie leidenden Menschen massenmedial vermittelt wird oder nicht. In weiterer Folge wäre zu klären, in welchem Ausmaß die Vorstellungen über Schizophrenie etwa hinsichtlich Ursachenverständnis, vermutete Behandelbarkeit und angenommene Gefährlichkeit die Kontaktbereitschaft gegenüber Menschen, die an Schizophrenie leiden, beeinflußt. Schließlich ist zu prüfen, ob und in welcher Weise die Vorstellungen über Psychopharmaka auch die Suche nach adäquaten Ansprechstellen bzw. Hilfen bzw. bevorzugten Therapieverfahren beim Auftreten der Krankheit Schizophrenie beeinflussen. [7] Angermeyer, M.C./Matschinger, H./ Held, T. (1995): Bereitschaft zu persönlichem Engagement für psychisch Kranke, Neuropsychiatrie, 9, 3, 130136 [8] Angermeyer, M.C./Matschinger, H./ Sandmann, J./Hillert, A. (1994): Die Einstellung von Medizinstudenten zur Behandlung mit Psychopharmaka, Psychiatr. Prax., 21, 58-63 [9] Angermeyer, M.C./Siara, C.S. (1994a): Auswirkungen der Attentate auf Lafontaine und Schäuble auf die Einstellung der Bevölkerung zu psychisch Kranken. Teil 1: Die Entwicklung im Jahr 1990, Nervenarzt, 65, 41-48 [10] Angermeyer, M.C./Siara, C.S. (1994b): Auswirkungen der Attentate auf Lafontaine und Schäuble auf die Einstellung der Bevölkerung zu psychisch Kranken. Teil 2: Die Entwicklung im Jahr 1991, Nervenarzt, 65, 49-56 [11] Arens, A. (1993): What do the neighbors think now? Community residences on Long Island, New York, Community Mental Health J, 29, 235-245 [12] Brockington, J.F./Hall, P./Levings, J./Murphy, C. (1993): The Community´s Tolerance of the Mentally Ill, : British Journal of Psychiatry, 162, 93-99 [13] Eronen, M./Angermeyer, M.C./Schulze, B. (1998): The psychiatric epidemiology of violent behavior, Soc Psychiatry Psychiatr. Epidemiol, Suppl 1, 13-23 [14] Forster, R. (1999): Von der Anstalts- zur Gemeindepsychiatrie: Empirische Befunde und theoriegeleitete Interpretationen eines Wandlungsprozesses in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 3:56-75 [15] Angermeyer, M.C./Matschinger, H. (1999b): Lay beliefs about mental disorders: a comparison between the western and the eastern parts of Germany, Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 34(5), 275-281 Grausgruber, A./Hofmann, G./Schöny, W./Zapotoczky, K. (1989): Einstellung zu psychisch Kranken und zur psychosozialen Versorgung, Thieme, Stuttgart [16] Angermeyer, M.C./Matschinger, H./Riedel-Heller, S.G. (1999): Whom to ask for help in case of mental disorder? Preferences of the lay public. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 34(4), 202-210 Grausgruber, A. (1989a): „... Mit der Zeit gewöhnt man sich an alles ...“ Ergebnisse einer empirischen Untersuchung über die Akzeptanz von BewohnerInnen eines Langzeitwohnheimes, Gemeindenahe Psychiatrie, 10, 11-30 [17] Grausgruber A. (1989b): Zur Einstellung gegenüber verschiedenen Typen psychisch Kranker. In: Grausgruber, A./Hofmann, G./Schöny, W./ Zapotoczky, K.: Einstellung zu psychisch Kranken und zur psychosozialen Versorgung, Thieme, Stuttgart, 145-188 [18] Grausgruber, A./Schöny, W. (1993): Die Beurteilung psychisch Kranker und psychiatrischer Einrichtungen durch Angehörige psychisch Kranker, Gemeindenahe Psychiatrie, 1, 19-26 [19] Grausgruber, A./Schöny, W. (1995): Einstellungsforschung zu psychisch Kranken, Neuropsychiatrie, 9, 3, 123-129 Danksagung Die Studie wäre ohne die Unterstützung der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, pro mente Austria und der Österreichischen Schizophrenie Gesellschaft und ohne die finanzielle Hilfe der Arbeitsgemeinschaft der Pharmafirmen in Österreich (ASTRA ZENECA Österreich GmbH, ELI LILLY GmbH, JANSSEN-CILAG Pharma GmbH, LUNDBECK Arzneimittel GmbH, NOVARTIS Pharma GmbH) in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen. Dafür sei herzlicher Dank ausgsprochen. Dank gebührt auch den bei der Umfrage antwortenden Österreicherinnen und Österreichern für ihre Bereitwilligkeit zur Mitarbeit. Für seine Unterstützung und wertvolle Hinweise danken wir besonders Herrn Univ.-Prof. Dr. W. Wolfgang Fleischhacker, Psychiatrische Universitätsklinik, Innsbruck. Literatur [1] [2] [3] Angermeyer, M.C./Matschinger, H. (1999a): Neuroleptika im Urteil der Angehörigen, Psychiatrische Praxis, 26, 171-174 [4] Angermeyer, M.C./Schulze, B. (1998): Psychisch Kranke – eine Gefahr? Psychiatr. Prax., 25(5), 211-220 [5] Angermeyer, M.C./Matschinger, H. (1997): Social distance towards the mentally ill: Results of representative surveys in the Federal Republik of Germany, Psychological Medicine, 27, 131-141 [6] Angermeyer, M.C./Matschinger, H. (1996): Relatives` beliefs about the causes of schizophrenia, Acta Psychiatr Scand, 93, 199-204 67 Grausgruber, Katschnig, Meise und Schöny [20] [21] Holzinger, A./Angermeyer, M.C./Matschinger, H. (1998): Was fällt Ihnen zum Wort Schizophrenie ein? Psychiat. Prax., 25, 9-13 [22] Jorm, A.F./Angermeyer, M.C./Katschnig, H. (1998): Public Knowledge and Attitudes about Mental Disorders: A Limiting Factor in the Optimal Use of Treatment Services, Manuskript Wien [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] trische Versorgung aus der Sicht der Angehörigen. in: Platz, T.: Brennpunkte der Schizophrenie, Springer, Wien, 151-159 Hoffmann-Richter, U./Alder, B./Hinselmann, V./Finzen, A. (1998): Schizophrenie in der "Neuen Zürcher Zeitung”, Psychiat. Prax., 25, 14-18 Jorm, A.F./Korten, A.E./Jacomb, P.A./Rodgers, B./Pollitt, P./Christensen, H./ Henderson, S. (1997): Helpfulness of interventions for mental disorders: beliefs of health professionals compared with the general public, Britisch Journal of Psychiatry, 171, 233-237 Katschnig, H./Etzersdorfer, E./Muzick, M. (1993): „Nicht nur eine minderwertige Gesundheit ...“. Eine Untersuchung über die Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu psychisch Kranken und zur Psychiatrie. Forschungsbericht Wien Katschnig, H. (1999): Schizophrenie in Zeitungen und Zeitschriften in Österreich, Manuskript Wien [33] Meise, U./Hafner, F./Hinterhuber, H. (Hrsg.) (1991): Die Versorgung psychisch Kranker in Österreich. Eine Standortbestimmung. Springer, Wien/ New York [34] Meise, U./Rössler, W./Hinterhuber, H. (1995): Einstellungsforschung und Öffentlichkeitsarbeit: Stiefkinder der Psychiatrie? Neuropsychiatrie, 9, 3, 119122 [35] Meise, U./Hafner, F./Hinterhuber, H. (Hrsg.) (1998): Gemeindepsychiatrie in Österreich, Innsbruck, VIP-Verlag Integrative Psychiatrie, Innsbruck [36] Meise, U./Sulzenbacher, H./Kemmler, G./Schmid, R./Rössler, W. (2000): "...nicht gefährlich, aber doch furchterregend”. Ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophrenie in Schulen, Psychiat Prax., 27, 340-346 [37] Monahan, J./Steadman, H.J. (eds.) (1994): Violence and Mental Disorders. Developments and Risk Assessment, Chicago/London [38] Pescosolido, B.A./Monahan, J./Link, B.G./Stueve, A./Kikuzawa, S. (1999): The Public´s View of the Competence, Dangerousness, and Need for Legal Coercion among People with Mental Health Problems, American Journal of Public Health 89, 1339-45 Link, B.G./Stueve, A. (1994): Psychotic Symptoms and the Violent/Illegal Behavior of Mental Patients Compared to Community Controls, in: Monahan, J./Steadman, H.J. (eds.): 137-159 Link, B.G. (1982): Mental Patient Status, Work and Income: An Examination of the Effects of a Psychiatric Label, American Sociological Review, 47, 202-215 [39] Phelan, J.C./Link, B.G./Stueve A./Pescosolido, B.A. (2000): Public Conceptions of Mental Illness in 1950 and 1996: What is Mental Illness and is it to be Feared? Journal of Health and Social Behavior 41, 188-207 Link, B.G./Cullen, F.T./Frank, J. et.al. (1987): The Social Rejection of Former Mental Patients: Understanding why Labels Matter, Am J Sociol, 92, 14611500 [40] Link, B.G./Cullen, F.T./Struening, E. et.al. (1989): A Modified Labeling Theory Approach in the Area of Mental Disorders: An Empirical Assessment. American Sociological Review, 54, 400-423 [41] Link, B.G./Phelan, J./Bresnahan, M./Stueve, A./Pescosolido, A. (1999): Public Conceptions of Mental Illness: Labels, Causes, Dangerousness and Social Distance. American Journal of Public Health, 89, 1328-1333 [42] Schöny, W./Grausgruber, A. (1995): Ergebnisse von Einstellungsuntersuchungen als Voraussetzung für Veränderungen im psychosozialen Bereich, Neuropsychiatrie, 9, 3, 163-167 [43] Schöny W. (2002): Schizophrenie hat viele Gesichter: Die Österreichische Kampagne zur Reduktion des Stigmas und der Diskriminierung wegen Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 58-53 (2002) Martin, J.K./Pescosolido, B.A./Tuch, S.A. (2000): Of Fear and Loathing: The Role of "Disturbing Behavior”, Labels and Causal Attributions in Shaping Public Attitudes toward People with Mental Illness, Journal of Health and Social Behavior 41, 208-223 Mayr, H./Schöny, W./Winkler, J./Grausgruber. A. (1993): Stationäre psychia- [44] Sartorius N. (2002): Eines der letzten Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankungen. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 5-10 (2002) Schöny, W. (1989): Vorstellungen über psychische Erkrankungen. In: Grausgruber, A. /Hofmann, G./Schöny, W./Zapotoczky, K.: Einstellung zu psychisch Kranken und zur psychosozialen Versorgung, Thieme, Stuttgart, 48-83 Simon, M.D. (2000): Wir melden uns zu Wort. Die Angehörigen von psychisch kranken Menschen beziehen Position, Psychiat. Praxis, 27, 209-213 [45] Star, S. (1955): The Public Ideas about Mental Illness, Chicago [46] Stumme, W. (1975): Psychische Erkrankungen im Urteil der Bevölkerung. Urban & Schwarzenberg, München/ Berlin/Wien [47] Swanson, J.W. (1994): Mental Disorder, Substance Abuse, and Community Violence: An Epidemiological Approach, in: Monahan, J./Steadman, H.J. (eds.): 101-136 [48] Tefft, B./Segall, A./Trute, B. (1987): Neighborhood response to community mental health facilities for the chronically mentally disabled, Can.J.Comm. Mental Health 6, 37-49 [49] Voges, B./Rössler, W. (1995): Beeinflußt die gemeindenahe psychiatrische Versorgung das Bild vom psychisch Kranken in der Gesellschaft?, Neuropsychiatrie, 9, 3, 144-151 [50] Wolff, G./Pathare, S./Craig, T./Leff, J. (1996a): Community Attitude to Mental Illness, British Journal of Psychiatry, 168, 183-190 [51] Wolff, G./Pathare, S./Craig, T./Leff, J. (1996b): Community Knowledge to Mental Illness and Reaction to Mental Ill People, British Journal of Psychiatry, 168, 191-198 [52] Wolff, G./Pathare, S./Craig, T./Leff, J. (1996c): Public Education for Community Care. A New Approach, British Journal of Psychiatry, 168, 441-447 [53] Wolff, G. (1997): Attitudes of the media and the public. In: Leff, J.: Care in the Community: Illusion or Reality? Wiley, Chichester/New York/Weinheim/ Brisbane/Singapore/Toronto, 145-163 [54] World Psychiatric Association (WPA) (1998): The WPA Global Programme. Against Stigma and Discrimination Because of Schizophrenia (deutsche Übersetzung pro mente Oberösterreich, Linz) [55] Zapotoczky, K. (1989): Zum Krankheitsverhalten bei psychischen Erkrankungen, in: Grausgruber, A. et. al.: Einstellung zu psychisch Kranken und zur psychosozialen Versorgung, 189-205 Dr. Alfred Grausgruber Institut für Soziologie der Johannes-Kepler-Universität Linz, A-4040 Linz, Altenbergerstr. 69, e-mail: [email protected] ORIGINAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 68 – 77 Das Image der Psychopharmaka in der österreichischen Bevölkerung Ullrich Meise1, Alfred Grausgruber2, Heinz Katschnig3 und WernerSchöny4 1Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck 2Institut für Soziologie der Johannes-Kepler Universität, Linz 3Universitätsklinik für Psychiatrie, Wien 4Landesnervenklinik Wagner-Jauregg, Linz Schlüsselwörter Einstellung – Meinungsumfrage – Psychopharmaka – Behandlung Key words Attitudes – Public Opinion – Psychotropic drugs – Treatment Das Image der Psychopharmaka in der Österreichischen Bevölkerung 1998 wurde im Vorfeld zur österreichischen Anti-Stigma Kampagne eine repräsentative Bevölkerungsumfrage (N = 1042) zu schizophrenen Erkrankungen und ihrer Behandlung durchgeführt. Aus dem umfangreichen Fragenkatalog wurden für diese Arbeit nur jene Fragen herangezogen, die sich allgemein auf Wissens- und Einstellungsaspekte gegenüber Psychopharmaka und deren Verabreichung beziehen. Zudem wurde versucht jene Faktoren zu identifizieren, welche im Falle einer psychischen Erkrankung die Bereitschaft ärztlicherseits verordneter Psychopharmaka selbst einzunehmen beeinflussen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass in der Bevölkerung bezüglich Psychopharmaka mangelhafte Kenntnisse bestehen. Eine Liste mit 20 vorgegebenen Statements zur Wirkung von Psychopharmaka sowie verschiedenen Aspekten der Psychopharmakotherapie zeigte, dass die Bewertung positiver Wirkaspekte weder auf Ablehnung noch auf Zustimmung stoßen. Eine deutlichere Zustimmung verzeichneten negative Einstellungsstereotype, die sich auf Wirkdefizite oder mögliche unerwünschte Effekte beziehen. 74 % der Befragten sehen die Pharmakotherapie als „ultima ratio“. Lediglich 31,2 % beantworte- ten die Frage, ob sie im Falle einer Erkrankung vom Arzt verschrieben Psychopharmaka einnehmen würden, mit „ja“. Mittels einer Kovarianzanalyse wurden drei Modelle berechnet, um Faktoren zu identifizieren, die die Bereitschaft zur Einnahme von Psychopharmaka fördern. Durch soziodemographische Merkmale wie auch jenen Variablen, die auf Kenntnisse hinweisen, konnte diese Bereitschaft kaum erklärt werden. Einen guten Erklärungsbeitrag bietet hingegen die Beurteilung einzelner Fragen, die in der zuvor genannten Liste zur Wirkung von Psychopharmaka und verschiedenen Aspekten der Therapie beinhaltet sind. Psychopharmaka werden demnach eher eingenommen, wenn jemand sie als „wirksamste Mittel zur Behandlung psychischer Erkrankungen“ versteht, und der Meinung ist, dass „durch ihre Einführung eine menschenwürdige Behandlung psychisch Kranker erst möglich wurde“. Diese Bereitschaft nimmt ab, wenn jemand der Ansicht ist, dass man mit Psychopharmaka „Patienten nur ruhigstellen kann“, dass Psychopharmaka einen „am Ende noch kränker machen, als man ohnehin schon ist“, und, dass „viele Ärzte lieber Psychopharmaka verschreiben, anstatt auf die Probleme der Patienten einzugehen“. Irritierend in diesem Zusammenhang ist, dass die Bereitschaft zur Einnahme von Psychopharmaka gefördert wird, wenn die Interviewten die Verwendung von Psychopharmaka zur sozialen Kontrolle oder zur allgemeinen Stressreduktion gutheißen. The Image of Psycho-Pharmaceuticals among the Austrian Population In 1998, in the run-up to the Austrian Anti-Stigma Campaign, a representative population questionnaire (N=1042) was carried out concerning aspects of schizophrenic illnesses and their treatment. From the wide reaching catalogue of questions, only those were used which referred to general knowledge and attitude aspects in relation to psycho-pharmaceuticals and their treatment. In connection with this, attempts were made to identify factors which could influence the readiness of the interviewee himself, in the case of mental illness, to take medically prescribed psycho-pharmaceuticals. This research gives an indication that the population is inadequately informed concerning psycho-pharmaceuticals. A list with 20 given statements to the effects of psychopharmaceuticals along with different aspects of psycho-pharmacological therapy shows that positive effects resulted in neither rejection nor acceptance. A clearer acceptance was registered among the negative attitude stereotypes that referred to deficits in effectiveness or undesirable sideeffects. 74 % of those questioned see this method of treatment as „ultima ratio“. Just 31.2 % responded to the question whether they would accept medically prescribed pharmaceuticals in the case of mental illness with „yes“. Using a covariance analysis, three models were calculated to identify those factors which would encourage the readiness to use psychopharmaceuticals. Through sociodemographic variables along with variables that refer to knowledge, the 69 Meise, Grausgruber, Katschnig und Schöny readiness could not be clearly explained. A clearer explanation could be achieved through specific attitude facets from the previously mentioned list concerning the effects of psychopharmaceuticals and different aspects of the therapy. Psycho-pharmaceuticals are more likely to be taken when somebody sees them as the „most effective treatment of a mental illness“, and is of the opinion that „only through their use is a humane and dignified treatment of the mentally ill possible“. This readiness declines when somebody is of the opinion that one „simply pacifies the patient“ with psycho-pharmaceuticals which „will only worsen their illness“ and thinks that „many doctors prefer to prescribe psycho-pharmaceuticals instead of responding to the patient’s problems“. In relation to this it is irritating that the readiness to take psychopharmaceuticals personally increases, if the interviewee perceives their use as being for social control or for general stress reduction. Vorbemerkungen „Das mit psychischer Erkrankung einhergehende Stigma und die negative Diskriminierung treffen nicht nur Patienten und ihre Angehörigen, sondern auch psychiatrische Institutionen, Psychopharmaka, Psychiater und andere in der Psychiatrie Tätige. Grundsätzlich durchdringt das Stigma alles und wirkt schädigend.“ [22]. Vergleicht man die Anzahl der Untersuchungen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten von Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber psychisch Kranken befassen, mit der Zahl von Studien, die auf Einstellungen zur Behandlung – insbesondere zu Psychopharmaka – fokusieren, so zeigt sich, dass dieser wichtige Aspekt bislang stiefmütterlich behandelt wurde. Die wenigen uns vorliegenden Untersuchungen zeigen recht eindrücklich, dass das Image der medikamentösen Behandlung psychischer Erkrankungen in der Bevölkerung schlecht ist. Die in einer Anfang der 70er Jahre publizierten Studie – sie untersuchte die Einstellungen in der Bevölkerung gegenüber Tranquilizern [21] – erhobenen negativen Einstellungsstereotypien sind in nachfolgenden Studien auch gegenüber anderen Gruppen von Psychopharmaka – Antidepressiva und Antipsychotika – anzutreffen [3, 5, 7, 16, 17, 18]. Bis heute ist ein hoher Prozentsatz in der Bevölkerung der Meinung, dass Psychopharmaka schädigen, ja sogar gefährlich sind. Psychopharmaka werden undifferenziert als symptomatisch wirkende Beruhigungsmittel angesehen, die eine zugrundeliegende psychische Problematik lediglich verschleiern oder überdecken; zudem werden ihnen erhebliche Nebenwirkungen und ein hohes Abhängigkeitspotential zugeschrieben; ihre Behandlung oft als „ultima ratio“ gesehen. Angermeyer und Mitarbeiter [2, 3] gingen im Rahmen einer repräsentativen Umfrage für verschiedene psychische Erkrankungen den bestehenden Behandlungspräferenzen in der Bevölkerung nach. Die Zahl der Befragten, die eine Psychopharmakotherapie ablehnten, war mit 41 % doppelt so hoch wie jene, die dieser Behandlung zustimmten. Dabei fanden sie keine Unterschiede für spezifische Erkrankungen oder einzelne Gruppen von Psychopharmaka. Mehr als die Hälfte der Interviewten votierten für eine psychotherapeutische Behandlung; für die Psychopharmakotherapie waren es lediglich 14 %. Die Präferenz für eine Behandlung mit Naturheilmitteln, Meditation oder Yoga war auch für Erkrankungen, wie schizophrene Psychosen, höher als für die Psychopharmakotherapie. Die „Mainzer Studie“ [5] – ebenfalls eine repräsentative Bevölkerungsumfrage zur Akzeptanz von Psychopharmaka – kam u.a. zum Ergebnis, dass im Falle einer HerzKreislauferkrankung der Großteil der Interviewten eine medikamentöse Behandlung für erforderlich erachtet, während im Falle einer psychischen Erkrankung nur eine Minorität der Psychopharmakabehandlung zustimmte. Auch diese Untersuchung kommt zur Erkenntnis, dass die Bevölkerung eine psychotherapeutische Behandlung wesentlich besser akzeptiert bzw. höher bewertet. Psychopharmaka stoßen somit in weiten Bevölkerungskreisen auf große Skepsis; ihnen wird im Gegensatz zur Behandlung mit Medikamenten aus der somatischen Medizin eine negative Nutzen-Risikobilanz zugeschrieben. Andere vergleichbare Studien, die in Österreich [18], der Schweiz [7] oder in Australien [16] durchgeführt wurden, weisen trotz unterschiedlicher methodischer Ansätze in die gleiche Richtung: Die Behandlung mit Psychopharmaka hat in der Bevölkerung ein schlechtes Image [17]. Die Aussagen der Bevölkerung stehen im Widerspruch zur Meinung der Behandler [16] und auch zu den Ergebnissen der „Evidence based Medicine“. Auf Grund dieser Diskrepanz wird die unzureichende Behandlungsbereitschaft und Compliance von Patienten verständlicher [3]. Die nachfolgende Untersuchung beschreibt die Einstellungen der österreichischen Bevölkerung gegenüber Psychopharmaka und geht auch der Frage nach, welche Faktoren auf die Bereitschaft, im Falle einer persönlichen Erkrankung selbst Psychopharmaka einzunehmen, einen Einfluss haben könnten. Methodik Im Vorfeld der österreichischen Anti-Stigma Kampagne [23] wurde eine landesweite Meinungsumfrage zu verschiedenen Einstellungsaspekten schizophrene Erkrankungen und ihre Behandlung betreffend durchgeführt [10]. 1998 wurde dazu eine repräsentative Stichprobe von 1042 Personen mittels face-to-face Interviews befragt. Die Erhebung erfolgte durch ein Meinungsforschungsinsti- 70 Das Image der Psychopharmaka in der österreichischen Bevölkerung tut. Als Grundgesamtheit diente die Wohnbevölkerung über 16 Jahre in Österreich; das zugrundeliegende Auswahlverfahren war ein QuotaVerfahren. Aus dem umfangreichen Fragenkatalog wurden für diese Auswertung nur jene Fragen herangezogen, die sich ganz allgemein auf Wissens- und Einstellungsaspekte gegenüber Psychopharmaka und ihrer Verwendung zur Behandlung beziehen; folgende Fragenbereiche wurden verwendet: 1. Hier auf dieser Liste sind verschiedene Behandlungsmöglichkeiten bei psychischen Krankheiten ganz allgemein angeführt. – Welche der folgenden Maßnahmen kennen Sie zumindestens dem Namen nach? – Und welche der angeführten Möglichkeiten halten Sie für eine gute Behandlungsmethode? 2. Haben Sie schon einmal das Wort Psychopharmaka gehört? – Wenn ja: Können Sie mir ungefähr sagen, was Psychopharmaka sind, was man darunter versteht? 3. Einmal ganz allgemein betrachtet, wie denken Sie über Psychopharmaka, also Medikamente, die bei psychischen Erkrankungen verschrieben werden? Ich lese Ihnen jetzt verschiedene Meinungen vor. Sagen Sie mit bitte anhand dieser Skala, inwieweit Sie mit jeder der Meinungen übereinstimmen oder nicht. 4. Angenommen Sie erkranken und ihr Arzt verschreibt Ihnen Psychopharmaka. Würden Sie die Psychopharmaka einnehmen oder vermutlich eher nicht? Bei der zuvor angesprochenen Liste von Meinungen gegenüber Psychopharmaka (Fragenbereich 3.) handelt es sich um 20 vorgegebene Statements zur Wirkung von Psychopharmaka sowie verschiedenen Aspekten der Psychopharmakotherapie [1, 12]. Jedes Item ist 5-Punkt skaliert mit den Polen „Stimme voll und ganz zu“ (1) und „Stimme überhaupt nicht zu“ (5). (Tabelle 2 und 3) Neben einer deskriptiven Darstellung wurden mittels einer KovarianzAnalyse, jene Faktoren identifiziert, die die Bereitschaft zur Einnahme von Psychopharmaka beeinflussen. Dabei wurde die abhängige Variable „Psychopharmaka nehmen, wenn der Arzt solche verschreibt – oder nicht (incl. weiß nicht)“ dichotomisiert. Es wurden drei Modelle berechnet: • Modell 1: Soziodemographischen Variablen wurden als unabhängige Faktoren – Einflussfaktoren – berücksichtig. • Modell 2: Soziodemographische Variablen und allgemeine Vorstellungen über Psychopharmaka wurden als unabhängige Faktoren – Einflussfaktoren – berücksichtigt. • Modell 3: Soziodemographische Variablen und allgemeine Vorstellungen über Psychopharmaka sowie spezifische Einstellungsfacetten zu Psychopharmaka und ihre Behandlung wurden als unabhängige Faktoren – Einflussfaktoren – berücksichtigt. Ergebnisse Wissen über psychiatrische Behandlungsmethoden: (Fragenbereich 1.) Die Frage, ob die Interviewten eine der aufgelisteten Behandlungsmöglichkeiten bei psychischen Erkrankungen zumindestens dem Namen nach kennen und ob sie diese auch als gute Behandlungsmöglichkeit erachten ergibt, dass spezifische psychotherapeutische Behandlungsverfahren und therapeutische Gespräche neben einem hohen Bekanntheitsgrad auch eine hohe Zustimmung als gute Behandlungsmethode aufweisen (Tab 1). Das Wissen um medikamentöse Behandlung ist deutlich geringer ausgeprägt, was auch auf die Art der Fragenformulierung zurückgeführt werden könnte. Die Frage, „Kennen Sie Medikamente?“, wurde möglicherweise auch so aufgefasst, dass die Interviewten der Meinung sein konnten, spezifische Angaben hinsichtlich der Medikamente machen zu müssen. Trotzdem erachten lediglich 61 % jener, denen Medikamente als Behandlungsme- Tab. 1: Wissen über Behandlungsmethoden bei psychischen Erkrankungen und deren Bewertung Wissen1 % Gute Behandlungsmethode2 % Psychotherapeutische Verfahren (Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, Autogenes Training) 70,8 67,1 Gespräch mit Therpeuten/Psychologen 82,8 65,9 Selbsterfahrungsgruppen 58,8 29,9 Yoga, Meditation, Tai-Chi 62,8 24,8 Medikamente 12,2 7,5 Elektroschockbehandlung 54,9 3,7 Gummizelle, Zwangsjacke 63,0 2,6 1 N = 1027, 2 N = 1021 Meise, Grausgruber, Katschnig und Schöny thode bekannt waren, diese auch als „gute Behandlungsmöglichkeit“. Als Nebenbefund wäre auch auf das schlechte Image, das offensichtlich die EKT-Behandlung in der Bevölkerung genießt, hinzuweisen. Wissen über Psychopharmaka: (Fragenbereich 2.) Den Hinweis auf ein doch bestehendes Kenntnisdefizit bezüglich Psychopharmaka liefert das Ergebnis der direkten Frage, ob die Interviewten schon einmal das Wort Psychopharmaka gehört haben. 39,2 % gaben an, diesen Begriff noch nie gehört zu haben. Auf die nachfolgende Frage, was jene, denen der Begriff Psychopharmaka bekannt war (59,3 %), darunter verstehen, gaben 46,1 % an, dass es sich um Medikamente handle, die die Psyche beeinflussen; 18 % assoziierten mit diesem Begriff Beruhigungsmittel; 17 % bezeichneten sie ganz allgemein als Medikamente und 12 % verbanden damit Medikamente gegen Depression, bewußtseinsverändernde Medikamente oder glaubten, dass es sich um Drogen handle. Beurteilung der Wirkung von Psychopharmaka und Einstellungen zu verschiedenen Aspekten der Psychopharmakotherapie: (Fragenbereich 3.) In Tabellen 2 und 3 sind der Fragenkatalog und die Ergebnisse für Zustimmung und Ablehnung in Form von Prozentwerten und Mittelwerten dargestellt. Von 11 vorgegebenen Aussagen zur Wirkung der Psychopharmaka beziehen sich 5 (Item 1-5) auf positive Aspekte. Die Mittelwerte der Antworten bewegen sich durchwegs im neutralen Bereich; es lässt sich also weder eine eindeutige Zustimmung noch eine eindeutige Ablehnung erkennen. Deutlicher ist jedoch die Zustimmung für negative Einstellungsaspekte, die sich auf Wirkdefizite von Psychopharmaka beziehen (Item 6-8). In Prozentsätzen ausgedrückt bewerten 55 % der Befragten die Aussage „Mit Psycho- pharmaka kann man Patienten nur ruhigstellen.“, mit dem Wert 1 oder 2 der 5-teiligen Skala und stimmen somit mit dieser Ansicht überein. Dem Statement „Nimmt man Psychopharmaka, so sieht man alles durch eine rosa Brille, in Wirklichkeit bleiben die Probleme unverändert bestehen.“, stimmen 65,6 % zu. Ähnlich verhält es sich bei Fragen, die sich auf mögliche unerwünschte Effekte der Psychopharmaka beziehen (Item 911). 72 % der Befragten bewerten die Aussage „Bei Psychopharmaka ist die Gefahr groß, dass man von ihnen abhängig wird“, mit 1 oder 2. Immerhin rund ein Drittel waren der Meinung, dass Psychopharmaka einem am Ende noch kränker machen, als man ohnehin schon ist. Bei den Einstellungen zu verschiedenen anderen Aspekten der Psychopharmakotherapie fällt auf, dass gängige negative Stereotype eine hohe Zustimmung erfahren (Item 12 und 16). 74 % stimmen der Pharmakotherapie als „ultima ratio“ (Item 12) zu; 62,9 % schlossen sich der Meinung an, dass man heute an Stelle der Zwangsjacke Psychopharmaka verwendet. Als überraschendes Ergebnis, das in einem gewissen Widerspruch zum Antwortverhalten bezüglich anderer Aspekte steht, ist zu werten, dass immerhin 50,3 % der Aussage zustimmten, dass durch die Einführung von Psychopharmaka eine menschenwürdige Behandlung psychisch Kranker möglich wurde. Eine hohe Zustimmung fanden auch die Aussagen in Item 18 und 19 mit 70,9 % bzw. 68,1 % Zustimmung. Sie weisen auf vermeintliche oder auch tatsächliche Defizite in Hinblick auf den persönlichen bzw. professionellen Umgang in der Bewältigung und Behandlung von psychischen Störungen hin. Einflussfaktoren auf die Bereitschaft, Psychopharmaka einzunehmen oder nicht:(Fragebereich 4) Die Frage, ob die Interviewten im Falle einer Erkrankung und Verschreibung durch ihren Arzt selbst 71 Psychopharmaka einnehmen würden, beantworteten 31,2 % mit „ja“, 35,3 % mit „eher nein“ und 33,5 % zeigten sich unentschlossen; d.h. sie antworteten mit „weiß nicht“. Mittels einer Kovarianzanalyse wurden 3 Modelle berechnet, um jene Faktoren zu identifizieren, welche die Bereitschaft zur Einnahme von Psychopharmaka, fördern könnten. (Tab 4) • Mit dem Modell 1, in das soziodemographische Variablen als unabhängige Faktoren eingingen, konnte eine Einnahmebereitschaft kaum erklärt werden. Lediglich das Alter und die berufliche Position spielen eine gewisse Rolle. Demnach werden Psychopharmaka eher eingenommen, je älter die Menschen sind und wenn jemand Arbeiter ist. Menschen in der beruflichen Position als Angestellte oder Beamte lehnen eine Psychopharmakaeinnahme eher ab. • Auch mit dem zweiten Modell, in das neben den demographischen Variablen verschiedene auf einen Wissensstand beruhende Vorstellungen zu Psychopharmaka als unabhängige Faktoren Eingang fanden, konnte eine Psychopharmakaeinnahme oder Nicht-Einnahme immer noch kaum erklärt werden. Neben Alter und Berufsposition erweist sich die Nennung von Psychopharmaka als gute Behandlungsmethode bei psychischen Erkrankungen oder die Kenntnis von Psychopharmaka als Medikamente, die die Psyche beeinflussen als relevant. Psychopharmaka werden eher eingenommen, je älter die Menschen sind, wenn jemand Arbeiter ist. Sie werden eher abgelehnt, wenn jemand in leitender Position als Beamter oder Angestellter tätig ist und sie werden eher eingenommen, wenn jemand Medikamente als gute Therapiemöglichkeit bei psychischen Erkrankungen nennt bzw. wenn jemand Psychopharmaka als Medikamente versteht, welche die Psyche beeinflussen. 72 Das Image der Psychopharmaka in der österreichischen Bevölkerung Tab. 2: Beurteilung der Wirkung von Psychopharmaka Bewertung* Mittelwert (SD) 1+2 % 3 % 4+5 % 2,89 (1,19) 26,7 36,2 27,1 2,76 (1,10) 31,1 36,9 22,2 2,65 (1,20) 45,6 32,2 22,2 2,90 (1,16) 37,9 35,0 27,1 5. Der Nutzen der Behandlung mit Psychopharmaka ist viel größer als die damit verbunden Risiken 2,70 (1,04) 32,0 40,3 17,7 6. Die Ursachen seelischer Erkrankungen kann man mit Psychopharmaka gut behandeln 2,94 (1,21) 36,6 32,9 20,5 2,34 (1,06) 55,8 30,7 16,5 2,11 (1,05) 65,6 23,7 10,7 9. Bei Psychopharmaka ist die Gefahr groß, dass man von ihnen abhängig wird 1,93 (1,01) 72,0 20,4 7,6 10. Über längere Zeit eingenommen, führen Psychopharmaka zu bleibenden Hirnschäden 2,88 (1,15) 26,1 35,7 28,2 11. Psychopharmaka machen einen am Ende noch kränker, als man ohnehin schon ist 2,63 (1,13) 33,7 35,9 20,4 1. Psychopharmaka sind die wirksamsten Mittel zur Behandlung seelischer Erkrankungen 2. Psychopharmaka sind das zuverlässigste Mittel,. um bei einer psychischen Erkrankung einen Rückfall zu verhindern 3. Bei schweren psychischen Störungen sind Psychopharmaka das einzig wahre Mittel 4. Will man rasch eine Besserung seelischer Störungen erreichen, nimmt man am besten Psychopharmaka 7. Mit Psychopharmaka kann man Patienten nur ruhigstellen 8. Nimmt man Psychopharmaka, so sieht man alles durch seine rosa Brille. In Wirklichkeit bleiben die Probleme aber unverändert bestehen. * Erhoben anhand einer fünfteiligen Skala von völliger Zustimmung (1) bis völliger Ablehnung (5); Neben Mittelwerten und Standardabweichungen wurden jeweils die Bewertungen 1+2 (Zustimmung), 3 sowie 4+5 (Ablehnung) zusammengezogen und in Prozetsätzen ausgewiesen. 73 Meise, Grausgruber, Katschnig und Schöny Tab. 3: Einstellungen zu verchiedenen Aspekten der Psychopharmakotherapie Bewertung* 12. Psychopharmaka sollte man nur dann nehmen, wenn alles andere nicht geholfen hat 13. Weil es Psychopharmaka gibt, müssen die Patienten heutzutage nur noch kurze Zeit in der psychiatrischen Klinik bleiben 14. Erst durch die Einführung der Psychopharmaka wurde eine menschenwürdige Behandlung psychisch Kranker möglich 15. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Medikamente geben wird, mit denen man schwere seelische Erkrankungen nicht nur behandeln, sondern heilen kann 16. Früher steckte man psychisch Kranke in die Zwangsjacke, heute gibt man ihnen dafür Psychopharmaka 17. Patienten, die sich auffallend und störend verhalten, gehören auf jeden Fall mit Psychopharmaka behandelt 18. Anstatt sich mit ihren Problemen ernsthaft auseinanderzusetzen, greifen die Leute viel zu rasch zu Psychopharmaka 19. Anstatt auf die Probleme der Patienten einzugehen, verschreiben viele Ärzte lieber Pschopharmaka 20. Bei dem Stress heutzutage ist es kein Wunder, wenn viele Leute Psychopharmaka nehmen * Mittelwert (SD) 1+2 % 3 % 4+5 % 1,89 (0.96) 74,0 19,7 6,3 2,65 (1,11) 46,0 34,1 19,9 2,46 (0,99) 50,5 37,2 12,3 2,75 (1,17) 41,8 35,2 27,0 2,09 (0,99) 62,9 29,6 7,5 2,97 (1,21) 34,0 36,5 28,5 1,19 (0,97) 70,9 23,3 5,8 2,03 (1,00) 68,1 24,3 7,6 2,38 (1,10) 55,6 29,3 15,1 Erhoben anhand einer fünfteiligen Skala von völliger Zustimmung (1) bis völliger Ablehnung (5); Neben Mittelwerten und Standardabweichungen wurden jeweils die Bewertungen 1+2 (Zustimmung), 3 sowie 4+5 (Ablehnung) zusammengezogen und in Prozetsätzen ausgewiesen. 74 Das Image der Psychopharmaka in der österreichischen Bevölkerung Tab. 4: Einflussfaktoren auf die Bereitschaft Psychopharmaka einzunehmen oder nicht1 Soziodemografische Merkmale Geschlecht Alter: ältere Menschen Schulbildung Ortsgröße Berufsposition Arbeiter Leitende Angestellte/Beamte Nicht-leitende Angestellte/Beamte Selbstständig Landwirte Modell 1 Modell 2 – +0,7 – – – +0,7 –,07 – – – – +0,7 – – – +0,7 –,06 – – – – – – – – (+0,5) –,07 – – – (+,05) – + – Vorstellungen zu Psychopharmaka gute Behandlungsmethode Kenntnis Begriff „Pschopharmaka“ Psyche beieinflussende Medikamente Einstellungen zu Psychopharmaka* Wegen Stress häufige Einnahme (Item 20) Wirksamste Mittel (Item 1) Erlauben menschenwürdige Behandlung (Item 14) für Auffallende/Störende (Item 17) Machen noch kränker (Item 11) Können nur ruhigstellen (Item 7) Verschreiben statt auf Probleme eingehen (Item 18) Mult. PRE Koeff = R2 +,09 +,08 +,07 +,06 –,08 (–,06) {–,05) ,131 ,212 ,452 Erklärte Varianz 1,7 % 4,5 % 20,4 % F-Wert 2,22 2,79 Zuwachs 1 * • Modell 3 2,8 % 6,72 15,9 % Kovarianzanalyse: (part. corr.coieff; p<0,05, ()p<0,1; + Psychopharmaka eher nehmen, – eher nicht nehmen) unter statistischer Kontrolle von 13 Items, welche nicht signifikante Werte zeigen (Tabelle 2). Im Modell 3 wurden als unabhängige Faktoren neben den soziodemographischen Variablen, allgemeine Vorstellungen über Psychopharmaka auch zusätzlich spezifische Einstellungsfacetten zu Psychopharmaka (Tab 2) berücksichtigt. Nunmehr kann die Bereitschaft, ob jemand Medikamente einnehmen würde oder nicht, relativ gut erklärt werden. Die soziodemographischen Faktoren verlieren an Prägekraft, das Verständnis von Psychopharmaka bleibt relevant, als bedeutend stellen sich spezifische Vorstellung über die Wirkung von Psychopharmaka bzw. andere verschiedene Aspekte der Pharmakotherapie heraus. Der Erklärungszuwachs mit rund 15 %-Punkten ist bemerkenswert. Psychopharmaka werden demnach eher eingenommen, wenn jemand Arbeiter ist und eher abgelehnt, wenn jemand in leitender Position als Ange- stellter oder Beamter tätig ist. Das Gleiche trifft zu, wenn jemand Psychopharmaka als Medikamente versteht, welche die Psyche beeinflussen. Psychopharmaka werden eher eingenommen, wenn jemand – sie als die wirksamsten Mittel zur Behandlung seelischer Erkrankungen versteht, – meint, dass erst durch die Einführung der Psychopharmaka eine menschenwürdige Be- Meise, Grausgruber, Katschnig und Schöny – – – – – handlung psychisch Kranker möglich wurde, der Ansicht ist, dass es bei dem Stress heutzutage kein Wunder sei, wenn viele Leute Psychopharmaka nehmen, der Ansicht ist, dass Patienten, die sich auffallend und störend verhalten, auf jeden Fall mit Psychopharmaka behandelt gehören, nicht der Meinung ist, dass man mit Psychopharmaka man Patienten nur ruhig stellen kann, nicht der Meinung ist, dass anstatt auf die Probleme der Patienten einzugehen, viele Ärzte lieber Psychopharmaka verschreiben und nicht der Meinung ist, dass einen Psychopharmaka am Ende noch kränker machen, als man ohnehin schon ist. Erstaunlich in diesem Zusammenhang ist, dass der Einsatz von Psychopharmaka zur sozialen Kontrolle einen positiven Einflussfaktor auf die Bereitschaft, Psychopharmaka selbst einzunehmen, darstellt. Diskussion Diese und andere Ergebnisse der österreichischen Befragung [10] weisen in dieselbe Richtung, wie jene, die durch repräsentativen Meinungsumfragen in anderen Kategorie A Ländern (gemäß Weltbank) gewonnen wurden [3, 5, 7, 16, 17, 18]. Lediglich etwa ein Drittel der Interviewten gab an, dass sie im Falle einer psychischen Erkrankung bereit wären selbst Psychopharmaka einzunehmen und somit dem ärztlichen Rat zu folgen. Nach dem verwendeten Fragenkatalog erfuhren positive Aussagen zur Wirkung von Psychopharmaka in unserer Befragung eine indifferente und somit höhere Zustimmung, als sie unter Medizin- studenten in der Studie von Hillert und Mitarbeitern anzutreffen war, in der derselbe Fragebogen verwendet wurde [13]. Ähnlich verhielt es sich mit den Fragen, die auf unerwünschte Effekte und Wirkdefizite Bezug nahmen; d.h. die von uns Interviewten stimmten den entsprechenden Statements deutlicher zu als Medizinstudenten in der zuvor genannten Untersuchung. Diese mangelnde Differenzierung oder dieser Widerspruch kann auch auf begrenzte Kenntnisse zurückgeführt werden. Dazu finden sich in unserer Befragung Hinweise. Eine höhere Zustimmung im Falle einer psychischen Erkrankung selbst Medikamente einzunehmen, äußern Personen, die Psychopharmaka als „wirksamste Mittel für die Behandlung psychischer Erkrankung ansehen“ und der Meinung sind, dass „Psychopharmaka erst eine menschenwürdige Behandlung psychisch Kranker ermöglichten“. Verwunderlich ist in diesem Kontext, dass diese Bereitschaft gefördert wird, wenn die Interviewten der Verwendung von Psychopharmaka zur sozialen Kontrolle oder zur allgemeinen Stressreduktion zustimmten Unsere Aussagen hinsichtlich jener Faktoren, die eine Bereitschaft Psychopharmaka einzunehmen positiv beeinflussen, sind limitiert. Auf Grund der spezifisch auf Schizophrenie fokusierten Befragung konnten die persönlichen Erfahrungen mit psychischen Störungen sowie deren Behandlung nicht in verallgemeinerter Form erhoben werden. Eine differenziertere und offenere Einstellung gegenüber Psychopharmaka weisen nach der Literatur Personen auf, die Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen haben, sei es, dass sie selbst oder ein ihnen Nahestehender erkrankt ist oder es war [4, 7, 18]. Folgt man den Ergebnissen jener Untersuchungen, die das Ausmaß des Psychopharmakagebrauches erhoben haben, so zeigt sich, dass die Anzahl jener, die Psychopharmaka einnehmen, mit 6 bis 15 % der Gesamtbevölkerung relativ hoch ist [11]. 75 Davon werden von einem erheblichen Prozentsatz Psychopharmaka gegen psychosozialen Stress eingesetzt, wobei sich viele selbst behandeln und keine psychische Erkrankung im engeren Sinne aufweisen. Zum einen könnte dadurch die zuvor angesprochene positive Korrelation zwischen Einnahmebereitschaft und der Zustimmung zur Aussage, „dass es beim heutigen Stress kein Wunder ist, dass viele Leute Psychopharmaka einnehmen“, erklärbarer werden. Zum anderen wundert es nicht, dass unter dieser Umständen das Bild der Psychopharmaka vom Wirk- und Nebenwirkungsprofil der Tranquilizer und Sedativa geprägt wird [3]. Trotz methodischer Unterschiede ist der Tenor in entsprechenden Untersuchungen gleichlautend; in der Bevölkerung besteht gegenüber Psychopharmaka große Skepsis. Explizit weist die Untersuchung von Jorm und Mitarbeiter darauf hin, dass zwischen Lehrmeinungen der Psychiatrie und den Meinungen in der Bevölkerung eine große Kluft besteht [16]. Diese Diskrepanz zwischen der Sicht der Experten und jener der Bevölkerung (die in einem hohen Ausmaß Psychopharmaka ablehnt, ihnen eine fehlende kausale Wirksamkeit und hohe Nebenwirkungsrate attestiert) ist ein Problem, da dadurch die Behandlungsbereitschaft und Compliance von Patienten beeinflusst werden muss. Dieser Gesichtspunkt wurde in der Complianceforschung bislang kaum berücksichtigt [3]. Unter diesem Blickwinkel kann die Non-Compliance von Patienten als eine rationale Entscheidung angesehen werden, wenn sie auf Grund eines mangelnden Vertrauens auf die Wirksamkeit der Medikamente, deren vermeintlich negativen Nutzen-Risikobilanz und dem negativen Meinungsbild in der Bevölkerung eine Psychopharmakaeinnahme ablehnen [6]. Patienten sind Teil des sozialen Systems und es ist zu erwarten, dass sie sich den vorherrschenden Einstellungen nicht entziehen können. 76 Das Image der Psychopharmaka in der österreichischen Bevölkerung Was sind mögliche Gründe, dass in einer Gesellschaft, die über ein hohes Bildungsniveau verfügt, offensichtlich in allen Schichten das Meinungsbild über Psychopharmaka von negativen Stereotypien geprägt ist? Warum konnte die Transformation von „Evidence Based Medicine“, „Expertenkonsensus“ oder dem „State of the Art“ der Behandlung in das Alltagswissen bisher nicht in erwünschtem Ausmaß erfolgen? Nachfolgend einige Überlegungen, zu möglichen kognitiven und affektiven Dimensionen, die mit verantwortlich sein können, dass sich Einstellungen und Vorurteile gegenüber Psychopharmaka, wie sie zuvor beschrieben wurden, so hartnäckig halten. Umfrangreiche Medienanalysen [13, 14, 15] bestätigen, dass sowohl meinungsführende Tages- oder Wochenzeitschriften wie auch Boulevardblätter und Magazine im deutschsprachigen Raum Psychopharmaka durchwegs negativ porträtieren. Diese Medikamente werden im Gegensatz zu Medikamenten aus der somatischen Medizin vorzüglich durch Nebenwirkungen und Abhängigkeit charakterisiert. Psychische Erkrankungen oder die Indikation dieser Behandlung werden kaum erwähnt; Differenzierungen welche Medikamente gegen welche Erkrankung und warum verordnet werden, werden kaum vorgenommen. Häufig ist die Berichterstattung einseitig oder von Emotionalität geprägt: Psychopharmaka werden in begriffliche Nähe zu Gewalt, Zwang, Fehlbehandlung und anderem mehr gestellt. Das Bild der Psychopharmaka wird stark von Missbrauch und den Gefahren der Tranquilizer geprägt [2]. Folgt man den Äußerungen von Niklas Luhmann [15] „Was wir über unsere Gesellschaft, ja die Welt in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien“, wird deutlich, dass diese in der Vermittlung unseres Alltagswissens eine zentrale Rolle spielen. Auf der anderen Seite sind die Medien auch von den vorherrschenden Vorurteilen beeinflusst, die sie oft lediglich widerspiegeln. Es gehört zum Wesen eines Vorurteiles, dass richtige Informationen ignoriert, nicht wahrgenommen oder verleugnet werden und einseitiges oder falsches Wissen nicht abgelehnt wird. In der Bevölkerung werden psychische Erkrankungen häufig ausschließlich auf ungelöste Konflikte, Stress und ähnliches zurückgeführt [8]. Dieses Krankheitsmodell ist einseitig psychologisch/psychodynamisch ausgerichtet; demgemäß ist das Behandlungsmodell ein psychotherapeutisch dominiertes, das zumeist aber ein psychoanalytisches ist[3]. So gesehen kann die Gegnerschaft gegenüber den Psychopharmaka auch Symbol für den Widerstand gegenüber Medizin und Psychiatrie sein, die häufig ein neurobiologisch dominiertes Krankheits- und Behandlungskonzept vermitteln. Neben der „kognitiven Dimension“, die den Stellenwert des Wissens auf die Einstellungsbildung und das Verhalten berücksichtigt, bezieht sich die „affektive Dimension“ auf positive oder negative Emotionen. Dieser Dimension wird eine zentrale Rolle in der Einstellungs- und Vorurteilsbildung zugeschrieben [9]. Demnach können neben rationalen, die Einstellung zu Psychopharmaka negativ beeinflussenden Faktoren, wie z.B. das Wissen über Nebenwirkungen [4], auch unbegründete Ängste und daraus resultierende Abwehrprozesse dazu beitragen, dass das bestehende Meinungsbild in der Bevölkerung verfestigt bleibt. Psychopharmaka werden häufig in gleicher Weise wie psychische Erkrankungen bewertet, wobei psychische Erkrankungen in der Regel als starke Bedrohung der Persönlichkeit erlebt werden. Durch sie werden Identität, psychische Integrität, Selbstkontrolle, Selbstwert oder der soziale Status als in Frage gestellt erachtet; ähnliches wird auch den Psychopharmaka zugeschrieben. [8]. Katschnig [19] hat in diesem Zusammenhang bemerkt, dass die Freud’sche Idee der dritten koperni- kanischen Kränkung des Menschen durch die Psychoanalyse auch auf die Psychopharmaka angewendet werden könnte. Ein weiterer Aspekt der die Abneigung gegenüber Psychopharmaka verstärken könnte, liegt in einem, wie es Klerman formuliert hat, „pharmakologischen Calvinismus“ [19]; einer in unserer Kultur verankerten Haltung, die uns abverlangt, Probleme ohne „Hilfsmittel“ nur durch eigene Anstrengung lösen zu müssen. Zusammenfassend ist es erforderlich, dass neben Maßnahmen die zur Verbesserung von sachlichen und verständlichen Information beitragen, auch die bestehenden emotionalen Vorbehalte thematisiert werden. Grundsätzlich sollten Krankheitskonzepte vermittelt werden, denen ein mehrdimensionaler Erklärungsversuch psychischer Erkrankungen zu Grunde liegt. Durch einen daraus zwangsläufig resultierenden biopsycho-soziale Behandlungsansatz, nach dem jeweils beim Einzelnen bedürfnisorientiert und flexibel eine Gewichtung von pharmakologischen und non-pharmakologischen Behandlungsverfahren erfolgt, könnte die bestehende Diskrepanz zwischen der Expertenmeinung und der öffentlichen Meinung gegenüber Psychopharmaka mit der Zeit wahrscheinlich aufgelöst werden [20]. Generell sollte auch die pharmazeutische Industrie den Fokus ihrer Öffentlichkeitsarbeit nicht nur auf die Experten sondern auch auf die Konsumenten und die Allgemeinbevölkerung richten. Danksagung Diese Studie wurde durch nachfolgende, in alphabetischer Reihenfolge angeführte Firmen der Pharmazeutischen Industrie ermöglicht, wofür wir Ihnen herzlichst danken möchten: • ASTRAZENECAÖsterreich GmbH • ELI LILLY GmbH 77 Meise, Grausgruber, Katschnig und Schöny • • • JANSSEN-CILAG Pharma GmbH LUNDBECK Arzneimittel GmbH NOVARTIS Pharma GmbH rapie und Psychotherapie in der Psychiatrie – Eine repräsentative Bevölkerungsumfrage. ZNS-Journal 21, 22-31 (2000). [1] [2] Angermeyer M., H. Matschinger, J. Sandmann, A. Hillert: Die Einstellung von Medizinstudenten zur Behandlung mit Psychopharmaka. Psychiat. Prax. 21, 58-63 (1994). Angermeyer M.: Einstellung der Bevölkerung zu Psychopharmaka; in Naber K., F. Müller-Spahn: Clozapin, Pharmakologie und Klinik eines atypischen Neuroleptikums. Springer, Heidelberg 113-123 (1994). [3] Angermeyer M, H. Matschinger: Public attitude towards psychiatric treatment. Acta Psychiatr Scand 94, 326-336 (1996). [4] Angermeyer M, H. Matschinger: Neuroleptika im Urteil der Angehörigen. Psychiat. Prax. 16, 171-174 (1999). [5] Benkert O, H. Kepplinger, K. Sobota: Psychopharmaka im Widerstreit. Eine Studie zur Akzeptanz von Psychopharmaka – Bevölkerungsumfrage und Medienanalyse. Springer, Berlin Heidelberg New York (1995). [6] [7] [8] DiMatteo M., R. Reiter, J. Gambone: Enhancing medication adherence through communication and informed collaborative choice. Health Commun 6, 253-265 (1994). Fischer W., D. Goerg, E. Zbinden, J. Guimón: Determining Factors and the Effects of Attitudes towards Psychotropic Medication. In: Guimón J, W. Fischer, N. Sartorius Ed: The Image of Madness. Karger, Basel 1999. Graf-Morgenstern M, O. Benkert: Urteile und Meinungen zur Pharmakothe- [18] Katschnig H, E. Etzersdorfer, M. Muzick: "Nicht nur eine minderwertige Gesundheit...”. Eine Untersuchung über die Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu psychisch Kranken und zur Psychiatrie. Forschungsbericht Wien, (1992). [19] Katschnig H.: Die Manisch-depressive Krankheit und die Überwindung der drittten kopernikanischen Kränkung des Menschen. In: Vasak G., H. Katschnig: Sturzfliegen. Leben in Depressionen und Manien. R& R Sachbuchverlag, Zürich 2001. [20] Hillert A, J. Sandmann, M. Angermeyer, R. Däumer: Die Einstellung von Medizinstudenten zur Behandlung mit Psychopharmaka. Teil 2: Der Wandel der Einstellung im Verlauf des Studiums. Psychiat. Prax. 21, 64-69 (1994). Katschnig H., H. Donat, W. W. Fleischhacker, U. Meise: 4 x 8 Empfehlungen zur Behandlung von Schizophrenie. edition pro mente, Linz (2002) [21] Hillert A., Sandmann J., S. Ehmig, H. Weisbecker, K. Sobota, H. Kepplinger, O. Benkert: Psychopharmaka in den Medien. Nervenarzt 66, 835-844 (1995). Manheimer D., S. Davidson, M. Balter, G. Mellinger, I. Cisin, H. Parry: Popular attitudes and beliefs about tranquilizers. Am J Psychiatry 130, 1246-1253 (1973). [22] Sartorius N.: Eines der letzten Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankungen. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 5-10 (2002). [23] Schöny W.: Schizophrenie hat viele Gesichter: Die österreichische Kampagne zur Reduktion des Stigmas und der Diskriminierung wegen Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 48-53 (2002). [9] Grausgruber A., W. Schöny: Einstellung zu psychisch Kranken. Neuropsychiatrie 9: 123-129 (1995). [10] Grausgruber A., H. Katschnig, U. Meise, W. Schöny: Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 54-67 (2002). Literatur [11] [12] [13] [14] Guimón J., W. Fischer, D. Goerg, E. Zbinden: Use and Misuse of Pharmacological Substances: The Question of Noncompliance. In: Guimón J., W. Fischer, N. Sartorius Ed: The Image of Madness. Karger, Basel 1999. Hoffmann-Richter U, F. Wick, B. Alder, A. Finzen: Neuroleptika in der Zeitung. Psychiat. Prax. 26, 175-180 (1999). [15] Hoffmann-Richter U: Psychiatrie in der Zeitung. Edition Das Narrenschiff Psychiatrie-Verlag, Bonn (2000). [16] Jorm A., A. Korten, P. Jacomb, B. Rodgers, P. Pollitt, H. Christensen, S. Henderson: Helpfulness of interventions for mental disorders: beliefs of health professionals compared with the general public. Brit. J. of Psych. 171: 233-237 (1997). [17] in Psychiatry. Problems, resources, responses. Cambridge University Press 1999. Jorm A., M. Angermeyer, H. Katschnig: Public knowledge of and attitudes to mental disorders: a limiting factor in the optimal use of treatment services. In: Andrews G., S. Henderson: Unmet need A. Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise ARGE-Versorgungsforschung Univ.-Klinik für Psychiatrie Anichstraße 35 A-6020 Innsbruck email: [email protected] ORIGINAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 78 – 86 Perspektivenwechsel: Stigma aus der Sicht schizophren Erkrankter, ihrer Angehörigen und von Mitarbeitern in der psychiatrischen Versorgung Beate Schulze und Matthias C. Angermeyer Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Leipzig Schlüsselwörter Stigma – Schizophrenie – subjektive Erfahrungen Key words stigma – schizophrenia – subjective experiences Perspektivenwechsel: Stigma aus der Sicht schizophren Erkrankter, ihrer Angehörigen und von Mitarbeitern in der psychiatrischen Versorgung Die Schizophrenie zählt zu den am meisten stigmatisierten Erkrankungen. Die Stigmaforschung hat vorrangig aus den Ergebnissen von Einstellungserhebungen oder analogen Verhaltensexperimenten Schlüsse auf das von schizophren Erkrankten erlebte Stigma gezogen. Die Perspektive derer, die den stigmatisierenden Reaktionen ausgesetzt sind, blieb bei der Untersuchung des Stigma-Prozesses und seiner Konsequenzen jedoch bislang weitgehend vernachlässigt. Mit dem Ziel, Stigma aus der subjektiven Sicht der schizophren Erkrankten und ihrer Angehörigen zu untersuchen, wurde an den vier in Deutschland am Anti-Stigma-Programm des Weltverbandes für Psychiatrie beteiligten Zentren eine Fokusgruppenstudie durchgeführt. Schizophren Erkrankte und ihre Angehörigen wurden zu ihren konkreten Stigmatisierungserfahrungen befragt. Zusätzlich wurde die Sicht von Mitarbeitern in der psychiatrischen Versorgung auf das Stigma schizophren Erkrankter erfragt. Die Fokusgruppen wurden auf Tonband und Video aufgezeichnet, transkribiert und mittels eines computergestützten qualitativen Analyseverfah- rens ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen 4 Dimensionen des Stigmaerlebens: interpersonelle Interaktion, strukturelle Diskriminierung, das Bild psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit, und Zugang zu sozialen Rollen. Die vier Dimensionen werden aus der Sicht der Patienten und Angehörigen dargestellt und mit der Perspektive der psychiatrischen Fachkräfte verglichen. Unterschiede in der Einschätzung der Situation unterstreichen, dass die subjektive Sicht der Betroffenen sowohl in der Stigmaforschung als auch bei der Planung und Umsetzung von Anti-Stigma Interventionen verstärkt einbezogen werden sollte. Changing perspectives: Stigma from the point of view of people with schizophrenia, their families and of mental health professionals Schizophrenia has been found to be one of the most stigmatising conditions. To the present, most research on stigma related to mental illness has drawn conclusions on the adverse reactions faced by people with schizophrenia from studies on public attitudes or analogue behavioural studies. The views of those exposed to the stigmatising reactions, however, has largely been absent from attempts to understand the stigma process and its consequences. Aiming to explore stigma from the subjective perspective of people with schizophrenia and their relatives, a focus group study was carried out at the 4 centres involved in the WPA Global Programme against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia in Germany. People with schizophrenia and their relatives were asked about concrete stigmatisation experiences. In addition, the perspective of mental health professionals on the stigma of schizophrenia was enquired. Focus group sessions were tape- and videorecorded, transcribed and analysed by means of a computer-based procedure for qualitative content analysis. Results reveal four dimensions of stigma: interpersonal interaction, structural discrimination, public images of mental illness and access to social roles. The dimensions are described from the perspective of patients and relatives and compared with the views of mental health professionals. Differences in the perceptions of the groups emphasize the importance of taking account of the subjective experiences of those affected by the illness – both in stigma research and in the design and implementation of anti-stigma interventions. Einleitung Das Erleben einer Schizophrenie umfasst nicht allein die psychotische Symptomatik. Vielmehr geht es einher mit einer „zweiten Krankheit“ [4]: den Reaktionen der Umwelt auf die Erkrankung, dem mit ihr verbundenen Stigma. Die Diagnose Schizophrenie hebt jene, die unter der Krankheit leiden aus der Allgemeinheit heraus und verbindet sie mit negativen Eigenschaften: man hält sie für aggressiv, gefährlich, unvernünf- 79 Schulze und Angermeyer tig, beängstigend, weniger intelligent als den Durchschnitt der Bevölkerung, und sieht in der Krankheit den Ausdruck mangelnder Disziplin und Selbstkontrolle [1]. Diese Stereotypen werden im Kontakt mit anderen aktiviert. In der Folge erfahren schizophren erkrankte Menschen häufig Ablehnung – ihre soziale Umwelt begegnet ihnen mit Unsicherheit und Unverständnis oder sucht sie zu vermeiden. Ein Großteil der Bevölkerung würde es ablehnen, mit einem schizophren Erkrankten eine Wohnung zu teilen, ihn für eine Stelle zu empfehlen oder ihn mit der Betreuung von Kindern zu betrauen [2]. Der Stigmatisierungsprozess beginnt damit, dass ein Unterschied wahrgenommen und benannt wird. In der Folge wird das vergebene Etikett, wie z. B. die Diagnose Schizophrenie, mit negativen, kulturell geprägten Vorurteilen entstammenden Eigenschaften verbunden. Diese negativen Stereotypen dienen wiederum als Rechtfertigung, um die etikettierten Personen aus der Allgemeinheit herauszulösen: sie werden zu einer Kategorie zusammengefasst („die Schizophrenen“) und erfahren in der Konsequenz eine Herabsetzung ihres sozialen Status und Diskriminierung [16, 17]. In der Stigmaforschung wurde der Versuch unternommen, den Prozess der Stigmatisierung näher zu beleuchten. Bisher jedoch basierte die wissenschaftliche Untersuchung von Stigma fast ausschließlich auf den von der Soziologie und Sozialpsychologie entworfenen theoretischen Konzepten [7, 8, 3, 5]. Das subjektive Erleben von Stigma und seinen Folgen durch die Betroffenen spielte dabei kaum eine Rolle. Die meisten empirischen Studien zum Stigma psychischer Erkrankungen untersuchten seine Auswirkungen für die Erkrankten selbst nur indirekt: aus den Einstellungen der Bevölkerung [20, 24, 10, 11, 26]), der gewünschten sozialen Distanz gegenüber psychisch Kranken [2], analogen Verhaltensexperimenten (e.g. [6, 21]) oder der Wahrnehmung vorherrschender negativer Vorstellungen in der Bevölkerung durch psychisch Erkrankte [14, 15] wurden Rükkschlüsse auf das Stigmaerleben der Betroffenen gezogen. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten zum Thema untersucht die hier vorliegende Studie Stigma explizit aus der subjektiven Perspektive schizophren Erkrankter und ihrer Angehörigen. Anhand konkreter Stigmatisierungserfahrungen wurde exploriert, wie negative Stereotypen und Diskriminierung sich auf den Alltag der Betroffenen auswirken und wie sich Stigma aus ihrer Sicht definiert. Weiterhin interessierte uns, inwieweit sich die Erfahrungen der Erkrankten und ihrer Angehörigen von der Sichtweise psychiatrischer Experten und Mitarbeitern in der psychiatrischen Versorgung auf das Stigma der Schizophrenie unterscheiden. Fokusgruppen wurden drei Themenschwerpunkte angesprochen: Konkrete Stigmatisierungserfahrungen, Vorstellungen zu den Ursachen der Stigmatisierung und Vorschläge zum Abbau von Stigma und Diskriminierung. Gegenstand dieser Arbeit ist die Darstellung der Stigmatisierungserfahrungen. Die Fokusgruppen wurden auf Tonband und Video aufgezeichnet, transkribiert und einer computergestützten, qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring unterzogen (s. [18, 12, 13]). Die Kodierung erfolgte durch induktive Kategorienbildung aus den Transkripten und hatte zum Ziel, eine Typologie der Stigmatisierungserfahrungen zu entwickeln. Ergebnisse Die häufigsten Stigmatisierungserfahrungen Methode Im Rahmen des von der World Psychiatric Association initiierten Programms „Reducing Stigma and Discrimination because of Schizophrenia“ [22] wurde in den vier in Deutschland am Programm beteiligten Regionen (München, Leipzig, Düsseldorf und Kiel/Hamburg/Itzehoe) eine Fokusgruppenstudie durchgeführt. Fokusgruppen sind Gruppeninterviews mit 5 – 12 Teilnehmern. Der Moderator regt eine Reihe von Themen (Foci) für die Diskussion an und sorgt dafür, dass sich die Diskussion nicht von Gegenstand des Interviews entfernt [19]. Im Rahmen dieser Studie wurden insgesamt zwölf Fokusgruppen durchgeführt: jeweils eine mit schizophren Erkrankten, eine mit Angehörigen und eine mit Mitarbeitern der psychiatrischen Versorgung in jeder der vier am WPA-Projekt beteiligten Regionen [s. 23]. In den Wie wird die Stigmatisierung von den Betroffenen und Angehörigen erlebt? Welche negativen Erfahrungen machten sie, die auf das Wissen ihrer Umwelt um die Erkrankung zurückzuführen sind? Insgesamt wurden von den Patienten und Angehörigen 457 konkrete Stigmatisierungserfahrungen genannt (Abb1.). Am häufigsten beschrieben die Befragten Situationen, in denen sie soziale Ausgrenzung, den Rükkzug von Freunden, Verwandten und Kollegen erlebten und auf Unverständnis in ihrer Umwelt stießen (16,7 %). In 11,3 % aller Fälle sprachen die Fokusgruppenteilnehmer von Stigmatisierung durch Ärzte und andere Mitarbeiter in der psychiatrischen Versorgung. Die mangelnde Qualität der psychiatrischen Versorgung wurde in 11 % aller Stigmaerlebnisse von den Befragten als stigmatisierend erlebt, besonders im Vergleich mit der Versorgungsqualität im somatischen Bereich. 8,9 % aller 80 Perspektivenwechsel: Stigma aus der Sicht schizophrener Erkrankter ... Stigmatisierungserfahrungen bezogen sich auf berufliche Desintegration infolge der Erkrankung. Ebenfalls 8,9 % der Nennungen betrafen Schuldzuweisungen an die Angehörigen bzw. die Zuschreibung eigener Verantwortung für die Erkrankung durch behandelnde Psychiater oder im Verwandten- und Bekanntenkreis. Besonders häufig hierbei waren die noch immer bemühte Theorie von der schizophrenogenen Mutter und Kommentare an die Betroffenen, man müsse sich nur ein bisschen zusammenreißen, wie zum Beispiel „Es ist ja kein Wunder, dass es dir so schlecht geht, du lässt dich ja total hängen, du bist selber Schuld, du bist ja gar nicht krank, du bist ja nur zu faul und lauter solche Sachen“. (Herr B., seit fünf Jahren schizophren erkrankt) Die Liste der häufigsten Stigmatisierungsformen aus der Sicht der Erkrankten und Angehörigen enthält außerdem negative Mediendarstellungen psychischer Krankheit (6,8 %), Unwissenheit und Informa- tionsmangel in der Bevölkerung (6,2 %), Unsicherheit und Angst (5,9 %), die Verheimlichung der Krankheit aufgrund antizipierter Stigmatisierung (4,1 %) sowie Benachteiligungen durch den unterschiedlichen Stellenwert psychischer und somatischer Erkrankungen (4,1 %). Diese zehn Kategorien beinhalten 85 % aller genannten Erfahrungen. anderen gemacht. Für die meisten Befragten – und dies betrifft sowohl die Erkrankten als auch ihre Angehörigen – führte das Bekanntwerden der schizophrenen Erkrankung zu einer Reduzierung sozialer Kontakte. Frau C., die seit 15 Jahren unter Schizophrenie leidet, beschreibt die Reaktionen ihrer Nachbarn auf ihren zweiten Klinikaufenthalt aufgrund einer psychotischen Episode wie folgt: Dimensionen der Stigmatisierung „Und dann habe ich auch meiner Nachbarin wieder Bescheid gesagt, dass ich wieder in die Klinik muss. Und wie es dann mit der Treppe wäre und dann sagte die: „Ach schade um die Wohnung.“ und bummste die Tür zu. Also da war ich völlig schockiert ... und das Verhältnis wie sie zu mir waren, war auch so ganz anders. Ich meine, ich wusste doch wie wir jahrzehntelang zusammen waren, in Urlaub gefahren sind, wie wir miteinander gesprochen haben und zueinander waren. Das war ganz, ganz anders. ...und das tat so weh.“ (Frau C., lebt seit 15 Jahren mit einer schizophrenen Erkrankung) Aus der Sicht der Erkrankten und Angehörigen fanden wir vier Dimensionen des mit der Schizophrenie verbundenen Stigmas: interpersonelle Interaktion, strukturelle Diskriminierung, das Bild psychisch Erkrankter in der Öffentlichkeit und erschwerter Zugang zu sozialen Rollen (Abb.2). Die erste Dimension, interpersonelle Interaktion, bezieht sich auf Stigmatisierung, die im Kontext sozialer Beziehungen erlebt wurde. 48% aller Stigmatisierungserfahrungen werden in direkter Interaktion mit Abb. 1: Die 10 häufigsten Stigmatisierungserfahrungen 16,7 Ausgrenzung/Rückzug/Unverständnis Umgang der Professionellen mit Betroffenen und Angehörigen 11,3 Qualität der psychiatrischen Versorgung 11 Berufliche Desintegration 8,9 Schuldzuweisungen/eigene Verantwortung 8,9 6,8 Negative Mediendarstellungen 6,2 Unwissenheit/Informationsmangel 5,9 Unsicherheit und Angst Verheimlichung der Krankheit 4,1 Differenzieurng zwischen psychischen und somatischen Erkrankungen 4,1 (n = 457) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 81 Schulze und Angermeyer Mehreren Befragten blieben außerhalb der „Psychiatrieszene“ keine sozialen Kontakte mehr. Die Erkrankten und Angehörigen gaben übereinstimmend an, dass Menschen, die selbst oder im Bekanntenkreis keine psychischen Erkrankungen erlebt haben, schizophrenen Patienten wenig Verständnis entgegenbringen. Darüber hinaus berichteten die Befragten, dass Freunde und Bekannte an Informationen über die Krankheit wenig interessiert seien. Die Erkrankten und Angehörigen betonten, dass die Schizophrenie in der Öffentlichkeit nicht als Krankheit anerkannt ist. Ein Kontakt mit der Psychiatrie führe dazu, dass die Person des Erkrankten darauf reduziert wird „verrückt zu sein, unzurechnungsfähig, jemand, dem man nicht trauen kann“. Sie schilderten, dass jede Auffälligkeit der Krankheit zugeschrieben und ihnen mit Misstrauen begegnet wurde: „Vor allen Dingen auch wenn ich etwas erzählte. Da wurde immer noch einmal gefragt, ob das auch wirklich stimmte und dann noch einmal gefragt und so.“ (Frau D., schizophren erkrankt) In den Augen der befragten Patienten und Angehörigen ist das mit der Schizophrenie verbundene Stigma auf Wissensmangel über die Erkrankung zurückzuführen. Noch wesentlicher seien Unsicherheit und Ängste im Umgang mit den Betroffenen und der Krankheit für die Stigmatisierung verantwortlich. Wie eine Angehörige schildert: „Unsicherheit würde ich sagen, sehr viel Unsicherheit. Also, ich merke das also im Freundeskreis, dass sie, also, auch jetzt, meinetwegen nach drei vier Wochen Rückmeldungen kommen, dass sie sagen, ja wir wissen da gar nicht recht mit umzugehen, wir bemühen uns jetzt auch mal was nachzulesen und jetzt stellen wir erst mal fest, was es doch alles für Richtungen gibt und wie viel Facetten diese Krankheit hat ... Im Grunde was uns eigentlich ein bisschen enttäuscht, ist so diese Unsicherheit auch unserem Sohn gegenüber, dass sie, wir müssen sie fast auffordern und sagen, ja ruf doch mal an. Was sollen wir denn jetzt zu ihm sagen, was sollen wir denn fragen?“ (Frau A., hat einen schizophren erkrankten Sohn) noch mal bestätigen, was vorher schon gesagt worden ist, zum Teil verweigert werden. Also, ich kenne in einer Psychiatrie hier einen Oberarzt, der hat gesagt, er redet mit den Angehörigen grundsätzlich nicht und bei Ihnen werde ich auch keine Ausnahme machen.“ (Frau G., zwei ihrer Kinder haben eine schizophrene Erkrankung) Die Mehrzahl der Befragten war sich einig, dass eine akute psychotische Episode genüge, um als „verrkckt“ eingestuft zu werden. Das Stigma wiederum präge die soziale Identität und die Wahrnehmung der Betroffenen in den verschiedensten Interaktionssituationen. Außerdem wurde über konkrete Fälle von Diskriminierung berichtet. So erlebten die schizophren Erkrankten Schwierigkeiten mit Vermietern bis hin zur Kündigung des Mietverhältnisses nach Bekanntwerden der Krankheit. In manchen Fällen wurden sie Fehlverhaltens und krimineller Handlungen bezichtigt. Patienten berichteten, in ihrer Ungebung häufig als „Sündenböcke“ zu dienen und als erste für Missverhältnisse verantwortlich gemacht zu werden. Stigmatisierung im Kontakt mit professionellen Helfern und im Kontext der Behandlung war die zweithäufigste Form des im Bereich der interpersonellen Interaktion. Besonders die Angehörigen schilderten häufig, auf Ablehnung von Seiten der behandelnden Psychiater zu stoßen und von der Behandlung ausgeschlossen zu sein. Oft träfe man in der psychiatrischen Versorgung noch auf die Vorstellung, dass falsche Erziehung für die Entstehung der Krankheit verantwortlich sei. Frau G., deren Tochter an Schizophrenie erkrankt ist, schildert ihre Erfahrung wie folgt: Die Erkrankten fühlten sich in Ihrer Beziehung zu den Ärzten in der Klinik vor allen dadurch stigmatisiert, dass man ihrer Person und der Vorgeschichte ihrer Erkrankung wenig Interesse entgegenbrachte und ihre Bedürfnisse und Sichtweisen nicht ernst nahm. Dies war besonders der Fall, wenn die Erkrankten aufgrund von somatischen Beschwerden in Behandlung waren. Darüber hinaus wurde erlebt, dass das Wissen um die psychische Erkrankung des Patienten dazu führte, dass körperliche Beschwerden weniger ernst genommen wurden oder gleich eine Überweisung in die Psychiatrie veranlasst wurde. Ein weiterer Faktor, der als stigmatisierend erlebt wird und die sozialen Beziehungen der Erkrankten negativ beeinflusst sind Nebenwirkungen der Medikamente wie z.B. extrapyramidale Störungen und Gewichtszunahme. Diese sichtbaren Zeichen der Krankheit (oder der Tatsache, dass man sich in psychiatrischer Behandlung befindet) werden in der Öffentlichkeit negativ bewertet und bringen den Betroffenen in Verbindung mit allen mit psychischer Krankheit assoziierten negativen Attributen. Dies veranlasste Patienten, Kontakte zu anderen zu vermeiden, da sich die Krankheit nun nicht mehr verbergen ließ und somit kein wirksamer Schutz mehr vor den antizipierten ablehnenden Reaktionen bestand. Der zweite Bereich, in dem Stigmatisierung erlebt wird ist die strukturelle Diskriminierung. 21 % aller Stigmatisierungserfahrungen waren „..dann ist man so ganz beschissen dran, sage ich jetzt mal, wenn man von der Klinik keine Information hat und auch die Gespräche dort, ich muss das auch Perspektivenwechsel: Stigma aus der Sicht schizophrener Erkrankter ... auf Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichte in gesellschaftlichen Strukturen, politischen Entscheidungen und gesetzlichen Regelungen zurükkzuführen. Dabei wird die Qualität der psychiatrischen Versorgung als stärkste Form der strukturellen Diskriminierung wahrgenommen. Patienten und Angehörige erleben gleichermaßen einen Mangel am gemeindenahen Versorgungseinrichtungen. In diesem Zusammenhang wird besonders die Notwendigkeit ambulanter Krisendienste hervorgehoben und der Wunsch zum Ausdruck gebracht, die Prävention psychischer Krisen stärker in den Vordergrund zu stellen, anstatt den Schwerpunkt allein auf die stationäre Akutversorgung zu legen. Die Erkrankten fühlten sich auch durch den Eindruck stigmatisiert, dass es nur eine Standardbehandlung für jedermann gibt. In den Augen der Befragten wird individuellen Bedürfnissen und persönlichen Lebensgeschichten innerhalb ihrer Behandlung nicht genug Raum gegeben. Pauschalisierende Aussagen von Psychiatern wie z.B. „Sie haben Schizophrenie. Sie werden für den Rest Ihres Lebens krank sein.“ seien auch heute noch an der Tagesordnung. Die Situation der psychiatrischen Versorgung wird teilweise durch die unausgewogene Verteilung von Ressourcen im Gesundheitswesen verursacht. Nach Meinung der Befragten ist der psychiatrische Bereich in Debatten über Ausgaben benachteiligt. Die ihm zur Verfügung stehenden Mittel sind knapp bemessen und hauptsächlich für einen eng definierten, stark an der somatischen Medizin orientierten Versorgungsbereich vorgesehen: die pharmakologische Behandlung und organische Diagnoseverfahren: „Ein CT wird schnell mal gemacht, da fragt niemand, ob das denn notwendig sei und wo das Geld dafür herkommen soll“. Auf der anderen Seite wird die Kostenübernahme durch die Krankenversicherung für speziell auf psychisch Kranker zugeschnittene Ange- bote wie Psychosentherapie oder die gemeindepsychiatrische Versorgung als äußerst schwierig beschrieben. Auch in der medikamentösen Behandlung verhindert die Arzneimittelbudgetierung bei niedergelassenen Nervenärzten oft, dass die teureren atypischen Neuroleptika, die mit weniger Nebenwirkungen behaftet sind und damit auch zur Reduzierung der sichtbaren Stigmatisierung beitragen könnten, verordnet werden. Wertvorstellungen in der Gesellschaft wie Leistungsbereitschaft und Wettbewerbsorientierung tragen zusätzlich zur Stigmatisierung schizophren Erkrankter bei. Durch die allgemeine Ausrichtung auf wirtschaftlichen Erfolg, Flexibilität und Aktivität wird es psychisch kranken Menschen besonders schwer gemacht, die vorherrschenden Kriterien für soziale Anerkennung und Integration zu erfüllen. Eine schizophren erkrankte Frau beschreibt das als „...ein Spiel, wer schneller durchdreht, wer sich verrät. Und bei psychisch Kranken ist das so, dass die normalerweise sensibler sind als die anderen und reagieren vielleicht heftiger und dann sind die dran. Dann können sie sich nicht durchsetzen. Das ist ein Teufelskreis. Wir kommen nicht da raus. Es hängt davon ab, wer schneller durchdreht.“ (Frau M., psychosekrank) Die hohen Leistungsanforderungen und die Vorstellung, dass psychisch Erkrankte nicht in der Lage sind, diese zu erfüllen wirken sich besonders negativ auf ihre Position auf dem Arbeitsmarkt aus. Ein weiteres Feld der Stigmatisierung schizophren Erkrankter ist das Bild psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit (20 %). Das Vorherrschen negativer Vorstellungen und Stereotypen über die Schizophrenie in der öffentlichen Meinung wird nicht allein als Ursache der Stigmatisierung wahrgenommen, sondern als direkt diskriminierend und verletzend 82 empfunden. Die Gegenwart dieses negativen öffentlichen Bildes ist Teil des Stigmaerlebens. Die Schilderungen der Befragten zeigen, dass das Wissen um die Präsenz von Vorurteilen zu einer Vermeidung sozialer Kontakte aufgrund von vorweggenommener Stigmatisierung führt. Das öffentliche Bild psychischer Erkrankungen und insbesondere der Schizophrenie wird geprägt durch die Vorstellung, dass die psychisch Kranke grundsätzlich zu Gewalttätigkeit neigen und daher gefährlich sind. Die befragten Patienten und Angehörigen machen die Medien für die Verbreitung dieses Bildes verantwortlich. Für den Großteil der Bevölkerung sind Presse, Fernsehen und Spielfilme oft die einzige Informationsquelle über psychische Erkrankungen („Die haben ihr Wissen aus der BILD-Zeitung oder aus dem Fernsehen ...“). Dort finden sich Darstellungen besonders schrecklicher, offensichtlich unmotivierter Verbrechen, bei denen die Krankheit als Erklärung für das scheinbar Unerklärliche dient (...“alles was sie wissen ist das eine Schizophrene am Heiligabend in der Kirche eine Handgranate gezündet hat ...“). Mit diesem Schwerpunkt der Berichterstattung verstärken die Medien negative Stereotypen und schüren Ängste in der Bevölkerung. Folgender Ausschnitt aus der Diskussion zweier schizophren Erkrankter macht diesen Zusammenhang deutlich: Frau C: Ja, dann kapier´ ich einfach nicht, warum man nicht, äh, äh, es gibt so oft im Fernsehen Berichte, äh, Familie erschossen, Mann hatte Psychose, war psychisch krank, und das kannst, das kommt in der Presse vor, die Meldungen kommen in der Presse vor, die kommen exklusiv – Frau D: Schreckensmeldungen Frau C: – und deswegen ham die Leute auch Berührungsängste mit psychisch Kranken. 83 Schulze und Angermeyer Ein zweites wichtiges Element des Bildes in der Öffentlichkeit ist, dass psychische Erkrankungen mit geistiger Behinderung gleichgesetzt werden. „Die Leute denken wir sind blöde ...“ sagt eine schizophren erkrankte Frau. Für die Patienten hieß die Diagnose Schizophrenie gleichzeitig, von ihrer Umwelt für inkompetent und geistig minderbemittelt gehalten zu werden – was nicht zuletzt dem entsprechenden Vorurteil in der Bevölkerung geschuldet sein dürfte. Schließlich trägt auch die öffentliche Sichtweise auf die psychiatrische Versorgung zur von den schizophren Erkrankten und ihrer Angehörigen erlebten Stigmatisierung bei. Obwohl sich die Psychiatrie mit der Einführung moderner Psychopharmaka und der gemeindepsychiatrischen Reform entscheidend verändert hat wird die Psychiatrie weiterhin und hartnäckig mit dem Bild der „Klapse“ in Verbindung gebracht: „... na ja, auch so, wie man im Film sieht. Was weiß ich, Gitter vorm Fenster, und die Leute sind ans Bett angebunden und was weiß ich. Also, ich denke, dass ist was den Leuten in den Köpfen rumgeistert, draußen, die von Psychiatrie nicht viel wissen.“ (Herr L., schizophren erkrankt) In der Folge erscheinen Zwangsmaßnahmen und stationäre Unterbringung in den Augen der Öffentlichkeit die angemessenste Art des Umgangs mit schizophren Erkrankten zu sein. Durch diese Sichtweise auf die Psychiatrie werden die Kranken indirekt stigmatisiert: wer eine solche Behandlung braucht muss schon große Probleme haben, und man sollte ihn/sie besser meiden oder gleich „wegschließen“. Die Trennung psychischer Krankheit von körperlichen Erkrankungen in der öffentlichen Diskussion ist ein weiteres Anzeichen für den Ausschluss psychischer Erkrankungen aus der allgemeinen Debatte zu Gesundheitsfragen. Die Befragten beklagen, dass es kaum Informationen oder Beratung zu psychischen Krankheiten gibt, während zu körperlichen Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder HIV großangelegte Aufklärungskampagnen stattfinden. Auch in den Medien ist diese Unterscheidung festzustellen: somatische Krankheiten sind Thema von Gesundheitsmagazinen, zu ihnen gibt es Expertengespräche und Beiträge auf den Gesundheitsseiten der Tagespresse, während psychische Krankheiten weitestgehend außen vor bleiben. Hierbei muss man jedoch zwischen den einzelnen Störungsbildern unterscheiden: Depressionen und Angststörungen werden zunehmend akzeptiert, und das Medieninteresse an diesen Erkrankungen steigt. Das Bild der Schizophrenie hingegen bleibt in den Medien mit negativen Attributen wie Unberechenbarkeit und persönlichem Fehlverhalten assoziiert. Wie einer der befragten Patienten es ausdrückte „Sogar Prinzen erlauben sich mal eine kleine Depression, aber Schizophrenie ... das heißt irre, verrückt“. Der vierte Bereich der Stigmatisierung schizophren Erkrankter liegt in einer Behinderung des Zugangs zu sozialen Rollen durch die Krankheit. 11 % aller in den Fokusgruppen zur Sprache gebrachten Stigmatisierungserfahrungen betrafen den Ausschluss von wichtigen Rollen in Familie, Partnerschaft und Beruf. Am häufigsten wurde davon berichtet, dass die Schizophrenie als Hindernis zu arbeits- und berufsbezogenen Rollen wirkt. Die Rückkehr an den Arbeitsplatz nach einer Erkrankungsphase wird häufig von kritischen Bemerkungen, Misstrauen oder der Aberkennung von vorher unter Beweis gestellten Fähigkeiten begleitet. Nicht selten bekämen die Erkrankten Kommentare wie „Ohne Dich lief alles viel besser“ zu hören. Unter solchen Umständen sind Menschen, die an einer Schizophrenie leiden oft die ersten, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Beschäftigungssituation von Psychosekranken wird zudem von der Frage geprägt, ob sie potentielle Arbeitgeber über ihre Krankheit informieren sollen oder nicht. Ehrliche Angaben über eine psychiatrische Vorgeschichte auf Bewerbungsformularen oder in Vorstellungsgesprächen haben in der Regel zur Folge, dass die Anstellung gar nicht erst zustande kommt, während das Verschweigen der Erkrankung die Entlassung aufgrund der nicht wahrheitsgetreuen Angaben nach sich ziehen könnte. Ungeachtet dieses Risikos empfehlen die meisten Befragten, die Krankheit besonders bei der Stellensuche auf jeden Fall für sich zu behalten und längere Phasen der Abwesenheit vom Arbeitsplatz mit „Scheindiagnosen“ wie z.B. „Stoffwechselstörung“ oder „Erschöpfungssyndrom” zu begründen. Auf die Frage hin, ob sein gegenwärtiger Arbeitgeber von seiner Krankheit wisse antwortete ein junger Mann „Nein, ich kann auch niemandem empfehlen, da etwas an der Arbeit zu erzählen über die psychische Krankheit, denn man kann schon reden, wenn man vielleicht mal eine Depression anspricht oder so. Das wird noch so allgemein so akzeptiert, aber wenn man dann sagt eine Psychose, dann um-Gottes-Willen und so.“ (Herr F., hat schizophrene Psychosen erlebt) Schwierigkeiten werden auch dabei geschildert, einen Partner zu finden oder eine bestehende Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Bei vielen der Befragten haben der unvorhersehbare Verlauf der Erkrankung, die zusätzlichen Belastungen und auch die Ängste des Partners zur Trennung geführt, die oft auch die Trennung von den eigenen Kindern bedeutete. So führt die Krankheit zu Schwierigkeiten, familiäre Rollen einzunehmen. Weiterhin beschreiben die Befragten Probleme bei der Wohnungs- 84 Perspektivenwechsel: Stigma aus der Sicht schizophrener Erkrankter ... suche oder beim Aufrechterhalten eines Mietverhältnisses. Das Verhältnis zum Vermieter ist oft konfliktbeladen einschließlich Verleumdungen, Verdächtigungen auf Diebstahl, Beschwerden der Nachbarn und Anzeigen wegen Landfriedensbruch (z.B. für lautes Musikhören). In einigen Fällen eskalierte die Situation und endete mit Wohnungskündigung. Das Stigmaerleben von Patienten und Angehörigen im Vergleich mit der Sicht der Mitarbeiter in der psychiatrischen Versorgung Wie die Patienten und Angehörigen beschreiben auch die Mitarbeiter in der psychiatrischen Versorgung Stigma-Erfahrungen in den Bereichen interpersonelle Interaktion, strukturelle Diskriminierung, Bild psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit und eingeschränkter Zugang zu sozialen Rollen. Allerdings haben die 4 Dimensionen für die direkt von der Erkrankung Betroffenen und ihre professionellen Helfer einen unterschiedlichen Stellenwert (Abb. 2). Interpersonelle Interaktion ist für alle Befragten gleichermaßen der wichtigste Bereich des Stigmaerlebens. Dessen ungeachtet schildern Patienten und Angehörige deutlich häufiger negative Erfahrungen im direkten persönlichen Kontakt mit anderen als die psychiatrischen Fachkräfte. Fast die Hälfte der von ihnen geschilderten Stigmatisierungserfahrungen betreffen diesen Bereich. Betrachtet man die Art der beschriebenen Stigmaerfahrungen innerhalb der Dimension interpersonelle Interaktion ergeben sich weitere Unterschiede: Das Stigmaerleben der Patienten und Angehörigen wird hauptsächlich vom Verlust sozialer Kontakte und der Tatsache, dass das Wissen um die psychische Erkrankung die Wahrnehmung ihrer gesamten Person dominiert geprägt. Im Gegensatz dazu betrachten die "Professionellen” die Verheimlichung der Erkrankung und die damit verbunde- ne Verzögerung der Inanspruchnahme psychiatrischer Behandlung als wichtigsten Aspekt der Stigmatisierung im Bereich interpersonelle Interaktion (s. [9]). Das negative Bild psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit ist für die Mitarbeiter in der Psychiatrie von wesentlich größerer Bedeutung als für Patienten und Angehörige (34,4%). Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sie als professionelle Helfer seltener mit Stigmatisierung in direktem Kontakt mit anderen konfrontiert sind und Stigma vornehmlich in Bereichen wahrnehmen, die auch sie selbst betreffen. So sind auch die Rolle und der Charakter von Psychiatern und stereotypische Vorstellungen von der psychiatrischen Behandlung Gegenstand negativer Mediendarstellungen (e.g. [25]). Stigmatisierung durch strukturelle Diskriminierung ist besonders wichtig aus der Sicht der Angehörigen. Für sie ist die Qualität der psychiatrischen Versorgung ein Indiz für die Anerkennung der Schizophrenie als Krankheit und die Gleichberechtigung psychischer und somatischer Abb. 2: Dimensionen der Stigmatisierung: die Sichtweise der Patienten und Angehörigen im Vergleich zur Sicht der Mitarbeiter in der Psychiatrie 47,7 Interpersonelle Interaktionen 38,7 21,1 Stukturelle Diskriminierung 13,1 20,3 Bild psychisch Kranker in der Öffentlichkeit 34,4 10,9 Zugang zu sozialen Rollen 13,8 0 Patienten und Angehörige 20 40 60 80 Mitarbeiter der Psychiatrie 100 85 Schulze und Angermeyer Erkrankungen. Die psychiatrischen Fachkräfte erleben diesen Bereich als weniger zentral für das Stigma der Schizophrenie (13,1 %). Für sie stehen vor allem Fragen der Finanzierung von Versorgungsleistungen im Mittelpunkt. Die ungleiche Position von psychischen und körperlichen Krankheiten finde ihren Ausdruck in Schwierigkeiten bei der Kostenübernahme für speziell auf schizophren Erkrankte zugeschnittene Behandlungsangebote wie z.B. Psychosenpsychotherapie oder bestimmte Rehabilitationsprogramme. Oft sehen sie sich harten Verhandlungen mit Versicherungsträgern gegenüber, die sich teilweise nicht für psychiatrische Patienten zuständig betrachten, weil diese Versorgungsangebote beanspruchen, die über die medizinische Standardversorgung hinausgehen. Der eingeschränkte Zugang zu sozialen Rollen spielt für die Mitarbeiter in der psychiatrischen Versorgung eine größere Rolle als für die befragten Patienten und Angehörigen (13,8 %). Die psychiatrischen Fachkräfte erleben den negativen Einfluss der Schizophrenie auf die Biographie der Patienten vor allem bei ihrem Versuch, die Erkrankten nach einem Klinikaufenthalt beim Wiedereinstieg ins Berufsleben zu unterstützten. Probleme ihrer Patienten auf dem Arbeitsmarkt sind die häufigste von ihnen geschilderte einzelne Stigmatisierungserfahrung. Besonders bei der Bewerbung käme das Stigma zum Tragen. Hier stünden Patienten vor dem Dilemma, wie sie Falschangaben auf Bewerbungsbögen vermeiden könnten ohne dadurch Benachteiligungen zu erfahren. Bei vielen Patienten führte die psychische Erkrankung langfristig zum Verlust ihres Arbeitsplatzes. Um diese Situation zu vermeiden, so die befragten Mitarbeiter, bitten Patienten immer wieder um „Scheindiagnosen“ wie z.B. „Erschöpfungssyndrom“ und um Ratschläge, inwieweit sie ihre Arbeitgeber über ihre Erkrankung informieren sollen. Eine gängige Praxis, hier Unterstützung zu leisten sei die Verwendung neutraler Klinikstempel auf dem Krankenschein, um den Kontakt mit der Psychiatrie zu verbergen. Schlussbemerkung Die meisten Stigmatisierungserfahrungen von schizophren Erkrankten und ihren Angehörigen werden im Rahmen der direkten Interaktion mit anderen gemacht. Aufgrund einer schizophrenen Erkrankung erlebte Benachteilungen gehen jedoch weit über diesen Bereich hinaus. Stigmatisierung wird auch in strukturellen Benachteilungen durch gesetzliche Regelungen und politische Entscheidungen, der vorurteilsbehafteten Einstellung der Bevölkerung und der entsprechenden Darstellung psychisch Erkrankter in den Medien, sowie in der behindernden Funktion der Erkrankung beim Zugang zu sozialen Rollen erfahren. Diese Erkenntnis sollte die Planung von Projekten zum Abbau von Stigma und Diskriminierung leiten. Neben Information und Aufklärung der Öffentlichkeit sind Gesundheitspolitik und Versorgungsplanung weitere wichtige Interventionsbereiche. Bei der Planung von Projekten zum Stigmaabbau dürfen wir es allerdings nicht versäumen, vor der eigenen Haustür zu kehren. 22,3 % der geschilderten Fälle - die größte Häufigkeit für einen Stigmatisierungsbereich überhaupt – betreffen stigmatisierendes Verhalten von Psychiatern und anderen Mitarbeitern in der psychiatrischen Versorgung bzw. die (aus der Sicht der Betroffenen und Angehörigen) schlechte Qualität des psychiatrischen Versorgungssystems. Dies besitzt besonders für die Definition von Zielgruppen für Anti-Stigma-Interventionen Relevanz. Neben Journalisten, Politikern, Schülern und der breiten Bevölkerung sind hier auch und besonders Ärzte und Pfle- gepersonal anzusprechen. Darüber hinaus sollte hinterfragt werden, ob bestehende Versorgungsangebote und Behandlungskonzept dem Bedarf entsprechen und patientenzentriert angelegt sind. Darüber hinaus verweisen die im Ergebnis unserer Studie gefundenen Unterschiede zwischen der Wahrnehmung von Stigmatisierung durch Patienten und Angehörige einerseits und der Mitarbeiter in der psychiatrischen Versorgung andererseits auf die Notwendigkeit, auch bei der Stigmaforschung die Perspektive der Betroffenen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Stigmatisierung wird von den drei Gruppen vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Alltagserfahrungen und spezifischen Interessen betrachtet, die bei Patienten und Angehörigen wesentlich durch die direkte Erfahrung der Erkrankung und ihrer Konsequenzen geprägt wird. Durch das Fehlen der Perspektive der Betroffenen wurden bei der Definition des Stigma-Konzepts strukturelle Benachteiligungen als auch die Rolle des negativen Bildes psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit für das direkte Stigmaerleben bislang vernachlässigt. Die vorliegende Studie ist ein erster Schritt in Richtung der Gewinnung eines umfassenderen Verständnisses davon, wie sich das mit der Schizophrenie verbundene Stigma auf die Lebensqualität und das Selbstwertgefühl der Patienten auswirkt und ihre Chancen beeinflusst, von einer optimalen Behandlung und Förderung zu profitieren. Zudem erlauben die unterschiedlichen Sichtweisen der Patienten und Angehörigen einerseits und der psychiatrischen Fachkräfte andererseits, Aspekte der Stigmatisierung zu erfassen, die von einer Gruppe allein unter Umständen nicht wahrgenommen werden. 86 Perspektivenwechsel: Stigma aus der Sicht schizophrener Erkrankter ... about mental disorders: a limiting factor in the optimal use of treatment services. In: Andrews G., S. Henderson (eds.): Unmet need in Psychiatry. Problems, resources, responses. Cambridge University Press 1999. Literatur [1] [2] [3] Angermeyer, M.C., H. Matschinger (Hrsg).: [Das Bundesministerium für Gesundheit] Auswirkungen der Reform der psychiatrischen Versorgung in den neuen Ländern der Bundesrepublik Deutschland auf die Einstellung der Bevölkerung zur Psychiatrie und zu psychisch Kranken. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1995. Angermeyer, M.C., H. Matschinger: Violent attacks on public figures by persons suffering from psychiatric disorders: Their effect on social distance towards the mentally ill. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 245, 159-164 (1995). Crocker, J., B. Major, C. Steele: Social Stigma. In: Gilbert, D.T., S.T. Fiske et al. (eds.): The Handbook of Social Psychology, vol. 2. (89-107). McGrawHill, Boston, M.A. 1998. [10] Huxley, P.: Location and stigma: A survey of community attitudes to mental illness – Part I. Enlightenment and stigma. Journal of Mental Health 2, 73-80 (1993). [11] Huxley, P.: Location and stigma: A survey of community attitudes to mental illness – Part II: Community mental health facilities - anonymity or invisibility. Journal of Mental Health 2, 157164 (1993). Piner, K.E., L.R. Kahle: Adapting to the stigmatising label of mental illness: Forgone but not forgotten. Journal of Personality and Social Psychology 47, 805-811 (1984). [22] Sartorius, N.: Stigma: what psychiatrists can do about it? Lancet, Sep 26, 325 (9133), 1058-59 (1998). [23] Schulze, B., M.C. Angermeyer: Subjective Experiences of Stigma. A focus group study of schizophrenic patients, their relatives and mental health professionals. Social Science and Medicine (im Druck). Kuckartz, U.: WinMAX. Professionelle Version. Handbuch zum Textanalysesystem WinMAX für Windows. Westdeutscher Verlag, Opladen 1998. [24] Taylor, S.M., M.J. Dear, M.J.: Scaling Community Attitudes Toward the Mentally Ill. Schizophrenia Bulletin 2 (7), 225-240 (1981). [14] Link, B.G., F.T. Cullen, J. Frank, J.F. Wozniak: The social rejection of former mental patients. Understanding why labels matter. American Journal of Sociology 92, 1461-1500 (1987). [25] Walter, G.: The stereotype of the mad psychiatrist. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 23 (4), 547554 (1989). [26] Wolff, G.: Attitudes of the media and the public. In: Leff, J. (ed.): Care in the community: Illusion or reality?(145163). John Wiley & Sons. London 1997. Fiske, S.T.: Stereotyping, prejudice, and discrimination. In: Gilbert, D.T., S.T. Fiske et al. (eds.): The Handbook of Social Psychology, vol. 2. (357-411). McGraw-Hill, Boston, M.A. 1998. [15] Link, B.G., F.T. Cullen, E. Struening, P.E. Shrout: A modified labelling theory approach to mental disoders: A empirical assessment. American Sociological Review 54, 400-423 (1989). [6] Farina, A., K. Ring: The influence of perceived mental illness on interpersonal relations. Journal of Abnormal Psychology 70, 47-51 (1965). [16] [7] Goffman, E. (1963): Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1963. Link, B.G., E. Struening, M. Rahav, J.C. Phelan, L. Nuttbrock: On stigma and its consequences: Evidence from a longitudinal study of men with dual diagnosis of mental illness and substance abuse. Journal of Health and Social Behavior 38, 177-190 (1997). Jorm, A.F., M. Angermeyer, H. Katschnig: Public knowledge and attitudes [21] [13] [5] [9 Nunnally, J.C.: Popular conceptions of mental health. Holt, Rinehart and Winston, New York, NY 1961. Kuckartz, U.: Computer und verbale Daten. Peter Lang, Frankfurt am Main 1988. Finzen, A.: Der Verwaltungsrat ist schizophren. Die Krankheit und das Stigma. Psychiatrie-Verlag, Bonn 1996. Jones, E., A. Farina, A. Hastorf., H. Markus, D.T. Miller, R. Scott: Social Stigma. The Psychology of Marked Relationships. Freeman, New York 1984 [20] [12] [4] [8] methods, v. 16) Sage, Thousand Oaks C.A. 1997. [17] [18] [19] Beate Schulze, M.A. Link, B.G., J.C. Phelan: Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology 27, 363-385 (2001). Universität Leipzig Mayring, P.: Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken. Deutscher Studien Verlag, Weinheim 1990. Epidemiologie Morgan, D.: Focus groups as qualitative research. (Qualitative research D-04317 Leipzig Klinik für Psychiatrie Evaluationsforschung und Johannisallee 20 [email protected] 88 REZENSION Rezension J. Guimón, W. Fischer, N. Sartorius (Editors): The Image of Madness – The Public Facing Mental Illness and Psychiatric Treatment Karger, Basel 1999. ISBN 3-8055-6846-0 Dieses Buch – ein Mehrautorenwerk – gibt einen recht guten Einblick in den Stand der wissenschaftlichen Bearbeitung von Stigma und Diskriminierung mit welchen psychische Erkrankungen, psychisch Kranke und deren Behandlung stark beladen sind. Bis vor kurzer Zeit wurde – von einigen Ausnahmen abgesehen – seitens der Psychiatrie die Einstellungsforschung stiefmütterlich behandelt. Die von der Weltpsychiatrischen Vereinigung (WPA) ins Leben gerufene Kampagne „Open the Doors – Against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia“, der sich bereits viele Länder aus verschiedenen Erdteilen angeschlossen haben, scheint nun langsam auch der Psychiatrie die Augen zu öffnen: Vorurteile und Diskriminierung – wie Norman Sartorius in seinem Beitrag ausführt – haben negative Auswirkungen auf Patienten, ihr soziales Umfeld, die Behandlung, den Behandlungsverlauf und die Entwicklung der Psychiatrie. In diesem Buch kommen Proponenten der Einstellungsforschung, wie M.C. Angermeyer, A. Finzen oder H. Hillert mit wichtigen Arbeiten aus ihrem wissenschaftlichen Oeuvre zu Wort. Zudem finden sich auch interessante Studien von Arbeitsgruppen aus Genf und Lausanne, die für die Einstellungsforschung als grundlegend zu betrachten sind. Thematisch setzt dieses Buch drei Schwerpunkte: • Ein Kapitel widmet sich empirischen Untersuchungen und grundsätzlichen Überlegungen zur sozialen Repräsentanz psychischer Erkrankungen und ihrem Image in der Bevölkerung. • Ein kurzer Abschnitt stellt Strategien vor, die für eine Entstigmatisierung nützlich sein können. In diesem Rahmen werden u.a. die dem WPA-Programm zu Grunde liegenden Überlegungen ausgeführt. Auch wird die Sichtweise von Patienten und ihren Familien bezüglich Stigmatisierung und Diskriminierung berücksichtigt. Dies ist auch deshalb von Bedeutung, da in der Begegnung von Vorurteilen und Ausgrenzung alle von psychischer Erkrankung „Betroffenen“, d.h. Patienten, ihre Familien sowie Experten gemeinsam „an einem Strang“ ziehen sollten. • Ein größeres Kapitel befasst sich mit den Einstellungen zur psychiatrischen Behandlung bzw. verschiedenen Behandlungsverfahren wie sie in der Bevölkerung anzutreffen sind. Dies ist ein wichtiger Aspekt mit dem sich die Psychiatrie in Zukunft stärker auseinandersetzen müßte. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird durch diese Beiträge deutlich, dass zwischen den Lehrmeinungen der Psychiatrie und den Meinungen der Bevölkerung gravierende, die Behandlung behindernde Diskrepanzen bestehen. Vor dem Hintergrund des Meinungsbildes, besonders hinsichtlich der Psychopharmaka, ist Handlungsbedarf geboten, vorhandene negative Einstellungsstereotype zu verändern. Auch sollten vor diesem Hintergrund unsere gängigen Auffassungen bezüglich der Compliance von Patienten neu überdacht werden. Obwohl diese Publikation in einem höheren Preissegment angesiedelt ist, bietet sie vor allem jenen, die an dieser Thematik wissenschaftlich interessiert sind, einen guten Überblick über den Stand des Wissens (aber auch des Nichtwissens). Hinweise auf wertvolle methodische Grundlagen, relevante Literaturzitate und ein Index, der die rasche Orientierung erleichtert, runden die Qualität dieses Buches ab. Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise, Innsbruck ORIGINAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 89 – 92 Soziale Distanz von an Schizophrenie Erkrankten gegenüber psychisch Kranken Christine De Col1, Peter Gurka1, Eckehart Madlung-Kratzer3, Georg Kemmler1,2, Harald Meller2 und Ullrich Meise1,2 1Univ.-Klinik für Psychiatrie, Innsbruck, 2Gesellschaft für Psychische Gesundheit Tirol, Innsbruck 3Psychiatrisches Krankenhaus des Landes Tirol, Hall i. T. Schlüsselwörter Soziale Distanz – Krankheitskonzept – Einstellung – Schizophrenie Erkrankte sich in ihrer Bereitschaft zum sozialen Handeln gegenüber psychisch Kranken nicht von der Allgemeinbevölkerung unterscheiden. Key words social distance – concept of illness – attitudes – schizophrenia Soziale Distanz von an schizophrenie Erkrankten gegenüber psychisch Kranken Anliegen: In dieser Studie untersuchten wir die Bereitschaft zum sozialen Handeln von schizophren Erkrankter gegenüber psychisch Kranken. Methode: 50 PatientInnen mit schizophrenen Störungen sowie 57 Medizin- und PsychologiestudentInnen wurde eine Vignette, die einen Wahnkranken zeichnet, vorgelegt. Anhand von Fragebögen sollten sie angeben, wie sie dieser Person in verschiedenen Situationen gegenüber handeln würden und welche Emotionen diese bei ihnen auslöst. Den Patienten wurde zudem eine Skala zur Erfassung des Krankheitskonzeptes vorgelegt. Ergebnisse: Hinsichtlich der, gegenüber in der Vignette beschriebenen Person angegebenen sozialen Distanz sowie des Einflusses der emotionalen Reaktionen auf die Bereitschaft zum sozialen Handeln, gab es keine wesentlichen Unterschiede zwischen Patienten und Studenten; die Antworten von Patienten standen in keiner Beziehung zu deren Krankheitskonzept. Schlußfolgerung: Die Studie liefert den Hinweis, daß schizophren Sozial distance of patients with schizophrenia towards mentally ill Objective: To examine the willingness to social acting in patients with schizophrenia facing a case of psychiatric disorder (vignette). Methode: We recruited 50 patients diagnosed with schizophrenia (DSM-IV) and 57 students of medicine and psychology who were confronted with a clinical vignette about a male subject suffering from paranoia. Emotions towards the person characterized by the vignette and social distance were assessed by means of two different questionnaires. In addition patients had to fill in a scale on their personal concept of illness. Results: Patients with schizophrenia did not differ significantly from control subjects in their social distance to the paranoid subject described in the vignette. They also, did not differ from controls regarding their emotions toward the vignette. The concept of illness did not have an impact on patients´ answers. Conclusion: Our data give hints that there are no major differences between patients with schizophrenia and general population regarding their willingness to social acting toward mentally ill. Einleitung Den Einstellungen und Haltungen der Bevölkerung zu psychiatrischen Themen werden erhebliche Auswirkungen auf die psychiatrische Versorgungspraxis zugeschrieben [12]. Durch Korrektur von Vorurteilen erwartet man unter anderem mehr Unterstützung beim Ausbau gemeindenaher Versorgungseinrichtungen. Obwohl die subjektive Sicht von Betroffenen z.B. im Rahmen der Lebensqualität, Behandlungsbewertung oder Krankheitstheorien in der psychiatrischen Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnt [11] sind Untersuchungen wie psychisch Kranke gegenüber psychisch Kranken eingestellt sind rar. Vor dem Hintergrund der Opinion-Leader Theorie [4], nach der den Haltungen von Personengruppen (z.B. aus Gesundheitsberufen), die in Hinblick auf psychiatrische Themen meinungsführend sind und die Informationskanäle „kontrollieren“, eine zentrale Bedeutung zukommt, müßten Betroffene auch zu diesen „Meinungsführern“ gezählt werden. Dies würde auch dem Empowerment-Konzept entsprechen [16] demnach eine verstärkte Selbstbestimmung und Qualifizierung von Nutzern psychiatrischer Dienste sowie ein partizipativer Behandlungsstil gefordert wird. 90 De Col, Kemmler, Gurka, Madlung-Kratzer, Meller und Meise positive Gefühlszustände, die bei der persönlichen Begegnung mit psychisch Kranken auftreten, erfaßt werden sollen [21]. Das Krankheitskonzept wurde mit einer für schizophren Erkrankte entwickelten Skala erhoben [8]. 7 Krankheits-Konzeptdimensionen beurteilen darin die Meinungen, Erklärungen und Vorhersagen eines Menschen hinsichtlich der Störung seines Gesundheitszustandes. An der Befragung nahmen 50 Patienten (46 mit schizophrener, 4 mit schizoaffektiver Störung nach ICD 10) teil. Die Geschlechtsverteilung war gleich (Alter: x = 31,1 ± 5,9 Jahre). Der erste Kontakt zu einer psychiatrischen Institution erfolgte bei den Patienten vor x 8,6 (± 6,3) Jahren. Sie wiesen keine psychopathologische Symptomatik auf, die eine solche Befragung verunmöglicht hätte und standen alle in einer Einrichtung zur tagesklinischen oder tagesstrukturierenden Behandlung. Als Vergleichsgruppe dienten 57 Medizin- und Psychologiestundenten (45 Frauen, 12 Männer: x = 24,3 ± 4,4 Fragestellung und Methodik Durch diese Befragung wollten wir erfragen, ob und in welchem Ausmaß an Schizophrenie Erkrankte gegenüber psychisch Kranken eine Bereitschaft zum sozialen Handelnd aufweisen. Als Vergleichsgruppe dienten zukünftigte „Meinungsführer“: Medizin- und PsychologiestudentInnen. Weiters gingen wir den Fragen nach, ob die Ergebnisse durch emotionale Reaktionen, die psychisch Kranke bei den Befragten auslösen, bzw. durch das Krankheitskonzept der Patienten beeinflußt werden. Patienten und Studenten wurde eine Vignette vorgelegt, die das Bild einer Person mit einer wahnhaften Störung zeichnet [17]. Zur Messung der sozialen Distanz verwendeten wir die Skala von Link [9]; 7 Fragen geben einen Hinweis, inwieweit Befragte psychisch Kranken gegenüber eine Integrationsbereitschaft angeben. Zur Erhebung von emotionalen Reaktionen verwendeten wir eine Liste mit 7 Aussagen, mit denen negative und Jahre). In dieser Arbeit werden jene Ergebnisse der Befragung berükksichtigt, die zu Beginn der Psychiatrievorlesung gewonnen wurden. Ergebnisse In Abb. 1 ist die Bereitschaft zum sozialen Handeln von Patienten und Studenten gegenüber einem in der Fallvignette beschriebenen Wahnkranken dargestellt. Bei zwei der insgesamt 7 im Fragebogen beschriebenen (hypothetischen) Situationen – „Würden Sie diese Person für eine Arbeitsstelle empfehlen?“ sowie „Würden Sie diese Person einem Freund vorstellen?“ – bestand ein statistisch signifikanter Unterschied in jeweils unterschiedliche Richtung. Der Gesamtscore-Mittelwert betrug bei Patienten 3,35, bei Studenten 3,19 (p = 0,189); es bestand kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen beiden Gruppen. Die beiden Abb. 1: Soziale Distanz Würden Sie X akzeptieren als ...? Würden Sie X ...? Babysitter Schwager/Schwiegersohn für Arbeit empfehlen Untermieter Nachbar Arbeitskollege einem Freund vorstellen 1 2 uneingeschränkt ja 3 4 uneingeschränkt nein schizophren Erkrankte * signifikanter Unterschied zwischen Studenten und schizophren Erkrankten: p<0,05 (adjustiert für Alter und Geschlecht) Studenten 5 Soziale Distanz schizophren Erkrankter gegenüber psychisch Kranken Gruppen unterschieden sich nicht signifikant in Hinblick auf emotionale Reaktionen (Subskalen: „positive Reaktionen“, „negative Reaktionen“), die durch die Vignette ausgelöst wurden. Der Einfluß emotionaler Reaktionen auf die soziale Distanz wurde mittels multipler Regressionsanalyse untersucht. Es zeigte sich, daß die soziale Distanz durch negative Reaktionen signifikant erhöht und durch positive Reaktionen signifikant verringert wird, und zwar in beiden Gruppen gleichermaßen. Hinsichtlich der, in der Krankheitskonzept-Skala aufgeführten Dimensionen bestanden bei Patienten keine Korrelationen zur sozialen Distanz. Diskussion Nach den wenigen, zumeist in den 60er Jahren, durchgeführten Studien gibt es Hinweise, daß psychisch Kranke sich in ihren Einstellungen gegenüber psychisch Kranken von der Normalbevölkerung nicht unterscheiden [2] bzw. sich ihnen gegenüber genauso ablehnend verhalten [20]. Aus der Untersuchung von Angermeyer und Matschinger [1] zur sozialen Distanz der Bevölkerung geht hervor, daß Befragte, die angaben selbst einmal in psychiatrischer Behandlung gestanden zu sein, „eine überraschend starke Distanz“ gegenüber psychisch Kranken aufwiesen. Berücksichtigt man weiter das Ergebnis der Einstellungsuntersuchung von Rössler und Mitarbeiter [13] so zeigt sich, daß Medizinstudenten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung „keine positiveren Einstellungen“ aufwiesen. Das Ergebnis, der von uns befragten StudentInnen war jenem dieser Studie sehr ähnlich. Diese Zusammenschau führt zum Schluß, daß schizophren Erkrankte gegenüber einem, mittels einer Vignette beschriebenen Wahnkranken, eine der Allgemeinbevölkerung vergleich- bare soziale Distanz aufweisen. Ihr Ausmaß wird auch in unserer Untersuchung sehr wesentlich von den emotionalen Reaktionen, die dieser Mensch bei den Befragten auslöst, beeinflußt [1]. In beiden Gruppen wurde durch negative Reaktionen die soziale Distanz erhöht und durch positive verringert. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die verbalen Reaktionen auf die in Fragebögen dargestellten Situationen keine Aussage über das tatsächliche Verhalten zulassen [19], sondern lediglich die Bereitschaft in dieser Form auch tatsächlich zu handeln, hinweisen. Unser Ergebnis muß auch vor dem Hintergrund dieser selegierten Gruppe von Langzeitkranken gesehen werden und läßt sich somit nicht verallgemeinern. Außerdem gehören schizophren Erkrankte zu einer Gruppe, denen im Vergleich zu anderen psychisch Kranken eine deutlich höhere soziale Distanz entgegengebracht wird [1]. Dazu einige Belege: Der Krankheitsname Schizophrenie ist mit einem hohen Grad an Stigmatisierung vergesellschaftet [3]. Das Unwissen hinsichtlich der Merkmale dieser Störungen, die von der (gebildeten) Öffentlichkeit in der Regel in "Spaltungen der Persönlichkeit” gesehen werden, ist groß [7]. Auch in medizinischen Fachkreisen halten sich hartnäckig Mythen, daß Schizophrenie unheilbar bzw. unbehandelbar sei [5]. Der Krankheitsname hat als umgangssprachlicher Begriff Eingang in den Duden gefunden und wird auch in Printmedien verwendet, um die innere Widersprüchlichkeit, Zwiespältigkeit oder die Unsinnigkeit von Handeln hervorzuheben [6]. In Filmen werden Menschen mit psychotischen Störungen oft als unberechenbar, gewalttätig oder diabolisch porträtiert; solche Darstellungen werden häufig in Fernsehprogrammen gesendet [18]. In der extremen Stigmatisierung und Diskriminierung, die schizophren Erkrankte erfahren (sie wird als ein wesentliches Hindernis für die soziale Integration dieser Menschen 91 angesehen [10]) könnte eine Erklärung für dieses unerwartete Ergebnis liegen. Die Beschreibung eines Menschen, der eine Symptomatik aufweist, die Patienten mit ihrer eigenen Störung bzw. Diagnose in Beziehung setzen, kann bei ihnen Abwehr bzw. Verleugnung bewirken. Dadurch laufen sie nicht Gefahr durch „SelbstLabelling“ mit den der Schizophrenie zugeschriebenen Stereotypen übereinzustimmen, und die ihnen so zugeteilten Rollen (z.B. Gefährlichkeit, Unfähigkeit, Wertlosigkeit, Unheilbarkeit) zu übernehmen [22]. Würden sie die mit diesem Stigma vergesellschafteten Eigenschaften akzeptieren, so könnte es geschehen, daß sie im Sinne einer verminderten Selbstwirksamkeitswahrnehmung sich nicht mehr als fähig erachten, über ihr Leben Kontrolle ausüben zu können. Durch Stigmatisierung und dem durch sie, wie zuvor beschrieben ausgelösten Prozeß, kann sich jedoch ein circulus vitiosus entwickeln, der unter anderem Copingfähigkeit und Compliance beeinträchtigt. Dies hat gerade bei Störungen deren "Verlauf” häufig mit einer hohen Rezidivneigung und der Entwicklung von sozialen Beeinträchtigungen vergesellschaftet ist, ungünstige Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Krankheit. Als eine Konsequenz unseres Ergebnisses und dieser Erklärung erscheinen Interventionen erforderlich, die in zwei Richtungen gehen sollten. Erstens sollten in der Behandlung von Patienten der Krankheits- und auch der Stigmabewältigung ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Zweitens sind Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit (nach „innen“ und nach „außen“) zur Entstigmatisierung dieser Krankheit und der von ihr Betroffenen erforderlich. Diese Anti-Stigma-Arbeit sollte über den Zeitraum der Kampagne [15] hinaus ein wichtiges Projekt der Psychiatrie werden [14]. Es ist jedoch zu bedenken, daß sich das mit der Krankheit „Schizophrenie“ verwobene Stigma 92 De Col, Kemmler, Gurka, Madlung-Kratzer, Meller und Meise im Sinne der Albert Einstein zugeschriebenen Feststellung – „It is harder to crack a prejudice than an atom“ – mittelfristig als „löschungsresistent“ erweisen kann. Literatur [1] Angermeyer, M. C., H. Matschinger: Social distance towards the mentally ill: results of representative surveys in the Federal Republic of Germany. Psychol. Med. 27 (1997) 131-141 [2] Crumpton, E., A. D. Weinstein, C. W. Acker, A. P. Annis: How patients and normals see the mental patient. J. Clin. Psychol. 23 (1967) 46-49 [3] Finzen, A.: „Der Verwaltungsrat ist schizophren“ – Die Krankheit und das Stigma. Psychiatrie-Verlag Bonn (1995) [4] [5] [6] [7] Grausgruber, A., W. Schöny: Einstellungsforschung zu psychisch Kranken: Eine kritische Bestandsaufnahme. Neuropsychiat. 9 (1995) 123-129 Harding, C. M., J. H. Zahniser: Empirical correction of seven myths about schizohrenia with implications for treatment. Acta Psychiat. Scand. 90 Suppl. 384 (1994) 140-146 Hoffmann-Richter, U., B. Alder, V. Hinselmann, A. Finzen: Schizophrenie in der „Neuen Züricher Zeitung“: Eine Medienanalyse. Psychiat. Prax. 25 (1998) 14-18 Holzinger, A., M. C. Angermeyer, H. Matschinger: Was fällt Ihnen zum Wort Schizophrenie ein? Psychiat. Prax. 25 (1998) 9-13 [8] Linden, M., J. Nather, H. U. Wilms: Zur Definition, Bedeutung und Messung der Krankheitskonzepte von Patienten. Die Krankheitskonzeptskala (KK-Skala) für schizophrene Patienten. Fortschr. Neurol. Psychiat. 56 (1988) 35-43 [9] Link, B. G., F. T. Cullen, J. Frank, J. F. Wozniak: The social rejection of former mental patients: understanding why labels matter. Am. J. Soc. 92 (1987) 1461-1500 [10] [11] [12] Penn, D. L., K. Guynan, T. Daily, W. D. Spaulding, C. P. Garbin, M. Sullivan: Dispelling the Stigma of Schizophrenia: what sort of information is best? Schizophr. Bull. 20 (1994) 567-577 Priebe, S., Th. Gruyters, M. Heinze, Ch. Hoffmann, A. Jäkel: Subjektive Evaluationskriterien in der psychiatrischen Versorgung – Erhebungsmethoden für Forschung und Praxis. Psychiat. Prax. 22 (1995) 140-144 Rössler, W., H. J. Salize: Gemeindenahe Versorgung braucht eine Gemeinde, die sich sorgt – Die Einstellung der Bevölkerung zur psychiatrischen Versorgung und zu psychisch Kranken. Psychiat. Prax. 22 (1995) 58-63 [13] Rössler, W., H. J. Salize, V. Trunk, B. Voges: Die Einstellung von Medizinstudenten gegenüber psychisch Kranken. Nervenarzt 67 (1996) 757-764 [14] Sartorius, N: Eines der letzten Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankungen. Neuropsychiatrie 16, S. 5-10 (2001) [15] Schöny, W: Schizophrenie hat viele Gesichter. Die österreichische Kampagne zur Redktion des Stigmas und der Diskriminierung wegen Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, S. 48-53(2002) [16] Schürmann, I.: Beziehungsformen zwischen Langzeitnutzer und Professionelle im Kontext der Moderne. In:Zaums- eil, M., K. Lefernik: Schizophrenie in der Moderne – Modernisierung der Schizophrenie. 239-279. Edition Narrenschiff, Psychiatrie Verlag Bonn (1997) [17] Star, S.: The public´s idea about mentall illness. Paper presented to the annual meeting of the National Association for Mental Health [18] Straub, E.: Diskriminierung der psychisch Kranken in Fernsehfilmen. Psychiat. Prax. 24 (1997) 213-214 [19] Stumme, W.: Zur Relevanz eines sozialwissenschaftlichen Paradigmas. Kölner Zeitung für Soziologie und Psychologie (1973) 386-402 [20] Swanson, R. M. S. P. Spitzer: Stigma and the psychiatric patient career. J. Health Soc. Behav. 11 (1970) 44-51 [21] Voges, B., W. Rössler: Beeinflußt die gemeindenahe psychiatrische Versorgung das Bild vom psychisch Kranken in der Gesellschaft? Neuropsychiat. 9 (1995) 145-151 [22] Warner, R., D. Taylor, M. Powers, J. Hyman: Acceptance of the mental illness label by psychotic patients: effects on functioning. Am. J. Orthopsychiat. 59 (1989) 398-409 OA Dr. Christine De Col Psychiatrische-Psychotherapeutische Tagesklinik der Univ.-Klinik für Psychiatrie, Innsbruck Anichstraße 35 A-6020 Innsbruck e-mail: [email protected] ORIGINAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 93 – 98 Schizophrenie ... „bedeutet für mich gespaltene Persönlichkeit“ Ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophrenie in Schulen Hubert Sulzenbacher1, Rosi Schmid2, Georg Kemmler1, 2, Christine De Col1 und Ullrich Meise1,2 1Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck 2Gesellschaft für Psychische Gesundheit Tirol, Innsbruck Schlüsselwörter Schizophrenie – Einstellungen – Wissen – Anti-Stigma-Programm Key words schizophrenia – attitude – knowledge – anti-stigma-program Schizophrenie ... „beudeutet für mich gespaltene Persönlichkeit“ – Ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophrenie in Schulen Im Zuge einer Informationsveranstaltung an Allgemein-Höherbildenden Schulen wurden SchülerInnen über schizophrene Erkrankungen informiert. Es sollte in Erfahrung gebracht werden, ob diese kurze Lehrveranstaltung zu Veränderungen der kognitiven Einstellungsdimension der SchülerInnen führt und ob die Einbeziehung einer Betroffenen im Unterricht diese beeinflusst. Dabei wurden 57 SchülerInnen aus drei Schulklassen (Gruppe A) durch eine Betroffene und einen Psychiater, 57 SchülerInnen (Gruppe B) durch eine Sozialarbeiterin und einen Psychiater informiert. Einige Tage vor und einige Tage nach der Veranstaltung wurden die SchülerInnen gebeten, alle Gedanken, welche ihnen zum Begriff „Schizophrenie“ einfielen, nieder zu schreiben. Die Ergebnisse dieser Befragung wurden auf zwei Arten ausgewertet: Einerseits wurden die einzelnen Antworten von vier Expertinnen getrennt benotet, andererseits ordneten wir die Antworten inhaltlichen Kategorien z. Es stellte sich heraus, dass sich die Benotung der SchülerInnen in Gruppe A (signifikant) deutlicher verbesserte als in Gruppe B. In beiden Grup- pen und zu beiden Befragungszeitpunkten betrafen mehr als zwei Drittel aller Aussagen zur Schizophrenie deren (vermeintliche) Symptomatik. Die bei der ersten Befragung noch sehr häufig vertretene Auffassung, dass an Schizophrenie Erkrankte eine „gespaltene Persönlichkeit“ aufweisen, trat nach der Informationsveranstaltung deutlich seltener auf. Dagegen nahm – folgt man der Beschreibung von Eugen Bleuler (1911) – von der ersten zur zweiten Befragung die Angabe „akzessorischer Symptome“ (z.B. akustische Halluzinationen, Wahn) in beiden Gruppen zu. Nur in der Gruppe A kam es bei der zweiten Befragung zu einer deutlichen Zunahme von Angaben zu „Grundsymptomen“ (z.B. kognitive- und affektive Störungen). Berücksichtigt man die bereits publizierten Ergebnisse dieser Studie, so erhärten sich die Hinweise, dass in jener Gruppe, in welcher die Informationsmittlung unter Mitarbeit einer Betroffenen erfolgte, das Wissen über schizophrene Erkrankungen, im Gegensatz zur anderen Gruppe deutlich verbessert wurde. Schizophrenia ... „to me this means a split personality“ – A school program aimed at fighting the stigma of schizophrenia In the course of the information workshops in secondary schools, pupils were informed about the illness of schizophrenia. The aim was to find out whether such short workshops bring about a change in the cognitive attitudes among pupils and whether the involvement of a patient in the lessons would have any influence. 57 pupils from three classes (group A) were informed by an affected person and a psychiatrist, a further 57 pupils (group B) by a social worker and a psychiatrist. A few days before and after the workshop the pupils were asked to write down all the thoughts which they could think of in relation to the term „schizophrenia“. The results of this request were evaluated in two ways: On the one hand the individual answers were graded separately by four experts, on the other the answers were categorised according to content in order to reach results. The findings were that the grades of the pupils in group A were (significantly) better than those of group B. In both groups and during both questionnaire dates, more than two thirds of all statements about schizophrenia concerned its (supposed) symptoms. In response to the first questionnaire the opinion was frequently expressed that patients suffering from schizophrenia had a „split personality“, a view expressed more seldom in the questionnaires after the workshops. In contrast, the number of references to what Eugen Bleuler called in 1911 „accessory symptoms“ (e.g. hallucinations, delusions) increased in both groups from the first to the second time of completing the questionnaires. The second time the questionnaires were completed, only group A showed a clear increase in the responses to „essential symptoms“ (e.g. affective and cognitive disorders).Taking into a account the already published results of this pilot study, there is strong evidence that the knowledge of the experience of schizophrenia and the difficulties it causes for the affected were much improved in the group in which an affected patient was involved in the workshop as opposed to the other group. Sulzenbacher, Schmid, Kemmler, De Col und Meise Einleitung Die negativen Auswirkungen des Stigmas auf den Lebensvollzug und die Behandlung von Menschen mit schizophrenen Erkrankungen sind so ausgeprägt, dass Asmus Finzen von einer „zweiten Erkrankung“ spricht, die als Folge von Stigmatisierung entstehen kann [8]. Vor dem Hintergrund des Vulnerabilität-Stress Paradigmas [30] können die sozialen Konsequenzen der mit dem Stigma regelhaft verbundenen Diskriminierung [1] als Stressoren wirksam werden und so zu Erkrankungsrezidiven beitragen. Benachteiligungen in verschiedenen Belangen der gesellschaftlichen Teilhabe [16, 24], negative Bewertungen und kränkende Benachteiligungen [2, 13, 14, 28] führen zur Beschädigung der Identität von Betroffenen [9] und untergraben Selbstvertrauen sowie Copingfähigkeit. Für die österreichische Anti-Stigma-Kampagne „Schizophrenie hat viele Gesichter – helfen statt ausgrenzen“ [26], die unter der Schirmherrschaft der weltweiten Initiative der WPA (World Psychiatric Association) „Open the doors – Reducing Stigma and Discrimination because of Schizophrenia“ steht [25], wurden als eine der landesweit durchzuführenden Aktivitäten Informationsveranstaltungen für Schüler AllgemeinHöherbildender Schulen formuliert. Da bekannt ist, dass jüngere Menschen offener sind, bestehende Vorurteile zu überdenken, verknüpfen wir mit dieser Initiative die Hoffnung, dass die Haltung zukünftiger Opinionleader gegenüber psychisch Kranken weniger von schädigenden Stereotypen geleitet wird. Zudem könnten diese jungen Erwachsenen in ihrem sozialen Umfeld als Fürsprecher für psychisch Kranke fungieren. Außerdem könnte im Falle, dass sie selbst psychisch erkranken sollten, ihre möglichen Vorbehalte, sich rechtzeitig in Behandlung zu begeben, beseitigt werden. Sinn macht diese Anti-Stigma-Arbeit in Schulen jedoch nur, wenn sie über den begrenzten Zeitraum der Kampagne hinaus fortgeführt wird. Da die Art und Weise, wie Information vermittelt wird, für den Erfolg der Aufklärung wesentlich ist [10, 22, 23], haben wir in Tirol dem Schulprojekt eine Pilotstudie vorgeschaltet [21]. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen recht deutlich, dass die bei den Schülerinnen und Schülern zu beobachtenden Einstellungsänderungen wesentlich ausgeprägter waren, wenn sie von einer von der Erkrankung Betroffenen und einem Experten gemeinsam unterrichtet wurden. Dagegen zeigte sich, dass Informationsvermittlung, wenn sie ausschließlich durch Experten erfolgte, weniger geeignet war, bestehende Einstellungen zu verändern. Bereits 1962 haben Krech und Mitarbeiter [19] in ihrem Definitionsvorschlag sozialer Einstellungen auf drei wesentliche Dimensionen von Einstellungen und deren systemhafte Verbindung hingewiesen; demnach würde eine Veränderung entweder der kognitiven, der affektiven oder der konativen Einstellungsdimension eine Veränderung der beiden anderen Dimensionen nach sich ziehen. Obwohl gezeigt werden konnte [3, 20, 27, 29], dass aus den Ergebnissen von Einstellungsuntersuchungen nicht ohne weiteres auf konkretes Verhalten geschlossen werden kann, wurde das Bestehen eines Zusammenhangs unseres Wissens nie grundsätzlich in Frage gestellt. Die kognitive Einstellungsdimension ist in der Einstellungsforschung zur Schizophrenie insofern von Bedeutung, als das vermeintliche Wissen der Bevölkerung, aber auch der Ärzte über die Erkrankung mit den realen Fakten oder dem Fachkonsens nur sehr bedingt übereinstimmt. Vorurteile und Fehlmeinungen gegenüber Menschen mit schizophrenen Erkrankungen sind in unserer kulturellen Tradition tief verwurzelt [7]. Das Bild, welches die Gesellschaft von Schizophrenien hat, ist von der vermuteten Persönlichkeitsspaltung 94 der Betroffenen und der scheinbar daraus auch resultierenden Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit geprägt. Zudem hat der Krankheitsname Eingang in die Umgangssprache gefunden [6] und wird auch in Printmedien synonym für „Widersprüchlichkeit“, „Zwiespältigkeit“, „Unsinnigkeit“ oder „absurdes Verhalten“ verwendet [4, 14, 15]. Andere mit der Schizophrenie vergesellschaftete Mythen, wie ihre vermeintliche Unbehandelbarkeit oder Unheilbarkeit, sind nicht nur bei Laien, sondern auch bei im Gesundheitswesen Tätigen häufig anzutreffen [12]. Das Odium des deletären Verlaufes, das dieser Erkrankung anhaftet, hat auch seine Wurzeln in der Einteilung der Psychosen durch Emil Kraepelin, der in seinem Dichotomiekonzept endogener Psychosen zwischen jenen mit günstigem Ausgang (Manisch-depressives Kranksein) und jenen mit ungünstigem Verlauf (Dementia praecox) unterschied: Die Vorurteile von heute sind oft die Lehrmeinung von gestern oder vorgestern (A. Finzen). [17] Spätestens seit der Untersuchung von Cumming und Cumming [5] ist bekannt, dass durch Aufklärung allein, also die ausschließliche Berücksichtigung der kognitiven Einstellungsdimension, bestehende Vorurteile nicht verändert werden können. Wichtig erscheint, mit von psychischer Erkrankung Betroffenen in Kontakt zu kommen, um Fehlmeinungen korrigieren zu können. Da das Wissen über schizophrene Erkrankungen und die davon Betroffenen äußerst gering ist bzw. falsches Wissen besteht [10], ist es trotzdem erforderlich, den Wissensstand über schizophrene Erkrankungen zu verbessern. Da es zum Wesen von Vorurteilen gehört, dass diese kaum hinterfragt werden und schwer korrigierbar sind, erscheint es von Bedeutung, entsprechende „Anreize“ zu schaffen, dass ein adäquates Wissen überhaupt angenommen wird. 95 Schizophrenie ... „ bedeutet für mich gespaltene Persönlichkeit“ Fragestellung und Methodik Im Rahmen des Psychologieunterrichtes wurden sechs Schulklassen der siebten Schulstufe von Allgemein-Höherbildenden Schulen Themenbereiche zur Schizophrenie in einem Block von zwei Unterrichtsstunden nähergebracht. In drei der Klassen (Gruppe A) wurde diese Information durch eine Betroffene und einen Psychiater, in weiteren drei Klassen (Gruppe B) durch eine Sozialarbeiterin und einen Psychiater vermittelt. Dazu wurde eine begleitende Evaluation mit Hilfe von Fragebögen durchgeführt, die in der Schulstunde vor (Zeitpunkt 1) und in der Schulstunde nach der Informationsveranstaltung (Zeitpunkt 2) von den SchülerInnen ausgefüllt wurden. [21] Nachdem die durch die Informationsveranstaltung verursachten Veränderungen in der affektiven Einstellungsdimension sowie der sozialen Distanz der SchülerInnen bereits an anderer Stelle [21] beschrieben wurden, untersucht die vorliegende Arbeit die Vorstellungen der SchülerInnen von Schizophrenie und deren Veränderungen durch die Informationsveranstaltung. Für diesen Zweck wurden die SchülerInnen aufgefordert, alles, was ihnen zum Begriff „Schizophrenie“ einfiel, in freier Form – vor und nach der Informationsveranstaltung – niederzuschreiben. Um nicht eine allzu selektive Interpretation der Ergebnisse vorzunehmen, wählten wir zwei voneinander unabhängige Methoden der Auswertung: Einerseits wurden vier Expertinnen (3 Psychiaterinnen, 1 Psychologin) gebeten, die Antworten der befragten SchülerInnen zu benoten (wobei aus den vorgelegten Texten nicht ersichtlich war, von welcher Person, aus welcher Gruppe der jeweilige Text stammte bzw. ob er vor oder nach der Informationsveranstaltung geschrieben wurde); so konnte schließlich jedem der insgesamt 228 Antwortblöcke (114 SchülerInnen zu zwei Zeitpunkten) eine Note zugeordnet werden, die dem Mittelwert der Einzelnoten der vier Expertinnen entsprach. Andererseits versuchten wir, über eine Kategorisierung der gegebenen Antworten inhaltliche Unterschiede zwischen den Gruppen A und B und die Veränderungen der Antworten durch den Einfluss der Informationsveranstaltung herauszufinden; es ist evident, dass eine inhaltliche Kategorisierung freier Texte immer ein willkürlicher Akt ist (so kann der Ausdruck „zwiegespalten“ sowohl der nicht zum Formenkreis der Schizophrenien gerechneten dissoziativen Identitätsstörung als auch der von E. Bleuler zu den Grundsymptomen schizophrener Erkrankungen gezählten Ambivalenz zugeordnet werden). In der Auswertung wurden nur jene Aussagen berücksichtigt, die sich einer Kategorie zuordnen ließen. Dabei legten wir folgende Kategorien fest: „Klassifikation der Schizophrenie“, „Häufigkeit“, „Ätiopathogenese“, „Verlauf“, „Therapie“, „Medien“, „Folgen für den Betroffenen“, „Folgen für die Umgebung“, „persönliche Erfahrung mit Schizophrenie“ sowie drei Kategorien für Aussagen zur Symptomatik („falsch“: Symptome, die nichts mit schizophrenen Erkrankungen zu tun haben; unspezifische Symptome und „Grund- sowie akzessorische Symptome“ nach E. Bleuler). Ergebnisse Insgesamt lagen vollständige Datensätze von 114 SchülerInnen vor, in beiden Gruppen jeweils 57 SchülerInnen. Auffällig war der höhere Anteil des weiblichen Geschlechts (weiblich : männlich = 59,6 : 40,4 %), was aber für die Gruppen A und B in annähernd gleichem Ausmaß zutraf. Das Alter der einzelnen Befragten lag zwischen 16 und 19, das Durchschnittsalter bei 17,0 Jahren. Benotung Die Resultate der Benotung der Schülerantworten durch die Expertinnen zeigt Abbildung 1. Die von den vier Expertinnen gegebenen Noten korrelierten zum Zeitpunkt 1 zwischen 0,40 und 0,65 (p in allen Fällen < 0,01), zu Zeitpunkt 2 zwischen 0,56 und 0,81 (p in allen Fällen < 0,01). Bei der ersten Befragung erreichten die SchülerInnen aus Gruppe B (wurden durch zwei Experten informiert) eine etwas bessere Benotung als jene aus Gruppe A, der Unterschied war allerdings nicht signifikant (p = 0,075). Bei der zweiten Befragung hatten sich die Noten beider Gruppen verbessert; dabei fiel die Verbesserung in Gruppe A (wurde durch Betroffene und Experten informiert) im Vergleich zur ersten Note deutlicher aus (p < 0,01) als in Gruppe B, in der die Verbesserung allerdings auch Signifikanzniveau erreichte (p < 0,05). Bei der zweiten Befragung erreichte Gruppe A eine bessere Benotung als Gruppe B, der Unterschied erreichte allerdings knapp nicht das Signifikanzniveau (p = 0,057). Die Verbesserung der Noten war allerdings in Gruppe A signifikant (p < 0,01) deutlicher ausgeprägt als in Gruppe B. Inhaltliche Kategorien Die Befragung vor der Informationsveranstaltung erbrachte 329 Aussagen, die zweite Befragung 491 Aussagen zur Schizophrenie. Mehr als zwei Drittel davon waren Beschreibungen der (vermeintlichen) Symptomatik schizophrener Erkrankungen. Mehr als 10 % der verwertbaren Aussagen entfielen sonst nur noch auf die Klassifikation der Schizophrenie als „psychischer Krankheit“. Zu allen anderen von uns verwendeten Kategorien wurden zu beiden Befragungszeitpunkten jeweils weniger als 5% der Aussagen gemacht. Die Veränderungen der Aussagen zur Symptomatik sind in Abbildung 2 96 Sulzenbacher, Schmid, Kemmler, De Col und Meise Abb. 1: Benotung vor und nach der Informationsveranstaltung 5 4,04 4 3,79 3,49 3,12 Note 3 2 1 Gruppe A Gruppe B 0 Zeitpunkt 2 Zeitpunkt 1 Gruppe A: Information durch Betroffene und Psychiater Gruppe B: Information durch Sozialarbeiterin und Psychiater dargestellt. Die hier als „falsch“ bezeichneten Nennungen beschäftigten sich praktisch ausschließlich (in 96 %) mit einer Persönlichkeitsspaltung. Diese Verwechslung der Schizophrenie mit der dissoziativen Iden- titätsstörung trat bei der zweiten Befragung in beiden Gruppen nur mehr viel seltener auf (p in beiden Gruppen < 0,01). Unter der Kategorie „unspezifische und Grundsymptome“ wurden beispielsweise Angst, Isola- tion, Rückzug, Verwirrtheit oder diverse Affektstörungen oder IchStörungen subsumiert. Auffällig ist, dass sich von der ersten zur zweiten Befragung in Gruppe A die Nennungen in dieser Kategorie mehr als ver- Abb. 2: Aussagen zur Symptomatik (nach E. Bleuler) vor und nach der Informationsveranstaltung Gruppe A Gruppe B 100 100 89 88 84 Anzahl der Nennungen 80 80 63 60 40 60 36 40 33 35 41 38 falsch 20 19 20 16 13 0 Akzessorische Symptome 0 Zeitpunkt 1 Zeitpunkt 2 Grundsymptome Zeitpunkt 1 Gruppe A: Information durch Betroffene und Psychiater Gruppe B: Information durch Sozialarbeiterin und Psychiater Zeitpunkt 2 Schizophrenie ... „ bedeutet für mich gespaltene Persönlichkeit“ doppelten (p < 0,01), während die Anzahl der Nennungen in Gruppe B kaum zunahm (p = 0,77), der Unterschied zwischen beiden Gruppen war dabei signifikant (p < 0,01). In der Kategorie der „akzessorischen Symptome“ wurden Halluzinationen, Wahn oder auch katatone Störungen zusammengefasst. Hier fällt auf, dass bei der ersten Befragung in Gruppe B diese produktiven Symptome dreimal häufiger genannt wurden als in Gruppe A. Bei der zweiten Befragung hatte sich die Anzahl der Nennungen in dieser Kategorie in beiden Gruppen ausgeglichen. Die Zunahme in Gruppe A war dabei wieder signifikant (p < 0,01), in Gruppe B wurde das Signifikanzniveau knapp nicht erreicht (p = 0,06), was aber auf den höheren Ausgangswert zurückzuführen sein mag. Zusammenhang zwischen inhaltlichen Aussagen und Benotung Die Angabe „akzessorischer Symptome“ war zu beiden Befragungszeitpunkten mit einer besseren Benotung signifikant korreliert (t1: p < 0,01; t2: p < 0,01). Auch die Angabe „unspezifischer und Grundsymptome“ ging bei beiden Befragungen mit einer signifikant besseren Benotung einher (t1: p < 0,01; t2: p < 0,01). Die Angabe "falscher” Symptome hatte bei der ersten Befragung noch einen signifikant nachteiligen Einfluss auf die Benotung (p < 0,05), bei der zweiten Befragung war die Notenverschlechterung nicht mehr signifikant (p = 0,22). Diskussion Dass das Gelingen einer Informationsvermittlung über schizophrene Erkrankungen sowohl vom Inhalt als auch von der Art und Weise, wie diese angeboten wird, abhängt, konnte in verschiedenen Untersuchungen belegt werden [11, 21, 22, 23]. In der Auswertung zur kognitiven Einstellungsdimension unserer Pilotstudie überraschte uns das Ergebnis, dass sich die Benotung der Aussagen zur Schizophrenie in jenen Klassen, bei denen eine Betroffene am Unterricht mitwirkte, deutlicher verbesserte als die jener Klassen, die ausschließlich durch Experten informiert wurden. Wir – die Experten – waren der Meinung, wesentlich mehr Fachwissen transportiert zu haben. In den Schulklassen, wo die Betroffene gemeinsam mit einem Experten unterrichtete, stand diese mit ihrer persönlichen Biographie im Zentrum, wobei unserer Wahrnehmung nach die Information über schizophrene Erkrankungen eher in den Hintergrund trat. Vergleicht man die Veränderung der von den Expertinnen gegebenen Noten (Abbildung 1) mit den Veränderungen in den inhaltlichen Kategorien der Antworten (Abbildung 2), so ist ersichtlich, dass die Abnahme der Angaben „falscher“ Symptome vom Zeitpunkt 1 zum Zeitpunkt 2 nicht die Ursache dieses Notenunterschieds sein kann, da diese in beiden Gruppen sehr ähnlich ausfällt. Diese Abnahme ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Aussage „Menschen mit schizophrenen Störungen haben eine Persönlichkeitsspaltung“ zum Zeitpunkt 2 deutlich seltener erfolgte. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Korrektur dieses Einstellungsstereotyps einen Fokus im Rahmen der Informationsveranstaltung darstellte. Diese Fehlmeinung trifft man besonders bei Menschen mit höherem Bildungsstand häufiger an [10, 15]. Bei näherer Betrachtung ist dies nicht verwunderlich, da der von Eugen Bleuler eingeführte Krankheitsname eine Neubildung aus dem griechischen σχιζειν (spalten) und ϕρην (Geist, Gemüt) darstellt. Sogar in einem Standardwerk zur Etymologie [18] wird Schizophrenie als „Bewusstseinsspaltung“ bezeichnet. Die Zunahme der akzessorischen Symptome nach Bleuler ist zwar in Gruppe A viel stärker als in Gruppe B, kann aber nur die schlechtere Benotung der Gruppe A bei der Befragung vor der Informationsver- 97 anstaltung erklären, nicht jedoch die deutlich bessere Benotung dieser Gruppe bei der zweiten Befragung. Als wahrscheinliche Erklärung bleiben somit nur die Grundsymptome übrig, die ja mit einer besseren Benotung signifikant korrelierten und in Gruppe A bei der zweiten Befragung viel häufiger genannt wurden als bei der ersten, während sie in Gruppe B in etwa gleich blieben. Dass in der Gruppe A, also in jener Gruppe, in der die Betroffene den Unterricht wesentlich mitgestaltete, verstärkt Grundsymptome schizophrener Erkrankungen vermittelt wurden, kann auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden. Zum einen scheinen die beiden Experten in der Gruppe B die paranoid-halluzinatorische Symptomatik als zentral für die schizophrenen Störungen vermittelt zu haben; dies entspricht der Gewichtung der Symptomatik in den zur Zeit maßgeblichen Klassifikationssystemen, wie ICD-10 und DSM IV. Zum anderen wurden seitens der Betroffenen den Schülerinnen und Schülern der Gruppe A schwerpunktmäßig Basisstörungen als subjektives Erleben schizophrener Vulnerabilität und v. a. ihre Auswirkungen auf den Lebensvollzug näher gebracht. Die Darstellung der in einer akuten Krankheitsepisode erlebten produktiven Symptomatik wurde eher vermieden. Diese wird häufig verdrängt oder verschwiegen, da dieses Erleben u a. oft mit Peinlichkeit und Scham vergesellschaftet ist. Berücksichtigt man ein anderes Ergebnis dieser Pilotstudie [21], nämlich, dass sich in Gruppe A gegenüber der Gruppe B die soziale Distanz gegenüber eines in der Vignette beschriebenen fiktiven Mitschülers mit einer schizophrenen Erkrankung deutlich verbesserte, scheint es wichtig, im Rahmen einer Information auch die Grundsymptome dieser Erkrankung und ihre Auswirkungen auf den Lebensvollzug der Betroffenen näher zu bringen. Diese könnten für einen Außenstehenden wesentlich nachvollziehbarer und einfühlbarer 98 Sulzenbacher, Schmid, Kemmler, De Col und Meise sein, als es die produktive Symptomatik sein kann. In der Gruppe (Gruppe A), in welcher die Informationsveranstaltung unter Mitarbeit einer Betroffenen erfolgte, hat sich somit das Wissen für die häufig eine akute Krankheitsphase länger überdauernde Symptomatik, das subjektive Erleben und die Schwierigkeiten, die eine schizophrene Erkrankung für den Betroffenen verursacht, im Gegensatz zur anderen Gruppe deutlich verbessert. Dies ist ein weiterer Beleg, dass es wichtig ist, der Gesellschaft die Möglichkeit der Begegnung mit von schizophrenen Erkrankungen Betroffenen zu eröffnen. Dadurch wird eine breitere Innensicht der Erkrankung vermittelt und eher Empathie geweckt, als wenn die Informationsvermittlung ausschließlich durch Expertinnen erfolgt bzw. das Hauptaugenmerk z.B. auf die Darstellung „produktiver Krankheitssymptome“ gelegt wird. [3] Angermeyer M.C., A. Holzinger, H. Matschinger: Lebensqualität, das bedeutet für mich ... Psychiat Prax 26, 56-60 (1999). Angermeyer M.C., H. Matschinger, T. Held: Bereitschaft zu persönlichem Engagement für psychisch Kranke. Ergebnisse einer Repräsentativerhebung in der Bundesrepublik Deutsch- [21] Meise U., H. Sulzenbacher, G. Kemmler, R. Schmid, W. Rössler, V. Günther: „... nicht gefährlich, aber doch furchterregend”.“Ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophrenie in Schulen. Psychiat Prax 27, 340-346 (2000). [22] Penn D.L., K. Guynan, T. Daily, W.D. Spaulding, C.P. Garbin, M. Sullivan: Dispelling the Stigma of Schizophrenia: What Sort of Information Is Best? Schizophr Bull 20, 567-577 (1994). [23] Penn D.L., S. Kommana, M. Mansfield, B.G. Link: Dispelling the Stigma of Schizophrenia: II. The Impact of Information of Dangerousness. Schizophr Bull 25, 437-446 (1999). [24] Grausgruber A., G. Hofmann, W. Schöny, K. Zapotoczky: Einstellung zu psychisch Kranken und zur psychosozialen Versorgung. Stuttgart, New York: Georg Thieme Verlag (1989). Priebe S.: Welche Ziele hat psychiatrische Rehabilitation, und welche erreicht sie? Psychiat Prax 28, 36-40 (1999). [25] Harding C.M, J.H. Zahniser: Empirical correction of seven myths about schizophrenia with implications for treatment. Acta Psychiatr Scand 90 (suppl 384), 140-146 (1994). Sartorius N.: Eines der letzten Hindernisse einer verbesserten psychiatrischen Versorgung: Das Stigma psychischer Erkrankungen Neuropsychiatrie 16, 1/2: 5-10 (2002). [26] Schöny W.: Schizophrenie hat viele Gesichter. Die österreichische Kampagne zur Reduktion des Stigma und der Diskriminierung wegen Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 48-53 (2002). [27] Six B.: Die Relation von Einstellung und Verhalten. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 270-296 (1975). [28] Straub E.: Diskriminierung der psychisch Kranken in Fernsehfilmen. Psychiat Prax 14, 213-214 (1997). [29] Wicker A.: Attitudes versus action: The relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects. Journal of Social Issues, 41-78 (1969). [30] Zubin J., B. Spring: Vulnerability: a new view of Schizophrenia. J Abnorm Psychol 86, 103-126 (1977). Cumming E., J. Cumming: Closed ranks: an experiment in mental health. Cambridge, MA: Harvard University Press (1957). [6] Duden: Band 5. Das Fremdwörterbuch. Mannheim, Wien, Zürich (1996). [7] Fabrega H.: Psychiatric stigma in the classical and medieval period: a review of the literature. Comprehensive Psych 31, 289-306 (1990). [8] Finzen A.: Psychose und Stigma. Psychiatrie Verlag Bonn (2000). [9] Goffman E.: Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall (1963). [10] [11] Grausgruber A., H. Katschnig, U. Meise, W. Schöny: Einstellung der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 54-67 (2002). Hoffmann-Richter U., A. Finzen: Das „Odium der Geisteskrankheit“. Die Psychose Emilie Kempin-Spyris und ihre Deutungen. Psychiat Prax 24, 2227 (1997). [14] Hoffmann-Richter U., B. Alder, V. Hinselmann, A. Finzen: Schizophrenie in der „Neuen Zürcher Zeitung“: Eine Medienanalyse. Psychiat Prax 25, 1418 (1998). [15] Holzinger A., M.C. Angermeyer, H. Matschinger: Was fällt Ihnen zum Wort Schizophrenie ein? Eine Untersuchung zur sozialen Repräsentation der Schizophrenie. Psychiat Prax 25, 9-13 (1998). Literatur [2] Meinefeld W.: Einstellung und soziales Handeln. Reinbek: Rowohlt Verlag (1977). [5] [13] Angermeyer M.C.: Interventionen zur Reduzierung des Stigmas der Schizophrenie: Konzeptuelle Überlegungen Neuropsychiatrie 16, 1/2: 39-45(2002). [20] Byrne P.: Psychiatric stigma: past, passing and to come. J R Soc Med 90, 618621 (1997). Danksagung [1] Krech D., R.S. Crutchfield, E.L. Ballachey: Individual in society. A textbook of social psychology. New York: Mac Graw-Hill (1962). [4] [12] Mag. Christina Haller, Prof. Dr. Martina Hummer sowie OA Dr. Ilse Kurzthaler sei für Ihre Mitarbeit gedankt. [19] land. Neuropsychiatrie 9, 130-136 (1995). [16] Kardorff E.: Die Bedeutung der Arbeit für psychisch kranke Menschen im gesellschaftlichen Wandel. Psychiat Prax 26, 25-29 (1999). [17] Katschnig H.: Stigmarelevante historische Wurzeln des Schizophreniekonzepts in Kraepelins, Bleulers und Schneiders Werk. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 11-19 (2002). [18] Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Berlin, New York: Walter de Gruyter (1999). A. Univ.-Prof. Dr. Ullrich Meise Psychiatrisch-Psychotherapeutische Tagesklinik der Univ.-Klinik für Psychiatrie, Innsbruck Anichstraße 35 6020 Innsbruck email: [email protected] ORIGINAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 99 – 102 Behandlungsvorstellungen der Bevölkerung zu Depression und Schizophrenie Christoph Lauber, Carlos Nordt, Luis Falcato und Wulf Rössler Psychiatrische Universitätsklinik, Zürich Schlüsselwörter Depression – Schizophrenie – Einstellung – Behandlung – Allgemeinarzt – Psychiater – Psychologe – öffentliche Meinung Key words Depression – schizoprenia – attitude – treatment – general practitioner – psychiatrist – psychologist – public opinion Behandlungsvorstellungen der Bevölkerung zu Depression und Schizophrenie Im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage über psychische Erkrankungen in der Schweiz wurde den Befragten in einer Vignette entweder ein schizophren oder depressiv Kranker vorgestellt. Aus einer Liste von 9 potentiellen Helfern wollten wir wissen, welche empfohlen und von welchen abgeraten würde. Rund zwei Drittel erachteten Psychologen und Hausärzte als hilfreich, weniger jedoch Psychiater und psychiatrische Institutionen. Alternative und schulmedizinische Ansätze wurden kontrovers betrachtet. Unterschiede im Antwortverhalten zwischen den beiden Vignetten zeigen, dass depressive Symptome deutlich weniger im Krankheitsbereich angesiedelt wurden. Folglich wurden weniger psychiatrische, sondern eher alltägliche Bewältigungsstrategien empfohlen. Aus dieser Untersuchung können wir folgende Schlüsse ziehen: (1) Das Bewusstsein, dass Depression eine Krankheit ist und deshalb einer Behandlung bedarf, muss geweckt werden. (2) Hausärzte und andere im sozialen Bereich Tätige müssen gezielt auf ihre Aufgabe als erste Ansprechpersonen für Men- schen in psychischer Not vorbereitet werden. Public’s Treatment Proposals for Depression and Schizophrenia Background: As psychiatric illnesses have a high life time risk, the population has probably contact to mental illness at some time. In this context, the personal viewpoint concerning treatment possibilities is crucial as it influences the own compliance, the recommendations to the affected, and the judgement of the measures taken. Method: In Switzerland we did a representative opinion survey (n=1737) on public attitude to mental illness, psychiatric treatment, and the institutions involved. The interviewees were presented with a vignette depicting a case of either depression or schizophrenia. Out of a list of 9 proposals we asked them to indicate both all helpful and all harmful proposals. Results: Two third favoured psychologists and general practitioners. Psychiatrists and psychiatric institutions were regarded as less helpful. Further, the public warned against dealing alone with the situation. Alternative and standard psychiatric treatments are controversially discussed. Distinctions made between the two vignettes indicate that the depressive person compared to the schizophrenic was considered less pathological. Conclusions: (1) The fact that depression is a serious illness and, therefore, requires a treatment must be better communicated. (2) General practitioners and those working in the health system must be specifically prepared for their task to be the first contact person for people with mental difficulties. Einleitung Die Lebenszeitprävalenz psychischer Krankheit ist hoch [1]. Somit werden grosse Teile der Bevölkerung eigene Erfahrungen mit psychischer Krankheit oder irgendeinmal in ihrem Leben Kontakt zu psychisch Kranken haben. Es ist wichtig, die Einstellung der Bevölkerung zu psychischer Krankheit zu kennen, weil sie im Falle eigener Betroffenheit die Behandlungsbereitschaft beeinflussen, aber auch wesentlich das weitere Umfeld psychisch Kranker prägen wird. Die Einstellung wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, wobei neben soziodemographischen auch kulturelle und individuelle Variablen eine Rolle spielen [2 – 5]. Obwohl psychische Krankheiten wirksam behandelt werden können, zeigt eine australische Studie, dass Standardbausteine psychiatrischer Therapie wie Psychopharmaka und Elektrokrampftherapie von der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt werden. Sogenannte alternative Heilmethoden, z.B. Yoga und Naturheilmittel, werden hingegen für wirksam gehalten [6]. Eine Mehrheit in 100 Lauber, Nordt, Falcato und Rössler Deutschland erachtet die Psychotherapie als geeigneten Therapieansatz, weil damit psychische Erkrankungen ursächlich behandelt werden könnten [7]. Bei den möglichen Helfern werden bei Schizophrenen der Psychiater und eine vertraute Person als erste genannt, bei Depressiven werden eine vertraute Person und der Hausarzt erwähnt [8]. Die Einschätzung, welche Hilfe oder welcher Helfer in einer bestimmten Situation hilfreich sein könnte, ist ein wesentlicher Faktor, wenn Betroffene von Laien Ratschläge erhalten. Um darauf gezielt Einfluss nehmen zu können, ist es wichtig, die entsprechende Meinung der Bevölkerung zu kennen. Deshalb haben wir in der Schweiz eine Bevölkerungsumfrage über Einstellungen zu psychischer Gesundheit, psychiatrischer Behandlung und psychiatrischen Institutionen durchgeführt. Ausgehend von zwei Vignetten, die je eine schizophrene und eine depressive Person darstellen, wollten wir von den Befragten aus einer Liste von 9 potentiellen Helfern wissen, welche sie empfehlen und von welchen sie abraten. würden. Folgende Helfer standen zur Auswahl: Psychologe, Sozialarbeiter, telephonische Beratung, Psychiater, Naturheilpraktiker, Hausarzt, Pfarrer, alleine mit der Situation zurechtkommen und eine Hospitalisation in einer psychiatrischen Klinik. Um die Qualität der Aussagen zu verbessern, hatten wir den Befragten die Liste der Helfer vor dem Interview zugeschickt. Um signifikante Unterschiede zwischen den Vorschlägen für die depressive und die schizophrene Vignette zu finden, benutzten wir den Chi-Quadrat-Test. Resultate Die Angaben aller 1737 Befragten konnten ausgewertet werden. Die prozentuale Verteilung der Antworten wird in Tabelle 1 dargestellt. 68 % sahen Psychologen, 57 % Hausärzte und 51 % Psychiater als adäquate Behandler. Helfende Berufe im weiteren Sinne wie Pfarrer und Sozialarbeiter sowie eine telephonische Beratung fanden bei etwas mehr als einem Viertel Zustimmung. 15 % empfahlen eine Hospitalisation in einer psychiatrischen Klinik. 65 % der Befragten Tab. 2: Dissenswerte der Behandlungsvorstellungen Psychiatrische Klinik Naturheilpraktiker Pfarrer Telefonische Beratung Sozialarbeiter Psychiater Hausarzt Alleine zurechtkommen Psychologe Kein Ratschlag 0.27 0.22 0.19 0.13 0.09 0.09 0.05 0.04 0.03 0.00 rieten davon ab, dass jemand in der geschilderten Situation alleine zurechtkommen soll. Ein Fünftel erachtete die Hospitalisation in einer psychiatrischen Klinik als nicht ratsam. Um die umstrittensten Vorstellungen zu finden, wurde der Dissenswert berechnet (Tabelle 2). Der Dissenswert z (0 ≤ z ≤ 1) wird folgendermassen berechnet: (x:y):(x+y), wobei x < y. Er ist dann maximal, wenn alle Befragten zu einer bestimmten Frage eine Meinung vertreten (hier: „empfehlenswert“ und „nicht zu empfehlen“) und diese beiden Möglichkeiten gleich häufig vertreten werden (hier: die beiden Gruppen sind gleich gross). Die Hospitalisation in einer psychiatrischen Klinik sowie Hilfe Methode Wir haben 1737 Einwohner der Schweiz, eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung zwischen 16 und 76 Jahren, telephonisch befragt. Die Stichprobe und die Methodik wurden bereits anderswo beschrieben [3]. Es wurde zuerst eine Vignette vorgelesen, die entweder einen depressiven oder einen schizophrenen Menschen darstellte. Wir baten darauf die Interviewten, aus 9 potentiellen Therapeuten oder Therapieformen (professionelle und andere) diejenigen Vorschläge anzugeben, welche sie als hilfreich erachteten. Dann wurden die Befragten gefragt, von welchen der Vorschläge sie abraten Tab. 1: Behandlungsvorstellungen, geordnet nach den Beurteilungskriterien „zu empfehlen“ und „nicht zu empfehlen“ (N=1737) „Zu empfehlen“ Psychologe Hausarzt Psychiater Telefonische Beratung Pfarrer Sozialarbeiter Naturheilpraktiker Psychiatrische Klinik Alleine zurechtkommen Kein Ratschlag „Nicht zu empfehlen“ 68 % 57 % 51 % 29 % 28 % 28 % 20 % 15 % 4% 0% Alleine zurechtkommen Psychiatrische Klinik Naturheilpraktiker Pfarrer Telefonische Beratung Psychiater Sozialarbeiter Hausarzt Psychologe Kein Ratschlag 65 % 21 % 13 % 13 % 9% 8% 7% 5% 3% 1% 101 Behandlungsvorstellungen der Bevölkerung zu Depression und Schizophrenie Tab. 3: Vergleich der Behandlungsvorstellungen für die beiden Vignetten (Depressionsvignette: N=873; Schizophrenievignette: N=864). Signifikante Unterschiede (p<0.001) sind hervorgehoben. „Zu empfehlen“ Depression Kein Ratschlag Psychologe Sozialarbeiter Telefonische Beratung Psychiater Naturheilpraktiker Hausarzt Pfarrer Alleine zurechtkommen Psychiatrische Klinik 0% 68 % 28 % 30 % 44 % 21 % 58 % 30 % 5% 10 % durch einen Naturheilpraktiker und einen Geistlichen haben sich als umstrittenste Vorschläge herausgestellt. Zwischen den zwei Vignetten wurden signifikante Unterschiede gemacht (Tabelle 3): für die schizophrene Vignette wird das Aufsuchen eines Psychiaters mehr empfohlen als für die depressive. Depressiven wird weniger als Schizophrenen geraten, sich in einer psychiatrischen Klinik behandeln zu lassen. Bei Schizophrenen wird der Psychiater häufiger erwähnt. Diskussion Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass wenig Dissens herrscht über die Einschätzung bezüglich Psychologen und Hausärzten, welche von ca. zwei Dritteln als hilfreich angesehen werden. Einigkeit herrscht auch, dass von „alleine zurecht kommen“ abgeraten wird. Andere Helfer werden divergent beurteilt: Aufsuchen eines Geistlichen oder eines Naturheilpraktikers sowie die Hospitalisation in einer psychiatrischen Klinik. Unterschiede Schizophrenie 0% 69 % 28 % 27 % 57 % 18 % 55 % 26 % 4% 21 % „Nicht zu empfehlen“ Depression 0% 3% 8% 10 % 9% 12 % 4% 13 % 63 % 26 % Schizophrenie 1% 3% 7% 9% 7% 15 % 6% 14 % 66 % 16 % in der Beurteilung, wer hilfreich sein könnte, werden auch zwischen den zwei Vignetten gemacht: Depressiven wird deutlich weniger zu psychiatrischer Hilfe geraten als Schizophrenen. Wie sind nun die erhobenen Aussagen einzuschätzen? Am wesentlichsten erscheint uns die Frage, ob die genannten Helfer eine adäquate Behandlung anbieten können. Die Hälfte bis zwei Drittel der Befragten erachteten hier die drei Stützen der psychiatrischen Therapie – Hausarzt, Psychiater und Psychologe – als hilfreich. Dies ist deutlich weniger, als es aus den neuen Bundesländer Deutschlands berichtet wird [8]. Gründe dafür bleiben spekulativ, liegen aber möglicherweise doch darin begründet, dass alternative Heilmethoden in den neuen Bundesländern zum Zeitpunkt der Erhebung (Frühling 1993) weniger bekannt und verbreitet waren als in der Schweiz knapp sechs Jahre später. Der Hausarzt wird an zweiter und nicht an erster Stelle genannt. In der Realität ist es aber oft der Hausarzt, der als erster Fachmann mit psychischem Leiden in Kontakt kommt und dieses erkennt. Als Generalist muss er dementsprechend speziell für die Aufgabe als erster Ansprechpartner bei psychischen Problemen ausgebildet werden. Nicht erwähnt Depression Schizophrenie 99 % 28 % 64 % 60 % 47% 67 % 38 % 57 % 32 % 64 % 99 % 28 % 65 % 63 % 36 % 67 % 39 % 60 % 30 % 63 % Als hilfreich werden auch Personen des erweiterten sozialen Hilfesystems gesehen, die durch ihre Tätigkeit mit seelischem Leiden in Kontakt kommen. Telephonische Beratungsstellen und kirchlich wie sozial Tätige sind je länger je mehr erste Anlaufstelle von Menschen in psychischer Not. Daraus ergibt sich, dass auch sozial Tätige Zeichen seelischer Krankheit kennen und erkennen müssten, um rechtzeitig aufmerksam zu werden und eine adäquate Therapie einzuleiten. Die Unterschiede in den Empfehlungen, die zwischen den Vignetten gemacht werden, sind bemerkenswert. Aufsuchen eines Psychiaters und die Hospitalisation in einer psychiatrischen Klinik werden eher für Schizophrene und weniger für Depressive empfohlen. Bei den Depressiven fällt der grosse Unterschied zwischen den Empfehlungen bezüglich den Psychologen, Hausärzten und Psychiatern auf, wobei letztere mit 44 % das Schlusslicht bilden. Dies mag damit zusammenhängen, dass Labels, die einen depressiven Zustand darstellen, oft nicht als krankheitsbedingt erkannt, sondern als normalpsychologisch verstanden werden. Folglich werden sie auch nicht „behandelt“, d.h. auch nicht „psychiatrisiert“, sondern mit zwar 102 Lauber, Nordt, Falcato und Rössler populären Alltagsratschlägen, aber nicht genügend wirksamen Hausmitteln oder mit Ratschlägen wie „Selbsthilfe“ und „Mobilisierung des sozialen Netzes“ angegangen, wie eine Untersuchung in Deutschland zeigte [7]. Die Symptom-Beschreibung eines schizophren Kranken wird eher als krankheitsbedingt empfunden, was auch aus professioneller Sicht adäquatere Behandlungsratschläge zur Folge hat, z.B. die häufigere Empfehlung von Psychopharmaka [9]. Es zeigt sich also, dass in der Bevölkerung das Bewusstsein mehr geweckt werden muss, dass psychische Leiden, insbesondere auch depressive Episoden, Krankheitswert haben und einer Behandlung bedürfen. Aus unserer Untersuchung können wir folgern, dass neben einer vertieften Ausbildung von Hausärzten und im Sozialbereich Tätigen auch Informationen über psychische Leiden, insbesondere die Depression, und die entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten sowohl in der Bevölkerung wie auch unter Professionellen erfolgen müssen. Literaturverzeichnis [1] Jenkins R., G. Lewis, P.E. Bebbington, T. Brugha, M. Farrell, B. Gill, H. Meltzer: The national psychiatric morbidity surveys of Great Britain – initial findings from the household survey. Psychological Medicine 27, 775 – 790 (1997). [2] Rössler W., H.J. Salize: Factors affecting public attitudes towards mental health care. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience 245, 20 – 26 (1995). [3] Lauber C., C. Nordt, N. Sartorius, L. Falcato, W. Rössler: Public acceptance of restrictions on mentally ill people. Acta Psychiatr Scand 2000; 102 (supp. 407): 26-32. [4] Lauber C., L. Falcato, W. Rössler: Attitudes to compulsory admission in psychiatry. The Lancet 355, 2080 (2000). [5] Lauber C., C. Nordt, L. Falcato, W. Rössler: Public acceptance of compulsory admission: an expression of trust in psychiatry. Acta Psychiatr Scand 2002; 105: 385-389. [6] Jorm A.F., A.E. Korten, B. Rodgers, P. Pollitt, P.A. Jacomb, H. Christensen, Z. Jiao: Belief systems of the general public concerning the appropriate treatments for mental disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 32, 468 – 473 (1997). [7] Angermeyer M.C., H. Matschinger: Public attitude towards psychiatric treatment. Acta Psychiatrica Scandinavica 94, 326 – 336 (1996). [8] Angermeyer M.C., H. Matschinger, S.G. Riedel-Heller: Whom to ask for help in case of a mental disorder? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 34, 202 – 210 (1999). [9] Lauber C., C. Nordt, L. Falcato, W. Rössler: Lay recommendations on how to treat mental disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2001; 36: 553556. Christoph Lauber Psychiatrische Univ.-Klinik Zürich Sozialpsychiatrische Forschungsgruppe Militärstrasse 8, Postfach 1930 CH-8021 Zürich, Schweiz e-mail: [email protected] ORIGINAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 103 – 107 Die Bewertung von Depression und Schizophrenie als psychische Krankheit und deren Einfluss auf die Hilfeempfehlung Carlos Nordt, Luis Falcato, Christoph Lauber und Wulf Rössler Psychiatrische Universitätsklinik, Zürich Schlüsselwörter Psychische Krankheit – Einstellung – Gesundheitsverhalten – Schweiz – Allgemeinarzt – Kultur – öffentliche Meinung – Behandlung Key words Mental disorder – attitude – health behaviour – Switzerland – general practitioner – culture – public opinion – treatment Die Bewertung von Depression und Schizophrenie als psychische Krankheit und deren Einfluss auf die Hilfeempfehlung Hintergrund/Fragestellung: Ratschläge aus dem sozialen Umfeld beeinflussen psychisch Kranke bei ihrer ersten Kontaktaufnahme mit Fachpersonen. Wir untersuchten die Frage, wieweit die subjektive Bewertung eines depressiven oder schizophrenen Menschen als „psychisch krank“ die Hilfeempfehlung prägen. Methode: Im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage über psychische Erkrankungen in der Schweiz wurde den Befragten in einer Fallbeschreibung entweder eine schizophrene oder depressive Person vorgestellt. Die Befragten mussten beurteilen, ob die geschilderte Person psychisch krank sei oder eine normale Reaktion in einer schwierigen Lebenssituation zeige. Aus einer Liste von neun potentiellen Hilfsangeboten wollten wir wissen, was als erste bzw. zweite Anlaufstelle empfohlen wird. Ergebnisse: Es zeigten sich Unterschiede in der Einschätzung der Vignetten: während über zwei Drittel der Befragten die schizophrenen Symptome als psychisch krank bezeichneten, wurde die depressive Person von einer Minderheit so einge- ordnet. Der Hausarzt wurde durchwegs als erster Ansprechpartner vorgeschlagen, gefolgt vom Psychologen und Psychiater. Ein sprachregionaler Unterschied zeigte sich bei den Befragten, welche vermuteten, es läge eine psychische Krankheit vor: In der deutschen und französischen Schweiz wurden Hausärzte häufiger empfohlen als in der italienischen Schweiz. Wurde die Falldarstellung als psychische Krankheit gesehen, so wurde der Psychiater in allen Sprachregionen häufiger empfohlen. Psychologen scheinen dagegen in der ganzen Schweiz sowohl für psychische Krankheiten wie auch für die Bewältigung von Lebenskrisen zuständig zu sein. Schlussfolgerung: Dem Hausarzt kommt als Anlaufstelle für psychisch Kranke je nach kulturellem Kontext eine andere Bedeutung zu. In der ganzen Schweiz werden Psychiater in erster Linie als Spezialisten für psychische Krankheiten wahrgenommen, dies im Gegensatz zu den Psychologen. Assessment of Depression and Schizophrenia as mental illness and its influence on the help-seeking recommendations Background: Mentally ill persons are influenced by their social environment when contacting mental health professionals for the first time. This study examine how much the subjective assessment whether a depressive or schizophrenic person is regarded as mentally ill by the public is influencing lay recommendations. Method: In Switzerland we conducted a representative opinion survey (n=1737) on public attitude to mental illness, psychiatric treatment, and the institutions involved. A vignette was presented depicting a case of either depression or schizophrenia. The interviewees were asked whether they regarded the described person as being mentally ill or expressing a normal reaction in a difficult life situation. Out of a list of nine proposals for help we further questioned to indicate their first and their second recommendation. Results: Two thirds of the respondents regarded the schizophrenic person as mentally ill whereas the depressive person was mainly considered as expressing a normal reaction in a difficult life situation. The preferred help proposal was the general practitioner (GP). Those who considered the person in the vignette as mentally ill proposed different recommendations depending on the lingustic area of Switzerland: GP’s were more recommended in the German and in the French part than in the Italian part. If the person was regarded as mentally ill, psychiatrists were more proposed. Psychologists were proposed independently of the evaluation of the vignette. Conclusions: Depending on the cultural context GP’s have a different function regarding the contact for mental illness. In Switzerland, psychiatrists are considered as specialists for mental disorders whereas psychologists are proposed independently of the nature of the disorder. 104 Nordt, Falcato, Lauber und Rössler Einleitung Etwa 50% der Bevölkerung leiden zumindest einmal in ihrem Leben an einer psychischen Krankheit, die der fachlichen Behandlung bedarf [1]. Obwohl in der Schweiz und anderen westlichen Ländern ein breites und differenziertes medizinisches, psychotherapeutisches und soziales Hilfesystem besteht, begeben sich Schätzungen zufolge fast zwei Drittel der Personen mit einer psychischen Erkrankung nicht in Behandlung [2]. Ein wichtiger Grund dafür besteht in der großen Diskrepanz zwischen den Vorstellungen der Fachleute und der Allgemeinbevölkerung über Ursachen und wirksame Behandlungsmöglichkeiten psychischer Krankheiten [3, 4]. Zur Verbesserung dieser Situation wurde vorgeschlagen, die Bevölkerung im korrekten Erkennen spezifischer psychischer Krankheitsbilder zu schulen [5]. Unserer Meinung nach kann es aber nicht darum gehen, die gesamte Bevölkerung zu Spezialisten auszubilden. Viel wäre schon erreicht, würden psychische Störungen als auffällig und zur Abklärung nötig erkannt. Wie andere [6] gehen wir davon aus, dass dem sozialen Umfeld der Betroffenen eine zentrale Rolle für die Vermittlung des Kontaktes zum Hilfesystem zukommt. Im Umfeld des Betroffenen werden bestimmte Verhaltensveränderungen wahrgenommen, als auffällig erachtet und unter Umständen als „krank“ bezeichnet. Diese Kategorisierung teilt eine prinzipiell kontinuierlich abgestufte Abweichung von der Norm anhand eines subjektiv festgelegten Schweregrades in „normal“ und „krankhaft“. Die Kategorisierung als „krank“ dürfte das Umfeld dazu veranlassen, vermehrt die Kontaktaufnahme mit einer Fachperson zu empfehlen. Wenn das Vorliegen einer psychischen Krankheit angenommen wird, so beeinflusst dies die wahrgenommene Zuständigkeit von Spezialisten wie Psychologe und Psychiater. Als Generalist hat der Hausarzt eine besondere Stellung in der Gesundheitsversorgung: er ist Vertrauensperson und primäre Anlaufstelle für alle mit der Gesundheit verbundenen Probleme und übernimmt die Abklärung und Überweisung an die Spezialisten. Für die Patienten unterliegt der Kontakt zum Hausarzt – im Gegensatz zum Kontakt zur Psychiatrie – keiner Stigmatisierung. Unser Konzept beinhaltet also die Annahme, dass die empirisch gefundenen Unterschiede der Hilfeempfehlungen zu verschiedenen Fallbeschreibungen [6] massgeblich vom subjektiv wahrgenommenen „Schweregrad“ der psychischen Krankheit abhängen. Bei einer Fallbeschreibung eines Schizophrenen, im Vergleich zur Beschreibung eines Depressiven, wird der Kontakt mit einem Psychiater deshalb häufiger empfohlen, weil bei ersterer Fallbeschreibung häufiger vermutet wird, dass eine psychische Krankheit vorliegen könnte, und nicht weil die in der Vignette dargestellte Diagnose richtig „erkannt“ wird. Die Symptome der Schizophrenie, z.B. Wahn oder Halluzinationen, weichen stärker von der kulturellen Norm ab und werden subjektiv eher als schwere psychisch Krankheit wahrgenommen. Wir postulieren, dass sich die für die Allgemeinbevölkerung relevanten Unterschiede zwischen den diagnostischen Vignetten auf den subjektiv wahrgenommenen Schweregrad der Fallbeschreibung beziehen und dadurch die Hilfeempfehlungen geprägt werden. Im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage über Einstellungen zu psychischer Krankheit, psychiatrischer Behandlung und psychiatrischen Institutionen wurde nach der Fallbeschreibung einer Depression bzw. Schizophrenie die subjektive Zuschreibung „psychisch krank“ versus „normale Reaktion in einer schwierigen Lebenssituation“ erfragt und aus einer Liste mit neun potentiellen Helfern eine erste und zweite Hilfeempfehlung erhoben. Da unsere Untersuchung in der italienischen, französischen und deutschen Schweiz durchgeführt wurde und die Vermutung nahe liegt, dass der soziokulturelle Kontext die Einstellung zu psychischen Krankheiten und die Hilfeempfehlungen massgeblich beeinflusst, wurden die Daten sprachregional getrennt untersucht. Wir haben folgende empirisch zu prüfende Hypothesen abgeleitet: 1. Die Fallbeschreibung der Schizophrenie wird häufiger als „psychisch krank” bezeichnet, weil die Symptome der Schizophrenie mehr von der kulturellen Norm abweichen als diejenigen der Depression. 2. Der Hausarzt wird häufiger empfohlen, wenn die Fallbeschreibung als psychische Krankheit denn als normale Reaktion in einer schwierigen Lebensphase angesehen wird, da er als Generalist als primäre Anlaufstelle für alle mit der Gesundheit verbundenen Probleme wahrgenommen wird. 3. Spezialisten wie Psychologen und Psychiater werden insbesondere dann empfohlen, wenn das Vorliegen einer psychischen Krankheit angenommen wird, und weniger, wenn der Befragte von einer normalen Reaktion in eine schwierige Lebensphase ausgeht, weil beide Berufsgruppen in erster Linie als Spezialisten für psychische Krankheiten wahrgenommen werden und die Kontaktaufnahme für den Patient stigmatisierend sein kann. 4. Im Sinne einer Nullhypothese wird angenommen, dass keine sprachregionalen Unterschiede bestehen. Methode 1737 Personen der schweizerischen Wohnbevölkerung im Alter zwischen 16 und 76 Jahren – eine repräsentative Stichprobe der 105 Die Bewertung von Depression und Schizophrenie als psychische Krankheit ... Schweizer Bevölkerung – wurden telefonisch befragt [7]. Um Vergleiche zwischen den Sprachregionen statistisch absichern zu können, wurden überproportional viele Bewohner der italienischen (N=426) und der französischen (N=520) Schweiz verglichen zur Deutschschweiz (N=791) einbezogen. In einer Vignette wurde den Befragten ein depressiver oder ein schizophrener Mann geschildert, dessen Krankheitsbild den DSM-IIIR-Kriterien entsprechen. Der Hälfte der Interviewten wurde die Frage gestellt, ob sie die dargestellte Person als psychisch krank bezeichnen würden, oder ob sie dies als eine normale Reaktion in einer schwierigen Lebenssituation erachteten. Um die Einstellung der Behandlungsratschläge zu erheben, baten wir darauf alle Befragten, aus 9 potentiellen Berufsgruppen oder Therapieformen diejenigen Vorschläge anzugeben, welche sie als hilfreich empfänden. Danach wurde gefragt, welches ihr erster und zweiter Rat an die geschilderte Person wäre, um so die sequentielle Abfolge der Hilfeempfehlungen festzuhalten. Folgende Möglichkeiten standen zur Auswahl: Psychologe, Sozialarbeiter, telefonische Beratung, Psychiater, Naturheilpraktiker, Hausarzt, Pfarrer, alleine mit der Situation zurechtkommen und eine Hospitalisation in einer psychiatrischen Klinik. Um Unterschiede statistisch zu prüfen, wurde der Chi-Quadrat-Test verwandt. Resultate Wie Tabelle 1 zeigt, wurde die in der Schizophrenie-Vignette dargestellte Person in allen drei Sprachregionen von mehr als zwei Drittel der Befragten als psychisch krank bezeichnet bzw. wurde das in der Vignette beschriebene Verhalten von einem Drittel bis einem Fünftel der Interviewten als „normale Reaktion in einer schwierigen Lebenssituation“ angesehen. Die DepressionsVignette wurde im italienischsprachigen Teil der Schweiz von 26 % als psychische Krankheit eingeordnet, in deutschen und französischen Schweiz von über 40 %. Tab. 1: Erkennen der Depressions- und Schizophrenie-Vignetten als psychische Krankheit, nach Sprachenregionen geordnet Deutsche Schweiz (N=374) psychisch krank Französische Schweiz (N=270) psychisch krank Italienische Schweiz (N=200) psychisch krank Depression 42 % 46 % 26 % Schizophrenie 67 % 80 % 72 % Missing in allen Fällen unter 3 % Tab. 2: Erste und zweite Hilfeempfehlung, nach Sprachregionen geordnet Hausarzt Psychologe Psychiater Telefonische Beratung Pfarrer Naturheilpraktiker Sozialarbeiter Psychiatrische Klinik Alleine zurechtkommen Kein Ratschlag Deutsche Schweiz (N=791) Französische Schweiz (N=520) Italienische Schweiz (N=426) 1. Rat 2. Rat 1. Rat 2. Rat 1. Rat 2. Rat 40 % 25 % 13 % 4% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 9% 22 % 19 % 5% 7% 4% 5% 3% 1% 5% 38 % 24 % 12 % 2% 2% 1% 4% 1% 1% 1% 14 % 19 % 16 % 4% 5% 3% 5% 3% 1% 3% 33 % 25 % 11 % 8% 4% 2% 5% 1% 1% 3% 12 % 25 % 13 % 5% 5% 2% 8% 3% 2% 6% 106 Nordt, Falcato, Lauber und Rössler In allen drei Sprachregionen wurde der Hausarzt als erste Hilfeempfehlung am häufigsten angegeben, als zweite Hilfeempfehlung aber deutlich weniger genannt (Tabelle 2). Ebenso wird der Psychologe als erste Hilfeempfehlung etwa doppelt so häufig wie der Psychiater genannt. Als zweite Hilfeempfehlung wird in der deutschen und französischen Schweiz der Psychiater beinahe so oft wie der Psychologe angegeben. Alle anderen Hilfeempfehlungen werden von weniger als 10 % der Befragten genannt. Tabelle 3 zeigt einen erheblichen sprachregionalen Unterschied: In der deutschsprachigen Schweiz wurde der Hausarzt mehrheitlich von den Personen empfohlen, welche die Fallbeschreibung als psychisch krank einordneten (Chi-Quadrat <0.001), in der italienischen Schweiz zeigt sich das Gegenteil (Chi-Quadrat <0.01). In der französischen Schweiz wird zur Konsultation beim Hausarztes unabhängig von der Einordnung geraten. Die Hilfeempfehlung des Psychologen ist in allen drei Sprachregionen der Schweiz unabhängig von der krankheitsbezogenen Beurteilung. Dagegen ist Empfehlung des Psychiaters in allen Sprachregionen signifikant häufiger (Chi-Quadrat <0.001), wenn die Fallbeschreibung als psychische Krankheit eingeordnet wurde. Statistisch signifikante Unterschiede der Hilfeempfehlungen bezüglich der drei Sprachregionen zeigten sich in einem der sechs Konfigurationen von Tabelle 3. Die Befragten, welche eine psychische Krankheit annahmen, empfahlen in der italienischen Schweiz den Hausarzt deutlich weniger als in den anderen Landesteilen (Chi-Quadrat <0.001). Diskussion Zusammenfassend können wir festhalten, dass über zwei Drittel der Befragten die in der Schizophrenievignette dargestellte Person als psychisch krank beurteilt haben. In der deutschen und französischen Schweiz bezeichneten mehr als die Hälfte die geschilderte depressive Symptomatik als normale Reaktion in einer schwierigen Lebenssituation, jedoch drei Viertel der Befragten in der italienischen Schweiz. In allen drei Sprachregionen wird der Hausarzt am häufigsten als erster Ansprechpartner für die geschilderte Situation genannt, gefolgt von Psychologen bzw. Psychiatern. In der Deutschschweiz ist die Einschätzung, dass jemand psychisch krank ist, ein zusätzlicher Grund, zum Hausarztbesuch zu raten. Die Befragten der italienischen Schweiz sind diesbezüglich anderer Meinung, denn der Hausarzt wird mehrheitlich empfohlen, wenn es sich aus der Sicht der Befragten nicht um eine psychische Krankheit handelt. Diesbezügliche sprachregionale Unterschiede bei Psychologen und Psychiatern wurden nicht gefunden. Unsere erste Hypothese, dass die Schizophrenievignette häufiger als die Depressionsvignette als „psychisch krank“ bezeichnet wird, bestätigt sich in allen drei Sprachregionen. Die zweite Hypothese, dass der Hausarztbesuch vermehrt empfohlen wird, wenn eine „psychische Krankheit“ vorzuliegen scheint, bestätigt sich einzig in der deutschsprachigen Schweiz. Jedoch wird der Hausarzt in allen drei Sprachregionen am häufigsten als erste Hilfeempfehlung angegeben. Dies erhärtet unsere Annahme [8], dass der Hausarzt als erste Fachperson mit psychischen oder psychiatrischen Leiden in Kontakt kommt. Wir nehmen an, dass der Hausarztbesuch häufig als erster Rat angegeben wird, weil dieser als Generalist für Tab. 3: Empfehlung des Hausarztes, Psychologen und Psychiaters (1. und 2. Hilfeempfehlung) nach Einordnung der Vignette, nach Sprachenregionen geordnet Deutsche Schweiz Französische Schweiz Italienische Schweiz P (Chi-Quadrat) Hausarzt Psychisch Krank (N=471) Normale Reaktion (N=373) 57 % 40 % 54 % 52 % 32 % 51 % 0.001 NS Psychologe Psychisch Krank (N=471) Normale Reaktion (N=373) 41 % 49 % 47 % 47 % 52 % 45 % NS NS Psychiater Psychisch Krank (N=471) Normale Reaktion (N=373) 37 % 19 % 37% 13 % 32 % 13 % NS NS 107 Die Bewertung von Depression und Schizophrenie als psychische Krankheit ... alle medizinischen Probleme zuständig ist. Dass er nicht als Spezialist für psychische Krankheiten wahrgenommen wird, zeigt sich darin, dass er im zweiten Ratschlag deutlich weniger genannt wird als die fachspezifischen Helfer. Dies würde auf eine niedrigschwellige, nicht stigmatisierende Triagefunktion des Hausarztes im Sinne eines „Gatekeeper“ hinweisen. Daneben zeigt sich, dass ein stufenweises Vorgehen in der Problembewältigung empfohlen wird. Erfolgt eine Weiterweisung, wird derjenige Spezialist empfohlen, dem am ehesten Fachkompetenz zugestanden wird. Die dritte Hypothese, dass sowohl Psychologen wie auch Psychiater bei der Annahme einer psychischen Krankheit häufiger empfohlen werden, trifft nur für letztere zu. Es scheint in der ganzen Schweiz die Idee vorzuherrschen, dass ein Psychologe sowohl für psychische Krankheiten wie auch bei der Bewältigung von Lebenskrisen zuständig ist. Dies könnte auch erklären, weshalb die Psychologen deutlich mehr empfohlen wurden als die Psychiater. Dieser Befund steht im Gegensatz zu deutschen Untersuchungen, in denen sich gezeigt hat, dass eher Psychiater als Psychologen empfohlen wurden [6]. Sprachregionale Besonderheiten wurden in der italienischen Schweiz festgestellt: Zum einen wird die Person, die in der Depressionsvignette geschildert wird, deutlich weniger als psychisch krank erkannt, zum andern wird der Hausarzt signifikant weniger als erste Anlaufstelle bei vermuteter psychischer Krankheit genannt. Wir interpretieren diese Resultate als kulturell bedingt. Eine mögliche Erklärung wäre, dass die geschilderten Depressionssymptome nicht den kulturspezifischen Symptomen der Depression entsprechen. U. W. gibt es keine Untersuchung, welche die Rolle des Hausarztes in der psychiatrischen Grundversorgung der italienischen Schweiz beleuchtet. Ein zur übrigen Schweiz unterschiedliches Gesundheitssystem besteht im Tessin nicht. Was auch immer die Ursachen für die soziokulturellen Unterschiede sein mögen, ist gemäß unseren Daten zu vermuten, dass Personen mit psychischen Störungen in der italienischen Schweiz weniger einer fachlicher Behandlung zugeführt werden, da einerseits die Bevölkerung psychische Krankheitssymptome weniger erkennt und andererseits der Hausarzt weniger als „Gatekeeper“ für psychische Krankheiten zuständig ist. From Diseases, Injuries, and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. Cambridge Mass., Harvard University Press 1996. [3] Jorm A.F., A.E. Korten, P.A. Jacomb, B. Rodgers, P. Pollitt, H. Christensen, S. Henderson: Helpfulness of interventions for mental disorders: beliefs of health professionals compared with the general public. British Journal of Psychiatry 171, 233 – 237 (1997). [4] Furnham A., P. Bower: A comparison of academic and lay theories of schizophrenia. British Journal of Psychiatry 161, 201 – 210 (1992). [5] Jorm A.F.: Mental health literacy. Public knowledge and beliefs about mental disorders. British Journal of Psychiatry 177, 396 – 401 (2000). [6] Angermeyer M.C., H. Matschinger, S.G. Riedel-Heller: Whom to ask for help in case of a mental disorder? Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 34, 202 – 210 (1999). [7] Lauber C., C. Nordt, N. Sartorius, L. Falcato, W. Rössler: Public acceptance of restrictions on mentally ill people. Acta Psychiatrica Scandinavica 102 (Suppl. 407) 26 – 32 (2000). [8] Lauber C., C. Nordt, L. Falcato, W. Rössler: Behandlungsvorstellungen der Bevölkerung zu Depression und Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 99-102 (2002). Literatur [1] [2] Kessler R.C., K.A. McGonagle, S. Zhao, C.B. Nelson, M. Hughes, S. Eshleman, H.U. Wittchen, K.S. Kendler: Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States. Archives of General Psychiatry 51, 8 – 19 (1994). Carlos Nordt Murray C.L., A.D. Lopez: The Global Burden of Disease. A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability CH-8021 Zürich, Schweiz Psychiatrische Univ.-Klinik Zürich Sozialpsychiatrische Forschungsgruppe Militärstrasse 8, Postfach 1930 E-Mail: [email protected] 109 Kommentar „Die Psychiatrie braucht Menschen, keine Leute“ Wilma Kantschieder, Oberdorf 24, A-6073 Sistrans, Österreich Vorbemerkungen des Herausgebers: Dieser Kommentar ist ein Brief, der mich einige Tage vor Drucklegung dieses Themenheftes erreichte. Es handelt sich um eine wahre Begebenheit, welche die Stigmatisierung psychisch Kranker betrifft und die somit nicht außergewöhnlich sondern leider alltäglich ist; in einer Hinsicht ist sie aber außergewöhnlich – dazu später. Neben den Produkten der Printmedien ist es besonders das Fernsehen, das zur Verfestigung des Stigmas psychisch Kranken beiträgt – „Bildwelt schafft Weltbild“. Durch Seifenopern, Fernsehserien oder Spielfilmen findet permanent – fast alltäglich – eine Diskriminierung psychisch Kranker statt. Als Tobias Moretti als Kommissar in der Fernsehserie „Kommissar Rex“ vor einigen Jahren Dank einem als psychisch krank bezeichneten Serienmörder aus der Serie aussteigen konnte, sahen über 2 Millionen Österreicherinnen und Österreicher zu. Unser nachfolgender Einspruch wurde von den im ORF dafür Verantwortlichen „abgeschmettert“; es handle sich nur um ein dramaturgisches Mittel um Spannung zu erzeugen; Zuseher könnten sehr wohl differenzieren und diese Geschichte als Fiktion erkennen. Nicht so offensichtlich meine Mutter, die diesen Film sah und mich besorgt um meine Sicherheit sofort anrief; trotzdem ich „erst“ seit etwa einem viertel Jahrhundert unbeschadet in der Psychiatrie arbeite. Auch die Werbung verwendet manchmal mit psychischer Erkrankung und Psychiatrie vergesellschaftete negative Stereotype, wahrscheinlich um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Frau Kantschieder fühlte sich – und mit ihr sicher viele tausend Menschen in Österreich – durch die Werbefolge einer Möbelfirma zu tiefst verletzt, gekränkt und abgewertet. Sie wandte sich an die Psychiatrie, suchte Verbündete und Unterstützung. Sie erbat Rückruf, wurde jedoch nicht zurückgerufen. Sie wandte sich an HPE, die, in solchen Angelegenheiten erfahren, meinte, dass man diesbezüglich beim ORF oder der Werbewirtschaft wenig erreichen würde. Daraufhin machte sie sich, nicht entmutigbar, alleine auf den Weg und erreichte es; der Werbespot wurde zurückgezogen. Für mich ein Beispiel für Empowerment. Ich glaube dazu brauchte es Courage; auch beim ORF und der Firma, die diesen Werbespot zurückzog. Ein paar Gedankensplitter zu Um-Welt-Vergiftung und Um-WeltSchutz im psychiatrischen Bereich: Wider das Schweigen Sollten Klinikleiter, Professoren, Ärzte und Therapeuten, die in der Psychiatrie tätig sind, nicht Stellung beziehen, sich persönlich verwenden wenn Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch Kranker ganz offen über den Bildschirm im ORF läuft? Schreiben Sie nicht Information, Aufklärung, Entstigmatisierung auf ihre Fahne? Da wurde in der Werbung des ORF (= öffentlich, rechtlich) folgender Spot der Firma MÖBEL LUTZ gesendet: Bilder von Menschen in einer Zwangsjacke, mit der Bezeichnung „untragbar“ bedacht – abgeführt von zwei Kraftprotzen in weißen Kitteln. Monate später wird in einem zweiten Werbespot wieder die besagte Zwangsjacke verwendet und diesmal an das Wort „Wahnsinn“ gekoppelt. Ist das nicht ein Anlass, dem gegenzusteuern ist? Ist das etwas was wir/Sie einfach so stehen lassen sollten? Bedenken Sie die Wirkung dieser Bildsprache und Schlagworte • Zwangsjacke • untragbar • abführen • Wahnsinn oder sind Sie der Meinung, dass Sie dafür nicht zuständig sind? Halten Sie es nicht auch für Ihre Aufgabe, das Wort gegen diese Form der Diskriminierung zu ergreifen? Ich habe mit den Menschen der Werbeabteilung des ORF und der werbenden Firma Gespräche geführt. Ich habe versucht Ihnen zu verdeutlichen, welche Verletzungen dieser Spot mir und anderen zufügt und mir einfach erlaubt hinzuzufügen, dass Ärzte der Universitätsklinik für Psychiatrie in Innsbruck gegebenenfalls schriftlich gegen diese Art von Werbespots auftreten würden. Ich habe mir das einfach erlaubt, im Glauben, Sie würden dies sicher tun. Anfangs hat man versucht mich zu beruhigen. Der Spot ziele darauf ab lustig zu sein; ein Produkt kreativer Werbefachleute. Dann hat man mich eindringlich ersucht nichts zu unternehmen; man wolle in den entsprechenden Gremien des ORF und der Firmenleitung meine Argumente und Bedenken vorbringen. Was mich dann überraschte, war der Anruf des Chefs der Werbeabteilung, der mir mitteilte, dass seine Firma noch am selben Abend beschlossen habe, besagten Spot aus dem Programm zu nehmen. Ebenso versprach die Dame der Werbeabteilung des ORF, sich persönlich dafür einzusetzen, dass die berechtigten Einwände psychisch Kranker in Zukunft stärker berücksichtigt werden, man das Recht auf Schutz ihrer Würde beachten und diesem Gesichtspunkt in Zukunft mehr Gewicht zumessen werde. Nach meiner Einschätzung hat die Äußerung Klinikvorstände, Professoren, Ärzte und andere in der Psychiatrie Tätige würde notfalls auch schriftlich Position beziehen sicher Wirkung gezeigt, beeindruckt. Ich frage mich aber war das meine Gutgläubigkeit, mein Wunschdenken? Hätte ich wirklich damit rechnen dürfen? Hätte ich mich notfalls auf Sie berufen dürfen? Muss ich das wirklich in Frage stellen? Die Psychiatrie braucht Menschen, keine Leute. ORIGINAL Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 110 – 114 Ist das www für die Anti-Stigma Kampagne nutzbar? Hubert Sulzenbacher1, Christine De Col1, Karin Lugger2 und Ullrich Meise1,2 1Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck 2Gesellschaft für Psychische Gesundheit Tirol, Innsbruck Schlüsselwörter psychische Erkrankung – Stigma – AntiStigma Kampagne – Internet Key words mental illness – stigma – anti-stigma campaign – Internet Ist das www für die Anti-` Stigma Kampagne nutzbar? Dieser Beitrag untersucht ausgehend von der Frage, ob und wie die Anti-Stigma Kampagnen bisher das Medium Internet einsetzen, die grundsätzliche Nutzbarkeit des Internets für die Anti-Stigma Kampagne. Bei der Suche nach Internetseiten wählten wir den Weg eines unbefangenen Internetusers und bedienten uns in einem ersten Schritt allgemeiner Suchdienste. Die weitere Suche erfolgte dann über die in gefundenen Internetseiten angegebenen Links. Es wurden dabei verschiedenste Möglichkeiten für die Anti-Stigma Kampagne wie beispielsweise Informationsvermittlung, Helpline, Gedankenaustausch, StigmaWatch oder auch Ankündigung und Organisation gemeinschaftlicher Aktivitäten gefunden. Als problematisch stellen sich die thematische Suche im Internet ganz allgemein sowie die Dominanz englischsprachiger Websites heraus, ebenso wie die geringeren Möglichkeiten des Internetzugangs sozial benachteiligter Personen. Zweifellos ist das Internet ein interessantes Medium für die AntiStigma Kampagne, potentielle Betreiber sollten allerdings die Grenzen der Möglichkeiten des Mediums nicht übersehen und auch ihre moralische Verantwortung bedenken. In how far is the word-wideweb useful for an anti-stigma campaign? This contribution is based on an examination of the question whether and how anti-stigma campaigns have used the Internet medium to date, and how useful the Internet can be for the anti-stigma campaign. In our search for Internet sites we took the approach of an impartial Internet user and began by employing general search engines. Further searches followed via links found on these Internet sites. As a result, a variety of possibilities for the anti-stigma campaign were identified such as information provision, help lines, exchange of ideas, StigmaWatch, along with the announcement and organisation of joint activities. The problem of thematic searches arises widely throughout the Internet, as does the dominance of English language web sites and the limited possibilities of access to the Internet for the socially disadvantaged. Einleitung Die Vision vom Internet stammt spätestens aus dem Jahr 1962, als J.C.R. Licklider seine Vorstellung des „galactic network“ als einer globalen Verbindung von Computern, über welche jeder Daten und Programme von jeder Seite erhalten könne, veröffentlichte. Die erste Nachrichtenübertragung über eine Telephonleitung zwischen zwei weit voneinander entfernten Computern fand 1965 statt [20]. Seit 1969 entwickelte eine Forschungsabteilung des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums ein Computernetzwerk aus ursprünglich vier Universitätscomputern, das Arpanet, welches 1972 mit nunmehr bereits vierzig vernetzten Computern erfolgreich der Öffentlichkeit präsentiert wurde [38]. Damit waren zwar die Grundlagen der Computervernetzung gelegt, die enorme Ausbreitung des Internets wurde allerdings erst durch eine weitere Entwicklung, nämlich jene des Personal Computers, ermöglicht: Erste Entwicklungsschritte finden sich auch hier bereits in den Sechzigerjahren, der große Durchbruch ist wohl im Jahr 1977 mit der Markteinführung des Apple II zu datieren [29]. Waren bisher hauptsächlich von Computerfachleuten bediente universitäre Großcomputer am Netzwerk angeschlossenen, so entstand mit der zunehmenden Verbreitung der Heimcomputer ein riesiger neuer Markt mit neuen Interessen und Forderungen (Unterhaltungsmedien, ansprechendes Design, leichte Bedienbarkeit). 1984 waren erstmals mehr als tausend Computer an das Netzwerk angeschlossen [16], seither beträgt die Verdoppelungsgeschwindigkeit der Anzahl der angeschlossenen Computer etwa ein Jahr. Im Jahr 2001 sind weltweit über 100 Millionen Computer an das Internet angeschlos- 111 Sulzenbacher, De Col, Lugger und Meise sen [38], über welche mehr als 1,6 Milliarden Websites erreichbar sind [14]. 1998 startete die World Psychiatric Association ein weltweites Programm gegen Stigmatisierung und Diskriminierung als Folge von Schizophrenie. Eine der Aktionen innerhalb dieses Programms war das Erstellen einer Website, die sich mit verschiedenen Aspekten des schizophren Erkrankten anhaftenden Stigmas beschäftigen sollte [37]. Der Gedanke, eine Anti-Stigma Kampagne auch mit Hilfe des Internets zu führen, erscheint naheliegend: Immerhin ermöglicht das Internet, mit vergleichsweise sehr geringen Ressourcen an Personal, finanziellen Mitteln und Know-how eine schier unübersehbare Anzahl von Interessierten zu erreichen. Wir möchten nun in diesem Artikel der Frage nachgehen, ob das Internet tatsächlich für die Anliegen der Anti-Stigma Kampagne geeignet ist, ob die potentiellen Adressaten erreichbar sind, welche Informationen vermittelt werden können und welche Möglichkeiten das Internet generell bietet. Es ist dabei nicht unsere Absicht, in diesem Artikel einzelne Internetseiten, die sich mit dem Stigma psychischer Erkrankungen auseinandersetzen, vorzustellen; dies würde lediglich zu einer Katalogisierung und Evaluierung vorhandener Websites führen. Stattdessen wollen wir versuchen, generell die Möglichkeiten des Mediums Internet für die Anti-Stigma Kampagne aufzuzeigen. Daher sind die angegebenen Literaturverweise stets nur als Beispiele, nie als vollständige Aufzählung, anzusehen. Methodik Dieser Artikel wurde zur Gänze auf der Grundlage von im Internet erhältlichen Informationen verfasst, das Literaturverzeichnis enthält demnach ausschließlich Internetseiten. Ausgangspunkt dieser Vorgangsweise war der Gedanke, dass ja auch viele der potentiellen Adressaten einer Anti-Stigma Kampagne kaum Zugang zu der in teuren psychiatrischen und soziologischen Fachzeitschriften enthaltenen und für medizinische und sozialwissenschaftliche Laien oft schwer verständlichen Fachliteratur erhalten. Bei der Suche nach Internetseiten zur Anti-Stigma Kampagne wählten wir den Weg eines unbefangenen, psychiatrisch nicht vorgebildeten Internet-Users: Wir verwendeten also im ersten Schritt allgemeine Suchdienste (insbesondere google), wobei die Suchbegriffe absichtlich unscharf formuliert wurden (beispielsweise „stigma“, „mental health“). Die weitere Suche erfolgte dann über die in den gefundenen Internetseiten angegebenen Links. Wenn nun eine Arbeit ausschließlich auf Recherchen im Internet basiert, müssen dabei verschiedene methodische Fragestellungen aus der Welt geschafft werden, welche bei der „üblichen“ wissenschaftlichen Arbeit mit Zeitschriftenartikeln längst geklärt sind: So gibt es unseres Wissens beispielsweise bis zum jetzigen Zeitpunkt keine verbindlichen Zitierungsregeln für Webpages. Wir wählten nun folgende Vorgangsweise: Waren Titel und Autor einer Quelle aus dem Internet eindeutig zu identifizieren, so wurde im Literaturverzeichnis dementsprechend zitiert (die in Klammern gesetzten Jahreszahlen bezeichnen dabei das letzte Update der jeweiligen Quellen und damit nicht unbedingt den Zeitpunkt ihrer Erstveröffentlichung) und danach die URL (Uniform Ressource Locator) angegeben. Waren Titel, Autorenschaft oder der Zeitpunkt des letzten Updates (bzw. der Entstehung) der zitierten Quelle nicht eindeutig, so wurde auf die unklaren Daten bei der Literaturangabe verzichtet; es erfolg- te dann nur die Angabe der jeweils gesicherten Daten zusammen mit der URL. In Fällen, in denen auf eine reine Funktionsseite, beispielsweise einen Suchdienst, verwiesen wurde, erfolgte im Literaturverzeichnis lediglich die Angabe der URL. Nun ist zwar eine Internetadresse durch die Angabe der URL genau definiert [12], der Inhalt kann aber vom Eigentümer der Webpage zu jedem Zeitpunkt nach Belieben verändert werden. In jenen Fällen, in denen es uns nicht möglich war, den Zeitpunkt des letzten Updates einer Internetseite zu eruieren, entspricht daher unsere Angabe im Literaturverzeichnis der Seite, wie sie sich im Herbst 2001 präsentierte. Die Anordnung der Quellen im Literaturverzeichnis erfolgt alphabetisch, wobei in jenen Fällen, in welchen der Verantwortliche für den Seiteninhalt nicht bestimmt werden konnte, der Name der Domain der jeweiligen Adresse [11] für die Stellung der Reihenfolge im Alphabet verwendet wurde. Ergebnisse Orientierung im Internet: Das Internet ist ein riesiger Datendschungel, in dem man, um sich auch nur einigermaßen zurechtfinden zu können, auf die Unterstützung von Suchdiensten, Internetkatalogen und Links, Querverweisen von einer Website zu anderen, angewiesen ist. Am häufigsten werden für die Suche von Datenmaterial wohl Suchdienste verwendet: Dabei wird allerdings ein Internet-User zu quantitativ völlig unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, je nachdem, welchen Suchdienst er verwendet: Gibt er beispielsweise in die Suchmaschine google den Suchbegriff „Stigma“ ein, so erhält er weit über zweihunderttau- 112 Ist das www für die Anti-Stigma Kampagne nutzbar? send Ergebnisse [15], derselbe Suchbegriff erbringt dagegen bei manchen anderen Suchmaschinen kaum tausend Treffer. Auch die Qualität der gefundenen Ergebnisse hängt stark von der verwendeten Suchmethode ab [18]. Einige Suchdienste bieten Suchkataloge an, die nach Themengebieten, manchmal zusätzlich auch nach Sprachen oder Ländern geordnet sind; diese Kataloge sind allerdings häufig schlecht redigiert (als löbliche Ausnahmen seien hier der leider kein eigenes Stigmaverzeichnis enthaltende Katalog der Webpage Internet Mental Health [22] sowie die katalogisierte Linksammlung der Webseite Mindinfo [25] erwähnt). Dagegen sind die von den verschiedenen Anti-Stigmaseiten angebrachten Links teilweise recht gut recherchiert, sodass man über diese Links zumindest die Seiten der großen in der Anti-Stigma Kampagne engagierten Organisationen leicht auffinden kann. Sprachbarrieren: Personen ohne passable Englischkenntnisse sind von sehr vielen Internetseiten durch die Sprachbarriere ausgeschlossen: Gibt man beispielsweise in die Suchmaschine lycos den Suchbegriff „schizophrenia“ ein, so erhält man über zweihunderttausend Treffer; ändert man nun den Suchbegriff in „schizophrenie“, werden nur mehr etwa sechzehntausend Ergebnisse, also gerade einmal 8 Prozent der englischsprachigen Suche, gefunden [23]. Zugangsbeschränkungen zum Internet: Ein weiteres Problem stellt die generelle Zugangsmöglichkeit zum Internet dar. Diese hängt in hohem Maß vom Ausbau der Informationstechnologie in den unterschiedlichen Weltregionen ab: So wird das Internet in den Industrieländern von mehr als einem Drittel der Bevölkerung genutzt, während in vielen Staaten der Dritten Welt nicht einmal jeder Tausendste Zugang zum Internet hat [28]. Schließlich muss auch der Ausschluss vom Internetzugang als Folge der beträchtlichen Kosten für die Anschaffung und Nutzung bedacht werden, insbesondere auch deshalb, weil einer der wichtigsten Ansprechpartner einer Anti-Stigma Kampagne, nämlich die Gruppe der von psychischer Krankheit Betroffenen, häufig – und gerade auch als Folge der Stigmatisierung – einen sozialen Abstieg durchmacht: So ist in den USA beispielsweise zirka ein Drittel der Obdachlosen psychisch krank – und dies bei einer sehr engen Definition von psychischer Krankheit, in der etwa Abhängigkeitserkrankungen nicht mitgezählt werden [27]. • Wer betreibt Anti-Stigmaseiten? Die Anti-Stigma Kampagne im Internet lebt von ihrer Vielfalt: So betreiben internationale [37] und verschiedene nationale psychiatrische Organisationen [36] Anti-Stigmawebsites; daneben gibt es große, zum Teil aus Selbsthilfegruppen, Angehörigenvereinigungen oder auch Stiftungen hervorgegangene Wohlfahrtseinrichtungen [32, 33, 26]; und schließlich beteiligen sich auch kleine Gruppen und Einzelpersonen, Professionelle [10, 22] wie Betroffene [6, 8, 31], an der Bekämpfung des Stigmas psychischer Erkrankungen. • Helpline: Im Internet werden verschiedenste Möglichkeiten der Krisenintervention angeboten, so beispielsweise die Vermittlung von professioneller Hilfe [9] oder eine „email-Seelsorge“ [2]. Es besteht sogar die Möglichkeit einer Online-Psychotherapie [1]. • StigmaWatch: Schon seit vielen Jahren versuchen Globalisierungskritiker, moralisch inkorrekte Vorgangsweisen internationaler Konzerne durch deren Veröffentlichung einzudämmen: Die Hoffnung dabei ist, dass Firmen angesichts des möglichen Imageschadens infolge fragwürdiger Geschäftspraktiken auf diese Möglichkeiten der Möglichkeiten des Internet: Grundsätzlich bieten sich im Internet vier Bereiche an, die für eine Anti-Stigma Kampagne genutzt werden könnten. • Informationsvermittlung: Im Internet werden verschiedenste stigmarelevante Informationen angeboten: Es finden sich Beschreibungen psychischer Erkrankungen [3, 17, 19] und thera- peutischer Ansätze [7, 13, 35], Erfahrungsberichte von Betroffenen [8, 31] und Angehörigen [6] sowie Informationen über Aktivitäten innerhalb der Anti-Stigma Kampagne [26]. Gedankenaustausch – die online community: Internetforen und Chatrooms ermöglichen eine anonyme Kontaktaufnahme zwischen Betroffenen, Angehörigen und Therapeuten. Angesichts der Hemmungen der meisten psychisch Kranken und ihrer Angehörigen, über ihre Schwierigkeiten zu sprechen oder psychiatrische Beratung und Hilfe vor Ort aufzusuchen, stellt das Medium Internet für Betroffene die wohl interessanteste und wichtigste Neuerung in der Kommunikation dar. Discussion- und Messageboards oder Chatrooms wurden von uns beispielsweise auf der Webpage von Mental Help Net [10], auf der Webpage der britischen SANE [33], auf Mental Health in the UK [24] und auf Health-Center [34] gefunden, deutschsprachige Foren betreiben die BayerischeAnti-STigma-Aktion BASTA [5] und das Psychiatrienetz [19]. Sulzenbacher, De Col, Lugger und Meise Gewinnmaximierung verzichten. StigmaWatch ist eine analoge Einrichtung der Webpage von SANE Australia mit dem Zweck, in Medien beobachtete Stigmatisierungen von psychisch Kranken zu sammeln und auf der Website zu veröffentlichen, um damit in weiterer Folge einen gewissen Druck auf die betroffenen Medien oder Firmen auszuüben, in Hinkunft etwas behutsamer vorzugehen [32]. NAMI in Nordamerika und BASTA in Deutschland verfolgen eine ähnliche Vorgangsweise [5, 26]. Diskussion Grundsätzlich sollte sich wohl jede Internetseite, die sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigt, auch als "Anti-Stigmaseite” verstehen. Es ist aber leider so, dass auch im Internet über psychische Erkrankungen häufig eher akademisch doziert wird, sodass viele dieser Webpages sicher nicht zur Anti-Stigma Kampagne gezählt werden können. In die Irre führt aber auch der entgegengesetzte Weg, nämlich nur jene Webseiten zu untersuchen, die sich explizit der Stigmabekämpfung verschreiben, da sich viele Internetseiten mit psychiatrischem Stigma beschäftigen, ohne dies ausdrücklich zu ihrem Thema zu machen. Damit ist eine der größten Schwierigkeiten einer effektiven Nutzung des Internets angesprochen, nämlich die Selektion der tatsächlich relevanten Quellen aus dem unübersehbaren Datenangebot. Diese Schwierigkeit beruht dabei nicht nur auf der schwer zu organisierenden Vielfalt innerhalb der offenen Architektur des Internets, sondern auch auf den unterschiedlichen potentiellen Adressaten der Anti-Stigma Kampagne: So werden psychisch Kranke, Angehörige, Therapeuten, Kampagnenbetreiber oder Journalisten aufgrund verschiedener Bedürfnisse auf Internetseiten der Anti-Stigma Kampagne stoßen und diese zu gänzlich unterschiedlichen Zwecken verwenden. Zweifellos ist aber das Internet für eine Anti-Stigma Kampagne nutzbar – und es wird auch genutzt: So liefert die Suchmaschine google beispielsweise auf die Eingabe des Suchbegriffs „stigma mental health“ über 70.000 Ergebnisse [15]. Dabei unterscheiden sich die einzelnen Seiten in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht beträchtlich. Dies beeinträchtigt die effiziente Suche nach relevanten Informationen, sodass man als Internetuser geneigt ist, eine straffere Organisation der stigmarelevanten Websites zu fordern: So wäre beispielsweise die Erstellung eines nach sprachlichen, geographischen und inhaltlichen Gesichtspunkten katalogisierten Linkverzeichnisses denkbar (eventuell mit einem „Gütesiegel“ zur Qualitätskontrolle der aufgelisteten Internetseiten), über welches jeder Benutzer leicht die für ihn interessanten Internetseiten finden könnte. Das Fehlen einer derartigen zentralen Anti-Stigmahomepage gibt andererseits aber die Möglichkeit, Informationen ohne zwischengeschaltete Filter und Zensur zu erhalten. Dies ist angesichts der zum Teil sehr divergierenden Interessen der an der Anti-Stigma Kampagne Beteiligten ein nicht zu unterschätzender Vorteil: So ist beispielsweise nur schwer vorstellbar, dass etwa jener Pharmakonzern, welcher als Hauptsponsor der Anti-Stigma Kampagne der WPA [37] auftritt, bereit wäre, ein Linkverzeichnis finanziell zu unterstützen, wenn auf diesem Verzeichnis auf eine Internetseite verwiesen würde, auf welcher das bekannteste Produkt eben dieses Konzerns kritisiert wird [30]. Das Medium Internet bietet verschiedenste Möglichkeiten für die Anti-Stigma Kampagne wie beispielsweise Informationsvermittlung, Helpline, Gedankenaustausch, Stig- 113 maWatch, Ankündigung und Organisation gemeinschaftlicher Aktivitäten und vieles mehr. Dabei sollte allerdings die Tatsache, dass viele dieser Möglichkeiten bereits genutzt werden, potentielle Betreiber der AntiStigma Kampagne im Internet nicht abschrecken. So liegt etwa ein Großteil der verfügbaren Daten nur auf Englisch vor. Dies mag bei Fachinformationen, die sich an Professionelle richten, oder in international tätigen Organisationen vertretbar sein; wenn Betroffene allerdings die Ansprechpartner sind oder gutes Englisch gefordert ist (beispielweise im Internet-Chat), ergeben sich für Personen, deren Muttersprache nicht Englisch ist, erhebliche Schwierigkeiten. Ein viel größeres Problem stellen die Zugangsbedingungen zum Internet dar: So lässt sich, weltweit gesehen, eine sehr enge Beziehung zwischen der Möglichkeit der Internetnutzung und dem individuellen Wohlstand herstellen. Dieses Ungleichgewicht, dessen Opfer ja sehr häufig psychisch Kranke sind, lässt sich wohl nur über tiefgreifende gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen beheben – auch die Anti-Stigma Kampagne sollte sich diesem Problem stellen. Zweifellos eröffnet das Internet Initiatoren von Anti-Stigma Kampagnen enorme Möglichkeiten: Insbesondere hinsichtlich der weltweiten Vernetzung ähnlich gelagerter Gruppen und Initiativen sowie des effektiven Gedankenaustauschs zwischen psychisch Kranken, Angehörigen und Therapeuten ist das Internet anderen Kommunikationsmedien weit überlegen. Die Möglichkeiten sollten dabei allerdings auch nicht überschätzt werden: So erscheint etwa zweifelhaft, ob ein Internet-chat oder eine Online-Psychotherapie den Face-toFace-Kontakt zwischen Patient und Therapeut ersetzen kann. Das Betreiben von Internetseiten bringt allerdings auch eine moralische Verantwortung mit sich, deren 114 Ist das www für die Anti-Stigma Kampagne nutzbar? sich die Betreiber stets bewusst sein sollten: So scheint es uns doch einigermaßen verantwortungslos, wenn etwa auf einem Linkverzeichnis zum Thema „Suizid und Depression“ [21] neben Internetseiten, auf welchen Krisenhilfe angeboten wird, auch eine Seite, welche „nützliche Hilfe für einen effizienten Abgang“ anbietet, angegeben ist [4]. Insgesamt hinterläßt unsere Recherche, die viele Stunden beanspruchte, den Eindruck, dass das Potential, welches im Internet für die Anti-Stigma Kampagne liegt, bisher nur in beschränktem Maße genutzt wurde [37]. [8] Chovil I. (2001): The Experience of Schizophrenia. Ian Chovil’s Homepage. http://www.chovil.com/ [25] Mindinfo.co.uk (2001): Mental Health Links A – Z. http://www.gtonline.net/ community/mindinfo/a-z.htm [9] Clinicians Yellow Pages (2000). http:// www.mentalhelp.net/mhn/yellowpages/db.cgi?uid=default&view_search=1 [26] National Alliance for the Mentally Ill: http://www.nami.org/ [27] [10] Dombeck M., W. Selekman (2000): Mental Help Net. http://community. mentalhelp.net/forum/newforums.html National Alliance for the Mentally Ill: http://www.nami.org/fact.htm [28] Pastore M. (2001): The World’s Online Populations. http://cyberatlas.internet. com/big_picture/geographics/article/0,,5911_151151,00.html [29] Polsson K. (2001): Chronology of Personal Computers. www.islandnet.com/ ~kpolsson/comphist/ [30] Prozac Truth. The Untold Story. http:// www.prozactruth.com/index.html [31] Ron’s Home Page. A Personal Story of My Experiences With Schizophrenia (2001).http://www.netidea.com/~rones/ [11] Eicker T. (2001): Ein kleines Lexikon des Internet. http://www.kleines-lexikon.de/w/d/domain.shtml [12] Eicker T. (2001): Ein kleines Lexikon des Internet. http://www.kleines-lexikon.de/w/u/url.shtml [13] Goldberg I. (2001): Dr. Ivan’s Depression Central. http://www.psycom.net/ depression.central.ect.html [14] http://www.google.com/intl/en/ [15] http://www.google.de [32] Sane Australia: http://www.sane.org/ [16] Griffiths R.T. (1999): Internet for Historians, History of the Internet. The development of the Internet. Universiteit Leiden, Instituut voor Geschiedenis http://www.let.leidenuniv.nl/history/ivh /frame_theorie.html [33] Sane.org.uk: http://www.sane.org.uk/ disc1_toc.htm [34] Tanner B., N. Slautich (2001): HealthCenter. http://www3.health-center.com/ mentalhealth/default.htm [17] Institute of Alcohol Studies. http:// www.ias.org.uk/factsheets/default.htm [35] Ainsworth M. (2001): Talk to a Therapist Online. http://www.metanoia.org/ imhs/?MentalHealthNet [18] ITXPLAIN. Internet-Systemhaus und Beratungsgesellschaft mbH: http:// www.suchmaschinen-verstehen.de/ The Royal College of Psychiatrists: Lithium Therapy (2001): http://www. rcpsych.ac.uk/info/factsheets/pfaclith.htm [36] [2] Ainsworth M.: The Samaritans. http:// www.metanoia.org/imhs/samaritans.htm [19] Janssen L. (2001): Das Psychiatrienetz. http://www.psychiatrie.de Wechdorn H. (2001): Österreichische Schizophreniegesellschaft. http://info. uibk.ac.at/sci-org/oesg/ [37] [3] Alzheimer’s Disease International: About Alzheimer’s disease. http://www. alz.co.uk/alzheimers/ [20] Leiner B.M., V.G. Cerf, D.D. Clark, R.E. Kahn, L. Kleinrock, D.C. Lynch, J. Postel, L.G. Roberts, S. Wolff (2000): A Brief History of the Internet. http:// www.isoc.org/internet/history/brief/html World Psychiatric Association: Schizophrenia. Open the Doors. http://www. openthedoors.com/ [38] Zakon R.H. (2001): Hobbes’ Internet Timeline v5.4. http://www.zakon.org/ robert/internet/timeline Literatur [1] [4] http://ash.xanthia.com/freitod/ [5] BASTA Bayerische-Anti-StigmaAktion (2001). http://www.openthedoors.de/~forum/ [21] Boysmum (2001): My Son and Schizophrenia. http://sites.netscape.net/boysmum2000/schizophreniahomepage Links zum Thema Suizid und Depression. http://gewi.kfunigraz.ac.at/~martin/ projektx.htm [22] Long P.W. (2001): Internet Mental Health http://www.mentalhealth.com/ fr13.html Hubert Sulzenbacher [23] http://www.lycos.com/ Univ.-Klinik für Psychiatrie Innsbruck [24] Mental Health in The UK (2001). http:// www.geocities.com/cazie Anichstraße 35 [6] [7] Chiko B.: The Schizophrenia Homepage: Medications. http://www.schizophrenia.com/newsletter/buckets/meds. html Arge-Versorgungsforschung A-6020 Innsbruck KOMMENTAR Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 115 – 116 Stigma – ein Kommentar aus gerontopsychiatrischer Perspektive Johannes Wancata Universitätsklinik für Psychiatrie, Wien Die Stigma-Forschung hat sich in den letzten Jahren vor allem mit psychischen Erkrankungen des Erwachsenenalters beschäftigt. So haben zahlreiche Studien das Stigma und die Diskriminierung von SchizophrenieKranken beforscht [1, 5]. Hier bestätigten sich beispielsweise die Ergebnisse früherer Studien, dass ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung einen Schizophrenie-Kranken nicht für eine Arbeitsstelle empfehlen würde. Das Wissen um diese Ergebnisse führte in zahlreichen Ländern zu den von der World Psychiatric Association initiierten „Anti-Stigma-Kampagnen“, um die Bevölkerung über schizophrene Psychosen aufzuklären und um die Einstellung der Bevölkerung zu den Kranken zu ändern [9, 11]. In Österreich hat sich aber – so wie in anderen Industrieländern – die Altersstruktur der Bevölkerung dramatisch verändert. Vor allem seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ist auch die Sterblichkeit bei den über 60-Jährigen zurückgegangen, sodass der Anteil der älteren Bevölkerung immer größer geworden ist. Für die Zukunft sagen Bevölkerungsprognosen eine noch stärkere Zunahme des Anteils älterer Menschen in Österreich voraus: innerhalb der nächsten 30 Jahre wird mit einer Zunahme der über 60-Jährigen um eine Million (von 1,7 auf 2,7 Millionen) gerechnet und die Zahl der über 80-Jährigen wird voraussichtlich von 286.000 im Jahr 2000 auf eine knappe Million im Jahr 2050 steigen [12]. Durch diese demographischen Veränderungen wird sich das Spektrum der psychischen Erkrankungen ändern: Einerseits wird es zu einer dramatischen Zunahme der Absolutzahlen von Demenzerkrankungen kommen (Anstieg auf etwa das 2,6fache der Krankenzahlen innerhalb von 50 Jahren [13]). Andererseits werden Krankheiten, die in allen Altersgruppen vorkommen (z.B. Depressionen, Suchterkrankungen, Angststörungen), in einem zunehmenden Anteil die Altenbevölkerung betreffen. Die Frage, ob die zunehmende Überalterung auch bei diesen Krankheiten zu Veränderungen der Absolutzahlen führen wird, kann bis heute nicht eindeutig beantwortet werden [4, 10], der Anteil älterer Menschen mit diesen Erkrankungen wird aber deutlich zunehmen. Demenzen, also Erkrankungen, die nahezu ausschließlich in der Altenbevölkerung vorkommen, standen in den jüngsten Diskussionen um Stigmatisierung und Diskriminierung nicht im Rampenlicht. Wenn man die Ergebnisse der vergleichsweise geringen Zahl von Allgemeinbevölkerungsstudien über die Einstellung zu Demenzkranken betrachtet, zeigt sich, dass auch diese in nicht geringem Ausmaß für gefährlich (18,6 %) oder unberechenbar (52,9 %) gehalten werden [3]. Angehörige von Demenzkranken müssen immer wieder die Erfahrung machen, dass man sich über ihre kranken Familienmitglieder lustig macht [14]. Demenzerkrankungen spielen außerdem eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Kosten aufgrund von Pflegebedürftigkeit [2, 7]. Dies trägt dazu bei, dass in absehbarer Zeit die Versorgung Demenzkranker in Österreich jährlich einige Milliarden Euro kosten wird. In der Diskussion um begrenzte Ressourcen im Gesundheits- und Sozialsystem werden zunehmend die Hauptverursacher der Kosten zu „Buhmännern“. Die zunehmende Zahl von Publikationen, die sich mit „physician-assisted suicide“ bei „mental incompetence“ im Alter [6] beschäftigen, eröffnet eine neue Diskussion über „lebensunwertes Leben“. Ausländische Studien zeigen, dass manche diagnostischen und therapeutischen Interventionen bei Demenzkranken in deutlich geringerem Ausmaß als bei psychisch Gesunden gesetzt werden [8]. Es drängt sich die Frage auf, ob hier nicht auch Vorurteile oder fehlendes Wissen eine beträchtliche Rolle spielen – Themen, die zum Aufgabengebiet der StigmaForschung gehören. Immer wieder hört man von Kollegen die Meinung, dass es ja nicht verwunderlich sei, wenn ein älterer Mensch mit verschiedenen körperlichen Leiden depressiv sei – so als gehöre Depressivität beim alten Menschen zum Normalzustand. Sowohl das Faktum, dass Depressionen Erkrankungen sind, als auch die Tatsache, dass sie gut behandelt werden können, werden hier offensichtlich ignoriert. Personen, die meinen, dass 116 Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002 eine Entzugsbehandlung bei einem 65-Jährigen „vergebliche Liebesmüh“ sei, dürften übersehen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in dieser Altersgruppe in Österreich noch 18 Jahre beträgt [12]. In die gleiche Kategorie gehören Diskussionen, ob ältere Menschen einen Anspruch auf neuere und nebenwirkungsärmere, aber oft teurere Psychopharmaka haben. Die Hintergründe für derartige Äußerungen zu untersuchen, wären weitere Aufgaben der Stigma-Forschung. Eine neuere britische Untersuchung fand, dass die über 65-Jährigen die Gefährlichkeit von manchen psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie oder Sucht signifikant geringer einschätzen als jüngere Menschen [3]. Es stellt sich die Frage, ob dieser Trend, dass ältere Menschen manche psychische Erkrankungen weniger negativ als jüngere beurteilen, auch für andere Länder zutrifft. Weiters wäre zu untersuchen, welche Mechanismen hier eine Rolle spielen und ob diese für die Bekämpfung von Stigma und Diskriminierung von Bedeutung sind. In den letzten Jahren wurden wichtige Kampagnen durchgeführt, die versuchten, die Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch Kranker zu vermindern. Zahlreiche interessante Studien lieferten die theoretischen Grundlagen dafür und begleiteten diese Kampagnen. Wenn man die demographische Entwikklung betrachtet, zeigt sich, dass psychische Alterserkrankungen eine zunehmend größere Rolle spielen werden. Diese Erkrankungen wurden bisher aber nur in relativ geringem Ausmaß beforscht. Außerdem sind bei psychischen Alterserkrankungen zusätzliche Aspekte zu berücksichtigen, die bei jüngeren Altersgruppen weniger bedeutsam sind. Kampagnen mit dem Ziel das Stigma der psychischen Erkrankungen im Alter zu bekämpfen, fanden bislang nicht statt. Sowohl Forscher als auch die für die psychosoziale Versorgung Verantwortlichen sind gefordert, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit als bisher zu widmen. Literatur [1] [2] [3] Angermeyer M., H. Matschinger: Social distance towards the mentally ill: resluts of representative surveys in the Federal Republic of Germany. Psychological Medicine 27, 131-141 (1997) Bickel H.: Pflegebedürftigkeit im Alter. Ergebnisse einer populationsbezogenen retrospektiven Längsschnittstudie. Gesundh-Wes 58 (Sonderheft 1), 56-62 (1996) Crisp A., M. Gelder, S. Rix, H. Meltzer, O. Rowlands: Stigmatisation of people with mental illnesses. Brit. J. Psychiatry 177, 4-7 (2000) [4] Jorm A.: Does old age reduce the risk of anxiety and depression? A review of epidemiological studies across the adult life span. Psychological Medicine 30, 11-22 (2000) [5] Grausgruber A., H. Katschnig, U. Meise, W. Schöny: Einstellungen der österreichischen Bevölkerung zu Schizophrenie. Neuropsychiatrie 16, 1/2: 54-67 (2002). [6] Koenig H., D. Wildman-Hanlon, K. Schmader: Attitudes of elderly patients and their families towards physicianassisted suicide. Arch. Intern. Med. 156, 2240-2248 (1996) [7] Krautgartner M., J. Berner, J. Wancata: Die Belastung der österreichischen Bevölkerung durch Demenzerkrankungen zwischen den Jahren 2000 und 2050. Gemeindenahe Psychiatrie 22, 33-49 (2001) [8] Marvill S., K. Freund, P. Barry: Patient factors associated with breast cancer screening among older women. J. Am. Geriatr. Soc. 44, 1210-1214 (1996) [9] Meise U., H. Sulzenbacher, G. Kemmler, R. Schmid, W. Rössler, V. Günther: „… nicht gefährlich, aber doch furchterregend“ – ein Programm gegen Stigmatisierung von Schizophrenie in Schulen. Psychiatrische Praxis 27, 230-246 (2000) [10] Palsson S., S. Östling, I. Skoog: The incidence of first-onset depression in a population followed from the age of 70 to 85. Psychological Medicine 31, 1159-1168 (2001) [11] Rosen A., G. Walter, D. Casey, B. Hokking: Combating psychiatric stigma: an overview of contemporary initiatives. Australasian Psychiatry 8, 19-26 (2000) [12] United Nations Population Division: World Population Prospects – The 2000 Revision (Vol. I and II). United Nations, New York 2001 [13] Wancata J., B. Kaup, M. Krautgartner: Die Entwicklung der Demenzerkrankungen in Österreich vom Jahr 1951 bis zum Jahr 2050. Wiener Klinische Wochenschrift 113, 172-180 (2001) [14] Wancata J., J. Windhaber, A. Friedmann, P. Fischer, M. Rainer, A. Wuschitz, J. Schneider, J. Murray, A. Mann, S. Banerjee: Die Pflege von Demenzkranken durch ihre Partner. Gemeindenahe Psychiatrie 19/ Heft 3, 3-15 (1998) Univ.-Prof. Dr. Johannes WANCATA Universitätsklinik für Psychiatrie, Klinische Abteilung für Sozialpsychiatrie und Evaluationsforschung 1090 Wien, Währinger Gürtel 18-20 [email protected] KOMMENTAR Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002, S. 117 – 119 Stigma hat Tradition – Zum historischen Hintergrund der Stigmatisierung Hartmann Hinterhuber Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck Lebten psychisch Kranke je in einer Gemeinschaft, die mit ihnen ihre Sorgen, ihre Not und ihr Leid teilte, die sie nicht ächtete, die für sie Verantwortung übernahm? Im Altertum erschien der psychisch Kranke als die Inkarnation des Fremden: „Alienus mente“ lesen wir in antiken und mittelalterlichen Schriften: der Fremde ist nicht Teil der Gesellschaft, ist von der Gemeinschaft ausgeschlossen. In vielen europäischen Sprachen lebt der lateinische Terminus des „Fremden“, des „Ausgeschlossenen“ als „alien“, als „alienats“ und „alienation“ in der Definition des psychisch Kranken fort. Fremd ist der, der infolge seines Andersseins sein Dasein nicht in lebendiger Verbindung mit seinen Mitmenschen austragen kann. Fremd in diesem weiteren Sinne ist das „Verrückte“, Uneinfühlbare, Befremdliche, das aus der mitmenschlich gemeinsamen Realität Herausgerükkte. (Scharfetter). Der „Irre“ ist der Verirrte, der sich am Irrweg Befindende, jenes Weges der aus der Gesellschaft herausführt. Psychiatrische Erkrankungen, ganz besonders schizophrene Störungen, waren in der Tat in Zeiten fehlender therapeutischer Möglichkeiten ein ungeheures und unbezwingbares Unglück. Angehörige und karitative Verbände waren – wenn das Ausmaß der Störung eine gewisse Grenze überschritten hatte – rasch überfordert. Kloster-, Stifts- und Stadtspi- täler konnten sich nur jenen widmen, deren Verhaltensauffälligkeiten besonders gemeinschaftsgefährdende Züge aufwies. Für viele wurden Hütten oder Käfige an den Ausfallstraßen der Städte und Märkte errichtet; andere schweiften durch die Täler, verspottet, verlacht und immer wieder aufs Neue vertrieben. Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts lesen wir in einem Bericht eines engagierten Arztes aus dem südlichen Tirol: „... und das sahen wir, nicht ohne davon schmerzlich beeindruckt zu werden, einige von diesen Ausgestoßenen: Sie irrten, sich selbst überlassen, herum und schweiften ohne Ziel, übel zugerichtet, auf Straßen, Plätzen und in den Wäldern herum.“ Der Begriff des Irrsinnes war sehr weit gespannt und schloss nicht nur die heute als psychische Störungen definierten Syndrome ein, sondern darüber hinaus jedes die Norm überschreitende Verhalten. So sah noch der § 61 des Strafgesetzbuches des Jahres 1787 vor, dass jeder, „der die Religion verleugnet und so tief sinkt, dass er dem Allmächtigen frevelhaft flucht, als Irrer angesehen werden und in einem Irrenhaus als Gefangener gehalten werden muss, bis man sicher ist, dass er sich gebessert hat.“ Im „Mann ohne Eigenschaften“ schreibt Robert Musil: „Psychisch Kranke leiden nicht nur an mangelnder Gesundheit, sondern auch an einer minderwertigen Krankheit.“ Und Franz Kafka ergänzt: „In meinen Augen sind die Mauern, die Gesunde und Kranke trennen, nur Sinnbild für die Blindheit, für die wahre Lage der Menschen, die dort und hier dieselbe ist.“ Bedingt durch das negative Numinosum, das seelische Erkrankungen beim Gesunden erzeugt und die von der Gesellschaft befürchtete kommunikative Anomie, die Unberechenbarkeit des psychisch Kranken, fließen in allen Kulturen und zu allen Zeiten irrationale Momente in die Beurteilung des psychisch kranken Menschen und – damit verbunden – auch der Psychiatrie ein. In der Betrachtung seelischer Not begegnet uns stets die Gefahr vereinfachender und verkürzender Sichtweisen. Reduktionistische Tendenzen finden wir in allen Gesellschaftsstrukturen, diese haben Schamanen und Naturheiler, Ärzte und Psychologen durch die Geschichte begleitet. Nicht selten haben in der Gegenwart und Vergangenheit Wissenschaftler – und besonders auch Psychiater – am Mythos der Unberechenbarkeit und der Unbehandelbarkeit des psychisch Kranken mitgewirkt und somit einen Beitrag zur Stigmatisierung der betroffenen Patienten geleistet. Etymologisch leitet sich „Stigma“ aus dem Griechischen ab, dort bedeutet es „Brandmal“. Cicero gebraucht den Terminus „Stigmatias“, um den Gebrandmarkten zu kennzeichnen, Plinius der Ältere verwendet den Ausdruck „Stigmosus“, um einen Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002 Menschen, einen Verbrecher zu kennzeichnen, der mit Brandmalen versehen ist. In der wörtlichen Bedeutung steht das Griechische „stigmein“ für „Durchbohren, ein Loch anbringen“. Heute wird das Wort „Stigma“ in der Bedeutung verwendet, dass eine Person auf Grund eines echten oder vermeintlichen Defizits oder bestimmter Merkmale geächtet und ausgegrenzt wird. Im Plural gewinnen „Stigmata“ eine weitere Bedeutung: Die christliche Theologie versteht darunter in Anlehnung an Galater 6,17 die von Paulus „an seinem Leib getragenen Malzeichen Jesu“, die seit dem ersten beglaubigten Auftreten bei Franz von Assisi bei rund 300 mystisch begabten Menschen als Leib-seelische Identifizierung mit Christus beobachtet wurden. Irrationalität und Emotionalität prägen die Einstellung weiter Bevölkerungskreise gegenüber psychisch Kranken. Die Vorurteile sind in unserer kulturellen Tradition fest verankert, die Wurzeln reichen weit zurück: Eine religiöse Interpretation seelischer Störungen betrachtete in verschiedenen Kulturkreisen den Kranken als einen Sündigen, der – selbst unter Anwendung des Exorzismus – auf den richtigen Weg hingeführt werden müsse. Krankheit wurde besonders von den romantischen Psychiatern vorwiegend als eine Folge sündhafter Vergehungen gesehen. J. Heinroth (1773–1843), der wesentliche Exponent der „religiösen Psychiker“, interpretierte Geisteskrankheiten als Krankheiten der Seele, die mit dem Verlust der Freiheit verbunden wären. Psychisch Kranke sind nach dieser Sichtweise für ihr Verhalten, ihr Handeln und ihre Fehler aber verantwortlich, da sie als Sünder von Gott mit dem Verlust der Willensfreiheit hätten bestraft werden müssen. Am Beginn des 19. Jahrhunderts beherrschten spekulative und moralisierende Vorstellungen die Gedankenwelt der deutschen Psychiater, obwohl zur gleichen Zeit an anderen Orten, beispielsweise in Frankreich, die Psychiatrie naturwissenschaftlichen Erklärungen geöffnet wurde. Eine weitere Wurzel der Stigmatisierung psychisch Kranker liegt in der Aufklärung, die psychisch Auffällige als offenkundige oder anlagemäßige Verbrecher bewertete. Erst die humanitären Taten eines Vincenzo Chiarugi, des Sozialreformers der habsburgischen Toskana, und – etwas später – die Befreiung der Geisteskranken durch Philipp Pinel setzten das Ende der „Gefängnispsychiatrie“. Die Vorurteile, die ihre Wurzeln in den genannten Traditionsströmen haben, bestehen auch heute in unseren Ländern noch fort, gefördert durch ein Fortbestehen von Argumenten nationalsozialistischer Propaganda, die neben den Kosten und der befürchteten Degeneration des Volkes auch das Moment der „Gefährlichkeit“ benutzte, um den Mord an über 150.000 psychisch Kranken zu legitimieren. Den Boden für diese mörderischen Theorien bildete noch ein anderes Phänomen: Die sozialen Folgen der Industrialisierung bedingten, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Betreuung psychisch Kranker von der Hauskrankenpflege in große psychiatrische Anstalten verlegt wurde. In Deutschland wurden zwischen 1880 und 1913 133 öffentliche psychiatrische Krankenanstalten errichtet. „Die wachsende Zahl der in öffentlichen Anstalten verpflegten Irrsinnigen“ (Gruber und Rüdin 1911) diente zur Illustration der Richtigkeit der Degenerationslehre und zur Forderung, den Anteil der Gesunden zu vermehren („positive Eugenik“) oder die Kranken und Schwachen „auszumerzen“ („negative Eugenik“). Diese Gedanken fielen besonders bei den Nationalsozialisten auf fruchtbaren Boden. In nicht zu überbietender Menschenverachtung begannen sie ihr teuflisches Vernichtungswerk. Der Nationalsozialismus leitete die gesellschaftlichen Strukturen sowie die Zusammengehörigkeit der Menschen aus der „völkischen“, auf „Blut und Rasse“ ruhenden Identität 118 ab: Wer sich durch „Blut und Rasse“ legitimiert, war „Volksgenosse“; wer sich nicht dadurch legitimieren konnte oder zu den „Minderwertigen“ und „Degenerierten“ zählte, wurde mit größter Brutalität aus der „völkischen Blutsbrüderschaft“ ausgeschlossen und vernichtet. Der Sozialdarwinismus ist aber mehr als bloß ein abgeschlossenes Kapitel der jüngeren Ideengeschichte. Obwohl die Zeit, in der er das bewusstseinsbestimmende Gewicht einer Religion gehabt hat, längst verflossen ist, wirkt er – bald untergründig, bald auch manifest – fort und zeigt gerade gegenwärtig Anzeichen einer beängstigenden Wiedergeburt. Am Beginn der 60er Jahre schrieb John F. Kennedy: „Psychisch Kranke dürfen nicht mehr länger durch das Einsetzen von Kommissionen und Unterkommissionen vertröstet werden, die Not und das Elend hunderttausender von Menschen fordern eine Entscheidung, heute, sofort. Diesen Mitbürgern dürfen Grundrechte nicht vorenthalten werden, wenn die Gemeinden und der Staat die Achtung vor sich selbst nicht verlieren wollen.“ Diese Worte, vor 40 Jahren formuliert, haben immer noch große Aktualität, heute mehr denn je, auch in unseren Ländern. Immer noch gilt die Aussage der Verfasser der Deutschen Psychiatrie-Enquete: „In den Gemeinden begegnet man häufig ablehnenden Ansichten und abwehrenden Verhaltensweisen gegenüber psychisch Kranken und Behinderten, die nicht nur die Betroffenen und ihre Angehörigen selbst verspüren, sondern auch die Mitarbeiter derjenigen Einrichtungen, welche diese Personengruppe zu behandeln und zu betreuen haben“. Nach einer anregenden Diskussion über die Stigmatisierung psychiatrischer Patienten schrieb mir Jules Angst in einem persönlichen Brief 2001 folgende Sätze: „Die Mehrzahl der Menschen würde im Laufe des Lebens 119 Hinterhuber mindestens einmal eine psychiatrische Diagnose erhalten, ließen sie sich untersuchen. Nur wenn es ebenso normal ist, eine psychische wie eine körperliche Störung zu haben, ist die Stigmatisierung überwunden. Je mehr man betont, psychiatrische Erkrankungen seien alle schwer, chronisch und beträfen nur einige wenige Prozente der Bevölkerung (was alles nicht wahr ist), umso leichter fällt es, psychisch Kranke als eine inferiore Minderheit zu stigmatisieren. Die modernen epidemiologischen Studien ergeben mit besserer Methodik immer höhere Lebenszeit-Prävalenzen für psychische Störungen. Sie dürften mehr als 2/3 der Menschen betreffen.“ Gewaltige Fortschritte kennzeichnen die jüngste Geschichte der Psychiatrie: Der Bogen reicht von der Entwicklung spezifischer psychotherapeutischer Methoden bis zu den modernen pharmakologischen Entdeckungen und den molekularbiologischen Erkenntnissen in der Ätiopathogenese vieler Krankheiten. Die sozialpsychiatrischen Ambulanzen haben die Bedeutung der psychiatrischen Krankenanstalten drastisch eingeschränkt, die Zahl der ambulant betreuten psychisch Kranken übersteigt um ein Vielfaches die der stationär Aufgenommenen. Anstelle der Zwangsmaßnahmen sind patientenorientierte Behandlungsprogramme getreten, der Kranke ist eine Persönlichkeit mit allen menschlichen Rechten. Die Umsetzung einer menschengerechten Psychiatrie, die Verwirklichung der sich heute darbietenden therapeutischen Möglichkeiten stellt eine der größten ethischen Herausforderungen für unsere Gesellschaft dar. Dazu zählen alle Anstrengungen, die Partizipationschancen der von psychischer Erkrankung Betroffener zu erhöhen. Seit der Etablierung der Psychiatrie als wissenschaftliche Disziplin kämpft diese um gesellschaftliche Gleichstellung der psychisch Kranken mit den körperlich Kranken, sie kämpft um soziale Integrierung der Betroffenen und gegen jede Form der Diskriminierung der Kranken als potentiell gefährliche Geistesgestörte. Im Gesundheitsbericht 2001, veröffentlicht am 4. Oktober 2001, fordert die WHO die internationale Staatenwelt eindringlich auf, mehr Mittel für die Behandlung und die Wiedereingliederung psychisch Kranker zur Verfügung zu stellen. Wegen anha- tender Stigmatisierung, Diskriminierung und Vernachlässigung lässt sich zur Zeit nur ein Drittel der von psychischen Problemen betroffenen Personen ärztlich behandeln. Die WHO-Generaldirektorin Gro Harlem Brundtland bekräftigt in ihrem Bericht, dass eine psychische Erkrankung nicht auf persönliches Versagen zurückzuführen sei und stellt klar: „Wenn in diesem Zusammenhang überhaupt von einem Versagen gesprochen werden könne, dann nur im Bezug auf den bisherigen Umgang der Gesellschaft mit psychischen Erkrankungen.“ Nach ihren Worten ist es das Ziel des WHO-Berichtes „den Teufelskreis von Vernachlässigung und Ignoranz gegenüber psychisch Kranken zu durchbrechen“: Es ist an der Zeit, dass die Entscheidungsträger endlich den Umfang des Problems zur Kenntnis nehmen und an Lösungsmöglichkeiten arbeiten. Univ.-Prof. Dr. Hartmann Hinterhuber Universitätsklinik für Psychiatrie Anichstraße 35 A-6020 Innsbruck LAUDATIO Neuropsychiatrie, Band 16, Nr. 1 und 2/2002 121 Hans Georg Zapotoczky zum 70. Geburtstag Hartmann Hinterhuber Universitätsklinik für Psychiatrie, Innsbruck Am 24.9.2002 unterbricht Univ.Prof. Dr. med. Hans Georg Zapotoczky nur kurz seine wissenschaftlichen Arbeiten, seine Forschungen und seine Vortragstätigkeit, um einen runden Geburtstag zu feiern: Sein alle mitreißender Schwung und sein jugendlicher Elan lassen vergessen, dass es sein 70. Geburtstag ist! Hans Georg Zapotoczky promovierte 1958 an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien zum Doktor der gesamten Heilkunde, 1961 trat er in die von Prof. Dr. Hans Hoff geleitete Psychiatrisch-Neurologische Universitätsklinik Wien ein und wurde 1966 Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Stets um ein umfassendes medizinisches Wissen bemüht, war Hans Georg Zapotoczky nicht nur Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Bleuler an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich/Burghölzli, sondern auch von Prof. Dr. Isaac Marks im Institute of Psychiatry in London sowie bei Prof. Dr. Vic Meyer im Middlesex-Hospital. 1982 wurde ihm der Titel eines a.o. Professors für Psychiatrie verliehen, seit 1.5.1991 stellte sich Prof. Dr. Hans Georg Zapotoczky als o. Universitätsprofessor der Medizinischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz dem Aufbau der Univ.-Klinik für Psychiatrie zur Verfügung. Ihm verdankt die österreichische Psychiatrie vieles von seiner internationalen Reputation, das Land Steiermark ehrt ihn als Begründer der wissenschaftlichen Psychiatrie und als Initiator vieler sozialpsychiatrischer Projekte. Bis zu seiner Emeritierung war Prof. Hans Georg Zapotoczky an allen Orten seines Wirkens seinen Assistentinnen und Assistenten ein vorbildhafter, richtungsweisender, stets zur konstruktiven Zusammenarbeit bereiter und von Menschlichkeit geprägter Lehrer. In der Psychiatrie sieht er nicht nur die biologischen, psychologischen und soziologischen Aspekte, er berücksichtigt auch den philosophischen, kulturellen und religiösen Hintergrund unserer Disziplin. Wie kaum ein anderer versteht es Hans Georg Zapotoczky die verschiedenen Fachgebiete und Fachrichtungen zu versöhnen und zu verbinden, ihre Zusammenarbeit zu katalysieren, ohne aber die Eigenständigkeit der einzelnen Denkrichtungen in Frage zu stellen. H. G. Zapotoczky erfuhr in Wien eine profunde individualpsychologische Ausbildung, in England begann ihn die Verhaltenstherapie zu faszinieren, zu deren wissenschaftlichen Fundierung er vieles beigetragen hat. So war er von 1993 bis 1995 Präsident der Österreichischen Gesellschaft zur Förderung der Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin. Prof. Zapotoczky genießt das uneingeschränkte Vertrauen der österreichischen Psychiater: Von 1998 bis 2000 bekleidete er das Amt des Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie und Psychiatrie, während dieser Zeit setzte er entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft. Seine Arbeitskraft ist auch heute für viele ein Vorbild, er ist zurzeit Präsident der Österreichischen Gesellschaft für depressive Erkrankungen und Herausgeber der Zeitschrift „Psychopraxis“. Prof. Zapotoczky ist Membre correspondant de la Societe medicopsychologique de Paris, Korrespondierendes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Nervenheilkunde, Korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Verhaltenstherapie und Ehrenmitglied der Medizinischen Gesellschaft für Oberösterreich. Die vielfältigen Anerkennungen dokumentieren seine internationale Geltung: Die Republik Österreich würdigte seine vielen Verdienste und zeichnete ihn mit dem Verdienstkreuz Erster Klasse für Kunst und Wissenschaften aus. Die Zahl seiner wissenschaftlichen Arbeiten und der von ihm verfassten bzw. herausgegebenen Bücher ist gewaltig und gebietet größte Bewunderung: Allein sein Verzeichnis umfasst weit über 300 wissenschaftliche Arbeiten und 20 Publikationen in Buchform. Die Kraft zu all diesen Aktivitäten findet er in seiner Familie, besonders in seiner lieben Gattin, der auch unser Dank gebührt. Eine große Schar von Freunden und Kollegen wünscht Hans Georg Zapotoczky weiterhin viel Kraft und Gesundheit für die Bewältigung seiner vielen Aufgaben und viel Freude und Erfüllung in seinen Musestunden.