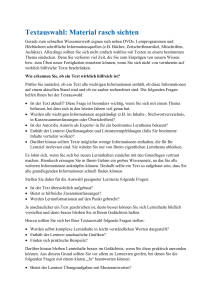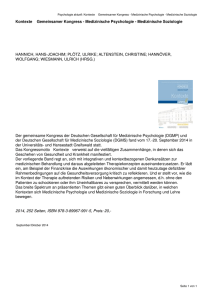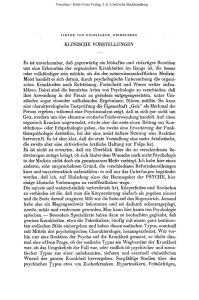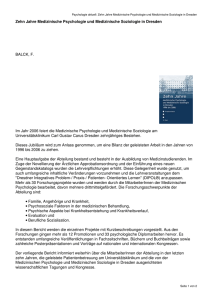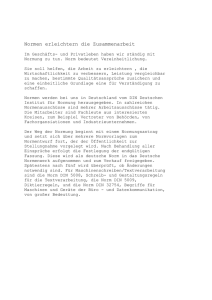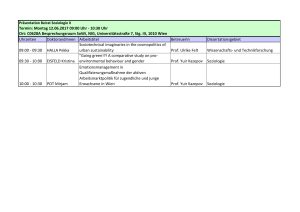1. ÄP Medizinische Psychologie, Medizinische Soziologie - Beck-Shop
Werbung

Schwarze Reihe 1. ÄP Medizinische Psychologie, Medizinische Soziologie Original-Prüfungsfragen mit Kommentar Bearbeitet von Erich Kasten, Bernhard Sabel 1. Auflage 2011. Buch. 412 S. Kartoniert ISBN 978 3 13 114927 5 Format (B x L): 17 x 24 cm Weitere Fachgebiete > Medizin > Human-Medizin, Gesundheitswesen > Medizinische Soziologie & Psychologie, Lebensqualität Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte. Kommentare 94 1 Entstehung und Verlauf von Krankheiten 1 Entstehung und Verlauf von Krankheiten 1.1 Bezugssysteme von Gesundheit und Krankheit 1.1.1 Begriffserklärungen I.1 Begriffserklärungen Zunächst einmal herzlich willkommen! Wirklich schrecklich nett, dass Sie mich angeschafft haben. Dafür werden Sie ab heute nie mehr alleine sein, sondern haben nun Ihren eigenen Psychologen bei sich. Wir werden jetzt, wohl oder übel, einige Zeit miteinander verbringen, bis Sie soviel über Psychologie gelernt haben, dass Sie die überwiegende Mehrzahl der Psychofragen im schriftlichen Physikum problemlos beantworten können. Dies ist übrigens kein Lehrbuch, sondern ein Lernbuch. Im Gegensatz zu richtigen Lehrbüchern, wo das alles lang und breit erklärt wird, soll hier gar nicht lange herumgeschwafelt werden, sondern es werden oft kurz und prägnant nur die Fachbegriffe definiert, die Sie für die Prüfung im Kopf haben müssen. Ich möchte gleich mit der Tür ins Haus fallen und mit einer echt schweren Frage anfangen: „Wie geht’s Ihnen denn heute so?“ „Wie geht’s Dir?“ ist eine allgemeine Plattheit, auf die wir keine wirkliche Antwort erwarten. Aber wonach richtet sich die Einschätzung? Bei ehrlicher Beantwortung musste ich voller Entsetzen feststellen, dass nur knapp ein Drittel der Teilnehmer eines Kurses sich „so richtig gesund“ fühlte. Die anderen waren aber nicht schwerkrank, denn Gesundheit und Krankheit sind keine Gegensätze (=dichotome Variable, d. h. zweigeteilte Ausprägung wie männlich/weiblich), sondern nur die Endpole eines Kontinuums. Dazwischen gibt es viele verschiedene Grade der Ausprägung (=polytome Variable). Da unser Immunsystem ständig Krankheitserreger bekämpft, sind wir fast immer „ein kleines bisschen krank“. Krankheit lässt sich also definieren als mehr oder minder große Abweichung von einem biologischen, medizinischen, verhaltensmäßigen oder sozialen Normalzustand. Den unklaren Zwischenzustand, in dem die meisten von uns sich zwischen Montagmorgen und Freitagabend befinden, bezeichnet man als Krankheitsvorfeld. Aber was ist dann „gesund“? Die wichtigsten Definitionen der Gesundheit sollten Sie kennen, um das nächste Mal die Frage danach, wie es Ihnen geht, kompetent zu beantworten: ● Nach der Definition eines Klinisches Wörterbuchs wird „Gesundheit“ als das Fehlen körperlicher und seelischer Störungen erklärt. „Krank- ● ● heit“ wird dann logischerweise als das Fehlen von Gesundheit definiert. Eine einleuchtende Erklärung, die auch Sie sich leicht merken können. Nach Ansicht der WHO (Welt-Gesundheitsorganisation) ist Gesundheit „der Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefindens“, wonach, abgesehen von einigen Frischverliebten, wohl kaum jemand wirklich gesund sein dürfte. Im sozialversicherungsrechtlichen Sinn wird Krankheit ganz pragmatisch als das Vorhandensein von Störungen definiert, die Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben und Therapie erfordern. Bei der Entstehung von Krankheiten (Pathogenese) spielen einige wichtige Faktoren eine Rolle. Folgende Begriffe muss man sich einprägen: Abb. 1.1 Risikofaktoren: Beruflichen Stress konnte Herbert B. in den letzten Jahren durch die entspannende Wirkung von Alkohol, Nikotin und nahrhaften Mahlzeiten gut kompensieren. Allostase: Langfristige Anpassungsmechanismen des Organismus an chronische Belastungen, z. B. bei Stress. Ätiologie: Theorien über die Ursachen der Entstehung einer Erkrankung (B.: Entstehung der Schizophrenie durch genetische oder sozialer Einflüsse). aus: 1. ÄP, Medizinische Psychologie und Soziologie (ISBN 9783131149275) © 2011 Georg Thieme Verlag KG Spontanremission: spontane Rückbildung von Krankheiten ohne Therapie gibt es nicht nur bei Schnupfen, sondern sogar bei Krebs. Risikofaktoren: Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung, z. B. Sturzgefahr bei Dachdeckern, Krebs durch Pestizide bei Landwirten, Heiserkeit bei Hochschuldozenten und Schrei(b)krämpfe bei Medizinstudenten. Protektive Faktoren: Schutzfaktoren, die Risikofaktoren abschwächen (B.: weniger Magengeschwüre durch das Physikum bei Studenten mit Lerngruppe). Resilienz (=Elastizität, Spannkraft): Aufgrund dieser Persönlichkeitseigenschaft erkranken manche Menschen auch bei massiven Risikofaktoren (z. B. Kriege, Katastrophen) nicht, sondern passen sich an. Rekrudeszenz: Rückfall im Krankheitsverlauf. Chronifizierung: eine Erkrankung heilt nicht aus, sondern bleibt dauerhaft bestehen (Diabetes). Rezidiv: nach kurzzeitiger Remission (Rückbildung) kommt es zum erneuten Ausbruch (B.: Krebs). Epidemiologie (Seuchenkunde): Verbreitung von Krankheiten und deren Folgen auf die Bevölkerung. Rehabilitation: Maßnahmen zur Linderung von schweren gesundheitlichen Störungen mit dem Ziel der (Re-)Integration. Klinischer Bezug Die Kenntnis der Definitionen von Gesundheit und Krankheit kann für sozialversicherungsrechtliche Fragen wichtig sein, wenn es darum geht zu entscheiden, ob und in welchem Ausmaß eine Person durch eine Störung in ihren Aktivitäten eingeschränkt ist und eine Minderung der Lebensqualität hierdurch erfährt. F01 ■ F10 Ú Frage 1.1: Lösung D Ú Frage 1.2: Lösung D Zu (A): Dispositioneller Optimismus. Theorie, dass die Erwartung, wie ein Ereignis ausgehen wird, das Handeln beeinflusst. Wünschenswerte Ereigniserwartungen veranlassen ein Individuum zu vermehrter Anstrengung, dieses Ziel auch zu erreichen. Umgekehrt reduzieren Personen ihre Bemühungen, wenn das Ziel unerreichbar erscheint. Optimisten werden zwar seltener krank und eher wieder gesund, zeichnen sich aber nicht zwangsläufig durch mehr Anpassungsfähigkeit aus. Zu (B): Eysenck unterschied vier Dimensionen der Persönlichkeit: 1. Extraversion – Introversion, 2. Stabilität – Labilität (Neurotizismus), 3. Realismus – Psychotizismus und 4. Intelligenz. Emotionale Stabilität hat vor allem Auswirkungen auf das Risiko, psychisch krank zu werden. Auch stabile müssen aber nicht psychisch elastischer sein als labile Personen. Zu (C): Kontrollüberzeugung: Personen mit internaler Kontrollüberzeugung glauben, dass Erfolg bzw. Misserfolg (auch Krankheiten!) von ihren eigenen Leistungen abhängt. Personen, die external attribuieren, sehen die Ursache für Erfolg/Misserfolg in anderen Personen oder im Schicksal. Zu (D): Resilienz: siehe Lerntext I.1. Zu (E): Selbstwirksamkeitserwartung ist ein von Bandura geprägter Begriff und bedeutet die Erwartung eines Effektes/Erfolges eigenen Handelns (Selbstwirksamkeit) unter gegebenen Situationsbedingungen unabhängig vom realen Ergebnis. Zu (A): Der Begriff Akkulturation bezeichnet das Hineinwachsen einer Person in ihre kulturelle Umwelt. In der Regel bezieht sich der Begriff auf Heranwachsende, also Kinder und Jugendliche in der Phase der Adoleszenz. Es kann aber auch der Assimilationsprozess Erwachsener gemeint sein, die sich als Immigranten mit einer ihnen fremden Kultur vertraut machen. Akkulturation vollzieht sich überwiegend durch Erziehung, teilweise aber auch durch ungeplantes Lernen. Zu (B): Stigmatisierung: Menschen mit bestimmten Eigenschaften (z. B. psychisch Kranke) werden von der Gesellschaft bestimmte Merkmale zugeschrieben. In der Regel werden diese Individuen damit zu Außenseitern, d. h. von der Gesellschaft „abgestempelt“. Bei der Entstigmatisierung wird dieser Prozess umgekehrt, z. B. Integration Behinderter, durch Aufklärung des sozialen Umfeldes oder gar der Bevölkerung. Zu (C): Menschen mit internaler Kontrollüberzeugung glauben, dass Erfolg bzw. Misserfolg von ihren eigenen Leistungen abhängt. Personen, die external attribuieren, sehen die Ursache für Erfolg-Misserfolg in anderen Personen oder im Schicksal. Zu (D): Das Konzept der Resilienz (Widerstandsfähigkeit, Spannkraft) erklärt, warum auch bei Vorliegen vieler Risikofaktoren manche Personen nicht krank werden. Dieses Konzept könnte man hier am ehesten noch heranziehen, da das Kind trotz ungünstiger Voraussetzungen eine erfolgreiche Laufbahn einschlägt. Zu (E): Der soziale Status einer Person hängt von einer Reihe von Statusmerkmalen (Einkommen, Ausbildung, Beruf) ab. Bei Statuskonsistenz sind die aus: 1. ÄP, Medizinische Psychologie und Soziologie (ISBN 9783131149275) © 2011 Georg Thieme Verlag KG 95 Kommentare 1.1 Bezugssysteme von Gesundheit und Krankheit Kommentare 96 1 Entstehung und Verlauf von Krankheiten einzelnen Statusmerkmale etwa auf dem gleichen Niveau, z. B. hat jemand mit Ach und Krach die Sonderschule abgeschlossen, arbeitet jetzt als ungelernter Hilfsarbeiter im Münchener Zoo und mistet dort den Elefantenstall aus. Statusinkonsistenz liegt bei Menschen vor, bei denen sich Statusmerkmale in ihren Niveaus deutlich unterscheiden (z. B. sehr gute Ausbildung und Einkommen, das mit Ach und Krach zum Leben reicht). H10 Ú Frage 1.3: Lösung E Zu (A), (B) und (D): Protektivfaktoren sind alle Faktoren, die ein Individuum vor Schädigung schützen. Es lassen sich personale (interne) von sozialen, ökologischen und ökonomischen (externen) Ressourcen unterscheiden. Die Bewältigung von Stressbelastungen ist davon abhängig, wie gut Personen in einer Belastungssituation sowohl interne als auch externe Ressourcen mobilisieren können. Diese Ressourcen sind individuelle Lebenskompetenzen (Skills), Persönlichkeitsmerkmale und spezifische Bewältigungsstrategien. Beispiele für externe Ressourcen sind z. B. die Sicherung der Erfüllung von Grundbedürfnissen, ausreichender Wohnraum, sozialer Rückhalt, soziale Integration und soziale Unterstützung. Solche Protektivfaktoren können Krankheiten verhindern ((A) z. B. durch ein gesundes Immunsystem), im Verlauf abschwächen (B), einer Chronifizierung und Wiederauftreten vorbeugen (D). Zu (C): Das Konzept der Resilienz (Widerstandsfähigkeit, Spannkraft) erklärt, warum auch bei Vorliegen vieler Risikofaktoren manche Personen nicht krank werden. Die Resilienz gehört mit zu den Protektivfaktoren. Zu (E): Diese Antwortmöglichkeit macht keinen Sinn, im Leben bestehen immer Risiken. H09 Ú Frage 1.4: Lösung A Zu (A): Als Allostase werden langfristige Anpassungsmechanismen des Organismus an chronische Belastungen bezeichnet, z. B. bei Stress. Zu (B): Die Homöostase ist die Selbstregulierung zur Einhaltung eines Gleichgewichts, das für die Lebenserhaltung notwendig ist (z. B. Körpertemperatur, Blutzucker). Zu (C): Resilienz (Widerstandsfähigkeit, Spannkraft): siehe Lerntext I.1. Zu (D): Stressoren (Stressfaktoren) sind definiert als alle äußeren oder inneren Reize, die eine Anpassungsreaktion des Individuums erfordern. Hierbei wird positiver Stress (Eustress) und belastender Stress (Dysstress) unterschieden. Zu (E): Vulnerabilität (Verletzlichkeit): Personen können hinsichtlich bestimmter Störungen eine ho- he Vulnerabilität haben, d. h. besonders leicht daran erkranken. F10 Ú Frage 1.5: Lösung A Zu (A): Ein Rezidiv ist ein Rückfall im Heilungsprozess bzw. das Wiederauftreten einer bekannten Erkrankung. Zu (B): Das wäre Spontanremission. Zu (C): Das könnte z. B. bei Chronifizierung der Fall sein. Zu (D): Damit wird Non-Compliance beschrieben. Zu (E): Die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen wird z. B. durch das Konzept der Resilienz beschrieben. 1.1.2 I.2 Die betroffene Person Aspekte der Gesundheitspsychologie Krankheit lässt sich heute zwar objektiv messen (B.: erhöhte Lymphozytenzahl, Tumor im MRT), die Patienten schert das jedoch nichts, sie kommen einfach wegen subjektiv empfundener Beschwerden zum Arzt. Hierbei spielen eine Rolle: ● Exterozeption: Wahrnehmung äußerer Faktoren (B.: Lärm). ● Interozeption: Spüren innerer Funktionen; ● Nozizeption: Schmerzwahrnehmung; ● Propriozeption: Eigenwahrnehmung des Körpers (B.: Haltung, Stellung der Gelenke). ● Viszerozeption: Wahrnehmung innerer Organe, besonders der Eingeweide. Nur so spaßeshalber, kreuzen Sie mal an: Ich habe ... fast nie selten mittel oft sehr oft über 10-stündige Arbeitstage Prüfungsstress + Referate Fast-Food Über- oder Untergewicht Schlafmangel Bewegungsmangel Zuwendungsmangel Liebeskummer, Depressionen Burnout, Überlastung Finanzielle Sorgen aus: 1. ÄP, Medizinische Psychologie und Soziologie (ISBN 9783131149275) © 2011 Georg Thieme Verlag KG Ich habe ... fast nie selten mittel oft sehr oft Rauchen Alkohol / Drogen Umgang mit krebserrgd. Chemikalien Risikoreiches Zweirad- od. Autofahren Die Gesundheitspsychologie arbeitet krankmachende psychosoziale Faktoren heraus. Warum nehmen Sie Risikofaktoren in Kauf, obwohl gerade Sie als Medizinstudent/-in wissen müssten, dass diese irgendwann in Krankheit resultieren? Wie es uns geht ist auch eine Frage danach, wie wir Körperempfindungen interpretieren. Gedanken nennen wir ab jetzt „Kognitionen“ und merken uns, dass es „heiße“ und „kalte“ davon gibt. Damit ist leider nicht das gemeint, woran Sie jetzt wahrscheinlich denken. Richard Lazarus (US Psycho-Proff) unterschied „knowledge“ (fachliches Wissen z. B. über eine Krankheit = kalte Kognitionen) und „appraisal“ (persönliche Betroffenheit = heiße Kognitionen). Solche Gedankengänge umfassen: 1. Symptomwahrnehmung („Ich habe Bauchschmerzen!“); 2. Attributionen (=Ursachensuche: „Das Verfallsdatum der Wurst war vor drei Monaten abgelaufen.“); 3. Einschätzung der Bedrohlichkeit („An einer Fleischvergiftung kann man elendiglich eingehen!“); 4. Kontrollüberzeugung („Bestimmt hilft Kamillentee!“); 5. Selbstwirksamkeit: Erwartung des Erfolges eigenen Handelns („Es wird helfen, wenn ich mir den Finger in den Hals stecke“); 6. Krankheitsschemata: („Besser, ich lese das erst mal genau nach. Wo ist denn bloß Omas Buch ‚Die Frau als Hausärztin?’“). Kognitionen bestimmen auch, wie stark wir uns auf Reize konzentrieren und ob wir sie verstärken, abschwächen oder leugnen. Z. B. erhöht die gedankliche Fokussierung auf eine Wunde das Schmerzerleben massiv. Die Symptomwahrnehmung ist auch abhängig von der persönlichen Lerngeschichte. Jeder Mensch hat im Verlauf seines Lebens Hypothesen über die Entstehung von Krankheiten gelernt, die beim Auftauchen von Krankheitsanzeichen herangezogen werden und zu unterschiedlichen Bewertungen führen. Nasenbluten kann man als harmlos oder als Symptom für Leukämie ansehen. Klinischer Bezug Krankheit ist nicht alleine ein körperlicher Prozess, sondern unteilbar verbunden mit den Kognitionen der erkrankten Person. Diese Einstellungen sind vom Arzt zu berücksichtigen. H05 Ú Frage 1.6: Lösung E Zu (A): Introspektion: Untersuchung psychischer Vorgänge durch Selbstbeobachtung. Zu (B): Nozizeption: Schmerzwahrnehmung. Zu (C): Propriozeption: Eigenwahrnehmung des Körpers. Zu (D): Sensitization: Der sensitive Reaktionstyp („sensitizer“) nimmt Gefahren übermäßig stark wahr und ist emotional viel damit beschäftigt. Gegenteil ist der Repressor. Zu (E): Viszerozeption: Wahrnehmung von Prozessen aus den Bereichen der inneren Organe, besonders der Eingeweide. F07 H04 Ú Frage 1.7: Lösung B Zu (A): Exterozeption: Wahrnehmung äußerer Faktoren wie Berührung, Temperatur, Licht. Zu (B): Interozeption: Wahrnehmung von vegetativen Prozessen aus inneren Organen, hier z. B. Herzschlag. Zu (C): Nozizeption: Schmerzwahrnehmung. Zu (D): Propriozeption: Wahrnehmung innerer Funktionen wie z. B. Lage oder Haltung des Körpers. Zu (E): Somatisierung: Ausbildung eines körperlichen Symptoms bei einer ursprünglich psychischen Störung. H10 Ú Frage 1.8: Lösung A Zu (A): Der Begriff Nozizeption bezeichnet die Schmerzwahrnehmung. Zu (B): Unter Propriozeption ist die Wahrnehmung innerer Funktionen wie z. B. Lage oder Haltung des Körpers zu verstehen. Zu (C) und (D): Die beiden Begriffe beschreiben Persönlichkeitseigenschaften. Repression ist die Unterdrückung oder Verleugnung von Bedürfnissen oder Gefühlen. Ein Sensitizer (sensitiver Reaktionstyp) besitzt eine sehr starke Eindrucksfähigkeit für Erlebnisreize und achtet in mehrdeutigen Situationen stark auf beziehungsrelevante Hinweise der Kommunikation. Der Repressor verleugnet Gefahren, der Sensitizer dagegen nimmt mögliche Gefahren geradezu übermäßig wachsam wahr. Zu (E): Viszerozeption ist die Wahrnehmung von Prozessen aus dem Bereich der „Eingeweide“. aus: 1. ÄP, Medizinische Psychologie und Soziologie (ISBN 9783131149275) © 2011 Georg Thieme Verlag KG 97 Kommentare 1.1 Bezugssysteme von Gesundheit und Krankheit Kommentare 98 1 Entstehung und Verlauf von Krankheiten F05 Ú Frage 1.9: Lösung D Zu (A): Kontrollüberzeugung: Ein Ergebnis kann abhängig von den eigenen Fähigkeiten oder von Umweltfaktoren sein. Personen mit einer internalen Kontrollüberzeugung gehen davon aus, dass Erfolg und Misserfolg von eigenen Leistungen abhängt. Bei externaler Kontrollüberzeugung wird die Ursache in anderen Personen oder Schicksalsschlägen gesehen. Bei der übergewichtigen Patientin liegt aber eine internale und keine externale Kontrollüberzeugung vor. Zu (B): Kognitive Dissonanz tritt auf, wenn zwei (oder mehr) widersprüchliche Erkenntnisse in einem Individuum aufeinander treffen („Ich esse sooooooo gerne Schokoladenpudding!“ versus „Oh, ich habe mich ja gerade mit einer Diät einverstanden erklärt.“). Bei der Patientin wird leider keine solche Dissonanz geschildert. Zu (C): Resilienz (Widerstandsfähigkeit, Spannkraft). Zu (D): Selbstwirksamkeitserwartung: Die Aussage der Patientin, dass sie es schaffen kann abzunehmen, wenn sie es wirklich will, fällt in diesen Bereich. Zu (E): Soziale Verstärkung: Soziale Verstärker sind Lob (in Form von Gestik und verbalen Äußerungen) und Zuwendung im Gegensatz zu materiellen Verstärkern. Soziale Verstärker sollen in systematischer Abhängigkeit vom gewünschten Verhalten des Patienten vom Therapeuten gegeben werden. Systematische soziale Verstärkung ist v. a. bei Patienten mit leichten Verhaltensauffälligkeiten geeignet. Hier ist nicht die Rede davon, ob der Arzt die Patientin für das Abnehmen sozial verstärken wird. I.3 Attributionstheorie Wer ist Schuld, wenn Sie durch ein Testat gefallen sind? Wem schreiben Sie das Verdienst zu, wenn Sie eine Prüfung bestanden haben? Attributionstheorien beschäftigen sich mit solchen Ursachenzuschreibungen. Auch für Krankheiten gibt es derartige Attributionen; man differenziert: ● Extern/intern: Bei externalen Kontrollüberzeugungen werden außenstehende Mächte oder das Schicksal verantwortlich gemacht („Diese Bauchschmerzen! Es könnte Magenkrebs sein. Mein Überleben hängt jetzt nur noch von den Ärzten ab“). Bei internalen Attributionen wird die Verantwortlichkeit in sich selbst gesehen („Bin selbst Schuld; habe die letzten Tage wohl zu oft bei MacDagobert gegessen“). ● Global/spezifisch: Globale Kontrollüberzeugungen dehnen sich über alle Lebensbereiche aus, spezifische beziehen sich nur auf abgrenzbare Bereiche (z. B. Beruf oder Partnerschaft). ● ● Variabel/stabil: Bei variablen Attributionen werden die Ursachen für einen Handlungsausgang jeweils unterschiedlich bewertet; stabile bedeuten, dass die Person davon ausgeht, dass sie immer Glück/Pech hat. Kontrollierbar/unkontrollierbar: Lässt sich die Ursache eines Handlungsausganges künftig kontrollieren (Prüfungsversagen durch Faulheit) oder ist das Resultat nicht mit eigenen Möglichkeiten zu steuern (fieser, unberechenbarer Prüfer): Im zweiten Fall kommt es zu Gefühlen der Hilflosigkeit. Der Glaube, eine Krankheit kontrollieren zu können, erhöht die „Selbstwirksamkeit“, die Sie im letzten Lerntext kennengelernt haben. Selbstwirksamkeits-Kognitionen sind entscheidend für gesundheitsbezogene Verhaltensweisen (z. B. Abmagerungskur, Raucherentwöhnung, Sport treiben). Eine Kieler Studie zeigte, dass Attributionen auch Einfluss auf das Heilungsgeschehen haben. Nach einem Verkehrsunfall hatten diejenigen Patienten den besten Heilungsverlauf, die den Unfall für unvermeidbar hielten und sich selbst gar keine Schuld zuschrieben. Patienten dagegen, die gedanklich an der Frage „Warum gerade ich?“ („Why me?“) klebten, verweilten länger im Krankenhaus. Grübeleien führen zu Depressionen, die den Heilungsverlauf verzögern. Actor-Observer: Sie beobachten wie auf offener Straße ein breitschultriger, grimmig aussehender, bärtiger Mann einen harmlos wirkenden, schlanken Jugendlichen brutal festhält und auf ihn einbrüllt. Wer ist der Böse? Der Akteur-BeobachterAnsatz geht davon aus, dass Beobachter oft die Personenmerkmale des Handelnden überschätzen, der Akteur dagegen attribuiert auf die situativen Einflüsse. Beobachter kennen die beobachtete Person nur aus diesem einen Beispiel und sehen daher gleich eine Persönlichkeitseigenschaft hinter dem Verhalten; ist man selbst Akteur, kennt man sich selbst aus vielen ähnlichen Situationen und weiß um die Konsistenz der eigenen Charaktereigenschaften. In dem obigen Beispiel handelte es sich bei dem Bärtigen um einen unbescholtenen Bürger, dem der Jugendliche gerade die Brieftasche geklaut hatte. Klinischer Bezug In welchem Ausmaß ein Patient sich bemüht gesund zu leben oder eine Krankheit aktiv zu bekämpfen, hängt von seinen Attribuierungen ab. Insbesondere bei mangelhafter Zusammenarbeit sollte der Arzt sich über solche Ursachenzuschreibungen Gedanken machen. aus: 1. ÄP, Medizinische Psychologie und Soziologie (ISBN 9783131149275) © 2011 Georg Thieme Verlag KG Ú Frage 1.10: Lösung A Zu (A): Attribution: siehe Lerntext I.3. Die Attributionstheorie beschäftigt sich also vorrangig mit den in der IMPP-Frage genannten Sachverhalten. Zu (B): Gestalttheorie: Theorie, die Anfang des 20. Jahrhunderts z. B. von Wertheimer, Köhler, Koffka und Lewin begründet wurde: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Auch psychische Prozesse setzen sich nicht einfach aus Teilen zusammen, sondern bilden eine Ganzheit. Zu (C): Der Behaviorismus beschäftigt sich nur mit Ein- und Ausgangsvariablen und macht keine Aussagen darüber, was dabei eigentlich im Individuum geschieht. Dies wird als „black-box“-Phänomen (engl. = schwarzer Kasten) bezeichnet. Nicht betrachtbar sind alle die Variablen, die in der Versuchsperson selbst wirksam und damit nicht messbar sind. Zu (D): Die faktorenanalytischen Persönlichkeitsmodelle beruhen auf korrelationsstatistischer Auswertung der Erfassung von Persönlichkeitseigenschaften durch Fragebögen. Zu (E): Psychoanalytische Modelle betonen die Dynamik unterschiedlicher Anteile der Persönlichkeit. Solche Theorien wurden z. B. entwickelt von Sigmund Freud, Alfred Adler oder Wilhelm Reich. Ganz falsch ist diese Lösungsmöglichkeit nicht, da auch die Psychoanalyse sich mit den in der IMPP-Frage genannten Sachverhalten auseinandersetzt. Allerdings ist es hier eher der Analytiker, der den Sinn des Verhaltens zu ergründen versucht, weniger der Mensch selbst. F07 F01 Ú Frage 1.11: Lösung A Zu (A): Actor-Observer-Ansatz: siehe Lerntext I.3. Zu (B): Kausalattribution bedeutet Zuschreibung der Ursachen für eine Handlung. Zu (C): Das kognitive Modell psychischer Störungen geht davon aus, dass dysfunktionale Gedankengänge Ursache vieler psychischer Störungen sind. Therapietechniken wie die kognitive Umstrukturierung oder die rational-emotive Therapie bemühen sich darum, negative, selbstzerstörerische oder hemmende Gedankengänge („Helga hat mich heute noch gar nicht begrüßt.“) durch positive zu ersetzen („Bestimmt macht sie sich gerade besonders hübsch für mich und kommt erst dann ...“). Zu (D): Kontrollüberzeugung: Hinsichtlich der Gesundheit geht der Arbeiter also davon aus, dass seine Gesundheit von Schicksalsschlägen abhängt und er selbst gar nichts dafür tun kann. Zu (E): Nach dem Konzept der Wahrnehmungsabwehr („perceptual defense“) werden unangenehme oder tabuisierte Reize unbewusst abgelehnt. Experimentell wurden hierfür z. B. Worte tachistosko- 99 pisch dargeboten. Gewisse „Tabuworte“, die aus Gründen des sozialen Anstandes auch in dieser Ausgabe bedauernswerterweise leider wieder einmal nicht zitiert werden können, wurden gar nicht, schlechter oder erst zeitlich verzögert erkannt. Auch kritische Gedanken zur eigenen Person könnten auf diese Art abgewehrt werden. Kommentare H03 F01 1.1 Bezugssysteme von Gesundheit und Krankheit F03 ■ ■ Ú Frage 1.12: Lösung C Zu (A)–(E): Die Person in dem Beispiel dieser Frage sieht die Schuld für das Misslingen seiner sozialen Beziehungen in sich selbst („Ich sage meist irgendwelche Sachen ...“), die Attribution ist also internal. Darüber hinaus ist sie global („Egal, mit wem ich in Kontakt trete ...“) und stabil („Das ist überhaupt so typisch für mich ...“). Damit ist (C) richtig. I.4 Krankheitsschemata Ausschlaggebend dafür, wie man selbst die Ursachen für eine Krankheit attribuiert, sind subjektive Krankheitsschemata. Wer hinter Herzrhythmusstörungen gleich eine Endokarditis vermutet, wird mehr Angst haben, intensiver auf die Symptome achten und früher einen Arzt aufsuchen. Bei Patienten mit der medizinisch harmlosen, psychisch-bedingten „Herzphobie“ kommt es zum gegenseitigen Aufschaukeln: Die Angst verstärkt die Symptome (Herzrasen) wodurch sich das Panikgefühl verstärkt usw. Solche Krankheitsschemen sind – abhängig vom medizinischen Vorwissen – mehr oder weniger gut fundiert. Symptome werden danach klassifiziert, was dann zu einem Versuch der Selbstbehandlung führt („Blutreinigungstee trinken“). Neue Krankheitsanzeichen führen dabei wesentlich häufiger zum Aufsuchen des Arztes als bekannte, da das Schema fehlt. Diese Krankheitsschemata stehen in enger Relation zur Gesamtpersönlichkeit und zur Lebensgeschichte. Eine generell eher ängstliche Person wird auch geringfügige Symptome überschätzen und als Bedrohung ansehen. Jemand, dessen Eltern an Herzinfarkt gestorben sind, wird schon auf ein leichtes Stolpern des eigenen Herzens mit Panik reagieren. Hypochondrie (Hineinsteigern in eingebildete Krankheitssymptome) markiert hier das eine Ende eines Kontinuums und Indolenz (Gleichgültigkeit gegen Schmerzen) das andere. Klinischer Bezug Wenn ein Patient einen Arzt aufsucht, so hat dieser die Schemata der wichtigsten Krankheiten im Kopf und versucht nun die Symptome einzuordnen. aus: 1. ÄP, Medizinische Psychologie und Soziologie (ISBN 9783131149275) © 2011 Georg Thieme Verlag KG Kommentare 100 1 Entstehung und Verlauf von Krankheiten 1.1.3 Die Medizin als Wissens- und Klinischer Bezug Handlungssystem Medizinische Diagnosen sind nicht unfehlbar. Die Benutzung von Klassifikationssystemen hilft vergleichbare Diagnosen zu erstellen. Zu diesem Kapitel gibt es keine aktuellen Fragen. I.5 Die Medizin als Wissens- und Handlungssystem Im Gegensatz zum reichen Spektrum subjektiver Befindlichkeit orientiert sich die klassische Medizin an objektiven Messdaten. Ein kostenintensives Sammelsurium unterschiedlichster Techniken analysiert sämtliche erfassbaren Parameter und vergleicht diese mit Normalwerten aus Tabellen. Abweichungen werden ab bestimmten Grenzwerten als pathologisch bezeichnet. Das hört sich ganz logisch an, allerdings liegen in der Alltagsroutine des Arztes nicht immer tabellarische Normwerte vor (z. B. beim CT oder MRT ist man auf seine Erfahrung angewiesen) und manche Symptome sind kaum wirklich messbar (z. B. Schmerzen). Hinter manchen Änderungen verbirgt sich nur ein Messfehler (B.: hoher Creatinkinase-Wert durch Leistungssport und nicht durch einen Herzinfarkt). Darüber hinaus können auch zufällige Ereignisse (z. B. miserabler Nachtschlaf, Wetterumschwung) Testergebnisse verfälschen. Wichtiger Merksatz für Ihr künftiges Arztleben: Alle Messergebnisse sind mehr oder minder fehlerbehaftet. Verlassen Sie sich nie auf einen Wert; was zählt ist die Gesamtheit des Patienten und seiner Symptome! Darüber hinaus gibt es auch gesunde Kranke: Eine Person, die völlig glücklich ist und sich auf der Höhe ihres Leistungsvermögens fühlt, kann im medizinischen Sinne als krank eingestuft werden (z. B. manische Phase einer bipolaren affektiven Störung) oder ein Patient, der sich sterbenskrank fühlt wird aufgrund der körperlichen Befunde als völlig gesund eingestuft (z. B. Hypochonder). Klassifikationssysteme Jahrzehntelang wurden in Nordamerika viel mehr Schizophrenien diagnostiziert als in Europa. Ist diese Erkrankung dort wirklich häufiger? Oder neigten die Psychiater in Übersee leichter zum Urteil einer Psychose? Um Diagnosen überregional zu vereinheitlichen, wurden Klassifikationssysteme geschaffen, die Ein- und Ausschlusskriterien genau definieren. Die am häufigsten benutzten Systeme sind: ICD = International Classification of Diseases ICIDH: International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps DSM = Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen Auf alle drei kommen wir später noch ausführlicher zu sprechen. 1.1.4 I.6 Die Gesellschaft Normen Warum werden Sie in Rom auch bei heißem Wetter vermutlich nicht nackt in einem städtischen Springbrunnen baden? Sonderbarerweise bemüht man sich selbst in Gegenwart völlig fremder Personen einen „ordentlichen Eindruck“ zu hinterlassen. Menschliches Zusammenleben wird durch Normen geregelt. Die Einhaltung solcher Verhaltenserwartungen wird durch positive/negative Sanktionen belohnt oder bestraft. Normen schränken zwar das individuelle Verhalten ein, machen es aber auch vorhersagbarer. Was eigentlich ist „normal“? Im November 2007 wurde ein Schotte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er in einem Hotelzimmer Sex mit seinem Fahrrad hatte. Hinsichtlich der Einschätzung, ob ein solches Verhalten als „gesund“ oder „krank“ eingestuft wird, spielen Normen der Gesellschaft eine Rolle. Man unterscheidet: Statistische Norm: rechnerischer Durchschnitt, Mittelwert der Bevölkerung plus-minus eine Standardabweichung (keine Panik: was eine Standardabweichung ist, wird später erklärt). Als „normal“ gilt demnach alles das, was in der Bevölkerung am häufigsten vorkommt. Wie häufig z. B. Sex mit Fahrrädern ist, stellt leider eine völlig unbekannte Größe dar. Therapeutische Norm: Hoher Blutdruck ist im Alter häufig, d. h. statistisch gesehen „normal“. Man definiert daher als Behandlungsziel einen therapeutisch wünschenswerten Normalzustand. Funktionsnorm/funktionale Norm: Hier ist das Normkriterium eine Funktion, z. B. laufen, heben, sprechen, lieben können. Eine Krankheit ist unbedeutend, wenn keine Beeinträchtigung spürbar ist. Idealnorm: Wertbegriff zur Orientierung, höchstes erreichbares Ziel für ein Individuum; z. B. Idealgewicht. Rollennorm: Mit jeder sozialen Rolle (Tochter, Freundin, Studentin, Prüfling usw.) sind Rollenanforderungen verbunden, die beschreiben wie sich der Träger zu verhalten hat. Hinsichtlich der jeweiligen Rollennorm kann man sich konform (angepasst) oder nonkonform (unangemessen, widerspenstig) verhalten. Wie wäre es, wenn Sie in der mündlichen Prüfung mal ihrem Professor ein paar Fragen stellen, um abzuchecken, was der au- aus: 1. ÄP, Medizinische Psychologie und Soziologie (ISBN 9783131149275) © 2011 Georg Thieme Verlag KG ßerhalb seines Fachgebietes sonst noch von Medizin versteht? Soziale Normen sind gruppenspezifische Verhaltensanweisungen, d. h. konkrete Vorschriften über Handlungen in sozialen Situationen. Der „fleißige Deutsche“ war früher einmal eine soziale Rolle mit entsprechenden Normen, nach der wir unser Selbstbild und das Fremdbild von anderen eingeschätzt haben. Viele psychische Krankheiten (z. B. Schizophrenie, Oligophrenie, Manie, Soziopathie) äußern sich darin, dass die Betreffenden übliche soziale Normen nicht einhalten können. Bezugsnorm: Normen und Werte der Bezugsgruppe (z. B. Ärzteschaft), mit der eine Person sich identifiziert. Klinischer Bezug Bei der Vorstellung eines Patienten muss auch der Arzt in der Lage sein zu entscheiden, ob nicht nur dessen Blutwerte, sondern auch das Verhalten des Patienten als „normal“ zu beurteilen ist. F07 Ú Frage 1.13: Lösung C Zu (A): Diagnostische Norm: Medizinische wie auch psychologische Diagnoseverfahren sind normiert, d. h. es gibt Qualitätsvorschriften, denen eine Untersuchungsmethode genügen muss. Diagnostisches Handeln wird dann an dieser Norm gemessen. Bei fehlerhaften Therapieerfolgen kann ggf. sogar gerichtlich geprüft werden, in welchem Ausmaß die Diagnose einer Erkrankung solchen Qualitätsmerkmalen entsprach. Zu (B): Funktionale Norm/Funktionsnorm: siehe Lerntext I.6. Zu (C): Idealnorm: siehe Lerntext I.6. Zu (D): Statistische Norm: siehe Lerntext I.6. Zu (E): Therapeutische Norm: siehe Lerntext I.6. F01 Ú Frage 1.14: Lösung D Zu (A): Statistische Norm: siehe Lerntext I.6. Funktionsnorm: siehe Lerntext I.6. Zu (B): Individuelle Gesundheitsüberzeugung: Es hängt von den individuellen Einstellungen einer Person ab, als was sie Gesundheit und Krankheit definiert und ab wann sie sich krank fühlt. Der eine geht mit einem dicken Schnupfen problemlos zur Arbeit, der andere meint, das sei ausreichend, um sich 14 Tage krankschreiben zu lassen. Zu (C): Idealnorm: siehe Lerntext I.6. Zu (D): Idealnorm: Eine Idealnorm wäre auch der Besuch von Vorsorgeuntersuchungen, denn wir alle wissen, wie wichtig das insbesondere bei Tumorerkrankungen im Ernstfall gewesen wäre. Statistische Norm: Durchschnittsnorm; das Verhalten, welches im statistischen Sinne die meisten Menschen zeigen. Die meisten Personen gehen nicht zu Vorsorgeuntersuchungen. Es liegt also eine Diskrepanz zwischen Ideal- und statistischer Norm vor. Zu (E): Individuelle Gesundheitsüberzeugung: Es hängt von den individuellen Einstellungen einer Person ab, als was sie Gesundheit und Krankheit definiert und ab wann sie sich krank fühlt. Schichtspezifisches Gesundheitsverhalten: Unterschiede im Gesundheits- und Krankheitsverhalten der Angehörigen verschiedener sozialer Schichten gibt es in folgenden Bereichen: Untere Schichten sollen höhere Symptomtoleranz zeigen und entsprechend seltener den Arzt konsultieren. Krebsund Schwangerenvorsorgeuntersuchungen werden von sozial schwächeren Schichten weniger genutzt. Auch gebe es in den unteren Schichten mehr Zigarettenraucher. Der sprachliche Umgang mit dem Arzt fällt Angehörigen höherer Schichten leichter als denen unterer Schichten. Der Informationsstand in medizinischen Dingen ist in unteren Schichten geringer. Eine Diskrepanz zwischen individueller Gesundheitsüberzeugung („Ich fühle mich doch gesund, also warum sollte ich zur Vorsorgeuntersuchung gehen?“) liegt gerade bei unteren Sozialschichten nicht vor. F08 Ú Frage 1.15: Lösung C Zu (A): Eine Reduzierung von Beeinträchtigung des Patienten im Alltag ist zumindest bei Blutdruck ein schwieriges Kapitel. Menschen, die jahrelang zu hohen Blutdruck hatten, fühlen sich nach Einstellung mit blutdrucksenkenden Medikamenten oft schlapp, müde und nicht leistungsfähig. β-Blocker können darüber hinaus zur Impotenz führen. Zu (B): Psychisches Wohlbefinden gehört zur WHODefinition von Gesundheit, stellt aber keine Norm dar. Zu (C): Risikosenkung von Folgekrankheiten stellt die therapeutische Norm dar, die medizinisch definiert ist. Zu (D): Statistische Norm: siehe Lerntext I.6. Zu (E): Nach Ansicht der WHO (Weltgesundheitsorganisation) ist Gesundheit „der Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefindens“. I.7 Abweichendes Verhalten Letztlich müssen wir alle gut funktionieren, damit diese Gesellschaftsform stabil bleibt. Ohne hohe Spezialisierung und den regen Austausch von kleinen bedruckten Papierscheinchen, müsste jeder einzelne seine Kartoffeln wieder selbst im Garten anbauen. Zu viele unproduktive Mitglieder aus: 1. ÄP, Medizinische Psychologie und Soziologie (ISBN 9783131149275) © 2011 Georg Thieme Verlag KG 101 Kommentare 1.1 Bezugssysteme von Gesundheit und Krankheit