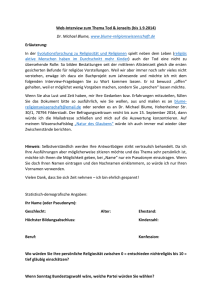Jedem der Seine
Werbung

3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 Jedem der Seine? Kritische Anmerkungen zu Ulrich Becks „Eigenem Gott“ Dietrich Schotte, Marburg 1. Einleitung Der Titel „Kulturkritik der Religion“ ist offensichtlich mehrdeutig. Versteht man ihn als genitivus subiectivus, dann meint er eine Kulturkritik aus der Perspektive der Religion. In unserem Fall wäre die Kritik der säkularisierten Moderne als Diktatur der Beliebigkeit, als schleichende Entsolidarisierung der Gesellschaft, o.ä. sicherlich ein gutes Beispiel, der Extremfall dieser Kritik wäre der Fundamentalismus. Oder man liest den Titel als genitivus obiectivus, so dass er etwa Kulturkritik als Religionskritik meint; ein Beispiel wäre eine Kulturkritik, die auf der Grundlage säkularer Prinzipien die Probleme der Moderne, etwa in Integrationsfragen, auf ‚Restbestände der Vormoderne’ in Form religiöser Ideen und Weltanschaaungen zurückführt. Im Extremfall gelangt man zum so genannten „Neuen Atheismus“. Beide Beispiele zeigen, dass es zumindest im Falle unserer modernen Kultur naheliegt, von einem Spannungsverhältnis zwischen dieser Kultur und der Religion auszugehen und es wird dem Unbeteiligten nahegelegt, sich für eine der beiden Seiten zu entscheiden. Unbestritten werden diese Positionen von nicht wenigen vertreten, zumeist sogar sehr aggressiv. Ebenso unbestritten existieren im Kontrast zu ihnen aber Vorschläge, Ansätze und Plädoyers, die nicht nur eine Vermittlung zwischen Religion und Moderne als möglich behaupten, sondern sogar von einem Verhältnis wechselseitiger Ergänzung ausgehen. [event. Verweis Ref Vortag] Eine solche Alternative zum Lagerdenken ist auch Ulrich Becks Konzeption des „Eigenen Gottes“, die ich hier kurz referieren und kritisieren will. Sie ist nicht 1 3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 nur von Interesse, weil sie aus einer soziologisch-agnostischen Theorie der Moderne heraus entworfen wird (obwohl sie dies prima facie vor dem Verdacht der Apologetik in Schutz nimmt); sondern sie zeigt meines Erachtens mustergültig eine bestimmte Art, Religion zu denken, indem die Unterscheidung von individuell-subjektivem Glauben und allgemein-objektivem Ritus, also von Religiosität und Religion, so gedeutet wird, dass beide unabhängig voneinander sind. Ich will in der Auseinandersetzung mit Becks Entwurf zeigen, dass eine solche Unterscheidung weder dem Phänomen Religion gerecht wird noch eine Grundlage für die Vermittlung von Religion und Moderne darstellt. 2. Religiosität ohne Religion: Der „eigene Gott“ Beck gewinnt seine Konzeption wesentlich in Auseinandersetzung mit dem Phänomen des Fundamentalismus und vor dem Hintergrund seiner Individualisierungsthese. Letztere besagt, dass die Moderne sich dadurch auszeichnet, dass soziale Bindungen jeglicher Art (von der Familie bis zum Staat) ihre Bedeutung verlieren und die Menschen sich nicht mehr an ihnen orientieren, sondern sich statt dessen mehr und mehr auf die Durchsetzung ihrer eigenen Interessen konzentrieren. Sofern soziale Bindungen und Institutionen überhaupt noch existieren und Bedeutung haben, erhalten sie diese dadurch, dass sie den sie unterstützenden Individuen helfen, ihre partikularen Interessen durchzusetzen. Es ist nun durchaus plausibel, wenn Beck den Fundamentalismus als Reaktion auf diese Entwicklung rekonstruiert und feststellt, dass er seine Aggressivität in erster Linie der Wahrnehmung dieser Moderne als existentieller Bedrohung der Religion verdankt. Denn ‚Religion’ meint Beck zufolge ‚Glaubensgemeinschaft’, d.h. eine soziale Praxis, die durch Institutionen wie klerikale Strukturen, Dogmen, Kodizes, Riten und allgemein verbindliche 2 3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 Symbole strukturiert und vor allem integriert ist. Sie ist also selbst eine Form sozialer Bindung und setzt diese wesentlich voraus. Mehr noch: Indem sie, etwa im Falle der Monotheismen, davon ausgeht, dass es nur einen Gott gibt und dass dieser unmissverständliche Vorgaben für das Leben der Menschen gemacht hat, beansprucht sie absolute Geltung für ihre Institutionen. Der Fundamentalismus definiert Religiosität demzufolge über die Zugehörigkeit zu einer solchen Glaubensgemeinschaft und damit ist die Moderne, die jegliche Art von Bindungen an Gemeinschaften im Kern angreift und sogar dem individuellen Nutzenkalkül unterstellt, aus seiner Sicht das Grundübel. Denn infolge der Modernisierung bilden sich alle Arten von Synkretismen und Häresien im Wortsinne, also Privatmeinungen in Religionsdingen, welche die Einheit und Einheitlichkeit der Glaubensgemeinschaft Schritt für Schritt auflösen. Daher die vorhin angeführte Opposition zwischen Moderne und Religion: Entweder Individuum oder Teil eines großen Ganzen, entweder Moderne oder Religion. Der Fundamentalismus macht nach Beck genau denselben Fehler wie der sogenannte Neue Atheismus, wenn er Religiosität an die Zugehörigkeit zu einer Religion im Sinne einer Glaubensgemeinschaft bindet. Hiergegen macht Beck geltend, dass man zwar derart von Religion „als Substantiv“ sprechen könne, dass man aber darüber nicht vergessen dürfe, dass es auch eine sinnvolle Redeweise von Religion „als Adjektiv“ gebe – nämlich im Sinne von „religiös“. Dies bezeichnet nun Beck zufolge nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, sondern lediglich eine bestimmte, existentiell bedeutsame Perspektive auf die Welt und den Menschen sub specie divinitatis. Entscheidend ist der Glaube an die Existenz einer Sphäre der Transzendenz, die von der Sphäre der Immanenz, unserer Welt, unterschieden wird und diese bedingt. Ob es sich dabei um das Nirwana, den Olymp oder um die heilige Dreifaltigkeit handelt, ist 3 3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 ebenso belanglos wie die Frage, ob der Gläubige regelmäßig an den Riten einer Gemeinschaft teilnimmt, die sich für eine dieser Alternativen entschieden hat. Konzentriert man sich also auf die Religion „als Adjektiv“, so wird eine Form religiösen Lebens möglich, die Beck als „Religion des eigenen Gottes“ bezeichnet. Denn die Welt sub specie divinitatis zu betrachten bedeutet dann lediglich, irgendeine Form von Beziehung zur Transzendenz zu entwickeln und zu praktizieren. Dass man diese Religiosität dann analog zum Kleidungsstil oder zur politischen Meinung den individuellen Bedürfnissen anpasst, ist aus Becks Perspektive kein zu kritisierender Fall von ‚Baukastenspiritualität’, sondern schlicht die adäquat moderne Form religiösen Lebens. Sie hat ihm zufolge vor allem einen Vorteil: Sie ist individualistisch und damit non- oder sogar antiklerikal, weil sie jede Art institutioneller Bervormundung in Religionsdingen ablehnt und ablehnen muss; und dadurch ist sie nach Beck auch weder missionarisch noch intolerant, weil Religion als Religiosität notwendig Privatsache im Sinne der individuellen Angelegenheit ist. 3. Die Bedeutung der Religion für die Religiosität Becks Konzeption des „eigenen Gottes“ baut m. E. auf zwei durchaus nicht unproblematischen Thesen auf: Erstens, dass eine Person zwar religiös sein kann, dass aber Religion („als Substantiv“) für die Ausbildung und Formung dieser Religiosität (Religion „als Adjektiv“) keine notwendige Bedingung darstellt. Zweitens nimmt Beck an, dass die Individualisierung der Religion einer Absolutsetzung religiöser Weltbilder und dem damit verbundenen Problem von Intoleranz und Missionierung entgegenwirkt. Beginnen wir mit der ersten These und formulieren sogleich eine Gegenthese: Ohne die Zugehörigkeit zu einer Glaubensgemeinschaft lässt sich Religiosität gar nicht (individuell) entwickeln. 4 3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 Es ist nämlich gar nicht einzusehen, wie ein Mensch einen Blick auf die Welt und sich selbst sub specie divinitatis entwickeln soll, ohne zuvor Teil einer Gemeinschaft gewesen zu sein, die einen solchen Blick expliziert und propagiert. Anders formuliert: Wie soll ich die Möglichkeit in Betracht ziehen können, die Welt sei die Schöpfung Gottes, wenn ich nicht einmal mit Menschen zu tun gehabt habe, die hiervon überzeugt sind und mir diese Sichtweise mitteilen. Denn eine wesentliche Aufgabe religiöser Institutionen ist neben der Explikation der zentralen Glaubensgehalte ihre Kommunikation, sowohl innerhalb der Glaubensgemeinschaft als auch nach außen. Die einzige, von der Religion unabhängige Grundlage für eine solche Religiosität wäre so etwas wie ‚religiöse Erfahrung’. Aber auch religiöse Erfahrungen liefern eine Grundlage für eine individuelle Religiosität nur dann, wenn man Teil einer Glaubensgemeinschaft ist, was zwei Gründe hat: Erstens wird sinnfälligerweise nur innerhalb von Religionen ein Konzept religiöser Erfahrung entwickelt und daher bedarf es wiederum der Teilnahme an einer religiösen Praxis, um Zugang zu dem entsprechenden Vokabular zu erlangen, mit dem man religiöse Erfahrungen sinnvoll thematisieren kann. [Bsp. Kuh, Gott, etc.] Zweitens liefert nur Religion „als Substantiv“ Maßstäbe, um religiöse Erfahrungen von anderen zu unterscheiden, etwa von Halluzinationen, o.ä. Und in beiden Fällen bedarf es der Einübung in die Praxis, weil sonst ein kompetenter Umgang sowohl mit dem Vokabular als auch mit den Maßstäben nicht möglich ist. Und die jeweiligen Institutionen dienen der Vermittlung genau dieser Kompetenz, was die Anleitung durch bereits kompetente Personen, kurz: Autoritäten, voraussetzt. [wie unterscheide ich Schizophrenie und Prophetie?] Das Primat der Praxis gilt im Übrigen auch dann, wenn man die Quelle göttlicher Offenbarung nicht mehr in der Privatoffenbarung, sondern in einer Heiligen Schrift sieht. Es sei denn, man gehe davon aus, dass diese Schrift entweder so eindeutig sei, dass man sie nicht missverstehen könne, oder dass 5 3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 jedem Leser das Verständnis unmittelbar eingegeben werde. Realistisch betrachtet verhält es sich aber doch wohl so, dass man auch bestimmte Kompetenzen gerade im Umgang mit heiligen Texten braucht, wenn man sich ihre Botschaft erschließen möchte. Und das jenseits der Frage, woher man eigentlich wissen soll, dass die Bibel die Heilige Schrift ist und nicht der Koran oder Douglas Adams' The Deeper Meaning of Liff. In jedem Falle ist die Entwicklung einer individuellen Religiosität also von der Teilnahme an einer Religion im Sinne einer religiösen Praxis abhängig. Individuelle Formen religiösen Lebens sind ohne institutionalisierte nicht sinnvoll denk- oder erklärbar. Becks Annahme, dass man auch ohne Religion religiös sein könne, gleicht dem Versuch, schwimmen zu gehen, ohne nass zu werden. 4. Religion ohne Absolutheitsanspruch? Nun könnte man aus Becks Perspektive sicherlich Folgendes erwidern: Es möge ja sein, dass man eine individuelle Religiosität nur als Mitglied einer Glaubensgemeinschaft entwickeln könne, gleichwohl sei diese Mitgliedschaft nur eine Stufe der Entwickelung, an deren Ende eben der „eigene Gott“ stehen müsse. Religiöse Institutionen wären dann so etwas wie Vorschulen oder Geburtshelfer der Religiosität. Man tritt also (idealerweise) nicht so sehr in eine Kirche ein, man geht vielmehr durch sie hindurch. So ließe sich zumindest prima facie die zweite These halten, dass im Grunde nichts für den Absolutheitsanspruch der Religionen spricht und damit der „eigene Gott“ eben nicht der „eine“ sei. Der Gott der jeweiligen Glaubensgemeinschaft ist dann so eine Art Schneiderpuppe, an der man für den „eigenen“ Gott Maß nehmen kann. 6 3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 Nach Beck finden sich Fälle der Individualisierung bereits zahlreich in der Moderne und sie gelingen immer dann, wenn Einzelne 'ihren' Glauben jenseits von oder sogar in deutlicher Abgrenzung zu religiösen Institutionen entwickeln. Ein Beispiel ist die bereits zuvor erwähnt 'Baukastenspiritualität', die sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass eine Person sich verschiedener Religionen bedient und an verschiedenen Kulten teilnimmt. Ein anderes Beispiel findet sich, so Beck, bei denjenigen, die sich zwar weiterhin zu einem der Monotheismen bekennen, dies aber in deutlicher Abgrenzung zur jeweiligen Orthodoxie tun. Aber was sagt diese Individualisierung bezüglich des Absolutheitsanspruches? Man sollte erst einmal zwei Fälle unterscheiden: Den der „liberalen Ironikerin“ und den des Häretikers. Die „liberale Ironikerin“ ist eine Figur Richard Rortys, die durchaus willens und in der Lage ist, eine individuelle Form religiösen Lebens nach dem Muster einer Bauskastenspiritualität zu entwickeln, solange es nur ihrer „Selbstschaffung“ dient. Allerdings handelt es sich hier lediglich darum, religiöse Narrative genauso wie andere, belletristische etwa, zur wunschgemäßen Beschreibung der eigenen Lebenswelt heranzuziehen. Es handelt sich explizit nicht um eine Anerkennung irgend einer Form von Transzendenzbeziehung. Die „liberale Ironikerin“ redet vielleicht gerne in Psalmen, an Gott glauben tut sie nicht; und ist deswegen, denke ich, auch kein ernstzunehmender Entwurf individueller Religiosität (sofern man zugibt, dass Religion ohne eine ernstzunehmende Transzendenzbeziehung nicht auskommt, was im Übrigen auch Beck tut). Also kann es wenn, dann nur um den Häretiker gehen, also denjenigen, der sich eine eigene Meinung über ‚die göttlichen Dinge’ erlaubt, aber dennoch an der Eigenständigkeit und Unabhängigkeit Gottes festhält. In den Worten Becks: „Also wünscht die Liebende nicht, den geliebten, eigenen Gott zu besitzen, wie man eine Sache besitzt; sie sucht nach einem besonderen Typus von Aneignung. Sie will die göttliche Freiheit als Freiheit besitzen.“ Beck spricht an dieser Stelle 7 3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 vom Gegenmodell als Versuch, „den eigenen Gott zum ‚Kuschelgott’ zu erniedrigen“.[Beck 2008, S. 27.] Es ist einsichtig, dass der Monotheismus der Prüfstein einer solchen Theorie ist. Im Falle polytheistischer Religionen scheint die Entscheidung für einen Gott und gegen andere, etwa als Schutzpatron, sowieso nahezu unumgänglich.[trotzdem: Gesamtmodell muss akzeptiert werden; siehe 'Mithras' bzw. Sokrates] Aber im Monotheismus steht die Sache bekanntlich anders und Beck ist sicherlich zuzustimmen, dass religiöse antimoderne Kritik in erster Linie aus monotheistischen Religion erwächst. Also: Ist ein individualistischer Christ, Jude oder Moslem notwendigerweise nicht intolerant und missionarisch? Wohl kaum. Selbst wenn man ‚seinen Gott’ jenseits der offiziellen Institutionen sucht und findet und anbetet, so bleibt dennoch der Anspruch, dass er der alleinige Gott sein muss. Gerade die Gottesbilder von Intellektuellen, Theologen und Philosophen, die ja nicht selten denkbar weit von der Orthodoxie entfernt und durchaus individuell sind, erheben in der Regel den Anspruch, die einzig 'denkbare' Alternative zu sein. Solange sich hinter der Religiosität eine existentielle und praktisch eingeholte Bedeutung verbirgt (und nicht eine intellektuelle Feierabendübung), solange wird dieser Anspruch bestehen bleiben. Wiederum gilt: Wenn es eine Sphäre der Transzendenz gibt, so ist sie auf eine bestimmte Weise beschaffen und wenn diese Beschaffenheit unsere Existenz als Menschen in dieser Welt bestimmt – dann ist nicht recht ersichtlich, wie man gleichzeitig annehmen könnte, dass es ja auch 'ganz anders' sein könnte, weil ja andere ganz anders damit umgehen. Die wechselseitige Akzeptanz individueller Sinnstiftung gelingt nur unter der Prämisse, dass sie autonom und nicht unter Rückgriff auf eine vorgegebene und daher anzuerkennende Instanz geschieht. Letzteres ist aber der Kern der Religion, nicht nur der monotheistischen. 8 3. Berliner Kolloquium Junge Religionsphilosophie, 10. bis 12. September 2009 5. Religion, Moderne und die „Kulturkritik der Religion“ Das alles bedeutet freilich nicht, dass sofort mit dem Schwert missioniert werden muss. Es legt aber nahe, dass Religionen immer in jeder Kultur, die nicht durch eine Religion dominiert wird, ein „Stachel“ sein werden. Womit freilich nicht gesagt ist, dass aus der Perspektive der Religion nicht richtige und notwendige Kritik an der jeweiligen Kultur formuliert werden kann. [obwohl dann zu schauen wäre, ob nur die Religion in der Lage ist, diese Kritik zu formulieren, oder ob sie nicht auch aus der jeweiligen Kultur selbst entwickelt werden kann] Aber das Entweder-Oder bleibt bestehen ebenso wie die Notwendigkeit kollektiver Formen religiösen Lebens und beides folgt aus der für jede Religion konstitutiven Unterscheidung von Transzendenz und Immanenz. Anders gesagt: Solange wir glauben, dass es etwas Göttliches ‚jenseits’ der Welt gibt, kommen wir um ernsthafte Diskussionen über die Beschaffenheit desselben und die sich daraus ergebenden Folgerungen für unser Leben nicht herum. Und auch nicht um die hieraus entstehenden Glaubensgemeinschaften und Institutionen, samt deren politischer Eigendynamik und den sich daraus ergebenden Konflikten. Das Konzept des „eigenen Gottes“ und ihm artverwandte Entwürfe religiösen Lebens erscheinen demgegenüber als eine Art Intellektuellenreligion, die offensiv gegen dasjenige polemisieren, was sie immer schon voraussetzen: Die Religion, „als Substantiv“. Und – Hand auf's Herz – wenn der „eigene Gott“ so oder so auf unsere Bedürfnisse zurechtgestutzt wird oder werden soll – sollte man sich nicht vielleicht überlegen, lieber ganz auf ihn zu verzichten und vom „Jedem der seine“ lieber zum „as you like it“ überzugehen!?! 9