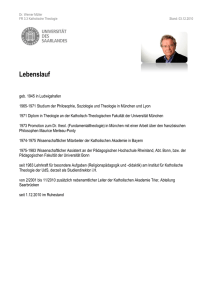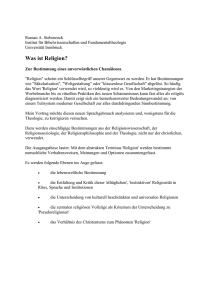Der »entschränkte« Dialog
Werbung

Der »entschränkte« Dialog Reflexionen zum Dialog zwischen Juden – Christen – Muslimen Peter Hünermann Seit den Anfängen des Christentums gibt es einen Dialog mit dem Judentum. Er spiegelt sich deutlich im Neuen Testament und in der Patristik. Seit dem Auftreten des Islam weitet sich dieses Gespräch aus und wird zum Streitgespräch zwischen Christen, Muslimen und Juden. Ein frühes repräsentatives Beispiel bildet die »Quelle der Erkenntnis« des Johannes von Damaskus mit Ausführungen über das Judentum und den Islam sowie einer Darlegung der christlichen Lehre. Der Dialog der Monotheismen ist keine Neuerung unserer Zeit. Er begleitet die Geschichte der drei Monotheismen. Insofern richten sich die hier vorgelegten Reflexionen dezidiert gegen die These von Jan Assmann in seinem Werk: »Moses the Egyptian. The memory of Egypt in Western Monotheism«.1 Allerdings durchläuft dieser Dialog der Monotheismen unterschiedliche Ausformungen. Überblickt man die zahlreichen Schriften des Mittelalters, der beginnenden Neuzeit bis zur Schwelle der Moderne und die Neuerungen des interreligiösen Dialogs im 19./20. Jahrhundert, so zeichnen sich deutlich unterschiedliche Typen des Dialogs ab. I. Ein erster Typus des Dialogs: Die andere Religion als Häresie Johannes von Damaskus gibt in seiner »Quelle der Erkenntnis« keine Gesamtdarstellung des Islam bzw. des Judentums. Er reiht seine Ausführungen über diese beiden Religionen vielmehr in sein großes Kapitel über die Häresien ein. Sein Interesse ist es, die Irrtümer bzw. die von der christlichen Lehre abweichenden Punkte herauszuheben. Seine hermeneutische Leitfrage lautet: Wo gibt es Widersprüche zur christlichen 1 Harvard University Press, Cambridge/Massachusetts 1997, deutsche Ausgabe: München – Wien 1998. Assmann setzt gegen die »mosaische Unterscheidung«, die die vera religio von anderen Religionen abgrenzt und unfähig zum Dialog macht, sein Lob des Polytheismus. Er ist nicht der einzige Denker mit seinem Lobpreis auf den Polytheismus als Frieden stiftende Religion. Eine gewisse Vorreiterrolle kommt Odo Marquardt zu: Vgl. Odo Marquardt, Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1986; ders., Apologie des Zufälligen, Stuttgart 1986; ders., Individuum und Gewaltenteilung, Stuttgart 2004; zusammenfassend: Alois Halbmayr, Lob der Vielheit. Zur Kritik Odo Marquardts am Monotheismus (Salzburger Theologische Studien 13), Salzburg 2000. 246 Peter Hünermann Lehre? Die jeweiligen gegnerischen Positionen werden oft mit einem gewissen Sarkasmus zurückgewiesen, öfter auch ironisiert.2 Es ist auffällig, dass die mittelalterlichen Schriften der lateinischen Christenheit, die sich auf den Islam beziehen, im Grunde vom gleichen Typus sind. Petrus Venerabilis, Abt von Cluny, der im lateinischen Westen für die Übersetzung des Korans sorgt, engagiert sich für eine Bekehrung der Muslime »non vi sed ratione« und entwirft so eine Alternative zur Kreuzzugspolitik seiner Zeit. In seiner Schrift »Contra sectam saracenorum« reiht Petrus – ähnlich wie Johannes von Damaskus – die »gottlose Irrlehre des ruchlosen Mohammad« unter die Häresien ein. Der Ton in der Argumentation des Petrus wird bereits mit diesen ersten Sätzen seines Schreibens vorgegeben. Petrus benutzt die ganze Palette der rhetorischen Möglichkeiten, die gegen Häretiker und Schismatiker im Gebrauch waren, mit der Einschränkung allerdings, dass er die Muslime mit Vernunftgründen zu gewinnen sucht und deswegen auf jede persönliche Beleidigung oder ähnliches verzichtet. Der Aufbau der Argumentation in den überlieferten beiden Büchern ist streng logisch: In einem ersten Teil sucht Petrus die Muslime zum ernsthaften Erwägen seiner Argumente zu bewegen und aufzuweisen, dass sie als vernünftige Wesen, als Menschen, denen es um die Hingabe an Gott zu tun ist, zum Dialog verpflichtet sind. Daran anschließend setzt sich der Abt von Cluny mit einer reichen Anzahl auch historischer Argumente gegen die Unterstellung zur Wehr, die Juden bzw. die Christen hätten ihre Schriften verfälscht. Petrus sucht aufzuweisen, dass die Muslime die Bibel genauso wie den Koran anzunehmen haben. An diese beiden Argumentationsgänge im ersten Band schließen sich die Argumente gegen die Anerkennung Mohammeds als Propheten an. Dabei geht Petrus von einer Definition des Propheten aus, wie sie von Gregor dem Großen formuliert worden ist: »Prophetie ist die Mitteilung bekannter Dinge aus Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, die nicht durch menschliche Erfindung, sondern durch göttliche Eingebung erfolgt«. Entsprechend dieser Definition weist Petrus Venerabilis dann auf, dass in Bibel und Neuem Testament in dieser Weise prophezeit worden ist, Mohammed sich hingegen nach dem Koran keine »Mitteilungen unbekannter Dinge aus Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft« zugeschrieben hat.3 Hier wird zunächst der eigene Maßstab aufgestellt, dann wird der Gegner daran gemessen. Das Resultat ist vorgegeben. Wie sieht die Argumentation auf der islamischen Seite aus? Eine sehr umfangreiche und ausgefeilte islamische Stellungnahme zur christlichen Lehre stammt von AbĨ IsÁ Mohammad B. HÁrun Al-WarrÁq aus dem 9. Jahrhundert. David Thomas hat seine 2 Vgl. Raymond Le Coz, in: Jean Damascène, Écrits sur l’Islam, présentation commentaire et traduction par Raymond Le Coz (Sources Chrétiennes 383), Paris 1992, 13: »C’est une œuvre polémique, écrite pour dénoncer et condamner comme il n’existe tant dans la littérature chrétienne«. Vgl. ferner zu diesem Typus der Argumentation im Orient: Adel-Theodore Khoury, Les théologiens byzantins et l’Islam. Textes et auteurs (8ème– 13ème s.), Louvain 1969; ders., Polémique byzantine contre l’Islam (8ème–13ème s.), Leyden 1972; ders., Apologétique byzantine contre l’Islam (8ème–13ème s.), Altenberge 1982. 3 Vgl. zu Petrus Venerabilis: Petrus Venerabilis, Schriften zum Islam, ediert, ins Deutsche übersetzt und kommentiert von Reinhold Glei (Corpus islamo-christianum), Series latina 1, Altenberge 1985. Der »entschränkte« Dialog 247 Schrift »Radd’alÁ al Thalas Firac Min Al-NasÁrÁ« analysiert.4 Bei allen Differenzen gibt es strukturelle Ähnlichkeiten mit den christlichen polemischen Texten. Auch in den islamischen Texten werden christliche Lehrpunkte herausgegriffen und durch Begriffsanalysen widerlegt bzw. ad absurdum geführt; dabei ist – ebenso wie bei den christlichen Autoren – eine Reihe von grundlegenden Voraussetzungen gemacht, die nicht hinterfragt bzw. erläutert werden und welche das Fundament für die Argumentationen abgeben. Obwohl IsÁ Al Waraq detaillierte Kenntnisse der verschiedenen Auffassungen von der Trinitätslehre hat und sich in den verschiedenen christlichen Schulen der Christologie auskennt, verändert dies nicht die Grundstruktur seiner Argumentation. David Thomas fasst seine Analyse der Argumentationen wie folgt zusammen: »Wir sehen an diesen Beispielen, die aus der frühesten Periode der muslimische Zurückweisungen des Christentums überliefert sind, dass die Polemiker viel eher Lehren angriffen, indem sie deren fundamentale Gültigkeit in Frage stellten, als dass sie sie in jener Form vortrugen, in der sie ursprünglich ausgesprochen und in der sie zu zentralen Diskussionspunkten in den christlichen Schulstreitigkeiten geworden waren. Unter solchen Umständen ist es verständlich, wenn Christen den Eindruck hatten, ihre Lehren würden nicht mit voller Seriosität behandelt, und dass Muslime ihrerseits denken mochten, ihre Argumente würden von den Christen nicht ernsthaft aufgenommen. Beide Seiten sprachen nicht wirklich miteinander. Es ist traurig, aber es wird schwierig, eine spätere Zeit zu finden, in der sich diese Situation der Kommunikation substantiell verändert hätte«.5 Schaut man auf die Dialoge zwischen Juden und Christen im lateinischen Westen, so ergibt sich im Prinzip vom Hochmittelalter ab ein ähnliches Bild. Während in der Spätantike und im frühen Mittelalter ein langer Zeitraum begegnet, in der – nach der Lehre des Augustinus – Juden zu dulden, wenngleich von gesellschaftlich bedeutsameren Stellungen fern zu halten sind6, so wendet sich das Blatt mit dem ersten Kreuzzug. Ausgehend von Übergriffen des Kreuzfahrerheeres 1096, angeheizt durch die Erzählung über Ritualmorde, zunächst in England, werden die bis dahin geltenden kaiserlichen und königlichen Schutzrechte durchbrochen. Pogrome und Ausweisungen von Juden häufen sich europaweit bis zur spanischen Reconquista. Die drei großen »Dialoge« zwischen Christen und Juden in Paris, Barcelona und Tortosa wie die zahlreichen kleineren Streitgespräche spiegeln diese Situation insofern, als den Juden – abgesehen von wenigen Ausnahmen – eine strikt reglementierte Rolle zudiktiert wird. Sie dürfen Fragen stellen, Stichworte geben, aber nicht frei diskutieren. 4 Vgl. David Thomas, Anti-christian polemique in early Islam, AbĨ IsÁ Al Waraq’s »Against Trinity«, Cambridge 1992; ders., Early muslim polemique against christianity, AbĨ IsÁ Al Waraq’s »Against the Incarnation«, Cambridge 2002. 5 David Thomas, Christian Theologians and New Questions, in: Emmanouela Grypeou – Mark Swanson – David Thomas, The Encounter of Eastern Christianity with Early Islam, Leiden – Boston 2006, 276. 6 Vgl. u. a. Augustinus, Civitas Dei 4, 34; 18, 43; Expositio in psalmos 58, 21. – Eine Ausnahme bildet die versuchte Zwangsbekehrung von Juden im westgotischen Spanien im 7. Jahrhundert. 248 Peter Hünermann So heißt der relativ kurze Text des Petrus Damiani bezeichnenderweise: »Dialogus inter judaeum requirentem et christianum respondentem«7. Bereits am Anfang steht das Ergebnis fest: »Wenn dir in jeder Hinsicht Genüge getan ist, dann bist du entweder gezwungen, als Besiegter die Hände zu reichen, oder du wirst mit schändlicher Ungläubigkeit verwirrt zurückweichen«8. Eine Ausnahme bildet Rupert von Deutz. In seinem Dialog9 erklärt er, dass er abwarten und tolerieren will, wenn sein Gesprächspartner die Einladung zum himmlischen Gastmahl, die er ihm ausrichtet, ablehnt. Rupert würde dann warten, bis Gott selbst sein Gegenüber zu diesem Gastmahl auffordert.10 Auch wenn in den späteren Dialogen des Mittelalters, etwa bei Abaelard oder Ramón Llull, die philosophische Basis des Dialogs mit Muslimen und Juden verbreitert wird und so mehr Möglichkeiten des Verstehens bietet, so gilt doch, dass der christlichen Argumentation – parallel im islamischen Bereich – im theologischen und juristischen Bereich eine unbedingte Triftigkeit und Einsehbarkeit zugeschrieben wird. Daraus wird in Bezug auf die Juden gefolgert, dass der Talmud mutwillige Missinterpretationen der Bibel enthält und folglich als häretisches Buch zu betrachten ist. Die Folge ist eine öffentliche Verbrennung aller bekannten Talmud-Exemplare unter Ludwig IX. in Paris. Die römischen Behörden der Inquisition erlauben einen moderat zensierten Talmud für den jüdischen Gebrauch.11 Es wäre zu kurz gegriffen, wenn in diesen Vorgängen lediglich der Machtanspruch und die Machtausübung der Mehrheitsreligion gesehen würden. Der Machtanspruch und die Machtausübung existieren zweifellos. Aber ist es lediglich die reine Dominanz, die sich in solchen Ereignissen ausspricht? Die Zensur des Talmud wird theologisch und rechtlich begründet. Voraussetzung der Zensurierung von Texten ist es, dass in einer rational nicht nachvollziehbaren Weise argumentiert wird. Was für eine theologische Rationalität wird hier vorausgesetzt – und zwar sowohl in den Diskussionen mit dem Judentum wie mit dem Islam? Überblickt man die christliche Theologie im Osten wie im Westen vom Ende der Patristik bis zum 12./13. Jahrhundert, so weist diese Theologie eine ganz eigentümliche Struktur auf. Diese Struktur wird bei Johannes von Damaskus deutlich greifbar. Er steht am Ende der Patristik im Osten. In dieser Zeit ruht die Theologie ganz stark auf Florilegien auf. Man stellt Zitate der Väter, der Konzilien zusammen, fragt nach ihrer Verständlichkeit und Vereinbarkeit. Die Argumentation aus der Schrift tritt fast ganz hinter der Vätertradition zurück. Johannes erklärt12: »Wo steht nämlich im Alten Testament oder im Evangelium ausdrücklich der Begriff ›Dreieinigkeit‹ oder ›wesensgleich‹ 7 PL 145, 57–68. – »Dialog zwischen dem fragenden Juden und dem antwortenden Christen«. 8 »…Cum tibi fuerit ex omnibus satisfactum, aut compellaris manus dare convictus, aut cum ignominiosa tua recedas infedilitate confusus«, ebd. 57. 9 PL 170, 559–610. 10 Vgl. a.a.O. 610. 11 Vgl. Jeremy Cohen, The friars and the jews: The evolution of medieval anti-judaism, Ithaka – London 1982, 60–85. 12 Vgl. seine Schrift: »Orationes adversus iconoclastas«, 3, 11; PG 94, 1333. Der »entschränkte« Dialog 249 oder ›eine Natur und drei Hypostasen‹ in der Gottheit oder ›eine Hypostase und zwei Naturen‹ in Christus? Weil jedoch die Väter solche Begriffe aus den gleichwertigen Begriffen der Schrift bestimmten, nehmen wir sie an und verurteilen alle, die sich dem widersetzen.« Es ist kennzeichnend, dass man den ursprünglichen Zusammenhang der zitierten Texte oft nicht kennt, immer wieder die gleichen Stellen anführt und sehr stark mit Begriffsanalysen arbeitet. Die Grundlage bilden die aristotelischen Kategorien, die arbor porphyriana. Das Interesse richtet sich auf Auflösung von Schwierigkeiten, Klärung von Begriffen und Zurückweisung von Häresien. Charles Moeller bemerkt dazu: »Die Häresien sind hier ›rekonstruiert‹, ›rekonstituiert‹; ihr realer Inhalt in der Geschichte der Theologie wird völlig vergessen; dies umso mehr, als sehr schnell die Texte der Väter, die man zitiert – wenn man denn zitiert – immer dieselben sind«.13 Zweifellos besaß Johannes von Damaskus, der dieser theologischen Arbeitsmethode folgte, seine Qualitäten. Er ist einer der wenigen, der auf die Echtheit der Väterzitate achtet. Er hat ein besonderes Geschick für »klar umrissene Formeln« und die Gabe, »die christliche Lehre zusammenzufassen«14. Er steht damit den lateinischen Theologen des 12. Jahrhunderts sehr nahe, die sich ebenso bemühen, gestützt auf Florilegien, die Sentenzen der Väter in Übereinstimmung und in einen gewissen systemischen Zusammenhang zu bringen. Es dürfte kein Zufall sein, dass der dritte Teil der »Quelle der Erkenntnis« mit dem Titel »Der orthodoxe Glaube« bereits um 1150 übersetzt wird, bevor noch das mittelalterliche Schulbuch des Petrus Lombardus, die vier Bücher über die Sentenzen, erscheint. Interessanterweise hat dieses Werk des Johannes von Damaskus eine ähnliche Einteilung, wie sie die vier Bücher des Petrus Lombardus aufweisen. So wird dieses Werk im lateinischen Westen häufiger die »Sententiae Damasceni« genannt. Was tragen diese historischen Anmerkungen zur theologischen Methode der ausgehenden Patristik und des anhebenden Mittelalters für die uns hier beschäftigende Frage nach dem Charakter der theologischen Wahrheit bei? Die Gestalt der Theologie, welche hier zutage tritt, setzt den Glauben voraus, den Glauben an Gott und an die Offenbarung Gottes. Diese Theologie entwickelt aus diesen Glaubenssätzen aber einen intellectus fidei, ein Verständnis des Glaubens, das in sich beansprucht, ein universales, einheitliches Verständnis zu sein, rational durchgeklärt, der geschichtlichen Vielfalt und der kulturellen Pluralität gegenüber völlig überlegen. Diese Theologie beansprucht, Glaube in der Form universaler Lernbarkeit, in der Form der Wissenschaft zu sein. Hochinteressant ist ein zweiter Aspekt. 13 Charles Moeller, Le calcédonisme et le neo-calcédonisme, in: Aloys Grillmeier S. J. – Heinrich Bacht S.J., Das Konzil von Chalkedon Bd. 1, Würzburg 1951, 639. 14 Vgl. Basil Studer, Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus (Studia patristica byzantina 2), Ettal 1964, 128. 250 Peter Hünermann Louis Gardet und George C. Anawati haben begründete Hinweise gegeben, die den Einfluss dieser Gestalt von Theologie, wie sie etwa bei Johannes von Damaskus vorliegt, auf die sich ausbildende muslimische Theologie zeigen.15 Die Begleitumstände der sich ausbildenden islamischen Theologie sprechen sehr für diese Interdependenz. Die islamische Theologie entsteht als Kontroverstheologie in der Auseinandersetzung vor allem mit dem Christentum in intellektuellen Milieus wie Damaskus oder Bagdad. Als Voraussetzung solcher Theologie und um das geeignete Instrumentar zu haben, eignen sich die muslimischen Intellektuellen jene Philosophie an – nämlich vornehmlich Aristoteles in einer gewissen neuplatonischen Auslegung –, über die auch ihre Gegner verfügen. Wie sie teilen sie weitgehend die methodischen Ansätze, arbeiten sehr stark mit Begriffsanalysen und entwerfen Argumentationszusammenhänge, die einen einheitlichen universalen Wahrheitsanspruch ungeschichtlicher Art erheben. Es wäre ein dringendes Forschungsdesiderat, diese Methodologien in den islamischen Werken näher zu untersuchen. Es würde damit noch mehr Licht auf drei wichtige Sachverhalte fallen: Der monologische Charakter der verschiedenen »Dialoge«. – Es wäre zu einfach, diesen monologischen Charakter lediglich auf Borniertheit bzw. Rechthaberei zurückführen zu wollen. Der systemische Charakter der Theologie, der zu dieser Eigentümlichkeit der Dialoge führt, hängt aufs Engste mit dem philosophischen Instrumentarium und der metaphysischen Denkweise zusammen, welche zum Behuf der Theologie rezipiert werden. Eine Sicht der Wirklichkeit, die geprägt ist vom Substanzbegriff und welche die verschiedenen Substanzen als Naturgegebenheiten mit unverrückbaren Formen ansieht, fragt selbstverständlich nach den festen unveränderlichen Definitionen der Dinge. Die »sizilianischen Fragen«16, die am Hofe Friedrichs II. diskutiert wurden, legen ein beredtes Zeugnis davon ab. Dass sich bei der islamischen Rezeption dieses philosophischen Instrumentariums und der metaphysischen Denkweise sowie bei der daran anschließenden Ausbildung einer islamischen »Theologie« eine eigene Sachlogik entwickelt, ist leicht verständlich. Die geschichtlichen Auswirkungen dieser Gestalten von Theologie. – Christlicherseits entsteht mit diesem Typus systemischer Theologie die Dogmatik, welche das 2. Jahrtausend bis zur Moderne hin prägt. »Die Quelle der Erkenntnis« des Johannes von Damaskus wurde in der georgischen, und armenischen Kirche ebenso wie bei den arabischen Christen oder unter den Slaven 15 Vgl. Louis Gardet – M. M. Anawati, Introduction à la théologie musulmane, Paris 1948, vgl. insbesondere 200–207. 16 Vgl. Ibn Sab’in, Die sizilianischen Fragen, übers. und eingeleitet von Anna Akasoy (Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters [Bachmann] Bd. 2), Freiburg 2005. Der »entschränkte« Dialog 251 rezipiert. Es war bis ins 17. Jahrhundert fast das einzige Werk der russischen Theologie. Es war über Jahrhunderte hin die Dogmatik. Die lateinische Theologie wird von diesem Typus theologischen Denkens nicht weniger stark geprägt. Zwar werden die Sentenzen des Petrus Lombardus als Schulbuch in der Barockscholastik durch die Summa Theologiae des Thomas von Aquin abgelöst, der Geist dieser Theologie aber hält sich durch bis in die Neuscholastik hinein. Die Sonderstellung der jüdischen Dialoge. – Hier wird in einer anderen Weise gefragt und argumentiert. Zwar findet auch im Bereich des Judentums eine umfangreiche Rezeption der Philosophie statt. Moses Maimonides steht dafür. Zugleich aber kommen durch die Bindung an Mose, an die Thora, eine Sprachlichkeit, Pluralität, Geschichtlichkeit der Offenbarung ins Spiel, die eine »systemische Wahrheitsgestalt« der Orthodoxie verbieten. Ein herausragendes Beispiel ist Jehuda Halewis »Kusari«.17 Wenn in der »systemischen Theologie« – auf christlicher und islamischer Seite – eine gewisse epochale Grundgestalt ausgemacht wird, soll damit keineswegs die Variationsbreite und Originalität der Theologen des Ostens und Westens negiert oder nivelliert werden. Es sind gleichsam viele kleinere und größere Schritte der Differenzierung, die in der Theologie vollzogen werden. Die ersten Schritte sind bereits im 12. Jahrhundert zu beobachten. Besorgt um die Einheit der Liturgie im Orden der Zisterzienser, wendet sich der zweite Abt von Citaux, Étienne Harding an jüdische Gelehrte, um Korrekturen am Vulgata-Text vorzunehmen und der »discordia nostrorum librorum« entgegenzutreten.18 Ein anderer Ordensbruder, Nicola Maniacutia, kritisiert um dieselbe Zeit in seinem »Libellus de corruptione et correctione psalmorum et aliarum quarundam scripturarum« die Arbeit in den Skriptorien des Ordens, wo oftmals die Maxime angewendet wird, neue Texte seien besser als alte, weil sie umfangreicher sind.19 Eine gewisse Parallele dieser Arbeit findet sich im exegetischen Gespräch der Viktoriner mit Rabbinen, ebenfalls im 12. Jahrhundert. Eine zweite wichtige theologische Differenzierung besteht in der Herausarbeitung des Vorrangs der Schrift vor der Tradition. Abaelard etwa stellt – gerade in der Auseinandersetzung mit den Griechen um das Filioque – die Frage, ob das Evangelium genüge, um den Glauben selbst und vollständig zu fassen. Er fragt, ob es legitime theologische Differenzen gibt, er fragt nach den unterschiedlichen Dignitäten der Bezeu- 17 Vgl. D. C. Cassel, Das Buch Kusari, Berlin 51922. 18 Vgl. Matthieu Cauwe, La bible de Étienne Harding. Principe critique textuel mise en œuvre au livre de Samuel, in: Revue Bénédictine 103 (1993) 414–444. 19 Vgl. Vittorio Peri, »Correctores immo corruptores«. Un saggio di critica testuale nella Roma del XII scolo, in: Italia medievale e umanistica 20 (1977) 19–125, die Ausgabe des Libellus findet sich auf den Seiten 99–125. 252 Peter Hünermann gungsinstanzen des Glaubens. Dabei benützt er die mannigfachen Differenzierungen, die er in seinem Werk »Sic et Non« und in seiner Dialektik ausgearbeitet hat.20 Wichtige weitere Unterscheidungen bahnen sich im Universalienstreit des 12. Jahrhunderts an. Drei Positionen stehen sich gegenüber: die frühe, am platonischen Denken orientierte Position, wie sie bei Anselm bzw. Wilhelm von Champeaux auftritt, die Unversalien bezeichneten Sachverhalte, die den Sachen und Dingen vorausgehen und an denen die Sachen und Dinge Anteil haben. Die zweite Position, vertreten von Roscelinus von Compiègne: die Universalien sind lediglich »flatus vocis«, Namen und weiter nichts. Die dritte Position, die sich in der Folge dann durchsetzt und entfaltet wird, trifft man bei Abaelard an: die Universalien sind Begriffe, conceptus, die ein »fundamentum in re«, ein Fundament in den Dingen, haben.21 Diese grundlegenden Differenzierungen, die für die weitere philosophische und theologische Arbeit von entscheidender Bedeutung sind, kommen in Bezug auf den interreligiösen Dialog allerdings nicht zur Auswirkung. Es sind gleichsam Binnendifferenzierungen des christlichen Denkens, die nicht zu einer Veränderung der Außenbeziehungen führen. Zwar sind die Dialoge eines Ramón Llull Zeugnisse der gesteigerten inneren Komplexität und größeren Weiträumigkeit christlichen Denkens. Aber der Gedanke, dass Anfragen und Argumentationen von anderen Religionen her Grenzen, latente Implikationen ideologischer Art, ganz selbstverständlich akzeptierte Konjekturen im eigenen Lehrgebäude des Glaubens aufdecken könnten, tritt nicht auf. Aber auch hier liegt eine Weichenstellung für eine Differenzierung bereits im Werk des Thomas von Aquin vor. Thomas charakterisiert den Glauben dadurch, dass er das objectum formale des Glaubens in Gott als der ersten Wahrheit sieht. Der Glaubende glaubt Gott, der der Ursprung aller Wahrheit, alles Wahren ist, und er glaubt nur insoweit, als das, was er glaubt, aus Gott hervorgeht und zu ihm zurückführt. Von diesem Formalobjekt des Glaubens unterscheidet Thomas das sogenannte Materialobjekt des Glaubens, alles das, was im Glauben bejaht wird, nämlich die Menschheit Christi, die Kirche, ihre Sakramente, kurz alles, was »in der Heiligen Schrift enthalten ist«.22 In Bezug auf diese vielen Dinge schreibt Thomas ausdrücklich, dass sie vom Glauben nur bejaht werden, insofern sie in der gegebenen Perspektive, dem objectum formale, bejaht werden. Natürlich ist es möglich, dass ein gläubiger Mensch »aus menschlicher Mutmaßung etwas Falsches meint«23, und diese falsche Meinung kann sich selbstverständlich auf Dinge beziehen, die zum objectum materiale des Glaubens gezählt werden. Eine solche Mutmaßung sei aber dann keine Mutmaßung aus dem Glauben, weil der Glaube grundsätzlich durch die gekennzeichnete Perspektive und ein entsprechendes Verhalten bestimmt ist. Thomas zieht nirgends die Konsequenz daraus, dass Konjekturen, die in der breiten 20 Peter Abailard, Sic et non. A critical edition, ed. Blanche B. Boyer – Richard McKeon, Chikago – London 1976; ders., Dialectica, ed. Lambertus M. de Reijk, Assen 1956, ² 1970. 21 Vgl. H. U. Wöhler, Texte zum Universalienstreit, 2 Bde., Berlin 1992–1994. 22 So Summa Theologiae II-II, 1, 1. 23 STh II-II, 1, 3 ad 3. Der »entschränkte« Dialog 253 faktischen kirchlichen Tradition mitgeschleppt werden, auszuschließen sind und die traditio fidei folglich einer fortlaufenden geschichtlichen Reinigung und Klärung bedarf. II. Ein zweiter Typus interreligiösen Dialogs: Die anderen Religionen als »unaufgeklärte« Gestalten des einen (christlichen) Glaubens Wendet man sich von diesen mittelalterlichem Befund herkommend den großen Dialogen der frühen Neuzeit zu, so wird einem ihre Eigentümlichkeit verständlich. Sie unterscheiden sich deutlich von den frühen mittelalterlichen Dialogen. Nicht nur dass Kenntnisstand und Argumentationsformen stark erweitert sind. Hier zeigen sich zum Teil auch ein neuer Geist und ein die mittelalterlichen Denkweisen wesentlich fortschreibendes Denken. Als Beispiel für eine zwar erweiterte, zugleich aber von einem rigoros abgrenzenden Geist beseelte Dialogschrift mag der »Tractatus contra principales errores perfidi Machomedi« des Johannes de Turrecremata dienen, eines Teilnehmers am Konstanzer Konzil wie am Konzil von Florenz (1439–1445). Die Gegenposition dazu repräsentiert der denkwürdige Traktat des Nikolaus von Kues, den er nach dem Fall Konstantinopels und erschüttert durch dieses Geschehen geschrieben hat: »De pace fidei«. Verglichen mit dem strikt abgrenzenden, verurteilenden Dialog des Dominikanerkardinals ist der Dialog des Kardinals von Kues von einer ganz anderen Blickweise und einem anderen Geist geprägt. Er hat die Vielheit der Religionen, die in der damaligen Welt überhaupt bekannt waren, im Blick, sieht ihre unterschiedlichen Kulte, Gebräuche und Verhaltensweisen, respektiert die Vielzahl von Propheten und Gesandten Gottes, die in den verschiedenen Religionen jeweils eine Rolle spielen. Ebenso ist ihm die leidvolle Geschichte der verschiedenen Religionsgemeinschaften bewusst, die miteinander immer wieder in Streit um die wahre Gottesverehrung geraten. Er sieht das ganze Leid der zerrissenen Menschheit, aber auch den guten Willen, ja die Bereitschaft zum Martyrium, zur Hingabe des eigenen Lebens in der jeweiligen eigenen Religion. Er hat einen Blick für die Schwierigkeiten der Menschen, hinsichtlich der Religionen ein vernünftiges Urteil zu bilden, er sieht die Macht der Gewohnheiten, die Neigung des Menschen, das Gewohnte, Selbstverständliche für wahr zu halten. Vor allem aber ist Nikolaus von Kues davon überzeugt, dass es der eine lebendige Gott ist, der in den vielen Kulten gesucht und verehrt wird. Er spricht deswegen immer wieder von der einen fides und den vielen Kulten. Was ist die innere Struktur seiner Argumentation? Nikolaus bezeichnet seinen Dialog als ein Gespräch im »Himmel der Ratio«, der »Vernunft«24. Indem Nikolaus von 24 Nikolaus von Kues, De pace fidei/Der Friede im Glauben, in: Philosophisch-theologische Schriften, hrsg. und eingeführt von Leo Gabriel, Wien 1976, Bd. III, 796 (De pace fidei XIX). 254 Peter Hünermann Kues seine Reflexionen auf dieser Ebene ansiedelt, bewegt er sich im Raum der »intelligentia«, die unterhalb Gottes – als des mundus divinus – und oberhalb der sinnlich wahrnehmbaren Welt liegt.25 Er bewegt sich damit im Raum der docta ignorantia, im Raum einer transzendentalen Reflexion, in dem die Voraussetzungen bzw. Grundlagen der Vernünftigkeit der Welt erörtert und geklärt werden.26 Wie strukturiert Nikolaus seine Argumentation? Unter dem Vorsitz der Weisheit (des Wortes bzw. der Wahrheit) wird im Dialog die bunte Vielfalt des Polytheismus auf den Glauben an den einen Gott zurückgeführt und in einem nächsten Argumentationsgang die Einheit und Dreifaltigkeit des einen Gottes auf die Einheit, Selbigkeit und die Unterschiedenheit der Transzendentalien zurückgeführt. Sorgfältig vermeidet Nikolaus die Nutzung der traditionellen theologischen Begriffe mia physis – treis hypostaseis, eine Natur – drei Personen. Dass man mit Muslimen und Juden die Dreifaltigkeit ablehnen müsse, wird von der Wahrheit, dem Verbum, ausdrücklich bestätigt, unter der Voraussetzung freilich, sie werde so verstanden, wie dies in beider Argumentation vorausgesetzt ist. Wird sie hingegen im Sinne der Einheit, Gleichheit und der Verbindung der Transzendentalien verstanden, können, ja müssen, die Gesprächspartner zustimmen. Es fällt auf, dass Nikolaus im Ausgang von seiner transzendentalen Reflexion und der Erschließung der Trinität von der Einheit, Selbigkeit und Zusammengehörigkeit der Transzendentalien in keiner Weise auf die Ambivalenz der traditionellen Bestimmungen der Trinität zu sprechen kommt. Es fällt kein Wort einer kritischen Evaluation. Weiter ist denkwürdig, dass der Kusaner nicht auf die Transzendentalien des Seins, der Wahrheit und der Gutheit zurückgreift, obwohl diese im Hintergrund stehen, sondern von der »aeterna unitas, unitatis aequalitas et unitatis et aequalitatis unio seu connexio«27 spricht. Sein argumentativer Ausgangspunkt ist die Vielheit der Kreaturen und ihre transzendentale Voraussetzung. Damit zeigt sich im Grunde indirekt, wie sehr er mit dem Begriff der drei Hypostasen ringt. In Bezug auf die Diskussion um die Menschwerdung des Wortes übernimmt Petrus, der Glaubenszeuge, den Vorsitz. Die Einwände der Muslime und Juden werden durch die transzendentale Reflexion auf die nicht größer zu denkende kommunikative Einheit der menschlichen natura rationalis mit der Weisheit Gottes beantwortet. Paulus, der Völkerapostel, erläutert dann die sich daraus ergebenden Sequenzen für die Vermittlung des Heils bzw. der Erlösung in der Geschichte durch die Sakramente. 25 Vgl. die Beschreibung der drei Welten in: De conjecturis/Die Mutmaßungen, a.a.O. Bd. 2, 66 (De conjecturis XIV). 26 Welt meint bei Nikolaus von Kues jeweils das Universum, alles, was es gibt, Gott, Menschen und die Dinge. Zu unterscheiden ist aber die Welt, wie sie Gott in Gott ist und in Gott da ist, von der Welt, wie sie sich im Ausgang von der Vernunft als Zentrum darbietet und wie sie sich schließlich von der sensibilitas her darbietet. Vgl. ebd. 27 A.a.O. 732 (De pace fidei VII).