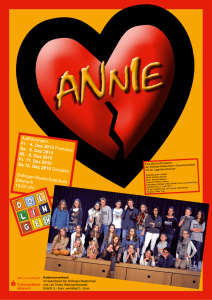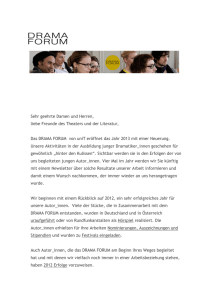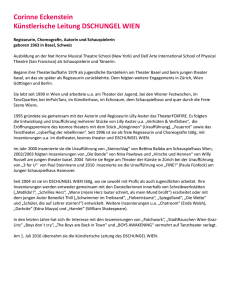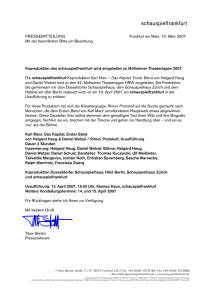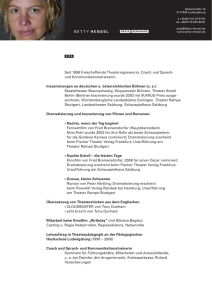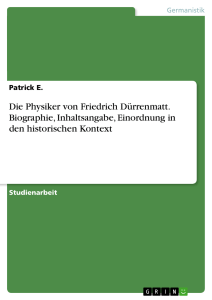Für ihr Stück „Beben“ erhält Maria Milisavljevic den AutorenPreis
Werbung

Für ihr Stück „Beben“ erhält Maria Milisavljevic den AutorenPreis des Heidelberger Stückmarkts 2016 Laudatio von Andrea Vilter Bevor ich beginne, das Stück zu loben, dem die Jury den Preis zuerkennt, möchte ich gerne auch die anderen eingereichten Stücke noch mit Lob bedenken. Wir alle lesen viel und auch viel neueste Dramatik und alle die das ebenfalls tun, wissen, dass das mühsam und nicht selten ernüchternd sein kann. Umso erfreulicher war es, sich mit der Auswahl des diesjährigen Heidelberger Stückemarkts zu beschäftigen, die ganz sicher mehr als ein Stück für das Theater bereithält. Stefan Hornbachs Über meine Leiche, zum Beispiel hat den Beweis bereits erbracht und ist zur Uraufführung in Osnabrück vorgesehen. Kontroverse Diskussionen in der Jury blieben dementsprechend nicht aus, aber zum Schluss – und das finde ich einen wirklich schönen Vorgang – konnten wir uns alle auf einen Text einigen: Beben von Maria Milisavljevic. Wer den Text liest, wird leicht feststellen, dass das keine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bedeuten kann. Dafür ist der Text zu sperrig, dem Theater zu widerständig, wirft das Stück zu viele Fragen auf. Die erste Frage stellt sich gleich zu Anfang: Wer spricht da überhaupt? In einem Gewebe von Sätzen zeichnet sich eine Dialogstruktur zwar ab, aber sie ist fließend und entsteht allein durch den Wechsel der Perspektiven in einer sich erst allmählich abzeichnenden Handlung. Wer genau also spricht in diesem vielstimmigen Text? Die Antwort der Autorin lautet: „Wir. Wer immer und wie viele wir auch sind.“ Maria Milisavljevic zwingt uns dieses „Wir“ gleichsam auf, sie will uns involvieren in eine Geschichte. Wir sollen uns identifizieren mit einer Gesellschaft, die sich angesichts immer näher rückender realer Bedrohungen in die Unverbindlichkeit virtueller Welten verabschiedet hat. Dass ihr das gelingt, und wie es ihr gelingt, macht die besondere Qualität ihres Textes aus. Die Autorin bringt scheinbar Entlegenes auf eine sehr persönliche und eigenwillige Weise zusammen und bezieht vor allem ganz unmittelbar Stellung. Sie weicht der Gegenwart nicht aus, im Gegenteil, sie lässt sich von ihr berühren, auch da, wo man sich sonst oft lieber ausklinkt um sich nicht angreifbar zu machen. Dabei zeigt sie (durchaus kunstvoll dabei aber sehr konkret) eine Realität, die aus unterschiedlichsten Erfahrungsebenen zusammengesetzt ist. Fremd, fast befremdlich in seiner Parabelhaftigkeit, erscheint eine mythologische Landschaft und in ihr eine geheimnisvolle Figur: Der Mann an der Kante von Ulro bezieht sich auf den englischen Dichter William Blake und sein mystisches Weltbild, in dem Ulro so etwas wie einen Zustand der Entgleisung beschreibt, der durch Selbstsucht und Rationalität bestimmt wird und auf unerwartete Weise auch eine Beschreibung unserer gegenwärtigen Wirklichkeit sein kann. Daneben die banalen, in erschreckender Weise bekannten Alltagsszenen und -dialoge einer Gruppe junger Erwachsener (offenbar eine WG in Berlin Kreuzberg?), deren subjektive Innenschau sich immer weiter von den Anforderungen ihrer Lebenswirklichkeit entfernt. Vor allem mit sich selbst beschäftigt, wird ihre Realitätswahrnehmung durch die allumfassende Medialisierung mehr und mehr von starken Störgeräuschen überlagert. Ist das im Text beschriebene Dröhnen Ursache oder Ergebnis einer sich unmerklich in unsere Gegenwart einblendenden Gewalt? Ist es Metapher oder konkretes Kriegsgeräusch? Sicher beides, wenn sich im Text die latente Bedrohung allmählich in einen sehr realen Bürgerkrieg verwandelt, aus dem sich auch die auf Rückzug aus der Verantwortung bedachten Jugendlichen irgendwann nicht mehr ganz heraushalten können. Sie müssen handeln und das führt zur Katastrophe. Ein Kind wird erschossen. Der Täter und die Mutter des Opfers müssen mit dem Schrecken der Tat leben. Und im Moment der größten Verzweiflung traut die Autorin sich und ihren Figuren eine unwahrscheinliche und dabei bezwingend einfache Möglichkeit der Erlösung zu. Mit Vehemenz und Pathos plädiert sie dafür, das Prinzip Liebe als Mittel gesellschaftspolitischen Handelns wieder zu entdecken und zeigt damit den Mut zur Utopie als Widerspruch zum Fatalismus der Vernünftigen. Das hat die Jury überzeugt und natürlich soll die Auszeichnung das Theater – ganz konkret die Dramaturgien, Regieteams und Ensembles – dazu ermutigen, die formalen und inhaltlichen Herausforderungen des Stücks anzunehmen. Wir glauben, dass es sich lohnen wird. Für sein Stück „Der Reservist“ erhält der Belgier Thomas Depryck den Internationalen AutorenPreis des Heidelberger Stückmarkts 2016 Notizen von Anne Lenk für ihre Laudatio Gibt’s das überhaupt noch, einen, der nicht mitspielen will? Oder zumindest nicht so, wie man es von ihm erwartet. Der nicht bereit ist, bedingungslos dem Fetisch unserer Gesellschaft, Arbeit, zu huldigen, sondern lieber fressen, fernsehen, faulenzen möchte und für den Selbstoptimierung tatsächlich noch ein Fremdwort ist? Der Held in Thomas Deprycks Stück „Der Reservist“ ist Sozialschmarotzer aus innerer Überzeugung. Denn wenn alle Arbeit hätten, so steht es schon bei Karl Marx, dann würde das Prinzip des Kapitalismus kollabieren, weil niemand mehr Druck auf die Arbeitenden ausüben könnte. So gesehen übernimmt der Reservist, indem er zu seiner Antriebsschwäche steht, sogar eine systemrelevante Aufgabe, an der er dann allerdings doch tragisch scheitert, weil ihm letztlich selbst die Verweigerung zu anstrengend ist. Aus der Lust am süßen Nichtstun wird allmählich ein verzweifelter Kampf um Würde und Selbstbestimmung. In der Warteschleife kreisend kämpft er wie Don Quichote gegen die Windmühlenflügel der Jobcenterbürokratie, stets bereit zum Amoklauf gegen Anpassungsdruck und Konsumzwang und doch auf verlorenem Posten gegen die unerbittliche Verwertungslogik des Marktes. Der belgische Dramatiker, Drehbuchautor und Dramaturg Thomas Depryck, Jahrgang 1979, hat mit viel Wut im Bauch und aggressivem Witz eine Figur in der Tradition der großen Nichtstuer Oblomow oder Bartleby geschaffen, der man auch auf deutschen Bühnen gern einmal begegnen möchte. Der diesjährige NachSpielPreis geht an „Furcht und Ekel. Das Privatleben glücklicher Leute“ von Dirk Laucke, inszeniert am Schauspiel Köln von Pınar Karabulut. Laudatio von Mounia Meiborg Guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf hier heute Abend den NachspielPreis vergeben. Also einen Preis für ein Theater und ein Inszenierungsteam, die den Mut haben, sich dem Uraufführungswahn zu widersetzen. Und das Gefühl, das mich dabei begleitet, ist ein schlechtes Gewissen. Denn ich bin Kritikerin. Und als Kritiker ist man in gewisser Weise Teil dieses Systems. Man dreht an den Reglern, schafft eine Aufmerksamkeit für bestimmte Produktionen – und für andere eben nicht. Wenn ich die Monatsspielpläne durchgucke und diese Flut an Premieren sehe, gibt es gewisse Signalwörter. Eines davon heißt „Uraufführung“. Ich weiß nicht wie oft ich schon zu Redakteuren den Satz gesagt habe: „Das ist eine Uraufführung, das müssen wir besprechen.“ Ich habe ganz sicher noch nie den Satz gesagt: „Das Stück wird zum zweiten Mal inszeniert, das müssen wir besprechen.“ Es ist ein Dilemma: Niemand will Wegwerfstücke. Aber nur relativ wenige Theater sind bereit, auf die Aufmerksamkeit, die eine Uraufführung bringt, zu verzichten. Und neuen Stücken – wenn sie nicht gerade von Roland Schimmelpfennig oder Dea Loher stammen – eine zweite, dritte oder vierte Chance zu geben. Ich weiß auch nicht, wie man diese Mechanismen des Marktes aushebeln und die Gesetze der Aufmerksamkeitsökonomie durchbrechen kann. Aber ich freue mich, den NachspielPreis vom Heidelberger Stückemarkt vergeben zu können. Denn dieser Preis will gegensteuern. Es ist ein undotierter Preis, der verbunden ist mit einer Einladung zu den Autorentheatertagen in Berlin im kommenden Jahr. Die Kritikerin Barbara Behrendt hat den NachSpielPreis in diesem Jahr kuratiert. Sie hat mit großem Einsatz Inszenierungen gesucht, hat sich von Verlagen Aufführungslisten schicken lassen, ist zu kleinen und kleinsten Theatern im deutschsprachigen Raum gereist. Drei Arbeiten hat sie eingeladen, die wir in der vergangenen Woche hier sehen konnten. „Lupus in Fabula“ von Henriette Dushe ist oft als Requiem bezeichnet worden. Aber für mich ist das Besondere an dem Stück, dass noch niemand gestorben ist. Drei Schwestern warten auf den Tod ihres kranken Vaters. Sie leben in einem Zwischenreich, das Raum und Zeit enthoben zu sein scheint. Claudia Bossard hat das Stück am Schauspielhaus Graz inszeniert und dabei die Poesie des Textes in konkrete Szenen übersetzt. Sie hat ihn geerdet, ohne die musikalische Textur zu verlieren. Die drei Schauspielerinnen erzählen einander, und sich selbst ihre Version der Geschichte, spielen die alten Kinderspiele und tanzen einen Totentanz mit dem Medikamentenschrank. Es sind Szenen, die berühren und die dabei erstaunlich unsentimental sind. Sie erzählen vom Abschiednehmen, aber auch von diesem komplexen Ding, das sich Familie nennt. Tuğsal Moğuls NSU-Stück „Auch Deutsche unter den Opfern“ ist eine große Rechercheleistung. In sieben Kapiteln erzählt der Text von einem Staatsversagen: von Opfern, die zu Tätern gemacht werden. Vom Verfassungsschutz, der über seine V-Männer Terroristen finanziert. Und von Kriminalbeamten und Politikern, die bis heute behaupten, der NSU – das seien doch nur drei rechtsextreme Einzeltäter. In Sapir Hellers Inszenierung vom Zimmertheater Tübingen sagen die Schauspieler einmal: „Wie sollen wir damit umgehen?“ Sie schreiben das Stück fort, fahren nach München zum NSU-Prozess und fragen sich immer wieder, wie sie von all dem, von diesen unfassbaren Dingen erzählen können. Die drei Schauspieler wechseln rasant die Perspektiven; sie sind Täter, Opfer, Unbeteiligte. Die Absurdität, die im Text steckt, wird zu einer temporeichen Farce gesteigert. Es ist ein Abend, der mit seiner Botschaft aufrütteln will. Und dem das durch den spürbaren Ernst aller Beteiligten auch gelingt. Auch in Dirk Lauckes Stück „Furcht und Elend. Das Privatleben glücklicher Leute“ geht es um Rassismus. Aber um einen ganz alltäglichen, der einem in der U-Bahn, auf dem Schulhof oder im Sozialamt begegnet. Angelehnt an Brechts „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ entsteht in 23 szenischen Schlaglichtern das Bild eines Landes, in dem Stumpfsinn, Verrohung und Fremdenfeindlichkeit herrschen. Die Inszenierung von Pinar Karabulut vom Schauspielhaus Köln setzt Lauckes Hyperrealismus an den richtigen Stellen Abstraktion entgegen. Als Setting wählt sie eine Kleingartenkolonie. Und dort, zwischen Gartenzwergen und Deutschlandfähnchen, spielen sich unter dem Deckmantel der Harmlosigkeit Szenen des Schreckens ab. Karabulut hat ein erstklassiges Ensemble. Die fünf Schauspieler machen sich Lauckes Soziolekte zu eigen und stürzen sich mit anarchischer Energie in die Szenen. Und sie geben den Figuren – auch wenn sie noch so prollig sind – eigenständige, liebenswerte Züge. Intelligente Rollenwechsel stellen die Zuschreibungen von männlich und weiblich, deutsch und ausländisch auf den Kopf – und denken Lauckes Text auf eine sehr sinnliche Art weiter. Jetzt habe ich einiges von dem genannt, was ich in den drei Inszenierungen gesehen habe. Alle drei sind würdige Kandidaten für den Nachspielpreis, alle drei überzeugen durch inhaltliche Tiefe, durch szenische und emotionale Klugheit. Natürlich ist eine Preisentscheidung immer subjektiv, vor allem wenn sie nur von einer Person getroffen wird. Deshalb sage ich es jetzt ganz subjektiv: „Furcht und Ekel“ inszeniert von Pinar Karabulut ist ein Theaterabend, der mich glücklich gemacht hat. Weil er uns mit Witz und Liebe durch die Abgründe deutscher Seelen führt. Weil er Spiel und Ernst gekonnt verbindet. Weil seine szenische Fantasie dem Text eine neue Dimension verleiht. Der diesjährige NachSpielPreis geht an Pinar Karabulut und das Schauspielhaus Köln. Herzlichen Glückwunsch. Der JugendStückePreis geht an die Uraufführung „Es bringen“ nach dem Roman von Verena Güntner (Bühnenfassung und Regie Karsten Dahlem) am Jungen Schauspielhaus Düsseldorf. Laudatio der Jugendjury: Felix Hacker, Paul Jonathan Berger, Vera Kreichgauer, Josephine Scholl und Mahtab Rahmani Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentleman, liebe Autoren. Wir, die Jugendjury hatten die letzte Woche die schwierige Aufgabe die Entscheidung zwischen drei interessanten Theaterstücken zu treffen. Einen wunderbaren Start brachte am Montag „Deals“ auf die Bühne. Mit einer Vielzahl aktueller Themen bietet das Stück Einblick in eine zerrüttete Familie. Auch haben uns die verschiedenen Charaktere und ihre verschiedenen Beziehungen zwischen einander gut gefallen. Jan Friedrich hat mit „Deals“ ein tolles Stück geschrieben, das uns nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird. Weiter ging es am Dienstag mit dem Klassenzimmerstück „Zwischeneinander“ von Martin Grünheit, in einer Kooperation mit einer neunten Klasse, einer Stückentwicklung des Jungen Deutschen Theaters Berlin. Es wurde die Kommunikation über die sozialen Medien und derer Vor- und Nachteile thematisiert und treffend dargestellt. Starke und verblüffende Situationen zeichnete das Stück von Liebeserklärungen über soziale Medien. Den bildgewaltigen Abschluss am Freitag machte das Stück „Es bringen“ von Karsten Dahlem und Judith Weißenborn nach dem Roman von Verena Güntner. Hier hat uns die emotionale Tiefe, das für Jugendliche ansprechende Thema und die persönliche Beziehung zum Protagonisten besonders gefallen. Nach langer Diskussion mit knappem Ausgang, haben wir uns für den Gewinner des diesjährigen JugendStückePreises entschieden: Herzlichen Glückwunsch an Verena Güntner, Karsten Dahlem und Judith Weißenborn für ihr Stück „Es bringen“! Wir als Jugendjury wollen uns nochmal ganz herzlich bei der „Erwachsenenjury“ für ihre Unterstützung bedanken und besonders bei der Dramaturgin Viktoria Klawitter, die uns kontaktiert und unsere Treffen und sonstiges organisiert hat.