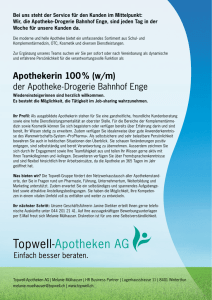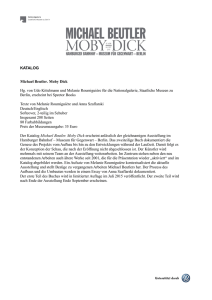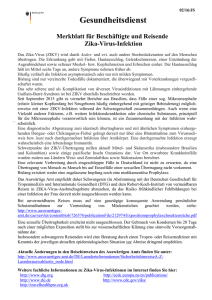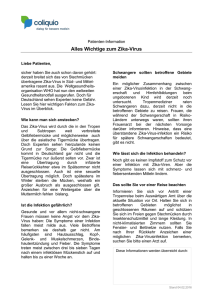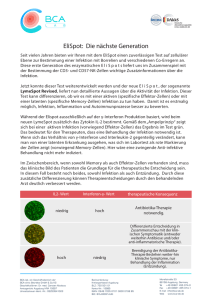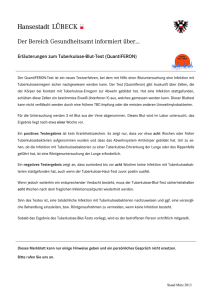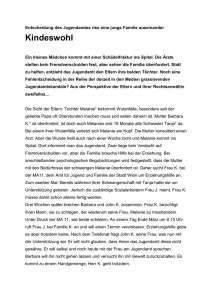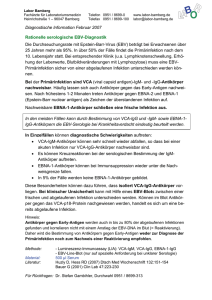Prüfungspraxis Medizinische Fachangestellte
Werbung
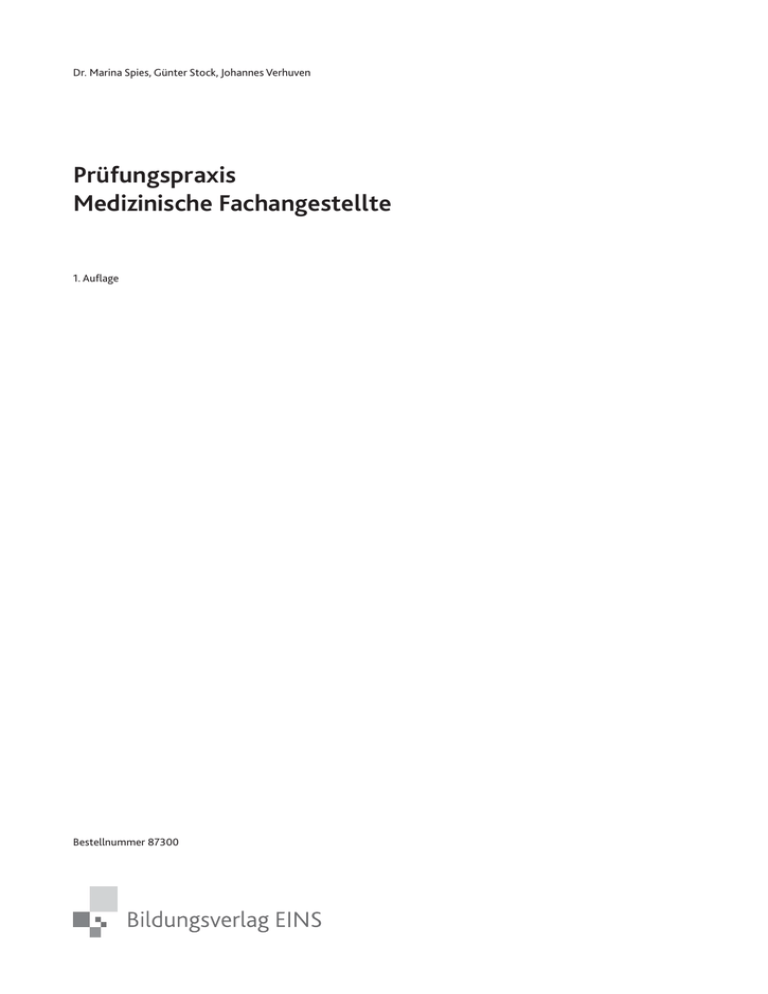
Dr. Marina Spies, Günter Stock, Johannes Verhuven Prüfungspraxis Medizinische Fachangestellte 1. Auflage Bestellnummer 87300 Haben Sie Anregungen oder Kritikpunkte zu diesem Produkt? Dann senden Sie eine E-Mail an [email protected] Autoren und Verlag freuen sich auf Ihre Rückmeldung. www.bildungsverlag1.de Bildungsverlag EINS GmbH Hansestraße 115, 51149 Köln ISBN 978-3-427-87300-6 © Copyright 2012: Bildungsverlag EINS GmbH, Köln Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt werden. Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen. 3 Vorwort Prüfungen bei den Medizinischen Fachangestellten werden zunehmend zentral für mehrere beteiligte Ärztekammern gestellt. Einhergeht mit dieser Entwicklung eine Aufgabenstellung im Multiple-Choice-Verfahren. Im Rahmen der dualen Ausbildung werden die Medizinischen Fachangestellten in der Berufsschule mit umfassenden Lernsituationen konfrontiert. Anhand dieser Lernsituationen sollen sie möglichst handlungsorientiert alle notwendigen Kompetenzen für die Ausübung ihres Berufes erwerben. Hierbei gewinnen sie selten Erfahrungen zur Bearbeitung von Aufgaben nach dem Multiple-Choice-Verfahren. Dies ist aber notwendig, um mit den Eigenarten dieses Verfahrens vertraut zu sein und die in der Ausbildung zu leistenden Prüfungen bestehen zu können. Mit der Prüfungspraxis Medizinische Fachangestellte möchten wir die Auszubildenden bei der Vorbereitung der Kammerprüfung durch • anforderungsgerechte, • prüfungsrelevante, • aktuelle, • handlungsorientiert aufbereitete, • nach Prüfungsgebieten geordnete Aufgaben unterstützen. Die Prüfungspraxis umfasst folgende Bausteine: • Behandlungsassistenz, • Betriebsorganisation und –verwaltung, • Wirtschafts- und Sozialkunde. Im ersten Teil der Prüfungspraxis wird eine umfassende Wiederholung aller prüfungsrelevanten Inhalte geboten. Im zweiten Teil bieten Prüfungsklausuren aus den oben genannten Bereichen die Möglichkeit, sich mit Art, Umfang und Anspruch der Kammerprüfung vertraut zu machen. Ziel dieser Aufgabensammlung ist es, dass die Medizinischen Fachangestellten die Möglichkeit erhalten, Prüfungspraxis zu gewinnen, um erfolgreich ihre Ausbildung abzuschließen. Wir wünschen hierbei viel Erfolg. Für Anregungen und Hinweise sind wir dankbar. Dr. Marina Spies Günter Stock Johannes Verhuven 4 Liebe Auszubildende, die „Prüfungspraxis Medizinische Fachangestellte“ enthält Aufgaben, die in Art und Umfang den Ansprüchen der Kammerprüfung entsprechen. Möglichst aktuell und praxisnah werden zu allen relevanten Inhalten aus den einzelnen Lernfelder Aufgaben gestellt. Für die Arbeit mit der Prüfungspraxis möchten wir einige Empfehlungen geben: • Lesen sie langsam und sorgfältig. Nur so ist gesichert, dass Sie keine Informationen überlesen, die für die Lösung entscheidend sein können. • Erstellen Sie einen Arbeits- und Zeitplan für die Prüfungsvorbereitung. So entgehen Sie der Gefahr, vor der Prüfung durch übermäßiges Lernen bis an die Grenze belastet zu sein. Außerdem bringt kontinuierliche Arbeit mehr Erfolg. • Betrügen Sie sich nicht selbst. Lösen Sie die Aufgaben, tragen Sie die Lösungen in die Kästchen ein und vergleichen Sie dann erst Ihr Ergebnis mit den angebotenen Lösungen. Nur so haben Sie eine Kontrolle über Ihren augenblicklichen Leistungsstand. Wir wünschen ein erfolgreiches Lernen. Tipps für die Lösung der Prüfungsklausuren • Testen Sie den Ernstfall. Bearbeiten Sie vor den Kammerprüfungen noch einmal die Prüfungsklausuren in der von der Prüfungsordnung vorgegebenen Zeit. Diese beträgt für Behandlungsassistenz Praxisorganisation und –verwaltung Wirtschafts- und Sozialkunde – – – 120 Minuten, 120 Minuten, 60 Minuten. • Überfliegen Sie den gesamten Aufgabensatz. Sie gewinnen so ein Bild über Umfang und Schwierigkeit der Prüfungsklausur. Lösen Sie zunächst die Aufgaben, bei denen sie sicher sind, dass Sie hier schnell zum richtigen Ergebnis kommen. Die für diese Aufgaben vergebenen Punkte sind dann schon mal gesichert und Sie gewinnen an Vertrauen und Sicherheit. Haben Sie sich zunächst an für Sie schwierige Aufgaben zu lange aufgehalten, reicht oft die Zeit nicht mehr für die Aufgaben, die Sie sicher, schnell und richtig lösen können. • Beachten Sie die Zeit. Bei 120 Minuten Prüfungsdauer und 40 Aufgaben haben Sie durchschnittlich 3 Minuten Zeit pro Aufgaben. Bei kleineren Aufgaben unterbieten Sie die Durchschnittszeit, bei größeren Aufgaben kann es etwas länger dauern. Haben Sie aber das Gefühl, dass bei einer Aufgabe von Ihnen unverhältnismäßig viel Zeit aufgewendet wird, bearbeiten Sie lieber zunächst die weiteren Aufgaben. • Achten Sie auf die richtigen Arbeitsmittel. Für das Ausfüllen des Lösungsblattes benötigen Sie einen Kugelschreiber, der ein möglichst deutliches Markieren der jeweiligen Lösung ermöglicht. Die Funktionsfähigkeit des mitzuführenden Taschenrechners sollte nicht erst in der Prüfung, sondern möglichst am Vortag erfolgen. So können eventuell leere Batterien noch ausgetauscht werden. Die Arbeitsmittel sollten nicht dazu führen, dass in der Prüfung selbst unnötige Hektik entsteht, weil der Kugelschreiber nicht schreibt oder der Taschenrechner nicht funktioniert. Vermeiden Sie in jedem Fall solche Extremsituationen. • Nutzen Sie für die Erarbeitung der Lösungen die der Prüfung beigefügten Arbeitsmittel richtig. So findet man in den von der Kammer bei der Prüfung zur Verfügung gestellten Gebührenordnung nicht nur die Gebührenordnungspositionen, die abgefragt werden, sondern manche allgemeine Frage zur Abrechnung lässt sich auch mit ihrer Hilfe lösen. Viel Erfolg! 5 Prüfungsbereiche Aufgaben Lösungen Behandlungsassistenz S. 7 S. 229 Betriebsorganisation und -verwaltung S. 69 S. 236 Wirtschafts- und Sozialkunde S. 109 S. 239 Prüfungsklausuren S. 154 S. 242 Aufgaben Lösungen 1 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren S. 8 S. 229 2 Bei Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Bewegungsapparates assistieren S. 16 S. 229 3 Zwischenfällen vorbeugen und in Notfallsituationen Hilfe leisten S. 23 S. 230 4 Patienten bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen der Erkrankungen des Urogenitalsystems begleiten S. 30 S. 230 5 Patienten bei diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen der Erkrankungen des Verdauungssystems begleiten S. 40 S. 232 6 Diagnostik S. 49 S. 234 7 Patienten bei kleinen chirurgischen Behandlungen und bei der Versorgung von Wunden begleiten S. 51 S. 234 8 Der Begriff der Prävention S. 61 S. 235 9 Vorsorgeuntersuchungen S. 62 S. 235 10 IGeL-Leistungen S. 64 S. 235 11 Impfungen S. 65 S. 235 12 Abrechnung nach GOÄ und EBM S. 66 S. 235 Aufgaben Lösungen 1 Gestaltung des Empfangs- und Wartebereichs S. 70 S. 236 2 Behandlungsvertrag S. 71 S. 236 3 Karteiführung S. 75 S. 236 4 EDV-Arzt für den Arzt – auf dem Weg zur digitalen Praxis S. 75 S. 236 5 Terminvergabe – die Kunst eines effizienten Terminmanagements unter Einbeziehung der EDV S. 77 S. 236 6 Patienten verwalten und abrechnen S. 79 S. 237 7 Waren beschaffen und verwalten S. 87 S. 237 8 Zahlungsverkehr S. 95 S. 237 9 Aufbau- und Ablauforganisation S. 98 S. 238 10 Qualitätssicherung S. 99 S. 238 11 Postbearbeitung S. 105 S. 238 12 Praxismarketing S. 107 S. 238 Behandlungsassistenz Themengebiete Betriebsorganisation und -verwaltung Themengebiete Behandlungsassistenz Inhaltsübersicht 6 Wirtschafts- und Sozialkunde Themengebiete Aufgaben Lösungen 1 Duale Berufsausbildung S. 110 S. 239 2 Arbeitsschutzgesetze S. 113 S. 239 3 Gesundheitswesen S. 116 S. 239 4 Sozialversicherung und Möglichkeiten der privaten Absicherung S. 119 S. 239 5 Grundlagen des Privatrechts S. 127 S. 240 6 Überwachung des Zahlungseingangs und Durchführung von Mahnverfahren S. 130 S. 240 7 Arbeits- und Tarifvertrag S. 133 S. 240 8 Gesetzliche Sozialversicherung und private Versicherungen S. 143 S. 241 9 Sparen und Kredite S. 148 S. 241 Themengebiete Aufgaben Lösungen 1 Behandlungsassistenz – Prüfungsklausur 1 S. 154 S. 242 2 Behandlungsassistenz – Prüfungsklausur 2 S. 167 S. 243 3 Betriebsorganisation und -verwaltung – Prüfungsklausur 1 S. 181 S. 244 4 Betriebsorganisation und -verwaltung – Prüfungsklausur 2 S. 198 S. 245 5 Wirtschafts- und Sozialkunde – Prüfungsklausur 1 S. 213 S. 246 6 Wirtschafts- und Sozialkunde – Prüfungsklausur 2 S. 220 S. 247 Prüfungsklausuren Bildquellenverzeichnis 247 Prüfungsbereich Behandlungsassistenz 4 Bakterien können u. a. Krankheitserreger beim Menschen sein. Melanie muss daher zu möglichen Infektionsquellen in der Praxis Kenntnisse haben, um entsprechend bei der Vorsorge und Vermeidung von Infektionen mitzuwirken. Ordnen Sie den unten aufgeführten Bakterien ihre entsprechende Form zu. Tragen Sie hierzu die zutreffenden Buchstaben hinter die Ziffern 1 bis 5. 1 Staphylokokken a Stäbchenförmige Bakterien 1 ____ 2 Streptokokken b Spiralförmige Bakterien 2 ____ 3 Bazillen c Doppelkokken 3 ____ 4 Spirochäten d Traubenkokken 4 ____ 5 Diplokokken e Kettenkokken 5 ____ 5 Neben den Bakterien sind Viren häufig Erreger von Infektionskrankheiten. Bringen Sie die einzelnen Abschnitte der Virenvermehrung in die richtige Reihenfolge. Setzen Sie hierzu in die Kästchen die entsprechenden Buchstaben vor den Aussagen ein. a Viren verlassen die abgestorbene Zelle. 1 ____ b Ein Virus dringt in die Zelle ein. 2 ____ c Viren befallen weitere gesunde Zellen. 3 ____ d Ein Virus verändert die DNS der Wirtszelle. 4 ____ 6 Ordnen Sie den links genannten Begriffen die entsprechende Aussage zu. 1 pathogen e Lebewesen, die auf Kosten anderer existieren 1 ____ 2 Bakteriophagen d nicht krank machend 2 ____ 3 apathogen c Tierische Einzeller mit Zellkern 3 ____ 4 Protozoen b Krank machend 4 ____ 5 Parasiten a Viren, die Bakterien als Wirtszelle benutzen 5 ____ 7 Kreuzen Sie die richtigen Antworten an: a Durch Protozoen verursachte Erkrankungen kommen in Deutschland häufig vor. b Protozoen sind keine Mikroorganismen. c Protozoen verursachen hauptsächlich tropische Krankheiten. d Malaria wird von Protozoen verursacht. e Windpocken werden von Protozoen verursacht. f Protozoen enthalten keinen Zellkern. 8 Tröpfcheninfektionen gefährden insbesondere im Wartebereich einer Praxis die Patienten. Melanie informiert sich zu dem Übertragungsweg bei dieser Infektion. Kreuzen Sie die richten Antworten an: a Eine Infektion durch herumliegendes kontaminiertes Material. b Die Übertragung z. B. durch einen Händedruck. c Erregerhaltige Schwebeteilchen werden z. B. durch Niesen über die Atemluft von einer Person auf die andere übertragen. d Eine Infektion durch fehlendes Händewaschen nach dem Toilettengang. e Eine Infektion durch Geschlechtsverkehr. 9 Behandlungsassistenz 1 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren Behandlungsassistenz 10 1 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren 9 Melanie erhält des Öfteren die Aufgabe, Desinfektionsmaßnahmen durchzuführen und Instrumente zu sterilisieren. Helfen Sie ihr bei der Unterscheidung der Begriffe. Ordnen Sie den Begriffen die richtige Definition zu: 1 Desinfektion 2 Sterilisation a Die Abtötung, Reduktion oder Inaktivierung von pathogenen Mikroorganismen, sodass sie nicht mehr infizieren können. b Abtötung aller pathogenen und apathogenen Keime. 10 Die Wirksamkeit der Desinfektion ist abhängig von: 1 der Wahl der Methode; 2 der Konzentration der chemischen Mittel; 3 der Einwirkzeit der chemischen Mittel und physikalischen Methoden; 4 der Temperatur der physikalischen Methoden. Kreuzen Sie die zutreffende Aussage an: a Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig b Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig c Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig d Alle Aussagen sind richtig 11 Melanie kommt aus der Berufsschule wieder, wo heute die Immunisierung besprochen wurde. Da sie sich bisher noch nicht mit der Thematik beschäftigt hat, hat sie Schwierigkeiten mit den neu erlernten Begriffen. Gehen Sie mit ihr die Begriffe durch und ordnen Sie den hier angeführten Definitionen die unten stehenden Begriffe zu, indem Sie in die Kästchen die Ziffern vor den Begriffen eintragen. a Es besteht ein direkter Schutz durch Verabreichung von fremden Antikörpern. Der Verlauf einer Erkrankung kann so abgeschwächt werden; allerdings beträgt der Impfschutz nur wenige Wochen. b Es erfolgt die gleichzeitige Durchführung von aktiver und passiver Impfung. Dadurch setzt der Impfschutz sofort ein und es besteht ein Langzeitschutz. c Man verabreicht eine Gabe von abgeschwächten oder abgetöteten Krankheitserregern oder inaktivierten Giften. d Der Körper besitzt Widerstandsfähigkeit gegen Krankheitserreger oder Giftstoffe. e Die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Institutes wird auch bezeichnet als …? f Inaktivierte Giftstoffe (Toxine) nennt man? g Eine künstliche Erzeugung von Immunität wird wie genannt? h Eine Infektionskrankheit tritt gehäuft in einem begrenzten Gebiet oder Zeitraum auf. i Abwehrstoffe führen zu einer Immunität gegen Erkrankungen. j Man ergreift Maßnahmen nach einem möglichen Kontakt mit Erregern einer Infektionserkrankung, um deren Ausbruch zu verhindern oder deren Verlauf abzumildern. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Postexpositionsprophylaxe (PEP) Immunität Schutzimpfung Epidemie STIKO Toxoide Antikörper aktive Impfung passive Impfung Simultanimpfung 1 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren Behandlungsassistenz 12 Melanie ist sich nicht sicher, wie sie die hygienische Händedesinfektion durchführen muss. Helfen Sie ihr, die folgenden Aussagen zu beurteilen. Tragen Sie eine 1 ein, wenn die Aussage richtig ist, eine 0, wenn die Aussage falsch ist. a Daumen und Fingerkuppen werden bei der hygienischen Händedesinfektion häufig vernachlässigt. b Das Desinfektionsmittel kann in die nassen, vorher gewaschenen Hände gegeben werden. c Der Desinfektionsspender soll mit dem Ellenbogen bedient werden. d Es sollte immer eine ausreichende Menge an Desinfektionsmittel benutzt werden, in der Regel 3 ml. e Eine Händedesinfektion ist vor jedem Patientenkontakt nötig. f Handrücken, Fingerzwischenräume und Handgelenke müssen auch desinfiziert werden. g Nach dem Patientenkontakt ist keine Händedesinfektion nötig. 13 Bringen Sie die Schritte der chirurgischen Händedesinfektion in die richtige Reihenfolge. Tragen Sie hierzu die vor den Aussagen stehenden Buchstaben in die richtige Reihenfolge ein. a Hände und Unterarme zweieinhalb Minuten mit geeignetem Desinfektionsmittel einreiben. 1 ____ b Hände, Fingernägel und Unterarme gründlich mit Wasser, Seife und Bürste reinigen. 2 ____ c Sterile Handschuhe anziehen. 3 ____ d Abtrocknen mit einem Einmalhandtuch. 4 ____ 14 Melanie hat zum ersten Mal Instrumente sterilisiert. Nach dem Vorgang ist sie verunsichert, da sie nicht weiß, ob sie alles richtig gemacht hat, und fragt Nadine, woran sie erkennen kann, dass die Instrumente nun auch wirklich steril sind. Nadine gibt nachfolgende Antworten vor. Entscheiden Sie welche Antwort richtig ist, indem sie eine 1 eintragen. Tragen Sie für die falschen Antworten eine 0 ein. a Die Instrumente sind feucht – also hat eine Sterilisation stattgefunden. b Die Instrumente sind noch heiß, was auf eine gerade abgeschlossene Sterilisation schließen lässt. c Die Instrumente liegen auf einem speziellen Tablett, sodass Sterilität angenommen werden kann. d Ein spezieller Teststreifen (biologischer Indikator) gibt Auskunft über eine gelungene Sterilisation. e Die Instrumente sehen völlig sauber aus – also sind sie auch steril. 15 In der Praxis von Dr. Heine häufen sich zurzeit Infektionskrankheiten. Melanie stellt sich die Frage, wie es denn überhaupt zu einer Infektion kommt. Ergänzen Sie die folgende Definition um das richtige Wort, damit Melanie eine Antwort auf ihre Frage findet. Eine Infektion kommt zustande indem gen und sich dort vermehren. in einen Makroorganismus (Mensch, Tier, Pflanze) eindrin- a Mikroorganismen b Antibiosen c Infekte 16 Welche Aussagen zur Infektionsentwicklung sind richtig? 1 Jede Infektion hat spezielle Symptome – wird also vom Betroffenen bemerkt. 2 Entstehung und Verlauf hängen u. a. von der Abwehrkraft und der Immunität des Makroorganismus ab. 3 Entstehung und Verlauf hängen von den Eigenschaften des Mikroorganismus ab. 4 Die Abwehrlage des Makroorganismus hat keinen Einfluss auf die Infektion. a Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig b Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig c Nur die Aussagen 2, 3und 4 sind richtig d Alle Aussagen sind richtig 11 Behandlungsassistenz 12 1 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren 17 Ordnen Sie den folgenden Fachbegriffen die richtige Definition zu. Tragen Sie hierzu die Buchstaben vor den Definitionen in die entsprechenden Kästchen ein. 1 Pathogenität 2 Fakultativ pathogen 3 Virulenz 4 Resistenz 5 Disposition 6 Inkubationszeit 7 Rekonvaleszenz a Die Zeit zwischen dem Eindringen der Erreger und dem Beginn der Krankheitszeichen. b Die Fähigkeit der Mikroorganismen, eine Krankheit auszulösen. c Die Fähigkeit, eine Krankheit nur unter bestimmten Bedingungen auszulösen, z. B. bei bereits vorhandener Immunschwäche. d Die Genesungszeit nach überstandener Krankheit. e Die Empfänglichkeit des Menschen für bestimmte Krankheiten. f Der Grad der krankheitserregenden Eigenschaften der Mikroorganismen bestimmt die Schwere der Krankheit. g Der unspezifische Schutz des Menschen gegenüber Giften und Infektionen. 18 Melanie möchte mehr über das Abwehrsystem des menschlichen Körpers erfahren. Helfen Sie ihr, folgende Aussagen als richtig oder falsch zu beurteilen: 1 Das Immunsystem hat die Aufgabe, sämtliche körperfremden Substanzen abzuwehren. 2 Die Lymphe nimmt Fremdstoffe oder Mikroorganismen auf und transportiert sie zu den Lymphknoten. 3 Die Lymphgefäße bilden zusammen mit den Lymphknoten, der Milz, den Rachen- und Gaumenmandeln, dem Thymus, dem Appendix, dem Knochenmark und Teilen des Dünndarms das lymphatische System. 4 Mit der Lymphe werden neben anderen Bestandteilen z. B. Krankheitserreger abtransportiert. a Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig b Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig c Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig d Alle Aussagen sind richtig 19 Wie nennt man Stoffe, die eine Abwehrreaktion im menschlichen Körper auslösen? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. a Antiköper b Antigene c Makrophagen d Monozyten 20 Was versteht man unter der unspezifischen Abwehr? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. a Die schon bei der Geburt vorhandene, also angeborene Abwehr. b Die im Laufe des Lebens erworbene Abwehr. c Wenn keine Abwehr vorhanden ist. d Die passive Immunisierung. e Die aktive Immunisierung. 21 Wie nennt man Zellen, die an der spezifischen Abwehr maßgeblich beteiligt sind? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. a Lymphozyten b Erythrozyten c Thrombozyten 22 Wie nennt man hochspezialisierte Eiweiße, die sich mit bestimmten Antigenen verbinden können und zusammenpassen wie Schlüssel und Schloss? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. a Antikörper b Antigene c Lymphozyten d Proteine e Erythrozyten 23 Beurteilen Sie die folgenden Aussagen. Setzen Sie für die richtigen Aussagen eine 1 und für die falschen eine 0. a Ob jemand nach dem Kontakt mit Krankheitserregern erkrankt, hängt u. a. von der Virulenz und der Menge der Erreger ab. b Psychische Belastungen können das Immunsystem schwächen und somit eine Infektion begünstigen. c Die Einnahme von Medikamenten wirkt sich nicht negativ auf das Immunsystem und die Empfänglichkeit von Infektionserkrankungen aus. d Das Immunsystem kann Abwehrreaktionen gegen Stoffe einleiten, die gar nicht abgewehrt werden müssen. e Störungen bzw. das teilweise Fehlen des Immunsystems haben keine Auswirkungen auf die Infektionsanfälligkeit eines Menschen. 24 Beurteilen Sie, welche Aussagen richtig, welche falsch sind. Tragen Sie eine 1 für richtig, eine 0 für falsch ein. a Ein mit HIV infizierter Mensch weiß in den ersten Jahren seiner Infektion häufig nichts davon, da Symptome zunächst ausbleiben. Er kann in dieser Zeit andere Personen infizieren. b Erst nach dem Ausbruch der Erkrankung spricht man von Aids. c Eine HIV-Infektion ist heilbar. d Gegen HIV gibt es eine wirksame Impfung. e Mit einer Aids-Erkrankung können schwere Lungenentzündungen, Infektionen in Gehirn und Darm und bösartige Tumore einhergehen. f Eine Infektion kann über Blut-zu-Blut-Kontakt, ungeschützten Geschlechtsverkehr und während der Schwangerschaft, unter der Geburt oder beim Stillen übertragen werden. g Eine Infektion kann erst nach ca. 12 Wochen nach Ansteckung diagnostiziert werden. 25 Bakterielle Infektionen werden u. a. durch Tröpfcheninfektionen übertragen. Kreuzen Sie an, welche Erkrankungen auf diesem Weg in den menschlichen Körper gelangen. a Diphterie b Keuchhusten c Scharlach d Tetanus e Lyme-Borreliose f Salmonellen-Infektion g Tuberkulose 13 Behandlungsassistenz 1 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren Behandlungsassistenz 14 1 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren 26 Melanie wird von Frau Goch nach möglichen Impfungen befragt. Gegen welche Erkrankungen gibt es keine wirksame Schutzimpfung? Kreuzen Sie an. a Diphterie b Keuchhusten c Scharlach d Tetanus e Lyme-Borreliose f Salmonellen-Infektion g Tuberkulose 27 Melanie hat richtig festgestellt, dass in letzter Zeit sehr viele Patienten an Infektionskrankheiten erkrankt sind. Sie kennt die grobe Einteilung der Mikroorganismen in Bakterien, Viren, Pilze und Protozoen. Ordnen Sie den unten aufgeführten Erkrankungen die jeweiligen Mikroorganismen zu, indem Sie die fettgedruckten Anfangsbuchstaben eintragen. Scharlach Röteln Masern Borreliose Influenza Tetanus Mumps Windpocken Malaria Diphtherie Keuchhusten Salmonellen-Infektion Tuberkulose Trichomonas-Infektion Polymyelitis Hepatitis HIV Mykosen 28 Melanie fragt sich nun, welche Art der Infektion in der Praxis am häufigsten vorkommt. Nummerieren Sie die folgenden Krankheiten nach abnehmender Häufigkeit, indem Sie die Ziffern 1 (häufigste Erkrankung) bis 4 (am wenigsten häufige Erkrankung) einsetzen. a Pilzinfektionen b Virusinfektionen c Bakterielle Infektionen d Protozoenerkrankungen 29 Eine weitere Möglichkeit, eine Infektionskrankheit zu erlangen, ist die Übertragung, die von Würmern hervorgerufen wird. Melanie hat davon schon mal gehört, allerdings war sie sich nicht sicher, ob es das wirklich gibt. Gehen Sie mit ihr folgende Aussagen durch und entscheiden Sie, ob Sie die Ziffer 1 für wahr bzw. die Ziffer 0 für falsch eintragen muss. a Würmer schädigen als Parasiten den Körper. b Sie können über die Tröpfcheninfektion in den Körper gelangen. c Sie gelangen über den Mund in den Darm. d Ursache eine Wurmerkrankung kann der Genuss von rohem oder nicht ausreichend gekochtem Fleisch sein. e Haustiere haben keine Auswirkung auf die Wurmerkrankung von Menschen. f Erwachsene leiden häufiger an Wurmerkrankungen als Kinder. g Eine Wurmerkrankung lässt sich im Stuhl und im Blut nachweisen. 30 Melanie weiß, dass es u. a. für die Therapie wichtig ist, Krankheitserreger nachzuweisen. Sie hat in der Praxis schon von verschiedenen Nachweismethoden gehört. Sie möchte nun von Laura wissen, worauf sie besonders achten muss, damit die Ergebnisse auch zuverlässig sind. Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an: a Abstrichtupfer müssen immer steril sein. b Abstrichtupfer haben kein Verfallsdatum. c Nach dem Abstrich muss der Abstrichtupfer sofort in das Transportmedium zurückgesteckt werden. d Um Transportkosen zu sparen, reicht es aus, wenn das Untersuchungsmaterial gesammelt und zweimal wöchentlich versandt wird. e Auch geronnenes Blut kann im Labor gut untersucht werden. f Zur Stuhluntersuchung reicht eine bohnengroße Menge aus. g Ein Antibiogramm gibt Auskunft darüber, ob Bakterien gegenüber bestimmten Antibiotika resistent sind. 31 Melanie macht sich Gedanken darüber, welche Medikamentengruppe bei welchem Erreger eingesetzt wird. 1 Bakterielle Infektionen werden mit Antibiotika therapiert. 2 Virusinfektionen werden mit Antibiotika therapiert. 3 Virusinfektionen werden symptomatisch und gegebenenfalls mit Virostatika therapiert. 4 Multiresistente Keime sind mindestens gegen vier Antibiotikagruppen resistent. Welche Aussagen sind richtig? a Nur Aussage 1 ist richtig b Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig c Alle Aussagen sind richtig d Nur Aussage 2 ist richtig 15 Behandlungsassistenz 1 Praxishygiene und Schutz vor Infektionskrankheiten organisieren Behandlungsassistenz 16 2 Bei Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Bewegungsapparates assistieren 2 Bei Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Bewegungsapparates assistieren Anatomie und Physiologie des Bewegungsapparates 1 Melanie setzt sich im Rahmen ihrer Ausbildung mit dem Aufbau des Bewegungsapparates auseinander. Die Einteilung in die Bereiche „passiver Bewegungsapparat“ und „aktiver Bewegungsapparat“ sollen anhand der folgenden Zuordnung geübt werden. Setzen Sie in die Kästchen hinter den unten stehenden Bereichen jeweils ein A für aktiv bzw. ein P für passiv ein. a Die etwa 210 unterschiedlich geformten Knochen b Die Skelettmuskulatur c Die Gelenke d Das gesamte Skelett e Muskeln und Sehnen 2 In dem Zusammenhang prüft Melanie ihre Kenntnisse zum Organsystem Bewegungsapparat. Kreuzen Sie die richtigen Aussagen zu diesem Organsystem an. a Erkrankungen des Organsystems entstehen u. a. durch Verletzungen, Entzündungen, Abbau und Verschleiß sowie durch Fehlbelastungen. b Fehlstellung haben keine Auswirkungen auf Erkrankungen des Bewegungsapparates. c Die Therapie von Erkrankungen des Bewegungsapparates kann eine Vielzahl verschiedener Fachärzte beanspruchen. d Der passive Bewegungsapparat wird so genannt, da eine Bewegung von Knochen und Gelenken ohne Muskeln nicht möglich ist. e Eine der Aufgaben des Bewegungsapparates ist die Blutbildung. f Eine weitere Aufgabe besteht in der psychischen Stabilisation des Menschen. g Die Knochen und Gelenke sind aus verschiedenen Binde- und Stützgeweben aufgebaut: Binde- und Stützgewebe, Muskelgewebe, Epithelgewebe und Nervengewebe. 3 Im Rahmen der Assistenz muss Melanie, wie jede Medizinische Fachangestellte, über Kenntnisse der Gelenkarten und der Gelenke verfügen. Ordnen Sie der genannten Gelenkart das entsprechende Gelenk zu 1 Gleitgelenk 4 Eigelenk 2 Kugelgelenk 5 Zapfen- und Drehgelenk 3 Scharniergelenk 6 Sattelgelenk a Schultergelenk, Hüftgelenk b Verbindung von Handwurzel- oder Fußwurzelknochen c Daumengrundgelenk d Zwischen Atlas und Axis oder Ulna und Radius e Handwurzelgelenk f Finger- und Zehengelenke 4 Welche Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie an: a Knochen sind durch Gelenke beweglich miteinander verbunden. b Es gibt verschiedene Formen von Gelenken. c Zwischen dem Gelenkkopf und der Gelenkpfanne befindet sich kein Spalt, die beiden Kontaktflächen reiben aneinander. d Je nach Bauart der Gelenke sind Bewegungen in einer, zwei oder drei Raumebenen möglich. e Gelenke können nur in einer Raumebene bewegt werden. 5 Bei Untersuchungen weist Dr. Heine des Öfteren darauf hin, dass die Wirbelsäule die Stütze und Längsachse unseres Körpers ist. Ordnen Sie die unten stehenden Fachbegriffe entsprechend zu. a Kreuzbein b Lendenwirbelsäule c Steißbein d Halswirbelsäule e Brustwirbelsäule Zuzuordnende Fachbegriffe: 1 Atlas und Axis, 2 Os coccygis, 3 L1 bis L5, 4 Os sacrum, 5 Th1 bis Th12 6 Ordnen Sie den Begriffen die am knöchernen Thorax abgebildeten Zahlen zu. 1 a Brustbein/Sternum b zwölfte Rippe c Rippen-Brustbein-Gelenk 3 4 d erste Rippe 2 7 Welche Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie die zutreffende Lösungskombination an. 1 Der Schultergürtel besteht ausschließlich aus den beiden Schlüsselbeinen. 2 Der Schultergürtel liegt flach auf dem Brustkorb auf. 3 Der Schultergürtel ist Ansatzstelle für Rücken-, Hals- und Oberarmmuskeln und befestigt die Arme beweglich am Rumpf. 4 Neben den Schlüsselbeinen bilden auch die Schulterblätter den Schultergürtel. a Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig b Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig c Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig d Alle Aussagen sind richtig 17 Behandlungsassistenz 2 Bei Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des Bewegungsapparates assistieren