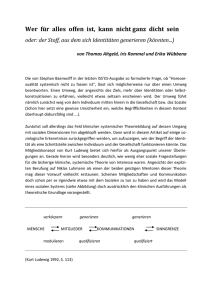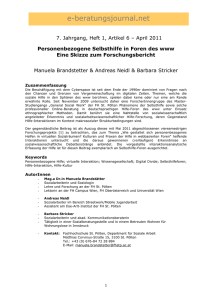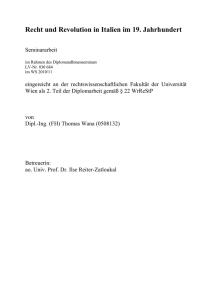Masterarbeit als PDF-Datei
Werbung

Master-Arbeit Thema: Zum Zusammenhang zwischen Sensomotorik und Schizophrenie und dessen möglicher Bedeutung für Prävention und Therapie Englische Übersetzung: The relationship between sensorimotor function and schizophrenia and the potential relevance for prevention und therapy Vorgelegt von: Ortrud Aden E-Mail: [email protected] M. A. Sonderpädagogik und Rehabilitationswissenschaften Erstleser: Axel Ramberg Zweitleser: Dr. phil. Joachim Kutscher Datum der Abgabe: 17.01.2012 Note: 1,0 Inhalt Einleitung .................................................................................................................................... 1 Teil I: Faktoren der kindlichen Entwicklung im Zusammenhang mit „Stress“ .......................... 4 1. Motorik und sensomotorische Entwicklung ....................................................................... 4 2. Sensorische Integration ....................................................................................................... 6 2.1. Diagnostik von Störungen der sensorischen Integration .................................................... 7 2.2. Störung der sensorischen Modulation................................................................................. 8 2.3. Ursachen der sensorischen Integrationsstörung ................................................................ 10 3. Bindungstheorie ................................................................................................................ 11 3.1. Feinfühligkeit und Bindungstypen.................................................................................... 13 3.2. Die desorganisierte Bindung ............................................................................................. 14 3.2.1. Beschreibung .............................................................................................................. 14 3.2.2. Ursachen der desorganisierten Bindung..................................................................... 16 3.2.3. Mögliche Folgen der unsicheren und/oder desorganisierten Bindung ....................... 18 3.3. Zusammenfassung ............................................................................................................ 18 4. Stress ................................................................................................................................. 19 4.1. Kontrollierbarer und unkontrollierbarer Stress ................................................................. 19 4.2. Neuroception – Defensives und soziales Verhalten ......................................................... 21 4.3. Komplexe Analyse durch die Großhirnrinde .................................................................... 23 4.4. Die psychische Entwicklung und die Entwicklung des Gehirns ...................................... 24 5. Zusammenfassung ............................................................................................................ 25 Teil II: Die Schizophrenie......................................................................................................... 26 1. Beschreibung ....................................................................................................................... 26 1.1. Definition des Krankheitsbilds ......................................................................................... 26 1.2. Verlauf der Erkrankung .................................................................................................... 28 1.3. Epidemiologie ................................................................................................................... 30 1.4. Zusammenfassung ............................................................................................................ 31 2. Äthiopathogenese.............................................................................................................. 32 2.1. Angeborene und psychosoziale Faktoren ......................................................................... 32 2.2. Informationsverarbeitung im Gehirn ................................................................................ 35 2.3. Erkenntnisse aus bildgebenden Verfahren ........................................................................ 36 2.4. Stress als Komponente bei der Krankheitsentstehung ...................................................... 37 2.5. Infektionen ........................................................................................................................ 38 2.6. Kognition, Motorik, Kommunkation und Verhalten ........................................................ 38 2.7. Angehörige schizophrener Patienten ................................................................................ 39 3. Das Erleben des Körpers bei der Schizophrenie ............................................................... 41 3.1. Ärztliche Diagnostik ......................................................................................................... 41 3.2. Bewegungstherapeutische Diagnostik allgemein ............................................................. 43 3.3. Körperbezogene Diagnostik im Hinblick auf Schizophrenie ........................................... 44 3.3.1. Die neurologisch-funktionelle Perspektive: ............................................................... 45 3.3.2. Erfassung des subjektiven Körpererlebens ................................................................ 46 3.3.3. Bewegungsbeobachtungen ......................................................................................... 50 3.4. Zusammenfassung ............................................................................................................ 52 Teil III: Prävention und Therapie ............................................................................................. 53 1. Der Begriff der Prävention ............................................................................................... 53 2. Prävention im Säuglingsalter ............................................................................................ 54 2.1. PEKiP................................................................................................................................ 56 2.1.1. Entwicklung des Konzepts ......................................................................................... 56 2.1.2. Empirische Überprüfung des Konzepts ..................................................................... 59 ii 2.2. Entwicklung im individuellenTempo ............................................................................... 62 3. Auffälligkeiten in Kindheit und Prodromalphase: ............................................................ 65 3.1.1. Neuromotorische Entwicklungsdefizite ..................................................................... 66 3.1.2. Neurological Soft Signs und Schizophrenie .............................................................. 66 3.1.3. Unspezifische Symptome in der Prodromalphase...................................................... 68 4. Therapie und Rückfallprophilaxe im Erwachsenenalter:.................................................. 69 4.1. Allgemeine Prinzipien ...................................................................................................... 69 4.2. Allgemeines zu körperbezogenen Interventionen ............................................................. 70 4.3. Interventionen in der akuten Phase ................................................................................... 72 4.4. Psychotherapie .................................................................................................................. 75 4.5. Psychoedukation ............................................................................................................... 77 4.5.1. Psychoedukation und Sensorische Integrationstherapie ............................................ 77 4.5.2. Sporttherapeutische Intervention im Zusammenhang mit Kognition ........................ 79 4.6. Postklinische soziotherapeutische Angebote .................................................................... 82 4.7. Schlussfolgerung für Therapie und Rückfallprophilaxe Erwachsener ............................. 84 Fazit ......................................................................................................................................... 85 Anhang ...................................................................................................................................... 88 Medizinische Fachbegriffe ....................................................................................................... 88 Literaturliste .............................................................................................................................. 92 Anmerkungen............................................................................................................................ 95 iii Einleitung Auf den ersten Blick scheint es zwischen Sensomotorik und Schizophrenie keinen Zusammenhang zu geben: In den einschlägigen Lehrbüchern über Schizophrenie wird die Sensomotorik nicht erwähnt; demzufolge finden auch Verfahren zu Prävention und Therapie im Zusammenhang mit Schizophrenie, die den Körper explizit einbeziehen, keine Erwähnung. Umgekehrt wird in der Regel in Lehrbüchern über Sensomotorik die Schizophrenie in der Regel nicht erwähnt. Ein möglicher Zusammenhang erschließt sich erst beim genaueren Hinsehen: So gehören einerseits zu den Symptomen der Schizophrenie häufig Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung. Andererseits findet die Entwicklung der Wahrnehmung in enger Verknüpfung mit der Entwicklung der Motorik statt; wesentliche diesbezügliche Grundlagen entwickeln sich in der Säuglingszeit. Die Entwicklung in der Säuglingszeit aber ist in hohem Maße abhängig von den Bezugspersonen. Aus diesen Vorüberlegungen heraus stelle ich folgende Hypothese auf: Unkontrollierbarer Stress in der Säuglingszeit, verursacht beispielsweise durch eine unsichere oder desorganisierte Bindung, trägt zu gestörter Sensomotorik bei. Diese Problematik zeigt sich oft bei der schizophrenen Erkrankung. Therapieund Präventionsansätze sollten diesen Gesichtspunkt berücksichtigen und körperbezogene Interventionen mehr in ihr Programm einbeziehen. Um diese Hypothese zu begründen, werde ich mich in den vier Kapiteln des ersten Teils zunächst mit verschiedenen Faktoren der kindlichen Entwicklung im Zusammenhang mit Stress befassen: Zunächst untersuche ich den Begriff der Motorik auf einer ganzheitlichen Ebene und stelle den Zusammenhang zwischen Motorik und Sensorik dar. Anschließend zeige ich anhand der Theorie der Sensorischen Integration die Entwicklung der Wahrnehmungsverarbeitung auf der Grundlage der Nahsinne, welche einen klaren Bezug zur Sensomotorik aufweisen. Diese Entwicklung ist störanfällig durch Stress, beispielsweise bei misslingender Emotionsregulation. Die Theorie der sensorischen Integration beschreibt zwar schlüssig den Zusammenhang zwischen Stress und problematischer Emotionsregulation einerseits und Störungen bei der Wahrnehmungsverarbeitung andererseits. Allerdings bleibt sie in Bezug auf die Ursachen dieser Entwicklung meiner Ansicht nach unklar; daher verweise ich im dritten Kapitel des ersten Teils auf die Bindungstheorie und zeige, dass die Qualität der Bindung eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Fähigkeit zur Emoti1 onsregulation spielt. Insbesondere untersuche ich die desorganisierte Bindungsorganisation, bei der einige Autoren Zusammenhänge zu einer späteren Erkrankung der Schizophrenie sehen. Dem Faktor Stress wird sowohl bei der Theorie der Sensorischen Integration eine wesentliche Bedeutung bei Fehlentwicklungen zugeschrieben, als auch bei der Bindungstheorie, ebenso bei der Erkrankung der Schizophrenie. Daher werde ich mich im vierten Kapitel des ersten Teils mit Beschreibungen verschiedener Stressreaktionen, mit den Auswirkungen von Stress in Bezug auf adäquate Situationswahrnehmung, soziale Wahrnehmung und auf die Entwicklung eines funktionsfähigen Gehirns als Voraussetzung für die adäquate Verarbeitungen von Sinnesreizen beschäftigen. Diese Ausführungen stützen den ersten Teil meiner Hypothese: Unkontrollierbarer Stress in der Säuglingszeit, verursacht beispielsweise durch eine unsichere oder desorganisierte Bindung, trägt zu gestörter Sensomotorik bei. Einzelne Erläuterungen dieses Teils, beispielsweise im Bezug auf die desorganisierte Bindung und die veränderte soziale Wahrnehmung bei Stress, verweisen bereits direkt auf die Schizophrenie, andere indirekt. Im zweiten Teil befasse ich mich mit dem Krankheitsbild der Schizophrenie. Dazu beschreibe ich im ersten Kapitel anhand zweier Lehrbücher das Krankheitsbild. Im zweiten Kapitel stelle ich verschiedene Ansichten zur Äthiopathogenese dar; im dritten Kapitel beschreibe ich das Erleben des Körpers in der Schizophrenie, zunächst aus ärztlicher, dann aus bewegungstherapeutischer und aus Sicht der Sensorischen Integration. Aus diesen Ausführungen ergibt sich der zweite Teil meiner Hypothese: Diese Problematik der gestörten Sensomotorik zeigt sich oft bei der schizophrenen Erkrankung. Präventions- und Therapieansätze sollten diesen Gesichtspunkt berücksichtigen und körperorientierte Interventionen mehr in ihr Programm einbeziehen. Im dritten Teil überprüfe ich diese Hypothese anhand von Studien, die in der Literatur beschrieben werden. Dazu erläutere ich zunächst den Begriff der Prävention. Anschließend befasse ich mich mit zwei Präventionsansätzen in der Säuglingszeit, die den Körper explizit einbeziehen. Zwar beziehen diese Ansätze sich nicht explizit auf Prävention im Hinblick auf Schizophrenie; aus den ersten beiden Teilen meiner Arbeit geht jedoch hervor, dass zum einen die elterliche Feinfühligkeit geschult werden kann. Zum anderen hat die motorische Entwicklung einen Einfluss auf die Verarbeitung von 2 Sinnesreizen, und gerade die Verarbeitung von Sinnesreizen wird langfristig bei der Erkrankung der Schizophrenie häufig zu einem Problem. Daher betrachte ich Präventionsansätze, die in der Säuglingszeit explizit die Motorik fördern, als besonders geeignet für die Prävention im Hinblick auf die Schizophrenie. Im nächsten Kapitel beschreibe ich die Zusammenfassungen mehrerer Studien, die belegen, dass Störungen der Motorik im mittleren Kindesalter - im Zusammenhang mit anderen Prädiktoren - einen möglichen Prädiktor für spätere Schizophrenie darstellen. Außerdem werde ich mich in diesem Kapitel kritisch mit einem Aufsatz auseinander setzen, der Prävention im Zusammenhang mit Schizophrenie ausschließlich als Rückfallprophylaxe für sinnvoll hält und sich explizit ausschließlich auf medikamentöse Prävention bezieht. Im letzten Kapitel des dritten Teils beschreibe ich Möglichkeiten der Rückfallprävention und Therapie nach einer oder mehreren psychotischen Episoden. Dabei erläutere ich Maßnahmen in der akuten Phase, Gesichtspunkte zur Psychotherapie, Psychoedukation und postklinische soziotherapeutische Angebote. Ich beschreibe jeweils die diesbezüglichen Richtlinien der Lehrbücher und dazu weitere Ansätze und ihre empirische Überprüfung, die den Körper explizit einbeziehen. Schließlich komme ich zu dem Ergebnis, dass die vorhandenen Studien grundsätzlich ausreichen, um meine These zu bestätigen. Weitere Studien, vor allem zum Langzeitverlauf und den speziellen Wirkfaktoren, halte ich dennoch für sinnvoll. Darüber hinaus halte ich auch Studien für sinnvoll, die den Kenntnisstand und die Einstellungen der verschiedenen in Prävention und Therapie involvierten Berufsgruppen in Bezug auf körperorientierte Angebote zum Gegenstand haben. Medizizische Fachausdrücke werden in dieser Arbeit mit * bezeichnet und alphabetisch geordnet im Anhang erklärt. Die Anmerkungen zu den durchnummerierten Fußnoten befinden sich ebenfalls im Anhang. 3 Teil I: Faktoren der kindlichen Entwicklung im Zusammenhang mit „Stress“ 1. Motorik und sensomotorische Entwicklung Der Schweizer Psychiater Scharfetter definiert Motorik: „Motorik ist Haltung und Bewegung des handelnden Menschen. In Mimik, Gestik, Haltung, Einzelbewegungen und kombinierten Bewegungsabläufen drücken sich sein Temperament, sein Selbstbewusstsein, seine Stimmung, seine Intelligenz, seine Wachheit, seine Gerichtetheit, sein Wollen, seine Triebe usw. aus“ (Scharfetter 2010, S. 266). Motorik betrachtet er als Verhalten, untrennbar mit Erfahrung und Lebensweise verknüpft: „Motorik ist Verhalten – und Verhalten eine Funktion der Erfahrung. (…) Die Motorik ist nur künstlich aus dem Ganzen des menschlichen Daseins (…) zu trennen. Es gibt uns ein Bild vom lebendig bewegten Menschen, von der Weise, wie er sich in der Welt befindet, wie er den Anspruch von Menschen und Dingen vernimmt, auffasst und beantwortet“ (ebd.) Durch den alltäglichen Sprachgebrauch sieht Scharfetter sich in dieser Sichtweise bestätigt, beispielsweise durch Redewendungen wie: „(…) Wir bringen einen anderen in eine Lage oder sehen uns selbst in eine bestimmte Lage versetzt. Wir richten jemanden durch Trost wieder auf, geben ihm Halt, stützen ihn (…) (Scharfetter 2010, S. 267). Die Motorik betrachtet er als ein individuelles Merkmal, welches sich auch im Zusammenhang mit der Sozialisation entwickelt: „Jeder Mensch hat seine ihm eigene, ihn als vererbtes Merkmal charakterisierende Motorik, die sich im Verlaufe seines Lebens und nach seiner persönlichen Eigenart und nach den Gebräuchen, Normen und Vorbildern seine Gruppe entwickelt. Sie wird von seiner jeweiligen Gesamtverfassung beeinflusst (…)“ (ebd.). Scharfetter sieht Motorik nicht ausschließlich als bewusste Handlung: „Ein großer Teil der Motorik läuft unwillkürlich, ohne Überlegung, Absicht, Bemühung ab. Viele Fertigkeiten (skills) erwerben wir übend und vollziehen sie dann als komplexe Handlungen ‚automatisch‘ (z.B. Schwimmen, Radfahren, Autorfahren), ohne die einzelnen Bewegungen jedesmal genau überwachen zu müssen“ (ebd.). Er betont, dass die Motorik früh gelernt wird, und zwar „nach angeborenen Schemata und in Nachahmung: Die Mimik am Gesicht der Mutter, das Handeln im Tasten, Greifen, Halten usw. Sie ist entscheidend für die Entwicklung des IchBewusstseins“ (Scharfetter 2010, S. 267 f.). 4 Pikler betont die Bedeutung der Motorik im Säuglingsalter: In dieser Phase stellt die Motorik nach ihrer Ansicht „eine[n] bedeutende[n] Teil aller Aktivitäten“ (Pikler 2001, S. 21) dar. Die Entwicklung der Bewegung sieht sie als einen Bestandteil eines „komplexen Prozesses“ (ebd.), zu dem verschiedene Bereiche gehören wie beispielsweise „Bewegung, Erkenntnis, Motivation usw.“ (ebd.). Diese Bereiche hängen „eng zusammen und wirken aufeinander ein“ (ebd.). „Als Ergebnis ihrer Forschungen erkennen auch Psychologen immer mehr die Bedeutung der aktiven Bewegung für die Entwicklung der psychischen Funktionen, so z. B. bei der Ausbildung des Körperschemas, der Orientierungsfähigkeit in der Außenwelt sowie bei der elementaren Begriffsbildung bzw. dem elementaren Denken“ (ebd.). Pikler bezieht sich unter anderem auf Held, der die Wichtigkeit der „kinästhetischen Rückmeldungen“ (Pikler 2001, S. 22) betonte. „Es sieht so aus, daß die Aktionen (…) mit ihren sensorischen Konsequenzen eine sehr wichtige Informationsquelle für die Funktion des Perceptionsprozesses[*] darstellen. Die Information dient zur Vervollkommnung der Organisation der Bewegungen der einzelnen Körperteile zueinander und zur Außenwelt. Daneben scheint es so, daß die verschiedenen Aspekte der Raumwahrnehmung Produkte innerer Spuren (internalized records) der Aktionen und deren sensorischen Konsequenzen sind" (Held 1966, in: Pikler 2001, S. 22) Pikler kritisiert, dass trotz des Wissens über die Bedeutung der aktiven Bewegung „das Interesse für ihre Entfaltung, für ihre Bedingungen und Auswirkungen bis heute gering [ist]“ (ebd.). Motorik und Sensorik hängen demnach eng zusammen. Im Säuglingsalter stellt die Motorik einen bedeutenden Anteil der Aktivität dar, aber auch im Erwachsenenalter drücken sich über die Motorik individuelle emotionale und sozialisationsbedingte Komponenten einer Person aus. Nicht jede motorische Handlung findet auf der bewussten Ebene statt, jedoch wirken sich motorische Handlungen auf das Körperschema und die Orientierungs- und Denkfähigkeit aus. Ayres beschäftigt sich mit der Verarbeitung vielfältiger Sinneswahrnehmungen im Gehirn und deren Auswirkungen auf Motorik und Verhalten. Den Prozess der Verarbeitung der Wahrnehmung nennt sie „Sensorische Integration“. 5 2. Sensorische Integration Die Theorie der sensorischen Integration beschreibt „die Zusammenhänge zwischen dem Gehirn und dem Verhalten“ (Bundy et al. 2007, S. 5). Die sensorische Integration definiert Ayres als „den neurologischen Prozess, der Sinneseindrücke aus dem eigenen Körper und aus der Umwelt organisiert und es uns somit ermöglicht, den Körper effektiv in der Umwelt einzusetzen“ (Ayres 1972a, S. 11, in: Bundy et al. 2007, S. 4 f.). Hesse und Prünte definieren genauer: „Bei der sensorischen Integration geht es darum, die zahllosen ‚Bits‘ an sensorischen Eindrücken zu filtern, zu organisieren und zu koordinieren, sie zu einem sinnvollen Ganzen zu integrieren, um eine angepasste Reaktion auf die Anforderungen der Umwelt zu ermöglichen“ (Hesse & Prünte 2004, S. 19). Die Reaktionen auf die Umwelt bestehen aus „motorische[n] Aktivitäten“ (Hesse und Prünte 2004, S. 30). Diese motorischen Aktivitäten sind wiederum mit einem „sensorischen Feedback“ (ebd.) verbunden. Der Kreislauf aus gelungener sensorischer Integration und adäquater motorischer Reaktion verstärkt sich in der Entwicklung selbst, so dass ein Kind ein Gefühl von „Kompetenz und Sicherheit“ (ebd.) entwickelt. Ayres unterscheidet zwischen „Fernsinnen“ (Hesse & Prünte 2004, S. 24) (Sehen und Hören), die meist bewusst wahrgenommen werden, und „Nahsinnen“ (ebd.). Bei den Nahsinnen legt sie besonderes Gewicht auf den „vestibulären[*]“ (ebd.) Sinn, den „taktilen[*]“ (ebd.) Sinn und den „propriozeptiven[*]“ (ebd.) Sinn. Die Verarbeitung dieser Sinneswahrnehmungen verläuft in der Regel automatisch und unbewusst, meist werden diese Wahrnehmungen erst dann bewusst, wenn eine Störung vorliegt, beispielsweise Schwindel oder Schmerzen (vgl. Hesse & Prünte 2004, S. 24 f.). Die Nahsinne tragen wesentlich zur Entwicklung des Körperschemas bei. Beim Körperschema „handelt es sich um eine Art innere Landkarte über die Beschaffenheit des eigenen Körpers und der Relation der Körperteile zueinander. Diese bietet einen relativ stabilen Bezugsrahmen, mit dessen Hilfe sensorische Eindrücke eingeordnet und verarbeitet werden können. Das Körperschema ist wichtig für die Handlungsplanung, darüber hinaus dient es als Grundlage für die Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls“ (Hesse & Prünte 2004, S. 27). Sinneseindrücke können demnach durch den Rahmen, den das Körperschema bietet, verarbeitet werden, ohne dass der Prozess der Verarbeitung explizit beachtet wird. Damit wird das Körperschema eine unbewusste Grundlage für die bewusste Handlungsplanung und ein gutes Selbstwertgefühl. 6 Das menschliche Gehirn ist ständig einer Vielzahl von Reizen ausgesetzt. Um eine sinnvolle Reaktion auf diese Reize zu ermöglichen, muss es diese „sensorische[n] Eindrücke … filtern, … organisieren und … integrieren“ (Hesse & Prünte 2004, S. 31), andernfalls würde das Gehirn „unter dem Bombardement sensorischer Eindrücke zusammenbrechen“ (ebd.). Wichtige Informationen müssen weiter geleitet – „gebahnt“ (Hesse & Prünte 2004, S. 32) - , unwichtige unterdrückt – „gehemmt“ (ebd.) werden. Die angemessene Verarbeitung relevanter Informationen erfordert ein „Gleichgewicht“ (ebd.) zwischen „Hemmung“ (ebd.) und „Bahnung“ (ebd.). „Werden sensorische Eindrücke nur ungenügend gehemmt, so dringen irrelevante Informationen zu höheren Strukturen des Gehirns vor und stören den Verarbeitungsprozess. (…) Auch eine ungenügende Bahnung von sensorischen Eindrücken wird als unangenehm erlebt: Fehlen propriozeptive[*] und vestibuläre[*] Informationen, so stellt sich Unsicherheit über die eigene Körperhaltung und die Schwerkraft ein. In Experimenten zur sensorischen Deprivation löst sich das Körperschema auf und es stellen sich Halluzinationen ein“ (ebd.) Demnach ist die adäquate Verarbeitung der Informationen der Nahsinne eine wesentliche Voraussetzung für die Informationsverarbeitung auf höherer Ebene. 2.1.Diagnostik von Störungen der sensorischen Integration Ayres Intention war es, „Zusammenhänge zwischen Schwierigkeiten in der Interpretation von Körper- und Umweltwahrnehmung und schulischen und motorischen Lernschwierigkeiten zu erklären“ (Bundy et al. 2007, S. 4). Eine „Untergruppe von lernbehinderten Menschen“ (ebd.) hat nach ihrer Ansicht „Defizite bei der Interpretation von Sinnesinformationen“ (ebd.), die zu diesen Schwierigkeiten beitragen können. Allerdings sind die Funktionen der sensorischen Integration der direkten Beobachtung nicht zugänglich. Zwar können „Defizite im Verhalten“ (Bundy et al. 2007, S. 4) beobachtet werden, die Schlussfolgerung einer Störung der sensorischen Integration beruht jedoch auf einer Annahme. Auch eine mögliche Verbesserung der sensorischen Integration kann nur aufgrund von Veränderungen des Verhaltens angenommen werden (vgl. Bundy et al. 2007, S. 4). Hesse und Prünte verweisen darauf, dass in der Literatur „diskrete sensorische und motorische Auffälligkeiten“ (Hesse & Prünte 2004, S. 84) als „Neurological Soft Signs“ (ebd.) bezeichnet werden: „Der Begriff ‚Neurological Soft Signs‘ umfasst drei Aspekte (…): Mit dem englischen Wort ‚signs‘ werden beobachtbare Verhaltensweisen bezeichnet. Im deutschsprachigen Raum wird 7 von Ausdruckssymptomen gesprochen, die von den Erlebnissymptomen – englisch: symptoms – zu unterscheiden sind. ‚Neurological‘ sind diese Auffälligkeiten, weil sie auf eine neurologische Funktionsstörung, auf eine Störung der zentralen Verarbeitung von sensorischen Eindrücken und der zentralen Steuerung motorischer Aktivitäten deuten. ‚Soft‘ sind sie, insofern sie nicht auf eindeutig lokalisierbare Funktionsstörungen verweisen und deshalb diagnostisch vieldeutig sind“ (Hesse & Prünte 2004, S. 85). Die Neurological Soft Signs können nach konkreten Testaufgaben beurteilt werden. Aus „Auffälligkeiten“ (ebd.) bei der Bearbeitung entsprechender Tests wird auf „Störungen der sensorischen Integration“ (ebd.) geschlossen. Diese Störungen werden allerdings häufig übersehen, „weil die entsprechenden Prozesse normalerweise automatisch ablaufen und daher als selbstverständlich gelten“ (Hesse & Prünte 2004, S. 19). Bundy et al. betonen, dass Ayres sich ausschließlich auf Kinder mit Lernschwierigkeiten bezogen hatte. Sie stellen explizit fest, dass bei Erkrankungen, die im Erwachsenenalter auftreten wie beispielsweise bei der Schizophrenie, nicht von einer „sensorisch-integrativen Dysfunktion“ (Bundy et al. 2007, S. 14) gesprochen wird. Ganz im Gegensatz dazu beschäftigen Hesse und Prünte sich explizit mit der Frage, ob eine Störung der sensorischen Integration einen der Faktoren darstellt, die eine Schizophrenie begünstigt (vgl. Hesse, Prünte 2004, S. 83 f.). Sie beschreiben ein spezielles Syndrom, welches sie im Zusammenhang mit psychiatrischen Patienten für bedeutsam halten als „Störung der sensorischen Modulation“ (vgl. Fisher 1998; Royeen & Lane 1998, in: Hesse & Prünte 2004, S. 44). 2.2.Störung der sensorischen Modulation Ayres definierte den Begriff Modulation im Zusammenhang mit der Sensorischen Integration als die „Regulation der zentralnervösen Aktivität durch das Gehirn selbst” (Ayres 1979, in: Bundy et al. 2007, S. 10). Störungen dieser Modulation vergleichen Bundy et al. mit Störungen bei der Feineinstellung eines Radiosenders. Durch diese Störungen wird beim Radio ein Rauschen ausgelöst, während nur bei störungsfreier Einstellung der Sender „klar und rauschfrei“ (Bundy et al. S. 10) gehört werden kann. Reize aus der Umgebung, die „objektiv weder bedrohlich noch schädlich sind“ (Bundy et al. S. 11) werden bei einer Störung der sensorischen Modulation entweder als bedrohlich interpretiert, was sich in einer „Überreaktion“ (ebd.) in Form von verschiedenen Stressreaktionen zeigt, oder aber sie werden allem Anschein nach gar nicht 8 oder verzögert und abgeschwächt wahrgenommen, was sich in einer verzögerten abgeschwächten Reaktion zeigt. Diese Vorgänge beziehen sich auf „Sensorische Defensivität“ (ebd.), „Schwerkraftunsicherheit“ (ebd.), „Aversive Reaktion auf Bewegung“ (ebd.) und „sensorische Unterempfindlichkeit“ (ebd.). Stressreaktionen stellen für Bundy et al. demnach eine Folge der Modulationsstörung dar. Hesse & Prünte beschreiben bei der Störung der sensorischen Modulation „widersprüchliches Verhalten“ (Hesse & Prünte 2004, S. 44): „Einige Kinder zeigen sowohl eine Über- wie Unterempfindlichkeit gegenüber verschiedenen sensorischen Eindrücken einer oder mehrerer Modalitäten. So reagieren einige Kinder manchmal auf Berührungen stark emotional, wobei sie die taktilen Eindrücke als schmerzhaft empfinden und zu vermeiden suchen. Zu anderer Zeit spüren sie selbst starke taktile Eindrücke wie kleinere Wunden oder Schnitte nicht. Manchmal reagieren Kinder auf kleine Bewegungen oder Drehungen bereits mit Schwindel und Unwohlsein, zeigen sich schwerkraftunsicher und vermeiden es, die Beine vom Boden zu heben. Dann wieder suchen dieselben Kinder starke vestibuläre Stimulation, indem sie wild toben und extrem schaukeln“ (ebd.). Die Störung der sensorischen Modulation bringen die Autoren mit einer „Dysfunktion im limbischen System“ (vgl. Royeen & Lane 1998, in: Hesse & Prünte 2004, S. 44) in Verbindung. Das limbische System ist ein „gürtelförmig um den Hirnstamm gruppiertes Areal neuronaler Netze, die intensiv miteinander sowie mit höher- und tiefer gelegenen Netzwerken des Gehirns verbunden sind. Es erhält seine Informationen parallel zu diesen anderen Hirnregionen und wirkt modulierend auf die dort ablaufenden Verarbeitungsprozesse ein. Es hat eine zentrale Bedeutung für die Entstehung von Emotionen (Amygdala), für Lern- und Gedächtnisleistungen (Hippocampus) und für die Regulation vegetativer Funktionen (Hypothalamus)“ (Hüther 2004, S. 119). Auch Hesse & Prünte betonen die Funktion der emotionalen Modulation beim limbischen System; sie ergänzen: „Das limbische System ist in erster Linie für die emotionale Bewertung der Informationen zuständig. (…) Einfache emotionale Reaktionen haben evolutionär betrachtet hohen Überlebenswert, das limbische System steuert entsprechend die Kampf-oder-Flucht-Reaktion“ (Hesse & Prünte 2004, S. 23). Außerdem - so ergänzen Hesse & Prünte - kann das limbische System als „Modulationszentrum für alle Sinnessysteme gelten … Dabei löst die fehlende Übereinstimmung von erwarteten und tatsächlich bemerkten Sinneseindrücken Stress und Angst aus, was wiederum zu gesteigerter Erregung und Aufmerksamkeit führt. Angst verstärkt so eine übermäßige Sensibilität gegenüber sensorischen Sinneseindrücken (…). Gelingt es innerhalb des 9 limbischen Systems nicht, die Emotionen angemessen zu regulieren, so sind die beschriebenen Störungen der sensorischen Integration zu erwarten (Hesse & Prünte 2004, S. 44). Hesse & Prünte beschreiben Angst als verstärkenden Faktor der übermäßigen Sensibilität. Angemessene Emotionsregulation ist demnach die Voraussetzung für eine ungestörte sensorische Integration, ganz besonders bei übermäßiger Sensibilität; für die Emotionsregulation aber ist das limbische System zuständig. 2.3.Ursachen der sensorischen Integrationsstörung Bei der Beschreibung der Ursachen der sensorischen Integrationsstörung zitieren Bundy et al. Short-DeGraff (1988, in: Bundy et al. S. 12): „Die Theorie der Sensorischen Integration geht davon aus, dass das Gehirn bei der Geburt noch nicht ausgereift ist, und dieser Zustand der Unreife (bzw. Dysfunktionalität) bei manchen Kindern [mit] Lernschwierigkeiten bestehen bleibt.“ Damit bleiben die Autoren bei der Frage nach der Ursache der sensorischen Integrationsstörung meiner Ansicht nach unklar. Es wird nicht deutlich, warum diese Dysfunktionalität bei manchen Kindern bestehen bleibt und bei anderen offensichtlich nicht. Hesse & Prünte gehen auf häufig geäußerte Kritik am Konzept der sensorischen Integration ein, die unter anderem von Brüggebors formuliert wurde: Das Konzept reduziere „die komplexen Wechselwirkungen von biologischen, psychologischen und sozialen Phänomenen einseitig auf neuronale Prozesse“ (vgl. Brüggebors 1992; 1996, in: Hesse & Prünte 2004, S. 42). Hesse & Prünte sind der Ansicht, dass diese Kritik teilweise zu Recht besteht. Ayres habe sich beispielsweise sehr deutlich gegen psychologische Deutungen ausgesprochen (vgl. Hesse & Prünte 2004, S. 42). Hesse & Prünte hingegen bevorzugen das „bio-psycho-soziale Rahmenmodell“ (ebd.) und beschreiben die Wirkungen, die die sensorische Integrationsstörung des Kindes auf die weitere Entwicklung des Kindes und auf sein Umfeld hat: Dem Kind gelingen viele Dinge nicht, es entwickelt „Bewältigungsmechanismen …, die zwar kurzfristig günstig, langfristig aber eher schädlich sind“ (ebd.) Daraufhin wird es von seiner Umgebung möglicherweise als „tollpatschig, ungeschickt, dumm oder aggressiv eingeschätzt und möglicherweise abgelehnt“ (ebd.). Hierdurch kommt es zu einer negativen Spirale. 10 Der Umwelt kommt für Hesse & Prünte lediglich im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, die sie „bereit stell[t], damit sich das Kind entsprechende sensorische Stimulation suchen kann“ (Hesse & Prünte 2004, S. 31) eine wesentliche Bedeutung zu. Als problematisch werden zu viel Fernsehen oder Computerspielen, oder aber eine „übermäßig reinliche oder überfürsorglich-ängstliche Erziehung“ (ebd.) angesehen. Hesse & Prünte interpretieren demnach den bio-psycho-sozialen Ansatz dahingehend, dass die Ursache dieser Negativspirale hauptsächlich in der Störung des Kindes liegt. Read & Gumley kritisieren im Zusammenhang mit der Entstehung der Schizophrenie diese Variante des bio-psycho-sozialen Ansatzes, die hauptsächlich von einer angeborenen Störung des Kindes in Form einer „Stress-Disposition“ (Read & Gumley 2009, S. 253) ausgeht. Sie sind der Ansicht, gerade diese Disposition beruhe auf negativen Umwelteinflüssen, verursacht durch traumatische Erfahrungen mit frühem Bezugspersonen (vgl. ebd.). Ich werde weiter unten näher darauf eingehen. Im Kontext mit der sensorischen Modulationsstörung beschreiben insbesondere Hesse & Prünte den Zusammenhang zwischen Stressreaktionen und Angst, misslingender Emotionsregulation und Störungen der sensorischen Integration meiner Ansicht nach schlüssig: Das limbische System spielt über die Regulierung der Emotionen eine Schlüsselrolle bei der Verarbeitung von Sinnesreizen. Wenn die Emotionsregulation nicht adäquat gelingt, trägt das limbische System zu einer sich selbst unterhaltenden, negativen Spirale von fehlender Übereinstimmung zwischen erwarteter und tatsächlicher Wahrnehmung einerseits und Angst bzw. Stress andererseits bei. Negative Reaktionen aus der Umwelt verstärken diese Spirale. Es stellt sich allerdings die Frage, warum dem limbischen System die Regulierung der Affekte nicht immer gelingt, also nach den tieferen Ursachen dieser sensorischen Modulationsstörung. Hier bleibt die Theorie der sensorischen Integration meiner Ansicht nach unklar. In Bezug auf die Emotionsregulation bietet die Bindungstheorie schlüssige Ansätze. 3. Bindungstheorie John Bowlby, ein Kinderpsychiater und Psychoanalytiker aus London, der in den fünfziger Jahren von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beauftragt worden war, einen Bericht über „die Befindlichkeit von Eltern- und heimatlos gewordenen Kindern, besonders von Kriegsweisen“ (Brisch 2011, S. 125) anzufertigen, begründete die 11 Bindungstheorie, die von der psychoanalytischen Sichtweise abweicht. Bowlby fand heraus, dass der Verlust der Bindungspersonen weltweit auf die Entwicklung der Kinder einen bedeutenden Einfluss hatte. Brisch beschreibt im Zusammenhang mit der Bindungstheorie verschiedene „motivationale Systeme“ (Brisch 2011, S. 125): Besondere Bedeutung haben die motivationalen Systeme der „Bindung“ (Brisch 2011, S. 126) und der „Exploration“ (ebd.). Die Bindungstheorie besagt, „dass der Säugling im Laufe des ersten Lebensjahres auf der Grundlage eines biologisch angelegten Verhaltenssystems eine starke emotionale Bindung zu einer Hauptbindungsperson entwickelt“ (Brisch 2011, S. 126). Wenn ein Säugling Angst erlebt, aktiviert er sein „‘Bindungssystem‘ als innere Verhaltensbereitschaft“ (ebd.). Bowlby (2008, S. 21): „Unter ‚Bindungsverhalten‘ verstehe ich jegliches Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, die Nähe eines vermeintlich kompetenteren Menschen zu suchen oder zu bewahren, ein Verhalten, das bei Angst, Müdigkeit, Erkrankung und entsprechendem Zuwendungs- oder Versorgungsbedürfnis am deutlichsten wird.“ Dieses Bindungsverhalten, das bei Kleinkindern beobachtet wird, tritt auch in späteren Lebensphasen auf; auch Erwachsene finden es beruhigend, zu wissen, dass sie in problematischen Situationen einen vertrauten Menschen um Hilfe bitten können (vgl. ebd). Kinder zeigen dieses Bindungsverhalten in der Regel der Person, mit der sie am meisten zusammen sind, meist der Mutter. In Abwesenheit dieser Person zeigen sie es auch anderen Menschen, die sie gut kennen, selten „sympathischen Fremden“ (Bowlby 2008, S. 22). „Dauerhafte Bindungen knüpfen Kinder nur zu wenigen Menschen, während sich ihr Bindungsverhalten (situationsabhängig) durchaus auf mehrere Personen richten kann. Kinder, denen diese Differenzierung misslingt, entwickeln im Allgemeinen ernste psychische Störungen“ (ebd.). Wenn ein Kind „eine sichere Bindung emotional erfährt“ (Brisch 2011, S. 126), wird das Motivationssystem der „Exploration“ (ebd.) aktiviert, also der „Neugier und Entdeckungsfreude“ (ebd.). Bindung ohne Exploration wäre nicht förderlich für die Entwicklung des Säuglings: „Der Säugling würde alle möglichen Außenwahrnehmungsstimuli über die verschiedensten Wahrnehmungskanäle vermissen, sodass die wahrnehmenden Sinne in vielen Bereichen verkümmern könnten“ (ebd.) 12 Zimmermann & Spangler betonen die Bedeutung der Bindungserfahrung für die Emotionsregulation: „Bindungserfahrungen sind Erfahrungen der Regulation negativer Gefühle und bilden die Grundlage für individuelle Handlungsmuster im Umgang mit emotionaler Belastung“ (Zimmermann & Spangler 2008, S. 699). Die Bindungserfahrung ist demnach sowohl für die Exploration und die Entwicklung der wahrnehmenden Sinne als auch für die Emotionsregulation entscheidend. 3.1. Feinfühligkeit und Bindungstypen Ainthworth (1977, in: Brisch 2011, S. 127), eine Mitarbeiterin von Bowlby, fand heraus, dass das „feinfühlige Pflegeverhalten der Bindungsperson“ (ebd.) eine besondere Bedeutung bei der Entwicklung der Bindung hat. „Dies bedeutet, dass die Pflegeperson die Signale des Säuglings richtig wahrnimmt und sie ohne Verzerrungen durch eigene Bedürfnisse und Wünsche auch richtig interpretiert“ (ebd.). Ainthworth untersuchte das Bindungsverhalten von Kindern im Alter von 12 bis 18 Monaten mit Hilfe einer standardisierten Untersuchung, der „Fremden Situation (strange situation)“ (Brisch 2011, S. 128). Dabei werden die Kinder und die Interaktionen zwischen Mutter und Kind im Hinblick auf ihr Bindungsverhalten beobachtet, und zwar bei acht Episoden, bei denen sich die Mutter „von ihrem Kind zweimal trennt und nach einigen Minuten wieder mit ihm zusammenkommt“ (ebd.). Ainthworth stellte fest, dass sich drei Bindungsmuster reliabel voneinander unterscheiden lassen: die „sichere Bindung (Typ B)“ (ebd.) entwickelt sich, wenn die Bezugsperson auf die Bedürfnisse des Säuglings feinfühlig reagiert. Der Säugling wird die Bezugsperson „bei Bedrohung und Gefahr als ‚sicheren Hort‘ bzw. ‚Hafen‘ und mit der Erwartung, Schutz und Geborgenheit zu finden, aufsuchen …“ (ebd.). Zimmermann & Spangler betonen hier eine „effektive[…] soziale[…] Emotionsregulation“ (Zimmermann & Spangler 2008, S. 689). Die „unsicher vermeidende Bindungsqualität (Typ A)“ (Brisch 2011, S. 128) entwickelt sich, wenn die Bezugsperson auf die Bedürfnisse des Kindes „eher zurückweisend“ (Brisch 2011, S. 128) reagiert. Der Säugling äußert weniger Bindungsbedürfnisse, an den Kortisolwerten* lässt sich jedoch erhöhter innerer Stress feststellen. Die Emotionen werden nicht kommuniziert, die Emotionsregulation erfolgt durch „Ausdruckskontrolle“ (Zimmermann & Spangler 2008, S. 690), 13 Bei extremer Belastung zeigen diese Kinder dennoch Bindungsverhalten, und die Mütter reagieren darauf, „die ‚Schwelle‘ für Bindungsverhalten [liegt] sowohl bei den Kindern als auch bei ihren Müttern höher … als bei Mutter-Kind-Paaren, die auf einer sicheren Bindungsbasis interagieren“ (Brisch 2011, S. 128). Die „unsicher-ambivalente Bindungsqualität“ (ebd.) entwickelt sich, wenn die Bezugsperson „manchmal zuverlässig und feinfühlig, ein anderes Mal aber eher mit Zurückweisung und Ablehnung“ (ebd.) reagiert. Die Kinder lassen sich nach einer Trennung nur schwer wieder beruhigen. Sie klammern sich einerseits an die Mutter, andererseits „strampeln sie und treten mit den Füßchen nach ihr“ (vgl.ebd.). Die Nähe zur Bezugsperson „führt … nicht zu Beruhigung und Sicherheit…“ (Zimmermann & Spangler 2008 S. 690). Ein viertes Muster, das „unsicher-desorganisierte[...] und desorientierte[...] Muster (Typ D)“ (Brisch 2011, S. 128) wurde später als eigenständiges Muster hinzugefügt. Das Bindungsverhalten der Kinder im Alter von einem Jahr determiniert die weitere Entwicklung, allerdings nicht ausschließlich, Faktoren im weiteren Leben haben ebenfalls eine große Bedeutung (vgl. Brisch 2011, S. 132). Hesse und Prünte beschreiben das limbische System als zuständig für die Regulationen der Emotionen. Bei einer Dysfunktion kommt es zu einer Störung der sensorischen Modulation, mit weitreichenden Folgen. Im Zusammenhang mit der Bindungstheorie wird deutlich, dass die Regulation der Emotionen mit der Organisation der Bindung zusammenhängt. 3.2. Die desorganisierte Bindung 3.2.1. Beschreibung Die „desorganisierten Bindungsverhaltensweisen (…) sind insbesondere durch motorische Sequenzen von stereotypen Verhaltensweisen gekennzeichnet, oder die Kinder halten im Ablauf ihrer Bewegungen inne und erstarren für die Dauer von einigen Sekunden, was auch als ‚Einfrieren‘ bezeichnet wird. Solche tranceartigen Zustände erinnern an dissoziative Phänomene. Nach einer Trennung von der Mutter laufen manche desorganisierten Kinder bei der Wiederbegegnung mit der Mutter auf diese zu, halten auf halben Weg inne, drehen sich plötzlich um, laufen von ihr weg und ‚oszillieren‘ so in ihrem motorischen Verhalten ‚vor und zurück‘. Wieder andere 14 zeigen vorwiegend nonverbal deutliche Anzeichen von Angst und Erregung, wenn sie wieder mit ihrer Bindungsperson zusammenkommen“ (Brisch 2011, S. 128 f.). Auch Kinder, die sicher gebunden sind, können für kurze Zeiträume desorganisierte Verhaltensweisen haben, bei allen drei Bindungsmustern kann die desorganisierte Bindung als „zusätzliche Kategorie vergeben werden“ (Brisch 2011, S. 129). Zimmermann & Spangler beschreiben das desorganisierte Bindungsmuster: „Desorganisierte Bindungsmuster sind gekennzeichnet durch die Abwesenheit einer klaren Bindungsverhaltensstrategie oder eines klaren Ziels, nach einer Trennung wieder Nähe herzustellen (…1) oder einer kohärenten Strategie, emotionale Erregung zu regulieren (…2)“ ( Zimmermann & Spangler 2008, S. 691). Downing betont, dass bei einem Kind mit einer Bindungsorganisation vom Typ D „die Furcht den dominanten Faktor bildet“ (Downing, 2007, S. 348). Zwei Verhaltensweisen des hebt er besonders hervor: • „die Fragmentierung der Bewegungen und • das plötzliche tranceartige Einfrieren der Bewegungen“ (ebd.). In der Körpertherapie gibt es, auch wenn eindeutige empirische Nachweise bisher fehlen, einige Parallelen zu dem „schizoide[n] Typ[*]“ (ebd.): „Hierunter versteht man ein Kind, das aus tief empfundener Angst vor feindlichen mütterlichen Äußerungen seinen ganzen Körper in einer fragmentierten, asymmetrischen Weise verhärtet hat. Dadurch hat es sich selbst die Möglichkeit genommen, Zugang zu anderen Formen eines tiefen emotionalen Kontaktes zu finden“ (ebd., Hervorhebung von mir). Brisch rechnet die desorganisierte Bindung zu den unsicheren Bindungen, da bei diesen Kindern am Speichel-Kortisol* ebenso erhöhte Stresswerte gemessen wurden wie bei den anderen Kindern mit unsicherer Bindung. Die betroffenen Kinder entwickeln „einander widersprechende[...] innere[...] Arbeitsmodelle“ (vgl. Brisch 2011, S. 129). Grossmann & Grossmann betonen, dass viele Autoren die desorganisierte Bindung mit Traumen und Dissoziation in Verbindung bringen (vgl. Grossmann & Grossmann 2008, S. 229) 3. Die Kinder haben „keine durchgängige Strategie, viele Widersprüche oder Störungen, z.B. Erstarrungen, Absenzen, Stereotypien, Angst vor [der] Bindungsperson, Verlust der Orientierung an der BP“ (Grossmann & Grossmann 2008, S. 227). Diese Verhaltensweisen sind oft nur für einen sehr kurzen Zeitraum sichtbar (vgl. ebd., Fußnote *). Die desorganisierte Bindung erscheint „in vielerlei Form als Störungen innerhalb der drei organisierten Bindungsmuster“ (Grossmann & Grossmann 2008, S. 228). Aus „statistischen Gründen“ (ebd.) werde allerdings häufig von einem vierten Bindungsmuster ausgegangen. Bei den betroffenen Kindern lassen sich die 15 „höchsten Indikatoren von Stress“ (Grossmann & Grossmann 2008, S. 229)4 nachweisen. Die desorganisierte Bindung zeigt sich demnach auch bei motorischen Verhaltensweisen und geht mit den höchsten Stressindikatoren einher. Es erscheint meiner Ansicht nach denkbar, dass insbesondere die desorganisierte Bindungsorganisation die Entstehung einer Störung der sensorischen Modulation begünstigt, da die Emotionsregulation hier besonders problematisch scheint. 3.2.2. Ursachen der desorganisierten Bindung Die Mütter der desorganisiert gebundenen Kinder werden von diesen nicht nur als Sicherheit gebend erlebt, sondern manchmal auch als „Quelle der Angst und Bedrohung“ (Brisch 2011, S. 129), entweder, weil sie sich aggressiv verhielten, oder weil sie sich selbst ängstlich zeigten, was in ihrer Gestik und Mimik und in dem Klang ihrer Sprache zum Ausdruck kommt (ebd.). Für Erwachsene wurden durch das „Erwachsenen-Bindungsinterview“ (Brisch 2011, S. 131) Klassifikationen entwickelt5; diese „… Verfahren überprüfen die Bindungsrepräsentation der Erwachsenen und führen zu Ergebnissen mit Kategorien wie ‚sicher‘ (free-autonomous), ‚unsicher-vermeidend‘ (dismissive), ‚unsicher-ambivalent‘ (embeshed) sowie ungelöste Traumatisierung (unresolved loss and trauma)“ (ebd.). Es hat sich gezeigt, dass die Bindungsrepräsentationen der Eltern eine partielle Vorhersage für die Bindungsmuster der Kinder im Alter von einem Jahr erlauben, allerdings kann das Bindungsverhalten des Kindes gegenüber Vater und Mutter unterschiedlich sein (Brisch 2011, S. 132). „Aufgrund der bis jetzt gefundenen Zusammenhänge kann vermutet werden, dass ein ungelöstes Trauma der Mutter und/oder des Vaters und/oder des Kindes selbst zu entsprechenden Störungen in der ganz frühen Interaktion zwischen Eltern und Säugling führt und auch die physiologische Regulationsebene beeinträchtigt“ (ebd.). Ein desorganisiertes Bindungsverhalten mit einer desorganisierten inneren Repräsentation der Bindung kann die Folge davon sein (vgl. ebd.). Möglicherweise beeinflusst aber auch eine angeborene Disposition des Säuglings die Entwicklung der Bindungsorganisation: „Säuglinge mit einer „genetischen Veränderung im Dopamin[*]-Regulationsystem“ (ebd.) könnten eher anfällig dafür sein, einen desorganisierten Bindungsstil zu entwickeln. 16 Im Zusammenhang mit angeborenen Faktoren griff Bowlby die Frage auf, ob bestimmte Eigenschaften wie „Frühreife, Erkrankungen oder der schwierige Charakter des Kindes“ (Bowlby 2008, S. 69) eine Spirale in Gang setzt, die ein negatives Verhalten der Mütter verstärkt, vor allem, wenn diese selbst „infolge eigener schlimmer Kindheitserfahrungen eine psychische Störung entwickelt (…)“ (ebd.) haben. Zimmermann & Spangler beschreiben verschiedene Verhaltensweisen, die schon bei Neugeborenen die Entwicklung bestimmter Bindungstypen begünstigen. Eine sichere Bindung wird beispielsweise begünstigt durch „Orientierungsfähigkeit (…) und wache Aufmerksamkeit sowie eine geringe Irritierbarkeit“ (Zimmermann & Spangler 2008, S. 695). Eine unsichere Bindung hingegen findet sich häufiger bei Kindern, die „schon als Neugeborene eine geringe Fähigkeit besitzen (…), ihren emotionalen Zustand zu regulieren“ (ebd.). Read & Gumley hingegen führen eine Metaanalyse an, die belegt, dass eine frühe desorganisierte Bindung nicht aufgrund „temperamentbedingter“ oder „genetischer Faktoren“ entsteht6. Bowlby fand Hinweise darauf, dass sich „schwierige Kinder, von wenigen Ausnahmen abgesehen, bei sensiblem Pflegeverhalten positiv (…7), vermeintlich ‚pflegeleichte‘ Babys bei unsensibler Behandlung hingegen negativ entwickeln (…8)“ (Bowlby 2008, S. 77, Fußnote 4). Brisch et al. belegten die Wirksamkeit einer psychotherapeutischen Intervention von Eltern neurologisch erkrankter Frühgeborener: Unabhängig von der mütterlichen Bindungsrepräsentation entwickelten diese Kinder signifikant häufiger eine unsichere Bindung als Frühgeborene, die nicht neurologisch erkrankt waren. Nach einer psychotherapeutischen Intervention zeigte sich dieses Ergebnis nicht mehr (vgl. Brisch et al. 2003a, in: Brisch 2011, S. 130). Auch Zimmermann & Spangler weisen auf Studienergebnisse hin, nach denen die mütterliche Feinfühligkeit nachgewiesenermaßen durch entsprechende Trainings erhöht werden konnte, der Anteil sicher gebundener Kinder stieg dadurch langfristig (vgl. Zimmermann & Spangler 2008, S. 695) Demnach scheint bei der Entwicklung der Bindung die Feinfühligkeit der Bezugsperson gerade bei „schwierigen“ Neugeborenen eine entscheidende Rolle zu spielen, und diese Feinfühligkeit scheint auch zumindest teilweise erlernbar zu sein. 17 3.2.3. Mögliche Folgen der unsicheren und/oder desorganisierten Bindung Kinder mit unsicherer Bindung zeigen im Kindergartenalter „weniger prosoziale Verhaltensweisen und eher aggressive Interpretationen des Verhaltens ihrer Spielkameraden“ (vgl. Suess et al. 1992, in: Brisch 2011, S. 127). „Im Jugendalter sind sie eher isoliert, haben weniger Freundschaftsbeziehungen und schätzen Beziehungen insgesamt als weniger bedeutsam für ihr Leben ein“ (Brisch 2011, S. 127). Brisch erwähnt Zusammenhänge zwischen desorganisierter Bindung und verschiedenen psychiatrischen Krankheitsbildern, jedoch erwähnt er keinen expliziten Zusammenhang zur Schizophrenie. Allerdings konstatiert er: „Kinder, deren Bindungsqualität als desorganisiert oder bindungsgestört qualifiziert wurde, haben große Schwierigkeiten in der Affektregulation, weil mit dem Fehlen eines organisierten Bindungsmusters auch die Ich-Funktionen und die Differenzierungen in Selbst- und Objektrepräsentanzen nicht ausreichend entwickelt sind“ (Brisch 2011, S. 133). 3.3.Zusammenfassung Eine sichere Bindung zeigt sich unter anderem darin, dass ein Säugling, nach gelungener Emotionsregulation Explorationsverhalten zeigt. Bei einer unsicheren Bindung und insbesondere bei der desorganisierten Bindung gelingt die Emotionsregulation oft weniger, was sich auch in erhöhten Stressparametern zeigt. Eine Dysfunktion des limbischen Systems, welches die Emotionsregulation steuert, kann eine Störung der sensorischen Modulation zur Folge haben. Da die Emotionsregulation mit der Bindungsorganisation zusammenhängt, ist es meiner Ansicht nach denkbar, dass eine unsichere und insbesondere eine desorganisierte Bindung zu der Störung der sensorischen Modulation beitragen.. Die Bindungsrepräsentationen der Eltern haben einen Einfluss auf die Bindungsorganisation der Kinder; insbesondere unverarbeitete Traumata der Eltern führen oft auch auf physiologischer Ebene zu einer desorganisierten Bindungsorganisation und repräsentation bei dem Kind. Unterschiedliche Dispositionen des Neugeborenen beeinflussen das spätere Bindungsverhalten; jedoch konnte gezeigt werden, dass Feinfühligkeit der Bezugspersonen für die weitere Entwicklung eine größere Bedeutung hatten als die Disposition des Säuglings. Die Feinfühligkeit der Bezugspersonen konnte durch entsprechende Interventionen auch langfristig günstig beeinflusst werden. 18 Sowohl in der Theorie der Sensorischen Integration als auch in der Bindungstheorie ist von „Stress“ die Rede; daher werde ich im folgenden Kapitel diesen Begriff genauer untersuchen. 4. Stress Seyle führte den Begriff Stress in den 1940er und 1950er Jahren ein. Dieses Modell erwies sich als sehr aussagekräftig und wurde im Lauf der Zeit die Grundlage für viele weitere Modelle (vgl. Klapp & Peters 2011, S. 43). 4.1.Kontrollierbarer und unkontrollierbarer Stress Hüther unterscheidet zwischen „kontrollierbare[n] Belastungen“ (Hüther 2007, S. 50) einerseits und „unkontrollierbaren Stressreaktion[en]“ (ebd.) andererseits. Wenn eine Belastung wiederholt auftritt und bewältigt wird, sich also als „kontrollierbar[...]“ (ebd.) erweist, werden die „neuronalen Netzwerke und Verschaltungen“ (ebd.), die in die erfolgreiche Bewältigung einbezogen waren, stabilisiert und gebahnt, ihre „Effizienz“ (ebd.) wird verbessert. Demnach sind „komplexe, verschiedenartige und vielseitig kontrollierbare Belastungen … offenbar notwendig, um die individuellen genetischen Möglichkeiten zur Strukturierung eines … Gehirns nutzen zu können“ (ebd.). Wenn allerdings eine Situation mit den bisher erlernten Verhaltensweisen nicht bewältigt werden kann, kommt es zu einer „‘unkontrollierbaren Stressreaktion‘“ (ebd.). Dabei kommt es unter anderem zu einer vermehrten „Cortisolausschüttung[*] durch die Nebennierenrinde“ (Hüther 2007, S. 51), die lange anhaltende Erhöhung des „Glucokorticoid[*]-Spiegel[s]“ (ebd.) bewirkt eine „Destabilisierung der bereits angelegten (…) neuronalen Netzwerke“ (ebd.). Es kann unter anderem zum Absterben von „Pyramidenzellen im Hippokampus[*]“ (ebd.) kommen. Verhaltensweisen, die bereits erlernt worden sind, können dabei wieder verloren gehen oder ausgelöscht werden: „Hohe Spiegel von Glucokortikoiden[*], wie sie physiologischerweise bei unkontrollierbarem Stress erreicht werden, fördern die Auslöschung von erlernten Verhaltensreaktionen, (…) die für eine erfolgreiche Beendigung des Stress-Reaktionsprozesses ungeeignet sind“ (ebd.). Unkontrollierbare Belastungen führen demnach zunächst zur Destabilisierung der neuronalen Verschaltungen im Gehirn. Gerade diese Belastungen ermöglichen allerdings 19 daraufhin auch die Entwicklung völlig neuer Verhaltensmuster. Diese Prozesse sind besonders in „Umbruchsphasen wie … [der] … Pubertät, die zu psychosozialer Neuorientierung zwingen [und] besonders häufig mit lang anhaltenden, unkontrollierbaren Belastungen einhergehen“ (ebd.) relevant. Erst dann, wenn die Bewältigung über längere Zeiträume auch durch neue Verhaltensweisen nicht gelingt, ist die physische und psychische Gesundheit gefährdet. Damit können beide Stressreaktionen sinnvoll für die menschliche Entwicklung sein: Bei der kontrollierbaren Stressreaktion wird das Gehirn strukturiert, und die Strukturen festigen sich. Bei der unkontrollierbaren Stressreaktion hingegen besteht die Möglichkeit, unbrauchbar gewordene Verhaltensweisen auszulöschen und völlig neue zu erlernen. Auch Klapp & Peters unterscheiden zwischen Stress, auf den eine adäquate Antwort gefunden wird einerseits und Stress, bei dem dies nicht gelingt, andererseits. Wenn keine adäquate Stressantwort gefunden wird, kann auch das „ConservationWithdrawal-Muster [entstehen] im Sinne des ‚Totstellreflexes‘“ (Klapp & Peters 2011, S. 46). Diese Reaktion geht einher mit „Schwindel, Ohnmacht, Blutdruckabfall, Atemverflachung u. a.“ (ebd.). Sie kann „zu einer habituellen Bewältigungsstrategie“ (ebd.) werden, dabei entsteht allerdings das Risiko dass „Stresstoleranz und Passungskompetenz“ (ebd.) immer mehr abnehmen. Uexküll & Wessiak beschreiben eine Stressreaktion als „Alarmsituation“ (Uexkuell & Wesjack 2011, S. 12) bei ungelösten Problemen, die „zu einer Stimmung der Verzweiflung und schließlich zu Rückzug und Resignation führen“ (ebd.). Dieses Handlungsschema ist von seinen Grundzügen her angeboren und tritt schon bei einem Säugling auf: „Situationen, die das Kind vor Probleme stellen, für deren Lösung es über keine Programme verfügt, werden schon im frühesten Kindesalter mit einer Alarmreaktion beantwortet. … Wenn der Säugling die richtige Lösung einer Problemsituation nicht findet, steigert er zunächst sein Bemühen, aber seine Reaktionen verlieren bald an Koordination. … Dies kann so weit gehen, dass eine Überlastung des Organismus droht. Hier können wir beim Säugling eine plötzliche Verhaltensänderung beobachten, die an die Pawlow´sche Schutzhemmung oder den biologischen Totstellreflex erinnert. Der Säugling bleibt bewegungslos liegen mit konvergenzlos starrenden Augen und geht zur Schlafatmung über“ (Papousek 1975, in: Uexkuell & Wesjack 2011, S. 12): Hier werden zwei verschiedene Stadien der Stressreaktion beschrieben: zunächst die gesteigerten Bemühungen um eine Lösung mit schon bald unkoordinierten Bewegun- 20 gen, dann ein Erstarren, welches an den Pawlow´schen Totstellreflex erinnert. Die Beschreibung der Erstarrung des Säuglings weist meiner Ansicht nach Parallelen zu dem beim Bindungstyp D beschriebenen Erstarren und den Absenzen auf. 4.2.Neuroception – Defensives und soziales Verhalten Porges beschreibt die Unterscheidung einer Situation als „sicher, gefährlich oder lebensbedrohlich“ (Porges 2006, S. 64) durch die „Neuroception“ (ebd.). Diese Neuroception findet in „primitiven Teilen des Gehirns“ (ebd.) und „ohne bewusste Wahrnehmung“ (ebd.) statt“. Sie „löst neurobiologisch determiniertes prosoziales oder defensives Verhalten aus. Auch wenn wir uns der Gefahr auf einer kognitiven Ebene gar nicht bewusst sein mögen, hat unser Körper auf einer neurophysiologischen Ebene bereits eine Folge neuronaler Prozesse gestartet, die adaptives Abwehrverhalten wie Kampf (fight), Flucht (flight) oder Erstarrung (freeze) auslösen“ (ebd.). Diese Prozesse können auch dann stattfinden, wenn die Situation kognitiv als „sicher“ (ebd.) wahrgenommen wird. Erst wenn auch die Neuroception „Sicherheit““ (Porges 2006, S. 65) wahrnimmt, werden physiologische Zustände gefördert, die „Sozialverhalten“ (ebd.) fördern. Es wird keinesfalls zu prosozialem Verhalten kommen, wenn die Neuroception „die Umweltreize missinterpretiert und physiologische Zustände triggert, die defensive Strategien fördern“ (ebd.). „Spezifische Hirnareale entdecken und bewerten Merkmale, wie Körper- und Gesichtsbewegungen sowie den Sprachausdruck, die zu einem Eindruck von Sicherheit oder Vertrauenswürdigkeit beitragen“ (Porges 2006, S. 66). Bereits die Wahrnehmung „geringer Veränderungen biologischer Bewegungen kann eine Neuroception von ‚sicher‘ zu ‚gefährlich‘ verschieben“ (ebd.), prosoziale Aktivität werden verhindert. Umgekehrt kann beispielsweise das Auftauchen einer „sicheren Person“ (ebd.) zu einer Hemmung der defensiven Strategien und damit zu einer Förderung des Sozialverhaltens beitragen. Nach der „Polyvagale[n] Theorie“ (Porges 2006, S. 68) gibt es drei verschiedene „neuronale Schaltkreise“ (ebd.), die sich im Verlauf der Evolution entwickelt haben: Zwei Varianten gibt es bei dem defensiven Verhalten: Die erste ist die „Immobilisierung“ (Porges 2006, S. 69), ein „Totstellreflex“ (ebd.) mit einer „Verhaltensstarre“ (ebd.). Diese Reaktion tritt bei fast allen Wirbeltieren auf. Die zweite Variante reguliert die „Mobilisierung“ (ebd.) mit „Kampf- und Fluchtverhalten“ (ebd.). Bei dieser Reaktion 21 kommt es unter anderem zu einer erhöhten Herzfrequenz. Erst wenn durch die Wahrnehmung von Sicherheit diese beiden Schaltkreise gehemmt werden, kann der dritte Schaltkreis die „soziale Kommunikation“ (ebd.) ermöglichen. Soziale Bindung besteht allerdings nicht nur aus der Hemmung defensiver Strategien, sondern auch aus körperlicher Nähe. „Im Verlauf der Evolution wurden [daher] die Schaltkreise, die ursprünglich an der Erstarrung beteiligt waren, modifiziert, um intime soziale Bedürfnisse zu erfüllen“ (Porges 2006, S. 67), so dass eine „Immobilisierung ohne Furcht“ (Porges 2006, S. 66) stattfinden kann. Das gelingt unter anderem durch den Neurotransmitter*„Oxytoxin[*]“ (Porges 2006, S. 67). Dadurch werden „notwendige prosoziale Aktivitäten einschließlich des Sexualverhaltens, der Geburt, der Versorgung des Nachwuchses und des Aufbaus sozialer Bindungen“ (Porges 2006, S. 66) ermöglicht. Die neuronalen Bahnen zum prosozialen Verhalten sind bereits bei der Geburt vorhanden: Der Säugling ist in der Lage, sich „auf die sozialen und Versorgungsaspekte der Welt mittels Blickkontakt, Lächeln und Lutschen einzulassen“ (Porges 2006, S. 67). Sein Gehör kann er so steuern, „dass die menschliche Stimme von Hintergrundgeräuschen unterschieden werden kann“ (Porges 2006, S. 68). Wenn die Neuroception des Säuglings allerdings Gefahr wahrnimmt, nimmt „die Sensitivität gegenüber sozialem Beziehungsverhalten anderer … ab“ (ebd.), unter anderem wird „[d]as Wahrnehmen des Klangs der menschlichen Stimme … unschärfer“ (ebd.). Diese Reaktion kann durch „externale[...]“ Faktoren in Gang kommen, beispielsweise durch den „flache[n] Affekt eines depressiven Elternteils“ oder andere als gefährlich empfundene Personen oder Situationen. Sie kann aber ebenso durch „internale[...]“ (ebd.) Prozesse wie „Fieber, Schmerz oder eine körperliche Krankheit“ (ebd.) in Gang kommen. Porges ist der Ansicht, dass bei psychiatrischen Erkrankungen, bei denen die Fähigkeit zur sozialen Wahrnehmung herabgesetzt ist, wie beispielsweise bei der Schizophrenie, diese Prozesse eine bedeutende Rolle spielen können (vgl. Porges 2006, S. 69). Ich halte diesen Zusammenhang für schlüssig. Auch diese Beschreibung der Erstarrung erinnert meines Erachtens an das Erstarren und die Absencen, die bei der desorganisierten Bindung beobachtet werden. Während Porges die Bedeutung der unwillkürlichen Neuroception für die Einschätzung einer Situation betont, führt Beutel im Gegensatz dazu aus, wie die Großhirnrin- 22 de in der Regel eine erste Beurteilung einer Situation als gefährlich durchaus nach wenigen Sekunden korrigieren kann: 4.3. Komplexe Analyse durch die Großhirnrinde Beutel bezieht sich auf das Angstmodell von Le Doux (2000, in: Beutel 2011, S. 66): Es gibt zwei „Notfallschaltkreise zur Erkennung von Gefahrensituationen“ (Beutel 2011, S. 66). Im ersten, schnellen Kreislauf erfolgt die emotionale Bewertung von Sinneseindrücken durch die Amygdala*, die über den Thalamus* Signale aus dem „Wahrnehmungsapparat“ (ebd.) erhält. Diese Bewertung der Sinneseindrücke erfolgt zunächst ohne die Großhirnrinde, also ohne, dass die Sinneswahrnehmung bewusst wird. Diese erste Bewertung entspricht meines Erachtens der Neuroception bei Porges. Der Vorteil dieser schnellen Bewertung besteht „in der rechtzeitig eingeleiteten psychophysiologischen Aktivierung für Kampf oder Flucht“ (Beutel 2011, S. 67). Beutel verdeutlicht das weitere Geschehen an einem Beispiel, er unterscheidet dabei allerdings nicht wie Porges zwischen Kampf/Flucht einerseits und Erstarrung andererseits: „Beispielsweise erstarrt der Wanderer in seiner Bewegung, der im Wald einen länglichen Gegenstand vor sich auf dem Boden liegen sieht, bevor er genau bestimmen kann, ob es sich um eine Giftschlange handelt“ (Beutel 2011, S. 67). Mit einer zeitlichen Verzögerung kommt dann der zweite Notfallschaltkreis zum Einsatz, die Großhirnrinde ermöglicht eine „komplexer[e]“ (ebd.) und „situationsgerecht[e]“ (ebd.) Analyse der Situation, nachdem eine „Integration und Bewertung sensorischer Information“ (ebd.) stattgefunden hat. Die eigene Körperreaktion wird in dem Moment wahrgenommen, in dem die vermeintliche Gefahr als harmlos erkannt wird – in dem Beispiel oben wird der Stock als ein solcher wahrgenommen. Es erscheint in diesem Zusammenhang denkbar, dass insbesondere dieser zweite Notfallschaltkreis störanfällig ist und nicht immer adäquat in Gang kommt, so dass die von Porges beschriebene Situation eintreten kann, bei der die unwillkürliche Bewertung einer Situation als gefährlich nicht durch eine kognitive Einschätzung gestoppt wird. Sowohl aufgrund problematischer Emotionsregulation im Zusammenhang mit unsicheren Bindungsrepräsentationen als auch bei einer bereits bestehenden Störung der sensorischen Modulation ist eine unzureichende Korrektur einer möglichen ersten Fehleinschätzung meiner Ansicht nach denkbar. 23 Hüther ist der Ansicht, dass die physiologische Entwicklung des Gehirns untrennbar mit der psychischen Entwicklung zusammengehört: 4.4.Die psychische Entwicklung und die Entwicklung des Gehirns Die traditionelle Trennung zwischen der Entwicklung des Gehirns einerseits und der Entwicklung des „Verhaltens, Denkens und Fühlens“ (Hüther 2007, S. 46) andererseits unterliegt nach Hüthers Ansicht einem Irrtum. Durch bildgebende Verfahren sind in jüngerer Zeit diesbezüglich weitreichende Erkenntnisse möglich geworden: Die „neuronalen Verschaltungen“ (Hüther 2007, S. 45) sind beim Menschen „weitaus plastischer“ (ebd.), als man bisher angenommen hatte und sehr viel weniger genetisch determiniert als bei Tieren. Diese im Gehirn angelegten neuronalen Netzwerke werden am besten mit dem Begriff der „Erfahrung“ (ebd). verdeutlicht. Der junge Mensch ist länger als andere Arten „auf Fürsorge und Schutz, Unterstützung und Lenkung durch die Erwachsenen angewiesen“ (Hüther 2007, S. 46), daher ist auch die Hirnentwicklung in besonderem Maße „von der emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenz dieser erwachsenen Bezugspersonen abhängig“ (ebd.) Da die Erwachsenen nicht immer optimale Bedingungen herstellen können, können Kinder nicht immer die optimalen Vernetzungen in ihrem Gehirn entwickeln, was allerdings oft erst später deutlich wird. Ebenso wie Ayres weist Hüther auf die besondere Bedeutung phylogenetisch* älterer Hirnareale bei der Verarbeitung der Wahrnehmungen hin; im Unterschied zu Ayres betont Hüther dabei allerdings die Verarbeitung emotionaler Erfahrungen: „Von besonderer Bedeutung für die Verarbeitung und Verankerung emotionaler Erfahrungen sind die Verschaltungen zwischen den für die Entstehung emotionaler Erregungen zuständigen neuronalen Netzwerken in den (…) phylogenetisch[*] älteren limbischen Hirnregionen und den für kognitive Verarbeitungsprozesse zuständigen neokortikalen[*] Netzwerken“ (Hüther 2007, S. 47 f., ). Diese Verschaltungen sind das „neurobiologische Substrat, das für die Integration äußerer und innerer Zustandsbilder verantwortlich ist. Es ermöglicht uns die gleichzeitige sensorische, kognitive und autonome Verarbeitung und die Verankerung emotionaler Erfahrungen“ (Hüther 2007, S. 48). Kinder kommen mit vorgeburtlich verankerten Erfahrungen in ihrem Gehirn zur Welt. Sie müssen, ebenso wie die Erwachsenen, alle neuen Erfahrungen mit den bereits vor- 24 handenen, was ihnen vertraut ist, abgleichen und in Beziehung setzen. Dafür benötigen sie Sicherheit und Vertrauen. „Jede Art der Verunsicherung, von Angst und Druck erzeugt in ihrem Gehirn eine sich ausbreitende Unruhe und Erregung. Unter diesen Bedingungen können die dort über die Sinneskanäle eintreffenden Wahrnehmungsmuster nicht mit den bereits abgespeicherten Erfahrungen abgeglichen werden. (…) Das einzige, was dann noch funktioniert, sind ältere, sehr früh entwickelte und sehr fest eingefahrene Denk- und Verhaltensweisen“ (Hüther 2007, S. 52). Auf diese Verhaltensweisen fällt ein Kind dann zurück. Sicherheit und Vertrauen stellen also nach Hüther die Basis für die adäquate Verarbeitung von Sinneswahrnehmungen dar. Hüther fasst zusammen: Um ihr Gehirn möglichst optimal nutzen zu können, „brauchen Kinder sichere emotionale Beziehungen und vielfältige Herausforderungen und Anregungen“ (Hüther 2007, S. 55). Wenn also Emotionen wie Angst, Unruhe und Erregung nicht reguliert werden können, gelingt das Abgleichen der wahrgenommenen Sinnesreize mit früheren Erfahrungen nicht; die Verarbeitung der Sinnesreize wird zum Problem. 5. Zusammenfassung Mit dieser Aussage Hüthers lassen sich meine bisherigen Ausführungen zusammenfassen: Die These stimmt überein mit der Theorie der Sensorischen Integration, nach der Stress und Angst die sich selbst verstärkende negativen Spirale der sensorischen Modulationsstörung unterhalten. Auch die kognitive Korrektur einer im ersten Moment als gefährlich eingeschätzten Situation ist demnach mit abhängig von einem funktionsfähigen Gehirn mit der Möglichkeit der adäquaten Abgleichung der aktuellen Sinnesinformation mit früheren Erfahrungen (Beutel). Hüthers Aussage stimmt auch mit der Bindungstheorie überein: Sichere emotionale Beziehungen zu Erwachsenen fördern eine optimale Entwicklung des Gehirns als Voraussetzung für die adäquate Verarbeitung von Sinnesreizen. Auch mit der polyvagalen Theorie ist diese Aussage Hüthers kompatibel, nach der gerade auch die soziale Wahrnehmung reduziert ist, wenn ein Kind sich im Stressmodus befindet. Unkontrollierbarer Stress, verursacht durch eine unsichere Bindung, kann demnach zu einer sensorischen Modulationsstörung und zu Problemen mit der sozialen Wahrnehmung beitragen. Sichtbar gemacht werden kann diese Problematik durch 25 die Neurological Soft Signs. Damit kann unkontrollierbarer Stress in der Säuglingszeit zu gestörter Sensomotorik beitragen. Teil II: Die Schizophrenie 1. Beschreibung 1.1. Definition des Krankheitsbilds Nach Möller, Lux und Deister (2009, S. 139) gehören die Schizophrenien zur „Hauptgruppe der endogenen Psychosen (ebd.), es handelt sich vermutlich um eine „heterogene Gruppe von Störungen“ (ebd.). Es kommt „zum Auftreten charakteristischer, symptomatisch oft sehr vielgestaltiger psychopathologischer Querschnittsbilder mit Wahn, Halluzinationen, formalen Denkstörungen, Ich-Stöungen, Affektstörungen und psychomotorischen Störungen. Nachweisbare körperliche Ursachen, aus denen im Einzelfall die Diagnose gestellt werden könnte, fehlen. Die neueren Klassifikationssysteme verlangen eine bestimmte Mindesterkrankungsdauer. Schizophrenieartige Bilder, die dieses Kriterium nicht erfüllen, werden als schizophrenieforme Erkrankung klassifiziert“ (ebd.) Im Mittelalter und Altertum gab es Bezeichnungen wie „‘Irresein‘, ‚Verrücktsein‘, ‚Besessensein‘ oder ‚Wahnsinnigsein‘“ (Deimel & Hölter 2011, S. 211). Entsprechende Erkrankungen wurden als „Geisteskrankheit“ (Deimel & Hölter 2011, S. 212) angesehen. Manchmal wurden sie im Zusammenhang mit „übernatürlichen Kräften“ (ebd.) oder „dämonischer Besessenheit“ (ebd.) oder aber als „göttliche Bestrafung“ (ebd.) betrachtet (vgl. Deimel & Hölter 2011, S. 212). Kraepelin (1896, in: Möller et al. 2009, S. 139) nannte die Erscheinungsbilder dieser Erkrankung „‘Demetia präcox‘ (vorzeitige Verblödung)“ (ebd.), Damit werden der Verlauf und die oft schwerwiegenden Persönlichkeitsveränderungen verdeutlicht. Gaebel erwähnt, dass Kraepelin die Dementia präcox den „manischdepressiven[*] Erkrankungen“ (Kraepelin 1896, in: Gaebel 2002, S. 82) gegenüberstellte und den vorwiegend negativen Verlauf der Dementia präcox damit betonte, im Gegensatz zum Verlauf der manischdepressiven* Erkrankungen. Diese klare Gegenüberstellung hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Heute gehen die meisten Autoren von einer „Kontinuumshypothese[*]“(Gaebel 2002, S. 82) aus. Read & Gumley sehen es in diesem Kontext als problematisch an, dass die Schizophrenie lange als „nicht affektive Psychose“ (Read & Gumley 2009, S. 238) aufgefasst worden ist. Die Autoren sehen die Schizophrenie im Zusammenhang und im Einklang 26 mit der Bindungstheorie „in erster Linie als Störung, die durch affektive Dysregulation gekennzeichnet [ist]“ (ebd.). Bleuler (1911, in: Möller et al. 2009, S. 139) prägte den Begriff „Schizophrenie“ (ebd.) und betonte damit den Aspekt, dass die Betroffenen häufig ihr psychisches Erleben gespalten wahrnehmen. Gaebel weist darauf hin, dass Bleuler damit keinesfalls eine „gespaltene Persönlichkeit“ (Gaebel 2002, S. 83) meinte, sondern eine „Spaltung der verschiedensten psychischen Funktionen“ (ebd.). Bleuler differenzierte zwischen „dauerhaft vorhandenen Grundsymptomen einerseits sowie akzessorischen, zeitweilig auftretenden Symptomen andererseits“ (ebd.). Diese Unterteilung wird heute in ähnlicher Weise als Plus- und Minus-Symptomatik verwendet. Beeinträchtigt sind fast alle psychischen Funktionen, im Vordergrund stehen aber Störungen der 1. „Konzentration und Aufmerksamkeit 2. Inhaltliches und formales Denken 3. Ich-Funktionen 4. Wahrnehmung 5. Intentionalität 6. Affektivität und Psychomotorik“ (ebd.) Störungen des inhaltlichen und formalen Denkens, der Ich-Funktionen und der Wahrnehmung werden zu der Positivsymptomatik gezählt, Störungen der Konzentration und Aufmerksamkeit, der Intentionalität und der Affektivität und Psychomotorik zu der Negativsymptomatik (vgl. Gaebel S. 83, Möller S. 147). Gaebel stellt weitere diagnostische Untergruppen dar, die mit unterschiedlichen Verlaufsprognosen einhergehen: • Bei der „paranoide[n] … Schizophrenie“ (Gaebel 2002, S. 85) stehen die positiven Symptome im Vordergrund. Hier werden verschiedene Verlaufsformen beobachtet. • Die „hebephrene[...] Schizophrenie“ (ebd.) beginnt zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr, hier stehen die negativen Symptome im Vordergrund, die Verlaufsprognose ist ungünstig. • Die „katatone Schizophrenie[...]“ (Gaebel 2002, S. 86) kommt selten vor, es zeigen sich „psychomotorische Störungen, die zwischen Erregung und Stupor“ (ebd.) wechseln. Diese Form hat eher eine günstige Prognose. 27 • Bei der „Schizophrenia simplex“ (ebd.) wird eine fortschreitende Negativsymptomatik beobachtet, oft folgt eine allmähliche soziale „Desintegration bis zur Nichtsesshaftigkeit“ (ebd.). Da diese Diagnose schwer zu erstellen ist, sollte sie nur mit großer Vorsicht gestellt werden. Häufig tritt „Komorbidität“ (Möller et al. 2009, S. 165) auf: Schizophren Erkrankte haben dann zusätzlich Abhängigkeitserkrankungen oder auch andere psychische Erkrankungen. Es gibt mittlerweile darauf abgestimmte „Stationen für sog. ‚DoppelDiagnose‘“ (ebd.), bei denen im Therapieprogramm sowohl auf die Abhängigkeit, als auch auf die Schizophrenie eingegangen wird. 1.2. Verlauf der Erkrankung Gaebel unterscheidet zwischen einer „akute[n] Phase“ (Gaebel 2002, S. 89) von einigen Wochen bis Monaten, einer „postakute[n] Stabilisierungsphase“ (ebd.) von drei bis sechs Monaten und einer „stabile[n] (partielle[n]) Remissionsphase“ (ebd.), die „Monate bis Jahre“ (ebd.) dauern kann. In der akuten Phase herrschen die produktiven, positiven Symptome vor. Die Phasen können in Schüben immer wieder auftauchen, teilweise mit kompletter Remission zwischen den Schüben; teilweise bleibt eine zunehmend stärkere, überwiegend negative Symptomatik zurück – die sogenannten „Residualzustände“ (Möller et al. 2009, S. 163). In der postakuten Phase bilden sich die positiven Symptome zurück, während die Negativsymptomatik noch anhält. Es besteht eine erhöhte „Rezidivneigung“ (Gaebel 2002, S. 89). Ob diese Zustände durch die Erkrankung selber, die psychische Belastung oder die Medikamente verursacht werden, ist noch nicht geklärt. Man geht heute von einem Zusammenwirken verschiedener Faktoren aus (vgl. Möller S. 164). Die stabile (partielle) Remissionsphase dauert Monate bis Jahre. In dieser Phase sind die positiven und negativen Symptome entweder weitgehend abgeklungen, oder sie haben sich in einem Residuum stabilisiert (Vgl. Gaebel 2002, S. 89). In der Regel herrscht bei dem Residuum die Negativsymptomatik vor, bei wenigen Patienten chronifiziert sich die Positivsymptomatik, die in unterschiedlicher Stärke zu der Negativsymptomatik hinzukommen kann (vgl. Möller et al. 2009, S. 163). Im Verlauf der Erkrankung kommt es immer wieder zu „suizidalen[*] Krisen“ (ebd.). 28 Sogenannte „‘Prodromalerscheinungen‘“ (ebd.) können der akuten Erkrankung vorausgehen, unter Umständen tritt die volle Symptomatik aber auch akut auf. In der Prodromalphase, die einige Jahre bis einige Monate dauern kann, treten die Negativsymptome auf, wenn auch meist in abgeschwächter Form (vgl. ebd.). Gaebel beschreibt in diesem Zusammenhang unspezifische Symptome „z.B. Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit, Nervosität“ (Gaebel 2002, S. 84). Manchmal wird auch ein „Knick in der Lebenslinie“ (ebd.) beobachtet, der sich beispielsweise in Leistungsabfall in der Schule zeigen kann. Die Prodromalphase lässt sich allerdings schwer von der „prämorbiden Persönlichkeit“ (ebd.) unterscheiden. Grundsätzlich gilt heute als „grobe klinische Faustregel …:unter anderem: Je akuter der Beginn und je deutlicher situative Auslöser, desto günstiger die Prognose“ (Möller et al. 2009, S. 165). Die längere Dauer hat sich als „besonders wichtiger Prädiktor“ (ebd.) herausgestellt, daher gibt es weltweite Bemühungen um frühe Diagnose und Behandlung (vgl. ebd.). Gaebel benennt Prädiktoren für eine Verlaufsprognose: „Zu den günstigen Verlaufsprädiktoren werden beispielsweise gute prämorbide Persönlichkeit, adäquate soziale Integration und heterosexuelle Anpassung, weibliches Geschlecht, situative Auslösung, akuter Krankheitsbeginn und affektive Begleitsymptomatik gerechnet.“ (Gaebel 2002, S. 95) Er fasst den Verlauf zusammen: Während in der akuten Phase die Positivsymptomatik im Vordergrund steht, „spielen im Langzeitverlauf vor allem Negativsymptomatik und soziale Faktoren einschließlich Lebensgewohnheiten sowie Lebensqualität eine besondere Rolle“ (Gaebel 2002, S. 93f). Die heutigen Behandlungsmöglichkeiten ermöglichen eine bessere Prognose als früher, dennoch erleben auch heute noch „mehr als 50% der Erkrankten einen ungünstigen Verlauf mit Rezidiven und Residualsymptomatik sowie erheblichen Störungen der sozialen Integration“ (Möller et al. 2009, S. 165). Die Hälfte der Erkrankten ist schon mit 40 Jahren berentet. Die Lebenserwartung ist um 15 Jahre geringer als bei der Allgemeinbevölkerung. Außer Suiziden* spielen dabei kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht und Diabetes eine große Rolle. Daimel & Hölter erwähnen zusätzlich die Risikofaktoren „Inaktivität“ (Deimel & Hölter 2011, S. 222) und „Bewegungsmangel“ (ebd.). 29 1.3. Epidemiologie Im Durchschnitt erkranken 1% der Gesamtbevölkerung im Lauf ihres Lebens an einer Schizophrenie, Frauen und Männer zu gleichen Teilen. Diese Zahlen gelten auch für Länder mit anderem soziokulturellen Hintergrund (vgl. Möller et al. 2009, S. 140). Schizophrene steigen im Laufe ihres Lebens häufig sozial ab; dieser Umstand stellt nach Ansicht von Möller et al. und Gaebel eine Erklärung dafür dar, dass Schizophrenie in niedrigen sozialen Schichten überproportional häufig vorkommt – die sogenannte „Drifthypothese“ (Möller et al. 2009, S. 140, vgl. auch Gaebel 2002, S. 95). Bei Berücksichtigung der Schicht der Herkunftsfamilie ergibt sich ein „der Schichtverteilung entsprechendes Risiko“ (Möller et al. 2009, S. 145). Im Gegensatz dazu sind Read & Gumley der Ansicht, dass gesellschaftliche Bedingungen bei dem Erkrankungsrisiko eine wesentliche Bedeutung haben. Die Autoren führen eine Vielzahl von Studien an, aus denen klar hervor geht, dass die Faktoren „Armut, Stadtleben, Ethnizität“ (Read & Gumley 2009, S. 239) Prädiktoren für eine schizophrene Erkrankung sind. Eine der Studien greife ich heraus, weil der Sachverhalt hier besonders deutlich wird: Das Risiko benachteiligter Kinder, eine schizophrene Störung zu entwickeln, war einer britischen Studie zufolge achtmal höher als das nicht benachteiligter Kinder. Nicht bei allen dieser Kinder gibt es bereits in der Familiengeschichte Psychosen: „Bei den Kindern, in deren Familiengeschichte es keine Psychosen gab, war das Risiko der Benachteiligten, eine Schizophrenie zu entwickeln, siebenmal so hoch wie das der Nichtbenachteiligten, was zeigt, dass es zur Ausbildung einer Schizophrenie keiner genetischen Disposition bedarf“ (vgl. Harrison et al. 2001, in: Read & Gumley 2009, S. 239). In vielen Ländern wurde gezeigt, dass Ethnizität einen Prädiktor für Schizophrenie darstellt. Zwar tragen auch „rassistisch bedingte Fehldiagnosen“ (Read & Gumley 2009, S. 239) zu diesem Ergebnis bei, dennoch gibt es nach Ansicht der Autoren „Umweltfaktoren, die zuverlässig einen Zusammenhang zwischen Ethnizität und Schizophrenie schaffen, vor allem Rassendiskriminierung, finanzielle Benachteiligung, Arbeitslosigkeit, Verlust der Eltern und soziale Isolation (Read & Gumley 2009, S. 239)9 Assion, Weiss & Korwischka beschreiben für Migranten ein höheres Risiko, an Schizophrenie zu erkranken als für einheimische Bevölkerung, was sie unter anderem mit einer Metaanalyse belegen. Ein noch höheres Risiko als Migranten der ersten Generation haben Migranten der zweiten Generation. Migranten aus weniger entwickelten Ländern hatten eine höheres Risiko als Migranten aus höher entwickelten Ländern; 30 Menschen mit schwarzer Hautfarbe hatten ein höheres Risiko als Menschen mit weißer Hautfarbe (vgl. Cantor-Graae & Selten 2005, in: Assion et al. 2009, S. 32). Die Autoren erklären dieses Phänomen damit, dass „Migranten … Stressfaktoren in einem hohen Maße ausgesetzt [sind]“ (Assion et al. 2009, S. 33), Stressfaktoren wiederum begünstigen die Erkrankung. Ich halte die Nachweise von Read & Gumley sowie von Assion et al. für schlüssig. Nach Möller et al. liegt die Suizidrate bei Schizophrenen ungefähr bei 10%. Das „Risiko für Tötungs- und Gewaltdelikte“ (Möller et al. 2009, S. 140) ist, im Gegensatz zu früheren Forschungsergebnissen, nach neueren Erkenntnissen höher als in der Gesamtbevölkerung. Diese Veränderung hängt möglicherweise damit zusammen, dass sich die Langzeitversorgung der Patienten verändert hat: Es gibt heute weniger Hospitalisierung (vgl. ebd.). Gaebel erwähnt, dass die Schizophrenie zu den zehn häufigsten Erkrankungen gehört, die verantwortlich für eine Behinderung sind. Die Kosten, die durch Invalidisierung und Produktionsausfall verursacht werden, sind fünfmal höher als die direkten Behandlungskosten. Diese Kosten sind vergleichbar mit denen „somatischer Volkskrankheiten (Diabetes, Herzerkrankungen)“ (Gaebel 2002, S. 90). 1.4. Zusammenfassung Bevor ich auf die Äthiopathogenese eingehe, fasse ich zusammen: Die Schizophrenie ist eine Erkrankung, bei der die meisten psychischen Funktionen beeinträchtigt sind. Man unterscheidet heute zwischen positiven Symptomen, beispielsweise Wahn und Halluzinationen, und negativen Symptomen wie Störungen der Affektivität, Psychomotorik und der Intentionalität. Störungen der Konzentration und Aufmerksamkeit werden sowohl dem positiven als auch dem negativen Symptomenkomplex zugeordnet. In akuten Phasen herrscht eher die positive Symptomatik vor, in den chronischen Phasen eher die negative. Etwa ein Prozent der Bevölkerung erkrankt an Schizophrenie. Über die Frage, ob soziale Gesichtspunkte bei der Entstehung der Erkrankung eine Rolle spielen, sind die Ansichten geteilt: Gaebel und Möller et al. sind der Ansicht , dass zunächst alle sozialen Schichten gleichermaßen betroffen sind und führen die Drifthypothese an, nach der das häufigere Vorkommen der Erkrankung in sozial schwächeren Schichten eine Erklärung in einem sozialen Abstieg findet, der durch die Erkrankung selbst verur31 sacht wird. Im Gegensatz dazu sehen Read & Gumley bei Menschen aus unteren sozialen Schichten ein höheres Erkrankungsrisiko; Assion et al. sehen insbesondere bei Menschen mit Migrationshintergrund ein erhöhtes Erkrankungsrisiko, was sie mit vermehrtem Stress aufgrund der Migration erklären. Der Erkrankung können unspezifische Symptome in einer Prodromalphase vorausgehen, die allerdings schwer von der prämorbiden Persönlichkeit abzugrenzen sind. Trotz der verbesserten Therapiemöglichkeiten in der heutigen Zeit verläuft die Erkrankung zu einem hohen Prozentsatz ungünstig, über die Hälfte der Betroffenen erleben Rezidive und/oder Residualsymptomatik. Die Betroffenen haben ein relativ hohes Suizidrisiko, auch die Invalidisierungsrate ist vergleichsweise hoch. Die Gesamtkosten, die durch diese Erkrankung verursacht werden, sind vergleichbar mit den Kosten für andere Volkskrankheiten wie Diabetes oder Herzerkrankungen. 2. Äthiopathogenese 2.1. Angeborene und psychosoziale Faktoren Gaebel geht davon aus, dass die „Krankheitsdisposition oder Vulnerabilität“ (Gaebel 2002, S. 87) „erworben oder vererbt“ (ebd.) wird (vgl. auch Möller et al. 2009, S. 140). Beide Autoren berufen sich auf Zwillings- und Adoptionsstudien (Gaebel 2002, S. 87; Möller 2009, S. 140). Nach Möller et al. wird die genetische Disposition heute als eine „polygene Erbanlage interpretiert, über deren Details trotz der Fortschritte molekulargenetischer Forschung wenig bekannt ist“ (Möller et al. S. 140,). Im Gegensatz dazu ist Zerres der Ansicht, dass die Ergebnisse der Genforschung „eher ernüchternde Ergebnisse“ (Zerres 2010, S. 98) im Hinblick auf Veränderungen der DNA bei bestimmten Erkrankungen gebracht haben. „Familien- und Zwillingsstudien“ (Zerres 2010, S. 96) lassen seiner Ansicht nach keine Rückschlüsse auf Veränderungen der DNA zu, sondern können unter Umständen auch auf „epigenetische Mechanismen“ (ebd.) zurückgeführt werden. „Die Epigenetik beschäftigt sich … mit der Weitergabe von Eigenschaften an Nachkommen, die nicht auf Abweichungen in der DNA-Sequenz zurück gehen, sondern auf eine vererbbare Änderung der Genregulation und Genexpression“ (Zerres, 2010, S. 95). Epigenetische Muster können - im Gegensatz zu genetisch bedingten Mustern „durch exogene Einflüsse (Ernährung, Verhalten) beeinflusst werden“ (Zerres 2010, S. 97). 32 Bisherige Studien mit Tieren weisen darauf hin, dass „nicht nur Kortisol[*], sondern auch Oxytocin[*] und Vasopressin[*], die Einfluss auf das Sozialverhalten haben, … der epigenetischen Steuerung [unterliegen]“ (Zerres 2010, S. 96). Das gilt auch für „Serotonin[*]- und Dopamin[*]-spiegel, die Einfluss auf Psyche und Verhalten haben“ (ebd.). In Tierexperimenten zeigte sich, dass „[e]pigenetische Muster einzelner Gene (…) an nachfolgende Generationen weiter gegeben werden [können]“ (Zerres 2010, S. 96). Zwar ist ein entsprechender Nachweis bei Menschen ungleich schwieriger (vgl. Zerres 2010, S. 97), es gibt jedoch Hinweise darauf, dass epigenetische Mechanismen an der Entstehung etlicher Krankheiten beteiligt sind, so auch bei „Psychosen“ (Zerres 2010, S. 98). So konnte beispielsweise in einer umfangreichen holländischen Studie gezeigt werden, dass Kinder ein erhöhtes Schizophrenierisiko hatten, wenn „ein naher Verwandter der Mutter in dem Zeitraum von bis zu sechs Monaten vor der Konzeption bis zur Geburt plötzlich verstorben ist (vgl. Khasan et al. 2008, in: Zerres, 2010, S. 98). Die Epigenetik liefert nach Ansicht von Zerres schlüssige Erklärungsansätze für die Entwicklung von Psychosen, beispielsweise bei Kindern von traumatisierten Müttern oder nach einer unerwünschten Schwangerschaft. Da die Regulationsmechanismen von Genen auch durch das menschliche Verhalten beeinflusst werden können, sieht Zerres hier sowohl Erklärungsansätze für die Entstehung von Krankheiten als auch Ansätze für die „Erforschung der Wirkung von (Psycho)therapien“ (ebd.). Epigenetische Einflüsse auf eine angeborene Disposition und Vulnerabilität erscheinen mir schlüssig. Die Konsequenzen sind andere als bei einer ausschließlich genetisch bedingten Disposition: Umwelteinflüsse und damit möglicherweise Psychotherapien und/oder Feinfühligkeitstrainings für Eltern können auf dieser Grundlage eine weitreichende Wirkung entfalten. Read & Gumley sehen es kritisch, wenn der Blick bei psychischen Erkrankungen überwiegend auf die Gene gelegt wird, dadurch geraten ihrer Ansicht nach psychosoziale Ursachen aus dem Blickfeld. Diese Problematik sehen sie ganz besonders bei der Erkrankung der Schizophrenie: Seitdem diese Erkrankung vor etwa 100 Jahren „erfunden[..]“ (Read & Gumley 2009, S. 237)10 wurde, „sind Millionen von Menschen weltweit zu der pessimistischen und stigmatisierenden Überzeugung – einer Self-fulfilling Prophecy – verurteilt, dass sie an einer Art irreversibler Erkrankung des Gehirns leiden. Diese Krankheit, die zu Unrecht als weitgehend genetisch bedingt 33 hingestellt worden ist, hat angeblich wenig oder gar nichts mit der Lebensgeschichte oder den Lebensumständen der Betroffenen zu tun“ (ebd.). Read & Gumley sehen Befürchtungen vor einer Schuldzuweisung an die Eltern als Ursache für das Fehlen umfassender Untersuchungen der „entwicklungspsychologischen und interpersonalen Wurzeln der Psychose “ (Read & Gumley 2009, S. 238). Damit fehlt auch ein „teilnehmendes Verständnis der großen Bedeutung, welche die frühen Bindungen an Eltern und Peers im Prozess der Entwicklung von emotionaler Widerstandskraft und Vulnerabilität haben“ (ebd.). Ich halte diese Argumentation für schlüssig. Eine Erklärung im Sinne epigenetischer Zusammenhänge würde die Lebenszusammenhänge nicht nur des Individuums, sondern der ganzen Familie mit einbeziehen. Zerres (2010, S. 98): „Die Beobachtung, dass epigenetische Muster einzelner Gene an Kinder weitergegeben werden können, kann eine Brücke zwischen Vererbung und Wirkung exogener Einflüsse bieten.“ Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Auch die Autoren der Lehrbücher beurteilen die Schizophrenie nicht ausschließlich als genetisch bedingt: Gaebel geht von einer „multifaktioriellen Genese“ (Gaebel 2002, S. 86) aus. „Dies bedeutet, dass hinsichtlich dispositioneller, auslösender, unterhaltender und chronifizierender Bedingungen neurobiologische, psychologische und soziale Teilfaktoren berücksichtigt werden müssen“ (Gaebel 2002, S. 86). Auch Möller et al. gehen von einer „vermutlich multifaktiorielle[n] Entstehung“ (Möller et al. 2009, S. 140) aus. Sie erwähnen unter anderem „Geburtskomplikationen“ (Möller et al. 2009, S. 143, Tab. B4.6), „Drogenkonsum“ (ebd.), „soziale[n] Stress“ (ebd.), „toxische Einflüsse“ (ebd.) und andere; Den Faktor „emotionale Traumata“ (ebd.) versehen die Autoren mit einem Fragezeichen. Gaebel erwähnt die „Dopaminhypothese (…), die im Wesentlichen durch die (antidopaminerge) Wirkweise der Neuroleptika“ (Gaebel 2002, S. 88) gestützt wird. Möller et al. weisen darauf hin, dass diese Hypothese „noch nicht ausreichend belegt [ist], was unter anderem mit grundsätzlichen Forschungsproblemen in diesem Bereich zusammenhängt“ (Möller et al. 2009, S. 144). Die Dopaminregulation gehört nach Zerres zu den Faktoren, für die es Hinweise auf epigenetische Beeinflussung gibt. Damit erscheint möglicherweise auch die Dopamin- 34 regulation langfristig grundsätzlich als beeinflussbar durch die Umwelt und nicht als ausschließlich genetisch determiniert11. Psychosoziale Faktoren sind bei der Äthiopathogenese demnach heute unbestritten; unterschiedliche Auffassungen gibt es im Hinblick auf ihre Bedeutung im Verhältnis zu erblichen Faktoren. 2.2. Informationsverarbeitung im Gehirn Gaebel geht von einem „‘neurointegrativen Defizit‘“ (Gabel 2002, S. 87) aus, das durch „…Prä- oder Perinatalschäden sowie vor allem [durch] genetische Faktoren“ (ebd.) ausgelöst wird. Die Erkrankung manifestiert sich meist im frühen Erwachsenenalter erstmalig. Daher vermutet man weitere Ursachen zum einen in altersspezifischen Konflikten, zum anderen in der „zum Abschluss kommenden Ausreifung psychorelevanter Hirnsysteme (vor allem dopaminerges System)“ (Gaebel 2002, S. 88). „Das schließliche Auftreten psychotischer Symptomatik kann psychophysiologisch als Folge einer sensorischen Filterstörung mit Reizüberflutung, Überlastung und Zusammenbruch informationsverarbeitender Prozesse auf dem Boden einer (partiell) reversiblen Desintegration neuronaler Funktionssysteme verstanden werden“ (ebd., zweite Hervorhebung von mir) Gaebel betont die altersspezifischen Konflikte zum einen, und zum anderen die Ausreifung psychorelevanter Hirnsysteme. Im Sinne Hüthers halte ich eine andere Sichtweise für einleuchtender: Die spezifischen Konflikte in der Jugendzeit und im frühen Erwachsenenalter führen zu unkontrollierbarem Stress, der auf psychosozialer Ebene eine neue Orientierung erforderlich macht und gleichzeitig Veränderungen im Sinne von Destabilisierung neuronaler Verschaltungen im Gehirn hervorbringt. Es erscheint mit denkbar, dass sowohl bei einer zugrunde liegenden Störung der sensorischen Modulation als auch bei häufig misslingender Emotionsregulation der zusätzliche alterstypische Stress den Zusammenbruch der Informationsverarbeitung bewirken kann, den Gaebel beschreibt. Möller et al. beschreiben die Schädigungen, die durch Geburtskomplikationen hervorgerufen werden können, als eine „Minimal Brain Dysfunction“ (Möller et al. 2009, S. 141). Die Autoren sind der Ansicht, dass die der schizophrenen Erkrankung vorausgehenden Symptome als ZNS-Entwicklungsstörung verstanden werden können: „Von der modernen Schizophrenieforschung werden zunehmend die kognitiven Störungen Schizophrener als eine primäre, schon vor Ausbruch der Psychose vorhandene Kernsymptoma- 35 tik der Schizophrenie angesehen und im Rahmen einer genetisch disponierten und/oder exogen verursachten ZNS-Entwicklungsstörung interpretiert“ (Möller et al. 2009. S. 143). Mit den heutigen neurophysiologischen Methoden gelingt es, beispielsweise „veränderte Messwerte von evozierten Potentialen“ (ebd.) nachzuweisen. Damit sind Rückschlüsse auf die Störungen der Informationsverarbeitung möglich. „Die Denkstörungen und die in neuropsychologischen Tests nachweisbaren kognitiven Störungen Schizophrener lassen sich psychologisch mit Störungen der Informationsverarbeitung erklären. Dazu gehören unter anderem Schwächen der selektiven Aufmerksamkeit bzw. der Filterfunktion für irrelevante Informationen sowie Störungen der Reaktions- und Assoziationshierarchien“ (ebd.). Die von Möller et al. sowie von Gaebel beschriebenen Störungen der Informationsverarbeitung zeigen meiner Ansicht nach deutliche Parallelen zu den in der Theorie der Sensorischen Integration beschriebenen Störungen. Allerdings beziehen die Autoren sich auf den kognitiven Bereich, während Ayres den Schwerpunkt auf die Basissinne legt, die für sie die Grundlage für die kognitiven Funktionen darstellen. Ähnlich wie die Autoren der Theorie der Sensorischen Integration stellen auch Gaebel, sowie Möller et al. nicht die Frage nach möglicherweise emotional bedingten Ursachen dieser Störungen der Informationsverarbeitung. Im Gegensatz dazu sehen Read & Gumley die Krankheitsentstehung - im Zusammenhang mit der Dysregulation der Emotionen - in Verknüpfung mit der Bindungstheorie. Meiner Ansicht nach gehören, wie ich in Teil I dargelegt habe, diese beiden Gesichtspunkte untrennbar zusammen. Die Störung der Verarbeitung von Informationen zählt auch nach Ansicht der genannten Lehrbuchautoren häufig zu der Problematik späterer Schizophrener, möglicherweise ist diese Störung auch als Kernsymptom zu betrachten. Auslösende Stressfaktoren, beispielsweise im frühen Erwachsenenalter, bewirken den Zusammenbruch der Informationsverarbeitung vermutlich insbesondere dann, wenn Jugendliche mit unsicherer oder gar desorganisierter Bindungsrepräsentationen typischerweise keine Hilfe in Anspruch nehmen, wenn sie Schwierigkeiten haben, sondern sich isolieren. 2.3. Erkenntnisse aus bildgebenden Verfahren Bildgebende Verfahren zeigten bei den Patienten teilweise „strukturelle Abnormitäten des ZNS[*]“ (Möller et al. 2009, S. 142), unter anderem „Athrophien[*] (…) im Hip- 36 pokampus[*], was heute als Ergebnis einer „frühen Hirnentwicklungsstörung“ (ebd.) verstanden wird, und eine „verminderte Durchblutung des Frontalhirns[*]“ (Möller et al. 2009, S. 142), was als „Korrelate kognitiver und anderer Störungen Schizophrener interpretiert [wird]“ (ebd.). Diese Veränderungen sind bereits vor Ausbruch der Erkrankung zu erkennen und werden als einer der Vulnerabilitätsfaktoren betrachtet. Darüber hinaus kommt es im Verlauf der Erkrankung zu weiteren „progressiven Hirnveränderungen“ (ebd.). Einige Untersuchungen weisen darauf hin, dass diese Veränderungen mit einem ungünstigen Verlauf verknüpft sind. Nelson, Saykin, Flashman et al. (1996, in: Assion et al. 2009, S. 33) zeigten in einer Metaanalyse von 18 bildgebenden Studien „eine leichte (4%), aber signifikante, beidseitige Verminderung des Hippokampus[*]-Volumen“ (ebd.) bei schizophren erkrankten Menschen. Stresshormone, beispielsweise Glucokortikoide, bewirken eine Verringerung des Hippokampusvolumens (s. Teil I, Kap.4.1.). Somit erscheint es meiner Ansicht nach denkbar, dass die beschriebenen Veränderungen nicht eine Ursache der Vulnerabilität, sondern bereits die Folge von vermehrtem Erleben von Stress sind. 2.4. Stress als Komponente bei der Krankheitsentstehung Gaebel beschreibt Nuechtereins „Vulnerabilitäts-Stressmodell“ (vgl. Nuechterein 1987, in: Gaebel 2002, S. 89), welches davon ausgeht, dass auf der Grundlage angeborener oder früh erworbener Vulnerabilität bestimmte Stressoren die akute Erkrankung nach einigen „Zwischenstadien“ (ebd.) auslösen. Psychosoziale und therapeutische Faktoren beeinflussen diesen Prozess. Assion et al. befürworten das „Diathese-Stress-Modell (diathesis stress hypothesis)“ (Assion et al. 2009, S. 34). Nach diesem Modell entstehen psychische Krankheiten „auf der Grundlage genetischer Voraussetzungen und dem Einwirken von Stress“ (ebd.). Assion et al. halten diese These für bedeutsam im Hinblick auf den „möglicherweise schädlichen Einflüssen von Stresshormonen, wie den Glucokoritikoiden[*] auf bestimmte Gehirnstrukturen“ (vgl. Yehuda, 1997, in: Assion et al. 2009, S. 34). Möller et al. erwähnen den Begriff Stress nicht explizit, sondern beziehen sich auf die „Life-Event-Forschung“ (Möller et al. 2009, S. 145). Zwar zeigen verschiedene Untersuchungen eine „erhöhte ‚Life-Event‘-Belastung“ (ebd.) vor einer akuten Erkrankung, eindeutige Ergebnisse gebe es aber nicht. 37 Außer den Schädigungen bestimmter Hirnstrukturen beeinträchtigt Stress die soziale Wahrnehmung und ist an der Störung der sensorischen Modulation beteiligt. Neuronale Verbindungen werden destabilisiert. Die adäquate Verarbeitung von Sinnesreizen gelingt nicht mehr, „defensive“ Verhaltensweisen wie die Kampf-oder-FluchtReaktion oder die Erstarrung gewinnen die Oberhand. Von daher erscheint es mir schlüssig, dass Stress bei der Entstehung und Auslösung der Erkrankung beteiligt ist. 2.5. Infektionen Möller et al. weisen auf eine mögliche Bedeutung „virale[r] Infektionen in der vorgeburtlichen oder in der Neugeborenenperiode“ hin (Möller et al. 2009, S. 142). Nach Porges nimmt die Neuroception eine Situation auch dann als „gefährlich“ wahr, wenn es sich um einen Prozess innerhalb des Körpers handelt wie beispielsweise eine fieberhafte Erkrankung (s. Teil I, Kap. 4.2.). Diese Hinweise stützen die These, dass frühes Stresserleben bei der Krankheitsentstehung eine Rolle spielen kann. 2.6. Kognition, Motorik, Kommunkation und Verhalten Nach Gaebel können schon in frühester Kindheit Auffälligkeiten beobachtet werden: „Wie retrospektive Untersuchungen und prospektive ‚High-risk“- Studien (an Kindern mit einem schizophrenen Elternteil) zeigen, ist bereits in frühester Kindheit das motorische und sozialkommunikative Verhalten späterer Schizophrener auffällig gestört, was offensichtlich zur Entwicklung einer gestörten prämorbiden Persönlichkeit mit unter anderem abnormem Interaktionsstil beiträgt.“ (Gaebel 2002, S. 87) Die häufig beschriebenen „familiären Interaktionsstöungen“ (ebd.) schizophrener Patienten lassen sich nach Gaebels Ansicht teilweise aus diesen Auffälligkeiten erklären, teilweise aber auch aus Auffälligkeiten bei den Angehörigen. Gaebel und Wölwer beschreiben im Zusammenhang mit dem Sozialverhalten „Auffälligkeiten Schizophrener, z. B. hinsichtlich Blickverhaltens und Mimik, aber auch im Erkennen emotionalen Gesichtsausdrucks, (…) die zum Teil bereits vor der Krankheitsmanifestation nachweisbar [sind]“ (vgl. Gaebel und Wölwer1996, in: Gaebel 2002, S. 83). Möller et al. nennen im Zusammenhang mit weiteren entwicklungsbezogenen Vulnerabilitätsindikatoren die „motorische Entwicklung“ (Möller et al. 2009, S. 143, Tab. 4.6.), „kognitive Störungen“ (ebd.) und „Verhaltensauffälligkeiten“ (ebd.). 38 Die Hypothese, die „schizoide[*] Persönlichkeit“ (Möller 2009, S. 145) sei typisch, bestätigte sich nicht. Vor der Erkrankung zeigten sich dennoch Auffälligkeiten: „Die später an Schizophrenie Erkrankten wurden vorrangig als passive, unkonzentrierte Kleinkinder beschrieben, die sich in der Schulzeit zu unangepassten Kindern mit störenden Verhaltensweisen entwickelten.“ (Möller et al. S. 145). Die Sichtweise der Polyvagalen Theorie, nach der im Stressmodus die soziale Wahrnehmung eingeschränkt ist, stellt eine mögliche Erklärung der Auffälligkeiten bei der Interaktion dar. Die Auffälligkeiten der Motorik können meiner Ansicht nach, in Anlehnung an die Neurological Soft Signs, als ein Hinweis auf eine Störung der sensorischen Modulation gesehen werden, bei der es ebenfalls Zusammenhänge zu Stressfaktoren gibt. Beides ergibt einen weiteren Hinweis auf mögliche Einflüsse früher, unsicherer Bindungsorganisation, die mit erhöhten Stressparametern einher geht. 2.7. Angehörige schizophrener Patienten Gaebel verweist im Zusammenhang mit Angehörigen auf „sogenannte Spektrumsstörungen mit abnormen Verhaltensweisen“ (Gaebel 2002, S. 87), die zu den Interaktionsstörungen der späteren Patienten beitragen können. Er fragt nach den „Grenzen zwischen schizophrener Störung und psychischer Gesundheit. Familienuntersuchungen zeigen, dass Angehörige Schizophrener, die selbst (noch) keine akute psychiatrische Störung zeigen, gehäuft schizotype[*] Persönlichkeitsstörungen sowie schizophrenieähnliche, aber schwächer ausgeprägte psychobiologische Befundanomalien aufweisen“ (Gaebel 2002, S. 82). Möller et al. beschreiben, dass „während der Kindheit von später an Schizophrenie Erkrankten … oft schwere Störungen in der Beziehung der Familienmitglieder“ bestanden (Möller et al. S. 145). Eltern von später an Schizophrenie Erkrankten zeigen demnach selber psychische Auffälligkeiten und können ihre Familienbeziehungen oft nicht positiv gestalten. Das „schuldzuweisende Konzept der schizophrenogenen Mutter“ (Gaebel 2002, S. 87) wird heute als überholt angesehen, auch die „sog. Double-bind-Theorie“ (Möller et al. 2009, S. 146) wurde empirisch nicht belegt. „Verhaltensauffälligkeiten der Eltern“ (ebd.) scheinen dennoch eine Rolle zu spielen. Unbestritten ist „dass das Zusammentreffen von genetischem Risiko und ungünstige Familienatmosphäre das Risiko der Schizophrenieentstehung im Vergleich zur Konstellation genetisches Risiko und günstige Familienumgebungsfaktoren deutlich erhöhte“ (ebd.). 39 Hier sehe ich Parallelen zur Entwicklung der Bindungssicherheit, bei der das (feinfühlige) Verhalten der Eltern eine größere Bedeutung hat als ein angeborenes „schwieriges“ Temperament des Kindes. Empirische Untersuchungen belegten ein erhöhtes Rückfallrisiko für Schizophrene, die in sogenannten „‘High-expressed-Emotions‘-Familien“ (Möller et al. 2009, S. 145, vgl. Gaebel 2002, S. 87) leben. Gaebel betont in diesem Zusammenhang „emotionale[s] Überengagement“ und „erhöhte[s] Kritikverhalten“ (ebd.), Möller et al. betonen „eine erhöhte kritische Emotionalität und/oder überprotektive Einstellung gegenüber dem Erkrankten“ (Möller et al. 2009, S. 145). Read & Gumley definieren: „‘Expressed Emotion‘ (EE) [ist] ein britischer Euphemismus für feindseliges, kritisches und emotional zudringliches Elternverhalten“ (Read & Gumley 2009, S. 241). Sie kritisieren, dass dieses Verhalten ausschließlich im Hinblick auf Rückfallraten untersucht wurde, seltener jedoch auf seine verursachende Wirkung. Im Gegensatz dazu kam „eine über 15 Jahre hinweg fortgeführte USamerikanische Studie mit Adoleszenten zu dem Schluss, das 36% derjenigen, deren Eltern beide hohe EE-Scores erreichten, mittlerweile die Diagnose ‚Schizophrenie‘ erhalten hatten, verglichen mit 0% in den Fällen, in denen nur eine Elternperson oder keiner der Eltern einen hohen EE-Score erreichte“ (vgl. Goldstein 1987, in: Read & Gumley 2009, S. 241). Eine „einigermaßen sichere Bindung an eine Elternperson“ (ebd.) schwächt die „Folgen des feindseligen (…) Verhaltens der anderen Elternperson“ (Read & Gumley 2009, S. 242). Anhand weiterer Studien kommen die Autoren zu dem Schluss, dass diejenigen, die später „die Diagnose ‚Schizophrenie‘ erhalten“ (ebd.) mit größerer Wahrscheinlichkeit problematische Beziehungen und psychosoziale Konstellationen innerhalb ihrer Familien erlebt hatten12. Während Gaebel den Angehörigen „abnormes Verhalten“ (s. o.) attestiert, sehen Read & Gumley, dass „Trauma- und Verlusterfahrungen der Eltern für die frühe Entwicklung derjenigen, die später eine Schizophrenie entwickeln, relevant sind“ (Read & Gumley 2009, S. 245), sie beziehen also eine mögliche psychosoziale Problematik der Angehörigen in ihre Überlegungen ein. Mir erscheint diese Sichtweise umfassender und als eine bessere Basis für eine mögliche Zusammenarbeit mit den Eltern, sie deckt sich mit Brischs Aussage in Bezug auf die frühe Störung der Interaktion zwischen Eltern und Kind bei unbewältigten traumatischen Erfahrungen der Eltern. 40 Read & Gumley (ebd.): „der vermittelnde Mechanismus [ist] die frühe desorganisierte Bindung des Kindes …“. Ich schließe mich Read & Gumleys Schlussfolgerung an und ergänze sie mit folgender Hypothese: Eine desorganisierte Bindung kann zu einer Störung der Wahrnehmungsverarbeitung und der sozialen Wahrnehmung beitragen. Diese Störung, die sich bei den Neurological Soft Signs, bei sensomotorischen Aufgabestellungen also, zeigt, ist ein möglicher Prädiktor der Schizophrenie. 3. Das Erleben des Körpers bei der Schizophrenie 3.1. Ärztliche Diagnostik Im Folgenden gehe ich zunächst auf die positiven Symptome der Schizophrenie näher ein, die den Körper und die Bewegung betreffen. Gaebel beschreibt für „katatone Schizophrenien … psychomotorische Störungen, die zwischen Erregung und Stupor wechseln können“ (Gaebel 2002, S. 86). Scharfetter beschreibt den Stupor im Zusammenhang mit „Hypokinese“ (Scharfetter 2010, S. 270) und „Akinese“ (ebd.) als „Armut an Bewegungen (Hypokinese) bis Reglosigkeit (Akinese) im Stupor. Spontan oder auf Anregung in Gang kommende Bewegungen werden seltener, der Kranke zeigt auch kaum oder keine mimischen Bewegungen“ (ebd.). Stupor kommt nicht nur in pathologischen Zusammenhängen vor: „stuporähnliche Zustände kommen auch beim Gesunden in plötzlichem Schreck, großer Angst und Ratlosigkeit und in der Panik vor (vgl. Totstellreflex verfolgter Tiere)“ (ebd.). Die Differentialdiagnose des Stupors bezeichnet Scharfetter als schwierig, da eine Kontaktaufnahme mit dem Kranken problematisch ist. Meist sind eine neurologische Untersuchung (EEG) und eine Anamnese erforderlich. Bei der Schizophrenie spricht man von einem „katatone[n] Stupor“ (Scharfetter 2010, S. 271), im Gegensatz zum „depressive[n] Stupor[*]“ (ebd.) bei „schwerster, gehemmter Depression[*]“ (ebd.): „Der katatone Stupor ist zu verstehen als ein Erstarren in Angst und Schreck und Ratlosigkeit bei schwerster Bedrohung des Ich-Bewusstseins in seinen verschiedenen Dimensionen … Wer nicht mehr weiß, dass er noch lebt, wer seiner selbst nicht mehr als Erlebender und Handelnder gewiss ist, wer die Einheit und Abgrenzung seiner selbst nicht mehr sicher weiß, wer seiner Identität verlustig gegangen ist, der kann erstarren“ (ebd., vgl. Möller et al., S. 152). 41 Die von Gaebel angeführte „Erregung“ beschreibt Scharfetter näher: Im Gegensatz zum Stupor kommen „Hyperkinese, katatone Erregung, Raptus“ (Scharfetter 2010, S. 272) vor: „Katatone können manchmal aus dem Stupor heraus plötzlich in schwere Erregung geraten (Raptus), fortdrängen, toben, schreien, gegen die Wände und Türen anrennen oder einen gerade Anwesenden angreifen. (…). Der „katatone Bewegungssturm ist als Ausdruck von Angst zu verstehen: Es ist ein verzweifeltes Anrennen, um sich selbst noch zu spüren, um sich der eigenen Aktivitätsmöglichkeiten noch zu versichern“ (ebd.). Möller et al. ergänzen: Es kommt „zu einer starken motorischen Unruhe mit z. T. stereotypen Bewegungsabläufen, Schreien, Herunterreißen der Kleider, Grimassieren bis zum ungeordneten Bewegungssturm mit SichHerumwälzen, Um-sich-Schlagen, zielloser Aggressivität“ (Möller et al. 2009, S. 152 f.). Beide Reaktionen ähneln den Alarmreaktionen eines Säuglings, die Papousek beschreibt: zum einen die Erstarrung, zum anderen die unkoordinierten Bewegungen. Bei beiden Reaktionen scheint die adäquate, realistische Verarbeitung von Sinnesreizen nicht zu gelingen, die Neuroception (Porges) signalisiert Gefahr, die Großhirnrinde kann dieses Signal nicht korrigieren (Beutel). Die Informationsverarbeitung scheint zusammengebrochen zu sein (Gaebel). Laut Möller et al. kann der Stupor nicht nur bei der Katatonen, sondern auch bei allen anderen Typen der Schizophrenie auftreten. Häufiger allerdings als die volle Ausprägung des Stupor tritt der „Substupor“ (Möller et al. 2009, S. 152) auf: „Häufig kann man dem Kranken in diesem Zustand wie einer Gliederpuppe bestimmte Haltungen oder Stellungen der Gliedmaßen geben, die er dann beibehält (Katalepsie). Der Muskeltonus ist eigenartig verändert im Sinne einer wachsartigen Biegsamkeit (Flexibilitas cerea) der Gliedmaßen“ (ebd., vgl. auch Scharfetter 2010, S. 273). Diese Beschreibung erinnert entfernt an die eingefrorenen Bewegungen, die bei der desorganisierten Bindung beschrieben werden. Die Kooperationsfähigkeit des Patienten kann sich ändern: Der Kranke macht das Gegenteil von dem, was ihm aufgetragen wird, oder er gehorcht mechanisch. „Sinnlose, rhythmisch leer laufende Bewegungen wie Rumpfschaukeln, Klopfen, Grimassieren etc. (Bewegungsstereotypien) treten auf, oder es werden bestimmte Haltungen in stereotyper Weise beibehalten (Haltungsstereotypien…)“ (ebd., vgl. Scharfetter 2010, S. 274). Hier fällt eine Parallele zu den Bewegungsstereotypien auf, die im Zusammenhang mit desorganisierter Bindung beschrieben werden. Scharfetter beschreibt weitere Stereotypien, beispielsweise „stereotype Bewegungen der Hände, wobei die Kranken auf ihre Hände starren“ (ebd.). Er interpretiert, dass 42 „solche Bewegungen der Selbstvergewisserung der eigenen Aktivitätsmöglichkeiten und der eigenen Identität dienen. Diese Annahme findet ihre Bestätigung in der manchmal überraschenden therapeutischen Wirksamkeit von spontanen Berührungen der Hände durch den Therapeuten oder in gemeinsamen Turnübungen (Bewegungstherapie)“ (ebd.). Scharfetter gibt hier einen Hinweis auf eine einfache körperbezogene Intervention. Im Bezug auf körperbezogene Wahnthemen schreibt Röhricht (2007b, S. 261): „Körperbezogene Wahnthemen und Halluzinationen umfassen typischerweise: Penetration, Steuerung der Körperfunktionen von außen, Fehlen einzelner Körperteile, Implantation von Metallen oder anderen Materialien sowie Veränderungen in der geschlechtlichen Identität“ 3.2. Bewegungstherapeutische Diagnostik allgemein Hölter unterscheidet in Bezug auf Bewegungstherapie grundsätzlich zwei verschiedene Zugangsweisen: die naturwissenschaftliche und die geisteswissenschaftliche (vgl. Hölter 2011, S. 79). Bei einem naturwissenschaftlichen Zugang geht es um „die Erfassung und Erklärung von Phänomenen der Welt als Naturtatsachen“ (ebd.), verwendet werden vor allem „quantitativ erfassende und beschreibende Messinstrumente“ (Hölter 2011, S. 80). Im Gegensatz dazu steht bei einem geisteswissenschaftlich orientierten Zugang „der Mensch als Sinnproduzent im Mittelpunkt. Individueller Sinn lässt sich erschließen und verstehen, aber längst nicht immer klassifizierend beschreiben und erklären“ (ebd.). Im deutschsprachigen Raum überwiegt die Orientierung am Verstehen, „es fehlen weitgehend systematisierende, erklärende oder kausal begründbare empirische Befunde“ (ebd.). Im Gegensatz dazu überwiegen im englischsprachigen Raum Untersuchungen, „die in einem engeren naturwissenschaftlichen Sinne erklärend sind“ (ebd.). Für ein umfassendes Verständnis der Problematik sind nach Hölters Ansicht beide Erkenntniswege sinnvoll. Dieser Ansicht stimme ich zu. Röhricht hingegen unterscheidet zwischen einem „psychoanalytische[n] (…) Modell der beeinträchtigten Ich-Psychologie“ (Röhricht 2007b, S. 729) und „kognitivbehaviorale[n] Ansätze[n]“ (ebd.). Das psychoanalytische Modell setzt eine „(primäre oder erworbene) Ich-Schwäche mit primitiven Abwehrmechanismen (...) [voraus]; bei sehr frühen, ‚inkompatiblen‘ Traumata und ungenügender Selbststrukturierung entstehe ein Ambivalenzkonflikt zwischen symbiotisch-fusionären Verschmelzungswünschen versus intensiven Distanzierungstendenzen (und mörderischen Fantasien)“ (ebd.). 43 Röhricht bezieht sich auf Scharfetters Ich-Pathologie aus dem Jahr 1981, die seiner Ansicht nach inzwischen „empirisch validiert[...]“ ist (vgl. Scharfetter 1995, in: Röhricht 2007b, S. 730). Scharfetter beschreibt in einer neuen Auflage „Störungen der basalen Dimensionen des Ich-Bewusstseins“ (Scharfetter 2010, S. 86), von denen eine oder mehrere bei vielen Psychosen, besonders häufig aber bei Menschen mit Schizophrenie vorkommen. Diese Störungen gliedert er in Störungen der „Ich-Vitalität“ (ebd.), „Ich-Aktivität“ (ebd.), „Ich-Konsistenz“ (ebd.), „Ich-Demarkation“ (ebd.), „Ich-Identität“ (ebd.)13. Diese Systematik bildet eine vielzitierte Grundlage der klinischen Bewegungstherapie (vgl. Krietsch & Heuer 1997, S. 11 f.; Röhricht 2007, S. 729; Joraschky & von Arnim 2009, S. 191). Im Gegensatz dazu legen die kognitiv-behavioralen Ansätze den Schwerpunkt „auf die den Verlauf der Erkrankung begleitenden Informationsverarbeitungsstörungen“ (Röhricht 2007, S. 729), auf familiäre Einflüsse und auf „Coping-Stile“ (ebd.). 3.3. Körperbezogene Diagnostik im Hinblick auf Schizophrenie Deimel und Hölter sind der Ansicht, dass sich grundsätzliche „Instrumente, die motorische Basisdimensionen wie Kraft, Ausdauer, Koordination etc. sowie allgemeine Fitness messen“ (Deimel & Hölter 2011, S. 263) für die bewegungstherapeutische Diagnostik auch bei der Schizophrenie eignen. Hesse & Prünte lehnen die „gezielte Erhebung von Auffälligkeiten“ (Hesse & Prünte 2004, S. 169) vor allem am Beginn der Therapie ab, da ihre Intention eher darin liegt, die Patienten zu unterstützen, „zu sich selbst zu finden, eigene Wünsche und Bedürfnisse zu spüren, zu äußern sowie sich Aktivitäten frei zu wählen“ (ebd.). Die Autoren bevorzugen daher Berichte der Patienten über „subjektive Beschwerden im Bereich der Körperwahrnehmung (…) und Verhaltensbeobachtungen während der ergotherapeutischen Behandlung“ (Hesse & Prünte 2004, S. 170). Grundsätzlich stimme ich hier Hesse & Prünte zu, wobei mir vor dem Hintergrund häufiger Begleiterkrankungen, die mit Bewegungsmangel einher gehen, nach einer ersten Stabilisierungsphase auch eine Diagnostik der motorischen Basisfunktionen sinnvoll erscheint. Die spezifische Diagnostik im Hinblick auf Schizophrenie unterteilen Deimel & Hölter in drei Perspektiven: die „neurologisch funktionelle[.) Perspektive“ (Deimel & 44 Hölter 2011, S. 263), die „Erfassung des subjektiven Körpererlebens“ (Deimel & Hölter 2011, S. 264) und die „Bewegungsbeobachtung“ (Deimel & Hölter, S. 267). Ich halte diese Aufteilung für umfassend und schlüssig und werde mich daran anlehnen. Hesses & Prüntes Beschreibungen von Untersuchungen zu den Neurological Soft Signs ordne ich, neben einer allgemeinen Beschreibung von Hölter, in die „neurologisch funktionelle Perspektive“ ein. Dazu nenne ich eine Studie von Mohr et al., die Resch erwähnt. In der Kategorie „Erfassung des subjektiven Körpererlebens“ greife ich aus Deimels & Hölters Aufzählung die Ergebnisse zweier Untersuchungen von Röhricht & Priebe zu Körperbild und Körperschema sowie den Körperbildskulpturtest von Joraschiky heraus. Außerdem ordne ich einen Fragebogen von Hesse & Prünte nach subjektivem Erleben in Bezug auf Störungen der sensorischen Integration in diese Kategorie ein. In der Kategorie „Bewegungsbeobachtungen“ beschreibe ich eine Untersuchung von Hesse & Prünte: Die Autoren entwickelten eine kategoriale Analyse, nachdem sie 10 Jahre lang unsystematisch Patienten im Hinblick auf Verhaltensweisen, die mit einer Störung der Sensorischen Integration zusammenhängen können, beobachtet hatten. 3.3.1. Die neurologisch-funktionelle Perspektive: In diesem Zusammenhang seien zunächst Hölters grundsätzliche Beschreibungen erwähnt: „Viele psychische Erkrankungen sind mit Auffälligkeiten in der Koordination verbunden: sei es mit Schwierigkeiten in der Feinkoordination, die sich z.B. in der Schrift äußern können, oder mit grobkoordinatorischen Schwierigkeiten, z.B. beim Gebrauch von Messer und Gabel oder beim Treppensteigen, beim Rückwärtslaufen und anderen einfachen koordinatorischen Anforderungen“ (Hölter 2011, S. 81). Schon Kraepelin und Bleuler beschreiben Auffälligkeiten bei Menschen mit Schizophrenie, die man heute als Neurological Soft Signs bezeichnen würde (vgl. Kraepelin 1904; Bleuler 1911, in: Hesse & Prünte 2004, S. 84 f.). Diese Auffälligkeiten wurden allerdings erst seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Rahmen der „Forschungsrichtung der biologischen Psychiatrie“ (Hesse & Prünte 2004, S. 85) wieder mehr beachtet, da man sich Erkenntnisse über „gestörte physiologische Prozesse und über Störungen des ZNS[*] (…) verspricht“ (ebd.). Sehr viele neuere Studien zeigen, 45 „dass schizophrene Personen mehr bzw. stärker ausgeprägte Neurological Soft Signs zeigen als Personen aus der Allgemeinbevölkerung, als Personen mit affektiven Störungen sowie Personen mit einem Substanzabusus“ (Hesse & Prünte 2004, S. 87)14. Die Neurological Soft Signs zeigen sich gehäuft während der akuten psychotischen Episode und bleiben unterschiedlich lange bestehen: Sie bauen sich in einem Zeitraum von wenigen Tagen bis zu zwei Jahren kontinuierlich ab15. „Es lässt sich aber feststellen, dass es bei einer Subgruppe von schizophrenen Personen nicht zu einer Rückbildung der Neurological Soft Signs kommt. Dabei handelt es sich in erster Linie um Personen mit einer chronisch verlaufenden schizophrenen Störung, die oft schon vor deren Ausbruch sozial schlechter angepasst waren (…)“ (ebd.). Bei ungefähr einem Drittel der Menschen mit Schizophrenie zeigen sich „über zwei Jahre hinweg relativ stabile Neurological Soft Signs“ (vgl. Wahlheim et al. 1999, in: Hesse & Prünte 2004, S. 87). Demnach scheint es sich bei einem Teil der Menschen mit Schizophrenie um stabile, bei einem anderen Teil um vorübergehende Auffälligkeiten zu handeln. „Die meisten Autoren gehen davon aus, dass neurological soft signs nicht allein auf Neuroleptika zurückgeführt werden können“ (Hesse & Prünte 2004, S. 88), unter anderem, weil Kraepelin und Bleuler lange vor der Ära der Psychopharmaka Ähnliches beschrieben hatten. Resch verweist auf vergleichbare Ergebnisse: Mohr et al. (1996, in: Resch 2008, S. 812) zeigten, „dass vor allem chronisch schizophrene Patienten eine vermehrte Anzahl von neurologischen ‚Soft Signs‘ aufweisen, wenn man sie mit schizophrenen Patienten in anderen Stadien der Krankheit, einer Kontrollgruppe von alkoholabhängigen Patienten und mit gesunden Erwachsenen vergleicht“ (ebd.) 3.3.2. Erfassung des subjektiven Körpererlebens Bei dieser Perspektive unterscheiden Deimel & Hölter zwischen Körperschema und Körperbesetzung: „Körperbesetzung (Body cathexis) meint die Zufriedenheit mit Teilen des Körpers und seiner Funktionen. Als Körperschema werden hingegen das Bewusstsein und die Anschauung des eigenen Körpers sowie die Verwendung dieser Informationen im Handeln bezeichnet“ (vgl. Schilder 1923, in: Deimel & Hölter 2011, S. 264) Röhricht kritisiert, dass die diesbezüglichen Begriffsbestimmungen häufig unklar sind. Er orientiert sich bei dem Begriff des Körperschemas an neurologischen Zusammenhängen: 46 „(…) Vorstellungsbilder vom eigenen Körper sind schematisch strukturiert, aufgebaut aus neuronal gespeicherten Erinnerungen und sinnesphysiologisch organisierten Reizinformationen.“ (vgl. Poeck & Orgas 1963 S. 539, in: Röhricht 2007a, S. 257). In diesem Zusammenhang zitieren Poeck & Orgas Head: „An dem Schema erhält die Empfindung ihren Bezug zum Körperganzen, bevor sie bewusst wird“ (Head 191116, in: Poeck & Orgas 1964, S. 540). Röhricht (2007a, S. 257): „Demnach werden alle hinzukommenden Sinneswahrnehmungen auf dieses Schema bezogen und führen gleichzeitig zur kontinuierlichen Neustrukturierung des Schemas“ Der Begriff des Körperbilds jedoch beinhaltet die „subjektive[...] Erlebniswirklichkeit“ (Hartmann & Schilder 1927, in: Röhricht 2007a, S. 257), damit wird der Begriff des Körperschemas um die „psychologische Dimension“ (Röhricht 2007a, S. 258) erweitert, allerdings ohne „definitorische Grenzziehung“ (ebd.) zu den „neurophysiologischen Konzepten“ (ebd.). Röhricht & Priebe verwendeten im Zusammenhang mit dem subjektiven Körpererleben den “Body Disortion Questionaire von Fisher“ (Röhricht & Priebe 1998, S. 96)17 in einer deutschsprachigen Fassung (Meermann 1985, in: Röhricht & Priebe 1998, S. 96). Die sieben Subskalen umfassen „Large / Small / Boundary loss / Dirty / Blocked openings / Skin / Depersonalization“ (Röhricht & Priebe 1998, S. 96) Bei der Aufnahme zeigten sich bei vielen Patienten insbesondere bei „Aussagen zum Körpergrenzverlust (‚Boundary loss‘)“ (Röhricht & Priebe 1998, S. 97) Störungen18. Ungefähr 50% der Patienten gaben zu den Faktoren „Large“ (ebd.), , „Blocked openings“ (ebd.) „Boundary loss“ (ebd.) und „Depersonalization“ (ebd.) an19. Bei der Entlassung gaben die Patienten für alle Bereiche signifikant weniger Störungen an. Lediglich zwei Items, die sich auf die Empfindungen „ungewöhnlich schwer“ (ebd.) und „dick“ (ebd.) bezogen, wurden noch häufig angegeben20. Bei dem zweiten Verfahren geht es um die Erfassung des Körperschemas. Die Probanden zeichnen, nach gezielter Stimulation bestimmter Körperstellen durch einen Gegenstand, auf einem Plakat an der Wand die geschätzte Distanz der stimulierten Körperstellen ein. Das wird mit der realen Distanz verglichen. (Vgl. Röhricht 1998, S. 92). Röhricht fasst das Ergebnis zusammen: „Im Ergebnis zeigte sich, dass die Körperperipherie von den schizophrenen Patienten absolut und im Vergleich mit der Kontrollgruppe unterschätzt bzw. geschrumpft wahrgenommen wird. Dagegen werden die Kopfdistanzen in der Tendenz in Übereinstimmung mit der Kontrollgrup- 47 pe übergroß empfunden. (…) Für die Körpermaße Tailie, Hüfte und Bauchumfang erfolgte eine genauere Einschätzung durch die Patienten bei Überschätzung in der Kontrollgruppe“ (Röhricht 1998, S. 94). Er interpretiert: „Der Gesunde hat mit dieser Grenzverlagerung einen vorgelagerten äußeren Schutzwall errichtet […] Schizophren erkrankte Menschen verfügen offenbar nicht über diese Fähigkeit zur kohärenten Ausdehnung des Körperschemas und sind daher den auf sie einwirkenden Außenreizen unmittelbar ausgesetzt“ (Röhricht 1998, S. 95, vgl. Hesse & Prünte 2004, S. 118). Bis zur Entlassung bildeten sich diese Veränderungen nur teilweise zurück. Insbesondere bei der signifikanten Unterschätzung der Waden zeigte die Untersuchung Übereinstimmungen mit anderen Untersuchungen (vgl. Röhricht 1998, S. 94)21. Hesse & Prünte fragen in diesem Zusammenhang nach Ursache und Wirkung: „Führen Störungen der sensorischen Integration zu einem ungenügenden Körperschema und damit zu einer fundamentalen Schwächung des Ich? Oder führen psychische Konflikte zu einer Erschütterung des Ich-Erlebens, so dass es als Selbstschutz- und Bewältigungsversuch zu einer Einengung des Ichgefühls, somit sekundär zu einem veränderten Körpererleben kommt“ (Hesse & Prünte 2004, S. 118)? Im Rahmen von ergotherapeutischen und psychotherapeutischen Behandlungen stationär aufgenommener Patienten mit Schizophrenie sammelten die Autoren zehn Jahre lang Beschreibungen über subjektive Beschwerden, die sich ihrer Ansicht nach mit Schwierigkeiten bei der Verarbeitung basaler Sinneseindrücke erklären lassen. Sie ordneten diese Aussagen in folgende Bereiche: • „Taktile[*] Überempfindlichkeit und Stimulusvermeidung (…) Berührungen der Haut werden schon da wahrgenommen, wo sie normalerweise unbewusst bleiben bzw. wo die weitere Verarbeitung dieser Eindrücke sonst gehemmt wird (…)“ (Hesse & Prünte 2004, S. 171). • „Taktile[*] Unterempfindlichkeit und Stimulussuche“ (Hesse & Prünte 2004, S. 172). Die Patienten können „taktile Eindrücke nicht angemessen wahrnehmen und verarbeiten“ (ebd.). Die Patienten erleben dieses als „sehr verunsichernd …, weshalb sie gezielt nach starken taktilen Eindrücken suchen“ (ebd.). Da sie sich dieses Verhalten selber nicht erklären können, ist es ihnen manchmal „peinlich“ (ebd.), sie tun so, „als ob sie nur zufällig Gegenstände betasten oder mit den Fingern an Wänden entlang streichen“ (ebd.). • „Vestibuläre[*] Überempfindlichkeit und Stimulusvermeidung“ (ebd.). Bereits „geringfügige Bewegungen verursachen Schwindel und Unwohlsein“ (ebd.). Die Patienten vermeiden nach Möglichkeit vestibuläre Stimulation, was aber nicht 48 immer möglich ist. Beim Gehen haben diese Patienten „das Gefühl, der Boden scheine sich zu heben und zu senken“ (Hesse & Prünte 2004, S. 173). • „Vestibuläre[*] Unterempfindlichkeit und Stimulussuche“. Bei diesen Patienten tritt fast kein Schwindelgefühl auf, sie erleben auch extreme Bewegungen als angenehm. Sie schaukeln gerne auch beim Sitzen mit dem Oberkörper hin und her, manchmal auch unbewusst. Andererseits „fällt es diesen Patienten schwer, sich selbst ruhig zu halten, sie sind wibbelig und können kaum still sitzen“ (ebd.). Diese Patienten fühlen sich in der Regel beim Sport wohl. • „Propriozeptive[*] Störungen und Probleme der motorischen Koordination“ (ebd.). Die Patienten „spüren ihre Arme, ihre Beine oder ihren ganzen Körper nicht richtig, sie können ihre Bewegungen nicht genau nachvollziehen und ihre Kräfte nur unzureichend dosieren“ (Hesse & Prünte 2004, S. 173 f.). Sie wirken auf andere „tolpatschig“ (Hesse & Prünte 2004, S. 174) und benötigen für viele Bewegungen „visuelle Kontrolle“ (ebd.). Teilweise verletzen sie sich selber, um „sich selbst zu spüren“ (ebd.). Auf der Grundlage dieser Differenzierung entwickelten die Autoren einen Fragebogen, in dem schizophrene Patienten gezielt nach entsprechenden subjektiven Beschwerden gefragt werden. Sie verglichen die Aussagen schizophrener Patienten mit denen einer Gruppe von alkoholabhängigen Patienten und einer Gruppe von Nicht-Patienten. Die Gruppe der schizophrenen Patienten gab in allen Kategorien mehr Beschwerden an, was durch die Bewegungsbeobachtungen, auf die ich weiter unten eingehe, bestätigt wurde (vgl. Hesse & Prünte 2004, S. 177, Abb.17). Viele Patienten äußerten darüber hinaus, dass sie bei diesen Fragen sich „sehr gut verstanden“ (Hesse & Prünte 2004, S. 178) fühlten. Einige „versuchten, ihre Beschwerden herunterzuspielen“ (ebd.), weil es ihnen unangenehm war, so viele Symptome zu haben. Daher gehen die Autoren davon aus, dass die Patienten eher zu wenige als zu viele Symptome angegeben hatten. Die Wirkung der neuroleptischen Medikamente wurde in dieser Studie nicht untersucht. Die Autoren gehen davon aus, dass die stärker sedierende Medikation zu Beginn der stationären Behandlung eher negative Wirkungen auf die Wahrnehmung basaler Sinneseindrücke hat, während die modernen, atypischen Neuroleptika die psychotischen Symptome und damit auch die Verarbeitung basaler Sinneseindrücke verbessernde Wirkung haben (vgl. Hesse & Prünte 2004, S. 178 f.). Als letzter in dieser Kategorie sei der „Körperbild-Skulpturtest“ (Joraschiy et al. 1998; Jorachiky/von Arnim 2009, in: Deimel & Hölter 2011, S. 266) angeführt, bei dem es 49 sich um einen qualitativen Test handelt. Der Proband formt mit geschlossenen Augen und ohne Zeitvorgaben eine menschliche Figur aus Ton. In der Auswertung wird er befragt über den „Prozess des Modellierens selbst“ (ebd.) und über „Fantasien, Ängste und Erinnerungen“ (ebd.). Außerdem kann die Figur im Hinblick auf „Vollständigkeit, Proportionalität und Verbundenheit“ (ebd.) beurteilt werden. Joraschky & von Arnim sehen bei schizophrenen Patienten „häufig ‚künstlerische‘, stark symbolisierte Skulpturen, die qualitativ eingeschätzt werden müssen“ (Joraschky & Arnim 2009, S. 189), im Gegensatz zu „klinisch unauffälligen Personen, bei denen in der Regel eine strukturell formale Analyse möglich ist“ (ebd.). „Fragmentierungen, Körpergrenzstörungen und Identitätsstörungen lassen sich sehr gut erfassen. Im Verlauf werden die Integrationsprozesse und die zunehmende Selbstkonsistenz deutlich“ (ebd.). Die Autoren beschreiben ein Beispiel aus einer Pilotstudie, bei der eine Patientin kurz nach ihrer stationären Aufnahme in 50 Minuten eine fragmentierte Skulptur herstellt und dabei häufig „ratlos“ (Joraschky & von Arnim 2009, S. 190) wirkt. Vor der Entlassung gelingt ihr eine zusammenhängende Skulptur, bei der sie lediglich die Arme „vergessen“ (ebd.) hat, in vier Minuten22. Dieser Test vermittelt nach Ansicht der Autoren einen Eindruck über die „IchKonsistenz und die Integrationsprozesse im Krankheitsverlauf“ (Joraschky & Arnim 2009, S. 191) bietet. Er eignet sich gut für eine Diagnostik der „Ich-Gefühlsstörungen entsprechend den Dimensionen von Scharfetter“ (ebd., vgl. auch Fußnote 13). Das Körperschema stellt nach der Theorie der sensorischen Integration die Grundlage für ein gutes Selbst-Gefühl dar. Bei diesen Untersuchungen werden die weitreichenden Auswirkungen einer Störung des Körpererlebens auch auf andere Bereiche deutlich, die mit der Erkrankung der Schizophrenie häufig im Zusammenhang stehen. 3.3.3. Bewegungsbeobachtungen Eine letzte Perspektive sind „Bewegungsbeobachtungen“ (Deimel & Hölter 2011, S.267). Hesse & Prünte sammelten im Verlauf von zehn Jahren unsystematische „Verhaltensbeobachtungen“ (Hesse & Prünte 2004, S. 181) im Rahmen von Angeboten zur Sensorischen Integration, einer kompetenzzentrierten Ergotherapie und der Arbeitstherapie. Sie beschreiben verschiedene beobachtbare Auffälligkeiten: 50 „Auffälligkeiten des Ganges und der Körperhaltung“ (Hesse & Prünte 2004, S. 182): Unter anderem bleibt der Oberkörper häufig starr, die Arme schwingen nicht mit. Wenn die an Schizophrenie Erkrankten nach der Seite schauen, vermeiden sie es, den Kopf zu drehen, sondern drehen sich ganz um. „Auffälligkeiten bei der Bewegung“ (ebd.): Einige Patienten „stimulieren oder beruhigen sich selbst durch Dreh- oder Schaukelbewegungen“ (ebd.). Manche Patienten haben schon bei geringen Bewegungen „vegetative Reaktionen wie Schwindel, Übelkeit o.ä.“ (Hesse & Prünte 2004, S. 182 f.) Einige haben keine Abstützreaktion, wenn sie fallen, verletzen sie sich dem entsprechend relativ schwer. „Auffälligkeiten bei Berührungen“ (Hesse & Prünte 2004, S. 183): Einige Patienten vermeiden Körperkontakt, wollen niemandem die Hand geben und zucken zurück, wenn jemand sie zufällig berührt. Einige berühren Materialien nur mit den Fingerspitzen und vermeiden Berührungen mit der Handinnenfläche. Manche haben offensichtlich ein zu geringes Schmerzempfinden: sie machen einen Abwasch mit viel zu heißem Wasser oder bemerken kleine Verletzungen nicht. „Auffälligkeiten der motorischen Koordination“ (Hesse & Prünte 2004, S. 184): Viele haben fein- und grobmotorische Schwierigkeiten bei handwerklichen Arbeiten, bei denen es auf genaues Arbeiten ankommt. Einigen fällt es schwer, ihre Kraft angemessen zu dosieren. Kleinere „Missgeschicke“ (ebd.) passieren häufig. Hesse & Prünte sehen diese Verhaltensweisen als „indirekte Anzeichen für Störungen der sensorischen Integration“ (ebd.). Bei der Interpretation halten sie Vorsicht für angebracht: Diese Merkmale können beispielsweise durch „die medikamentöse Behandlung, psychotische Erlebnisse oder einen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus“ (ebd.) hervorgerufen werden. Die Autoren entwickelten auf dieser Grundlage eine „‘Checkliste zur Verhaltensbeobachtung zu Störungen der sensorischen Integration bei schizophrenen Patienten‘“ (Hesse & Prünte 2004, S. 185). Anhand dieser Checkliste systematisierten sie die beobachteten Auffälligkeiten und dokumentierte Verbesserungen. Die Autoren führten eine „Faktorenanalyse“ (Hesse & Prünte 2004, S. 186) durch, bei der sich fünf Faktoren ergaben, für die ihrer Ansicht nach eine Interpretation sinnvoll erscheint: „Faktor 1: Übermäßige Bewegungen“ (Hesse & Prünte 2004, S. 187) werden als „ungenügende Verarbeitung des propriozeptiven[*] Feedbacks über eigene[...] Bewegungen“ (ebd.) interpretiert. 51 „Faktor 2: Störungen des Körperschemas“ (ebd.) zeigen sich beispielsweise in einer „Vernachlässigung der Körperpflege“ (ebd.) und einer „ungenügend[en]“ (ebd.) „Koordination der beiden Körperhälften“ (ebd.). „Faktor 3: Vestibuläre Überempfindlichkeit“ (ebd.). Die Patienten klagen über Schwindel, ohne „starke Bewegungen“ (ebd.). Die Autoren sehen „Passivität und Unlust“ (ebd.) in einem Zusammenhang mit Vermeidung vestibulärer Überstimulation. „Faktor 4: Psychomotorische Verlangsamung“ (ebd.). Hierdurch drückt sich möglicherweise eine „allgemeine Energielosigkeit“ (ebd.) aus. „Faktor 5: Modulationsstörung im taktilen Bereich“ (ebd.). Die Patienten vermeiden einerseits „diffuse Gegenstände“ (ebd.) und berühren Gegenstände „nur mit den Fingern“ (ebd.). Andererseits zeigen sie ein „verringertes Schmerzempfinden“ (ebd.). 3.4. Zusammenfassung Ich fasse zusammen: Bei ärztlichen Diagnostik in der Akutphase wird der Stupor als ein Erstarren in Angst und Schreck, der Substupor als teilweises Erstarren verstanden; bei der katatonen Erregung werden stereotype und/oder unkoordinierte Bewegungen beobachtet. Außerdem werden leibbezogene Halluzinationen beschrieben. Bei der bewegungstherapeutischen Diagnostik wird einerseits zwischen eher naturwissenschaftlich orientierter und eher sinnbezogener Diagnostik, andererseits auch zwischen tiefenpsychologischer und kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ausrichtung unterschieden. Speziell im Hinblick auf Schizophrenie werden vier verschiedene Kategorien der Diagnostik unterschieden bei denen die eben genannten Kategorien unterschiedlich gewichtet sind: 1. Allgemein: Die Prüfung körperliche Fitness und Koordination kann bei allen psychiatrischen Erkrankungen sinnvoll sein; problematisch ist für Patienten unter Umständen das explizite Erleben von weiteren Defiziten. 2. Funktional neurologische – Neurological Soft Signs zeigen sich in der Akutphase häufig; bei einigen Patienten treten sie lange vor und nach der akuten Phase auf. 3. Subjektives Körpererleben – Hier zeigten sich vor allem Körpergrenzverlust und ein peripher eingeengtes Körperschema. Aus Sicht der Theorie der sensorischen Integration zeigten sich Beschwerden im Zusammenhang mit der 52 Wahrnehmung basaler Sinnesreize. Eine Untersuchung mit Körperbildskulpturen aus Ton zeigte fehlende Kohärenz der Skulpturen. 4. Eine Verhaltensbeobachtung über zehn Jahre im Zusammenhang mit sensorischer Integration führte zu Kategorien, die häufig vorkommende auffällige Verhaltensweisen in Zusammenhang mit Störungen der sensorischen interpretieren. Diese klar beschriebenen Symptome auf allen vier Ebenen zeigen, dass die Sensomotorik bei der Erkrankung der Schizophrenie häufig einbezogen ist. Daher sollten Präventions- und Therapieansätze diesen Gesichtspunkt berücksichtigen und körperbezogene Interventionen mehr in ihr Programm einbeziehen. Teil III: Prävention und Therapie 1. Der Begriff der Prävention Faltermeyer unterscheidet im Sinne von Caplan (1964, in: Faltermaier 2005, S. 294) zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention: „Während primäre Prävention alle Maßnahmen bezeichnet, die vor dem Beginn einer Krankheit ansetzen, beschreibt sekundäre Prävention Maßnahmen, die bei bereits eingetretenen Krankheitssymptomen eine Krankheit möglichst früh erkennen und ein Fortschreiten verhindern sollen. Schließlich bezieht sich tertiäre Prävention auf eine bereits voll entwickelte Krankheit, und auf jene Maßnahmen, die schwerwiegende Folgen verhindern sollen; tertiäre Prävention lässt sich somit nahezu gleichsetzen mit Interventionen und Rehabilitation“ (Faltermaier 2005, S. 294 f.). Gaebel bezieht sekundäre Prävention auf Rückfallprophylaxe, tertiäre Präventionsund Rehabilitationsmaßnahmen umfassen soziale Wiedereingliederung und Verhinderung von Chronifizierung. Primäre Prävention wird von ihm nicht näher beschrieben (Vgl. Gaebel 2002, S. 93). Ruhrmann, Schultze-Lutter, Paruch & Klosterkötter unterscheiden im Sinne des Konzepts des US-amerkikanischen Commitee on Prevention of Mental Disorders zwischen „universellen, selektiven und indizierten Präventionsmaßnahmen“ (vgl. Mrazek et al. 1994, in: Ruhrmann et al. 2009, S. 214): „Universelle Maßnahmen zielen auf eine Bevölkerungsgruppe ohne erkennbares individuelles Risiko (…) Selektive Maßnahmen wenden sich an medizinisch unauffällige Personen mit einem signifikant erhöhten Erkrankungsrisiko, etwa aufgrund einer familiengenetischen Belastung durch einen nahen Verwandten mit einer schizophrenen Psychose. Indizierte Präventi- 53 onsmaßnahmen schließlich sind vorgesehen für Personen, bei denen aufgrund minimaler, aber erkennbarer Vorzeichen oder im Sinne des diagnostischen Referenzsystems (DSM, ICD) subschwelliger Frühsymptome oder auch aufgrund biologischer Prädispositionsmarker (…) ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer klinisch manifesten Störung angenommen werden kann“ (Ruhrmann et al. 2009, S. 214). 2. Prävention im Säuglingsalter Ruhrmann et al. halten in Bezug auf Schizophrenie universelle Maßnahmen „aufgrund der komplexen Entstehungsbedingungen“ (ebd.) für unrealistisch, auch wenn verschiedene Maßnahmen diskutiert werden, beispielsweise „intensivierte Schwangerschafts- und Geburtsbetreuung bei schizophrenen Müttern oder … früh einsetzende, gezielte Stärkung von Stress-Bewältigungsverhalten“ (Ruhrmann et al. 2009, S. 214). Ruhrmann et al. sind skeptisch gegenüber diesem Ansatz, weil die „Kosten-NutzenRelation“ (Ruhrmann et al. S. 214) für die einzelnen Personen aufgrund der Schwierigkeiten einer genauen Vorhersage schwer überprüft werden kann. Dieser Argumentation folge ich nicht, zum einen aus ethischen und humanitären Gründen, zum anderen, weil die Behandlungs- und Folgekosten schizophrener Erkrankungen, wie oben ausgeführt, denen anderer „Volkskrankheiten“ durchaus vergleichbar sind. Gaebel ist der Ansicht, dass zu primärer Prävention noch keine Aussagen gemacht werden können, dass aber primäre Prävention erprobt werde. Da, wie ich ausgeführt habe, vieles dafür spricht, dass eine unsichere oder gar desorganisierte Bindung eine Entwicklung zur Schizophrenie oder anderen schweren psychischen Erkrankungen begünstigt, betrachte ich Interventionen, die die Bindung zwischen einem Säugling und seinen Hauptbezugspersonen verbessern, auch im Zusammenhang mit Schizophrenie als universelle, selektive oder primäre Prävention. Es stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, den Körper in diese Prävention einzubeziehen. Downing thematisiert bei den Interaktionen zwischen Bezugspersonen und Säugling explizit den körperlichen Aspekt. Er greift auf, dass die Interaktion des Säuglings mit seinen Bezugspersonen heute in der Säuglingsforschung oft thematisiert wird. Von Anfang an interessiert sich der Säugling für Gesichter und beginnt, die Mimik der Bezugspersonen zu imitieren. (vgl. Dornes 1993, in: Downing, 2007, S. 333). Diesen 54 Gesichtspunkt ergänzt Downing, indem er genauer beschreibt, wie der ganze Körper des Säuglings und auch der Mutter in die Interaktion involviert ist. „Natürlich wird das Kind schauen. Aber wie oft? Wie lange? Aus welchem Winkel? Mit welcher Frequenz wird es sich dabei selbst berühren? Mit welchem Muskeltonus? In welchem Kontext von Interaktionen? Mit welcher erkennbaren Absicht? Und in welcher Weise koordiniert mit den Signalen der Eltern?“ (Downing, 2007, S. 334). Hier sieht Downing bereits individuelle Unterschiede, begründet einerseits vom Temperament des Säuglings, andererseits stellt sich der Säugling bereits auf seine Bezugspersonen ein, jedoch nicht nur mit dem Blick, sondern mit dem ganzen Körper (vgl. ebd.). Der Säugling versucht, mit „strategischen Manövern“ (Downing 2007, S. 335) Kontakt zu der Bezugsperson herzustellen. Diese „Manöver“ (ebd.) nennt Downing „körperliche Mikropraktiken“ (Downing 2000, in: Downing, 2007, S. 335): „Es handelt sich um Kompetenzen eigener Art, um verkörperte Fertigkeiten. Sie stehen für das, was gelegentlich als prozedurales oder implizites Wissen bezeichnet wird, einem ‚Wissen-Wie’ im Unterschied zu einem ‚Wissen-Dass’“ (Downing, 2007, S.335). Im Unterschied zu einem Reflex, bei dem es sich um eine „einfache Sequenz von Reiz und Reaktion“ (ebd.) handelt, ist eine körperliche Mikropraktik „variabel und zielorientiert“ (ebd.). Sie erfordert mitunter einen großen Körpereinsatz, schließt eine kognitive Ebene ein und ist damit auch von mentalen Repräsentationen begleitet. Im Verlauf der ersten Lebensmonate werden diese Mikropraktiken vielfältiger. Beim Saugen und Schlucken handelt es sich im Gegensatz dazu um angeborene Bewegungen. Von den frühen Psychoanalytikern wurde dabei der orale Aspekt betont. Dieser Aspekt ist auch für Downing durchaus wichtig. Um jedoch diese Fähigkeiten „richtig zu mobilisieren, muss der Säugling lernen, seinen ganzen Körper auf die richtige Art und Weise zu organisieren: Er muss entspannt und doch ein bisschen wachsam sein, er muss es zulassen, dass sein Körper gehalten wird, und zugleich eine Feinabstimmung zwischen Kopf und Halsmuskeln herstellen“ (Downing, 2007, S. 336). Dieser Vorgang hat sehr viel damit zu tun, wie die Mutter ihren Körper organisiert, mit ihrer „Haltung, ihre[r] Atmung, de[m] Rhythmus ihrer Bewegungen, und wie sie den Säugling hält …“ (ebd.). Der Säugling baut Mikropraktiken auf, die auf die Haltung der Mutter abgestimmt sind. Im Kontakt mit anderen Personen, Familienmitgliedern oder Betreuungspersonen, baut der Säugling wieder neue, andere Mikropraktiken auf, die er wiederum in seinen Kontakt mit der Mutter einbaut (vgl. ebd.). Das Repertoire an Mikropraktiken des ersten Lebensjahres wird später auf vielfältige Art und Weise überlagert. Es ist nicht bekannt, „… wie viel aus dem ursprünglichen 55 Repertoire überdauert und auf die eine oder andere Weise bei dem heranwachsenden Kind und dem späteren Erwachsenen wirksam bleibt“ (Downing, 2007, S. 338). Downing vermutet, dass das „nicht wenig sein [wird], (…) wenn auch in stark veränderter Form. Vermutlich ereignen sich zahlreiche Modifikationen, darüber hinaus auch die Tilgung mancher und die Neuentwicklung anderer Praktiken. Ein schweres Trauma … kann etwa zur Entwicklung neuer defensiver Körperstrategien führen“ (ebd.) Vor diesem Hintergrund erscheint es mir sinnvoll, zwei Präventionsansätze herauszugreifen, die den Körper und die motorische Entwicklung des Säuglings explizit einbeziehen. Zunächst werde ich das Prager-Eltern-Kind-Programm (PEKiP) vorstellen, dabei werde ich den Schwerpunkt auf die Anteile des Programms legen, die die explizite Förderung der Motorik zum Inhalt haben. Anschließend werde ich Piklers Ansatz darstellen, bei dem adäquate Anreize für die selbständige motorische Entwicklung des Säuglings einen Schwerpunkt bilden. 2.1. PEKiP 2.1.1. Entwicklung des Konzepts Der tschechische Psychologe Jaroslaw Koch setzte sich in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts intensiv mit der Krippenerziehung auseinander. Die in der damaligen Tschechoslowakei üblichen „Wochen- und Ganztagskrippen“ (Zdenek 2004, S. 13) für Kinder unter drei Jahren wirkten sich auf die Kinder häufig ungünstig aus. Diese Strukturen waren vorgegeben, Koch wollte aber zumindest den ungünstigen Auswirkungen entgegen arbeiten. Gemeinsam mit seiner Frau entwickelte er Ausbildungsstandards für Kinderschwestern. Die Schwestern bekamen beispielsweise „Bewertungsformulare[...] …, anhand derer sie die Entwicklung jedes einzelnen ihnen anvertrauten Kindes verfolgen und bewerten sowie falls gegebenenfalls erforderlich sofort eingreifen konnten, falls ein Kind hinter den Normwerten zurück blieb“ (Zdenek 2004, S. 14). Außerdem beobachtete er die individuellen „Biorhythmen“ (ebd.) der Kinder, die Phasen der Aktivität und Ruhe. Schließlich ließ er durch Studenten die Interaktionen der Schwestern mit den einzelnen Kindern ihrer Gruppe beobachten. Diese Beobachtungen bestärkten seine Auffassung, die Individualität des Kindes „in jeder Interaktion zur Kenntnis zu nehmen und zu respektieren“ (ebd.) 56 In den sechziger Jahren änderte sich die Gesetzgebung in der Tschechoslowakei „zu Gunsten der Familie“ (ebd.). Koch erarbeitete in dieser Phase eine „Methodik zur Entwicklungsförderung von Säuglingen und Kleinkindern“ (Zdenek 2004, S. 15), in der er seine früheren Ideen weiter entwickelte. Man hatte ihm vorgeworfen, er habe durch „übertriebenes ‚Turnen‘ die Entwicklung der Kinder eher disharmonisiert als beschleunigt“ (ebd.). Daraufhin erweiterte er seine Methode im Sinne einer „naturgemäßen Stimulation der gesamten Persönlichkeitsentwicklung des Kindes … – und zwar in freudvoller, aktiver Interaktion von Eltern und Kind“ (ebd.). In der Tschechoslowakei stieß er mit diesem Konzept auf lebhaftes Interesse, ebenso in anderen Ländern. Damit beginnt PEKiP, das sich auch heute noch „zu Dr. Kochs Vermächtnis … laut und gerne bekennt“ (ebd.). In Anlehnung an Untersuchungen von Hebb (1949, in: Höltershinken & Scherer 2004, S. 18) zur „sensorischen Deprivation“ (ebd.) will Koch „die Bewegungsdeprivation der Säuglinge kompensieren“ (Höltershinken & Scherer 2004, S. 18). Koch hält die Stimulation der Bewegung von den ersten Lebenstagen an für sinnvoll: „Durch die Entfaltung der Bewegungen entfalten wir das ganze Kind – die freie Bewegung ist eine der wichtigsten physiologischen und psychologischen Grundbedürfnisse“ (Koch 1969, in: Scherer 2004, S. 37). Die Bewegung des Säuglings wird seiner Ansicht nach in der heutigen Kultur von Anfang an eingeschränkt, beispielsweise durch die Kleidung. So greift ein barfüßiger Säugling mit den Füßen fast genauso wie mit den Händen. Am meisten allerdings wird die Bewegung durch Angst vor Unfällen gehemmt; diese Angst ist zwar grundsätzlich richtig, sie sollte jedoch keinesfalls die Ursache für eine motorische „Deprivation“ (Koch 1969, in: Scherer 2004, S. 38) werden. Daher sollte die traditionelle körperliche Erziehung der Säuglinge überdacht werden: Koch geht von einer „Transporthypothese“ (ebd.) aus, nach der Säuglinge in Naturvölkern vom ersten Lebenstag an von ihren Müttern in verschiedensten Positionen, je nach ihrer jeweiligen Tätigkeit getragen wurden „Es scheint, dass der Transport für den Säugling eine angenehmere und adäquatere Situation darstellt, als das lange ruhige Liegen im Bettchen. Der Transport stellt neben dem Füttern eine Situation des engsten Kontaktes zwischen Kind und Erwachsenem dar und er bietet mehr Gelegenheit zu Orientierungsreaktionen als alle anderen Situationen“ (ebd.). Diese Transporthypothese wurde der Ausgangspunkt für Kochs „neue Auffassung des Säuglingsturnens“ (ebd.). 57 Im Lauf des ersten Lebensjahres entwickeln sich die Bewegungen des Säuglings von den „zunächst rein reflexartigen Bewegungen (…) nach der Geburt (…) zu willentlich gesteuerten Verhaltensweisen“ (Höltershinken & Scherer 2004, S. 17). Koch orientiert sich immer an der jeweiligen Aktivität des Kindes und verwendet ausschließlich Übungen, „an denen das Kind aktiv teilnimmt“ (Koch 1969, S. 416, in: Höltershinken & Scherer 2004, S. 17). Zu Beginn werden Übungen durchgeführt, die die angeborenen Reflexe provozieren, im Laufe des ersten Lebensjahres geht es immer mehr um willkürlich ausgelöste Bewegungen. Koch legte seinen Schwerpunkt zunächst auf „Körperbeherrschung“ (Höltershinken & Scherer 2004, S. 18) und die „Grob[motorik]“ (ebd.), später auch auf die „Feinmotorik“ (ebd.). Zwar liegt seinem Ansatz zunächst ein „behavioristisches Modell“ (ebd.) zugrunde, das er aber im Lauf der Zeit erweiterte. „Die Entwicklung der Sprache, der sozialen Beziehungen und der Emotionen im 2. Lebensquartal (…) hängen so eng miteinander zusammen, dass man sie beim Kind nicht gesondert pflegen kann (…)“ (Koch 1986, S. 7, in: Höltershinken & Scherer 2004, S.18 f.). In der Weiterentwicklung des Konzepts rückten die Interaktionen zwischen Mutter und Kind immer mehr in den Blickpunkt, die letzen Endes die „Voraussetzung für eine senso-motorische, sprachliche und emotionale Förderung des Kindes [bilden]“ (Höltershinken & Scherer 2004, S. 19). Das Konzept betont „grundlegende Bedürfnisse des Säuglings nach handelnder Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, nach Selbständigkeit und Eigentätigkeit, eingebettet in eine enge Mutter-KindBeziehung“ (ebd.). Moog & Moog sehen es als problematisch an, dass die „Auswirkungen der motorischen Übung nicht vom Einfluss der sozialen Zuwendung getrennt werden können“ (Moog & Moog 1973, in: Höltershinken & Scherer 2004, S. 19). Bei weiteren Untersuchungen solle dieser Faktor kontrolliert werden. Mir erscheint in diesem Zusammenhang Kochs Sichtweise schlüssig, nach der die verschiedenen Bereiche der Entwicklung kaum getrennt voneinander gepflegt werden können. Christa und Hans Ruppelt entwickelten das Programm weiter zu einem „‚Angebot der Elternbildung und Familienarbeit‘“(Höltershinken & Scherer 2004, S. 20). Pädagoginnen und Pädagogen können nach einer entsprechenden Weiterbildung Gruppen in diesem Sinne leiten. Kochs „Spiel-und Bewegungsanregungen“ (ebd.) stellen ein „wichtiges Strukturelement“ (ebd.) des Programms dar. Das Angebot findet jetzt als Gruppenangebot statt, nicht mehr im Einzelkontakt mit einer Mutter und ihrem Kind. 58 Dadurch haben sowohl Eltern als auch Kinder eine Möglichkeit des Austauschs untereinander. 2.1.2. Empirische Überprüfung des Konzepts Koch legte Wert darauf, seine Maßnahmen in Studien zu überprüfen. Von 1968-1978 führte er in der „Abteilung zur Erforschung der höheren Nerventätigkeit im Prager Institut für Mutter und Kind“ (Scherer 2004, S. 30) mehrere Untersuchungen durch. Zu diesem Institut gehörten unter anderem ein Mutter-Kind-Heim, ein Säuglingsheim und eine Mütterberatungsstelle (vgl. Scherer 2004, S. 30, Fußnote 9). Koch geht unter anderem von der zu seiner Zeit bereits erwiesenen Tatsache aus, dass Kinder, die in Säuglingsheimen aufwachsen, in der Regel Entwicklungsrückstände haben, die sie nicht mehr aufholen können. Seinen Forschungsschwerpunkt legte er auf „den Einfluss der Grobmotorik, Lokomotorik und der Handmotorik“ (Koch o.J., in: Scherer 2004, S. 32)23. Um seine Methode adäquat zu überprüfen, legte er folgende Untersuchungsbedingungen fest: „1. Größere Anzahl von Kindern, 2. Säuglinge ab erster Lebenswoche, 3. Stimulation der ganzen Person, 4. Stimulation während des ersten Lebensjahres, 5. tägliche Stimulation über eine ganze Wachperiode“ (ebd.). Koch stellt zehn Jungen aus dem „Institut für Mutter und Kind“ (ebd.) vor, mit denen bis zum Alter von sechs bis sieben Monaten gearbeitet wurde. Weitere 20 Jungen der Stichprobe wuchsen in ihren Familien auf, die Mütter kamen regelmäßig zur Beratung und wurden dabei entsprechend angeleitet. Eine Kontrollgruppe, ebenfalls ausschließlich Jungen, wuchs ebenfalls in Familien auf und wurde nicht systematisch stimuliert. Die Entwicklung der stimulierten Kinder aus dem Institut verlief ähnlich wie die der stimulierten Familienkinder, hingegen unterschieden sich die stimulierten Familienkinder deutlich von den nicht stimulierten Familienkindern: „Der Unterschied (…) war statistisch sehr groß und hat sich mit dem Alter vergrößert, so dass er am Ende des ersten Lebensjahres am größten war“ (Koch o.J., in: Scherer 2004, S. 33). Die stimulierten Kinder, vor allem die aus dem Institut, die von erfahrenen Mitarbeitern stimuliert worden waren, entwickelten darüber hinaus „Fertigkeiten (…), die bei ‚normalen‘, speziell nicht stimulierten Kindern nicht vorkommen, z.B. festhalten an einer Leiter zwischen dem 5. und 6. Monat; im 7. Monat halten sie aus eigener Kraft an einer Stange; steigen auf eine Leiter zwischen dem 7. und 8. Monat“ (ebd.). 59 Diese Fertigkeiten werden sonst in unserer Kultur aus Vorsicht unterdrückt, es zeigte sich, dass diese Normen „nicht immer die ‚Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Entwicklung‘ zeigen“ (ebd.). Außerdem zeigte sich, „dass die motorische Stimulation auch einen nicht-spezifischen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder hat. Motorisch stimulierte Kinder unterscheiden sich statistisch bedeutsam in der Entwicklung des Spieles, der Sprache und des Denkens u.ä..“ (ebd.). Koch führt diese Beobachtungen darauf zurück, dass Bewegung das Gehirn „aktiviert“ (ebd.), so dass dieses „leistungsfähiger und besser vorbereitet [wird], auch auf andere Reize als auf motorische Reize zu reagieren. Die Eltern sind nicht nur zufrieden mit motorisch entwickelten Kindern, sondern wollen allseitig entwickelte Kinder. Deshalb nutzen sie Erfahrungen mit der motorischen Stimulation und übertragen sie auch auf andere Bereiche. Diese Stimulation trifft auf ein gut vorbereitetes und aktives Gehirn“ (ebd.). Die Verarbeitung nicht nur der motorischen, sondern auch anderer Sinnesreize gelingt demnach den stimulierten Kindern besser. Da die Verarbeitung von Sinnesreizen bei der Entstehung der Schizophrenie eine entscheidende Rolle zu spielen scheint, ist dieser Ansatz meiner Ansicht nach nicht nur im Sinne primärer oder universeller Prävention, sondern auch im Sinne selektiver Prävention für Kinder mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko für Schizophrenie besonders geeignet. Eine weitere Untersuchung Kochs bestärkt diese Sichtweise: Die einseitige Stimulation der Grobmotorik kann dazu führen, dass Kinder unruhig sind und sich nicht auf eine Beschäftigung mit den Händen konzentrieren können. Daher setzte Koch sich auch mit „der frühen Stimulation der Handbewegung“ (Koch o.J., in: Scherer 2004, S. 34) auseinander. „Manuelle Funktionen sind nicht nur durch neuromuskuläre Koordination bedingt; sondern sie sind an eine ganze Reihe von psychischen Funktionen gebunden, so dass sie Äußerung von Intelligenz und ganzheitlicher Persönlichkeit sind“ (ebd.). 20 Familienkinder, die das Institut bis zu ihrem 15. Lebensmonat einmal monatlich besuchten und deren Mütter für die Stimulation der Hände angeleitet wurden, wurden untersucht. Die Kontrollgruppe umfasste 100 Kinder, die zuhause keine besondere Stimulation bekamen, jeweils 26 Kinder nach einem Vierteljahr. Im ersten bis dritten Vierteljahr unterschieden sich die Kinder in der Hälfte der Kriterien wesentlich, im vierten Vierteljahr unterschieden sie sich deutlich in 13 von 15 Merkmalen. „Die frühe Stimulation der Handbewegung hatte großen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder, nicht nur bzgl. der Entwicklung der Motorik sondern auch bzgl. einer ganzen Reihe 60 anderer psychischer Funktionen, weil die meisten manuellen Tätigkeiten im 4. Quartal einhergehen mit der Entwicklung von räumlicher Vorstellung, technischem Verständnis und Denken“ (Koch o.J., in: Scherer 2004, S. 34 f.). Kochs subjektiver Eindruck war, dass die Kinder, die sowohl in der Feinmotorik als auch in der Grobmotorik stimuliert worden waren, sich besser entwickelten als die Kinder, die nur feinmotorisch stimuliert worden waren. Hier wären seiner Ansicht nach statistische Belege sinnvoll, mit denen man zeigen könnte, „dass man die Fertigkeiten des Kindes nicht isoliert entwickeln kann, sondern dass diese Fertigkeiten voneinander abhängen“ (Koch o.J., in: Scherer 2004, S. 35). Ich finde Kochs subjektive Einschätzung schlüssig, auch wenn zunächst noch statistische Belege ausstehen. Koch zeigte, dass die frühe Stimulation positive Wirkungen auf die Entwicklung im ersten Lebensjahr hat. Eine Wirkung auf das spätere Leben kann man „aufgrund einer Analogie“ (ebd.) „eigener Erfahrung“ (ebd.) oder „Ergebnissen aus der Literatur“ (ebd.) annehmen; um sie nachzuweisen müsste man stimulierte Kinder auch im weiteren Verlauf ihres Lebens beobachten (vgl. ebd.). Dieser Einschätzung stimme ich zu. Gerade auch im Hinblick auf spätere psychische Erkrankungen kann man meiner Ansicht nach aufgrund von Analogieschlüssen von einer präventiven Wirkung ausgehen; interessant wären aber entsprechende Langzeituntersuchungen. Problematisch kann meiner Ansicht werden, wenn der Aspekt, dass die stimulierten Kinder die „Meilensteine der Entwicklung“ früher erreichen als andere Kinder, möglicherweise bei sehr ehrgeizigen Eltern überbetont wird, der Schwerpunkt also auf dem Ergebnis liegt und weniger auf dem Prozess, auch wenn das von Koch vermutlich nicht beabsichtigt war. Die Physiotherapeutin Aly kritisiert im Zusammenhang mit ergebnisorientiertem Handeln, dass „in der Bundesrepublik die Bewegungsentwicklung eines Säuglings mit kritischen Blicken verfolgt [wird]. Dabei geht es in erster Linie um ‚Ergebnisse‘. Wie ein Säugling die einzelnen Entwicklungsstufen erreicht und in welcher Reihenfolge, ist dabei fast gleichgültig. Das Prüfen und Testen zielt weniger auf die Qualität der Bewegungen ab, als auf eine Abgrenzung zur Pathologie und darauf, ob die Bewegungsleistung innerhalb der Norm liegt“ (Aly 2001, S. 12). 61 Aly ist mit Pikler der Ansicht, dass man einem Kind die Zeit geben sollte, die jeweiligen Entwicklungsschritte in seinem eigenen Tempo zu durchlaufen, da auch die Zwischenschritte wesentliche Erfahrungen für das Kind bedeuten. „Eine Förderung, welche die vielen notwendigen Übergangsstufen und die wochen- und monatelangen Zwischenräume verkennt, läuft Gefahr, den Säugling in eine Bewegungsunsicherheit zu bringen, die zu muskulären Verspannungen, Haltungsschäden, Fußdeformitäten oder ähnlichem führen kann“ (Aly 2001, S. 13) 2.2. Entwicklung im individuellenTempo Pikler, eine ungarische Kinderärztin, leitete von 1946 an 30 Jahre lang das Säuglingsheim „Lóczy“ (Pikler 2001, S. 23) in Budapest. Vor dieser Zeit beriet sie als Hausärztin Eltern im Sinne ihres Konzepts (vgl. Strub 2001, S. 9). In dem Heim Lóczy lebten bis zu 70 Säuglinge vom Neugeborenenalter bis zum Alter von maximal drei Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Familien leben konnten. Im Durchschnitt lebten die Kinder bis zu einem Jahr in diesem Heim. Pikler sah eine gute Beziehung zwischen Pflegerinnen und Säuglingen als wesentlich für die Vermeidung von Hospitalismusschäden an, diese Beziehung sei am besten während der täglichen Pflege zu erreichen. Eine Pflegerin betreute in ihrer Arbeitsschicht, wie damals in Ungarn üblich, neun Kinder (vgl. Pikler 2001, S. 23 f.). „Bei der täglich mehrmals notwendigen Pflege lernt das Kind … etwas, was es nur vom Erwachsenen lernen kann, denn für ein freundliches und rücksichtsvolles Verhalten braucht es ein Vorbild. Sich zu bewegen und zu spielen hingegen lernen Säuglinge und Kleinkinder auch ohne unsere unmittelbare Hilfe und Anregung …“ (Strub 2001, S. 10). Die Kinder werden nach Piklers Konzept immer auf den Rücken gelegt, bis sie selber in der Lage sind, sich in eine andere Position zu bringen. Weder werden sie hingesetzt, noch hingestellt. „Der Erwachsene gibt dem Kind nicht nur keine direkte Hilfe, sondern er spornt es auch nicht an, gewisse Bewegungen zu üben oder bestimmte Positionen aufzusuchen. Der Erwachsene hält z. B. dem Säugling nicht seinen Finger hin, damit er sich daran anklammernd zum Sitzen hochzieht, er hält kein Spielzeug über das Kind, damit es aufsteht. Und er ruft es weder direkt, noch lockt er es mit einem Spielzeug, damit es die ersten freien Schritte macht“ (Pikler 2001, S. 27) Die spontanen Bewegungsversuche der Kinder werden allerdings auch nicht behindert. Die Erwachsenen teilen die Freude mit dem Kind, wenn diesem ein weiterer Entwick- 62 lungsschritt gelungen ist, das „selbständige Probieren des Kindes“ (ebd.) wird ermutigt. Der Erwachsene freut sich über das Erscheinen jedes weiteren neuen Bewegungsdetails, und er schafft die Bedingungen zum Üben dieser Bewegungen. Er kennt und beobachtet den Verlauf der Bewegungsentwicklung. Er treibt also nicht das sich langsam entwickelnde Kind an, zu schematisch vorgegebenen Zeitpunkten Leistungen zu vollbringen, die noch verfrüht sind, die es nur unsicher, mit falscher Koordination auf Inititative und mit Hilfe der Erwachsenen durchzuführen fähig ist“ (Pikler 2001, S. 28). Der Erwachsene stellt geeignete Bedingungen für eine ungestörte motorische Entwicklung her, würdigt die vielen Zwischenstadien der Bewegungen und ist nicht fixiert auf das frühe Erreichen von Sitzen, Stehen und Gehen. Die Kleidung des Kindes sollte die Bewegung nicht einschränken (vgl. Pikler 2001, S. 28), das Kind bekommt, je nach Alter, eine angemessene „Grundfläche“ (Pikler 2001, S. 29), auf der es genügend Platz hat und sich dennoch geborgen fühlt. Das Spielmaterial regt die Kinder zum selbständigen Spielen und Klettern an, sie klettern im Garten auch auf Steintreppen. Im Sommer steht ihnen auch ein Planschbecken zur Verfügung, in dem das herein sprudelnde Wasser wieder abläuft, so dass die Kinder gefahrlos allein darin spielen können, für größere Kinder stehen entsprechende Klettergeräte zur Verfügung, auf die sie gefahrlos allein klettern können (vgl. Pikler 2001, S. 30 f.). Aly erwähnt, dass Pikler zwei Kinder vorstellt, die sich in einem völlig verschiedenen Tempo entwickeln, eines der Kinder entwickelt sich sogar „mit großer, beinahe besorgniserregender Verspätung“ (Aly 2001, S. 14). Dennoch ist auch dieses Kind in jeder Phase entsprechend seiner Entwicklungsstufe gut beweglich gewesen. Damit verdeutlicht Aly, dass der Prozess der Entwicklung entscheidend ist, nicht die Erfüllung einer bestimmten Norm zu einer bestimmten Zeit. Empirische Überprüfung Pikler bezieht sich auf Bowlbies Untersuchungen: „Bei der Mehrzahl der Personen, die in ihren ersten Lebensjahren außerhalb einer Familie aufgewachsen sind, [sind] spezifische Persönlichkeitsstörungen festgestellt worden. Diese äußerten sich in der Oberflächlichkeit sozialer Kontakte, in Schwierigkeiten, den Affekt zu zügeln und manchmal in der Beschränktheit der kognitiven und perzeptiven Funktionen. Nachdem die Persönlichkeitsstörungen auch dann auftraten, wenn die Kinder nach ein, zwei oder drei Jahren zu ihren Familien zurückkehrten, mußte man für die Persönlichkeitsstörungen in erster Linie die im Heim verbrachte Zeit verantwortlich machen“ (vgl. Bowlby 1951, S. 31; 1957; S. 34-37, in: Pikler 2001, S. 24 f.). 63 Hirsch machte ähnliche Beobachtungen bei umfangreichen Untersuchungen in Ungarn. In diesem Rahmen wurde er auf Lóczy aufmerksam: Er fand einige betroffene Kinder, die diese typischen Auffälligkeiten nicht zeigten. Diese Kinder waren alle als Säuglinge im Lóczy gewesen (vgl. Hirsch 1964, in: Pikler 2001, S. 25). Daraufhin führte er eine Nachuntersuchung mit 30 Kindern durch, die „vom Neugeborenenalter an 6 bis 34 Monate im Lóczy verbracht haben und danach in vermutlich normale Familienverhältnisse gekommen sind“ (Pikler 2001, S. 24). Die Auswahl war ansonsten zufällig. Die „Spätsymptome des Hospitalismus“ (ebd.) wurden bei keinem der Kinder festgestellt, „die in eine wirklich normale Umgebung kamen“ (ebd.) Eine weitere Nachuntersuchung führte Pikler mit Falk durch (Falk/Pikler 1972, in: Pikler 2001, S. 25). Hierbei wurden 100 Kinder untersucht, die ihre Säuglingszeit im Lóczy verbracht hatten und anschließend in ihren Familien lebten. Die Kinder waren zum Zeitpunkt der Untersuchung 14 bis 23 Jahre alt (vgl. ebd.). „Obwohl die Mehrzahl der Kinder nicht unter intakten familiären Umständen aufwuchs, z. B. nur mit einem Elternteil oder mit Stiefeltern, zeigten sie später keine auffallenden, typischen Persönlichkeitsstörungen, die auf das im Heim verbrachte Säuglingsalter hätten hinweisen können“ (ebd.). Inzwischen werden an verschiedenen Orten „Pikler-Pädagogen“ ausgebildet, die nach diesen Prinzipien arbeiten. Vor allem die Beobachtung der Bewegung spielt in dieser Ausbildung eine wesentliche Rolle (vgl. Link: Ausbildung zur Pikler-Pädagogin). In Bezug auf Schizophrenie eignet sich dieser Ansatz meiner Ansicht nach ebenfalls für primäre oder universelle Prävention im Rahmen von Konzepten für Kinderkrippen und in Bezug auf Elternberatung darüber hinaus auch für selektive Prävention. Es gibt bei Piklers Konzept einige Parallelen zu Koch: Beide Autoren wollten Hospitalismusschäden verhindern und sahen, neben einer die Initiative des Kindes respektierenden Form der Interaktion, die Motorik als wesentlichen Bestandteil der frühen Entwicklung an. Beide Autoren setzten sich kritisch mit der zu ihrer Zeit gängigen Versorgung der Säuglinge auseinander, die die motorische Entwicklung der Säuglinge nicht einbezog; Beide Autoren sahen, dass die motorischen Fähigkeiten der Säuglinge in unserer Kultur eher unterschätzt werden: Koch stellte explizit fest, dass siebenmonatige Säuglinge bereits auf eine Leiter klettern können, bei Pikler durften Säuglinge im Krabbelalter bereits auf Steintreppenstufen klettern. 64 Beide Autoren legten in den Säuglingsheimen Wert auf die Anleitung der Säuglingsschwestern zu genauer Beobachtung und Dokumentation der motorischen Entwicklung. Während Koch sich dabei allerdings an Tabellen mit Normwerten für den Zeitpunkt orientierte, wann ein Entwicklungsschritt vollzogen sein soll, betonte Pikler den Prozess der Entwicklung. Wesentliche Unterschiede sehe ich auch in der Art der Förderung: Während Koch sich intensiv mit einzelnen Kindern beschäftigte und sie gezielt stimulierte oder die Mütter dazu anregte, lehnte Pikler eine solche gezielte Stimulation ab und betonte die selbständige Tätigkeit des Säuglings, die Anregung erfolgte über die Gestaltung der Umgebung. Bei Pikler bedeutet die tägliche Pflege den Schwerpunkt der Interaktionen zwischen Pflegerin und Säugling, bei Koch wird dieser Aspekt nicht erwähnt. In der Weiterentwicklung des Konzepts bezog Koch die Mütter ein. Daraus entstanden in der heutigen Zeit Eltern-Kind-Gruppen, die von Pädagogen angeleitet werden. Auch Pikler führte Elternberatungen durch, bevor sie die Leitung des Säuglingsheims übernahm, ihr Schwerpunkt wurde dann die angemessene Pflege innerhalb des Säuglingsheims oder in Kinderkrippen. Es entwickelten sich Zusatzausbildungen für Fachkräfte im frühpädagogischen, medizinischen und psychologischen Bereich (vgl. Link: Pikler-Pädagogen). 3. Auffälligkeiten in Kindheit und Prodromalphase: Rothenberger, Banaschewski, Siniatchkin, Heinrich, (2008, S. 65): „Die motorische Entwicklung von Kindern (…) wird im Bereich der Kinder- und Jugendpsychatrie leider oft dem Primat der emotionalen und kognitiven Aspekte nachgeordnet, obwohl eine Vielzahl von pathologischen Hintergründen und therapeutischen Möglichkeiten im Bereich der Bewegung angesiedelt ist. (…) Nicht immer reichen die routinemäßigen Standardverfahren in der klinischen Untersuchung (…) aus, um das volle Bild der motorischen Funktionen zu erfassen. Vielmehr ist eine Ergänzung durch psychophysiologische Zusammenhänge im Rahmen der Bewegungssteuerung bei Kindern wichtig“ Diese Einschätzung erscheint mir schlüssig. Daher stelle ich diesbezüglich im Folgenden zunächst Studien aus Reschs Ausführungen vor, bevor ich auf einige der Studien eingehe, die Hesse & Prünte zusammengestellt haben. 65 3.1.1. Neuromotorische Entwicklungsdefizite Hochrisikostudien zeigten, dass Kinder mit einem erhöhten Risiko für Schizophrenie „signifikant häufiger neuromotorische Entwicklungsdefizite zeigten“ (Resch 2008, S. 812)24 Kinder, die später eine Psychose entwickeln, erreichen die „Meilensteine der motorischen Entwicklung“ (vgl. Jones et al. 1994, in: Resch 2008, S. 812) später als andere. Karp-Illowsky et al. (2001, in: Resch 2008, S. 812) gehen von der Hypothese aus, „dass schizophrene Patienten eine Beeinträchtigung der normalen Hirnentwicklung im Adoleszenzalter erleben“ (ebd.), da es sich gezeigt hat, „dass … früh beginnende Schizophrenien in erhöhtem Maße neurologische Auffälligkeiten besitzen“ (ebd.). 3.1.2. Neurological Soft Signs und Schizophrenie Hesse & Prünte stellen eine Vielzahl von Studien zu dieser Frage vor. Ich greife einige davon heraus, die den Zusammenhang besonders klar verdeutlichen: Verschiedene Studien untersuchen, ob Verwandte ersten Grades häufiger Neurological Soft Signs zeigen, insbesondere Eltern oder psychiatrisch nicht auffällige Geschwister. Sie wollen damit eine genetische Verursachung dieser Symptome erforschen. Diese Studien zeigten widersprüchliche Ergebnisse: Beispielsweise zeigt eine Studie Neurological Soft Signs bei den Verwandten ersten Grades, eine andere nicht25. Klarere Ergebnisse brachten Untersuchungen an Kindern von Menschen mit Schizophrenie, die eine besondere Risikogruppe für Schizophrenie darstellen: Bei Kindern dieser Risikogruppe fanden sich im Alter von sieben Jahren mehr Neurological Soft Signs (vgl. Hesse & Prünte 2004, S. 88)26. Besonders die Kinder von Eltern mit chronisch verlaufender Störung zeigten „mehr Hyperaktivität und Unreife als die Vergleichsgruppe“ (ebd.). Markus et al. (1985, in: Hesse & Prünte 2004, S. 89) fanden in zwei weiteren großen Untersuchungen bei ungefähr einem Viertel der betroffenen Risikokinder „sensorische und motorische Auffälligkeiten“ (ebd.). Erlenmeyer-Kimling et al. (2000, in: Hesse & Prünte 2004, S. 89) führten eine Langzeitstudie durch, die „New Yorker Risikostudie“ (ebd.). Untersucht wurden „Kinder schizophrener Personen, depressiver Personen sowie von Personen aus der Allgemeinbevölkerung im Alter von 7 bis 12 Jahren …, es wurden u.a. Aufmerksamkeit, verbales Gedächtnis und motorische Fertigkeiten erhoben. Nachuntersuchungen erfolgten in regel- 66 mäßigen Abständen, zuletzt wurde der psychopathologische Befund im Alter von durchschnittlich 30 Jahren ermittelt. 15 % der Kinder schizophrener Eltern und 7 % der Kinder depressiver Personen sowie ein Kind mit nicht erkrankten Eltern hatten inzwischen als Erwachsene selbst eine Störung aus dem schizophrenen Spektrum entwickelt“ (vgl. ebd., Hervorhebungen von mir). Jedes einzelne dieser drei Merkmale erwies sich als Prädiktor für eine schizophrene Störung, allerdings traten diese Merkmale einzeln auch bei anderen Kindern auf. „Die höchste Vorhersagesicherheit ließ sich bei Berücksichtigung aller drei Merkmale in Kombination erzielen“ (ebd.). Während die Studienlage bei Verwandten ersten Grades nicht eindeutig ist, und daher keine klaren Hinweise auf genetische Zusammenhänge anzeigt, gibt es klare Hinweise für gehäufte Auffälligkeiten bei Kindern schizophrener Eltern, die später selber erkranken. Es erscheint mir in diesem Zusammenhang - besonders vor dem Hintergrund der Ausführungen von Read & Gumley - denkbar, dass weniger die Genetik als vielmehr die Bindung zu den Eltern, die möglicherweise aufgrund ihrer Erkrankung Einschränkungen ihrer sozialen Wahrnehmung - auch ihrem Säugling gegenüber - haben, den vermittelnden Faktor darstellt. Walker & Lewine (1990, in: Hesse & Prünte 2004, S. 90) stellten Videoaufzeichnungen von später an Schizophrenie erkrankten Personen zusammen, als diese im Alter von 17 Monaten bis fünf Jahren waren; dazu nahmen sie Aufnahmen der nicht schizophrenen Geschwister zum Vergleich. „Studenten und erfahrene Psychiater sollten bei Videoaufnahmen von vier Geschwisterpaaren erkennen, welches der Kinder später eine schizophrene Störung entwickelte, wobei ihnen keinerlei Hinweise gegeben wurden, woran diese Kinder zu erkennen wären. Tatsächlich gelang eine weit überzufällige Zuordnung, wobei die Rater als auffällig das Fehlen von Augenkontakt, von Reaktionen, von positiven Affekten sowie Störungen der Grob- und Feinmotorik hervorhoben“ (ebd.). Den Eltern der Betroffenen waren diese Besonderheiten nicht aufgefallen; sie beschrieben sie „nur als insgesamt ruhigere Kinder“ (ebd.). Hesse & Prünte sind der Ansicht, dass die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen dafür sprechen, dass sich „diskrete sensorische und motorische Auffälligkeiten wenigstens bei einem Teil der schizophrenen Personen schon lange vor Ausbruch der Störung nachweisen lassen. Sie finden sich bei bestimmten Risikogruppen und sind wenigstens bei einem Teil der schizophrenen Personen relativ stabil. Damit stehen die Forschungsbefunde zu Neurological Soft Signs voll in Einklang 67 mit der Annahme, dass Störungen der sensorischen Integration wenigstens bei einem Teil der Personen als Vulnerabilitätsmerkmal auftreten können“ (Hesse & Prünte 2004, S. 90 f.). Dieser Einschätzung stimme ich zu. Weitere Forschungen wären sinnvoll, um zu prüfen, ob eine therapeutische Beeinflussung dieser Auffälligkeiten im Kindesalter einen Beitrag zu einer Reduzierung des Erkrankungsrisikos leisten kann. 3.1.3. Unspezifische Symptome in der Prodromalphase Im Zusammenhang mit Symptomen, die weit vor der Erkrankung auftreten, verweisen Ruhrmann et al. auf die Prodromalphase. Nach Gaebels Ansicht lässt sich die Prodromalphase allerdings nicht immer klar von der prämorbiden Persönlichkeit abgrenzen (s. Kap. 2.1.2). Aus diesem Grund erwähne ich die Ausführungen Ruhrmanns et al. im Zusammenhang mit frühen Auffälligkeiten später an Schizophrenie Erkrankter. In der Prodromalphase zeigen sich bereits häufig „Aufmerksamkeitsstörungen, Leistungseinbußen, sozialer Rückzug oder Angst und Depressionen“ (Ruhrmann et al. 2009, S. 214). Ein Zusammenhang zwischen diesen Symptomen und einer späteren Psychose kann allerdings aus diesen Symptomen „nicht zuverlässig erschlossen werden“ (ebd.). Daher kann man „erst nach einer Erstmanifestation (…) entscheiden, ob eine prodromal erscheinende Symptomatik tatsächlich Ausdruck eines Prodroms war, also kontinuierlich in eine Psychose eingemündet ist…“ (ebd.). Diese Symptome können auch Ausdruck eines „Vorpostensyndrom[s]“ (Ruhrmann et al. 2009, S. 215) sein, das sich spontan zurückbildet und durchschnittlich nach „10,2 Jahren“ (ebd.) in die „eigentliche Prodromphase“ (ebd.) führt. Außerdem kann es zu prodromähnlichen Symptomen kommen, ohne dass später eine Psychose auftritt. Die Folge dieser Überlegungen ist für Ruhrmann et al. die Notwendigkeit „prospektive[r]“ (ebd.) Studien. Die Vor- und Nachteile einer frühen Prophylaxe sollen nach Ansicht der Autoren gut abgewägt werden: „Das Risiko falsch positiver oder falsch negativer Zuordnungen“ (ebd.) ist hoch. Einerseits kann eine Prophylaxe möglicherweise hilfreich sein, andererseits kann die frühe Diagnose eine starke psychische Belastung bedeuten, außerdem haben die Medikamente Nebenwirkungen. Ruhrmann und Klosterkötter haben einen Interessenkonflikt, da beide auch für pharmazeutische Unternehmen tätig sind (vgl. Ruhrmann et al. 2009, S. 218). 68 Meiner Ansicht nach rechtfertigen die von Ruhrmann et al. beschriebenen Symptome einer Prodromalphase ein therapeutisches Eingreifen durchaus, auch wenn sie nicht in jedem Fall zu einer akuten Psychose führen müssen. Allerdings halte ich es für absurd, aufgrund dieser unspezifischen Symptome hochwirksame Medikamente vorbeugend zu verabreichen. Den Interessenkonflikt zweier Autoren finde ich in diesem Zusammenhang problematisch. Weitere Studien wären meiner Ansicht nach sinnvoll, um zu prüfen, ob diese unspezifischen Symptome mit den von Hesse & Prünte beschriebenen diskreten motorischen und sensorischen Auffälligkeiten einher gehen. Die Studien, die Resch und Hesse & Prünte anführen, bestätigen meiner Ansicht nach die Einschätzung von Rothenberger, Banaschewski, Siniatchkin & Heinrich: Die Auffälligkeiten in der Motorik sollten bei Kindern, die psychische Auffälligkeiten zeigen, stärker berücksichtigt werden. Das gilt meiner Ansicht nach auch für unspezifische Symptome, die auf eine Prodromalphase der Schizophrenie hindeuten könnten. Im Gegensatz zu einer medikamentösen Prophylaxe in dieser Phase, die von Ruhrmann et al. diskutiert wird, wäre ein Eingehen auf Störungen der sensorischen Integration risikolos für die Betroffenen. 4. Therapie und Rückfallprophilaxe im Erwachsenenalter: Ich werde hier Prävention und Therapie der Lehrbücher darstellen, die sich auf Rückfallprävention und Therapie erkrankter Erwachsener beziehen. Da die Lehrbücher körperbezogene Interventionen entweder nur am Rande oder aber gar nicht erwähnen, werde ich zu den einzelnen Formen der Prävention und Therapie, die die Lehrbücher erwähnen, jeweils zusätzliche Ansätze und ihre empirische Überprüfung darstellen, die den Körper einbeziehen. 4.1. Allgemeine Prinzipien Gaebel ist der Ansicht, die Therapie solle sich „am empirisch gesicherten Kenntnisstand“ (Gaebel 2002, S. 89) orientieren. Röhricht hält es darüber hinaus für sinnvoll, dass „das Votum der Patienten angemessene Beachtung findet“ (Röhricht 2000, S. 24). Der „Prädiktionswert der initialen Therapiebewertung“ (ebd.) sei nachgewiesen, außerdem sprächen „allgemein menschliche 69 Prinzipien“ (ebd.) dafür, die Patienten in diesem Sinne „als aktive und kompetente Partner“ (ebd.) wertzuschätzen. Ich stimme Röhrichts Einschätzung zu. Gaebel beschreibt allgemeine Therapieprinzipien: „Behandlungsziel ist ein von Krankheit weitgehend freier, zu selbstbestimmter Lebensführung fähiger, therapeutische Massnahmen [27] in Kenntnis von Nutzen und Risiken abwägender Patient. Diese Zielsetzung erfordert eine (…) möglichst wenig restriktive Therapie im Rahmen einer humanen, kooperativen und rationalen Therapeut-Patient-Beziehung.“ (Gaebel 2002, S. 89). Mögliche Interventionen unterteilt er in „symptomreduzierende, vulnerabilitätsmindernde und stressreduzierende“ (Gaebel 2002, S. 89). In der akuten Phase, in der die positiven Symptome überwiegen, liegt der Schwerpunkt der Behandlung auf medikamentöser Therapie. Dieser Schwerpunkt verlagert sich zunehmend auf psychosoziale Interventionen (vgl. Möller et al. 2009, S. 157). Alle Maßnahmen sollen sowohl „individuell und phasenspezifisch“ (Gaebel 2002, S. 90) koordiniert werden. Prinzipiell dauert eine Behandlung über die gesamte Lebensspanne an. Während die medikamentöse Behandlung kontinuierlich erfolgen sollte, sollten die psychosozialen Maßnahmen in Form von wiederholten Anwendungen durchgeführt werden (vgl. ebd.). Bei der Vorbeugung von Rezidiven haben die Medikamente eine nachgewiesene Wirkung, hingegen ist die „Negativsymptomatik des Residualsyndroms … insgesamt nur beschränkt medikamentös therapierbar“ (Möller et all 2009, S. 159). Die motorischen Nebenwirkungen der Medikamente lassen sich nach Gaebels Ansicht durch adäquate Auswahl und Dosierung in akzeptablen Grenzen halten (vgl. Gaebel 2002, S. 90). Problematisch ist mitunter die mangelnde Mitwirkung der Patienten in Bezug auf regelmäßige Medikamenteneinnahme (vgl. Gaebel 2002, S. 92). Die verschiedenen therapeutischen Settings reichen von psychiatrischen Krankenhäusern, teilstationären Einrichtungen, ambulanter Versorgung durch niedergelassene Psychiater, Übergangswohnheime bis zu beschützenden Wohngruppen (vgl. Gaebel 2002, S. 90). 4.2. Allgemeines zu körperbezogenen Interventionen Kraepelin beschrieb vor der Ära der Psychopharmaka explizit, dass sich betroffene Patienten beruhigten, wenn sie beispielsweise warme Bäder bekamen (vgl. Kraepelin 70 1909, S. 579, in: Deimel & Hölter 2011, S. 235). Spazierengehen, Gymnastik und Massage gelten seit der Antike als heilsam, um „Störungen des Gemüts“ (Deimel & Hölter 2011, S. 235) zu behandeln. In der heutigen Zeit wird nach Röhrichts Ansicht in der klinischen Behandlung auf den Körper meist nur „in Form eines unspezifisch strukturierten Sport-und Aktivierungsangebotes und einer sich auf taktile Reize beschränkenden Ergotherapie“ (Röhricht 2000, S. 156) eingegangen. Scharfetter stellt dazu fest: „Der Körper des psychisch kranken Menschen wird dabei zur bloßen Applikationsstätte von Psychopharmaka“ (Scharfetter 1998, S. 25, in: Röhricht 2000, S. 157). Nach Ansicht von Deimel & Hölter gibt es im Vergleich zu Depressionen bei schweren psychischen Erkrankungen nur wenige Studien zur Wirksamkeit von Bewegungstherapie (vgl. Deimel & Hölter 2011, S. 235). Darüber hinaus ist die Vergleichbarkeit der Studien erschwert, da sie von einfachen Interventionen wie Fahrradergometer oder Schwimmen bis hin zu komplexen Mischungen verschiedener Interventionen reichen. Außerdem sind die Patientengruppen in vieler Hinsicht heterogen. Auch die wissenschaftlichen Methoden sind nicht einheitlich: Es gibt qualitativ orientierte Studien, Studien mit einer Mischung aus qualitativen und quantitativen Methoden und Studien, die randomisiert und zum Teil blind bewertet sind (vgl. Deimel & Hölter 2011, S. 235f.). Die Autoren legen eine Überblicksarbeit vor, sie unterscheiden zwischen „körperpsychotherapeutischen (…) und übungszentrierten Interventionen“ (Deimel & Hölter 2011, S. 236). Dabei orientieren sie sich an Röhricht, der eine Zusammenstellung über körperpsychotherapeutischer Interventionen vorlegt (vgl. Röhricht 2000; 2009, in: Deimel & Hölter 2011, S. 236) und an Faulkner, der seinen Schwerpunkt auf übungszentrierte Interventionen legt (vgl. Faulkner 2005, in: Deimel & Hölter 2011, S. 236). Diese Kategorisierung finde ich grundsätzlich schlüssig, sie schließt allerdings nicht alle Formen der Intervention ein, die ich für erwähnenswert halte. Daher werde ich mich - im Gegensatz zu dieser Kategorisierung - im Wesentlichen an die verschiedenen Phasen der Therapie im Sinne der Lehrbücher anlehnen. Ich stelle zunächst im Zusammenhang mit der Therapie in der akuten Phase eine Studie zu Interventionen im Sinne der Sensorischen Integrationstherapie von Hesse & Prünte vor. Im Zusammenhang mit Psychotherapie greife ich aus der Zusammenstellung von Deimel & Hölter eine Studie über eine körperpsychotherapeutische Intervention von Röhricht & Priebe heraus. Im Zusammenhang mit Psychoedukation stelle ich 71 den Vorschlag von Hesse & Prünte vor, Erkenntnisse aus der Sensorischen Integrationstherapie in die Psychoedukation einzubeziehen, und dazu die Patientenbefragung dieser Autoren zu der subjektiv empfundenen Wirksamkeit der Angebote zur Sensorischen Integration. Außerdem beschreibe ich im Zusammenhang mit Psychoedukation eine Studie von Malchow, Wobrock & Falkai, die nach der Kategorisierung von Deimel & Hölter als „übungszentriert“ bezeichnet werden kann, und deren Ergebnisse meiner Ansicht nach ebenfalls in die Psychoedukation einbezogen werden sollten: Die Autoren beschreiben und überprüfen die Wirkung sporttherapeutischer Interventionen auf kognitive Funktionen und spezielle Gehirnstrukturen. Schließlich beschreibe ich im Zusammenhang mit soziotherapeutischen Interventionen ein Einzelfallbeispiel, in dem Deimel & Hölter im Rahmen einer postklinischen Intervention positive Effekte der Sporttherapie bei der Sozialkompetenz und darüber hinaus in weiteren Lebensbereichen beschreiben. 4.3. Interventionen in der akuten Phase In der akuten Phase steht die Behandlung der Positivsymptomatik durch Medikamente im Vordergrund (vgl. Gaebel 2002, S. 90; Möller et al. 2009, S. 156 f.). Im Gegensatz dazu sehen Deimel & Hölter auch in der akuten Phase unter Umständen einen Sinn in körperbezogenen Interventionen. In dieser Phase steht „die Positiv-Symptomatik mit ausgeprägten Körperschemastörungen und großer motorischer Unruhe im Vordergrund, die als Konsequenz u.a. eine Entängstigung, Beruhigung und Entspannung sowie eine rudimentäre Wiederherstellung einer Orientierung in Raum und Zeit verlangt“ (Deimel & Hölter 2011, S. 269), Die bewegungstherapeutische Vorgehensweise sollte „übungszentriert[...] und strukturiert[...]“ sein, unter Umständen sollte auch in Einzeltherapie gearbeitet werden. Hesse & Prünte stellen ein Konzept dar, bei dem auch akut psychotische Patienten im Rahmen der Ergotherapie Angebote zur sensorischen Integration bekommen. Die Grundlage ihres Konzepts stellen für die Autoren „humanistische[...] Therapieprinzipien“ (Hesse & Prünte 2004, S. 226) dar, nach denen die Patienten „genügend Raum und Zeit für sich“ (ebd.) bekommen, um die Angebote zur sensorischen Integration zu wählen und in Anspruch zu nehmen. Die Autoren gehen davon aus, dass sich die Patienten selber genau die Angebote suchen, die für sie „aufgrund ihrer Beeinträchtigun- 72 gen bei der Verarbeitung basaler Sinneseindrücke nützlich sind“ (Hesse & Prünte 2004, S. 227). „Eine grundlegende Annahme des hier vorgestellten Behandlungskonzeptes besagt, dass schizophrene Patienten durch die Nutzung der Angebote zur sensorischen Integration dazu in die Lage versetzt werden, in Handlung zu treten und sich mit kreativen und handwerklichen Medien sowie mit lebenspraktischen Aufgaben auseinander zu setzen“ (Hesse & Prünte 2004, S. 229). Hesse & Prünte stellen zunächst drei Einzelfallbeschreibungen dar, bei denen im Rahmen der täglichen ergotherapeutischen Gruppentherapie (fünfmal pro Woche eineinhalb Stunden) Angebote zur sensorischen Integration vorgehalten wurden. Die Patienten waren durchschnittlich vom zehnten Tag ihrer stationären Behandlung an zur ergotherapeutischen Behandlung erschienen, zu einem Zeitpunkt, an dem sie noch in der „akut psychotischen Episode“ (Hesse & Prünte 2004, S. 223) waren. Für die Autoren war es „offensichtlich, dass diese schizophrenen Patienten in eine Ergotherapie mit nur den üblichen Medien nicht zu integrieren gewesen wären“ (ebd.), auch in dem angebotenen Setting zeigten sie sich an manchen Stellen überfordert. Bei allen drei Patienten zeigten sich Störungen der sensorischen Integration, diese wurden bei den „Aufgaben zur Erhebung der ‚neurological soft signs‘“ (Hesse & Prünte 2004, S. 224), bei den „subjektiven Beschwerden“ (ebd.) und bei den „Verhaltensbeobachtungen“ (ebd.) deutlich. Die „akut psychotischen schizophrenen Patienten [konnten] mit den subjektiven Beschwerden ein erstaunlich genaues Bild ihrer Beeinträchtigungen vermitteln …, das mit den beobachteten Auffälligkeiten zu einem großen Teil übereinstimmt“ (ebd.). Zwei Patientinnen konnten dazu noch angeben, welche dieser Beschwerden sie bereits vor der ersten psychotischen Episode gehabt hatten. Die drei Patienten nutzten die Angebote zur sensorischen Integration während der Ergotherapie, „um sich zu beruhigen, zu entspannen und um kognitiv geordneter zu werden“ (Hesse & Prünte 2004, S. 225). Die Patienten „setzen die Angebote ganz gezielt ein, um ein In-Handlung-Treten für sich selbst zu ermöglichen“ (ebd.). Dabei wählten die Patienten individuell unterschiedliche Angebote aus, die jeweils einen Zusammenhang mit ihren „Beeinträchtigungen“ (ebd.) hatten. Hesse & Prünte sind der Ansicht, dass die Angebote zur sensorischen Integration insbesondere im Zusammenhang mit alltagspraktischen Aktivitäten zur Stabilisierung dieser Patienten beitrug. Die Autoren führten eine weitere Untersuchung durch, in der sie 25 Patienten im Hinblick darauf beobachteten, ob und wie diese die Angebote zur sensorischen Integ- 73 ration nutzten. Die meisten Patienten nutzten diese Angebote intensiv, und zwar durchschnittlich für rund ein Drittel ihrer Zeit, die sie in der Ergotherapie verbrachten. Sie wählten individuell verschiedene Angebote aus. Die Autoren führen die unterschiedliche Auswahl nicht nur auf die individuellen Beeinträchtigungen zurück, sondern auch auf unterschiedlichen Vorerfahrungen der Patienten (vgl. Hesse & Prünte S. 227 f.). „Die offene Gestaltung des Therapieraumes, die freie Zugänglichkeit aller Angebote sowie das an den Bedürfnissen der schizophrenen Patienten orientierte Behandlungskonzept erlaubt es den Betroffenen, individuelle Strategien zu entwickeln, wie sie die Angebote zur sensorischen Integration für sich in den Ablauf der Sitzungen einbauen und für sich nutzbar machen möchten“ (S. 229). Befürchtungen, dass diese Angebote „eine unerwünschte Regression“ (ebd.) und damit eine „Chronifizierung“ (ebd.) fördern würden, bewahrheiteten sich nicht. Im Gegenteil: Die „Dauer der kreativen, handwerklichen und lebenspraktischen Tätigkeiten“ (ebd.) nimmt bereits in den ersten vier Wochen der Therapie immer mehr zu, es zeigen sich auch „qualitative Fortschritte[...]“ (ebd.). „Dabei führt die Nutzung von Angeboten zur sensorischen Integration schon innerhalb einzelner Sitzungen zu positiven Veränderungen, d.h. die akut psychotischen schizophrenen Patienten können sich am Ende der Stunde auf Aktivitäten einlassen, zu denen sie anfänglich noch nicht in der Lage gewesen sind“ (S. 229). Diesen Hinweis halte ich für besonders wesentlich, da hier andere Wirkfaktoren weitestgehend ausgeschlossen werden können. Den Autoren fiel auf, dass Patienten „mit ausgeprägten Störungen der Informationsverarbeitung auch entsprechende motorische Auffälligkeiten zeigten“ (Hesse & Prünte 2004, S. 230). Die Patienten konnten sich im Lauf der Zeit immer besser auf die ergotherapeutischen Angebote und die Gesprächsrunden am Anfang und am Schluss der Therapie einlassen. „Je intensiver die schizophrenen Patienten die Angebote zur sensorischen Integration nutzen, desto mehr nehmen die sensorischen und motorischen Auffälligkeiten ab“ (Hesse & Prünte 2004, S. 231) Ich halte diesen Ansatz für sinnvoll, da die Patienten von Anfang an dazu angeregt werden, herauszufinden, was für sie individuell hilfreich ist. Die Kompetenz im Hinblick auf Eigenaktivität zur Verbesserung der Symptomatik wird gefördert. Sinnvoll wären weitere Studien, auch zum Langzeitverlauf. 74 4.4. Psychotherapie Nach Möller et al. soll die Psychotherapie grundsätzlich einen stützenden, supportiven Charakter haben, den Patienten soll „in realistischer Weise Hoffnung und Mut vermittel[t]“ (Möller et al. 2009, S. 161) werden. Aufdeckende Verfahren wie beispielsweise die Psychoanalyse sind in der Regel nicht indiziert, da die Patienten leicht überfordert werden, wenn die Therapie nicht von einem Therapeuten durchgeführt wird, der Erfahrungen in diesem Bereich hat. Die psychoanalytische Therapie hat nach Ansicht von Möller et al. auf den Langzeitverlauf der Erkrankung keinen wesentlichen Einfluss. Gaebel ist der Ansicht, dass „aufdeckende [Psycho]therapieverfahren … zur Symptomprovokation“ (Gaebel 2002, S. 93) führen können, auch seiner Ansicht nach sind diese Verfahren „nur in Einzelfällen mit modifizierter Technik“ (ebd.) sinnvoll. Deimel & Hölter erwähnen eine Studie von Röhricht & Priebe, die sie als „psychotherapeutisch bzw. psychologisch orientierte[...] Bewegungstherapie“ (Deimel & Hölter 2011, S. 258) bezeichnen: Röhricht & Priebe begründen ihre Studie unter anderem damit, dass besonders bei der teilweise behandlungsresistenten Negativsymptomatik ein Bedarf für neue, effektive Maßnahmen besteht. Außerdem sprechen sowohl positive Berichte in der Literatur als auch neuropsychologische Überlegungen für eine Untersuchung körperpsychotherapeutischer Interventionen (vgl. Röhricht 2006, S. 669): Bewegung und emotionale Erfahrungen gehören einerseits biologisch, andererseits auch erfahrungsgemäß zusammen. Anatomische und funktionelle Verbindungen zwischen dem limbischen System* und den Basalganglien* stützen diese Aussage, ebenso der allgemeine Sprachgebrauch (vgl. auch Scharfetter 2010, S. 267, in: Teil I, Kap. 1.). „Emotional withdrawal/affective blunting and motor retardation“ (Röhricht & Priebe 2006, S. 670) stellen zwei Negativsymptome dar, die sich für körperorientierte Interventionen anbieten. Da diese beiden Symptome nicht kognitiver Natur sind, können sie gezielt durch nicht verbale Methoden beeinflusst werden, in Kombination mit „sensory awareness techniques and emotional movement stimuli“ (ebd.). Die Studie überprüft die Hypothese, dass körperorientierte Psychotherapie effektiv die Negativsymptomatik bei Patienten mit Schizophrenie vermindert. Sie wurde in OstLondon durchgeführt und von dem „North East London Strategic Health Authority Ethics Committee“ (Röhricht & Priebe 2006, S. 670) befürwortet. Die Patienten kamen auf ärztliche Anordnung der „community mental health services“ (ebd.) zur The75 rapie. In der Vergleichsgruppe wurde eine Intervention „supportive counselling (SC)“ (ebd.)28 durchgeführt, um unspezifische Wirkfaktoren auszuschließen. Die Patienten wurden nach klaren Kriterien ausgewählt29. Bei beiden Interventionen waren in einer Therapiegruppe maximal acht Patienten. Die Interventionen fanden zusätzlich zum üblichen Therapieprogramm statt. Über einen Zeitraum von zehn Wochen fanden in beiden Gruppen 20 Sitzungen mit der Dauer von 60-90 Minuten statt, beide Gruppen wurden von erfahrenen Therapeuten begleitet (vgl. Röhricht & Priebe 2006, S. 670 f.). 45 Patienten gaben ihre Einwilligung und wurden nach dem Zufallsprinzip für die beiden Interventionen eingeteilt (vgl. Röhricht 2006, S. 673). Die körperpsychotherapeutische Behandlung orientierte sich an den Prinzipien von Krietsch & Heuer (1997)30 und Scharfetter (vgl. Fußnote 13). Es gibt in der Körperpsychotherapie verschiedene Richtungen, Röhricht & Priebe legten jedoch schulenübergreifend folgende Ziele fest: (1) “to overcome communication barriers though the introduction of non-verbal techniques; (2) to refocus cognitive and emotional awareness towards the body (physical reality, coordination and orientation in space); (3) to stimulate activity and emotional responsiveness; (4) to promote exploration of self-potentials, focusing on body strength and capability, reliability, peasure and selvexpression; (5) to modify dysfunctional self-perception; (6) to address common psychopathological features such as boundary loss, somatic depersonalization, and body schema disturbances” (Röhricht & Priebe 2006, S. 671). Je eine Untersuchung der Patienten wurden zu Beginn und am Ende der Therapie durchgeführt, nach vier Monaten erfolgte eine Folgeuntersuchung. Die Arbeit des Therapeuten und der Forscher verliefen streng getrennt, um die Blindheit des Gutachters zu gewährleisten (vgl. Röhricht & Priebe 2006, S. 672). Die Auswertung erfolgte sowohl über verschiedene quantitative Skalen als auch qualitativ31. Auch die Zufriedenheit der Patienten wurde am Therapieende und in der Folgeuntersuchung berücksichtigt. Die Patienten der Experimentalgruppe hatten nach der Behandlung und in der Folgeuntersuchung signifikant weniger Negativsymptome als die Kontrollgruppe32. Die Autoren belegen, dass diese Verbesserungen unabhängig von medikamentösen Effekten sind, soweit sie in dieser Untersuchung gemessen werden konnten (vgl. Röhricht & Priebe 2006, S. 673). Beide Gruppen zeigten ähnliche Therapiezufriedenheit und ähnliche Beurteilungen der therapeutischen Beziehungen. Auf diese unspezifischen Fakto- 76 ren kann der Effekt der Intervention daher nicht zurück geführt werden. Da es sich um eine kleine Stichprobe mit einem einzigen Therapeuten handelt, ist allerdings nicht geklärt, ob sich diese Ergebnisse bei einer größeren Stichprobe und anderen Therapeuten wiederholen würden. Die Drop-out Rate war in der Experimentalgruppe niedriger, in der Analyse zeigten sich dennoch keine unspezifischen Effekte zwischen den Interventionen. Die Autoren schließen daraus, dass die Körperpsychotherapie von den Patienten gut akzeptiert wurde (vgl. Röhricht & Priebe 2006, S. 675). Die Effekte waren mindestens so groß wie in der Literatur bekannte Effekte medikamentöser Behandlung und kognitiver Verhaltenstherapie. Wenn sich die Effekte wiederholen lassen, sollte man nach Ansicht der Autoren überprüfen, ob körperorientierte Psychotherapie mit anderen Verfahren, beispielsweise kognitiver Verhaltenstherapie, kombiniert werden kann, oder ob die verschiedenen Methoden als Alternativen angesehen werden sollten, möglicherweise für verschiedene Patientengruppen (vgl. Röhricht & Priebe 2006, S. 677). Deimel & Hölter kommentieren diese Studie (2011, S. 258): „Es bestärkt sich die Vermutung, dass die Bewegungstherapie in der beschriebenen Form tatsächlich eine eigenständige Form der Intervention darstellt.“ Ich schließe mich der Ansicht von Deimel & Hölter an, auch die Vorschläge von Röhricht & Priebe für weitere Forschung halte ich für sinnvoll. 4.5. Psychoedukation Gaebel ist der Ansicht, dass „[i]ndividuelle Psychoedukation mit dem Ziel einer Verbesserung des Krankheits- und Behandlungswissens als Grundlage einer Stärkung von Therapiemotivation und Compliance (…) grundsätzlich indiziert [ist]“ (Gaebel 2002, S. 92). Auch Möller et al. sind der Ansicht, dass durch die Psychoedukation, bei der die Patienten über „Informationen über ihre Erkrankung, ihre Behandlungsmöglichkeiten sowie über pathogene Einflussfaktoren“ (Möller et al. 2009, S. 161) erhalten, die „Behandlungsmotivation“ (ebd.) fördern. 4.5.1. Psychoedukation und Sensorische Integrationstherapie Hesse & Prünte kritisieren die gängigen Formen der Psychoedukation: Manchmal werden den Patienten „im Gießkannenprinzip“ (Hesse & Prünte 2004, S. 166) krank- 77 heitsspezifische Informationen gegeben, die Therapeuten gehen nicht immer auf die subjektiven Beschwerden der Patienten ein. Schizophrene Patienten berichten ihrer Erfahrung nach oft über Beschwerden, die auf „Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von Eindrücken in den basalen Sinnessystemen zurückzuführen sind“ (Hesse & Prünte 2004, S. 167). In der Psychoedukation sollte auf diese individuellen Beschwerden eingegangen werden. „Einzelne Symptome und Auffälligkeiten der Patienten können sich dabei als relativ dysfunktionale Bewältigungsversuche der Störungen der sensorischen Integration erweisen“ (ebd.). Die „Grundzüge der sensorischen Integrationstherapie“ (ebd.) und das „Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungsmodell“ (ebd.) sollten in die Psychoedukation einbezogen werden und darauf aufbauend „angemessene Bewältigungsstrategien“ (ebd.) abgeleitet und erprobt werden. Damit wird eine Integration dieser Aspekte in den Alltag wahrscheinlicher, die individuell verschieden ausfallen kann: „Beispielsweise mögen sich Patienten eine Hängematte anschaffen, sich Fühlkissen schneidern oder einem Sportverein beitreten“ (ebd.). Bei einem Teil der Patienten kann die sensorische Integrationsstörung als Teil der bereits vor der Erkrankung auftretenden Vulnerabilität aufgefasst werden. „Es wird weiter vermutet, dass diese Beeinträchtigungen bei der Verarbeitung basaler Sinneseindrücke in Stresssituation[en] zunehmen und insofern eine Überforderung bzw. eine drohende psychotische Episode ankündigen können (…). Wenn diese subjektiven Beschwerden der schizophrenen Patienten als Frühwarnzeichen für eine drohende psychotische Episode genutzt werden sollen, dann ist es wichtig, dass die Patienten selbst das Gefühl haben, sie könnten diese Beschwerden beeinflussen und bewältigen“ (Hesse & Prünte 2004, S. 231). Die Autoren führten daher eine weitere Studie durch, bei der sie gegen Ende der Therapie 15 Patienten „zu ihrer subjektiven Wahrnehmung der Angebote zur sensorischen Integration und zu den Erfolgen der ergotherapeutischen Behandlung“ (ebd.) befragten. Die Patienten berichteten in differenzierter Weise über ihre Erfahrungen mit den verschiedenen Angeboten. Sie nannten nicht nur „rein körperbezogene Folgen“ (Hesse & Prünte 2004, S. 232), sondern auch „Auswirkungen auf ihr psychisches Befinden“ (ebd.). „Aus Sicht der schizophrenen Patienten sind die Angebote zur sensorischen Integration sehr effektiv. Eine Reihe von positiven Veränderungen werden von den Patienten direkt auf die Nutzung der Angebote zurückgeführt. Die akut schizophrenen Patienten berichten, dass sie sich entspannter gefühlt hätten, ihre Stimmung und ihr Tätigkeitsverhalten habe sich gebessert. Die Hälfte der schizophrenen Patienten erwähnen jeweils Fortschritte bezüglich der Konzentration, 78 der Ausdauer, der Belastbarkeit, des Kontaktverhaltens, der Wahrnehmung eigener Bedürfnisse sowie des Umgangs mit Anspannung und Aggression“ (S. 232). Viele Patienten planen entsprechende Aktivitäten für die Zeit nach ihrer Entlassung, beispielsweise die „Wiederaufnahme von Hobbys und besonders von sportlichen Aktivitäten“ (ebd.) oder „die Anschaffung von verschiedenen Therapiematerialien“ (ebd.). Sie lernten, „ihre Bedürfnisse besser zu beachten und ihren Körper stärker wahrzunehmen, Stress zu vermeiden, sich zu entspannen und allgemein früher auf ihr Wohlbefinden zu achten“ (Hesse & Prünte 2004, S. 233). Diese Ergebnisse sind meiner Ansicht nach im Einklang mit den in den Lehrbüchern angegebenen Zielen der Psychoedukation, orientieren sich aber im Unterschied zu den Lehrbüchern explizit an der Erarbeitung eigener Möglichkeiten und Ressourcen der Patienten. Die Ergebnisse beider Studien stimmten mit den Beobachtungen der Therapeuten überein. Um die Effektivität letztlich beurteilen zu können, müssten allerdings weitere Untersuchungen mit einer Vergleichsgruppe und einer Kontrolle der medikamentösen Versorgung stattfinden, was die Autoren in dem ihnen möglichen Rahmen nicht durchführen konnten. Die Autoren kommen dennoch zu dem Schluss, dass die „Angebote zur sensorischen Integration […] eine wesentliche Bereicherung der üblichen Behandlungsweisen schizophrener Patienten“ (Hesse & Prünte, 2004, S. 234) darstellen. Ich stimme der Einschätzung von Hesse & Prünte zu. Eine Verknüpfung der Angebote zur sensorischen Integration mit der Psychoedukation, bei der die Erfahrungen aus der Therapie individuell reflektiert werden, erscheint mir sinnvoll, die Patienten werden zu einer aktiven Mitgestaltung ihrer Therapie angeregt. Neben Studien mit einer Kontrollgruppe erscheinen mir darüber hinaus auch Studien zum Langzeitverlauf im Zusammenhang mit dieser Therapie interessant. 4.5.2. Sporttherapeutische Intervention im Zusammenhang mit Kognition Möller et al. berichten von verhaltenstherapeutischen Ansätzen, bei denen unter anderem „Verfahren zur Reduktion kognitiver Defizite“ (Möller et al. 2009, S. 161) durchgeführt werden. Der Langzeitverlauf kann noch nicht beurteilt werden, kurzfristig scheinen diese Programme erfolgreich zu sein. 79 Malchow, Wobrock & Falkai beschäftigen sich mit den Auswirkungen von aerobem* Training auf die kognitiven Fähigkeiten. Sie sind der Ansicht, dass die Wirkungen körperlicher Aktivität bei psychischen Erkrankungen bisher kaum untersucht worden seien, obwohl es in den meisten Kliniken sportliche Angebote zu den Therapieplänen gehören. Speziell bei schizophrenen Erkrankungen gebe es nur wenige kontrollierte Studien (vgl. Malchow et al. 2010, S. 26). Die Autoren erwähnen tierexperimentelle Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, inwiefern ein Ausdauertraining sowohl die Neurogenese* im Erwachsenenalter als auch „Lern- und Gedächtnisfunktionen“ (ebd.) verbessert. Es zeigte sich, dass die jüngeren Mäuse nach dem Laufradtraining den höchsten Prozentsatz an neu gebildeten Neuronen aufwiesen, zusätzlich vergrößerte sich bei ihnen die Gefäßoberfläche. Aber auch die älteren Mäuse hatten eine gesteigerte Neurogeneserate*33.Weitere Untersuchungen, bei denen die Neurogenese* der Mäuse durch verschiedene Verfahren gehemmt wurde, belegten einen Zusammenhang zwischen der Neurogenese* im Hippokampus* und Lern- und Gedächtnisleistungen (vgl. Malchow et al. 2010, S. 27). Schizophren Erkrankte werden durch die Negativsymptomatik und durch kognitive Störungen oft bereits „Jahre vor dem Ausbruch einer ersten psychotischen Episode“ (ebd.) beeinträchtigt, bei vielen Patienten bleiben diese Symptome während des gesamten Krankheitsverlaufs stabil. Außerdem werden bei schizophren Erkrankten Volumenreduktionen verschiedener Hirnregionen beobachtet. Diese Reduktionen sind am ausgeprägtesten im frontalen* und temporalen* Kortex zu finden34. Eine zweiseitige Verminderung des Hippokampusvolumens* ist besonders belegt. Allem Anschein nach korreliert diese Reduktion mit Defiziten im Verbalgedächtnis35. In post-mortem Studien bei Schizophrenen fand man allerdings keinen Zellverlust. Es gibt aber Hinweise darauf, dass das Neuropil* reduziert ist, insbesondere die Anzahl der Synapsen*36. Malchow et al. halten es daher für sinnvoll, „eine an Tieren erprobte Intervention wie Ausdauersport (…) auch an schizophren Erkrankten einzusetzen, um potentielle, neuroregenerative Effekte gezielt zu verstärken und zu überprüfen, ob die hippokampale[*] Volumenminderung sowie die Kognition zumindest in hippokampus[*]-abhängigen Aufgaben verbessert werden kann“ (Malchow et al. 2010, S. 27). An der Untersuchung nahmen 16 Patienten mit „einer chronischen Verlaufsform der Schizophrenie“ (ebd.) teil, in der „Tagesklinik oder der Ambulanz der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums des Saarlandes in Hom- 80 burg/Saar“ (ebd.) behandelt wurden. Jeweils acht Patienten bildeten die Experimentalund die Kontrollgruppe. Eine gesunde Kontrollgruppe wurde „gezielt im Hinblick auf die Demografie, Bildungsstand und körperliche Fitness der schizophrenen Patienten“ (ebd.) ausgewählt. Alle Patienten nahmen antipsychotische Medikamente, die Medikation musste in den sechs Wochen vor Beginn des Experiments stabil geblieben sein. Die Autoren führten mit der Experimentalgruppe über 12 Wochen dreimal wöchentlich ein Ausdauertraining „nach individuell ermitteltem Belastungsschema“ (Malchow et al. 2010, S. 28) durch. Die Patienten der Kontrollgruppe spielten für die gleiche Zeitdauer Tischfußball; dabei wird zwar motorische Geschicklichkeit und Konzentrationsfähigkeit gefördert, nicht aber die körperliche Ausdauer. Die „Gemeinschaft“ (ebd.) sollte einen Motivationsfaktor darstellen, daher wurde eine „Strategie der blockweisen Zuordnung zu zweit oder zu viert pro Gruppe“ (ebd.) gewählt, was auch für die Durchführung der Kontrollgruppe (Tischfußball) vorteilhaft war. Wenn die Teilnehmer an mindestens 75% der Termine teilgenommen hatten, galt die Studie als „komplettiert“ (ebd.). Ergebnisse: Bei der gesunden Kontrollgruppe vergrößerte sich das Hippokampusvolumen* um 16%, bei den an Schizophrenie Erkrankten um 12%. Bei der Kontrollgruppe der an Schizophrenie Erkrankten, die statt des aeroben* Trainings Tischfußball spielten, vergrößerte sich das Hippokampusvolumen* nicht (-1%). In der Ausdauersportgruppe korrelierte die Zunahme des Hippokampusvolumens* mit der Verbesserung der körperlichen Fitness, die anhand der „Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme“ (ebd.) gemessen wurde. Die in neuropsychologischen Tests gemessenen Verbesserungen des Kurzzeitgedächtnisses korrelierten in der gesamten Patientengruppe mit der Veränderung des Hippokampusvolumens* (vgl. Malchow et al. 2010, S. 79). Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass „körperliches Ausdauertraining (…) eine positive Auswirkung auf das Kurzzeitgedächtnis und damit eines Teils der kognitiven Funktionen haben kann. Beeindruckender als die neuropsychologischen und klinischen Effekte waren die Effekte von körperlichem Ausdauertraining auf neurobiologische Strukturen“ (ebd.). Es zeigte sich damit, dass sich die Ergebnisse der tierexperimentellen Befunde auf den Menschen übertragen lassen: Dieser Befund spreche dafür, dass „Sport als möglicher unspezifischer Proliferationsreiz[*] für eine gesteigerte Neurogenese[*] angesehen werden kann“ (ebd.). 81 Die Autoren halten eine Kombination von gezieltem sportlichem Ausdauertraining mit kognitivem Training für sinnvoll, im Gegensatz zu der heute meist geläufigen Praxis, bei der „Sport … keine entscheidende Rolle in der Therapie chronischer psychiatrischer Erkrankungen spielt, sonder häufig nur allgemeine Empfehlungen von leichter Gruppengymnastik bis zum Krafttraining gegeben werden“ (Molchow et al. 2010, S. 30). Bereits „bisherige Pilotstudien“ rechtfertigen nach Ansicht der Autoren, „sportliches Ausdauertraining als systematisches Therapieelement in den Gesamtbehandlungsplan schizophrener Patienten aufzunehmen“ (ebd.). Die neurobiologischen Mechanismen sollen weiter untersucht werden, um die Behandlungsstrategien zu optimieren. Die Vorschläge der Autoren für weitere Forschung finde ich sinnvoll. Darüber hinaus halte ich diese Studie für richtungsweisend im Hinblick auf das Design: Die Interventionen sowohl in der Experimentalgruppe als auch in den Kontrollgruppen werden klar definiert. Die Intervention in der Kontrollgruppe ist vergleichbar mit der Intervention der Experimentalgruppe, so dass der Wirkfaktor hier nicht die individuelle Zuwendung sein kann. Deimel & Hölter sehen es grundsätzlich als problematisch an, dass sich in den letzten 20 Jahren die meisten diesbezüglichen Studien auf ein „meist funktionell Messkriterium konzentrieren, das sich zwar gut evaluieren lässt, aber kaum die spezifische Problematik dieser Patientengruppe repräsentiert“ (Deimel & Hölter 2011, S. 259). Diese Kritik trifft auf diese Studie zu. Darüber hinaus fehlen meiner Ansicht nach Angaben über die subjektive Bewertung der Patienten und zu Abbruchquoten. Trotz dieser Einwände bin ich der Ansicht, dass der Ansatz Beachtung verdient. Die Patienten sollten im Rahmen der Psychoedukation über diese Möglichkeit, bei der sie selber zu der Regeneration ihres Gehirns und ihrer kognitiven Fähigkeiten beitragen können, informiert werden. Ein entsprechendes spezifisches und individuelles bewegungstherapeutisches Programm sollte sowohl im klinischen als auch im postklinischen Bereich vorgehalten werden. 4.6. Postklinische soziotherapeutische Angebote Sowohl Gaebel (vgl. Gaebel 2002, S. 92) als auch Möller et al. (vgl. Möller et al. S. 161) befürworten Interventionen, bei denen die Familien einbezogen werden. 82 Grundsätzlich ist im Zusammenhang mit soziotherapeutischen Interventionen ein „individuell angemessener Ausgleich zwischen Über- und Unterstimulation“ (Gaebel 2002, S. 93) wichtig, um eine „Provokation von Positiv- oder Negativsymptomatik“ (ebd.) zu vermeiden. Eine Unterstimulation kann sowohl durch „die Unterforderung am Arbeitsplatz als auch ein behütendes, überprotektives familiäres oder institutionelles Milieu“ (Möller et al. S. 161) bewirkt werden. Im Gegensatz dazu kann „jede Form von Stress“ (ebd.) für den Patienten eine Überstimulation bedeuten. Bereits „geringfügige Änderungen der Lebensgewohnheiten bzw. von Gesunden als eher positiv bewertete emotionale Erlebnisse“ (ebd.) werden von schizophrenen Patienten oft als Stress wahrgenommen, auf diesen Umstand müssen insbesondere Angehörige aufmerksam gemacht werden. Deimel & Hölter beschreiben die Schwierigkeit der meisten schizophren erkrankten Menschen, soziale Kontakte über längere Zeit aufrecht zu erhalten. Da Sport und Bewegung nicht nur eine funktionelle, sondern auch eine soziale Komponente hat, bedauern die Autoren, dass es im Anschluss an den Klinikaufenthalt kaum Bewegungsangebote gibt, an die die Patienten anschließen können (vgl. Deimel & Hölter 2011, S. 277). Faulkner (2004, S. 40, in. Deimel & Hölter 2011, S. 277) weist auf der Grundlage empirischer Arbeiten, von denen es allerdings nur wenige gibt, darauf hin, dass die Integration bewegungstherapeutischer Angebot in eine „patientenorientierte Nachsorge “ (vgl. ebd.) sehr wichtig sei. Deimel & Hölter befürworten „Patientenclubs oder die Integration von Bewegungs- und Sportangeboten in Betreuungseinrichtungen … oder auch gesundheitsorientierte, störungsorientierte Programme, die sich allerdings auf breiter Basis noch nicht etabliert haben“ (Deimel & Hölter, 2011, S. 277) Die Autoren stellen im Zusammenhang mit der Bewegungstherapie sechs Einzelfallbeispiele vor, vier davon aus dem postklinischen Bereich. Bei allen Beispielen wird deutlich, wie sich die regelmäßige Bewegungstherapie gerade auch auf soziale Kontakte auswirkt (vgl. Deimel & Hölter 2011, S. 281 ff). Ein Beispiel sei hier exemplarisch dargestellt: Herr G. war aufgrund einer mehrmals wiederkehrenden Schizophrenie nach einem seiner Klinikaufenthalte in ein Wohnheim gezogen. Er erledigte dort zwar seine Pflichten, verhielt sich aber während seiner Freizeit völlig passiv, was von der behandelnden Psychiaterin und der Leitung des Heims unter anderem aufgrund der Adipositas von Herrn G. als problematisch angesehen wurde. Daher wurde ihm die „verpflichtende Teilnahme an soziotherapeutischen Angeboten“ (Deimel & Hölter 2001, S. 283) 83 empfohlen. Diese Gruppe wurde für ihn ein fester Bestandteil seiner Freizeit. Nachdem man ihm viel Zeit zur Eingewöhnung ließ, wurde er in der Gruppe allmählich aktiver und schloss sich verschiedenen Mitpatienten an. Im Lauf der Zeit wurde er dann auch in anderen Bereichen aktiver, konnte eine Teilzeitarbeit aufnehmen und in ein anderes, weniger strukturiertes Heim umziehen. Die in der Sport- und auch in der Psychotherapiegruppe geknüpften Kontakte pflegte er weiterhin. Dieses und auch die anderen Beispiele verdeutlichen, dass es sinnvoll erscheint, Sport und Bewegung in den postklinischen Bereich einzubeziehen. Interessant wären auch hier weitere wissenschaftliche Studien, insbesondere Langzeitstudien. 4.7. Schlussfolgerung für Therapie und Rückfallprophilaxe Erwachsener Auch wenn weitere Studien sinnvoll und notwendig erscheinen, rechtfertigen nach meiner Ansicht die vorliegenden Studien ein vermehrtes Einbeziehen des Körpers in Therapie und Rückfallprophilaxe auf allen genannten Ebenen. Deimel und Hölter (2011, S. 268): „Für eine weitere klinische Etablierung der Bewegungstherapie scheint es insgesamt sinnvoll zu sein, zusätzliche interventionsnahe Diagnostik- und Evaluationsmaße zu entwickeln. Bei chronischen schizophrenen Erkrankungen lassen sich außerdem therapeutische Veränderungen häufig nur auf der Mikroebene nachweisen.“ Dieser Feststellung stimme ich zu. Darüber hinaus halte ich es für sinnvoll, die Patienten selber für die Wahrnehmung von Veränderungen auf der Mikroebene zu sensibilisieren, um sie in die Lage zu versetzen, einerseits ein mögliches Rezidiv frühzeitig zu erkennen, andererseits auch positive Veränderungen wahrzunehmen, die sie möglicherweise teilweise selber bewirken und unterstützen können. 84 Fazit Unkontrollierbarer Stress in der Säuglingszeit, verursacht beispielsweise durch eine unsichere oder desorganisierte Bindung, trägt zu gestörter Sensomotorik bei. Diese Problematik zeigt sich oft bei der schizophrenen Erkrankung. Therapieund Präventionsansätze sollten diesen Gesichtspunkt berücksichtigen und körperbezogene Interventionen mehr in ihr Programm einbeziehen. Die beschriebenen Studien stützen meiner Ansicht nach diese Hypothese. Es spricht vieles für Read´s und Gumley´s Sichtweise der Schizophrenie als einer Erkrankung, bei der emotionale Dysregulation, oft auch im Zusammenhang mit desorganisierter Bindungsorganisation, eine wesentliche Rolle spielt. Daher halte ich es für sinnvoll, bereits im Säuglingsalter primäre und universelle Präventionsangebote vorzuhalten, beispielsweise Feinfühligkeitstrainings für Eltern. Ganz besonders sinnvoll finde ich selektive Präventionsangebote für Säuglinge mit besonderen Risikofaktoren. Wenn ein Säugling aufgrund eines Feinfühligkeitstrainings seiner Eltern mehr emotionale Sicherheit erfährt, optimieren sich die Voraussetzungen für eine adäquate Entwicklung sowohl der Emotionsregulation, als auch des Gehirns und der Wahrnehmungsverarbeitung, beide Faktoren spielen bei der Entstehung der Schizophrenie eine Schlüsselrolle. Die beiden Präventionsansätze, die ich im Zusammenhang mit früher Prävention vorgestellt habe, geben deutliche Hinweise darauf, dass es sinnvoll ist, die Sensomotorik darüber hinaus auch explizit in die frühe Prävention einzubeziehen. Zu beiden Ansätzen liegen schlüssige Studien vor, in denen gezeigt wurde, dass die Förderung der Sensomotorik gerade auch bei schwierigen Entwicklungsbedingungen die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des Säuglings fördert. Weitere Recherche und/oder Forschung erscheint in diesem Zusammenhang sinnvoll und notwendig, vor allem, um die Punkte zu klären, an denen diese beiden Konzepte verschieden sind. Beide Konzepte sind in einer Notsituation entstanden, in der nur relativ wenige Betreuungspersonen für die Säuglinge zur Verfügung standen. In postmodernen Industrieländern ist eine solche Notsituation nicht die Regel. Ich halte daher die Entwicklung weiterer Konzepte für denkbar, in denen die wesentlichen Bestandteile beider Konzepte enthalten sind: Säuglinge können dann einerseits vom aktiven Üben in einer bestimmten Phase des Tages, andererseits auch von aufmerksamer, die Selbständigkeit 85 unterstützender Pflege und einer bewegungsfreundlichen Umgebung, in der sie andere Phasen des Tages ungestört verbringen können, profitieren. Auch die häufig übersehenen Neurological Soft Signs im mittleren Kindesalter sollten mehr Beachtung bei Prävention und Forschung finden, insbesondere im Zusammenhang mit den unspezifischen Symptomen, die Ruhrmann beschreibt. Es wäre interessant, hier mögliche Zusammenhänge mit emotionaler Dysregulation zu überprüfen und damit klarere Anhaltspunkte für effektive Therapie- und Präventionsmöglichkeiten in dieser Phase zu gewinnen. Die Aspekte zum Erleben des Körpers in der Schizophrenie geben weitere Hinweise auf eine Bedeutung der Sensomotorik bei der Entstehung der Schizophrenie zumindest in den Fällen, bei denen die entsprechenden Symptome nach einer psychotischen Episode nicht abgebaut werden. Diese Aspekte zeigen aber auch die Bedeutung körperbezogener Interventionen bei der Therapie und Rückfallprophilaxe Erwachsener. Die im Zusammenhang mit Therapie und Rückfallprophilaxe erkrankter Erwachsener erläuterten Studien rechtfertigen meiner Ansicht nach eine weitere Verbreitung körperbezogener Interventionen in allen Phasen des Therapieprozesses. Die beschriebenen Interventionen unterstützen die aktive Mitgestaltung dieses Prozesses durch die Betroffenen selber. Weitere Forschung halte ich vor allem in Bezug auf die Wirkfaktoren der Therapie und zu der Effektivität körperbezogener Interventionen hinsichtlich des Langzeitverlaufs für sinnvoll und geboten. Diese Untersuchungen sollten meiner Ansicht nach immer auch die subjektive Sichtweise der Betroffenen berücksichtigen (vgl. Hesse & Prünte 2004, S.232 ff.). Deimel & Hölter sind der Ansicht, dass es im Zusammenhang mit Schizophrenie noch relativ wenige Studien zur Effektivität von Bewegungstherapie gebe (s. Teil III; Kap. 4.2.). Hesse & Prünte führen im Zusammenhang mit der Durchführung der Sensorischen Integrationstherapie allerdings auch organisatorische Probleme innerhalb der Klinik, teilweise geringe diesbezügliche Kenntnisse der verordnenden Ärzte und Psychologen (vgl. Hesse & Prünte 2004, S. 158)37 und die Problematik, die Klinikleitungen von dem Konzept zu überzeugen (vgl. Hesse & Prünte, 2004, S. 234) als zu überwindende Hindernisse an. Bei dem Interessenkonflikt der publizierenden Autoren Ruhrmann & Klosterkötter, die gleichzeitig für ein Pharmaunternehmen tätig sind, wird ein weiteres mögliches Problem deutlich (s. Teil III; Kap. 3.1.3.), das sich ge- 86 genwärtig nicht gerade fördernd auf die Anwendung körperorientierter Interventionen bei Prävention und Therapie auswirkt. Daher finde ich weitere Untersuchungen zum Kenntnisstand und zu den Einstellungen aller involvierten Berufsgruppen in Bezug auf die Berücksichtigung der Sensomotorik bei Prävention und Therapie in ihrem jeweiligen Fachgebiet ebenso notwendig, sei es in der Arbeit mit Säuglingen und Kindern mit erhöhtem Risiko, mit Menschen jeden Alters mit unspezifischen Symptomen oder mit Menschen, die bereits eine oder mehrere psychotische Episoden hatten, sowohl im klinischen als auch im postklinischen Bereich. Erklärung: Ich versichere hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst habe und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht, diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen. 87 Anhang Medizinische Fachbegriffe • Amygdala: „(…) Mandel, Frucht des Mandelbaums“ (Duden 2012, S. 103) • Aerob: „(…) Sauerstoff (…) brauchend (…)“ (Duden 2012, S. 80) • Antagonistisch: „gegensätzlich, entgegengesetzt“ (Duden 2012m –s, 115) • Atrophie : „… Schwund von Organen, Geweben, Zellen (wobei Gewebsstrukturen und Organaufbau erhalten bleiben“ (Duden 2012, S. 144 f.) • Basalganglion: „vgl. Stammganglion“ (Duden 2012, S. 156): „Nervenknoten des Hirnstamms“ (Duden 2012, S. 730) • Cortisolausschüttung: s. Kortisol • Depressiv: „seelisch gedrückt, verstimmt“ (Duden 2012, S. 222) • Depressiver Stupor: „Die Überwältigung von Angst und Schuld, von Devitalisierung und Untergang, schwere Ratlosigkeit und totale Entschlussunfähigkeit bei völliger Antriebslosigkeit können solche Ausmaße annehmen, dass der Kranke erstarrt“ (Scharfetter 2010, S. 271). Nach Scharfetters Erfahrung ist der Zugang zu einem Kranken im depressiven Stupor problematischer als zu einem Kranken im katatonen Stupor (vgl. ebd.). • Dopamin gehört zu den => „Neurotransmittern“ „Muttersubstanz der Hormone Adrenalin und Noradrenalin“ (Duden 2012, S. 237), „(…) Beteiligung des dopaminergen Systems an Entstehung versch. (…) psychischer Störungen (…); zentraler Stellenwert des D. als Neurotransmitter im sog. dopaminergen Belohnungssystem (…); enthält (…) Verbindungen zu allen Transmittersystemen, insbes. auch zur Präfrontalregion[*] (…) mit denen Regulierung von Aktivitätsgrad, Bewusstseinslage u. emotionaler Befindlichkeit assoziiert wird (…)“ (Pschyrembel 2012, S. 492) • frontal: „… stirnwärts, stirnseitig“ (Pschyrembel 2012, S. 702) • Frontalhirn: Das Frontalhirn ist ein Teil der Hirnrinde (Kortex), in dem „die höchsten integralen Funktionen gesteuert“ werden (vgl. Hüther 2004, S. 119) • Frontaler Kortex => s. Frontalhirn • Glucokortikoide (Glucocorticoid): „(…) Glucosteroide, sog. Stresshormone (…)“ (Pschyrembel 2012, S. 777) • Glucosteroide => Glucokortikoide 88 • Hippocampus: „(…) zum Archicortex der Großhirnrinde gehörender Teil des limbischen Systems[*] (…) spielt eine zentrale Rolle bei der Gedächtnisbildung“ (Pschyrembel 2012, S. 882) • Hippocampusvolumen: Volumen des => Hippokampus • Hirnstamm: „(…) von den Hemisphären fast vollständig umschlossenner Teil des Gehirns“ (Pschyrembel 2012, S. 885) • Kontinuumshypothese: Heute gehen die meisten Autoren von einem Kontinuum aus, an dessen einem Ende die unipolaren (depressive* oder manische*) und bipolaren (manischdepressive*) Psychosen stehen an dessen anderen Ende die Schizophrenie steht. Die schizoaffektiven Psychosen, die sowohl von psychotischer Symptomatik als auch von manischdepressiver* Symptomatik gekennzeichnet sind, nehmen hier eine Zwischenstellung ein (vgl. Gaebel 2002, S. 82). Marneros & Watzke stützen diese Hypothese mit Hinweisen unter anderem zur Verlaufsdynamik, zur Prognose, zu neuropsychologischen Aspekten und zu prämorbidphänomenoloschen Aspekten (vgl. Marneros & Watzke 2010, S. 132 ff.) • Kortex: „(…) Rinde, Schale, (…) Cortex cerebri: ‚Großhirnrinde‘“ (Duden 2012, S. 440) • Kortisol gehört zu den => Kortikosteroiden. „Nachw.: durch direkte Bestimmung i Plasma u. Harn, ggf. auch im Speichel (…)“ (Pschyrembel 2012, S. 461) • Kortisolwert: S. Kortisol • Limbisches System: s. Kapitel 1.1.2: Störungen der sensorischen Modulation • Manisch: „(…) krankhaft heiter, erregt, besessen, tobsüchtig“ (Duden 2012, S. 482) • Manisch-depressive Erkrankung: „bipolare Störung: periodisch auftretende psychische Erkrankung, charakterisiert durch manische und depressive Phasen, die einander in mehr oder weniger raschem Wechsel ablösen“ (Duden 2012, S. 482) • Neokortex: „(…) stammesgeschichtlich jüngster Teil der Großhirnrinde“ (Duden 2012, S. 530) • Neuropil: „(…) im ZNS[*] zwischen den Zellkörpern gelegenes, amorph erscheinendes Geflecht, das aus Dendriten, Axonen u. Gliazellfortsätzen besteht“ (Pschyrembel 2012, S. 1451) • Neuroleptika: „(…) Bezeichnung für solche zur Behandlung von Psychosen angewandten Arzneimittel, die den zentralnervösen Grundtonus herabsetzen, die moto- 89 rische Aktivität hemmen, bedingte Reflexe abschwächen u. das vegetative Nervensystem beeinflussen“ (Duden 2012, S. 540). • Neurotransmitter: „(...) neurogen gebildete Substanzen, die bei der Erregungsübertragung in den synaptischen[*] Spalt freigesetzt werden und die Erregungsweiterleitung bewirken (…)“ (Duden 2012, S. 542) • Oxytocin: (…) „ruft rhythm. Kontraktionen des Uterus hervor, bes. am Ende der Schwangerschaft, u. bewirkt ein Auspressen der Milch aus den (…) Brustdrüsen (…). Es wird durch Wärme- u. Berührungsreize freigesetzt, die beim Saugen an der laktierenden Mamma entstehen“ (Zetkin & Schaldach, 1992, S. 1562) • PANSS: “Positive and Negative Syndrome Scale” („Positive and Negative Syndrome Scale“ (Hanley & Belfus 1998, S. 288) • ) Perception => Perzeption – „(…) 1) [Vorgang der] Reizaufnahme durch die Sinnesorgane. 2) sinnliches Wahrnehmen eines Gegenstandes ohne bewusstes Erfassen und Identifizieren des Wahrgenommenen (z. B. bei flüchtigem Hinschauen (…)“ (Duden 2012, S. 602) • Perzeptionsprozess: s. Perception • Phylogenetisch: „(…) die Stammesgeschichte der Lebewesen betreffend“ (Duden 2012, S. 610) • Präfrontaler Kortex => Frontalhirn • Proliferieren: „wuchern, gesteigertes Wachstum zeigen (von Geweben)“ (Duden 2012, S. 640) • Propriozeption: „(…) Eigenempfindung des Körpers“ (Duden 2012, S. 642) • Rezidiv: „(…) Wiederaufleben, Rückfall (bezogen auf eine gerade überstandene Krankheit)“ (Duden 2012, S. 682) • Schizoid: „(…) die Symptome der … Schizophrenie in leichterem Grade zeigend, seelisch gespalten, von introvertierter, autistischer Veranlagung (von Menschen mit Persönlichkeitsstörungen)“ (Duden 2012, S. 700) • Schizotypische Persönlichkeitsstörung: „(…) psychische Störung mit auffällig eigenartigem Verhalten, Misstrauen hoher sozialer Ängstlichkeit, vagem Denkstil, bizarren Gedanken, inadäquaten Gefühlsäußerungen, Kontaktstörungen u. Tendenz zu sozialem Rückzug ohne eindeutige Sympt. einer Schizophrenie (…)“ (Pschyrembel 2012, S. 164) 90 • Serotonin: „(…) im ZNS[*] Einfluss auf Stimmung (S.-Mangel wird als pathogenet. Faktor der Depression[*] diskutiert), Schlaf-Wach-Rhythmus, Nahrungsaufnahme, Schmerzwahrnehmung u. Körpertemperatur (…)“ (Pschyrembel 2012, S. 1922) • Suizid: „(…) eine suizidale Handlung mit letalem (tödlichem) Ende“ (Duden 2012, S. 745) • Synapse: „(…) Umschaltstelle für die diskontinuierl. Erregungsübertragung von einem Neuron auf ein anderes od. auf das Erfolgsorgan (z. B. Muskelzelle); … Erregungsübertragung erfolgt beim Menschen v. a. biochemisch mit Hilfe von Neurotransmittern[*]“ (Pschyrembel 2012, S. 2032 • Taktil: „(…) den Tastsinn betreffend; mithilfe des Tastsinns [erfolgend]“ (Duden 2012, S. 757) • Temporalis: „(…) zu den Schläfen gehörend“ (Duden 2012, S. 761) • Thalamus: „(…) Funktion: steht durch entspr. Fasersysteme mit anderen Teilen des ZNS[*] (…) in Verbindung (…); zentrale subkortikale Sammel- u. Umschaltstelle für fast alle der Großhirnrinde zufließenden sensibel-sensor. Erregungen aus der Umwelt u. Innenwelt u. ein wichtiges selbständiges Koordinationszentrum, in dem die exterozeptiven (Berührungs-, Schmerz-, Temperatur-) Empfindungen eine somatotop. Gliederung in spezif. Kernen aufweisen. Die propriozeptiven (Geschmacks, Eingeweide-, Gleichgewichts-) Empfindungen werden in nichtspezifischen Thalamuskernen miteinander verknüpft u. können so affektbetont erscheinen (Lust, Unlust). (…) der Th. [ist] außerdem am Zustandekommen von Ausdrucksbewegungen od. Psychoreflexen beteiligt, die als motorische Reaktionen (Abwehr, Fluchtreflex u. Schmerzäußerungen) bei schmerzhaften od. affektbetonten Impulsen auftreten. (…)“ (Pschyrembel 2012, S. 2070) • Vasopressin: „(…) Hormon (…) von blutdrucksteigernder Wirkung“ (Duden 2012, S. 804) • Vestibularapparat: „Gleichgewichtsorgan im Ohr (…)“ (Duden 2012, S. 818) • ZNS: „Zentralnervensystem“ (Duden 2012, S. 849) 91 Literaturliste 1. Aly, Monika: Zur Einführung. In: Pikler, Emmi: Laßt mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen, zusammengestellt und überarbeitet von Anna Tardos, München 2001, S. 12-15 2. Assion, H.-J.; Weiss, A.; Korwischka, J: Schizophrenie – ethnopsychiatrische und ethnopharmakologische Aspekte. In: Die Psychiatrie 1/2009, Schattauer Gmbh 3. Beutel, Manfred E.: Neurobiologie. In: Rolf H. Adler, Wolfgang Herzog, Peter Joraschki, Karl Köhle, Wolf Langewitz, Wolfgang Söllner, Wolfgang Wesiack: Uexkül: Psychosomatische Medizin, Theoretische Modelle und klinische Praxis. München, 7. Aufl. 2011, S. 61-73 4. Bolby, John: Bindung als sichere Basis. Grundlage und Anwendung der Bindungstheorie; aus dem Englischen übersetzt von Hillig, Axel und Hanf, Helene; München 2008 5. Brisch, Karl Heinz: Bindungstheorie. In: Rolf H. Adler; Wolfgang Herzog; Peter Joraschki, Karl Köhle; Wolf Langewitz, Wolfgang Söllner, Wolfgang Wesiack: Uexkül: Psychosomatische Medizin, Theoretische Modelle und klinische Praxis. München, 7. Aufl. 2011, S. 125-135 6. Bundy, Anita C.; Lane, Shelly J.; Murray, Elizabeth A.: Sensorische Integrationstherapie. Theorie und Praxis, Heidelberg, 2007 7. Deimel, Hubertus; Hölter, Gerd: Störungs- und altersorientierte Behandlungsansätze in der klinischen Bewegungstherapie; Schizophrene Störungen, in: Gerd Hölter: Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen. Köln 2011; S. 211-287 8. Downing, George: Frühkindlicher Affektaustausch und dessen Beziehung zum Körper. Übersetzung von Michael Koulen. In: Gustl Marlock, Halko Weiss (Hrsg.): Handbuch der Körperpsychotherapie. Stuttgart, 1. korrigierter Nachdruck 2007, S. 333-350 9. Duden. Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe. Projektleitung: Bauer, Michael; Redaktionelle Leitung: Kilian, Ulrich; Redaktion: Klonk, Sabine; Schooltink, Heidi. Manheim, 2012 10. Faltermaier, Toni: Gesundheitspsychologie; Stuttgart, 2005 11. Gaebel, Wolfgang: Schizophrenien und wahnhafte Störungen. In: Harald Freyberger,Wolfgang Schneider, RolfDieter Stieglitz (Hrg.): Kompendium Psychiatrie, Psychotherapie, psychosomatische Medizin. Basel 2002, 11. Aufl. 12. Grossmann & Grossmann: Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen. In: Herpetz-Dahlmann, Beate; Resch, Franz, Schulte-Markwort, Michael; Warnke, Andreas (Hrg.): Entwicklungspsychiatrie. Biopsychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen. Stuttgart, 2. Aufl. 2008, S. 221-241 13. Hanley & Belfus: Dictionary of Medical Acronyms, Phildalphia, 3rd edition 1998, S.288 14. Hesse, Wolfgang, Prünte, Katharina: Sensorische Integration für schizophrene Patienten. Theoretische Grundlagen – Therapiekonzept – Erfahrungen. Unter Mitarbeit von Gabriele Königer. Dortmund 2004 15. Hölter, G.: Konturen der klinischen Bewegungstherapie. In: Gerd Hölter: Bewegungstherapie bei psychischen Erkrankungen. Köln 2011, S. 71-153 16. Höltershinken, Dieter; Scherer, Gertrud: Die theoretischen Grundlagen des PEKiP und ihre Weiterentwicklung – ein Überblick, in: Höltershinken, Dieter; Scherer, Gertrud (Hrsg.): PEKiP. Das Prager-Eltern-Kind-Programm. Theoretische Grundlagen, Ursprung und Weiterentwicklung, Bochum/Freiburg 2004, S. 16-29 17. Hüther, Gerald: Biologie der Angst. Wie aus Streß Gefühle werden, Göttingen, 6. Aufl. 2004 92 18. Hüther, Gerald: Resilienz im Spiegel entwicklungsbiologischer Erkenntnisse, in: Opp, Günter, Fingerle Michael (Hrsg.): Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Resilienz und Risiko, München 2007, S. 45-56 19. Joraschky, Peter; von Arnim, Angela: Der Körperbildskulpturtest. In: Peter Joraschky; Thomas Loew; Frank Röhricht: Körpererleben und Körperbild. Ein Handbuch zur Diagnostik. Stuttgart, 2009, S. 183-191 20. Klapp, Burgard F.; Peters, Eva M.J.: Biologische Grundlagen der Anpassung und ihre Entwicklung – Einführung. In: Rolf H. Adler, Wolfgang Herzog, Peter Joraschki, Karl Köhle, Wolf Langewitz, Wolfgang Söllner, Wolfgang Wesiack: Uexkül: Psychosomatische Medizin, Theoretische Modelle und klinische Praxis. München, 7. Aufl. 2011, S. 43-48 21. Koch, Jaroslaw: „Abschließendes Protokoll“ der Forschungsarbeiten aus den Jahren 1968 – 1978. (o.J., S. 1-10) In: Höltershinken, Dieter; Scherer, Gertrud (Hrsg.): PEKiP. Das Prager-Eltern-Kind-Programm. Theoretische Grundlagen, Ursprung und Weiterentwicklung, Bochum/Freiburg 2004, S. 31-36 22. Koch, Jaroslaw: Der Einfluss der frühen Bewegungsentwicklung auf die motorische und psychische Entwicklung des Säuglings, in: Irle M. (Hrsg.): Bericht über den 26. Kongress der deutschen Gesellschaft für Psyschologie, Göttingen 1969, S. 413-421). In: Höltershinken, Dieter; Scherer, Gertrud (Hrsg.): PEKiP. Das PragerEltern-Kind-Programm. Theoretische Grundlagen, Ursprung und Weiterentwicklung, Bochum/Freiburg 2004, S. 37-43 23. Krietsch, Sophie, Heuer Birgit: Schritte zur Ganzheit. Bewegungstherapie mit schizophren Kranken, Stuttgart 1997 24. Malchow, B.; Wobrock, T; Falkai, P: Sport als Therapieoption bei Schizophrenie. In: Die Psychiatrie; 1/2010, S. 25-31 25. Möller, Hans-Jürgen; Laux, Gerd; Deister, Arno: Psychiatrie und Psychotherapie. Stuttgart, 4. Aufl. 2009 26. Matecek, Zdenek: Jaroslaw Koch und sein Kampf für eine harmonische Kinderentwicklung, in: Höltershinken, Dieter; Scherer, Gertrud (Hrsg.): PEKiP. Das PragerEltern-Kind-Programm. Theoretische Grundlagen, Ursprung und Weiterentwicklung, Bochum/Freiburg 2004, S. 13-15 27. Pikler, Emmi: Laßt mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen, zusammengestellt und überarbeitet von Anna Tardos, München 2001 28. Poeck & Orgas: Über die Entwicklung des Körperschemas. In: Scheid, W.; Weitbrecht, H. J.; Wieck, H. H.: Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie und ihrer Grenzgebiete. Stuttgart, 1964 29. Porges, Stephen W.: Neuroception – Ein „unterbewusstes“ System zur Wahrnehmung von Bedrohung und Sicherheit. Übersetzt von Andreas Remmel. In: Andreas Remmel, Otto F. Kernberg, Wolfgang Vollmoeller, Bernhard Strauß: Handbuch Körper und Persönlichkeit. Entwicklungspsychologie, Neurobiologie und Therapie von Persönlichkeitsstörungen, Stuttgart, 2006, S. 64-72 30. Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch. Redaktion: Arnold, Ulrike; Mailahn Miriam; Nagl, Britta; Vettin, Julia; Wilck, Aydan; Berlin/Boston, 263. Auflage, 2011 31. Read, John; Gumley Andrew: Bindungstheorie und Psychose. Die Dominanz des medizinischen Modells. In: Karl Heinz Brisch, Theodor Hellbrügge (Hrsg.): Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft. Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie. Stuttgart 2009, S. 237-278 93 32. Resch, Frank.: Schizophrenie. In: Beate Herpertz-Dahlmann, Frank Resch, Michael Schulte-Markwort, Andreas Warnke (Hrsg.): Entwiclungspsychiatrie. Bio4 psychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Stuttgart, 2. Aufl. 2008, S. 803-834 33. Rothenberger, A.; Banaschewski, M.; Siniatchkin, H.; Heinrich, H.: Entwicklungsneurophysiologie. In: Beate Herpertz-Dahlmann; Franz Resch; Michael Schulte-Markwort; Andreas Warnke: Entwicklungspsychiatrie. Biopsychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen. Stuttgart u. a., 2. Aufl. 2008, S. 55-87 34. Röhricht, Frank: Körperschema, Körperbild und Körperkathexis in der akuten Schizophrenie. In: Frank Röhricht, Stefan Priebe: Körpererleben in der Schizophrenie; Göttingen u. a. 1998, S. 91-104 35. Röhricht Frank: Körperorientierte Psychotherapie psychischer Störungen. Ein Leitfaden für Forschung und Praxis; Göttingen 2000 36. Röhricht, Frank; Priebe, Stefan: Effekt of body-oriented psychological therapy on negative symptoms in schizophrenia: a randomized controlled trial. In: Psychological Medicine. A Journal for Research in Psychiatry and the Allied Sciences. Edited by Eugene Paykel, Kenneth S. Kendler; Cambridge University Press 2006, S. 669-678 37. Röhricht,Frank: „Körperschema“, „Körperbild“ und Körpererleben - Begriffsbildung und klinische Relevanz. In: Gustl Marlock, Halko Weiss (Hrsg.): Handbuch der Körperpsychotherapie. Stuttgart, 1. korrigierter Nachdruck 2007a, S. 256-262 38. Röhricht, Frank: Körperpsychotherapie bei schweren psychischen Erkrankungen. In: Gustl Marlock, Halko Weiss (Hrsg.): Handbuch der Körperpsychotherapie. Stuttgart, 1. korrigierter Nachdruck 2007b, S. 723-733 39. Ruhrmann, S.; Schultze-Lutter, F.; Paruch, J.; Klosterkötter, J.: Prädiktion und Prävention psychischer Störungen am Beispiel der Psychosen. In: Die Psychiatrie 4/2009, Schattauer GmbH, S. 213-220 40. Scharfetter, Christian: Allgemeine Psychopathologie. Eine Einführung. Stuttgart u. a., 6. Aufl. 2010 41. Scherer, Gertrud: Untersuchungen von J. Koch zur Wirksamkeit der Förderung von Kindern im Säuglingsalter. In: Höltershinken, Dieter; Scherer, Gertrud (Hrsg.): PEKiP, Das Prager-Eltern-Kind-Programm. Theoretische Grundlagen, Ursprung und Weiterentwicklung, Dortmund, 2. Aufl. 2004, S. 30-43 42. Strub, Ute: Zur Einführung. In: Pikler, Emmi: Laßt mir Zeit. Die selbständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen, zusammengestellt und überarbeitet von Anna Tardos, München 2001, S. 9-12 43. Uexküll, Thure von; Wesjack, Wolfgang: Integrierte Medizin als Gesamtkonzept der Heilkunde: ein bio-psycho-soziales Modell. In: Rolf H. Adler, Wolfgang Herzog, Peter Joraschki, Karl Köhle, Wolf Langewitz, Wolfgang Söllner, Wolfgang Wesiack: Uexkül: Psychosomatische Medizin, Theoretische Modelle und klinische Praxis. München, 7. Aufl. 2011, S. 3-40 44. Zdenek Matèjcek: Jarosloaw Koch und sein Kampf für eine harmonische Kinderentwicklung, in: Höltershinken, Dieter; Scherer, Gertrud (Hrsg.): PEKiP, Das PragerEltern-Kind-Programm. Theoretische Grundlagen, Ursprung und Weiterentwicklung, Dortmund, 2. Aufl. 2004, S. 13-15 45. Zerres, A: Epigenetik – Vermittlung zwischen Anlage und Umwelt. In: Die Psychiatrie 2/2010, S. 94-99; Schattauer GmbH 46. Zimmermann & Spangler: Bindung, Bindungsdesorganisation und Bindungsstörungen 94 in der frühen Kindheit: Entwicklungsbedingungen, Prävention und Intervention, in: Robert S. Siegler; Judy S. Deloache; Nancy Eisenberg: Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter. Deutsche Auflage: Hrsg.: Sabina Pauen; aus dem Amerikanischen übersetzt von Joachim Grabowski; Heidelberg, 2008 Link: Ausbildung zur Pikler-Pädagogin http://www.basisgemeinde.de/images/pikler_ausbildung07_def.pdf [16.10.2011] Anmerkungen 1 Zimmermann & Spangler beziehen sich hier auf Main & Salomon 1990. 2 Zimmermann & Spangler beziehen sich bei dieser Aussage auf Hertshaard et al. 1995 3 Grossmann & Grossmann beziehen sich auf Brisch 1999; Jacobwith et al. 2001; Spangler & Zimmermann 1995; Lyons-Ruth et al. 1993; Main 1995; 2001; Liotti 1999 4 Grosmann & Grossmann beziehen sich auf Herstsgaard et al. 1995; Spangler et al. 2000. 5 zum einen das „Adult Attachment Interview, AAI“ (vgl. Main & Golswyn 1982, in: Brisch 2011, S. 131); zum anderen der „Adult Attachment Projective Test (AAP)“ (vgl. George et al. 1999, in: Brisch 2011, S. 131). 6 Van Ijzendoorn et al. (1999, in: Read & Gumley 2009, S. 254) zeigten dies für „temperamentbedingte[...]“ (ebd.) Bokhorst et al. (2003); Bakermanns-Kranenburg & van Ijzendoorn 2004, in: Read & Gumley 2009, S. 254) für „genetische[...]“ Faktoren 7 Bowlby bezieht sich bei dieser Aussage auf Sameroff/Candler 1975. 8 Bowlby bezieht sich bei dieser Aussage auf vgl. Sroufe 1983. 9 Read & Bumley beziehen sich auf Bhugra et al.1997; Janssen et al. 2003; Mallett et al. 2002; Morgan et al. 2007 10 Vgl. Bental 2003 und Read 2004a, in: Read & Gumley 2009, S. 237 11 Gervai zeigte beispielsweise, dass bestimmte Eigenschaften eines „Dopaminrezeptores … eher mit einer desorganisierten Bindung in Zusammenhang stehen“ (vgl. Gervai 2008, in. Read & Gumley 2009, S. 269, Anm. 2). Andere Untersuchungen in Bezug auf eine „Gen-Umwelt-Interaktion“ (Read & Gumley 2009, S. 269, Anm. 2) verliefen jedoch widersprüchlicher. 12 Vgl. u. a. Burman et al. 1987; Roff & Knight 1981; Tienari 1991; Marcus et al. 1987, in: Read & Gumley 2009, S. 242 13 Scharfetter beschreibt„Ich-Vitalität [als] Angst vor dem oder Erleben vom eigenen Absterben (…) [;] Ich-Aktivität [als] Fehlen der Eigenmächtigkeit im Handeln und Denken (…) [;], Ich-Konsistenz und Kohärenz [als] Aufhebung des Zusammenhangs oder/und der Beschaffenheit des Leibs oder seiner Teile, der Gedanken-Gefühlsverbindungen (…) [;] Ich Demarkation [als] Unsicherheit, Schwäche oder Aufhebung der Ich-/Nicht-Ich-Abgrenzung, Fehlen eines (privaten) Eigenbereichs (…)[;] Ich-Identität [als] Unsicherheit über die eigene Identität, (…) Verwandlung in ein anderes Wesen (…)“ (Scharfetter 2010, S. 86, Tab. 3.3.;). 14 (vgl. King et al., 1991; Manschrek & Ames, 1984; Manschrek, Maher & Ader, 1981; Manschrek et al., 1982; u. a., in: Hesse & Prünte 2004, S. 87) 95 15 Vgl. Schröder, Bubeck & Sauter 2000; Schröder, Niethammer & Karr 1999; Schröder et al. 1993; 1998, in: Hesse & Prünte 2004, S. 87 16 Peak & Orgas nennen in diesem Zusammenhang keine Seitenzahl. 17 Röhricht macht keine Angaben, wann und wo dieser Test erschienen ist. 18 19 Folgende Einzelaussagen wurden besonders häufig genannt: • „‘Ich fühle mich, als hätte das Innere meines Körpers keinen Schutz gegenüber Dingen, die in meiner Nähe geschehen.‘ (34 Patienten = 65,4%)“ (Röhricht & Priebe, 1998, S. 97). • „‘Ich fühle mich, als wollte ich meinen Körper mit etwas bedecken, das mich beschützen wird.‘ (31 Patienten = 59,6%)“ (ebd.). • Zu diesen Punkten wurden folgende Einzelaussagen gemacht: „’Mein Körper fühlt sich ungewöhnlich schwer an.’ (Large)[;] ‚Meine Augen fühlen sich an, als wären sie mit einem Schleier belegt.’ (Boundary loss)[;] ‚Dinge scheinen ungewöhnlich nah an meinem Körper zu sein.’ (Boundary loss)[;] ‚Ich fühle mich weniger fähig zu sagen, wo mein Körper aufhört, und wo die Außenwelt anfängt.’ (Boundary loss)[;] ‚Ich bin mir meines Körpers weniger bewusst.’ (Derpersonalisaztion)“ (Röhricht & Priebe 1998, S. 97). 20 „’Mein Körper fühlt sich ungewöhnlich schwer an’ und ‚Mein Körper fühlt sich ungewöhnlich dick an’“ (Röhricht & Priebe 1998, S. 97). 21 22 Vgl. Wagner 1984; Meermann 1985; in: Röhricht 1998, S. 94 Joraschky und von Arnim 2009, S. 190: 23 Scherer gibt als Quelle an: „Koch o.J. S. 1-12“ (Scherer 2004, S. 31, Fußnote 10) Im Einzelnen gibt sie keine Seitenzahlen an. 24 Resch bezieht sich auf Tarrant u. Jones 1999; Walker et al. 1994. 96 25 Kinney, Woods & Yurgelun (1986, in: Hesse & Prünte 2004 S. 88) zeigten Neurological Soft Signs bei Verwandten ersten Grades; Wahlheim et al. (1999, in: Hesse & Prünte 2004, S. 88) zeigten keine. 26 Vgl. Rieder et al. 1975; Rieder, Broman & Rosenthal 1977; Rieder & Nichols 1979, in: Hesse & Prünte 2004, S. 88 27 Rechtschreibfehler im Buch 28 SC: Röhricht & Priebe weisen darauf hin, dass die Grundsätze der Methode bei Tarrier et al., 1993 und bei Valmaggia et al., 2005 beschrieben werden. In dieser Studie legte der Therapeut den Schwerpunkt auf individuelle Schwierigkeiten und darauf bezogene Problemlösestrategien unter Berücksichtigung der negativen Kernsymptomatik (vgl. Röhricht & Priebe 2006, S. 672). 29 „age 20-55 years; an established diagnosis of schizophrenia according t DSM-IV, with at least two episodes with acute psychotic symptoms; time since last in-patient treatment more than 1 month (currently out-patient); suffering from persistent symptoms of schizophrenia for at least 6 months with a high degree of negative symptoms at baseline. (…); stable medication prior to entering the study. Exclusion criteria were: evidence of organic brain disease; severe or chronic physical illness; and substance miuse as primary diagnosis. An experienced psychiatrist, blind to the allocated treatment, carried out all screening, baseline and outcome assessments; (…)” (Röhricht & Priebe 2006, S. 670). 30 Krietsch & Heuer gliederten in ihr bewegungstherapeutisches Konzept in folgende Übungsbereiche: „Beziehung zum eigenen Körper Beziehung zu Raum und Zeit Beziehung zu den Dingen Beziehung zu den Mitmenschen“ (Krietsch & Heuer 1997, S. 3) 31 Verwendet wurden: • PANSS* (Kay et al. 1987, in: Röhricht 2006, S. 672) • EPS: Extrapyramidal Symptom Scale, (Simpson & Angus, 1970, in: Röhricht 2006, S. 672) • SQOL: subjective quality of life (Röhricht 2006, S. 672) • MANSA: Manchester Short Assessment of Puality of Life (Priebe et al. 1999, in: Röhricht 2006, S. 672) • CAT: Client´s Assessment of Treatment Scale (Priebe et al. 1995, in: Röhricht 2006, S. 672 • HAS: Heopning Alliance Scale (Priebe & Gruyters, 1993, in: Röhricht 2006, S. 673 32 Rector et al. (2003, in: Röhricht & Priebe 2006, S. 675) schlugen vor, eine Verminderung auf Symptomskalen um 20% als klinisch signifikant zu bezeichnen. Diese Grenze erreichten in der Experimentalgruppe signifikant mehr Patienten (50%) (vgl. Röhricht & Priebe 2006, S. 675). 33 Vgl. Van Praag; shubert, Zhao, Gage 2005;25: 8680-8685, in: Malchow, et al. 2010, S. 27 34 Vgl. Falkai et al. 2003; 253: 92-99, in Malchow et al. 2010, S. 27 35 vgl. Wright, Rabe-Hesketh, Woodruff, David, Murray, Bullmore 2000; 157: 16-25, in: Malchow et al. 2010, S. 27 36 Vgl. Harrison, Weinberger 2005; 10 (1): 40-68 37 Hesse & Prünte erwähnen in diesem Zusammenhang hohe Fluktuation und die Tatsache, dass einige Ärzte und Psychologen jeweils am Beginn einer psychiatrischen oder psychotherapeutischen Ausbildung stehen (vgl. Hesse & Prünte 2004, S. 158). 97