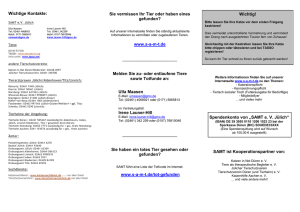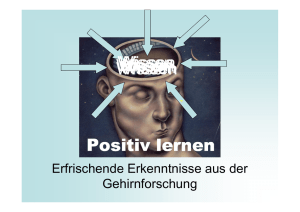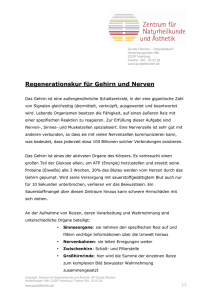Gehirn, Alter und erkrAnkunGen
Werbung

Das Magazin aus dem Forschungszentrum FORSCHEN in Jülich Gehirn, Alter und Erkrankungen :: Gedächtnisschwund und Altersweisheit :: Dem unmerklichen Anfang auf der Spur :: Länger gut Leben 01|2008 FORSCHEN in Jülich Das Magazin aus dem Forschungszentrum IMPRESSUM Forschen in Jülich ISSN 1433-7371 Magazin des Forschungszentrums Jülich Herausgeber Forschungszentrum Jülich GmbH 52425 Jülich Redaktion Dr. Wiebke Rögener, Dr. Angela Lindner (v.i.S.d.P), Dr. Barbara Schunk, Annette Stettien Autoren Dr. Frank Frick, Dr. Karin Hollricher, Dr. Wiebke Rögener 2 Design und Layout SeitenPlan GmbH, Dortmund Bildnachweis Forschungszentrum Jülich (S. 6 li., S. 7 re. u., S. 11, S. 14, S. 15, S. 18/19, S. 19 li. o., S. 22/23, S. 26, S. 27 re., S. 28, ­ S. 31 re., S. 33, S. 34/35, S. 36/37, ­S. 38­ o., S. 39 o.), R. U. Limbach (S. 2, S. 3, S. 7 o., li. u., S. 21, S. 27 li., S. 30, ­S. 31­li., ­­ S. 38 u.), Deutscher Zukunftspreis, Ans­ gar Pudenz (S. 4 re. u., S. 17), Thomas Klink (S. 6 li.), RWTH Aachen (S. 20), Hermann Krämer (S. 25), vario images (S. 29), Sergey Lavrentev (S. 39 li. u.), Simone van den Berg (S. 38 li.u.), Natalia Sinjushina & Evgeniy Meyke (S. 39 re. u.) Kontakt Stabsstelle Unternehmenskommunikation Tel. 02461 61 - 4661 Fax 02461 61 -4666 [email protected] Druck Druckerei Medienhaus Plump GmbH Auflage 15 000 Forschen in Jülich 1 | 2008 Exzellente Hirnforschung D as vor Ihnen liegende Heft aus der Reihe „Forschen in Jülich“ geht in seinem Schwerpunktthema der Frage nach: Was kann die Hirnforschung bei der Diagnose und Therapie von neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen leisten? Sie erfahren etwas darüber, wie sich das Gehirn im Laufe des Lebens verändert und wie sich ganz normale Alterungsprozesse beispielsweise von einer Alzheimer-Demenz unterscheiden. Lesen Sie, welche Möglichkeiten Jülicher Wissenschaftler erforschen, Erkrankungen des Gehirns so frühzeitig zu erkennen, dass sich Chancen für eine Behandlung ergeben! Patienten würden gesunde Lebenszeit gewinnen und die Gesellschaft enorme Kosten sparen – geschätzte 40 Milliarden Euro pro Jahr –, wenn sich der Beginn von Demenzen um durchschnittlich fünf Jahre verzögern ließe. Außerdem stellen wir Ansätze für zukunftweisende Therapieverfahren vor, die im Forschungszentrum Jülich entwickelt werden, beispielsweise einen neuartigen Hirnschrittmacher für Parkinson-Patienten. Auch neue Wege der Schlag­ anfalltherapie werden aufgezeigt. All dies ist aber nur auf der Basis einer exzellenten Grundlagenforschung möglich, die es uns erlaubt, die Organisation des ­Gehirns besser zu verstehen. Das Forschungszentrum Jülich ist für diese Forschung hervorragend ausgestattet. So entwickeln wir gemeinsam mit Siemens ein Gerät, das einzigartige Einblicke in das lebende Gehirn liefern wird – einen 9,4-TeslaMagnetresonanz-Positronenemissionstomo­grafen. Vor allem aber forschen in Jülich Naturwissenschaftler und Mediziner mit herausragenden Kompetenzen in der Hirnforschung, die in strategischen Allianzen mit Kliniken und Universitäten der Region vernetzt sind. Das Besondere an der Neuroforschung in Jülich ist die fachliche Kombination von Physik und Medizin. Viele unserer Forschungsgruppen sind in beiden Fächern qualifiziert. Forschen in Jülich 1 | 2008 Eine einmalige Forschungskooperation besteht mit der RWTH Aachen im Rahmen der 2007 gegründeten Jülich-Aachen Research Alliance JARA. So ist es ein wichtiges Ziel der Sektion JARA-BRAIN, Forschungsergebnisse zu erzielen, die Patienten helfen können, und diese Erkenntnisse möglichst rasch in den Klinikalltag zu übertragen. Dass Jülich eine herausragende Rolle in der Demenzforschung spielt, machte eine forschungspolitische Entscheidung im Frühjahr 2008 deutlich: Im bundesweiten Wettbewerb um die Errichtung eines nationalen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen, den die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Annette Schavan, initiiert hatte, war das Forschungszentrum Jülich mit seinen Partnern in Bonn und Köln erfolgreich. Im März 2008 fiel die Wahl auf den Antrag aus Nordrhein-Westfalen, sodass nun das „Helmholtz-Zentrum Bonn – Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen“ (DZNE) mit seinem Kernzentrum auf dem Campus der Universitätsklinik Bonn errichtet wird. „Ohne das Engagement Jülichs wäre es nicht zu dieser Positionierung des Antrags im Wettbewerb gekommen“, hob NRW-Innovationsminister Prof. Andreas Pinkwart­ hervor. Wir freuen uns, dass unsere seit Jahren ­exzellenten Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Hirnforschung damit eine besondere Anerkennung gefunden haben und wir einen wesentlichen Beitrag liefern werden. Prof. Dr. Achim Bachem Vorstandvorsitzender des Forschungszentrums Jülich 3 10 :: Gedächtnisschwund und AltersweisheiT Jülicher Wissenschaftler erforschen den Umbau des Denkorgans im Alter. So erarbeiten sie einen Hirnatlas, der die Strukturen des Gehirns mit bisher ungekannter Genauigkeit beschreibt, und untersuchen, wie Organisation und Funktion miteinander verknüpft sind. 4 12 15 :: Dem unmerklichen Anfang auf der Spur Wer leidet nicht hin und wieder an Vergesslichkeit? Doch kann sie auch frühes Anzeichen einer Demenzerkrankung sein. In Jülich arbeiten Forscher daran, erste Vorboten der AlzheimerErkrankung, aber auch von Schizophrenie oder Multipler Sklerose früher zu erkennen. :: Länger gut Leben Mit Magnetfeldern können Jülicher Neurowissenschaftler die Zusammenarbeit der Hirnhälften nach einem Schlaganfall verbessern. Neuartige Hirnschrittmacher helfen Parkinson-Patienten. Zwei Beispiele dafür, wie die Jülicher Hirnforschung den Weg von Theorie und Laborexperiment zum klinischen Einsatz geht. Forschen in Jülich 1 | 2008 IN DIESER AUSGABE 3Editorial :: Highlights :: Schnappschüsse aus Jülich 26 Durchblick bis ins Detail Ein Bericht über ein einzigartiges Großgerät der Hirnforschung. 6 Forschung im Überblick Ein buntes Kaleidoskop von Bildern zeigt Highlights aus der Jülicher Forschung – von Klimaforschern im Zeppelin über den Physik-Nobelpreis für Peter Grünberg bis zu einem der schnellsten zivilen Supercomputer der Welt. :: SCHWERPUNKT 8 Alterungsprozesse und Erkrankungen des Gehirns 10 Gedächtnisschwund und Altersweisheit Jülicher Wissenschaftler erforschen den Umbau des Denkorgans im Alter. 12Dem unmerklichen Anfang auf der Spur Das alternde Gehirn: Wie lassen sich schwere Symptome von Alzheimer, Schizophrenie oder Multipler Sklerose aufhalten? 15Länger gut leben Hirnforschung für neue Therapien Die Jülicher Hirnforschung auf dem Weg von Theorie und Laborexperiment zum klinischen Einsatz. 18 Schritte zur Normalität Sichtbare Besserung bei Parkinson-Patienten. 20 Forschungsallianz für neue Therapien Interview mit Prof. Frank Schneider, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklini- kum Aachen und Geschäftsführender Direktor von JARA. 28Der weibliche Blick Ein Hirnareal, das Bewegung im Gesichtsfeld wahrnimmt, unterscheidet sich bei Frauen und Männern. 30Das Molekül, das müde macht Neurowissenschaftler identifizieren einen Schlaffaktor im Gehirn und erklären, wie Kaffee die Müdigkeit vertreibt. 32 Tumor im Fokus Mit einem speziellen radioaktiv markierten Molekül lassen sich Hirntumore genauer orten. 34 Besondere Kontakte Der unterschiedliche strukturelle Aufbau verschiedener Synapsen – Schaltstellen zwischen Nervenzellen im Gehirn – wird in virtuellen dreidimensionalen Modellen sichtbar. 36 Hirnlandschaften Orientierungshilfe im Gehirn. 38 Nachrichten aus der Medizin Von Molekülen, die Herzen höher schlagen lassen, einer Sonde zur Alzheimer-Diagnostik und Erkenntnissen aus Computersimulationen – Schlaglichter auf die medizi- nische Forschung in Jülich. 22 Vom Molekül zur Hirnkarte 24Tics in der Röhre Jülicher und Aachener Neurowissenschaftler erforschen mit modernsten Methoden die Vorgänge im Hirn von Tourette-Patienten. Forschen in Jülich 1 | 2008 5 Klimaforscher im Luftschiff Er schwebt in geringen Höhen langsam in der Luft, kann in der Luft anhalten und ist für Bodensee-Touristen eine Attraktion: der Zeppelin NT. Die einzigartigen Flugeigenschaften des Luftschiffs nutzten Jülicher Atmosphärenforscher erstmals im Sommer 2007, um die Luft über Süddeutschland genauestens zu analysieren. Die Wissenschaftler bestimmten verschiedene Schad- und Spurengase bis in eine Höhe von 1 000 Metern über dem Boden. In dieser chemisch sehr aktiven untersten Schicht der Atmosphäre sind die Prozesse bisher nur lückenhaft bekannt. Im Oktober 2008 startet der Zeppelin erneut. Leben im Supercomputer Nach vier Monaten Rechenzeit auf 2 000 Prozessoren des Jülicher Super­ computers JUBL fanden Bochumer Wissenschaftler heraus, wie sich vor vier Milliarden Jahren Aminosäuren zu den Bausteinen des Lebens, den Peptiden, zusammenschließen konnten – an vulkanischen Schloten in den Tiefen der Ozeane. Forschung im Überblick Die Jülicher Gesundheitsforschung steht im Mittelpunkt dieses Magazins. Jülicher Wissenschaftler sind aber auch auf anderen Forschungsgebieten aktiv und erfolgreich. Einige Momentaufnahmen künden davon. Frank Frick LINKTIPP www.fz-juelich.de/portal/kurznachrichten 6 Forschen in Jülich 1 | 2008 Schnappschüsse Höchste Ehrung Der Nobelpreis für Physik 2007 ging an den Jülicher Forscher Peter Grünberg und seinen Pariser Kollegen Albert Fert. „Die Zeit“ fand für die Physiklaien unter ihren Lesern dazu folgende Worte: „Über Grünbergs Arbeit müssen Sie nur wissen, dass ohne sie dieser Text so nicht entstanden wäre. Ohne sie gäbe es kein digitales Familienalbum auf Ihrer Computerfestplatte, keine tragbare Musiksammlung – und keine pünktlich erscheinende moderne Wochenzeitung.“ Grünberg und Fert hatten in den 80er-Jahren unabhängig voneinander den Riesenmagnetowiderstand entdeckt – ein Effekt, der den Durchbruch zu GigabyteFestplatten brachte, die heute in jedem PC im Einsatz sind. Ein Reformer, der kaum altert Aus Wasserstoffgas erzeugen Brennstoffzellen effizient Strom – ohne dabei Schadstoffe freizusetzen. Das Problem: Wasserstoff steht nicht flächendeckend zur Verfügung. Deshalb haben Jülicher Forscher mithilfe von Supercomputer-­Simulationen einen Reformer entwickelt, der den Wasserstoff aus Diesel oder Kerosin erzeugt. Er zeigt kaum Alterserscheinungen und verrichtet seinen Dienst mehr als 2 000 ­Betriebsstunden lang. Forschen in Jülich 1 | 2008 Weltspitze JUGENE, der neueste Supercomputer des Forschungszentrums Jülich, schafft unvorstellbare 167 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde. Damit war er der schnellste zivile Rechner der Welt, als er im Februar 2008 mit einem feierlichen Festakt offiziell für die Nutzer freigeschaltet wurde. Diskussion ums Ozonloch Die Laborergebnisse einer kalifornischen Forschergruppe vom Jet Propulsion Laboratory erschütterten im April 2007 das bisherige Verständnis von der Entstehung des Ozonlochs. Einige Monate danach rückten Jülicher Forscher die Ergebnisse im renommierten Fachmagazin „Science“ gerade. „Unter anderem aufgrund eigener neuer Experimente ist es auf keinen Fall angebracht, die Rolle der Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) und das Montrealer Protokoll infrage zu stellen“, so der Jülicher Atmosphärenchemiker Marc von Hobe. Im Montreal-Protokoll und mehreren Folgeabkommen wurde die Produktion der FCKW stark begrenzt. 7 8 Forschen in Jülich 1 | 2008 Schwerpunkt XXX :: ALTERUNGSPROZESSE UND ERKRANKUNGEN des GEhirns Immer mehr Menschen erreichen ein hohes Alter. Doch diese insgesamt erfreuliche Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten: Alterstypische Erkrankungen, wie Alzheimer oder Parkinson, betreffen einen wachsenden Teil der Bevölkerung. Bereits heute leben in Deutschland mehr als eine Million Menschen mit Demenzerkrankungen – Tendenz steigend. Auch mit den Folgen eines Schlaganfalls müssen vorwiegend ältere Menschen fertig werden. Die Zunahme solcher Erkrankungen in einer alternden Bevölkerung bedeutet eine Herausforderung, nicht zuletzt für die Forschung. Denn noch verfügen wir über keine wirksame Prävention oder Therapie nach Ausbruch der Erkrankung. Forschen in Jülich 1 | 2008 9 Gedächtsnisschwund und Altersweisheit Vergesslichkeit ist ein alltägliches Phänomen. Und je ­älter man wird, desto häufiger lässt einen das Gedächtnis im Stich. Jülicher Forscher wollen ­herausfinden, welche anatomischen und funktionellen Veränderungen im Gehirn ­dafür verantwortlich sind und wie sich das Gehirn im ­Laufe des Lebens wandelt. W ie war doch gleich der Name? Jeder hat wohl schon erlebt, dass man jemanden auf der Straße trifft, sich aber beim besten Willen nicht daran erinnern kann, woher man diese Person kennt und wie sie heißt. Mit zunehmendem Alter passiert das immer häufiger. Doch muss das nicht gleich Anzeichen einer Erkrankung sein. Vergesslichkeit gehört zum normalen Alterungsprozess des Gehirns. Was dabei im Gehirn vor sich geht, kann man heute noch nicht genau beantworten. Das gesunde alternde Gehirn ist erst seit Kurzem Gegenstand der wissenschaftlichen Neugier. Die 10 Hirnforscher konzentrierten sich bisher darauf, die Entwicklung des jungen Gehirns und krankheitsbedingte Veränderungen im Denkorgan zu untersuchen. Von dem, was das gesunde Hirn ab 30 so alles durchmacht, ist daher nur wenig bekannt. Fest steht, dass die Alterung des Gehirns von den Genen und vom Training abhängig ist, das man dem Oberstübchen zuteil werden lässt. „Jeder von uns wird mit dem Alter vergesslicher. Dies betrifft aber vor allem die fluide Intelligenz, also die Fähigkeit, neue Probleme ohne Rückgriff auf Erfahrungen zu lösen“, erklärt Prof. Gereon Fink, Direktor am Institut für Neurowissenschaften und Biophysik in Jülich. „Die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse, also die kultur- und wissensabhängige Software, bleiben dagegen meist lange erhalten – man spricht hier auch von kristalliner Intelligenz. Dies ist die Altersweisheit, mit der ältere Menschen viele Defizite ausgleichen können.“ Was und WO? Die Jülicher Neurowissenschaftler untersuchen, wie sich Menschen unterschiedlichen Alters Dinge, Personen und Ereignisse einprägen und wie sie sich daran erinnern. In einem ExperiForschen in Jülich 1 | 2008 Schwerpunkt ment zeigten die Forscher beispielsweise jüngeren und älteren Probanden in schneller Folge 100 Gegenstände, die in unterschiedlichen Positionen auf einem Bildschirm angeordnet waren. Anschließend sollten sich die Probanden daran erinnern, was sie gesehen haben und wo dieser Gegenstand abgebildet war. Währenddessen zeichneten die Forscher mithilfe eines Kernspintomatografen die Hirnfunktionen der Probanden auf. Das Ergebnis: Vergessen ist nicht gleich vergessen. Junge wie ältere Menschen konnten sich gleich gut an die gezeigten Objekte erinnern. Allerdings nutzten die Altersgruppen beim Einprägen der Gegenstände unterschiedliche Gehirnregionen. Das könnte ein Indiz auf einen ausgleichenden Mechanismus sein, der Älteren ein ähnlich effizientes Kurzzeitgedächtnis beschert wie den Jüngeren. Deutliche altersabhängige Unterschiede zeigten sich indes beim räumlichen Kontext, also bei der Erinnerung daran, wo die Probanden einen Gegenstand gesehen hatten. Die Hälfte der Objekte, die sich die Älteren korrekt gemerkt hatten, ordneten sie einer falschen Position zu. Die Jüngeren dagegen konnten sich in fast zwei Dritteln der Fälle richtig daran erinnern, wo sie das Objekt gesehen hatten. Die korrekte Erinnerung spiegelte sich in einer höheren Aktivität im Hippocampus wider. Dieses Gehirnareal, das sich im Schläfenlappen befindet, ist ein wichtiges Zentrum, das neue Informationen ins Langzeitgedächtnis überführt. Umbau des Gehirns Es stellt sich nun die Frage, wie die beobachteten Veränderungen in den Hirnfunktionen mit Änderungen in der Anatomie des Gehirns zusammenhängen. Viele Jahrzehnte lang glaubte man, dass der Verlust von Nervenzellen die Forschen in Jülich 1 | 2008 Ursache für altersbedingte Vergesslichkeit sei. Doch inzwischen sieht man das etwas anders. „Das Gehirn schrumpft nicht einfach, sondern verändert sich während des ganzen Lebens“, betont Prof. Katrin Amunts. Die Leiterin der Arbeitsgruppe „Funktionelle Architektonik“ am Institut für Neurowissenschaften und Biophysik untersucht die Gehirne Verstorbener und entwickelt aus diesen Daten einen detaillierten dreidimensionalen Gehirnatlas. „Die Alterung des Denkorgans ist mehr als ein Massensterben von Nervenzellen, nämlich ein komplexer Umbau- und Anpassungsprozess, der für verschiedene Hirnregionen unterschiedlich abläuft“, sagt Amunts. Mithilfe des hochgenauen Atlas' lassen sich die anatomischen Umbauprozesse in Gehirnen gesunder Probanden während der Hirn­ alterung genau lokalisieren. Der Atlas dokumentiert beispielsweise einen altersabhängigen Verlust an Gehirnmasse in solchen Hirnarealen, die motorische Fähigkeiten steuern. Dieser Abgleich von Hirnfunktion und Hirnanatomie ist Teil des „International Consortium for Human Brain Mapping“ (ICBM), eines großen Gemeinschaftsprojekts, das unter anderem vom US-amerikanischen National Institute of Health (NIH) finanziell unterstützt wird. Insgesamt zeigen die verschiedenen Forschungsprojekte immer deutlicher, dass das Gehirn ausgesprochen elastisch ist. Daher kann man auch mit 60 Jahren noch Sprachen oder Klavierspielen erlernen. Die Hirne der meisten älteren Menschen sind weit davon entfernt, sich langsam abzuschalten, sondern sie reagieren im Alter noch sehr geschmeidig auf jegliche Reize. Auch wenn das Gedächtnis ein wenig nachlässt – viele Aufgaben werden nicht schlechter, sondern einfach nur anders bewältigt als in jüngeren Jahren. Diesen Prozessen auf den Grund zu gehen, bleibt eine extrem spannende Aufgabe für die Hirnforschung. :: Karin Hollricher Schnitte in der Horizontalebene (links) und der Sagittalebene (rechts) durch einen MR-Datensatz eines menschlichen Gehirns. Die orange-gelben Regionen zeigen Bereiche, in denen das Gehirn zwischen 18 und 51 Jahren an Substanz verliert. Hierzu gehören auch eine Faserbahn (Tractus corticospinalis), die für die Steuerung von ­Bewegungen wichtig ist (braune Konturlinien), sowie das Kleinhirn. 11 Dem unmerklichen Anfang auf der Spur Jülicher Forscher entwickeln Methoden, Krankheiten wie Alzheimer, Schizophrenie und Multiple Sklerose früher als bisher sicher zu diagnostizieren. Für die Kranken heißt das: Früher richtig behandelt, gewinnen sie Lebenszeit, in der sie noch nicht unter schweren Symptomen leiden. D as kann jedem passieren: Man ­hat vor einigen Tagen ein neues ­Handy gekauft, und nun will einem die PIN partout nicht einfallen. Oder man tritt aus der Haustür und kann sich nicht erinnern, wo man am Vorabend das ­Auto geparkt hat ­– am botanischen Garten oder doch in der Riehler Straße? Manche – vor allem Jüngere – nehmen es mit Humor und sagen „Alzheimer lässt grüßen“. Andere dagegen fragen sich ernsthaft, ob solche Aussetzer erste Vorboten einer Demenzerkrankung sein könnten. Gänzlich unbegründet ist die Sorge nicht: „Recht viele Menschen, die zum Arzt gehen, weil sie mit zunehmendem 12 Alter erste Beeinträchtigungen ihres Erinnerungsvermögens feststellen, entwickeln tatsächlich später eine AlzheimerDemenz“, sagt der Jülicher Neurologe Prof. Gereon Fink. Suche nach Gewissheit Wer befürchtet, dass sein Gedächtnis nachlässt, den treibt wohl zunächst vor allem das Bedürfnis nach Gewissheit zum Arzt. Insofern ist es für ihn wichtig, dass der Mediziner eine sichere Diagnose stellen kann – auch wenn die Krankheit noch nicht sehr ausgeprägt ist. Aber auch aus einem anderen Grund ist es bedeutsam, die Vorzeichen möglichst früh zu erkennen: „Indem man dann sofort mit einer Therapie – etwa einem Gedächtnistraining – beginnt kann man die Erkrankung zwar nicht verhindern, aber das Auftreten schwerer Symptome zeitlich hinauszögern“, sagt Fink. Sein Kollege Prof. Andreas Bauer erklärt noch aus einem anderen Blickwinkel heraus, warum eine frühzeitige Diagnosestellung bei vielen Krankheiten des Gehirns wünschenswert ist. Ausgangspunkt ist eine eigentlich niederschmetternde Erkenntnis: „Was zerstört ist, bleibt in der Regel dauerhaft zerstört und ist zumeist nicht wiederherzustellen – für das zentrale Nervensystem gilt das Forschen in Jülich 1 | 2008 Schwerpunkt Die Vorzeichen der Alzheimer-Demenz sind schwer zu erkennen. Doch eine frühzeitige und sichere Diagnose der Krankheit ist wichtig, um das Auftreten schwerer Symptome zeitlich hinauszögern zu können. immer noch, trotz allen medizinischen Fortschritts und der Erkenntnis, dass das Gehirn zu erstaunlichen Kompensationsleistungen fähig ist.“ Daher, so der Neurologe weiter, müsse man versuchen, die Nervenzellen von vornherein vor der Zerstörung zu bewahren und so der Krankheit entgegenzuwirken. In der Praxis bedeutet das üblicherweise, den Patienten möglichst frühzeitig und gezielt medikamentös zu behandeln. Zeitige Therapie nützt Wie erfolgreich diese Strategie ist, hängt von der Art der Erkrankung ab. „Studien zur Schizophrenie beispielsweise zeigen einen doppelten Nutzen des frühzeitigen pharmakologischen Eingriffs: Zum einen verläuft die Krankheit weniger dramatisch, und zum anderen lässt sich ihr Schwerpunkt in Richtung eines höheren Lebensalters verschieben“, so Bauer. Eine vorbeugende Gabe von Medikamenten ohne sichere Diagnose kommt jedoch nicht infrage: Alle Arzneistoffe haben Nebenwirkungen, und ihre Einnahme ist stets mit einem gewissen gesundheitlichen Risiko verbunden. Hinzu kommt, dass die prophylaktische Medikamentengabe mit enormen Kosten verbunden wäre. „Somit ist die sichere Diagnose der neurologischen oder psychischen Erkrankung Voraussetzung, um gezielt pharmakologisch intervenieren zu können“, folgert Bauer. Um herauszufinden, ob jemand tatsächlich unter krankheitsbedingten Gedächtnisstörungen leidet, setzen Ärzte üblicherweise neuropsychologische Tests ein. So legen sie ihren Patienten zum Beispiel zehn Bilder von verschiedenen Tieren mit der Aufforderung vor, sich diese einzuprägen. Fünf Minuten später Forschen in Jülich 1 | 2008 sollen die Patienten dann möglichst viele Tiere aufzählen. Bei einem anderen Test haben die Patienten eine Minute Zeit, um möglichst viele Begriffe etwa zum Oberbegriff „Supermarkt“ zu nennen. Um zur Diagnose Schizophrenie zu gelangen, beobachten die Ärzte das Verhalten der Patienten und befragen sie, wobei sie auf standardisierte Interviewbögen zurückgreifen können. Auf diese Weise stellen sie fest, ob die ­Patienten unter bestimmten Symptomen leiden, die für die Schizophrenie typisch sind. Zu ihnen zählen Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Betroffene – 800 000 Menschen in Deutschland – hören Stimmen, sehen Personen, die nicht da sind, oder fühlen sich verfolgt. Weit verbreitet ist auch die wahnhafte Überzeugung, durch Außerirdische oder magische Mächte beobachtet und kontrolliert zu werden. Schon Jahre vor diesen auffälligen, sogenannten Positivsymptomen, beginnen die weniger eindeutigen Negativsymp­ tome, zu denen unter anderem Antriebsverlust, Konzentrationsschwäche und der soziale Rückzug von Freunden und Familie gehören. Schizophrenie früh erkannt Der Nachteil der Diagnose durch solche Tests: „Selbst der beste Mediziner kann die Diagnose Schizophrenie erst dann stellen, wenn auch die Positivsymptome auftreten“, erläutert Bauer. Vergleichbares gilt auch für die Diagnose Alzheimer: Die Defizite, die von den maßgeschneiderten Tests aufgedeckt werden, müssen schon sehr gravierend sein, bevor ein Mediziner davon ausgehen kann, dass sein Patient wirklich an dieser Demenzerkrankung leidet – und völlig sicher kann er selbst dann noch nicht sein. Angesichts dessen liegt es nahe, mit Verfahren wie der Magnetresonanztomografie (MRT) oder der Positronen­ emissionstomografie (PET) nach Veränderungen im Gehirn zu suchen, die für die jeweilige Krankheit charakteristisch sind. Spiegelt sich die Erkrankung tatsächlich in den Bildern wider, die diese Verfahren liefern, so kann man im nächsten Schritt untersuchen, ob diese Abweichungen auch schon sichtbar sind, bevor jemand unter schweren Symptomen leidet. Genau das tun viele Hirnforscher weltweit, darunter auch Jülicher Neurowissenschaftler. Das Team um Andreas Bauer hat sein Augenmerk auf ein Molekül namens 5‑HT2A – einen sogenannten Transmitter­ rezeptor – gerichtet. Transmitterrezeptoren sind Eiweißmoleküle in der äuße­ ren Hülle von Nervenzellen und für die Informationsübertragung im Gehirn entscheidend. Mithilfe der PET können die Wissenschaftler feststellen, wie viele dieser 5-HT2A-Rezeptoren in den einzelnen Hirnregionen vorhanden sind. Dazu injizieren sie den Menschen, die sie untersuchen wollen, eine schwach radioaktiv markierte Substanz, das [18F]Altanserin. Im Gehirn angelangt, lagert es sich spezifisch an die 5-HT2A-Rezeptoren an. Durch den spontanen Zerfall der radioaktiven Atome entsteht dann ein messbares Signal, das die Position der Rezeptoren anzeigt. Gemeinsam mit Bonner Kollegen ­untersuchten die Wissenschaftler um Bauer so Menschen, bei denen es aufgrund der herkömmlichen Diagnoseverfahren mit standardisierter Befragung als wahrscheinlich galt, dass sie an Schizophrenie erkrankt waren, obwohl die schweren Positivsymptome noch nicht aufgetreten waren. Dabei fanden sie 13 Wie sich im Gehirn ein erhöhtes SchizophrenieRisiko widerspiegelt, zeigt diese Gegenüberstellung: Die Zunahme blauer, violetter und schwarzer Bereiche (links) zeigt eine verringerte 5-HT2A-Rezeptorendichte gegenüber derjenigen im gesunden Gehirn (rechts). Das Gehirn von Gesunden (obere Zeile) reagiert auf Reize, die das Langzeitgedächtnis ansprechen, anders als das von Menschen mit einer sogenannten „leichten kognitiven Beeinträchtigung“ (mittlere Zeile). Die untere Zeile macht die Unterschiede auf einen Blick sichtbar. heraus: Je stärker die psychologischen Tests auf eine beginnende Schizophrenie hinwiesen, desto geringer war die Konzentration von 5-HT2A-Rezeptoren im Gehirn. „Allerdings müssen wir noch mehr Menschen über einen längeren Zeitraum untersuchen, um tatsächlich sagen zu können, ob wir auf einen biologischen Marker zur Frühdiagnose von Schizophrenie gestoßen sind“, schränkt Bauer ein. Erst nach einer Beobachtungszeit von fünf Jahren wird endgültig feststehen, ob sich bei Betroffenen mit weniger 5-HT2A-Rezeptoren wirklich häufiger eine ausgeprägte Schizophrenie entwickelt. Anzeichen der MS Jülicher Wissenschaftler um Prof. Jon Shah sind ebenfalls auf der Suche nach frühen Anzeichen einer Hirnerkrankung. Sie haben mithilfe einer speziellen, selbst entwickelten MRT-Methode die Gehirne von MS-Patienten untersucht. MS ist das Kürzel für „Multiple Sklerose“, eine sehr unterschiedlich verlaufende Krankheit, bei der im Gehirn und im Rückenmark charakteristische Entzündungsherde auftreten. Körpereigene Abwehrzellen greifen dort die MyelinSchutzschicht an, die die Nervenfasern 14 umhüllt – ähnlich der Isolierung um ein elektrisches Kabel. MS-Patienten bekommen dann unter anderem Schwierigkeiten beim Sehen und beim Gehen und leiden unter gestörten Empfindungen für Berührung und Temperatur. Das patentierte MRT-Verfahren der Jülicher Forscher erlaubt es, den Wassergehalt in unterschiedlichen Bereichen des lebenden Gehirns bis auf ein Prozent genau zu bestimmen. „Antrieb für unsere Untersuchungen an MS-Patienten ist die Vermutung, dass es schon Störungen im Gehirn gibt, bevor die Entzündungsherde in herkömmlichen MRT-Aufnahmen sichtbar werden“, sagt Shah. Diese Störungen werden möglicherweise von Veränderungen des Wassergehaltes begleitet. Noch stehen die Wissenschaftler mit ihrer Forschung ganz am Anfang. Doch: „Es gibt erste Hinweise, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freut sich Shah. Vergesslichkeit als Warnung Die Vorboten der Alzheimer-Erkrankung hat sich die Jülicher Arbeitsgruppe um Gereon Fink näher angeschaut. Gemeinsam mit Dresdener Forschern untersuchten die Wissenschaftler Menschen, die laut neuropsychologischer Tests unter einer „leichten kognitiven Beeinträchtigung“ (LKB) litten. Studien weisen darauf hin, dass Menschen mit einer LKB später besonders häufig an Morbus Alzheimer erkranken. „Typisch für die Betroffenen ist, dass sie kürzlich zurückliegende Ereignisse vergessen, während das Gedächtnis für länger zurückliegende Ereignisse noch funktioniert“, erläutert Fink. Trotzdem zeigen die funktionellen MRT-Bilder, die von den Forschern aufgenommen wurden: Das Gehirn von Menschen mit einer LKB reagiert auf Reize, die das Langzeitgedächtnis ansprechen, mit anderen Aktivitäten als das Gehirn gesunder älterer Menschen. „Darin spiegelt sich der – anfänglich noch gelingende – Versuch des Gehirns wider, Defizite zu kompensieren“, so Fink. Die Ergebnisse der Jülicher Forscher könnten künftig helfen, zunehmende Vergesslichkeit aufgrund normalen Alterns besser von krankhaften Gedächtnisstörungen abzugrenzen. Eine interessante Perspektive auch speziell für diejenigen, die sich gerade auf die Suche nach ihrem Auto begeben. :: Frank Frick Forschen in Jülich 1 | 2008 Schwerpunkt Länger gut leben Bei guter Gesundheit alt werden – wer möchte das nicht? Doch viele neurologische Erkrankungen werden mit höherem Alter wahrscheinlicher: die Parkinson-Erkrankung etwa oder ein Schlaganfall. Aktuelle Ergebnisse der Jülicher Neurowissenschaftler ­zeigen neue Behandlungsmöglichkeiten auf. W enn plötzlich rasende Kopfschmerzen auftreten, Schwindel, Sehstörungen oder Taubheit an Armen oder Beinen, kann das ein Schlaganfall sein – der Verschluss eines Blutgefäßes oder, seltener, eine Blutung im Gehirn. Mehr als 200 000 Menschen werden jährlich in Deutschland „vom Schlag getroffen“. Wer sofort in eine Klinik mit spezialisierter Schlaganfalleinheit kommt, hat die besten Karten: Oft lässt sich der Blutpfropf auflösen, und der Patient wird wieder ganz gesund. „Doch nur etwa jedes 20. Schlaganfallopfer erhält rechtzeitig eine solche Akuttherapie“, sagt Prof. Gereon Fink, Direktor des Bereichs Kognitive Neurologie in Jülich und Chefarzt der Klinik für Neurologie der Universitätsklinik Köln. Der Hirnschlag ist daher nicht nur die dritthäufigste Todesursache in Deutschland, sondern auch die wichtigste Ursache dauerhafter Behinderungen wie Lähmungen oder Sprachstörungen. SchlaganfallTherapie Finks Team sucht nach Wegen, solche Dauerschäden zu verringern. „Schlaganfallpatienten kann geholfen werden“, betont der Neurologe. Er nennt drei Ansätze für die Therapie: Zum einen hilft ein Verhaltenstraining, beispielsweise bei Menschen, die nach Forschen in Jülich 1 | 2008 einem Schlaganfall die eine Hälfte der Welt ignorieren. Ist die rechte Hirnhälfte geschädigt, übersehen die Betroffenen, was sich in der linken Hälfte ihres Gesichtfeldes befindet. Wenn man sie etwa auffordert, in einem Text bestimmte Buchstaben durchzustreichen, gelingt ihnen dies zunächst nur auf der rechten Seitenhälfte. „Doch mit einem speziellen Computertraining lässt sich die Aufmerksamkeit auf die andere Seite lenken“, berichtet Fink. Nach einigen Wochen Übung am Bildschirm finden die Patienten auch auf der zunächst vernachlässigten Seite die gesuchten Buchstaben. Zum anderen arbeiten die Jülicher Forscher daran, den Heilungsprozess auf molekularer Ebene zu fördern. Ein Unterfangen, das ihnen unerwartet die Aufmerksamkeit der Boulevardpresse einbrachte: „Trost für Raucher – Nikotin gut fürs Gehirn“ lautete eine Schlagzeile. Tatsächlich können einige Schlaganfallpatienten Aufgaben, bei denen es auf die rasche räumliche Orientierung ankommt, besser lösen, wenn sie dabei Nikotinkaugummi kauen. In einem Experiment Hemmung Wenn Gesunde die rechte Hand bewegen, ist ganz überwiegend die linke Hirnhälfte aktiv (linkes Bild). Bei Schlaganfallpatienten findet sich dagegen eine Überaktivität der nicht geschädigten rechten Hemisphäre. Sie hemmt die Aktivität der geschädigten Hirnrinde (rechtes Bild). 15 „Wie die Signale beschaffen sein müssen, um einen therapeutischen Umbau von Nervenzellverbänden zu erreichen, haben wir zunächst mit Bleistift und Papier berechnet. Für die immer komplexeren Modelle, die sich daraus entwickelt haben, nutzen wir auch die Jülicher Großrechner.“ Peter Tass wurden verschiedene Objekte nacheinander auf einem Bildschirm gezeigt. Später sollten die Patienten angeben, ob und wo sie die Gegenstände gesehen haben – oben, unten, links oder rechts? Mit Nikotin im Blut reagierten viele schneller und machten weniger Fehler. Die Erklärung: Für die Ausrichtung der Aufmerksamkeit spielt eine Hirnregion, die als ParietalKortex bezeichnet wird, eine zentrale Rolle. Die Gehirnzellen dort erhalten Nachrichten aus anderen Gehirnabschnitten über Empfängermoleküle, sogenannte cholinerge Rezeptoren. Nikotin stimuliert diese Empfänger und erleichtert damit den Patienten die Orientierung – allerdings nur, wenn der Parietal-Kortex selbst nicht geschädigt ist. Zum Rauchen verführen will Fink aber keineswegs: „Es gilt nun, ein Medikament zu entwickeln, das ebenso die räumliche Aufmerksamkeit unterstützt, aber ohne die Suchtwirkung von Nikotin“, betont er. Unerwünschte Einmischung Drittens schließlich möchten die Forscher besser verstehen, wie ein Schlaganfall die Vernetzung der Hirnregionen beeinträchtigt. Ein Verfahren namens „funktionale Magnetresonanztomografie“ liefert dafür Bilder aus dem Gehirn. „Sie zeigen, dass ein Schlaganfall die Zusammenarbeit im Gehirn stört“, erläutert Fink. So steuern normalerweise Nervenzellen im Motorkortex der rechten Hirnhälfte Bewegungen der linken Hand. Zugleich hemmen sie den Motorkortex der anderen Hemisphäre. Bei manchen Schlaganfallpatienten aber fällt diese Hemmung aus. Dadurch mischt sich die „unzuständige“ Hirnhälfte ein und bringt das Zusammenspiel der Nervenzellen durcheinander. Wenn beispielsweise die rechte Hirnhälfte geschädigt und da- 16 durch die Bewegungsfähigkeit der linken Hand beeinträchtigt ist, wird auch die linke Hirnhälfte aktiv, sobald der Patient die gelähmte Hand bewegen will. „Das ist wahrscheinlich ein Versuch des Hirns, die Ausfälle zu kompensieren“, nimmt Fink an. Tatsächlich aber wird dadurch alles nur schlimmer: Der blinde Aktionismus von der falschen Seite hemmt die Tätigkeit des zuständigen Motorkortex'. Je stärker ­diese störenden Signale sind, desto ausgeprägter ist die Lähmung. Mit starken Magnetfeldern können die Jülicher Forscher dieses „Störfeuer“ unterbinden: Wenn sie eine Magnetspule über der übereifrigen Schädelhälfte platzieren, geht die Lähmung zurück. Der Effekt dieser „transkraniellen Magnetstimulation“ hält etwa eine halbe Stunde an. Damit lässt sich die Frührehabilitation von Schlaganfallpatienten verbessern, erläutert Fink. Wenn Patienten gelähmte Gliedmaßen früher und besser wieder bewegen können, bleiben weniger Schäden zurück. Neue Hirnschrittmacher Ein Glas Wasser einzuschenken, kann für Menschen, die an der Parkinson­Erkrankung leiden, eine unmögliche Aufgabe sein. Die „Schüttellähmung“ lässt die Hand so heftig zittern, dass mehr Flüssigkeit verschüttet wird als ins Glas gelangt. Andere Symptome sind Steifheit oder Gehstörungen. Die Ursache liegt in einer kleinen Region des Gehirns, der Substantia nigra. Wenn hier Zellen zugrunde gehen, die einen Botenstoff namens Dopamin bilden, wird die Kommunikation der Nervenzellen in anderen Hirnregionen gestört. Statt fein aufeinander abgestimmte Signale auszutauschen, feuern sie stereo­ typ im Gleichtakt. „Erst kürzlich konnte bewiesen werden, dass diese synchrone Aktivität die Ursache des unkontrollierbaren Zitterns, des sogenannten ­Tremors, bei der Parkinson-Erkrankung ist“, berichtet Prof. Peter Tass vom Institut für Neurowissenschaften und Biophysik des Forschungszentrums Jülich. Der Mediziner, Mathematiker und Physiker Tass hat einen neuartigen Hirnschrittmacher entwickelt, der den krankhaften Gleichtakt im Gehirn unterbricht. Die Wirkung ist frappierend: ParkinsonPatienten können wieder mit entspannt schwingenden Armen gehen, und auch das Einschenken eines Getränks gelingt mühelos. Ein Hirnschrittmacher besteht aus Elektroden, die in die betreffenden tiefen Hirnregionen reichen, und einem damit verbundenen Stimulator. Bei herkömmlichen Schrittmachern, wie sie in der Medizin bereits verwendet werden, sendet dieser ständig Impulse mit hoher Frequenz ins Hirn. Sie unterbrechen den Gleichtakt der Nervenzellen. Aber das Dauerfeuer hat auch Nebenwirkungen. „Wir entwickeln einen Hirnschrittmacher mit einer ganz anderen Herangehensweise“, erläutert Tass. „Er beruht auf detaillierten mathematischen Modellierungen, die wir dann experimentell überprüfen.“ Tass bildet Nervenzellverbände in mathematischen Modellen nach und errechnet daran, wie schon kurze, schwache Störsignale die Synchronisierung verhindern können. Das Ergebnis ist ein Stimulator, der nur dann kurzzeitig Signale ans Gehirn sendet, wenn dort Zellverbände in den gleichen Rhythmus verfallen. So bringt er die Nervenzellen aus dem Takt – die Wissenschaftler sprechen vom „koordinierten Reset“. „Dieser wirkt qualitativ anders als die Hochfrequenzstimulation“, erklärt Tass. „Die Aktivität der stimulierten Nervenzellverbände wird nicht einfach unterdrückt, sondern gezielt desynchronisiert.“ Forschen in Jülich 1 | 2008 Schwerpunkt Mittels Elektroenzephalografie (EEG) wird die Hirnaktivität während der Stimulation mit dem Hirnschrittmacher gemessen. Das erlaubt Rückschlüsse auf die Effektivität unterschiedlicher Stimulationsverfahren. Die EEG-Messung ist eine wichtige nichtinvasive Methode zur Beobachtung der Hirnaktivität. Ein solcher Schrittmacher mit geringer Stromstärke, der nur bei Bedarf aktiv ist, verringert das Risiko, dass andere Areale im Gehirn in Mitleidenschaft gezogen werden. Der Jülicher Hirnschrittmacher ist nicht nur schonender, sondern er wirkt auch nachhaltiger. „Wenn ein herkömmlicher Stimulator ausgeschaltet wird, kehren die Symptome sofort zurück“, berichtet Tass. „Dagegen haben wir in einer ersten Pilotstudie mit unserem neuen Verfahren beeindruckende therapeutische Effekte gefunden, die bei einigen Patienten bis zum Ende der Beobachtungsphase, also bis zu fünf Tage lang, anhielten.“ Ziel ist es, nicht nur Symptome zu unterdrücken, sondern die Hirnzellen dazu zu bringen, dass sie ihr krankhaftes Verhalten ganz verlernen. „Nervenzellen, die wiederholt im gleichen Rhythmus aktiv sind, verstärken ihre Kopplung unterein­ ander“, erläutert Tass. Der Gleichtakt im Gehirn wird also immer wahrscheinlicher. „Wenn wir aber diese gleichförmige Aktivität unterbrechen, schwächt das die Forschen in Jülich 1 | 2008 Verbindung der Zellen untereinander.“ Damit nutzen die Forscher die natürlichen Mechanismen des Lernens im Gehirn aus und verringern so die Wahrscheinlichkeit, dass die Zellen gemeinsam feuern. „Wie die Signale beschaffen sein müssen, um einen therapeutischen Umbau von Nervenzellverbänden zu erreichen, haben wir zunächst mit Bleistift und Papier berechnet. Für die immer komplexeren Modelle, die sich daraus entwickelt haben, nutzen wir auch die Jülicher Großrechner“, berichtet Tass. Bald in der Klinik 2005 gründete er gemeinsam mit dem Neurochirurgen Prof. Volker Sturm von der Universitätsklinik Köln und dem Neurologen Prof. Hans-Joachim Freund, dem ehemaligen Direktor der Universitätsklinik Düsseldorf, das Unternehmen „ANM Adaptive Neuromodulation GmbH“, um Hirnschrittmacher für den klinischen Einsatz herzustellen. Noch werden die bedarfsgesteuerten Stimulatoren nur wenige Tage an Patienten ausprobiert, bevor diese einen herkömmlichen Schrittmacher erhalten. Doch die Ergebnisse sind so vielversprechend, dass Ende 2008 die ersten Patienten dauerhaft mit Hirnschrittmachern mit dem Jülicher Stimulationsverfahren versorgt werden sollen. „Wir erwarten, dass wir innerhalb von drei Jahren eine Zulassungsstudie für die EU abschließen werden“, sagt Tass. Profitieren könnten nicht nur ParkinsonKranke. Auch bei Patienten mit Epilepsie oder bei schweren Zwangserkrankungen tritt krankhafte rhythmische Aktivität im Gehirn auf. Die Forscher hoffen, dass der neuartige Hirnschrittmacher auch diesen Menschen helfen kann. :: Wiebke Rögener LinktiPP www.fz-juelich.de/portal/forschung/ highlights/parkinson/hirnschrittmacher 17 Schritte zur Normalität Jülicher Forscher entwickeln einen besonders schonenden und nachhaltigen Hirnschrittmacher. Er verhindert eine synchrone Aktivität von Nervenzellen, die Ursache des unkontrollierbaren Zitterns und anderer Bewegungsstörungen bei der Parkinson-Erkrankung ist. VORHER Der Tremor vieler Parkinson-Patienten ist so stark, dass es ihnen unmöglich ist, einfache Figuren wie eine Spirale zu zeichnen. Die Körperhaltung ist steif und der Gang stockend. 18 Forschen in Jülich 1 | 2008 Schwerpunkt Elektroden zur bedarfsgesteuerten tiefen Hirnstimulation ermöglichen Parkinson-Patienten ein normales Leben. NACHHER Nach der Implantation des Hirnschrittmachers können Patienten trotz ihrer ParkinsonErkrankung wieder entspannt ausschreiten. Auch das Zeichnen einer Spirale gelingt. Forschen in Jülich 1 | 2008 19 Prof. Frank Schneider im Gespräch Forschungsallianz für neue Therapien Mit der Jülich-Aachen Research Alliance JARA erreicht die Zusammenarbeit des Forschungszentrums Jülich mit der RWTH Aachen eine neue Qualität. Schwerpunkte der Sektion JARA-BRAIN sind neurodegenerative Erkrankungen, Schizophrenie und affektive Erkrankungen sowie Entwicklungsstörungen. Prof. Frank Schneider, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Aachen, Geschäftsführender Direktor von JARA und gemeinsam mit Prof. Karl Zilles vom Forschungszentrum Jülich Direktor von JARA-BRAIN, erläutert die Perspektiven. Frage: In der Forschungsallianz JARABRAIN verbinden Jülich und Aachen ihre Kompetenzen in der Hirnforschung. Welches sind die spezifischen Stärken der beiden Partner? Schneider: Mancher neigt dazu, das auf die Formel zu bringen: Die Jülicher haben die Maschinen, wir in Aachen haben die Patienten. Doch das trifft es nicht gut. In Jülich gibt es eine Forschungsbettenstation, und in Aachen haben wir beispielsweise mit zwei 3-T-Magnetresonanztomografen (MRT) eine weit bessere apparative Ausstattung als die meisten Universitätskliniken. Es geht vielmehr darum, Grundlagen- und klinische Forschung enger zu verknüpfen und dafür eine bessere Organisationsstruktur zu schaffen. Dazu gehört es beispielsweise, Professorenstellen stets einvernehmlich zu besetzen und alle Forschungsprogramme miteinander abzustimmen. Forscher aus Jülich werden noch dichter an die Klinik angebunden und Kliniker aus Aachen enger an die Grundlagenforschung in Jülich. 20 mit neuropsychischen Erkrankungen mittels leistungsfähiger MRT und Positronenemissionstomografie untersuchen. Das kann helfen, Medikamente richtig auszuwählen und zu dosieren. Auch arbeiten wir gemeinsam mit Jülicher Kollegen an neuen Ansätzen für die Psychotherapie in Form von Neurofeedback: Patienten mit Depressionen oder Angsterkrankungen erhalten dabei eine unmittelbare Rückmeldung über ­ihre Hirnaktivitäten, während sie im MRT liegen. Zum anderen werden künftige ­Patienten von unseren Forschungsergebnissen profitieren. Prof. Frank Schneider Frage: Was haben die Patienten von dieser Zusammenarbeit? Schneider: Zum einen können wir innerhalb der Allianz eine ungewöhnlich aufwendige Diagnostik in Forschungsprojekten leisten, beispielsweise Patienten Frage: In welcher Weise? Schneider: Wenn wir herausfinden, welche Moleküle und Mechanismen im Gehirn beteiligt sind, wenn ein Mensch psychisch erkrankt oder sich eine Demenz entwickelt, ist dies eine Voraussetzung für die Entwicklung experimenteller Therapien und neuer Medikamente. Hier erwarten wir auch wichtige Impulse durch das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Forschen in Jülich 1 | 2008 Schwerpunkt Der 3-T-MRT ist eines der Geräte für bildgebende Verfahren in der Hirnforschung. Das neue 9,4-T-MR-PET-Hybridsystem wird diesen Bereich in Zukunft optimal ergänzen. Frage: Es wird auch ein für Deutschland neues Berufsbild geschaffen, der „Klinische Forscher“. Warum? Schneider: Wir brauchen Professoren, die sowohl hervorragende wissenschaftliche als auch klinische Kompetenzen be­sitzen. Im Rahmen von JARA-BRAIN wurden daher durch die dritte Förderlinie der Exzellenzinitiative mit dem Zukunfts­ konzept der RWTH vier Juniorprofessuren geschaffen, für Fachärzte oder Psychologen mit klinischer Ausbildung, die sich hier der klinischen Ausbildung wie der Forschung widmen können. Wir hoffen, dass dieses Modell Vorbild für andere Bereiche der Medizin sein wird. Außerdem wollen wir bei der Besetzung den Frauenanteil erhöhen, wie es die Gutachter der Exzellenzinitiative mit Recht gefordert haben. Forschen in Jülich 1 | 2008 Frage: In einer alternden Gesellschaft werden neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson immer häufiger. Kann die Forschung damit Schritt halten? Schneider: Ja. Wir werden eine Demenzerkrankung künftig frühzeitiger diagnostizieren können und individuell maßgeschneiderte Therapien entwickeln, die das Voranschreiten der Erkrankung zumindest bremsen. Wann solche ­neuen Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen werden, kann niemand genau vorhersagen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit JARA-BRAIN die Entwicklung beschleunigen. :: Interview: Wiebke Rögener 21 2 1 4a 3 Vom Molekül bis zur Hirnkarte 4b Das menschliche Gehirn ist auf allen Ebenen äußerst komplex organisiert: vom fein abstimmten Zusammenspiel verschiedener Signalmoleküle über tausendfach miteinander verknüpfte Nervenzellen bis zur Zusammenarbeit ganzer Hirnregionen. 22 1 Ein Molekül, das Empfänger für bestimmte Botenstoffe in Nervenzellen an ihren Zielort geleitet – das GABAA-Rezeptorassoziierte Protein GABARAP. 2 Verteilung des muskarinischen M2-Rezeptors im menschlichen Gehirn. Der M2-Rezeptor ist ein Eiweißmolekül in der Zellmembran, das einen Botenstoff – Azetylcholin – bindet und so die Weiterleitung von Informationen zwischen Nervenzellen ermöglicht. Er ist besonders konzentriert in Arealen der Hirnrinde, mit denen wir Berührungen und Töne wahrnehmen. 3 Schaltstelle zwischen Nervenzellen – eine Synapse (gelb) mit einer Gliazelle und einem Blutgefäß. Forschen in Jülich 1 | 2008 SCHWERPUNKT Schwerpunkt 5 6 7 8 9 10 4 a) Zwei Nervenzellkörper umgeben von Gliazellen. b) Nervenzellen mit Fortsätzen in der Hirnrinde. 5 Nervenzelle des Kleinhirns mit ihren Verzweigungen (Purkinje-Zelle). 6 Zellarchitektur der Hirnrinde – ein Ausschnitt aus der Sehrinde (visueller Kortex). 7 Horizontalschnitt durch das Gehirn mit Magnetresonanz­ tomografie bei höchster Auflösung. 8 Funktionelle Magnetresonanztomografie macht die Aktivität von Hirnregionen sichtbar – hier die Reaktion auf Flickerlicht. Forschen in Jülich 1 | 2008 9 Hirnkarte, die auf der Analyse der Zellarchitektur beruht ­ (Abb. 6) und von Jülich der wissenschaftlichen Gemeinschaft weltweit zur Verfügung gestellt wird. Die Farben kennzeichnen ­Areale, die sich in Struktur und Funktion sowie in ihrer Verknüpfung mit anderen Hirnarealen unterscheiden. 10 Analyse der lokalen Veränderungen der Hirnstruktur, wie sie bei der Untersuchung neurodegenerativer Erkrankungen angewendet wird. Rot und orange markierte Bereiche entsprechen großen Veränderungen, blaue dagegen kleinen. 23 Tics in der Röhre Wenn ein Kind grundlos zuckt und sich dabei selbst verletzen kann, Grimassen schneidet oder obszöne Wörter ruft, wird es oft von anderen Kindern gehänselt und von Erwachsenen für unerzogen gehalten. Doch mitunter steckt eine ernste neuropsychische Erkrankung hinter derartigen „Tics“: das Tourette-Syndrom. Wegen der für die Umwelt unverständlichen und befremdenden Verhaltensweisen führt es zu sozialer Isolation. Tics treten meist schon im Kindesalter auf, verstärken sich in der Pubertät und werden danach häufig schwächer. Erstmals beschrieben wurde das Syndrom von dem französischen Nervenarzt Georges Gilles de la Tourette im Jahr 1885. Jülicher und Aachener Neurowissenschaftler erforschen mit modernsten Methoden die Vorgänge im Hirn von Tourette-Patienten. M it Verfahren wie der funktionalen Magnetresonanztomografie (fMRT) wollen Wissenschaftler des Forschungszentrums Jülich und der RWTH Aachen klären, was während der Tics im Gehirn passiert. „Innerhalb der Jülich-Aachener Forschungsallianz JARA-BRAIN wird hier die Jülicher Expertise in bildgebenden Verfahren der Hirnforschung mit den klinischen Kompetenzen in Aachen in beispielhafter Weise kombiniert“, betont Prof. Karl Zilles, Direktor des Jülicher Instituts für Neurowissenschaften und Biophysik und Mitglied von JARA-BRAIN. Erste Untersuchungen zeigten, dass bei Tourette-Patienten die Kommunikation zwischen bestimmten Hirnbereichen, der Substantia nigra und den Basalgang- 24 lien, beeinträchtigt ist. Die Signalübertragung über den Botenstoff Dopamin ist gestört. „Dazu passt die Beobachtung, dass sich Tics manchmal durch Medikamente lindern oder unterdrücken lassen, die Dopamin hemmen“, erläutert der Jülicher Diplom-Physiker Peter Pieperhoff. Als er MR-Bilder von Patientengehirnen mit denen gesunder Kontrollpersonen verglich, zeigte sich, dass bestimmte Regionen des Gehirns, wie die Substantia nigra, in der Dopamin gebildet wird, die Amygdala und die Insel­ sowie das Kleinhirn bei Tourette-Patienten ein geringeres Volumen haben. Die in der Arbeitsgruppe von Prof. Katrin Amunts erstellten Karten dieser Gebiete ermöglichen hierbei eine hochpräzise Zuordnung dieser Volumenunterschiede zu verschiedenen Hirnregionen – eine wichtige Voraussetzung, um die betroffenen Netzwerke genauer zu verstehen. Doch was genau passiert im Gehirn eines Patienten zu dem Zeitpunkt, an dem er von den Tics befallen wird? Ein Team von Forschern um die Aachener Neurologin und Psychiaterin Dr. Irene Neuner und den Jülicher Physiker Prof. Jon Shah entwickelte ein Verfahren, das diese Frage klärt. Es erlaubt, die Hirnaktivitäten eines Patienten im Magnetresonanztomografen zu registrieren und gleichzeitig seine Bewegungen und Mimik mittels Videoaufnahmen aufzuzeichnen. Das war schwierig, denn im MRT-Gerät dürfen sich keine Metall­gegenstände befinden, die das Magnetfeld stören oder durch dieses gestört werden – nicht einmal ein winziger Ohrring, schon gar keine Videokamera. Die findigen Forscher lösten das Problem mithilfe von Spiegeln, die sie über dem Gesicht des Patienten anbrachten. Sie lenken das Spiegelbild in eine ­Kamera hinter dem Tomografen um, die die Bewegungen des Gesichts aufzeichnet. Eine zweite Kamera hängt an der Decke des Untersuchungsraums und registriert die Bewegungen des ganzen Körpers. Spezielle Bauteile, beispielsForschen in Jülich 1 | 2008 SCHWERPUNKT Hermann Krämer lebt seit seinem zwölften Lebensjahr mit dem Tourette-Syndrom. In Texten und Bildern gewährt er Einblicke in sein Leben mit Tics. Mit seinen ausdrucksstarken Postern und Postkarten (hier: „tic-explosion“) lädt er seine Mitmenschen dazu ein, hinzuschauen und sich mit Tourette auseinanderzusetzen. Hermann Krämer ist Mitglied der Tourette-Gesellschaft Deutschland, betreibt eine eigene Homepage mit Forum (www.tourette-syndrom.de) und engagiert sich in der Redaktion der Zeitschrift „Tourette-aktuell“. weise aus Keramik, und besonders abgeschirmte Kabel sorgen dafür, dass­dies störungsfrei möglich ist. In Rechnern außerhalb des MRT-Raums kommen die verschiedenen Informationen zusammen. So erhalten die Forscher Auskunft darüber, welche Hirnaktivitäten mit den unwillkürlichen Bewegungen oder Grimassen einhergehen. Das System wurde mit dem Wissenschaftspreis der Deutschen Tourette-Gesellschaft 2007 ausgezeichnet. Forschen in Jülich 1 | 2008 Dieses Verfahren kann künftig auch zur Erforschung anderer neuropsy-­­ chischer Erkrankungen beitragen – von der Parkinson-Erkrankung bis zu Chorea Huntington. :: Wiebke Rögener LinktiPP www.tourette-syndrom.de www.tourette-gesellschaft.de 25 Durchblick bis ins Detail Strukturen und Stoffwechselvorgänge des Gehirns abbilden, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat – das ist die Mission der Wissenschaftler am Großgerät „9Komma4“. Dabei helfen ihnen Magnetfelder, die 190 000-mal so stark sind wie das der Erde. W er sich mit Prof. Jon Shah in aller Ruhe unterhalten will, hat derzeit schlechte Karten. Zum einen wegen des Baulärms, der in sein Büro dringt, zum anderen wegen der Arbeiter, die eine geschlossene Tür nicht beachten. „So ist es halt als Bauherr“, schmunzelt Shah – eigentlicher Beruf: Wissenschaftler – entschuldigend und folgt den Männern in den direkt angrenzenden Rohbau. Das Gebäude, das seine Aufmerksamkeit verlangt, ist kein gewöhnliches. Es wird schon bald ein weltweit einzigartiges Großgerät beherbergen, mit dem die Forscher vom Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Biophysik Strukturen und Stoffwechselstörungen des Gehirns auf den Millimeter genau lokalisieren können. 26 Wenn die neue Beobachtungsstation der Hirnforscher – 1 500 Quadratmeter groß – 2009 offiziell ihren Betrieb aufnimmt, werden seit Baubeginn weniger als zwei Jahre vergangen sein. Bei den Feierlichkeiten anlässlich des ersten Spatenstichs sagte Thomas Rachel, Parlamentarischer Staats­sekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung (BMBF): „Die Technologie, die hier durch die gemeinsame Initiative des Forschungszentrums Jülich, der Siemens Healthcare und des Bundesforschungsministeriums entwickelt und aufgebaut wird, verspricht erhebliche Verbesserungen für die Patienten: genauere und schonendere Diagnosemöglichkeiten – etwa bei der Tumorfrüherkennung – ebenso wie eine Verkürzung der Entwicklungszeiten für neue Arzneimittel.“ Der Mittelpunkt dieser Technologie – das Gerät, für das extra ein neues Gebäude errichtet wird – kostet 20 Millionen Euro, die jeweils zur Hälfte vom BMBF und von Siemens Healthcare stammen. Doch es ist eine andere Zahl, die dem Gerät seinen Spitznamen gibt. „9Komma4“ steht für die Feldstärke von 9,4 Tesla (T), die von seinen Magnetspulen erzeugt wird – eine Kraft, die rund 190 000-mal so stark ist wie das Magnetfeld der Erde. „9Komma4“ ist ein Kombisystem, bestehend aus einem ­Magnetresonanztomografen (MRT) und einem Positronen­­emissionstomografen (PET). Im Magnetfeld eines MRT richten sich Atomkerne des menschlichen Körpers – zumeist Wasserstoffkerne – wie winzige Kompassnadeln aus. Mit elektromagneForschen in Jülich 1 | 2008 Highlights tischen Wellen, ähnlich den Radiowellen, können sie aus dieser aufgezwungenen Orientierung ausgelenkt werden. Nach dem Abschalten der Radiowellen kehren sie in ihre alte Richtung zurück und senden dabei wiederum elektromagnetische Wellen aus, die von Empfängerspulen registriert werden. Daraus berechnet der Computer Schnittbilder des Gehirns oder des ganzen Körpers. Je höher das Magnetfeld, desto besser wird die Bildqualität und desto klarer unterscheiden sich verschiedene Gewebetypen voneinander. Insofern ist „9komma4“ ein gewaltiger Fortschritt gegenüber 1,5-T- oder 3-T-Geräten, wie sie derzeit üblicherweise in Kliniken stehen. „Sogar das Verhalten einzelner Zellen im lebenden Organismus wird sich verfolgen lassen, wenn wir sie mithilfe von Kontrastmitteln markieren“, ist Shah überzeugt. Doch wirklich einzigartig wird „9Komma4“ durch den integrierten PET. Mit ihm lässt sich verfolgen, wie sich eine zuvor injizierte, schwach radioaktive Substanz – in der Fachsprache Radiotracer genannt – im Gehirn verteilt. Je nach Radiotracer können die Forscher Stoffwechselvorgänge beobachten oder sogenannte Rezeptoren, die für die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen sorgen. Die Bilder eines PET alleine sind aber unscharf, sodass sich daraus nur sehr ungenaue Ortsinformationen ergeben. Gemeinsam mit dem MRT jedoch bildet das PET ein perfektes Team, das den Wissenschaftlern anatomisch detaillierte Bilder liefert und ihnen gleichzeitig die Analyse der ablaufenden molekularen Mechanismen erlaubt. Manche Stoffwechselvorgänge lassen sich auch alleine mit dem MRT verfolgen. Mithilfe des simultan messenden PET beobachten die Wissenschaftler dann ergänzend andere Stoffwechselvorgänge. „Durch diese kombinierte Untersuchung können wir das Gehirn Forschen in Jülich 1 | 2008 Für das neue „9komma4“- Gerät, ein einzigartiges Instrument der Hirnforschung, musste eigens ein 1 500 Quadratmeter großes Gebäude errichtet werden (Bild links). Bild rechts: Prof. Jon Shah vom Institut für Neurowissenschaften und Biophysik vor dem ­derzeit installierten 4-T-MRT. gleichsam aus verschiedenen Blickwinkeln im selben Zustand erforschen, was nicht möglich ist, wenn die MRT- und PET-Bilder nacheinander aufgenommen werden“, so Shah. Auch wenn „9Komma4“ der Star im Observatorium der Hirnforscher ist, so ist das Gerät letztlich nur ein Teil des Jülicher Forschungsspektrums an bildgebenden Verfahren. Die Aktivitäten der Wissenschaftler haben dabei für Prof. Achim Bachem, Vorstandsvorsitzender des Forschungszentrums, Modellcharakter: „Durch die enge Zusammenarbeit mit der Industrie und den benachbarten Universitätskliniken – insbesondere mit der RWTH Aachen im Verbund JARABRAIN – kommt Grundlagenforschung aus Jülich zeitnah in die Praxis. Der Weg von der Erkenntnis zum Nutzen für Patienten wird so entscheidend verkürzt.“ Kein Gerät von der Stange Zum Forschungsspektrum zählt auch ein MRT für Mäuse und Ratten, das auf ähnlichen Komponenten beruht wie „9komma4“. Auch seine Spulen erzeugen Magnetfelder von 9,4 Tesla, sind aber auf die Größe der Tiere hin ausgelegt, um Bilder in optimaler Qualität zu ermöglichen. „Wenn wir bei der Untersuchung von Patienten oder Probanden Ergebnisse erhalten, die wir nicht vollständig verstehen, so können wir versuchen, die aufgetauchten Fragen mithilfe des Tier-MRT zu beantworten“, erläutert Shah. Für Menschen sind weiterführende Experimente meist nicht zumutbar. Die derzeitigen Bauaktivitäten können Shah nicht aus der Ruhe bringen – eben- so wenig wie provozierende Fragen. Ob es denn – jenseits des geschickten Einwerbens von Finanzmitteln – eine Leistung sei, für 20 Millionen Euro ein Großgerät zu kaufen? Freundlich erläutert der Physiker, dass es sich keineswegs um ein Gerät von der Stange handele. Siemens Healthcare habe das Forschungszentrum als Standort gewählt, weil es über ausgezeichnete Expertisen für den Einsatz und den erfolgreichen Aufbau verfügt. „Beispielsweise entwickeln wir Methoden zur intelligenten Steuerung des „9komma4“-MRT und des Tier-MRT und verbessern ständig die Datenauswertung“, so Shah. Außerdem müssten zum Beispiel der Tier-MR-Tomograf und der PET-Teil von „9komma4“ auf Basis von gekauften – aber auch von selbst gebauten – Komponenten in Eigenregie installiert werden. „Da muss man wirklich in allen Einzelheiten wissen, wie ­Tomografen funktionieren“, sagt Shah. Häufig sind es eben gerade die scheinbar winzigen Details, die den Unterschied machen. Das gilt für die Geräte ebenso wie für die Bilder des Gehirns. Dass der Professor stets die Details im Blick hat, kann bestätigen, wer erlebt hat, wie er mit den Baufachleuten über die richtige Position eines automatischen Türöffners verhandelt. :: Frank Frick LinktiPP www.fz-juelich.de/portal/forschung/ highlights/parkinson/hirnschrittmacher 27 Der weibliche Blick Wenn eine Fahrerin ihr Auto nur mit Mühe in eine enge Parklücke manövriert, heißt es schnell: Typisch Frau! Und auch sonst wird Frauen oft nachgesagt, sie hätten ein schlechteres Orientierungsvermögen als Männer. Indes lernen Mädchen früher sprechen als Jungen. Gibt es für solche geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen biologische Ursachen? Neurowissenschaftler des Forschungszentrums Jülich fanden heraus, dass ein ­Hirnareal, das Bewegung im Gesichtsfeld wahrnimmt, sich bei Frauen und Männern unterscheidet. T ypisch männliche oder weibliche Verhaltensmuster seien durch unsere Evolution geprägt und von Geburt an im Gehirn verankert, behaupten – nicht nur – Bestsellerautoren. Allerdings wissen Hirnforscher, Psychologen und Mediziner bis heute nicht, ob tatsächlich biologische Ursachen für weibliche oder männliche Stärken und Schwächen verantwortlich sind. Ebenso gut könnten die beobachteten Unterschiede ­allein auf erlernten Verhaltensweisen oder auf einer Kombination­ aus biologischen und Umwelteinflüssen beruhen. Prof. Katrin Amunts vom Institut für Neurowissenschaften und Biophysik am Forschungszentrum Jülich geht diesen Fragen­ auf den Grund. Die Leiterin der Arbeitsgruppe „Funktionelle Architektonik“ analysiert geschlechtsspezifisches Verhalten und seine neurobiologischen Ursachen. Da- 28 bei entdeckte sie in einer bestimmten Region des Sehzentrums Unterschiede zwischen Frauen- und Männergehirnen. „Mich hat interessiert, wie das Sehzentrum des Gehirns aufgebaut ist, und in diesem Zusammenhang bin ich auf diese Unterschiede aufmerksam geworden“, berichtet die Hirnforscherin. Seit über zehn Jahren arbeitet sie mit Prof. Karl Zilles am Forschungszentrum Jülich an ei­nem dreidimensionalen anatomischen Atlas des Gehirns. Diese „Brain Map“ soll eine Hirnkarte aus dem Jahr 1909 ersetzen, die auf Arbeiten des Hirnforschers und Psychiaters Korbinian Brodmann zurückgeht und bis heute von den meisten Neurowissenschaftler verwendet wird. An hauchdünnen Schnitten von Gehirnen verstorbener Frauen und Männer unterschiedlichen Alters dokumentiert Amunts dazu mikroskopisch feinste Zellstrukturen und hat mit ihren Kollegen inzwischen etwa die Hälfte des Gehirns neu kartiert. Bei diesen Untersuchungen stellte sie fest, dass bestimmte Regionen im Sehzentrum, die Bewegungssignale verarbeiten, bei Männern etwas größer sind als bei Frauen. Die Sehrinde befindet sich im Hinterkopf, im Okzipitallappen. Sie besteht aus mehreren Arealen, die unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Das optische Signal gelangt von der im Augapfel gelegenen Netzhaut über den Sehnerv und das Zwischenhirn zunächst in die sogenannte primäre Sehrinde, eine Art Schaltzentrale, die eintreffende Signale analysiert und in andere Areale weiterleitet. Dort werden sie weiterverarbeitet und interpretiert. So entsteht schließlich das bewusst wahrgenommene Bild. Kleiner Unterschied im Gehirn Amunts entdeckte, dass ein für das räumliche Sehen zuständiger Bereich in der rechten Hirnhälfte im Sehzentrum bei Männern größer ist als bei Frauen. Dieses hOc5 genannte Areal ist beispielsweise dann aktiv, wenn der Blick Forschen in Jülich 1 | 2008 Highlights XXX Männer und Frauen verarbeiten Informationen über Bewegungen im Gesichtsfeld unterschiedlich – der dunkelblau markierte Bereich im Bild auf der linken Seite zeigt die Hirnregion, die dafür zuständig ist. Sie ist bei Frauen etwas kleiner. Was dieser Unterschied für die Orientierung im Alltag bedeutet, ist jedoch noch offen. An der Verarbeitung von Sehinformationen sind alle farbigen Areale beteiligt. auf ein bewegtes Objekt fällt. „Es ist ein sehr kleines Gebiet, das nur etwa ein Zwanzigstel so groß ist wie die primäre Sehrinde und nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Hirnvolumens ausmacht“, erklärt Amunts. Ist dieser kleine Unterschied nun die Ursache, dass Frauen mehr Schwierigkeiten beim Einparken haben oder links und rechts verwechseln? „Nein“, betont Amunts. „Das heißt nur, dass es in den betreffenden Bereichen der männlichen Gehirne potenziell mehr Platz gibt, in dem zusätzliche Informationen verarbeitet werden könnten. Das wiederum bedeutet, dass Frauen visuell wahrgenommene Informationen über Bewegung ein wenig anders verarbeiten als Männer.“ Verhaltenstests zeigten bereits: Frauen orientieren sich tatsächlich nach anderen Prinzipien als Männer. Sie nutzen eher Landmarken, Männer dagegen haben eher eine Landkarte im Kopf. Eine Wegbeschreibung wie: „An der Ampel Forschen in Jülich 1 | 2008 rechts, dann am Supermarkt links abbiegen“, wird eher von einer Frau stammen. „Fünf Kilometer nach Süden, dann rechts abbiegen und nach 300 Metern wieder links“ ist eher „typisch Mann“. Woran liegt´s? Ob solche geschlechtsspezifischen Problemlösungen tatsächlich auf Unterschiede im Oberstübchen oder auf das sozial geprägte Verhalten zurückzuführen sind, kann die Neuroanatomie alleine nicht beantworten. Amunts: „Was der Unterschied in der Hirnstruktur für die Hirnfunktion bedeutet und welches Verhalten daraus resultiert, wissen wir oft nicht. Unsere Studie zeigt anatomische Unterschiede in den Zentren, die für die Wahrnehmung von Bewegung zuständig sind. Sie sagt aber nichts darüber aus, ob Frauen ungeschickter einparken.“ Um das Auto perfekt in eine enge Parklücke zu manövrieren, ist erheblich mehr Hirnarbeit nötig als nur die Verarbeitung der Information, wohin sich das Fahrzeug bewegt. Einparken ist ein komplexes Verhalten, bei dem Lernen, Gewohnheit und Kultur entscheidende Faktoren sind. Und die kann man mit der Hirnanatomie alleine nicht erfassen. „Wir Anatomen arbeiten daher eng mit Wissenschaftlern zusammen, die sich mit der Hirnfunktion und dem Verhalten beschäftigen. Dazu haben wir in Jülich optimale Möglichkeiten, etwa durch die funktionelle Bildgebung. Vielleicht lassen sich diese Fragen dann in nicht allzu ferner Zukunft beantworten“, sagt Amunts. So könnte auch einfach mangelnde Übung die Probleme beim Orientieren oder Einparken verursachen. Denn eine Studie ergab, dass Frauen sich ebenso gut zurechtfinden wie Männer, wenn sie das gezielt trainieren. :: Karin Hollricher 29 Das Molekül, das müde macht Nur die Aussicht auf eine Tasse köstlich duftenden Kaffees hilft manchem Morgenmuffel nach einer viel zu kurzen Nacht aus dem Bett. Und wer nachmittags einen toten Punkt überwinden oder gar in der Nacht arbeiten muss, greift ebenfalls gern zum koffeinhaltigen Heißgetränk. Kaffee macht müde Menschen munter, das ist altbekannt. Aber warum das funktioniert und wie Müdigkeit überhaupt entsteht, haben Jülicher Forscher erst kürzlich herausgefunden. I ch muss dringend meine Adenosin­ rezeptoren blockieren“ – so würden es wohl nur wenige Menschen ausdrücken, wenn die Schläfrigkeit und das Begehren nach einem Espresso oder Milchkaffee immer stärker werden. Doch der alltägliche Wunsch „Ich brauche jetzt einen Kaffee!“ besagt nichts anderes. Denn Adenosinrezeptoren im Gehirn sind es, die hinter dem Schlafbedürfnis stecken. Wer sie blockiert, bleibt länger wach. 30 Schon seit über hundert Jahren vermuten Wissenschaftler, dass sich bestimmte Substanzen im Gehirn ansammeln, wenn man zu lange nicht geschlafen hat. In jüngerer Zeit zeigten vor allem Tierversuche: Nach längerem Schlafentzug finden sich im Gehirn große Mengen des Signalmoleküls Adenosin, viel mehr als im hellwachen Zustand. Doch nur wenn dieser Botenstoff im Gehirn auf passende Empfängermoleküle – die Adenosinrezeptoren – trifft, beeinflusst er die Hirnzellen und macht schläfrig. Ein bestimmter Typ dieser Rezeptoren, A1 genannt, wurde nun vom Jülicher Neurowissenschaftler Prof. Andreas Bauer und seiner Arbeitsgruppe „Molekulares Neuroimaging“ als Schlaffaktor identifiziert. Für diese Experimente mussten zwölf Freiwillige ihre Nachtruhe opfern. Und auch den Mitgliedern des Forscherteams war kein Schlaf vergönnt – ihre Aufgabe war es, die Versuchspersonen wach zu halten. Vor und nach der durchForschen in Jülich 1 | 2008 Highlights wachten Nacht maßen die Wissenschaftler, wie hoch die Konzentration der A1-Rezeptoren im Gehirn der Versuchspersonen war. Eine Vergleichsgruppe, die ungestört durchschlafen durfte, wurde ebenfalls untersucht. Dafür bekamen ­alle Teilnehmer des Experiments ein ­radioaktiv markiertes Molekül in die Blutbahn gespritzt, das spezifisch an das A1-Eiweiß bindet. Im Positronenemissionstomografen (PET) lässt sich die kurzlebige Strahlung, die von den markierten Molekülen ausgeht, genau orten. Die Messung ergab: Nach einer schlaflosen Nacht enthält das Gehirn in vielen Regionen, vor allem aber im orbitofrontalen Kortex, der dicht hinter den Augen liegt, weit mehr A1-Rezeptoren als nach einer erholsamen Nachtruhe. Offenbar werden diese Eiweißmoleküle vom Körper vermehrt gebildet, wenn man ihm keine Ruhe gönnt. Sie sind zumindest mitverantwortlich dafür, dass wir rund ein Drittel unseres Lebens verschlafen, schließen die Forscher aus diesen Experimenten. Denn je mehr A1-Rezeptoren vorhanden sind, desto mehr Adenosin kann an die Nervenzellen binden und dem Gehirn mitteilen: Zeit für ein Nickerchen! Wie dieses Müdigkeitssignal im Einzelnen seine Wirkung entfaltet, wissen die Forscher noch nicht genau. „Wahrscheinlich gibt es mehrere Pfade, über die Adenosin und A1 die Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus' beeinflussen“, er­­läutert Bauer. „Einerseits gibt es Adenosinrezeptoren auf spezialisierten Zellen im Hypothalamus. Das ist die Hirnregion, in der unsere innere Uhr tickt. Andererseits entsteht Adenosin als Abbauprodukt beim Energieverbrauch in allen Gehirnzellen und wirkt seinerseits Forschen in Jülich 1 | 2008 Horizontaler Schnitt durch ein Gehirn vor (oben) und nach (unten) Schlafentzug. Die Positronenemissionstomografie zeigt die erhöhte Menge des Schlaffaktors A1 nach einer schlaflosen Nacht: Blau und Grün stehen für geringe, Orange und Rot für hohe Konzentrationen. hemmend auf die Energieproduktion. Wir vermuten daher einen zusätzlichen globalen, überall im Gehirn auftretenden Mechanismus, der über die Zunahme von A1-Rezeptoren das Schlafbedürfnis erhöht.“ Hilfe bei Schlafstörungen Hemmen lässt sich dieser Schlaffaktor mit Koffein. Es bindet – genau wie die radioaktiven Markermoleküle aus den Jülicher Experimenten – an die A1-Rezeptoren und blockiert sie so für Adenosin. Damit wird das Müdigkeitssignal unterbunden. So erklärt sich die aufmunternde Wirkung von Cappuccino und Co. Doch die Jülicher Forscher wollen mehr. Die neuen Erkenntnisse über Einschlafmechanismen in Gehirn können einerseits helfen, in kritischen Situationen wach zu bleiben, andererseits Schlafstörungen entgegenwirken. So gibt es bereits Anfragen aus der Luftfahrtmedizin, ob sich aufgrund dieser Forschungsergebnisse nicht ein Mittel entwickeln ließe, das Piloten und Crews auf Langstreckenflügen munter hält. Ein Super-Koffein gewissermaßen. „Denkbar wäre ein solcher Muntermacher schon“, sagt Bauer. Doch sein Forschungsinteresse richtet sich in erster Linie auf Medikamente, die Patienten mit Schlafstörungen helfen sollen. „Eine Substanz, die gezielt an Adenosinrezeptoren des Gehirns wirkt und vom Körper nicht so rasch abgebaut wird wie Adenosin selbst, hätte große Potenziale in der Schlafmedizin“, ist Bauer überzeugt. Denn sie würde nachhaltiger schläfrig machen – voraussichtlich ohne die Nebenwirkungen herkömmlicher Schlafmittel. Davon könnten viele Menschen profitieren. Denn zahlreiche neurologische und psychische Leiden, wie Parkinson, Alzheimer und Depressionen, gehen mit Ein- oder Durchschlafstörungen einher. Derzeit untersucht Bauers Arbeitsgruppe, ob sich die an gesunden Versuchspersonen gewonnenen Erkenntnisse bei Patienten bestätigen lassen, deren normaler Schlafrhythmus gestört ist. Beispielsweise bei Menschen, die an Narkolepsie leiden, also ein krankhaftes Schlafbedürfnis haben. „Aufgrund der Befunde an gesunden Personen wäre zu erwarten, dass diese Patienten vermehrt A1-Rezeptoren bilden“, sagt Bauer. Ob das tatsächlich so ist und ob Medikamente, die auf der Jülicher Grundlagenforschung aufbauen, einmal Menschen helfen können, die zu viel oder zu wenig Schlaf bekommen, müssen weitere Studien zeigen. :: Wiebke Rögener 31 Tumor im Fokus Etwa 5 000 Menschen erkranken in Deutschland jährlich neu an einem Hirntumor, der aus dem Stützgewebe der Nervenzellen, den Gliazellen, entsteht. Damit sind solche als Gliome bezeichneten Krebswucherungen zwar relativ selten, doch für die Betroffenen ist das kein Trost: Gliome sind oft sehr bösartig und schwer zu ­behandeln. Das Team des Nuklearmediziners Prof. Karl-Josef Langen arbeitet daran, ­Diagnostik und Therapie dieser Hirntumoren zu verbessern. W er seinen Gegner schlagen will, muss wissen, wo er sich versteckt. Um die Krebszellen aufzuspüren, nutzt Langens Arbeitsgruppe „Hirntumordiagnostik“ am Jülicher Institut für Neurowissenschaften und Biophysik ein ganz spezielles Designermolekül: [18F]-Fluorethyltyrosin, kurz FET genannt (siehe Kasten). „Mit dieser radioaktiv markierten Aminosäure lassen sich Krebszellen im Hirn besser identifizieren als mit herkömmlichen Diagnoseverfahren“, erläutert Langen. Denn FET wird von Tumoren besonders stark angereichert. Mithilfe der Positronenemissionstomografie (PET) lässt sich diese Anhäufung radioaktiver Moleküle genau lokalisieren. Anders als andere Radiopharmaka – etwa die häufig in der Krebsdiagnostik genutzte [18F]Fluordeoxyglukose (FDG) – sammelt sich FET nicht in gesundem und nur selten in entzündetem oder anderweitig geschädigtem Hirngewebe an. Die Forscher hoffen daher, dass FET für die Patienten künftig in vielfacher Weise nützlich sein kann: zur Bestimmung, wie weit ein Hirntumor sich ausdehnt, zur Vorhersage, wie ein Gliom sich entwickeln wird, und zur Kontrolle der Therapie. 32 Um den Krebs mit Operationen oder Strahlen gezielt angreifen zu können, ohne das umliegende Hirngewebe zu schädigen, müssen die Ärzte Lage und Größe des Tumor möglichst genau bestimmen. Zwar liefern moderne Verfahren wie die Magnetresonanztomografie (MRT) sehr präzise Bilder aus dem Gehirn, doch lassen diese die Grenzen des Krebsgeschwulstes nicht sicher genug erkennen. Denn wenn ein Hirntumor wächst, bilden sich oft Schwellungen – Ödeme – im umgebenden gesunden Hirngewebe. Diese begleitenden Veränderungen sind im MRT-Bild nicht zuverlässig vom Tumor zu unterscheiden. „Die FET-Diagnostik ist hier überlegen, weil sie biologische Prozesse sichtbar macht und nicht nur Strukturen, die auch in die Irre führen können“, erläutert Langen. In Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Düsseldorf konnte sein Team zeigen: Eine Ansammlung von FETMolekülen findet sich fast nur im Tumorgewebe. Ende der Unsicherheit Besonders präzise Aussagen erlaubt eine Kombination von FET-PET und MRT. Wenn beide Verfahren auf einen Hirntumor hindeuteten, ließen sich in 97 Prozent der Fälle bei einer Gewebeentnahme an dieser Stelle Krebszellen nachweisen. Bei einer Strahlentherapie können die Ärzte so ihr Ziel sehr genau ins Visier nehmen. Damit werden höhere, gezielte Strahlendosen möglich, während gleichzeitig die Nebenwirkungen geringer sind als bei ­einer breiter gestreuten Bestrahlung. Nicht immer ist ein Gliom lebensbedrohlich. Manche dieser Tumoren wachsen so gemächlich, dass die Patienten viele Jahre ohne Beschwerden damit leben können. Doch andere Tumoren entwickeln sich rasch zu aggressiven Formen weiter. Welches Los ein Patient gezogen hat, ist bisher kaum vorauszusagen. Jetzt deuten Studienergebnisse auf ein Ende der Unsicherheit hin: Solange der Tumor kein FET anreichert, verhält er sich kaum angriffslustig. Erst wenn sich der Stoffwechsel der Krebszellen ändert und sie vermehrt FET aufnehmen, scheint eine Operation für den Patienten von Nutzen zu sein. Wenn dagegen sowohl FET-PET als auch MRT auf einen wenig aktiven Tumor hinweisen, kann man auf stark belastende Therapien vorerst verzichten. Auch wenn – etwa im Rahmen von wissenschaftlichen Studien – mittels MRT Strukturveränderungen im Gehirn entdeckt werden, kann FET helfen, diese Zufallsbefunde richtig zu interpretieren. „Wenn die Strukturen kein FET anreichern, kann man sehr gelassen sein“, sagt Langen. Nachdem ein Patient operiert oder bestrahlt wurde oder eine Chemotherapie erhielt, bleiben stets die bangen Fragen: Wirkt die Behandlung? Kommt der Tumor wieder? Auch hier hoffen die Forscher, dass das FET-Molekül bald schnellere und genauere Antworten erForschen in Jülich 1 | 2008 Highlights Die Anreicherung der radioaktiv markierten Aminosäure FET (rechts) lässt die Grenzen eines Hirntumors klarer erkennen als die Magnetresonanztomografie allein (links). lauben wird. Nimmt der Tumor im Verlauf der Therapie immer weniger von der markierten Aminosäure auf, so scheint der Krebs gut auf die gewählte Behandlungsmethode anzusprechen, ergaben erste Untersuchungen. Und ob ein auffälliger Befund im Röntgenbild ein nachwachsender Tumorherd ist oder einfach nur Narbengewebe, wie es sich häufig nach einer Operation bildet, soll sich bald ebenfalls mit dem Jülicher Designermolekül entscheiden lassen. Denn Narben schlucken kein FET. „Zwar gibt es noch keine Studien, die beweisen, dass eine Diagnose mittels FET-PET die Überlebenschancen der Patienten mit einem Hirntumor erhöhen“, erklärt Langen. Aber das gelte auch für andere bildgebende Verfahren. „Ich meine, dass es höchste Zeit ist, FET in die klinische Routinediagnostik einzuführen, weil sich mit diesem Verfahren die Behandlungsplanung erheblich verbessern lässt.“ :: Mit Aminosäuren gegen Hirntumoren Für den Einsatz als Kundschafter in der Positronenemissionstomografie braucht ein Molekül ganz spezielle Eigenschaften: Es muss sich in den gesuchten Zellen anreichern, und es muss Strahlung abgeben, die sich im Körper millimetergenau orten lässt. [18F]-Fluorethyltyrosin (FET) ist so ein in den Jülicher Labors gezüchteter Spezialist. Bei dieser Aminosäure – eigentlich einem Eiweißbaustein – wurde ein Wasserstoffatom durch ein etwa gleich großes radioaktives Fluor­atom ersetzt. Dieses strahlt Positronen ab, positiv geladene Antimaterieteilchen also, die die gleiche Masse wie ein Elektron besitzen. Das strahlende Fluor-Isotop wird in einem Jülicher Zyklotron erzeugt, das Verfahren zur Markie­­­ rung der Aminosäure wurde von Nuklearchemikern unter Leitung von Prof. Heinrich Coenen entwickelt. Besonders zielgenau ist dieses Designermolekül, weil es durch bestimmte Transportmoleküle in der Zellmembran der Krebszellen aufgenommen wird. Dort wird es allerdings nicht – wie gewöhnliche Aminosäuren – in Eiweiße eingebaut, sondern es sammelt sich in der Zelle an. In der Membran entzündeter Zellen finden sich die spezialisierten Transporter dagegen nicht. Besser als mit anderen Verfahren unterscheidet FET daher Krebszellen von Entzündungsherden. Ein weiterer Vorteil: Mit einer Halbwertszeit von 110 Minuten ist die radioaktive Markierung verglichen mit anderen „Kundschaftermolekülen“ relativ langlebig. FET kann daher von Forschungsinstituten, die ein geeignetes Zyklotron besitzen, für Krankenhäuser im Umkreis von etwa 200 Kilometern produziert werden. Wiebke Rögener Forschen in Jülich 1 | 2008 33 Besondere Kontakte Synapsen sind die Schlüsselstrukturen der Kommunikation zwischen Nervenzellen. Diese Strukturen sind in die unterschiedlichsten Netzwerke des Gehirns eingebunden und ermöglichen somit die Komplexität und Vielfalt der Leistungen, zu denen unser Gehirn fähig ist. Den Aufbau einzelner Synapsen in unterschiedlichen Gehirnregionen haben Jülicher Forscher in jahrelanger Arbeit bis ins Detail untersucht und anschließend in virtuellen dreidimensionalen Modellen nachgestellt. I nsgesamt etwa 20 bis 40 Milliarden Nervenzellen – Neurone – gibt es in der menschlichen Großhirnrinde. Zum Vergleich: Im Jahr 2007 verfügten etwa 1,2 Milliarden Menschen über einen Zugang zum Internet. Das menschliche Gehirn ist also ein noch weit komplexeres Netzwerk als das World Wide Web. Jedes Neuron innerhalb eines Netzwerks ist über 10 000 bis 15 000 Synapsen mit anderen Neuronen verbunden. An diesen Schaltstellen werden Informationen, die als elektrische Signale dort eintreffen, durch Botenstoffe von einer Nervenzelle zur nächsten übertragen. Dort wird die Botschaft wieder in ein elektrisches ­Signal übersetzt und weitergeleitet. Variable Schaltstellen Synapsen sind keine statischen Gebilde, sie verändern sich strukturell und funktionell im Laufe des Lebens. Im Hippocampus, einem mit Lern- und Gedächtnisfunktionen assoziierten Gehirnareal, können Synapsen im Minutentakt neu entstehen oder verschwinden, je nachdem, ob sie benötigt werden oder nicht. „Die Anzahl und der strukturelle Aufbau von Synapsen in einer gegebenen Region des Gehirns entscheiden über die Effizienz, Stärke und Modulation des eingehenden Signals“, erklärt Prof. ­Joachim Lübke, Leiter der Arbeitsgruppe „Struktur von Synapsen“ am Institut für Neurowissenschaften und Biophysik des Forschungszentrums Jülich. Obwohl der Begriff „Synapse“ schon vor ca. 150 Jahren durch den Physiologen Charles Sherrington eingeführt wurde, ist bis heute nur unzureichend geklärt, wie diese Schaltstellen im Detail aufgebaut sind. Aber erst wenn man ihre Struktur genau kennt, wird ihre Funktion verständlich und nachvollziehbar, was Links: Elektronenmikroskopische (EM) Aufnahme eines synaptischen Kontakts (Moosfaserbouton, gelb) und eines dendritischen Fortsatzes mit Dornen (blau) einer Pyramidenzelle im Hippocampus. Ausläufer von Stützzellen (Astrozyten, grün) umgeben diesen synaptischen Komplex (Größe: 0,0004 Millimeter) als dichtes Netzwerk. Mitte: 3-D-Rekonstruktion eines Moosfaserboutons (gelb) und seiner Zielstruktur (Dendrit, blau) einer Pyramidenzelle. Rechts: Verteilung der synaptischen Vesikel (grün), welche den Botenstoff enthalten, im Moosfaserbouton. 34 Forschen in Jülich 1 | 2008 Highlights Links: EM-Aufnahme im Bereich der Schicht 5 (einer von sechs Schichten der Großhirnrinde) mit postsynaptischen Dendriten und dendritischen Dornen (blau). Die mit diesen Zielstrukturen kontaktbildenden Synapsen sind gelb markiert. Rechts: 3-D-Rekonstruktion eines Dendritenabschnittes (blau) mit zwei kontaktbildenden Synapsen (oliv), die synaptische Vesikel (hellgrün) ­beinhalten. sich während der Entwicklung oder bei einer Erkrankung des Gehirns verändert. Zwar bestehen alle Synapsen des Zentralnervensystems aus den gleichen strukturellen Elementen: jeweils einer hochspezialisierten prä- und postsynaptischen Membran, die beide durch einen schmalen, synaptischen Spalt voneinander getrennt sind, den Signalübertragungsstellen (aktiven Zonen) und den synaptischen Vesikeln, kleinen Bläschen in der Synapse, die den Botenstoff enthalten. „Entscheidend ist aber die Anzahl und Verteilung dieser Elemente für die Stärke, Effizienz und Modulation der zu übertragenden Information an einer solchen Kommunikationsschnittstelle“, betont Lübke. Um die Kommunikation zwischen Nervenzellen in definierten neuronalen Netzwerken besser zu verstehen, untersucht er gemeinsam mit seiner Kollegin Dr. Astrid Rollenhagen den Aufbau und die Funktionsweise von Synapsen an seriellen Ultradünnschnitten von Rattengehirnen. Basierend auf den Ultradünnschnittserien nehmen die Forscher digitale Bildreihen am Elektronenmikroskop auf. So können synaptische Strukturen im Detail dargestellt werden. Aus diesen Daten entstehen in silico – am Computer – dreidimensionale Modelle für verschiedene Synapsentypen. Keine Standardsynapse Der von den Wissenschaftlern betriebene Aufwand ist enorm: Allein die Untersuchungen an einer RiesensynapForschen in Jülich 1 | 2008 se im Hörsystem, bei denen die Jülicher mit einem Team von Wissenschaftlern um den Nobelpreisträger Prof. Bert ­Sakmann zusammenarbeiteten, dauerten fünf Jahre. Mit den Arbeiten an der „Heldschen Calyx“ war die Hoffnung verbunden, ­diese Synapse als eine Art Modell für ­diese Schaltstellen im Gehirn anzusehen. „Doch wir mussten leider im Laufe der Zeit erkennen, dass die Heldsche Calyx strukturell und funktionell eher die Ausnahme als die Regel bezüglich der Signalübertragung im Gehirn ist“, sagt Lübke. „Deswegen haben wir unsere Forschungsaktivitäten auf den Moosfaserbouton ausgedehnt. Dies ist eine Synapse im Hippocampus, einer Region, die mit Lern- und Gedächtnisfunktionen assoziiert ist. Zusätzlich haben wir ­Synapsen der Großhirnrinde, des Teil des Gehirns, der wesentlich unser Bewusstsein und Verhalten steuert, analysiert.“ Die bisherigen Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede, nicht nur hinsichtlich der Größe und Form der untersuchten Synapsen, sondern auch in der Anzahl, Größe und Verteilung der aktiven Zonen (Transmitterfreisetzungsstellen) und der Größe und Organisation der sogenannten „Pools“ synaptischer Vesikel. Diese strukturellen Parameter tragen entscheidend zur Effizienz, Stärke und Plastizität von Synapsen bei. Im Vergleich zur Heldschen Calyx mit etwa 600 Transmitterfreisetzungsstellen und ca. 70 000 synaptischen Vesikeln, enthält der Moosfaserbouton im Mittel nur 25 aktive Zonen und 32 000 synaptische Vesikel. Korticale Synapsen dagegen haben in der Regel ein bis zwei aktive Zonen und im Mittel 1 000 synaptische Vesikel. Allein diese Zahlen deuten auf ­enorme Unterschiede im „Verhalten“ der Synapse wie Stärke und Effizienz synaptischer Übertragung sowie Kurz- und Langzeitplastizität hin. Die Befunde weisen darauf hin, dass jede einzelne Synapse strukturell und funktionell perfekt an das jeweilige neuronale Netzwerk der verschiedenen Gehirnregionen angepasst ist und deshalb flexibel auf die entsprechenden Sinnesreize reagieren kann. „Der Traum von einer ‚Standardsynapse‘ im Gehirn ist deshalb wohl nicht realistisch“, resümieren Rollenhagen und Lübke. Hinsichtlich der Zunahme von Demenzerkrankungen weltweit haben diese grundlegenden Erkenntnisse zu Synapsen mittlerweile einen wachsenden aktuellen Bezug. „Alle derartigen Erkrankungen, wie beispielsweise Morbus Alzheimer, lassen sich letztlich auf massive strukturelle Veränderungen im Gehirn zurückführen und erklären damit die Dysfunktion oder den Ausfall dieser Strukturen“, sagen Rollenhagen und Lübke. Den krankhaften Veränderungen an Synapsen wird das Jülicher Team in Zukunft verstärkt seine Aufmerksamkeit widmen. :: Karin Hollricher 35 Hirnlandschaften Von vielen unterschiedlichen Hirnregionen, ihren Strukturen, Funktionen und Veränderungen haben wir in diesem Heft berichtet. Hier wollen wir Ihnen helfen, sich in den komplexen Hirnlandschaften zu orientieren. Zwei Querschnitte (links) und ein Längsschnitt (rechts) durch das Gehirn sowie eine schematische Zeichnung zeigen, wo die Areale des menschlichen Gehirns liegen, von denen in den Artikeln die Rede war – von der Amygdala bis zum Zwischenhirn. Basalganglien Zwischenhirn Insel Schläfenlappen Präfrontaler Kortex Amygdala Sehnerv Hypothalamus Basalganglien Zwischenhirn Insel Großhirnrinde Schläfenlappen Hippocampus Substantia nigra 36 Forschen in Jülich 1 | 2008 Highlights Motorkortex Präfrontaler Kortex Parietalkortex Okzipitallappen Orbitofrontaler Kortex Schläfenlappen Parietalkortex Zwischenhirn Basalganglien Okzipitallappen Kleinhirn Hippocampus Amygdala Forschen in Jülich 1 | 2008 37 Nachrichten aus der Medizin Dreh gegen Fehlfaltung 38 Proteine sind die Arbeitspferde in der Zelle und steuern wichtige Körperprozesse. Durch Computersimulationen konnten Jülicher Forscher des John von Neumann-Instituts für Computing zeigen, wie sich bestimmte Proteine fehlerfrei zusammenbauen können: Am Anfang entsteht ein langes, gerades Segment, das normaler- weise wie ein klebriger Faden freie Moleküle einfangen und sich dadurch selbst zerstören würde. Davor schützt es sich, indem es sich zu einer Art Spirale aufwickelt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt entrollt es sich wieder und verbindet sich mit einem komplementären Endstück zu einer stabilen Faltblattstruktur. Tag der Entscheidung Patente Methode Am 11. März 2008 gab das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Ergebnis der Ausschreibung für das „Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen“ bekannt: Es wird in Bonn angesiedelt – mit Beteiligung des Forschungszentrums Jülich. „Ich freue mich, dass … die besonderen Kompetenzen des Forschungszentrums Jülich mit seinen exzellenten Möglichkeiten bei der Bildgebung des menschlichen Gehirns bei der Entscheidung für Bonn eine wichtige Rolle gespielt haben“, sagte Thomas Rachel, Parlamentarischer Staatssekretär. Bei nuklearmedizinischen Untersuchungen injizieren Ärzte dem Patienten eine radioaktiv markierte Substanz, die mithilfe der Positronenemissionstomografie (PET) Stoffwechselvorgänge im Gehirn sichtbar macht. Vor allem bei Parkinson-Kranken sowie zur Tumordiagnose setzen sie dabei sogenanntes [18F]FDOPA ein. Mit einem von Jülicher Nuklearchemikern entwickelten Verfahren, das inzwischen patentiert wurde, lässt sich dieses wichtige PET-Radiopharmakon künftig einfacher, billiger und ­sicherer herstellen als bisher. Forschen in Jülich 1 | 2008 Highlights Hilfreicher Hirnschrittmacher Mithilfe der Positronenemissionstomografie konnte Prof. Gereon Fink mit Wissenschaftlern aus Jülich, Kiel und Köln beobachten, wie bei Parkinson-Patienten der Hirnschrittmacher in das sensorische System im Gehirn eingreift. Er verstärkt das Signal für den Harndrang und verringert so Störungen der Blasenfunktion, die eine häufige Begleiterscheinung der Parkinson‘schen Krankheit sind. Das Schwingen der Neuronen Sonde zur Diagnose von Alzheimer Im Gehirn von Menschen, die unter der Alzheimer-Demenz leiden, bilden sich klumpenförmige Ablagerungen. Sie bestehen aus fehlerhaft gefaltetem Beta-Amyloid (im Bild blau, hier umgeben von bestimmten Nervengewebszellen, den Astrozyten). ­Jülicher Wissenschafter um Prof. Dieter Willbold haben ein eiweißartiges Molekül entwickelt, das in Gewebeproben nur an dieses Beta-Amyloid bindet. Es könnte künftig helfen, wie eine Sonde die krankhaften Ablagerungen im lebenden Gehirn frühzeitig aufzuspüren. Jülicher Forscher haben mathematisch das Verhalten einer großen Zahl von gekoppelten Oszillatoren untersucht, also von schwingenden Systemen wie etwa Pendeln oder Nervenzellen (Neuronen) im Gehirn. Bisher nahm man an, dass räumlich ausgedehnte Populationen von gekoppelten Oszillatoren entweder alle auf unterschiedlich komplexe Weise im Takt schwingen oder völlig aus dem Takt sind. Nun konnte ein Team um Prof. Peter Tass zeigen, dass die Mischform dieser extremen Zustände in medizinisch relevanten Situationen weit verbreitet ist. Dies könnte für die Therapie der Parkinson‘schen Krankheit bedeutsam sein, weil es bei ihr zu einer fehlerhaften Synchronisation der neuronalen Oszillatoren im Hirn kommt. Was Herzen höher schlagen lässt Im Erwachsenenalter wird der Herzschlag durch andere „Schrittmacherkanäle“ – bestimmte Eiweißmoleküle im Herzen – reguliert als während der Embryonalentwicklung. Das gilt zumindest für Mäuse. Herausgefunden hat das ein Wissenschaftlerteam aus dem Bereich „Zelluläre Biophysik“ des Jülicher ­Instituts für Neurowissenschaften und Biophysik. Forschen in Jülich 1 | 2008 39