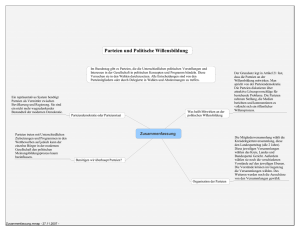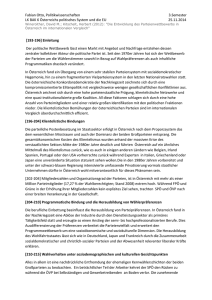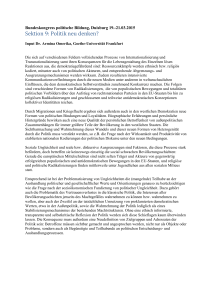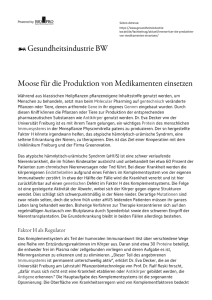Die Überwältigung der Parteiendemokratie durch die
Werbung
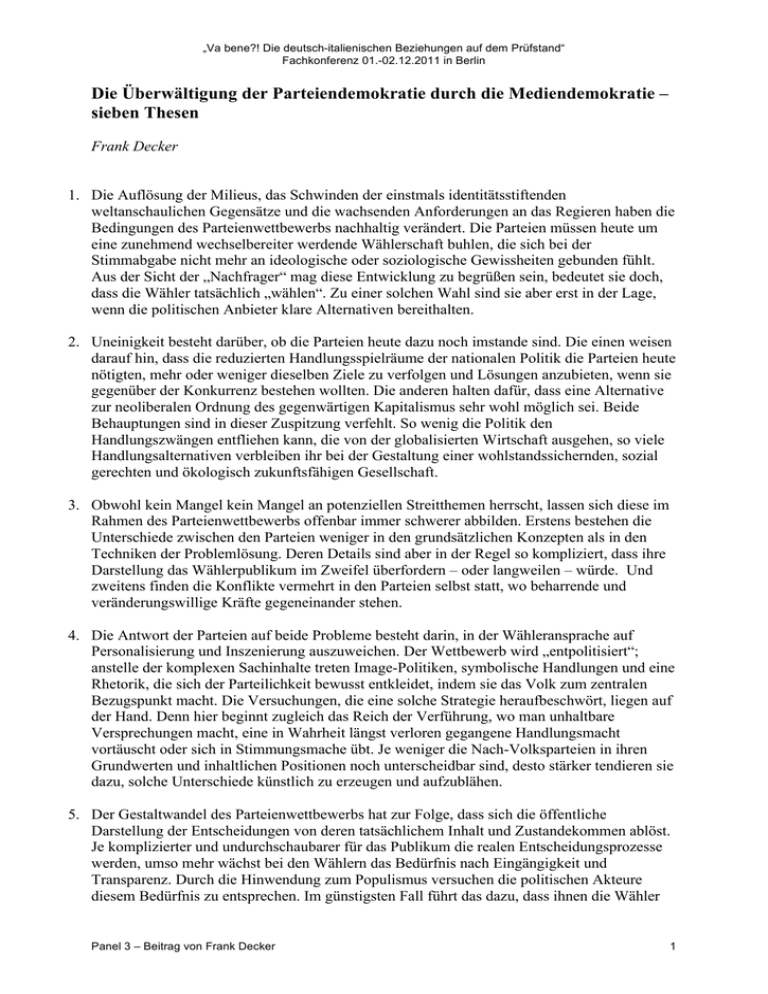
„Va bene?! Die deutsch-italienischen Beziehungen auf dem Prüfstand“ Fachkonferenz 01.-02.12.2011 in Berlin Die Überwältigung der Parteiendemokratie durch die Mediendemokratie – sieben Thesen Frank Decker 1. Die Auflösung der Milieus, das Schwinden der einstmals identitätsstiftenden weltanschaulichen Gegensätze und die wachsenden Anforderungen an das Regieren haben die Bedingungen des Parteienwettbewerbs nachhaltig verändert. Die Parteien müssen heute um eine zunehmend wechselbereiter werdende Wählerschaft buhlen, die sich bei der Stimmabgabe nicht mehr an ideologische oder soziologische Gewissheiten gebunden fühlt. Aus der Sicht der „Nachfrager“ mag diese Entwicklung zu begrüßen sein, bedeutet sie doch, dass die Wähler tatsächlich „wählen“. Zu einer solchen Wahl sind sie aber erst in der Lage, wenn die politischen Anbieter klare Alternativen bereithalten. 2. Uneinigkeit besteht darüber, ob die Parteien heute dazu noch imstande sind. Die einen weisen darauf hin, dass die reduzierten Handlungsspielräume der nationalen Politik die Parteien heute nötigten, mehr oder weniger dieselben Ziele zu verfolgen und Lösungen anzubieten, wenn sie gegenüber der Konkurrenz bestehen wollten. Die anderen halten dafür, dass eine Alternative zur neoliberalen Ordnung des gegenwärtigen Kapitalismus sehr wohl möglich sei. Beide Behauptungen sind in dieser Zuspitzung verfehlt. So wenig die Politik den Handlungszwängen entfliehen kann, die von der globalisierten Wirtschaft ausgehen, so viele Handlungsalternativen verbleiben ihr bei der Gestaltung einer wohlstandssichernden, sozial gerechten und ökologisch zukunftsfähigen Gesellschaft. 3. Obwohl kein Mangel kein Mangel an potenziellen Streitthemen herrscht, lassen sich diese im Rahmen des Parteienwettbewerbs offenbar immer schwerer abbilden. Erstens bestehen die Unterschiede zwischen den Parteien weniger in den grundsätzlichen Konzepten als in den Techniken der Problemlösung. Deren Details sind aber in der Regel so kompliziert, dass ihre Darstellung das Wählerpublikum im Zweifel überfordern – oder langweilen – würde. Und zweitens finden die Konflikte vermehrt in den Parteien selbst statt, wo beharrende und veränderungswillige Kräfte gegeneinander stehen. 4. Die Antwort der Parteien auf beide Probleme besteht darin, in der Wähleransprache auf Personalisierung und Inszenierung auszuweichen. Der Wettbewerb wird „entpolitisiert“; anstelle der komplexen Sachinhalte treten Image-Politiken, symbolische Handlungen und eine Rhetorik, die sich der Parteilichkeit bewusst entkleidet, indem sie das Volk zum zentralen Bezugspunkt macht. Die Versuchungen, die eine solche Strategie heraufbeschwört, liegen auf der Hand. Denn hier beginnt zugleich das Reich der Verführung, wo man unhaltbare Versprechungen macht, eine in Wahrheit längst verloren gegangene Handlungsmacht vortäuscht oder sich in Stimmungsmache übt. Je weniger die Nach-Volksparteien in ihren Grundwerten und inhaltlichen Positionen noch unterscheidbar sind, desto stärker tendieren sie dazu, solche Unterschiede künstlich zu erzeugen und aufzublähen. 5. Der Gestaltwandel des Parteienwettbewerbs hat zur Folge, dass sich die öffentliche Darstellung der Entscheidungen von deren tatsächlichem Inhalt und Zustandekommen ablöst. Je komplizierter und undurchschaubarer für das Publikum die realen Entscheidungsprozesse werden, umso mehr wächst bei den Wählern das Bedürfnis nach Eingängigkeit und Transparenz. Durch die Hinwendung zum Populismus versuchen die politischen Akteure diesem Bedürfnis zu entsprechen. Im günstigsten Fall führt das dazu, dass ihnen die Wähler Panel 3 – Beitrag von Frank Decker 1 „Va bene?! Die deutsch-italienischen Beziehungen auf dem Prüfstand“ Fachkonferenz 01.-02.12.2011 in Berlin weiter vertrauen. Im schlechtesten Fall gleitet ihre Ansprache in Gefälligkeitspolitik ab oder produziert Erwartungen, die später zwangsläufig enttäuscht werden. 6. Maßgeblich vorangetrieben wird der Wandel von den Medien, die eine natürliche Affinität zur populistischen „Darstellungspolitik“ entwickeln. Symptomatisch dafür steht die Verlagerung der öffentlichen Debatte aus den politischen Institutionen in eigene Medienformate: Parlamente und Parteitage werden durch Talkshows ersetzt, die die politischen Kontroversen publikumswirksam inszenieren und zugleich eine wichtige Rolle beim Agenda-setting einnehmen. Ob man in diesem Zusammenhang bereits von einer „Kolonialisierung der Politik durch das Mediensystem“ (Thomas Meyer) sprechen mag, sei dahingestellt. In der Wettbewerbsdemokratie bleiben beide Seiten jedenfalls eng aufeinander angewiesen. Dass die Medien in dieser Symbiose häufig am längeren Hebel sitzen, liegt an ihrer grundsätzlich gegnerschaftlichen Haltung gegenüber der politischen Klasse. Die Journalisten betreiben insofern ein doppeltes, fast zynisch zu nennendes Spiel. Durch ihre Neigung zur Personalisierung und Dramatisierung drehen sie einerseits kräftig mit an der Spirale der Erwartungen und bestärken den Allmachtsmythos der Politik, den diese selbst glaubt vor der Wählerschaft erzeugen zu müssen. Auf der anderen Seite stellen sie Politiker und Parteien an den Pranger, wenn die Erwartungen nicht in Erfüllung gehen oder sich als unhaltbar erweisen. 7. Der Gestaltwandel der Parteiendemokratie führt noch in anderer Hinsicht zu populistischen Konsequenzen. Die Parteien haben ihrem gesellschaftlichen Einflussverlust ja nicht tatenlos zugesehen, sondern ihn durch einen Ausbau ihrer Positionen im Staat auszugleichen versucht. Legitimatorisch birgt das ein schwieriges Dilemma, da die Akzeptanz der Parteiendemokratie damit ausschließlich an den von der Politik erbrachten Leistungen hängt. Bleiben diese hinter den Erwartungen der Bürger zurück, dürfte auch deren Bereitschaft sinken, die Machtprivilegien der Parteien als notwendiges Übel hinzunehmen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die Kritik am „Parteienstaat“ zu einem bevorzugten Thema der – sich selbst als Anti-Parteien-Parteien stilisierenden – populistischen Neuankömmlinge avanciert ist. Panel 3 – Beitrag von Frank Decker 2