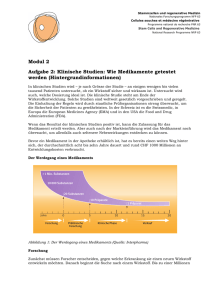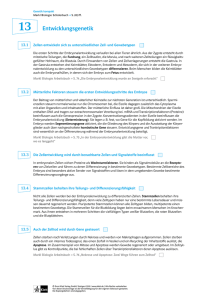Regenerative Medizin
Werbung

DEEN NNOVATION W CHSTUM Die Hightech-Strategie für Deutschland Regenerative Medizin Selbstheilungskraft des Körpers verstehen und nutzen Impressum Herausgeber Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Referat Gesundheitswirtschaft 11055 Berlin Bestellungen Schriftlich an Publikationsversand der Bundesregierung Postfach 48 10 09 18132 Rostock oder per Tel.: 01805 - 77 80 90 Fax.: 01805 - 77 80 94 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.) E-Mail: [email protected] Internet: www.bmbf.de Redaktion biotechnologie.de, Berlin Dr. Philipp Graf Sandra Wirsching Gestaltung Sven Oliver Reblin Druckerei DruckVogt GmbH, Berlin Bonn, Berlin 2013 Bildnachweise Umschlag: TRM Leipzig/ Metronom GmbH, Leipzig, Franziska Frenzel MHH Hannover, Axel Haverich (S. 2, S. 29); Universität des Saarlandes (S. 4); RTC, Peter Mark (S. 5.); BioTissue Technologies (S. 6); Nissim Benvenisty (S.7); Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin, Münster ( S. 11); MDC, Heike Naumann (S. 12), Universität Tübingen, Thomas Skutella (S. 9); Universität Würzburg, Jürgen Groll (S. 13); CRTD, Carsten Werner (S. 15, S. 17); CRTD, Katrin Boes ( S. 19, S. 20), CRTD, Elly Tanaka/Dunja Knapp (S. 21); RWTH Aachen, Stefan Jockenhövel (S. 16, S. 26); Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (S. 21); Euroderm GmbH (S. 22, S. 23), TU Berlin, Gerd Lindner (S. 24); Fraunhofer IPA (S. 25); Pluristem (S. 28); BCRT, Katrin Zeilinger (S. 30, S. 31, S. 32); Fraunhofer IGB, Heike Walles (S. 32); NMI Reutlingen, Martin Stelzle (S. 33); BCRT, Georg Duda (S. 34); Tetec AG (S. 35); Biotissue Technologies GmbH (S. 36); Universität Lübeck, Holger Notbohm (S. 37); Matricel GmbH (S. 38, S. 39), Universität Bonn, Oliver Brüstle (S. 40); ZEBET, Manfred Liebsch (S. 42, S. 45); BCRT (S. 42, S. 46); pixelio.de, Rolf van Melis (S. 43); Spherotec (S. 44); Fraunhofer FIT (S. 45) Vorwort Vorwort Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) begleitet die Entwicklungen in der regenerativen Medizin bereits seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Fördermaßnahmen, die wesentlich dazu beigetragen haben, die deutsche Forschungs- und Unternehmenslandschaft und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Auch deshalb ist Deutschland heute führend in der regenerativen Medizin. Die körpereigenen Kräfte nutzen, um Erkrankungen zu behandeln und zu heilen – das ist eines der wichtigsten Ziele der regenerativen Medizin. Bei Verletzungen der Haut, des Knorpels oder Erkrankungen des Herzens haben regenerative Verfahren bereits Eingang in die klinische Praxis gefunden. Innovative Forschung verbessert so schon heute nicht nur die medizinische Versorgung, sondern auch die Lebensqualität der Menschen. Der rasante wissenschaftliche Fortschritt zeigt eindrucksvoll: Das Potenzial der regenerativen Medizin ist noch längst nicht ausgeschöpft. Viele Forschungseinrichtungen und Unternehmen arbeiten daran, die Erkenntnisse aus dem Labor noch besser für neue Therapien und Diagnostika zu nutzen – beispielsweise für die Behandlung altersbedingter Erkrankungen, die angesichts der demografischen Entwicklung in Industrienationen wie Deutschland eine immer größere Rolle spielen. Regenerative Technologien eröffnen auch neue Wege, um die Zahl von Tierversuchen zu reduzieren. Eine wichtige Voraussetzung für Spitzenleistungen ist die Vernetzung der zentralen Akteure. Deshalb fördert das BMBF Translationszentren, in denen die Kooperation von Wissenschaftlern, Klinikern und Unternehmern besonders gefördert wird. Mit gezielten Maßnahmen unterstützen wir auch den innovativen Mittelstand in der regenerativen Medizin bei der Umsetzung anspruchsvoller Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Zudem fördert das BMBF den Dialog deutscher Forscherinnen und Forscher mit ihren internationalen Kollegen, zum Beispiel die bilaterale Kooperation mit dem renommierten California Institute for Regenerative Medicine (CIRM). Die vorliegende Broschüre gibt auf vielfältige Weise Einblicke in das faszinierende Forschungsfeld der regenerativen Medizin. Sie stellt aktuelle Forschungsansätze und neue Entwicklungen in den unterschiedlichen Anwendungsfeldern regenerativer Technologien vor. Informieren Sie sich über die Chancen, die die regenerative Medizin nicht nur Wissenschaft und Wirtschaft, sondern vor allem Patientinnen und Patienten eröffnet. Bundesministerin für Bildung und Forschung InHalt 1 Inhalt Regenerative Medizin im Überblick ................ 2 Die Leber im Labor nachbauen........................................ 32 Was ist Regenerative Medizin ? ....................................... 2 Mikrochip als Medikamententestsystem ................... 33 Mit Tissue Engineering zum Organersatz................... 5 Knochen und Knorpel: Zum wachstum anregen Stammzellen: zelluläre Multitalente .............. 7 ......................................... 34 Knorpelbildung im Körper stimulieren ........................ 36 Embryonale Stammzellen - die Alleskönner .............. 7 Knochenheilung mit Stammzellen ................................ 37 Nützliche Gewebestammzellen ..................................... 8 Reprogrammieren als neuer Weg ................................. 9 Regenerationstechnologien: Helfer für die Medizin ................................................ 13 nerven und Gehirn: Regenerationspotenzial ausloten .................. 38 Zellverluste bei Parkinson ersetzen .............................. 38 Künstliche Straßen für wachsende Nerven ............... 40 Bioreaktoren: Gewächshäuser für Gewebe ............... 16 Stammzellen im Gehirn gezielt nutzen ...................... 41 Hilfestellung für die Selbstheilung ................................ 17 Gezielt Erbanlagen reparieren ........................................ 18 Zebrafisch und Salamander: Von Modellen lernen .................................................. 19 neue tests: Gewebe als Ersatz zum tierversuch .............. 42 Zellkulturtests mit Prüfsiegel .......................................... 42 Organe auf dem Mikrochip ............................................... 45 Zebrafische regenerieren Herz und Gehirn ............... 19 Heilungsprozesse beim Lurch verstehen .................... 21 translation: Der schwierige weg in die Praxis ..................... 46 Haut: Kleine und große wunden heilen ...... 22 Kleine Unternehmen als Innovationsmotoren ........ 46 Wunden verschließen mit Ersatzgewebe ................... 22 Fünf Translationszentren bundesweit ......................... 47 Künstliche Hautproduktion im Akkord......................... 25 Klare Regeln für den europäischen Markt .................. 50 Herz: Schwache Pumpen ankurbeln ............... 26 Klinische Studien als große Herausforderung .......... 51 Herzmuskelzellen aus dem Labor .................................. 26 Fördermaßnahmen im Überblick Stammzelltherapie bei Herzinfarkt ............................... 27 Glossar Herzklappen wachsen im Bioreaktor............................ 28 weiterführende Publikationen des BMBF .. 57 Herzgewebe für die Wirkstoffforschung..................... 29 leber: Regenerationskraft ausnutzen ......... 30 Leberzellen aus Stammzellen gewinnen .................... 30 ..................... 53 ................................................................................... 54 2 REGEnERatIVE MEDIZIn IM ÜBERBlIcK Regenerative Medizin im Überblick Viele Krankheiten lassen sich behandeln, aber nicht heilen. Das gilt besonders für altersbedingte leiden, bei denen oft Zellen absterben und organfunktionen nachlassen. Die Regenerative Medizin kann erkranktes Gewebe wiederherstellen und funktionstüchtig machen. Dazu nutzt sie die Selbstheilungskräfte des Körpers. Ein großes Potenzial für die Medizin des 21. Jahrhunderts. Die Fähigkeit zur Regeneration ist lebensnotwendig. Unter Regeneration wird in der Biologie die Fähigkeit eines Organismus verstanden, verloren gegangene Körperteile und Körperfunktionen von Grund auf zu ersetzen – um so möglichst den gesunden Originalzustand wiederherzustellen. Diese Regenerationsfähigkeit besitzen prinzipiell alle Lebewesen – aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Die treibende Kraft dieser Selbstheilungsfähigkeit geht von den Zellen aus, die die betroffenen Gewebe und Organe aufbauen. Bei Menschen ist die Regenerationsfähigkeit gerade bei den Organen ausgeprägt, die in hohem Maße beansprucht werden: Knochenmark, Leber, die obere Hautschicht oder etwa die Darmschleimhaut werden ständig nachgebildet. Sogenannte Stammzellen sorgen in diesen Geweben ein Leben lang für Nachschub an neuen Zellen. In anderen menschlichen Organen ist dieses Potenzial jedoch stark eingeschränkt, wie etwa im Gehirn, im Herz und im Auge. Noch dazu bildet der Körper bei größeren Wunden Narbengewebe. So werden entstandene Defekte nur behelfsmäßig repariert, aber nicht regeneriert. W Innerhalb der Biomedizin gehört die Regenerative Medizin zu den Gebieten mit der stärksten Entwicklungsdynamik. Das spiegelt sich auch in den verschiedenen Versuchen wider, dieses Medizinkonzept in Worte zu fassen. Forscher haben sich bisher nicht auf eine offizielle Definition geeinigt. Prinzipiell gilt jedoch: Die Regenerative Medizin ist eine Heilkunst, die auf die Wiederherstellung funktionsgestörter Zellen, Gewebe oder Organe abzielt. Dies geschieht entweder durch Anregung der körpereigenen Regenerations- und Reparaturprozesse oder aber durch biologischen Ersatz in Form von lebenden Zellen oder eigens im Labor gezüchteten Geweben. Das Ziel Forscher in Hannover arbeiten daran, Herzgewebe künstlich herzustellen. Hier sind Herzmuskelzellen (grün mit blauem Zellkern) sowie Kollagenfasern (orange) zu sehen. ist immer gleich: Möglichst den gesunden und funktionalen Originalzustand eines betroffenen Gewebes wiederherzustellen, anstatt es nur behelfsmäßig zu ersetzen und zu reparieren. Heilen statt reparieren – das ist das Motto der Regenerationsmedizin. Lebende Zellen sind dabei das zentrale Werkzeug der Regenerativen Medizin. Sie liefern das Baumaterial für den angestrebten Organersatz und sie bewirken, dass regenerative Prozesse im Körper in Gang gesetzt werden. Auf diese Weise entstehen nicht nur Therapien, sondern auch neuartige Ansätze, um die Diagnostik von Krankheiten zu verbessern oder zellbasierte Testsysteme, um die Wirkung von Medikamenten zu prüfen. Als Forschungsdisziplin ist die Regenerative Medizin in hohem Maße multidisziplinär, denn sie verknüpft Ansätze der Zellbiologie, der Biotechnologie und der Pharmakologie mit Medizintechnik und Materialwissenschaften. Mit diversen Förderinitiativen, die all diese Forschungsdisziplinen adressieren, versucht das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), die dynamische Entwicklung auf diesem Feld voranzutreiben: Seit den 1990er Jahren werden dabei nicht nur akademische Forschungsprojekte, sondern auch vielversprechende Projekte von Unternehmen gezielt unterstützt. REGEnERatIVE MEDIZIn IM ÜBERBlIcK Die Erforschung der Selbstheilungskräfte des Körpers ist allerdings kein neues Phänomen. Schon seit der Antike beschäftigt Mediziner dieses Thema. Auch damals wollten sich die Ärzte diese Erkenntnisse für Therapien zunutze machen. Doch erst seit dem 19. Jahrhundert, als die Zellen als Ursache für Krankheiten in den Blick der Mediziner rückten, begannen Forscher damit, die Prozesse der Regeneration tatsächlich zu entschlüsseln. Deutsche Wissenschaftler gehörten dabei im frühen 20. Jahrhundert zu den Pionieren der Embryologie und Entwicklungsbiologie, die viel Grundlagenwissen für die Regenerative Medizin zutage gefördert haben. So untersuchen Entwicklungsbiologen die Mechanismen, die aus einer befruchteten Eizelle ein komplexes Lebewesen formen. Inzwischen ist bekannt, dass der voll entwickelte menschliche Organismus aus mehr als 200 verschiedenen Zelltypen besteht, die in Geweben und Organen organisiert sind und dort bestimmte Funktionen übernehmen. Obwohl diese Zellen alle die gleiche genetische Ausstattung besitzen, spezialisieren sie sich im Laufe ihrer Entwicklung und werden zu definierten Körperzellen. 3 Mit dem Siegeszug der Molekularbiologie in den 1970er Jahren begannen Genetiker und Zellbiologen damit, diesen auch als Differenzierung bezeichneten Prozess genauer zu untersuchen. Es zeigte sich, dass in den spezialisierten Zellen des Körpers eine deutlich geringere Zahl an Genen im Erbgut aktiv ist als etwa in befruchteten Eizellen. Lange Zeit gingen Forscher zudem davon aus, dass die einmal erlangte Spezialisierung einer Zelle ein unumkehrbares Schicksal ist. Diese Auffassung hat sich in den letzten Jahrzehnten durch die rasanten Entwicklungen in der Molekularbiologie, der Genom- und Stammzellforschung, der Fortpflanzungsmedizin sowie der Systembiologie grundlegend geändert. So ermöglichte die in vitro-Befruchtung – also die künstliche Befruchtung im Labor – bedeutende Untersuchungen zur Embryonalentwicklung. Im Jahr 1998 gelang es US-Forschern erstmals, menschliche embryonale Stammzellen zu gewinnen. Mit diesen Zellen, die sich nahezu unbegrenzt vermehren lassen und sich in viele verschiedene Zelltypen entwickeln kön- Forschungslandschaft Regenerative Medizin in Deutschland Mit der Regenerativen Medizin beschäftigen sich in Deutschland zahlreiche Forschergruppen, die über das ganze Land verteilt sind. Sie decken ein weites Spektrum an Wissenschaftsgebieten ab, angefangen bei der Biomedizin, der Biotechnologie, der Pharmakologie, der Medizintechnik und Materialwissenschaften. Die Wissenschaftler arbeiten in Hochschulen und Universitätskliniken, in Fachhochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Forschungsorganisationen (MaxPlanck, Helmholtz, Leibniz, Fraunhofer). Von besonderer Bedeutung für die Forschung und Umsetzung regenerativer Therapien in die klinische Praxis sind sogenannte Translationszentren, die in den vergangenen Jahren durch öffentliche Förderinitiativen eingerichtet wurden (vgl. S. 46 ff.). Solche Zentren gibt es mittlerweile in Berlin, Leipzig, Rostock (BMBF), Dresden und Hannover (DFG). Wichtige Standorte der Stammzellforschung sind zudem Bonn, München,Würzburg, Tübingen, Heidelberg und Münster. Forschungsstandorte der Regenerativen Medizin in Deutschland. 4 REGEnERatIVE MEDIZIn IM ÜBERBlIcK nen, bekamen die Forscher eine Möglichkeit an die Hand, in großen Mengen Zellen für die Grundlagenforschung zu gewinnen. Gleichzeitig entdeckten sie auch immer mehr neue Möglichkeiten bei anderen Stammzelltypen. So ist heute zunehmend ein Bild entstanden, dass selbst spezialisierte Zellen keine festgelegten Bausteine des Körpers sind, sondern wandelbare Gebilde, deren Verhalten beeinflussbar und umprogrammierbar ist. Die Stammzellforschung steht dabei in ganz besonderer Weise im Blickfeld der Öffentlichkeit – nicht zuletzt aufgrund ihrer ethischen Dimension, denn neue embryonale Stammzell-Linien können nur durch die Zerstörung von Embryonen gewonnen werden. Aus diesem Grund unterliegt die Stammzellforschung im Gegensatz zu anderen Forschungsfeldern in Deutschland vergleichsweise strengen Regeln, die Wissenschaftler einhalten müssen. Das 1991 in Kraft getretene Embryonenschutzgesetz verbietet die verbrauchende Embryonenforschung einschließlich der Verwendung von Embryonen zur Herstellung von Stammzellen. Das Stammzellgesetz von 2002 (novelliert im Jahr 2008) erlaubt deutschen Forschern nur unter strengen Voraussetzungen und nach Genehmigung durch das Robert Koch-Institut, embryonale Stammzellen aus dem Ausland zu Forschungszwecken zu importieren und zu verwenden. Von der Stammzelle zur therapie Aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften erforschen Wissenschaftler seit Ende der 90er Jahre das Potenzial von Stammzellen und ihren Einsatz in der Regenerativen Medizin. Deutsche Forscher werden dabei seit 1999 vom BMBF mit diversen Förderinitiativen unterstützt. Ging es dabei anfangs vor allem um Möglichkeiten für den Ersatz einzelner Organfunktionen bei verschiedenen volkswirtschaftlich relevanten Erkrankungen wie Parkinson, Diabetes oder Herzinfarkt, so liegt inzwischen ein Schwerpunkt auf Projekten, die nach ethisch unproblematischen Wegen für die Gewinnung von vielseitigen Stammzellen für medizinische Anwendungen suchen. Zwischen 2008 und 2013 werden diesbezüglich insgesamt 47 Vorhaben mit 15 Millionen Euro unterstützt. Hierbei erkunden Forscher entweder das Entwicklungspotenzial natürlich vorkommender Gewebestammzellen. Oder sie entwickeln Verfahren, mit denen sich Körperzellen künstlich in einen vielseitigen Zustand zurückprogrammieren lassen. Um auf der Basis dieser Erkenntnisse die Entwicklung zellbasierter Therapien voranzutreiben, werden zwischen 2005 und 2013 weitere Mittel in Höhe von mehr als 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Um die bislang in Deutschland aufgebauten Strukturen der grundlagenorientierten und angewandten Stammzellforschung sowohl national wie auch international gebündelt sichtbar zu machen und zu vertreten, soll 2012 ein „Deutsches Stammzellnetzwerk“ entstehen. Mithilfe einer solchen Dialogplattform ist auch geplant, die Nachwuchsförderung zu stärken und die rechtlichen sowie ethischen Rahmenbedingungen in diesem Forschungsfeld transparent darzustellen. Gleichzeitig soll die Translation von Ergebnissen gezielt unerstützt werden. Zum Start der Plattform stellt das BMBF eine Anschubfinanzierung zur Verfügung. Angefärbte Herzmuskelzellen in der Kulturschale: Künftig lassen sich womöglich derartige Zellen aus Stammzellen gewinnen. Mehr Informationen: www.bmbf.de/de/1084.php www.ptj.de/stammzellnetz REGEnERatIVE MEDIZIn IM ÜBERBlIcK 5 Neben der Forschung an embryonalen Stammzellen wurden in den letzten Jahrzehnten durch staatliche Förderprogramme besonders die Forschungen zu alternativen Quellen von Stammzellen intensiviert. Dadurch ist insbesondere in Deutschland im Bereich der adulten Stammzellforschung eine große wissenschaftliche Expertise entstanden. Die größte Herausforderung besteht nun darin, die vielen wissenschaftlichen Erkenntnisse in weiterführende Strategien für medizinische Forschung und Anwendungen zu überführen (vgl. Kapitel Stammzellen). Mit tissue Engineering zum organersatz Entscheidene Impulse für den Fortschritt in der Regenerativen Medizin, insbesondere was die Bereitstellung von Organen betrifft, kommen aber nicht nur aus der Stammzellforschung, sondern auch aus dem Bereich der Chirurgie. So gelang Ärzten in Boston in den 1950er Jahren die erste erfolgreiche Nierentransplantation. 1967 glückte die erste Verpflanzung eines Herzens. Wenige Jahre später meldeten Ärzte die erste erfolgreiche Knochenmarktransplantation. Seit es Mediziner schaffen, mit Medikamenten die Immunabwehr zu unterdrücken und so eine Abstoßung körperfremder Organe zu verhindern, hat sich die Transplantationsmedizin zu einem Eckpfeiler der Hightech-Medizin entwickelt. Sie sichert heute das Überleben vieler Patienten mit erkrankten oder verletzten Organen. Doch Spenderorgane sind knapp und können den stetig steigenden Bedarf nicht decken. Allein in Deutschland werden zurzeit schätzungsweise doppelt so viele Transplantationsorgane gebraucht wie zur Verfügung stehen. Die Wartelisten sind lang, viele Patienten überleben die Wartezeit nicht. Auf der Suche nach Alternativen begannen Biotechnologen deshalb in den 1990er Jahren verstärkt damit, lebendes Ersatzgewebe im Labor heranzuzüchten. Dies wird als sogenanntes Tissue Engineering bezeichnet, das heute als wichtiger Bereich der Regenerativen Medizin gilt. Ein immer tieferes Verständnis der Zellbiologie und die Verwendung immer ausgeklügelter Gerüstmaterialien, auf denen mithilfe menschlicher Zellen neue Gewebe und Organe heranwachsen können, haben hier inzwischen für bedeutende Fortschritte gesorgt, wenngleich das Organ auf Bestellung für jedermann noch in ferner Zukunft liegt. Frisch isolierte Stammzellen aus dem Knochenmark werden Patienten nach einem Herzinfarkt in den betroffenen Herzmuskelbereich gespritzt. Dort sollen sie die Regeneration ankurbeln. Die Potenziale der Regenerativen Medizin sind also groß. Der Fokus auf die Regenerationsfähigkeiten des Körpers könnte dabei helfen, viele drängende Probleme der medizinischen Versorgung zu lösen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wird der Regenerativen Medizin deshalb eine vielversprechende Zukunft prognostiziert, insbesondere für Industrienationen wie Deutschland. So nehmen mit dem demographischen Wandel auch hierzulande altersbedingte Krankheiten immer mehr zu: Bestimmte Organfunktionen lassen nach und die Zahl körperlicher Gebrechen steigt. Es sind Leiden wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Alzheimer, aber auch Nierenversagen, Diabetes sowie Gelenkverschleiß, die zu den Volkskrankheiten in Deutschland gehören. Eine Heilung ist dabei selten in Sicht. Zumeist müssen die Patienten für den Rest des Lebens Medikamente einnehmen. Doch diese können lediglich Symptome lindern und den Krankheitsverlauf verlangsamen. Oft sind mit der Einnahme auch unerwünschte Nebenwirkungen verbunden. Die Lebensqualität der Patienten bleibt deshalb meist eingeschränkt. In schweren Fällen sind Prothesen oder sogar Organtransplantationen die einzige Alternative. Solche Eingriffe sind zudem mit hohen Behandlungskosten verbunden. Die Vision der Regenerativen Medizin ist es, die medizinischen Probleme nicht nur symptomatisch zu behandeln, sondern tatsächlich die Ursache zu bekämpfen und zu heilen. Erste Fortschritte in den 6 REGEnERatIVE MEDIZIn IM ÜBERBlIcK Bereichen Haut (vgl. S. 22 ff.), Knochen (vgl. S. 34 ff.), Herz (vgl. S. 26 ff.), Leber (vgl. S. 30 ff.) und Nerven (vgl. S. 38 ff.) zeigen, dass die Wissenschaft für eine Vielzahl von Krankheiten bereits an vielversprechenden Behandlungsstrategien arbeitet. Zugleich steigt das Wissen über grundsätzliche Regenerationsprozesse in Modellorganismen wie Salamander oder Zebrafisch (vgl. S. 19 ff.). Die Forschung in Deutschland ist dabei sehr breit aufgestellt – sei es in der Grundlagenforschung oder der Anwendung regenerativer Therapien. Mit international renommierten Wissenschaftlern gehört Deutschland zu den weltweit führenden Nationen im Bereich der Regenerativen Medizin. Besondere Stärken gibt es traditionell im medizintechnischen Bereich, der Zellkulturtechnologie und der Gewebezüchtung. In der Stammzellforschung baut Deutschland auf jahrzehntelanger Expertise in der Entwicklungsbiologie und bei Zelltherapien auf. Dies spiegelt sich in einer hohen Dichte an Forschungseinrichtungen und klinischen Zentren wider. Darüber hinaus ist die Anwendungsorientierung der Forschng in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So wurden auf Initiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie des BMBF interdisziplinäre Forschungszentren gegründet, deren Ziel es ist, Ideen aus dem Labor möglichst schnell für Patientinnen und Patienten verfügbar zu machen (vgl. S. 46 ff.). Darüber hinaus wird im Rahmen internationaler Kooperationen die Zusammenarbeit deutscher Forscher mit Kollegen aus dem Ausland gefördert. All dies wiederum wird dazu führen, dass noch mehr Unternehmen Ansätze aus der Regenerativen Medizin aufgreifen. Um für die Zukunft gewappnet zu sein, hat das BMBF zudem langfristig angelegte Strategieprozesse in den Bereichen Biotechnologie und Medizintechnik initiiert, in denen die Regenerative Medizin auch eine Rolle spielt (vgl. S. 53). Hier werden schon heute Forschungs- und Entwicklungsroadmaps für die Zukunft erarbeitet. Regenerationstechnologien: Der weg in die klinische Praxis Die Regenerative Medizin ist ein dynamisches Forschungsgebiet, bei dem Spezialisten aus Biologie, Chemie, Physik, Materialforschung, Geräte- und Verfahrenstechnologie, Informatik, und Medizin zusammenarbeiten. Eine wichtige Triebfeder sind dabei mittelständische Biotechnologie- und Medizintechnik-Unternehmen (KMU), die die Anwendungsmöglichkeiten der Regenerationstechnologien für Therapien oder Diagnostika ständig vorantreiben. Seit dem Jahr 2000 werden Einige Biotechnologie-Unternehmen haben sich darauf spezialisiert, Gewebe für verschiedenste Anwendungen zu züchten. sie dabei vom BMBF unterstützt – insbesondere bei risikoreichen Projekten im Bereich der Gewebeherstellung (Tissue Engineering). Bis 2007 hat das BMBF dabei insgesamt 43 Millionen Euro investiert. Erste Anwendungen, etwa Produkte für die Regeneration von Haut oder Knorpel, befinden sich bereits im klinischen Einsatz. Die Erfahrungen der ersten Jahre haben jedoch gezeigt, dass noch zahlreiche Hürden zu meistern sind, bis Regenerationstechnologien tatsächlich breit eingesetzt werden. An klinische Studien sowie die Zulassung werden in diesem Feld inzwischen hohe Anforderungen gestellt. Deshalb fördert das BMBF seit 2008 auch die Entwicklung neuer und zuverlässiger Prüf- und Standardisierungsverfahren für Produkte der Regenerativen Medizin, um gravierende Innovationshemmnisse aus dem Weg zu räumen und den Nutzen regenerativer Therapien künftig bewerten zu können. Insgesamt 15 Millionen Euro fließen dabei in Verbundprojekte von Wissenschaft und Wirtschaft. Mehr Informationen: www.ptj.de/regenerative-technologien StaMMZEllEn: ZElluläRE MultItalEntE 7 Stammzellen: zelluläre Multitalente Stammzellen sind im Körper die treibenden Kräfte für Entwicklung und Regeneration. Da aus ihnen neue Zellen hervorgehen, sind sie auch die zentrale Materialquelle für die Regenerative Medizin. Je nach Herkunft sind Stammzellen unterschiedlich vielseitig. In Deutschland regelt ein striktes Stammzellgesetz die Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen. Gewebestammzellen und künstlich im labor gewonnene Stammzellen sind in den Fokus der Forscher geraten. Die „Familie“ der Stammzellen ist groß: Sie unterscheiden sich in ihrem Entwicklungsvermögen und lassen sich auf verschiedenen Wegen gewinnen. Einfach formuliert ist eine Stammzelle eine Zelle, von der andere Zellen im Körper abstammen. Im Vergleich zu hochspezialisierten Körperzellen sind Stammzellen weniger stark auf eine bestimmte Entwicklungsrichtung festgelegt. Durch Zellteilung sind sie in der Lage, eine sich spezialisierende Tochterzelle und eine Stammzelle zu erzeugen, wodurch sie sich selbst erhalten. Mithilfe von Stammzellen wächst und erneuert sich der Organismus ein Leben lang, Wunden und innere Schäden heilen aus eigener Kraft. Die Medizin versucht, die Heilkraft der Stammzellen zu verstehen und gezielt therapeutisch zu nutzen. Die Herkunft der Stammzellen ist dabei entscheidend für eine mögliche Anwendung. Der Stammzell-Typ entscheidet auch, wie Forscher mit den Multitalenten umgehen dürfen. Embryonale Stammzellen – die alleskönner Aus einer befruchteten Eizelle gehen bis zum 8-ZellStadium Tochterzellen hervor, die totipotent sind. Jede für sich hat das Entwicklungspotenzial, einen kompletten Organismus aufzubauen. Etwa fünf Tage nach der Befruchtung der Eizelle hat sich der Embryo zu einem kugeligen Zellgebilde entwickelt, der Blastozyste. Aus der inneren Zellmasse der Blastozyste lassen sich embryonale Stammzellen (ES-Zellen) gewinnen. Sie gelten als zelluläre Alleskönner. ES-Zellen sind pluripotent: Sie besitzen also grundsätzlich die Fähigkeit, noch alle Gewebe des menschlichen Körpers bilden zu können (mit Ausnahme des Plazentagewebes). Aus ihnen kann sich kein vollständiger Organismus mehr entwickeln, wie das bei totipotenten Zellen der Fall ist. Humane embryonale Stammzellen unter dem Mikroskop. Damit Wissenschaftler mit ES-Zellen arbeiten können, werden sie in Kulturschalen übertragen, die mit einer speziellen Nährlösung gefüllt sind. Hier vermehren sie sich zu mehreren hundert Zellen, die wiederum in neue Kulturschalen überführt werden, so dass aus wenigen embryonalen Stammzellen schließlich Abermillionen entstehen. Bei geeigneter Stimulierung mit einem Cocktail aus Wachstumsfaktoren lassen sie sich in jeden erdenklichen der 200 menschlichen Zelltypen verwandeln. Somit sind ES-Zellen eine schier unerschöpfliche Quelle, mit deren Hilfe sich Gewebe im Labor nachzüchten lässt, um verschiedenste Fragestellungen zu beantworten. Diese Züchtung aber kontrolliert zu erreichen, ist für Forscher immer noch eine große Herausforderung. Umstritten sind menschliche ES-Zellen, da zur Gewinnung neuer Stammzelllinien Embryonen zerstört werden müssen. Deshalb wird die Herstellung und Verwendung von humanen ES-Zellen ethisch kontrovers diskutiert. Verschiedene Länder auf der Welt haben politisch und rechtlich unterschiedliche Lösungen für den Umgang mit Embryonen und Stammzellen gefunden. In Deutschland sorgt das Embryonenschutzgesetz für einen strikten Schutz des Embryos und verbietet das Herstellen menschlicher Embryonen zu Forschungszwecken sowie die verbrauchende Embryonenforschung einschließlich der Herstellung von menschlichen ES-Zellen. Zusätzlich regelt das Stammzellgesetz den möglichen Import und die Verwendung von menschlichen ESZellen aus dem Ausland. Solche ES-Zelllinien müssen schon vor einem gesetzlich festgelegten Stichtag gewonnen worden sein (1. Mai 2007). Darüber hinaus dürfen sie nur für Forschungszwecke importiert und 8 verwandt werden, die hochrangig und auf anderem Wege voraussichtlich nicht zu erreichen sind (siehe Kasten rechts). Ebenso wie bei der Nutzung anderer Zellen mit vergleichbarem Potenzial müssen die Forscher sicherstellen, dass die aus den menschlichen ES-Zellen herangezüchteten Zellen sich im Körper nicht plötzlich unkontrolliert vermehren. Aus den ES-Zellen gewonnene Zelltypen können nach einer Transplantation vom Empfänger als fremd erkannt werden. In diesem Fall können, wie bei Transplantationen von Organen, gefährlichen Abstoßungsreaktionen auftreten. Wissenschaftler weltweit forschen daher daran, diese potenziellen Immunreaktionen zu beherrschen. In den USA und in Großbritannien wurden bereits erste klinische Studien mit aus ES-Zellen abgeleiteten Präparaten gestartet. Das Biotechnologie-Unternehmen Advanced Cell Technology (ACT) erprobt hierbei aus ES-Zellen entwickelte Pigmentepithelzellen, die zur Behandlung einer Augenerkrankung eingesetzt werden. Neben der klinischen Anwendung dienen ES-Zellen heute schon als Basis für Krankheitsmodelle oder bei der Identifizierung und Suche neuer Wirkstoffe. N Neben den ES-Zellen sind adulte Stammzellen oder Gewebestammzellen die zweite große Gruppe an Stammzellen. Sie sind in zahlreichen Geweben von erwachsenen Menschen vorhanden und sitzen dort in speziellen Nischen, um auf ihren Einsatz zu warten. Adulte Stammzellen sind die Reparaturreserve des jeweiligen Gewebes. Sie sorgen für den nötigen Zell-Nachschub, wenn im Gewebe Zellen absterben und ersetzt werden müssen. So treiben sie die Erneuerung und die Wundheilung an. Adulte Stammzellen sind allerdings in ihrem Entwicklungspotenzial eingeschränkt, sie gelten deshalb als multipotent, weil ihre Abkömmlinge nur noch zu wenigen Zelltypen heranreifen können. Dank neuester Methoden haben Forscher inzwischen an immer mehr Stellen im Körper die vor Ort zuständigen Gewebestammzellen entdeckt. Im Blut, der Haut und im Darm sind sie besonders aktiv, da diese Organe sich ständig erneuern. Doch auch in Orten, die nur bescheidene Regenerationsfähigkeiten besitzen, wie im Gehirn, wurden Forscher bereits fündig. Problem: Viele adulte Stammzellen sind nur mit großem Aufwand zu gewinnen und ihre Zucht StaMMZEllEn: ZElluläRE MultItalEntE Ein Gesetz für die Stammzellforschung Nachdem US-Forscher 1998 erstmals menschliche embryonale Stammzellen (ES-Zellen) gewonnen hatten, setzte auch in Deutschland eine bioethische Debatte ein. Bei der Herstellung von ES-Zellen müssen Embryonen zerstört werden, die bei künstlichen Befruchtungen übrig geblieben sind. Das deutsche Embryonenschutzgesetz stellt den Embryo unter strikten Schutz und verbietet das Herstellen von Embryonen zu Forschungszwecken sowie die verbrauchende Embryonenforschung. Um trotzdem Forschung an menschlichen ES-Zellen zu ermöglichen, gleichzeitig aber zu verhindern, dass von Deutschland aus ein Anreiz ausgeht, im Ausland weiterhin Embryonen zu zerstören, verabschiedete der Bundestag im Jahr 2002 das „Gesetz zur Sicherstellung des Embryonenschutzes im Zusammenhang mit Einfuhr und Verwendung menschlicher Stammzellen“. Demnach dürfen Forscher nur unter strikten Auflagen ES-Zellen aus dem Ausland einführen und verwenden. Diese Stammzellen müssen aber vor einem gesetzlich bestimmten Stichtag erzeugt worden sein. Um den Forschern die Möglichkeit zu geben, für ihre im internationalen Rahmen stattfindenden Arbeiten auf zwischenzeitlich erheblich verbesserte und stabilere Stammzelllinien zurückzugreifen, einigte sich der Bundestag 2008 in einer Gesetzesnovelle darauf, den Stichtag vom 1. Januar 2002 auf den 1. Mai 2007 zu verlegen. Jede Einfuhr und Verwendung menschlicher ES-Zellen in Deutschland muss vom Robert-Koch Institut (RKI) genehmigt werden. Zur Entscheidung über einen Antrag holt das RKI eine Stellungnahme der Zentralen Ethik-Kommission für die Stammzellenforschung (ZES) ein. Die ZES prüft und bewertet, ob das Forschungsvorhaben die Voraussetzungen nach § 5 StZG erfüllt und in diesem Sinne ethisch vertretbar ist. Bis Frühjahr 2012 hat das RKI auf diese Weise seit Bestehen des Stammzellgesetzes 70 Projekte genehmigt. Insgesamt arbeiteten 54 Wissenschaftlergruppen zu diesem Zeitpunkt mit humanen ES-Zellen. StaMMZEllEn: ZElluläRE MultItalEntE im Labor gestaltet sich oft schwierig. Die Vorteile: Weil sie im erwachsenen Körper vorkommen, sind sie nicht nur ethisch unproblematisch, sondern auch einfacher für therapeutische Zwecke nutzbar. So könnten adulte Stammzellen direkt vom Patienten gewonnen und für eine Behandlung optimiert werden. Ihr Einsatz führt auch nicht zu Abstoßungen durch das Immunsystem. So arbeiten Forscher derzeit unter anderem daran, adulte Stammzellen bei der Behandlung von Herzinfarkt einzusetzen – zum Beispiel an der Universität Frankfurt sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München. In Rostock wurde darüber hinaus mit Unterstützung des BMBF ein eigens darauf spezialisiertes Zentrum eingerichtet (vgl. Kapitel Herz und Translation). Eine besonders reiche und gut zugängliche Quelle für adulte Stammzellen ist das Knochenmark. Hier kommen unter anderen die Blutstammzellen vor und die mesenchymalen Stammzellen, die Vorläuferzellen für Knorpel-, Fett- und Knochengewebe darstellen. Gerade die mesenchymalen Stammzellen haben in den vergangenen Jahren die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen: Innerhalb der Gruppe der adulten Stammzellen scheinen sie besonders vielseitig zu sein und setzen in ihrer Umgebung offenbar einen Cocktail an Wachstumsfaktoren frei, der die Heilung verschiedener Gewebe anregen kann. Als weitere Quelle für adulte Stammzellen kommt das Nabelschnurblut von Neugeborenen in Frage. Hierin finden sich besonders junge, vermehrungsfähige Gewebestammzellen, die sich in vergleichweise viele Körperzelltypen differenzieren können. Sie haben die Fähigkeit, sich neben Blutzellen auch zu Nerven, Leber, Muskel, Knochen- oder Inselzellen zu entwickeln. Doch in jeder Nabelschnur stecken nur etwa 50 Milliliter Blut, zu wenig für eine spätere Therapie. In einem vom BMBF geförderten Forschungsverbund suchen Wissenschaftler aus Würzburg, Aachen und Hannover deshalb nach Rezepten, mit denen sich die Zahl der Stammzellen aus dem Nabelschnurblut vervielfachen lässt. Reprogrammieren als neuer weg Weder embryonale noch adulte Stammzellen haben Forscher bislang komplett zufriedengestellt. Aus diesem Grund wird seit langem nach Alternativen gesucht – zum Beispiel, indem Zellen künstlich in eine Art embryonalen Alleskönnerzustand 9 Adulte Stammzellen in Kultur. zurückversetzt werden. Diese „Reprogrammierung“ ist japanischen Forschern im Jahr 2006 erstmals gelungen. Sie wandelten ausgereifte Hautzellen von Mäusen durch gentechnische Tricks so um, dass sie sich wie embryonale Stammzellen verhielten. Das künstlich erzeugte Ergebnis nannten sie induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen). Die damaligen Experimente haben für einen Paukenschlag in der Wissenschaft gesorgt. Denn das Rezept für die Verwandlung ist fast zu einfach, um wahr zu sein: Lediglich ein Cocktail aus den vier Genen namens Oct4, Sox2, c-Myc und Klf4 wurde mithilfe von Viren in die Körperzellen eingeschleust. Dies reichte aus, um in den ausgereiften Zellen eigentlich stillgelegte Erbgutabschnitte zu aktivieren und so das embryonale Genaktivitäts-Programm wieder anzuschalten. Im Jahr 2007 gelang den japanischen Forschern dieselbe Verjüngungskur auch bei menschlichen Hautzellen. Seither entwickelt sich die Reprogrammierungstechnik in rasantem Tempo weiter und wird immer praxisfreundlicher und sicherer: Ein deutsches Team um Hans Schöler vom Max-PlanckInstitut für molekulare Biomedizin in Münster hat es geschafft, adulte Stammzellen von Mäusen und Menschen nur mit einem Gen (Oct4) zu iPS-Zellen umzuprogrammieren. Dann schafften es die Forscher, beim Einschleusen der Faktoren auf Viren als Genfähre und andere gentechnische Methoden zu verzichten. Offenbar reicht es aus, die Verjüngungsfaktoren in Form von Proteinen den Zellen zu verabreichen, um sie zu reprogrammieren. Aus diesem Grund nannten sie die verwandelten Zellen protein-induzierte pluripotente Stammzellen (piPS). … Blastozyste Inselzellen Blutzellen pluripotent Herzmuskelzellen innere Zellmasse Embryo embryonale Stammzellen Spermium Eizelle In vitro-Befruchtung Wie Stammzellen gewonnen werden PluripotenzFaktoren Nervenzellen Leberzellen induzierte pluripotente Stammzellen Körperzellen (z. B. Haut) Reprogrammieren … Knorpelzellen Bindegewebszellen multipotent adulte Stammzellen Aufreinigung der Stammzellen Entnahme von Stammzellen (z. B. aus dem Knochenmark) Isolierung von Gewebestammzellen 10 StaMMZEllEn: ZElluläRE MultItalEntE StaMMZEllEn: ZElluläRE MultItalEntE 11 Nun tüfteln Stammzellforscher weltweit an weiteren Verfahren, um die Herstellung von iPS-Zellen effizienter zu machen. Denn im Labor wird ungefähr nur bei einem Prozent der behandelten Zellen eine Reprogrammierung erreicht. Gleichzeitig wird derzeit ausgiebig getestet, wie ähnlich sie in ihren Eigenschaften den natürlichen pluripotenten Stammzellen wirklich sind. Die Weiterentwicklung der iPS-Technologien steht auch im Fokus des künftigen Centrums für angewandte Regenerationstechnologien (CARE), das an das Münsteraner Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin angedockt sein soll. Künstlich erzeugte induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) ballen sich zu einer Kolonie zusammen. Den iPS-Zellen wird ein hohes Potenzial zuerkannt, denn die Forschung an ihnen vermeidet den Verbrauch menschlicher Embryonen zur Generierung neuer Stammzelllinien. Da die iPS-Zellen aus winzigen Gewebeproben der Patienten selbst gewonnen werden können, werden aus ihnen hergestellte Zellen bei einer späteren Therapie nicht vom Immunsystem als fremd erkannt. Neuere Studien haben im Tierexperiment ergeben, dass auch von iPS-Zellen abgeleitetes Gewebe in manchen Fällen Immunreaktionen hervorrufen kann, was Forscher vor allem auf die Herstellungsmethoden zurückführen. Ein weiteres Problem: Die verwendeten Körperzellen der Patienten haben durch den Alterungsprozess bereits Mutationen in ihrer Erbinformation angesammelt. Europäisches Stammzellregister Forscher, die in Deutschland an menschlichen ES-Zellen forschen wollen, können diese gemäß dem Stammzellgesetz aus dem Ausland importieren. In anderen EU-Ländern, wie Belgien, Spanien, Großbritannien und Schweden, ist die ES-Zellgewinnung hingegen erlaubt. Einmal hergestellt, lassen sich ES-Zellen nahezu beliebig lange in Form sogenannter Zelllinien aufbewahren und verschicken. Doch die existierenden Linien unterscheiden sich erheblich in Alter und Qualität. Um Forschern einen Überblick zu verschaffen, werden die Daten zu Zelleigenschaften in Internet-Datenbanken katalogisiert, eine davon ist das mit EU-Fördermitteln aufgebaute europäische Stammzellregister hESCreg, das vom Berlin-Brandenburg Centrum für Regenerative Therapien (BCRT) und einer Stammzell-Einrichtung in Barcelona geführt wird. Hier sind mehr als 650 ES-Zelllinien verzeichnet. Forscher können so prüfen, ob die verfügbaren Zellen zu ihren Experimenten und zu ihrer Gesetzeslage passen. Mehr Informationen: www.hescreg.eu Das Beispiel zeigt: Die alternativen Verfahren zur Herstellung pluripotenter Stammzellen sind noch junge Entwicklungen. Es besteht noch reichlich Forschungsbedarf, um sie differenziert bewerten zu können. Noch ist nicht klar, wie sicher diese Zellen bei einem möglichen therapeutischen Einsatz wären und ob sie tatsächlich mit humanen ES-Zellen vergleichbar sind. Um herauszufinden, welcher Zelltyp sich als „Goldstandard“ für bestimmte Fragestellungen durchsetzen wird, verfolgen Forscher weltweit verschiedene Ansätze und vergleichen sie miteinander. Gleichzeitig geht auch die Suche nach weiteren Stammzellquellen im Körper voran. Ein Beispiel sind amniotische Stammzellen, die sich in großer Zahl im Fruchtwasser wiederfinden. Für ihre Gewinnung ist weder die Arbeit mit Embryonen, noch eine Reprogrammierung notwendig. Ob diese Zellen jedoch über ein vergleichbares Differenzierungspotenzial wie ES- oder iPS-Zellen verfügen, ist noch unklar. Eine neue Entwicklung aus den Stammzelllabors ist die direkte Reprogrammierung. Hierbei ist es gelungen, durch genetische und biochemische Kommandos verschiedene Zelltypen ineinander umzuwandeln, ohne den Umweg über Stammzellen zu gehen. So ist es bereits gelungen, Hautzellen direkt in Nervenzellen umzuwandeln. Die Stammzellforschung bleibt ein hochdynamisches Feld der biomedizinischen Forschung. 12 StaMMZEllEn: ZElluläRE MultItalEntE wie sich Stammzellen für die Medizin nutzen lassen Stammzellen haben ein vielseitiges Potenzial für die Medizin. Biomediziner wollen sie im Labor gezielt zu einem speziellen Zelltyp oder zu Geweben heranreifen lassen. Wenn diese Rezepturen ausreichend sicher sind, dann sehen Experten drei Anwendungsbereiche: Krankheitsmodelle in der Petrischale: Krankheiten können besser erforscht werden, da die betroffenen Zelltypen eines Patienten mihilfe von Stammzellen im Labor herangezüchtet und beobachtet werden können. Forscher können so den Stoffwechsel und die Genaktivität in kranken Zellen untersuchen und die molekularen Ursachen der Krankheiten besser verstehen. Vor allem schwierig zu erforschende Leiden wie die Amyotrophe Lateralsklerose, Krebs oder Schizophrenie werden so besser zugänglich. wirkstoffsuche und arzneitests: An aus Stammzellen gezüchteten Herz-, Leber- oder Nervenzellen lassen sich chemische Substanzen und Medikamente auf Giftigkeit und andere Nebenwirkungen in hoher Stückzahl testen. So können Pharmahersteller schon früh in der Medikamentenentwicklung aussagekräftigere Schlüsse ziehen und womöglich Tierversuche reduzieren. Eine Vision für die personalisierte Medizin: An nachgezüchteten Zellen eines Patienten könnte man durch Tests ermitteln, welche Therapie zu ihm am besten passt. b) Adulte Stammzellen: Eine klinische Anwendung von adulten Stammzellen ist bei der Behandlung von Leukämien bereits seit Jahrzehnten klinische Routine. Durch die Transplantation von immunologisch passenden Stammzellen eines Spenders kann das Blutbildungssystem eines Krebskranken wieder neu aufgebaut werden. Körpereigene Stammzellen aus dem Knochenmark scheinen sich zudem – in krankes Gewebe injiziert – für eine Therapie zu eignen, indem sie vor Ort die körpereigene Regeneration ankurbeln. Eine weitere mögliche Anwendung: Forscher wollen Stammzellvorkommen in erkrankten Organen durch Medikamente von außen gezielt zur Teilung anregen, um so die Regeneration zu fördern. c) induzierte pluripotente Stammzellen: Noch ist unklar, ob sich diese umprogrammierten Zellen direkt für therapeutische Zwecke nutzen lassen. Vermutlich werden iPS-Zellen eher bei der Wirkstoffsuche und für Arzneitests zum Einsatz kommen. Zelltherapie: a) Embryonale Stammzellen: Bei Erkrankungen wie Parkinson, Herzinfarkt oder Diabetes werden ganz bestimmte Zelltypen im Körper zerstört und können sich nicht von alleine regenerieren. Im Labor nachgezüchtete Zellen sollen in die betroffenen Organe transplantiert werden, um dort die verlorengegangene Funktion zu ersetzen. Bisher sind auf ES-Zellen aufbauende Zellersatztherapien vor allem an Tiermodellen durchgeführt worden. Für den Einsatz beim Menschen sind noch viele Sicherheits- und Nutzenaspekte zu klären. Erste Patientenstudien mit ES-Zellpräparaten sind jedoch bereits gestartet. Aus Stammzellen wollen Forscher Beta-Zellen gewinnen, die in der Bauchspeicheldrüse für die Produktion von Insulin sorgen. REGEnERatIonStEcHnoloGIEn: HElFER FÜR DIE MEDIZIn 13 Regenerationstechnologien: Helfer für die Medizin Die Regenerative Medizin zielt darauf ab, geschädigte Zellen, Gewebe oder organe im Körper zu ersetzen oder zu erneuern, um sie wieder funktionstüchtig zu machen. Diese Verfahren bedienen sich lebender Zellen, die im labor herangezüchtet werden müssen. Dabei kommt ein vielseitiger Mix an Methoden aus der Zell- und Molekularbiologie sowie den Ingenieurs- und Materialwissenschaften zum Einsatz, die unter dem oberbegriff Regenerationstechnologien zusammengefasst werden können. Innerhalb der Regenerativen Medizin wollen Wissenschaftler nicht nur verstehen, wie Selbstheilungsprozesse des Körpers funktionieren. Sie wollen dieses Wissen auch gezielt anwenden, um erkrankte oder verletzte Zellen, Gewebe oder Organe zu heilen, teilweise wieder herzustellen oder ihre Regeneration zu unterstützen. Mit diesem Ansatz verbinden Ärzte nicht nur die Hoffnung, aufwendige Organtransplantationen, rein technische Lösungen wie Prothesen oder etwa lebenslange Medikamententherapien zu vermeiden. Bisher nicht behandelbare Erkrankungen oder Verletzungen sollen – so die Hoffnung – auch aus eigener Kraft geheilt werden. Aus Polymeren lassen sich feine Fäden spinnen, die mit lebenden Zellen besiedelt werden können. Wichtigstes Werkzeug der Regenerativen Medizin sind lebende Zellen, die für den Einsatz in einer Therapie noch mit Wirkstoffen oder Biomaterialien kombiniert werden. Die Zellen werden entweder selbst innerhalb des Körpers zur Erneuerung angeregt oder aber im Labor zu Ersatzgewebe herangezüchtet. Für die Entwicklung dieser neuartigen Behandlungsstrategien arbeiten Forscher aus den verschiedensten Wissenschaftszweigen zusammen – von der Biomedizin, der Biomaterialforschung, den Ingenieurswissenschaften bis hin zu einzelnen Disziplinen in der Chirurgie. Zu den Regenerationstechnologien werden vier wichtige Bereiche gezählt : • Gewebeherstellung (tissue Engineering) • Zelltherapie • anregung körpereigener Regeneration (induzierte autoregeneration) • Gentherapie Für die Regenerative Medizin ist das Heranzüchten von einzelnen Zellen und Zellverbänden im Labor von zentraler Bedeutung. Sie können einerseits als Ersatzgewebe eingesetzt werden, andererseits aber auch als Modell dienen, um die Funktionsweise von Organen besser zu verstehen. Darüber hinaus eignet sich im Labor erstelltes Gewebe auch für Medikamententests, um Nebenwirkungen im Modell zu erforschen (vgl. Kapitel Neue Tests), oder für die Suche nach neuen Wirkstoffen in der Medizin. Die künstliche Herstellung von Geweben in der Kulturschale wird Tissue Engineering genannt. Dieses auch als in vitro -Gewebezüchtung bezeichnete Feld ist ein noch junges Forschungsgebiet. Erst 1975 gelang es Forschern, menschliche Hautzellen im Labor künstlich zu vermehren. Seitdem macht die Disziplin große Fortschritte. Heute wird versucht, möglichst dreidimensionale, organähnliche Gebilde aus verschiedenen Gewebetypen nachzuahmen. Für einige einfach aufgebaute Ersatzgewebe wie die Oberhaut, Knochen und Knorpel hat die aufwendige Gewebetechnik bereits erste klinische Verfahren hervorgebracht. Doch das Züchten von Zellen und ihre Kultivierung im Labor ist ausgesprochen schwierig und technisch anspruchsvoll. Dafür müs- 14 REGEnERatIonStEcHnoloGIEn: HElFER FÜR DIE MEDIZIn tissue Engineering – wie Gewebe im labor gezüchtet wird 1. Biopsie, Zellisolierung entnommene Zellen 2. Zellvermehrung Patient 4. Implantation Trägerstruktur 3. Besiedelung und Wachstum im Bioreaktor sen unterschiedliche Experten aus Lebenswissenschaften, Material- und Ingenieurswissenschaften zusammenarbeiten. So genannte biologisch-künstliche (bioartifizielle) Gewebe oder Organe werden in drei Schritten hergestellt (siehe Grafik oben): Zellen eines bestimmten Typs werden zunächst gewonnen und vermehrt. Im Labor werden sie auf speziellen Gerüstmaterialien angesiedelt. In Kultursystemen, den sogenannten Bioreaktoren, werden die Zellen versorgt und zu Gewebeverbänden herangezüchtet, bis sie als funktionstüchtiges Transplantat wieder in den Patienten zurückverpflanzt werden können. Die Gewinnung von Zellmaterial ist beim Tissue Engineering der entscheidende Ausgangspunkt. In der Regel werden organspezifische Zellen verwendet, die vom Patienten selbst stammen. Diese – auch autolog genannten – Zellen liefern letztlich Transplantate, die vom Körper nicht abgestoßen werden. Stammen die Zellen von anderen Menschen- wie etwa bei embryonalen Stammzellen, spricht man von allogenen Zellen. Zellen von Tieren, die für Menschen verwendet werden, nennen sich xenogene Transplantate. Hierzu gibt es inzwischen auch ein eigenes Forschungsgebiet – die Xenotransplantation. Geeignetes Zellmaterial für Gewebetechnologen zu finden, ist nicht so einfach. So gestaltet sich zum Beispiel die Verwendung von ausgereiften Gewebezellen meist schwierig: Sie sind oft nur mit hohem Aufwand zu gewinnen, noch dazu haben sie ihre Teilungsfähigkeit weitgehend verloren und lassen sich deshalb in der Petrischale nur langsam vermehren. Die Hoffnung der Zellingenieure richtet sich daher vor allem auf Stammzellen als Quelle, da sich diese in verschiedene andere Zelltypen verwandeln lassen (vgl. Kapitel Stammzellen). Trotz erfolgsversprechender Ansätze gibt es hier allerdings noch etliche Probleme zu lösen. Denn Stammzellen, egal in welcher Vielseitigkeit sie vorliegen, müssen mit geeigneten Rezepturen zuverlässig und vollständig in einen gewünschten Zelltyp verwandelt REGEnERatIonStEcHnoloGIEn: HElFER FÜR DIE MEDIZIn werden, ohne ein unstetes oder gar gefährliches Eigenleben zu entwickeln. Entscheidend für den Gewebezüchtungserfolg ist auch das eingesetzte Trägermaterial. Siedelnde Zellen benötigen den Kontakt zu einer solchen Struktur, um tatsächlich wachsen zu können. Im Körper übernimmt diese Rolle als Trägerstruktur die sogenannte extrazelluläre Matrix, ein komplexes Netzwerk aus Eiweißen und Kohlenhydraten. Die extrazelluläre Matrix enthält wichtige Biomoleküle und Anhaftungsstellen, die dafür sorgen, dass sich Zellen richtig entwickeln. Bioingenieure und Werk- 15 stoffwissenschaftler wollen dieses natürliche Vorbild im Labor so gut wie möglich nachahmen: Dazu werden Trägermaterialien verwendet, die natürlichen (auch tierischen) oder synthetischen Ursprungs sind. Zum Einsatz kommen Hydrogele, Kollagene, mineralische Substanzen wie Calciumphosphate oder Keramiken wie Aluminiumoxid. In manchen Fällen formen diese Materialien poröse Strukturen, mit zahlreichen Hohlräumen wie bei einem Schwamm. Zellen fühlen sich in solchen Nischen und Höhlen besonders wohl. Als Trägermaterial werden auch Gewebe von Schweinen und Rindern benutzt. Mit einer Waschlösung werden die tierischen Zellen komplett aus einem Organ entfernt, Biomaterialien: Maßgeschneiderte werkstoffe für die Regenerative Medizin Für nahezu alle Techniken der Regenerativen Medizin werden Biomaterialien benötigt. Darunter werden synthetische Hightech-Werkstoffe verstanden, die in Kontakt mit lebendem Körpergewebe kommen. Meist sind sie mit biologisch aktiven Molekülen beladen, damit sie von Zellen und Geweben nicht abgestoßen werden und sich möglichst gut in den Körper einpassen. Biomaterialien dienen in der Gewebezüchtung als Trägergerüst (Matrix), auf denen sich Zellen ansiedeln können. Außerdem werden sie für biologisch abbaubare Implantate eingesetzt, die zum Beispiel bei Knochendefekten vorübergehend als Lückenfüller und Wachstumsleitschiene dienen. Auch bei der gezielten Verabreichung von Medikamenten und Wirkstoffen (Drug Delivery) im menschlichen Körper kommen Biomaterialien zum Einsatz. Hier tüfteln Materialwissenschaftler an intelligenten Wirkstoffdepots. Künstliche Kapseln sollen empfindliche Signaleiweiße in den Körper transportieren, sich dann vor Ort öffnen und so die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren. Forscher um Andreas Lendlein vom Teltower Zentrum für Biomaterialentwicklung des Helmholtz-Zentrums Geesthacht setzen zum Beispiel auf Polymere als Ausgangsstoff für ihre Entwicklungen, die als sogenannte Formgedächtnis-Kunststoffe dienen. Auf einen Wärme- oder Lichtreiz hin ändern diese intelligenten Polymere ihre dreidimensionale Gestalt. Polymere haben Materialeigenschaften, die sich für Anwendungen in der Regenerativen Medizin nutzen lassen. Sie können sich also quasi per Knopfdruck verformen und setzen dann Wirkstoffe je nach Bedarf frei. Wichtig beim Design der neuartigen Kunststoffe: Um für den späteren Einsatz in einem Gewebe maßgeschneidert zu sein, müssen oftmals die Oberflächen der Polymere verändert werden – zum Beispiel zur Verankerung biologisch aktiver Moleküle. So haben die Teltower Forscher Materialien hergestellt, auf denen hornhautbildende Zellen (Keratinozyten) gut wachsen, die bindegewebsbildenden Fibroblasten jedoch nicht. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „Translationszentren in der Regenerativen Medizin“: „Berlin-Brandenburg Center for Regenerative Therapies“ Partner: Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für Biomaterialentwicklung, Teltow 16 REGEnERatIonStEcHnoloGIEn: HElFER FÜR DIE MEDIZIn übrig bleibt nur noch die tote Gerüstsubstanz der extrazellulären Matrix. Auch aus menschlichen Geweben gewinnen Biomediziner solche Trägerstrukturen, um sie für die Herstellung biologisch-künstlicher Implantate zum Beispiel mit Blutgefäßzellen zu besiedeln (vgl. Kapitel Herz). Materialwissenschaftler beschichten oder tränken die Trägersubstanzen noch zusätzlich mit Biomolekülen oder Wachstumsfaktoren, um den darauf siedelnden Zellen so gut wie möglich eine natürliche und reizvolle Umgebung vorzugaukeln. Bioreaktoren: Gewächshäuser für Gewebe Damit die Zellen unter optimalen Bedingungen in einer Nährlösung gedeihen können, werden sie in sogenannten Bioreaktoren herangezüchtet. Das sind Behälter, die mit komplizierter Elektrotechnik für die Steuerung und Datenanalyse ausgestattet sind. Für ihre Entwicklung ist die Expertise von Ingenieuren und Materialwissenschaftlern gefragt. Die Hightech-Bioreaktoren stellen sicher, dass die nötige Temperatur, der pH-Wert und die Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff gegeben sind. So wird eine kontrollierte und reproduzierbare Züchtung möglich. Einige Kultursysteme bieten außerdem noch die Möglichkeit, auf die Zellen während des Wachstums chemischen oder mechanischen Stress auszuüben. Mechanischer Stress in Form von Zugund Druckbelastung führt beispielweise dazu, dass sich Knochenmarkstammzellen zu Knochengewebe hin ausbilden. Bei der Züchtung von biokünstlichen Herzklappen stellt das Anlegen pulsierender Stöße wie bei einem Krafttraining die Ausbildung funktionstüchtiger Gewebe sicher, so dass die Klappen auch nach der Implantation in den Patienten den im Körper vorherrschenden Belastungen gewachsen sind. Für eine Vielzahl von Geweben oder Organen entwickeln Bioingenieure derzeit Prototypen und Modelle. Es geht ihnen darum, möglichst dreidimensionale Gewebekulturen zu konstrurieren, die wie in der Natur aufgebaut sind. Dadurch entsteht allerdings die große Herausforderung, ausreichende Versorgung der lebenden Kunstorgane mit Blutgefäßen und einem Blutstrom zu erreichen (vgl. S. 30 ff.). Neben der Gewebezüchtung geht es in der Regenerativen Medizin oft darum, eine Therapie zu entwickeln, die auf lebenden Zellen basiert. Diese werden dabei wie eine Art Arzneimittel verwendet und in die geschädigten Körpergewebe gespritzt. Dort sollen sie sich möglichst in den benötigten Zelltyp entwickeln und sich integrieren, um letztlich Forscher in Aachen entwickeln Bioreaktoren, mit deren Hilfe im Labor gezüchtete Herzklappen auf ihren Einsatz im Körper getrimmt werden. die verlorengegangene Funktion wiederherzustellen oder die Regeneration anzukurbeln. Zumindest eine Form der Zellersatztherapie ist mittlerweile zu einem erfolgreichen Routineverfahren in der Medizin geworden: Die Transplantation von Blutstammzellen aus dem Knochenmark. Akute Leukämien zählen zu den aggressivsten aller Krebsleiden. Oft kann den Betroffenen nur mit einer intensiven Chemo- und Strahlentherapie geholfen werden. Dabei werden unweigerlich das blutbildende System und das Immunsystem zerstört. Als Ersatz werden dem Patienten gesunde Blutstammzellen übertragen, sie siedeln sich selbstständig im Knochenmark wieder an und bauen ein völlig neues Blutbildungssystem auf, ebenso ein neues Immunsystem. Die Stammzellen kommen meist von einer fremden Person, die in ihren immunologischen Gewebemerkmalen möglichst gut mit dem Erkrankten übereinstimmen muss. Die Abhängigkeit von einem passenden Spender ist neben den Risiken auch die wichtigste Hürde bei dieser Therapie. Um die Suche zu erleichtern, haben verschiedene Institutionen in Deutschland sogenannte Stammzellspenderregister aufgebaut, in denen die Gewebemerkmale zehntausender Spender erfasst sind. Bei Zellersatztherapien für andere Organe und Gewebe stecken die Biomediziner noch in frühen Stadien der klinischen Forschung. In Frage für eine Zelltherapie kommen geschädigte Organe mit geringen Selbstheilungsfähigkeiten und wenigen vorhandenen Zelltypen wie etwa das Herz, das Gehirn oder Knorpel (vgl. die jeweiligen Kapitel REGEnERatIonStEcHnoloGIEn: HElFER FÜR DIE MEDIZIn 17 in dieser Broschüre). Adulte Stammzellen aus dem Knochenmark scheinen einen anderen, vielversprechenden therapeutischen Effekt zu haben: In herzinfarktgeschädigtes Gewebe injiziert, setzen sie vorübergehend einen Cocktail an Wachstumsfaktoren frei, der offenbar die Regeneration und die Durchblutung anregen kann (vgl. S. 26ff.). tiert werden. Für die Regeneration von Nervenfasern werden zum Beispiel sogenannte Leitschienen erprobt (vgl. Kapitel Nerven). Sie sollen als Lotsen dafür sorgen, dass durchtrennte Nervenbahnen im Körper wieder zueinander finden und miteinander verwachsen. Nach mehreren Monaten werden die Materialien vom Körper abgebaut. Hilfestellung für die Selbstheilung Die nähere Erforschung und das bessere Verständnis von Stammzellvorkommen im Körper hat auch zu neuen Strategien für eine regenerative Therapie geführt, die einmal komplett ohne chirurgischen Eingriff auskommen könnte. Die Vision ist es, zum Beispiel neurale Stammzellen im Gehirn durch Medikamente ganz gezielt anzuregen, so dass sie sich verstärkt teilen und neues Gewebe hervorbringen. So könnten damit vielleicht Parkinson-Patienten in ihren Gehirnen selbst für den Nachschub an Dopamin-produzierenden Nerven- Ein weiterer Ansatz verbirgt sich hinter dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Fachleute sprechen hierbei von „induzierter Autoregeneration“. Durch bestimmte medikamentöse oder medizintechnische Verfahren sollen im Körper Heilungs- und Erneuerungsprozesse angeregt und unterstützt werden. Dazu können biologisch abbaubare Trägermaterialien, die mit bestimmten Wachstums- und Lockstoffen beladen werden, in die geschädigten Gewebe implan- Künstlich nachgebaut: Ein Zuhause für Stammzellen Stammzellen halten sich im Körper in sogenannten Nischen auf. Hier sind sie in eine Umgebung eingebettet, die ihnen Halt gibt und verschiedene Signale an die Stammzelle sendet. So wird gewährleistet, dass die Zellen ihre Stammzelleigenschaften behalten. Verlassen die Zellen die Nische, so beginnen sie sich zu spezialisieren. Um Stammzellen noch besser im Labor kultivieren und steuern zu können, tüfteln Forscher daran, die Wachstumsbedingungen zu verbessern. Ein Ziel ist es dabei, die Stammzellnischen des Körpers so gut wie möglich nachzuahmen. Forscher um Materialwissenschaftler wollen die mechanischen und biochemischen Eigenschaften von Stammzellnischen nachahmen. Carsten Werner vom Centrum for Regenerative Therapies (CRTD) in Dresden versuchen mithilfe von Polymermaterialien, die Stammzellnische von sogenannten mesenchymalen Stammzellen, die im Knochenmark vorkommen, im Labor nachzubauen. Dazu werden Silikongerüste mit winzigen Vertiefungen hergestellt. Die Oberfläche der Vertiefungen wird mit bestimmten Polymeren und Wachstumsfaktoren beschichtet, die die natürliche Umgebung einer Stammzelle im Körper besonders lebensecht nachbilden sollen. Die Vertiefungen sind so klein, dass jeweils nur eine einzelne Stammzelle hineinpasst und diese die Nischenwände direkt berührt. So können die Forscher nicht nur die Stammzellentwicklung in der künstlichen Nische genau studieren und beeinflussen. Die Forscher um Werner hoffen, mit der neuen Kulturmethode Spenderstammzellen im Labor vermehren zu können. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „Zellbasierte, regenerative Medizin“: „Materialien zur Isolation, Expansion und Differenzierung mesenchymaler Stromazellen“ (2009-2012) Partner: Zentrum für Regnerative Therapien Dresden (CRTD) 18 REGEnERatIonStEcHnoloGIEn: HElFER FÜR DIE MEDIZIn wie eine Gentherapie abläuft 1. Entnahme der Stammzellen Genfähre (Virus) Stammzelle mit defektem Gen 2. Einschleusen des intakten Gens 4. Infusion der gentherapeutisch veränderten Stammzellen 3. Zelle mit dem korrigierten Gen zellen sorgen, an denen es ihnen mangelt. Forscher versuchen auch mithilfe bestimmter Signalmoleküle, Stammzellen aus dem Knochenmark über das Blut in bestimmte Organe zu locken, wie etwa Herzen, die durch einen Infarkt geschädigt wurden. Solche Lockstoffe werden zum Beispiel in geeignete Biomaterialien verpackt und gezielt freigesetzt. Gezielt Erbanlagen reparieren Als eine völlig andere Regenerationstechnologie gilt die Gentherapie, die wie eine Art Gen-Ersatztherapie funktioniert. Sie zielt darauf ab, defekte Erbanlagen in Körperzellen eines Erkrankten mithilfe von gentechnischen Methoden wieder zu reparieren. Dazu wird in betroffenen Zellen eine gesunde Version des fehlerhaften Gens einschleust (siehe Grafik oben). Die Einsatzgebiete für eine Gentherapie liegen vorrangig in der Behandlung von Erbkrankheiten, die auf Defekten in einzelnen Genen beruhen, oder etwa bei Krebs, wo kranke Zellen gezielt zerstört werden sollen. Knackpunkt bei der Gentherapie ist die richtige Auswahl und Entwicklung der sogenannten Genfähre, mit dem der gesunde Erbgutabschnitt in die Zelle eingebracht werden kann. Die wirkungsvollsten Erbmaterial-Einschleuser sind Viren, die diesen Mechanismus sonst dazu brauchen, um ihr Genom im Körper zu verteilen. Die sogenannten Retroviren laden ihre genetische Fracht besonders effektiv in Zellen ab, die sich gerade teilen. Deshalb sind Stammzellen ein wichtiges Ziel für Gentherapeuten, denn diese sind besonders teilungsfreudig. Noch dazu geben Stammzellen ihre genetischen Veränderungen an ihre Nachfahren weiter. Während in den Anfängen der Gentherapie-Forschung die Euphorie zunächst sehr groß war, hat sich inzwischen herausgestellt, dass die Verfahren doch sehr kompliziert und risikobehaftet sind. Besonders in den 1990er Jahren gab es einige harte Rückschläge bei der Behandlung von Patienten mit Gentherapien, die in einigen Fällen sogar zum Tod geführt haben. Doch die Forschung hat in den letzten Jahren wieder einige Schritte nach vorne gemacht. So wurden zum Beispiel neue Genfähren entwickelt, von denen deutlich weniger Gesundheitsrisiken ausgehen. Auch deutsche Forscher in Heidelberg, Frankfurt, Ulm, Berlin und München sind sehr aktiv daran beteiligt, die Gentherapie voranzutreiben. Im Visier haben die Wissenschaftler zum Beispiel Immundefekte. Diese könnten gezielt in Stammzellen, die aus dem Knochenmark entnommen und entsprechend modifiziert wurden, korrigiert werden. Ob Tissue Engineering, Biomaterialien, Zelltherapie oder Gentherapie – in der Erforschung von Regenerationstechnologien nimmt Deutschland eine Spitzenposition ein. Aus diesem Grund konnten bereits vielversprechende Behandlungsstrategien für vielfältige Anwendungsfelder wie Haut, Herz, Leber, Knochen oder Nerven entwickelt werden. Allerdings bedarf es vielfach noch einer klinischen Prüfung, ob die Erkenntnisse aus dem Labor tatsächlich in die klinische Praxis übertragen werden können. Diese Translation ist in der Regenerativen Medizin eine besondere Herausforderung (vgl. S. 46ff.). Eine Anwendung, die vermutlich früher routinemäßig zum Einsatz kommt, sind Testsysteme, die auf der Basis von gezüchteten Zellen etabliert werden (vgl. S. 42ff.). Eines gilt allerdings für alle Anwendungen: Ein wichtiger Innovationsmotor für die Regenerative Medizin sind kleine und mittlere BiotechnologieUnternehmen, die – oftmals unterstützt vom BMBF – Ergebnisse aus den Forschungseinrichtungen in Produkte für den Markt entwickeln. ZEBRaFIScH unD SalaManDER: Von MoDEllEn lERnEn 19 Zebrafisch und Salamander: Von Modellen lernen ob Plattwurm, Zebrafisch oder Salamander – viele tiere haben erstaunliche Selbstheilungskräfte. Ihnen wachsen abgetrennte Köpfe oder Schwänze zügig wieder nach, Verletzungen im Gehirn heilen von selbst. Forscher wollen von diesen Fähigkeiten lernen, wie die Regeneration bei organen im Detail abläuft. Für Stammzellforscher wiederum sind Experimente an Mäusen unverzichtbar – als Modell für Vorgänge im Menschen. Um den Grundlagen der Regeneration auf die Spur zu kommen, ist es wichtig, ihre natürlichen Abläufe im Detail zu verstehen. Welche Mechanismen laufen bei der Erneuerung von Geweben und Organen ab, welche Eiweiße und Gene spielen eine Rolle? Wie ist das Regenerationsprogramm aufeinander abgestimmt? Woher wissen die Zellen, wie sie sich wo entwickeln sollen? Für solche Fragestellungen haben sich Entwicklungsbiologen einige Lebewesen mit erstaunlichen Regenerationsfähigkeiten ausgesucht. Diese Modellorganismen können nicht nur Verletzungen aus eigener Kraft gut und schnell reparieren. Gleichzeitig kann man mit ihnen in großer Zahl experimentieren, genetische Studien durchführen, und ihre nachwachsenden Gewebe lassen sich genau unter dem Mikroskop beobachten. Letztlich wollen die Grundlagenforscher durch Studien an Modelltieren auch besser verstehen, wie man Regenerationsvorgänge beim Menschen auslösen, begünstigen und Entwicklungsbiologen nutzen Zebrafische sehr gern als Modelltiere. Sie sind in der Lage, Verletzungen im Gehirn zu regenerieren . steuern kann – vor allem in Organen wie dem Gehirn und dem Herzen. Zu den in der Forschung genutzten Modelltieren gehören unter anderem Organismen, die leicht zu übersehen sind: Plattwürmer (Planarien). Sie werden nur wenige Millimeter bis Zentimeter groß, leben im Meer und in Flüssen. Doch die Winzlinge besitzen herausragende Regenerationsfähigkeiten: Abgetrennte Köpfe oder Schwänze wachsen zügig wieder nach, und aus einem amputierten Körperteil geht selbst ein vollständiger, lebensfähiger Plattwurm hervor. Kein Wunder: Selbst in erwachsenen Tieren sind nahezu 30 Prozent der Zellen Stammzellen. Diese Neoblasten sind ähnlich wandlungsfähig wie embryonale Stammzellen und können ein Wurmleben lang die verschiedensten Zelltypen hervorbringen. Deswegen haben die Planarien mittlerweile ihren festen Platz in den Labors der Regenerationsforscher gefunden. Mithilfe des Modellorganismus Schmidtea mediterranea studieren Entwicklungsbiologen die molekularen Eigenschaften der Plattwurmstammzellen und fahnden nach Faktoren, die die Regeneration bei den Würmern in Gang setzen. Viele der Planariengene ähneln denen des Menschen. Die Forscher erhoffen sich deshalb auch Erkenntnisse über die humane Stammzellbiologie. Zebrafische regenerieren Herz und Gehirn Zu den beliebtesten Modelltieren unter Forschern gehört der Zebrafisch. Was den Zebrabärbling Danio rerio als Wirbeltier zum idealen Forschungsobjekt macht: Der Fisch ist als frischgeschlüpfter Embryo durchsichtig. Zellstrukturen und -bewegungen lassen sich in der frühen Entwicklungsphase deshalb direkt unter dem Mikroskop betrachten. Außerdem ist der Zebrafisch leicht auf engem Raum zu züchten und gut für genetische Experimente geeignet. In gentechnisch veränderten Fischen können Forscher beispielweise bestimmte Zelltypen mit einem grün leuchtenden Eiweiß markieren und so deren Entwicklung genau verfolgen. Auch der Zebrabärbling besitzt beeindruckende Selbstheilungskräfte. So sind die Tiere in der Lage, Verletzungen im Gehirn zu regenerieren. Dabei erlangen die Fische schon wenige Monate durch Selbstreparatur von Hirngewebe wieder alle Funktionen, die durch die Verletzung verlorengegangen sind. Der Schlüssel zu dieser Regenerationsfähigkeit sind offenbar neuronale Stammzellen, die im Fischgehirn verteilt 20 ZEBRaFIScH unD SalaManDER: Von MoDEllEn lERnEn sind, und die sich bei Bedarf dann in die passende Nervenzelle verwandeln können. Forscher vom Biotech-Zentrum der Technischen Universität Dresden interessieren sich dafür, wie dieses neuronale Ersatzteillager im Fischgehirn erhalten wird. Das Wissen über diese Vorgänge ist besonders für Alternsforscher interessant. Denn Säugetiere und der Mensch haben die Fähigkeit zur Regeneration von Nervenzellen in der Evolution nahezu komplett verloren. Der Vergleich mit den Fischen könnte also helfen zu verstehen, wie sich diese Fähigkeit vielleicht einst künstlich bei Menschen stimulieren lässt. Die Selbstheilungskräfte des Zebrafischs beschränken sich aber nicht auf das Gehirn. Auch abgetrennte Teile des Herzmuskels oder der Flossen wachsen einfach wieder nach. Forscher vermuten, dass die Wundheilung beim Fisch etwas anders verläuft als beim Menschen. Das nach Verletzungen entstandene Narbengewebe, bei Menschen Hemmschuh für eine weitere Regeneration, wird offenbar bei den Fischen wieder abgebaut und durch die jeweils passenden Zelltypen ersetzt. Forscher wollen mithilfe von Zebrafisch-Mutanten herausfinden, welche Faktoren diese besondere Wundheilung bei den Fischen steuern. wie verlorene Salamanderbeine nachwachsen Im Labor von Elly Tanaka tummeln sich in kleinen Wassertanks hunderte Axolotl. Die Lurche werden ausgewachsen bis zu 30 Zentimeter groß. Die Forscherin ist schon seit vielen Jahren der erstaunlichen Selbstheilungskraft dieser mexikanischen Salamander auf der Spur. Ihre Forschungen wurden mit dem BioFuture-Preis des BMBF unterstützt. Am Zentrum für Regenerative Therapien in Dresden (CRTD) ist sie Professorin für „Tiermodelle der Regeneration“. Die Entwicklungsbiologin sucht nach Genen und Eiweißen, mit deren Hilfe die Tiere verlorene Gliedmaßen und verletztes Rückenmark so perfekt nachbilden können. Dazu hat sie ganz besondere Axolotl gezüchtet: Die meisten Lurche sind Albinos, in deren nahezu durchsichtigem Gewebe man die wundersamen Umbauprozesse genau betrachten kann. Andere Tiere sind gentechnisch verändert, sie tragen in bestimmten Zelltypen ein grünes Leuchtprotein (GFP). Mithilfe dieser Markierungen sind die Forscher in der Lage, das Schicksal einzelner Zellen beim Nachwachsen genau zu verfolgen. Auf diese Weise hat Elly Tanaka mit ihrem Dresdner Forscherteam ein Geheimnis der Regeneration gelüftet: Lange dachte man, dass sich an Amputionsstellen beim Axolotl ein Zellklumpen aus pluripotenten Stammzellen bildet, die sich je nach Bedarf zu dem benötigten Zelltyp spezialisieren und so das neue Glied aufbauen. Die Analysen an den leuchtenden Salamandern zeigten jedoch: Die Wundheilungszone besteht aus einem Gemisch verschiedener Vorläufer- Der Axolotl ist das Wappentier der Regenerationsbiologie. Verlorene Gliedmaßen wachsen bei diesem Schwanzlurch völlig intakt nach. zellen, die bereits sehr eingeschränkt in ihrem Entwicklungsvermögen sind. Für Tanaka ist das ein Hinweis darauf, dass man Zellen gar nicht bis in ihren Alleskönner-Zustand zurückversetzen muss, um eine Ersatz-Extremität wachsen zu lassen. Die Zellen im Regenerationswunder Axolotl verhalten sich offenbar gar nicht so unterschiedlich zu denen von Säugetieren. Projekt im BMBF-Wettbewerb BioFuture: „Identifizierung von Faktoren, die die Geweberegenerierung initiieren“ (2004-2008); Advanced Grant des Europäischen Forschungsrats ERC: „RegenerateAcross“ (2012-2016) ZEBRaFIScH unD SalaManDER: Von MoDEllEn lERnEn Die Azteken nannten den ungewöhnlichen Ureinwohner Mexikos „Wassermonster“. Der Axolotl ist ein Salamander, der wie eine Art geschlechtsreife Kaulquappe mit Beinchen und Kiemen ein Leben lang unter Wasser lebt. Gleichzeitig ist der Axolotl (Ambystoma mexicanum) auch so etwas wie das Wappentier der Regenerationsbiologie. Schneidet man dem Axolotl ein Beinchen oder Teile seines Schwanzes ab, wächst das Körperteil in wenigen Wochen bis auf die ursprüngliche Größe nach. Dabei wird das verlorene Glied aus Nerven-, Skelettund Muskelgewebe wieder voll funktionstüchtig wieder hergestellt. Besser kann das kein anderes Wirbeltier. Auch Teile des Herzens, des Gehirns und des Rückenmarks werden ersetzt – und das selbst bei erwachsenen Tieren. 21 Plattwürmer besitzen ganz besondere Regenerationskräfte: abgetrennte Köpfe wachsen sehr schnell wieder nach. Heilungsprozesse beim lurch verstehen Grundlagenforscher weltweit versuchen, diese Prozesse aufzuklären (vgl. Kasten S. 20). Motiviert werden ihre Experimente von der Hoffnung, dass die beteiligten Moleküle und Gene auch beim Menschen noch vorhanden sind, und durch bestimmte Methoden wieder aktiviert werden können. Aber noch rätseln die Forscher: Wieso bildet der Axolotl bei der Wundheilung kein Narbengewebe? Wie werden spezialisierte Zellen in einen verjüngten Zustand zurückversetzt, so dass sie sich wieder teilen? Auch Molche sind mittlerweile zu beliebten Modellorganismen für Herzforscher avanciert. So sehen nachwachsende Gliedmaßen des Axolotl unter dem Stereomikroskop aus. Bestimmte Zelltypen wurden mit Farbstoffen markiert. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Herzund Lungenforschung in Bad Nauheim haben beim grünlichen Wassermolch die narbenfreie Wundheilung von verletztem Herzmuskelgewebe im Visier. Mäuse zählen wie der Mensch zu den Säugetieren. Sie sind für Forscher die wichtigsten Modellorganismen in der Biomedizin. An den Nagern lassen sich fast alle auch für den Menschen relevanten Entwicklungsschritte untersuchen. Besonders für Stammzellforscher sind Mäuse wichtige Studienobjekte, denn aus den frühen Embryonen der Tiere können Reproduktionsmediziner die embryonalen Stammzellen gewinnen. Sämtliche wichtigen Erkenntnisse der Stammzellbiologie beim Menschen wurden erst durch vorangegangene Experimente an Labormäusen erzielt. Da sich Mäuse gentechnisch leicht verändern lassen, eignen sie sich für die Genomforschung sowie die immunologische Forschung und werden für die Entwicklung von Medikamenten eingesetzt. In München wurde dazu auf dem Gelände des dortigen Helmholtz-Zentrums mit Unterstützung des BMBF die Deutsche Mausklinik aufgebaut, die die Erforschung von Krankheiten erleichtern soll. Wissenschaftler untersuchen hier sogenannte Mausmutanten, bei denen bestimmte Gene abgeschaltet sind. Mit modernsten Messgeräten erheben die Forscher für jeden Nager hunderte von Testwerten und prüfen, wie sich genetische Anlagen auf die Tiere auswirken. Viele, allerdings nicht sämtliche Erkenntnisse aus der Mäusemedizin sind auf den Menschen übertragbar. 22 Haut: KlEInE unD GRoSSE wunDEn HEIlEn Haut: Kleine und große Wunden heilen Die Haut ist das größte und regenerationsfreudigste organ des menschlichen Körpers. Da sie relativ einfach aufgebaut ist, wird Haut schon seit Jahren erfolgreich in der Zellkultur herangezüchtet – zum Einsatz bei transplantationen von Verbrennungsopfern oder bei schwer heilenden wunden. Die Haut aus dem labor wird aber auch immer wichtiger für die Kosmetikindustrie und die arzneiforschung. Denn auf kleinen Hautschnipseln lassen sich neue Substanzen auf ihre Verträglichkeit und Giftigkeit testen. Die menschliche Haut ist nicht nur das größte Organ des Menschen, sondern als Grenze und Kontaktstelle zur Außenwelt auch eines der wichtigsten. Deshalb muss sie sich auch regenerieren können. Die Haut nutzt sich ständig ab: Pro Minute verliert ein Mensch etwa 40 000 Hautzellen, die komplette Hautoberfläche wird im Durchschnitt alle zwei Wochen ausgetauscht. Der Nachschub wird dabei durch adulte Stammzellen gesichert. Sie sorgen ein Leben lang für neue Hautzellen. Noch deutlicher wird die Regenerationsfähigkeit der Haut bei einer Verletzung. Bis zu einer kritischen Größe ist der menschliche Körper nämlich in der Lage, Wunden zu verschließen und verlorengegangene Hautpartien inklusive deren Funktion zu ersetzen. So sieht der Querschnitt der menschlichen Haut unter dem Mikroskop aus. Gut zu sehen sind die verschiedenen Schichten, die sich übereinander stapeln. Von der Struktur her ist die Haut relativ klar aufgebaut: Sie besteht aus mehreren Zellschichten, die wie Mauersteine übereinander gestapelt sind. Die zwei obersten Hautschichten, die Oberhaut (Epidermis) und die Lederhaut (Dermis), sind nicht mit Blutgefäßen versorgt. Weiter nach innen folgt die Unterhaut, ein gut durchblutetes Bindegewebe mit Fetteinlagerungen, Haarwurzeln und Schweißdrüsen. Dank dieses vergleichweise einfachen Schichtenaufbaus der Haut ist die Züchtung von Gewebe im Labor in den vergangenen Jahren zum bisher erfolgreichsten Anwendungsgebiet des „Tissue Engineering“ geworden. So war die Haut das erste lebende Gewebe, das aus menschlichen Zellen rekonstruiert werden konnte. Das geschah in der 1980er Jahren, damals ging es vor allem um ästhetische Korrekturen für einen Einsatz in der plastischen Chirurgie. Heute hat im Labor nachgebaute und nachgezüchtete Haut zwei bedeutende Anwendungsfelder: In der Medizin ist sie oft die letzte Rettung für Patienten mit schweren Verbrennungen oder chronischen Wunden. In der Kosmetikindustrie wiederum werden die Hautpartien aus der Kulturschale dafür verwendet, neue Substanzen zu testen. wunden verschließen mit Ersatzgewebe Für Menschen mit Verbrennungen oder Verätzungen ist eine Transplantation von Ersatzhaut die letzte Rettung. Nur so können Wunden geschlossen und damit gefährliche Entzündungen und Flüssigkeitsverlust vermieden werden. Bei kleinen Wunden können Mediziner dabei auf Eigenhaut des jeweiligen Patienten setzen, die von anderen Körperteilen entnommen wird. Für größere oder chronische Wunden ist diese Vorgehensweise jedoch nicht praktikabel. Erst seit einigen Jahren kann auch diesen Patienten geholfen werden: Für sie wird künstliche Haut im Labor produziert. Um die menschliche Haut möglichst originalgetreu nachzubauen, mussten die Wissenschaftler lange Zeit in mehreren Schritten vorgehen. Aus menschlicher Haut, die dem Patienten entnommen wurde oder die bei Operationen angefallen ist, isolierten sie zwei unterschiedliche Zelltypen: Die dermalen Fibroblasten (Unterhaut) und die hornbildenden Zellen, die Keratinozyten. Zunächst wurden die Fibroblasten in eine Proteinlösung eingebettet. Darauf wurden die Keratinozyten ausgesät. Nach drei Wochen hatte sich aus ihnen dann die Ober- Haut: KlEInE unD GRoSSE wunDEn HEIlEn haut gebildet. Der große Vorteil dieses Modells ist zugleich auch seine große Schwäche. Es basiert auf ausgebildeten Hautzellen, die in der Kulturschale das tun, was sie am besten können: Haut bilden. Allerdings wird für dieses Verfahren als Keimquelle immer eine Biopsieprobe benötigt. Das kann – etwa bei Patienten mit großflächigen Verbrennungen – ein Problem sein. Außerdem dauert es ziemlich lange, bis das Ganze wächst. Denn ausdifferenzierte Zellen teilen sich in einem eher behäbigen Turnus. Forscher aus mehreren Arbeitsgruppen und Biotechnlogie-Unternehmen haben sich deshalb einer anderen Zellquelle zugewandt: Ihnen genügen we- 23 nige Haare, um beinahe beliebig viel neue Haut entstehen zu lassen. Was hat nun aber die Haut mit den Haaren zu tun? Was zunächst erstaunlich klingt, fußt auf einer Beobachtung, die Mediziner schon vor längerem gemacht haben: Ist die Haut verletzt, wandern adulte Stammzellen aus den Haaren um die Verletzung herum zur Wunde, um bei der Regeneration der Haut zu helfen. Stammzellen aus dem Haar sind also in der Lage, Haut zu bilden – und das nicht nur im Körper, sondern auch im Reagenzglas. Im Vergleich zum früheren Verfahren bietet dieser Weg mehrere Vorteile. Abgesehen davon, dass ein Haar leichter ausgerissen ist als ein Stück Haut Künstliche Haut aus dem labor für Patienten mit chronischen wunden Für die Biotechnologen des Leipziger Unternehmens Euroderm sind einige Dutzend ausgezupfte Haare ein wertvoller Rohstoff. Denn an der Haarwurzel sitzen adulte Stammzellen, die besonders teilungsfreudig sind, und die in wenigen Wochen in der Kulturschale eine Ersatzhaut hervorbringen können. Davon profitieren vor allem Patienten mit chronischen Wunden, denen bislang aufwändig und auf schmerzhafte Weise Eigenhaut transplantiert werden musste. Die Verfahren der „Haut aus Kopfhaaren“ hat Euroderm zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Immunologie und Zellforschung (IZI) in Leipzig und mithilfe einer BMBF-Förderung zur Marktreife entwickelt. Die Hautstammzellen aus der Haarwurzelscheide werden zwei bis drei Wochen in der Zellkultur vermehrt. Mit einem einfachen Trick geben die Forscher dann den Zellen das Signal für die Hautbildung: Sie reduzieren die Nährflüssigkeit so weit, dass die Oberseiten der Zellen nicht mehr bedeckt sind und so mit der Umgebungsluft in Kontakt kommen. Durch den erhöhten Druck, den die Luft auf die Zelloberflächen ausübt, reifen sie zu Oberhautzellen aus. Die Forscher züchten auf diese Weise viele kleine Hautstücke, die für jeden Patienten individuell hergestellt werden und aneinandergelegt eine Fläche von 10 bis 100 Quadratzentimetern ergeben. Die gezüchtete Epidermis ist zwar kein vollwertiger Ersatz, denn ihr fehlen noch Pigmente und Talgund Schweißdrüsen. Für die Patienten ist sie den- An der Wurzel eines Haares befinden sich Stammzellen, die eine wertvolle Quelle für die Hautproduktion darstellen. noch ein Fortschritt. Nach dem Anwachsen der verpflanzten Hautstückchen entstehen relativ weiche Narben, und in mehr als 60 Prozent der verpflanzten Fälle wird eine komplette Heilung der chronischen Wunden erreicht. Ob gesetzliche Krankenkassen die Kosten der Behandlung übernehmen, ist in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „Tissue Engineering“: „Gewinnung, Kultur und Transplantation follikulärer epidermaler Stammzellen für die Rekonstruktion menschlicher Haut“ (2005 bis 2009) Partner: Euroderm GmbH 24 Haut: KlEInE unD GRoSSE wunDEn HEIlEn herausgeschnitten, teilen sich adulte Stammzellen auch viel schneller als ausdifferenzierte Hautzellen. Das heißt: Es dauert nicht so lange, bis eine künstliche Hautpartie herangezüchtet ist. Ob mit Haaren oder Hautzellen als Quelle – die künstliche Haut aus dem Labor wird inzwischen seit vielen Jahren für medizinische Behandlungen von spezialisierten Unternehmen angeboten. In Deutschland sind es vornehmlich kleine und mittlere Biotechnologie-Unternehmen. Ihre Technologien unterscheiden sich jeweils im Herstellungsverfahren sowie in der Art und Weise, wie die entstandene Kunsthaut auf Wunden aufgebracht wird. Während das Unternehmen Euroderm als Quelle Stammzellen aus den Haarwurzeln verwendet ( vgl. Kasten S. 23), hat die Firma Biotissue die „Haut aus der Tube“ entwickelt. Bei dieser Methode werden körpereigene Oberhautzellen in der Kultur vermehrt und dann zusammen mit Fibrin, einem biologischen Gewebekleber, auf die verletzte Region aufgetragen. Aber nicht nur Mediziner haben Bedarf. Von der Haut aus der Fabrik träumen auch Pharmakologen und Chemiker schon lange – für den Einsatz als Testmodelle in der Forschung oder der Industrie. Bereits seit Jahren sind bestimmte Hautgewebe kommerziell erhältlich. Dazu gehören meist Modelle der Oberhaut (Epidermis). Sie müssen nicht über Blutgefäße versorgt werden und lassen sich verhältnismäßig leicht im Labor herstellen und züchten. Derzeit ist die Herstellung solcher Hautmodelle aber noch langwierig, denn sie basiert auf Manufaktur und Vom Hautmodell zur Haut mit Haaren Um aus Haarstammzellen Hautzellen zu entwickeln, gibt es mehrere Lösungen. Ein Konsortium von Wissenschaftlern aus Berlin, Lübeck, und München hat dabei ein ganz eigenes Verfahren entwickelt. Das Berliner Unternehmen Probiogen, das sich auf die Kultivierung von Zellen spezialisiert hat, steuerte dabei einen speziellen Bioreaktor bei, der das Hautmodell ständig mit Nährlösung versorgt und die Verhältnisse im Körper simuliert. Den Berliner Forschern fiel in dem Verbund die Aufgabe zu, die Stammzellen aus dem Haar zu isolieren, zu vermehren und schließlich sicherzustellen, dass sie ihre vielseitigen Eigenschaften bei alledem nicht verlieren. Um künstliche Haut mit Haaren auszustatten, müssen auch sogenannte Haarfolikel im Labor herangezüchtet werden. Mit ihrem Hautmodell wollen die Forscher künftig noch einen Schritt weitergehen: Sie soll mit Haaren ausgestattet werden. Dies wiederum wäre insbesondere für Kosmetikhersteller interessant, aber auch kahlköpfigen Menschen könnte eine solch behaarte Kunsthaut einmal helfen. Für die „Haut mit Haaren“ greifen die Berliner Forscher als Startpunkt erst einmal auf ausgezupfte Kopfhaare zurück. Zunächst gewinnen sie aus einer Region an der Wurzel, dem Haarfolikel, unterschiedliche Typen von adulten Stammzellen. Mit ihrer Hilfe gelingt es, eine zweilagige Oberhaut zu züchten. Ziel der Wissenschaflter ist es nun, auch einen künstlichen Haarfolikel daraus herzustellen. Bislang sind sie noch etwas kleiner und dünner als ihre natürlichen Vorbilder. Langfristig sollen die gezüchteten Follikel auch noch mit Blutgefäßen verbunden werden, um sie über Tage und Wochen hinweg am Leben zu erhalten. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „Zellbasierte, regenerative Medizin“: „Reparatur von Hautdefekten durch Verwendung autologer Haarfolikel-Stammzellen“ (2005 bis 2009) Partner: TU Berlin, Universitätsklinikum SchleswigHolstein, Max-Planck-Institut für Biochemie, Probiogen AG Haut: KlEInE unD GRoSSE wunDEn HEIlEn 25 ist damit teuer. Forscher der Fraunhofer-Institute für Produktionstechnologie (IPT) in Aachen, für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB) und für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart sowie das Fraunhofer IZi in Leipzig haben eine vollautomatischen Produktionsanlage für 3D-Hautmodelle entwickelt. 2011 ging die Gewebefabrik in Betrieb. Pro Monat sollen in der Stuttgarter „Tissue Factory“ bis zu 5.000 daumennagelgroße Hautstückchen vom Stapel gehen. Aufgebaut sind die gezüchteten Hautmodelle aus zwei Schichten: In einer gelartigen KollagenMatrix werden Bindegewebszellen (Fibroblasten) eingebracht. Auf diese Matrix werden dann Keratinozyten aufgepfropft. Dieses Zell-Sandwich wird dann über mehrere Wochen mit Kontakt zur Luft kultiviert. Das führt dazu, dass die Keratinozyten fast wie in ihrer natürlichen Umgebung im menschlichen Körper ausreifen. Sie bilden hierbei eine Epidermis aus, sogar mit Hornschicht. Eine solche Hornhaut ist eine entscheidende Eigenschaft, um die nachgebaute Haut so menschenähnlich wie möglich zu machen. Denn die Hornschicht erfüllt eine wichtige Barriere-Funktion. Künstliche Hautmodelle mit Hornhaut können deshalb noch zuverlässiger Auskunft geben, wie ein zu testender Wirkstoff in die Tiefen der Haut vordringt. Die Hoffnung der Fraunhofer-Forscher ist, dass ihr Fabrikorgan dank der automatisierten Herstellung die Vorraussetzungen schafft, endlich die ausreichende Reproduzierbarkeit und Verlässlichkeit bei der Gewebezüchtung zu erreichen. Künstliche Hautproduktion im akkord Die Hautfabrik funktioniert dabei Schritt für Schritt: Kleine Hautstücke werden sterilisiert und per Robotergreifarm in die Anlage transportiert. Der Automat zerkleinert die gewonnenen Hautproben und sortiert die Zellen in verschiedenene Typen auf. Zunächst werden die zwei gewünschten Zelltypen noch vermehrt, bevor die Anlage sie automatisch wieder zusammenschichtet. Gelagert in einem körperwarmen und feuchten Brutschrank verbinden sich die beiden Zellschichten in etwa drei Wochen. Die entstehenden Hautstücke sind einen Quadratzentimeter groß. Im letzten Schritt verpackt der Automat die Kunsthaut für den Versand. Auch wenn schon sehr lebensechte Oberhautmodelle existieren, die Haut als Ganzes wiederher- Die vollautomatische Hautfabrik am Fraunhofer IPA arbeitet im Akkord und kann bis zu 5000 Hautmodelle im Monat herstellen. zustellen, bleibt eine große Herausforderung für die Gewebezüchter. Denn es gilt nicht nur, die grobe Architektur nachzubilden. Für eine lebensnahe Version müssen die Forscher auch Haarbälge, Schweißdrüsen und Nervenendigungen mit einbeziehen. Um größere Hautwunden, zum Beispiel bei Verbrennungen, mit gezüchteten Transplantaten zu ersetzen, arbeiten Stuttgarter Fraunhofer-Forscher nun auch an einem komplexeren Voll-Hautmodell: Dieses soll künftig auch von Blutgefäßen durchzogen sein. Wichtig für die Kosmetikbranche und für die pharmazeutische Industrie ist es, dass sie die im Labor gezüchteten Hautmodelle verlässlich einsetzen können, um mit ihnen Substanzen auf ihre Verträglichkeit zu testen. Seit 2008 ist nach unabhängiger Prüfung durch die Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch am Bundesinstitut für Risikoforschung (ZEBET) mehrere Hautmodelle EU-weit zugelassen worden, die in Hautreizungstests eingesetzt werden. Eine Weiterentwicklung ist zudem als Modell für die Augenhornhaut geeignet und kann deshalb den umstrittenen Draize-Test an lebenden Kaninchen ersetzen. Bei diesem Test wird untersucht, wie stark chemische Substanzen die Augen reizen. Damit sind wichtige methodische Fortschritte erreicht, die Tierversuche ersetzen können (vgl. S. 42ff.). Mit diesen Entwicklungen haben Unternehmen nun Möglichkeiten an der Hand, den Bestimmungen der neuen EU-Chemikalienverordnung REACH sowie der EU-Richtlinie zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere nachzukommen. 26 HERZ: ScHwacHE PuMPEn anKuRBEln Herz: Schwache Pumpen ankurbeln Das Herz verrichtet als Pumporgan ein leben lang Schwerstarbeit. Infarkte oder Herzklappenfehler legen das Herz stellenweise lahm und schwächen es so dauerhaft. Denn die Selbstheilungskräfte des Herzmuskels sind nur sehr begrenzt. Regenerationsmediziner wollen die geschädigten Herzen trotzdem wieder reparieren: Ihr Repertoire reicht von mitwachsenden Herzklappen über Stammzelltherapien bis hin zu raffinierten lockstoffen. Ein schwaches Herz wieder fit zu bekommen, das bleibt für Mediziner eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Erkrankungen der Herz- und Blutgefäße sind die häufigste Todesursache in den Industrieländern der westlichen Welt. Allein 300 000 Menschen erleiden in Deutschland jedes Jahr einen Herzinfarkt, 60 000 sterben an diesem plötzlichen Durchblutungskollaps in den Herzkranzgefäßen. Bei einem Infarkt sterben die unterversorgten Gewebebereiche ab und der Herzmuskel hört an dieser Stelle auf zu schlagen. Bisher versuchen Ärzte das geschwächte Pumporgan dann mit Medikamenten in seiner Funktion zu stabilisieren. Um die Durchblutung des unbeschädigten Teils des Herzens zu sichern, werden in vielen Fällen Ersatzadern (Bypässe) rund um das Herz verlegt. Obwohl diese Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung führen können: Sie Diese Herzklappe ist in einem Bioreaktor herangewachsen. Sie besteht aus körpereigenem Zellmaterial des Patienten. beseitigen die Erkrankung nicht dauerhaft, und die Patienten leiden meist an den chronischen Folgen. Um die entstandenen Schäden am Herzmuskel wirklich zu heilen, hilft bislang nur eine Transplantation des Organs, mit allen damit verbundenen Risiken. Biomediziner versuchen daher, die Selbstheilungskräfte der geschwächten Pumpe wieder anzukurbeln. Doch die Regenerationsfähigkeit des Herzens ist bei Menschen stark eingeschränkt. Zwar haben Forscher vor kurzem Stammzellen oder Vorläuferzellen innerhalb des menschlichen Herzmuskels aufgespürt. Sie sind allerdings sehr selten und können von sich aus die zerstörten Muskelpartien nicht angemessen nachbilden. Regenerative Therapien am Herz stützen sich deshalb auf zwei Strategien: Gezüchtete Herzmuskelzellen aus dem Labor sollen als Aufbauhilfe dienen, injizierte Stammzellen sollen die geschwächten Zonen wiederbeleben. Für größere „Ersatzteile“ liefert die Disziplin des Tissue Engineering unter anderem mitwachsende Herzklappen. Die Zucht eines kompletten menschlichen Herzens in der Kultur bleibt bislang Utopie. Herzmuskelzellen aus dem labor Da nach einem Herzinfarkt vor allem ein einziger Zelltyp betroffen ist, die Herzmuskelzelle, gilt das Herz grundsätzlich als geeignetes Organ, um die einmal zerstörten Zellen durch die Transplantation neuer Zellen zu ersetzen. Forscher in Deutschland nutzen verschiedene Strategien, um für diesen Zweck geeignete Herzmuskelzellen im Labor heranreifen zu lassen. Arbeitsgruppen um Jürgen Hescheler an der Universität Köln und Wolfgang-Michael Franz von der Universität München experimentieren dazu mit embryonalen Stammzellen von Mäusen und Menschen, die in der Kulturschale durch Zugabe eines Cocktails von Wachstumsfaktoren zu Kardiomyozyten ausreifen. Versuche mit Nagern hatten bereits gezeigt, was passiert, wenn man die so hergestellten Vorläuferzellen in lädierte Mäuseherzen spritzt: Die Ersatzzellen nisteten sich im Herz ein, bauten an der Infarktnarbe Muskelmasse auf und die Schlagkraft des geschädigten Herzens besserte sich messbar. Die Spenderzellhaufen zuckten aber bisweilen nicht synchron mit den anderen Herzmuskelzellen, ein möglicher Auslöser für Herzrhythmusstörungen. Weiterhin bleibt immer ein – wenn auch geringes – Risiko, dass die Spenderzellen zu gefährlichen Tumoren wuchern oder aber aufgrund ihrer fremden Herkunft vom Immunsystem abgestoßen werden. Neue Hoffnungsträger für eine HERZ: ScHwacHE PuMPEn anKuRBEln 27 Stammzellen ins Herz gespritzt: Die Rostocker PERFEct Studie Schon seit einigen Jahren beschäftigen sich Forscher damit, Herzinfarkttherapien mit Stammzellen zu testen. So hat die am Klinikum der Universität Frankfurt durchgeführte REPAIR-AMI-Studie gezeigt, dass Herzpatienten von der Gabe körpereigener Stammzellen in die betroffene Herzregion profitieren können. Auch Herzmediziner um Gustav Steinhoff von der Klinik für Herzchirurgie der Universität Rostock testen derzeit einen ähnlichen Weg. Am Rostocker Referenz- und Translationszentrum für kardiale Stammzelltherapie (RTC) haben sie ein Verfahren entwickelt, bei dem körpereigene Stammzellen eines Patienten zur Therapie von Herzkrankheiten zum Einsatz kommen. Dazu wird bei einem Herzpatienten kurz vor der Operation aus dem Knochenmark eine bestimmte Gruppe adulter Stammzellen, die sogenannten CD133+-Zellen, isoliert. Im Verlauf einer Bypass-OP werden diese Zellen nun gezielt in den Herzmuskel gespritzt – und zwar in das Randgebiet des infarktgeschädigten Gewebes. Mit dem patentierten Verfahren haben die Rostocker bereits mehr als 140 Patienten behandelt. Die ersten Ergebnisse sind ermutigend: Im Vergleich zu Patienten ohne Stammzellbehand- Herzinfarkttherapie bilden vielseitige Stammzellen, die aus Körperzellen künstlich zurückprogrammiert werden. In einem BMBF-Verbundprojekt untersuchen Kölner Forscher das Potenzial dieser so genannten iPS-Zellen zur Behandlung des Herzinfarktes. Bei Mäusen ist es hier bereits gelungen, aus den künstlichen Stammzellen Herzmuskelzellen heranzuzüchten. Mit einer ähnlichen Strategie erforscht ein Team um Ulrich Martin von der Medizinischen Hochschule Hannover das Potenzial von adulten Stammzellen aus dem Nabelschnurblut von Neugeborenen. Erst kürzlich schafften es die Forscher, diese jungen menschlichen Zellen zu den noch vielseitigeren iPS-Zellen zurückzuverwandeln, um daraus in einem nächsten Schritt zuckende Herzmuskelzellen herzustellen. Auch wenn sich immer neue Quellen für Herzmuskelzellen aus dem Labor auftun – bis ein solcher Gewebeersatz zuverlässig bei Menschen eingesetzt werden kann, sind noch viele Jahre Grundlagenforschung nötig. lung habe sich die Pumpleistung des Herzens im Schnitt um zehn Prozent erhöht, erläutert Steinhoff. Zudem erwies sich die Therapie bislang als sicher: „Wie auch im Tierversuch haben wir bei den Patienten keine Nebenwirkungen der Therapie beobachtet“, so Steinhoff. Ende 2009 haben die Mediziner eine groß angelegte Phase III-Studie gestartet, in der bis zu 142 Patienten behandelt werden sollen. Diese Studie läuft doppelblind und placebokontrolliert ab, und ist damit die entscheidene Stufe für eine mögliche Zulassung der Therapie. Neben dem RTC sind noch das Deutsche Herzzentrum in Berlin und die Medizinische Hochschule in Hannover beteiligt. Die Studie wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern und vom BMBF unterstützt. Der Abschluss ist für 2012 geplant. Sollte die PERFECT- Studie dann einen klaren Nutzen der Stammzelltherapie nach Herzinfarkt belegen, so wäre der Weg frei für die Zulassung der Stammzellbehandlung. Projekt in der BMBF-Förderiniative „Translationszentren in der Regenerativen Medizin“: Referenz- und Translationszentrum für kardiale Stammzelltherapie (RTC), Universität Rostock Stammzelltherapie bei Herzinfarkt Eine andere Form der Stammzelltherapie bei Herzinfarkt hat bereits den Sprung in die Klinik geschafft: Die Injektion von körpereigenen adulten Stammzellen. Eine breit angelegte Zulassungsstudie zu dieser Stammzelltherapie bei Herzinfarkt ist 2009 in Rostock, Berlin und Hannover gestartet (siehe Kasten). Bei dieser Behandlung werden bei einer Herz-Operation Stammzellen aus dem Knochenmark des Patienten gezielt in den Randbereich des gelähmten Herzmuskels gespritzt. Die bisherigen Ergebnisse einer solchen Behandlung überraschten die Forscher: Zwar blieb der eigentlich erhoffte Zellersatz im Herzgewebe weitgehend aus. Trotzdem ging es den behandelten Patienten besser, ihr Herz pumpte kraftvoller. Offenbar kurbeln die verabreichten adulten Stammzellen die körpereigenen Reparaturmechanismen wieder an: Sie geben zahlreiche Botenstoffe und 28 HERZ: ScHwacHE PuMPEn anKuRBEln Wachstumsfaktoren in das Gewebe in ihrer Umgebung ab. Die Heilkraft der Stammzellen besteht also vermutlich darin, dass sie wie kleine, lebende Apotheken funktionieren. Die bisherigen klinischen Erfahrungen zu adulten Stammzellen bei der Therapie von Herzerkrankungen zeigten, dass ihr Einsatz relativ unbedenklich für den Patienten ist. Ob die Zellkuren per Spritze auch langfristig zu keinerlei gesundheitlichen Schäden führen, müssen die weiteren Studien aber erst noch belegen. Einen anderen Weg untersuchen derzeit Wissenschaftler in Tübingen und München: Ihr Ziel ist es, möglichst ohne einen chirurgischen Eingriff, dafür mithilfe biochemischer Tricks, die Regenerationskräfte im Herz wieder anzuregen. Dazu wollen die Forscher adulte Stammzellen vermehrt aus dem Blut in die geschwächten Herzregionen locken, damit sie dort gezielt andocken und Reparaturarbeiten in Gang setzen. Für diesen Zweck verabreichten die Forscher Mäusen bestimmte Lockstoffe, die nicht nur die körpereigene Stammzellen aus dem Blut ins kranke Herz lotsen, sondern sie auch dazu bringen, sich genau an das definierte Zielgewebe anzulagern. In München wird dieser Ansatz mittlerweile auch an Patienten getestet. Herzklappen wachsen im Bioreaktor Herzklappen sind lebenswichtige Ventile, die dafür sorgen, dass beim gerichteten Pumpen des Blutes nichts davon in die Herzkammern zurückfließt. Herzklappenfehler können angeboren sein, oder sie entstehen durch Infektionen bzw. durch Verschleiß mit zunehmendem Alter. Sie führen meist zu einer lebensbedrohlichen Schwächung. Bisher stehen Herzchirurgen für die unvermeidlichen Eingriffe entweder biologische Herzklappen von Schweinen und Rindern oder aber mechanische Klappen zu Verfügung. Kleine Patienten müssen bis zu sechsmal operiert werden, da die herkömmlichen biologischen Klappen zu klein werden und verkalken. Mechanische Klappen wiederum sind nicht geeignet, weil die Träger eines solchen Kunststoffventils blutverdünnende Mittel einnehmen müssen. Stefan Jockenhövel züchtet an der Technischen Körperfremde Stammzellen aus dem Mutterkuchen lassen Blutgefäße sprießen Nicht nur im Herzmuskel sind Durchblutungsstörungen ein ernstes Problem. In Beinen entstehen Gefäßverschlüsse zumeist bei älteren Patienten, oft in Folge einer Diabeteserkrankung und aber bei starken Rauchern. In fortgeschrittenen Stadien ist oft eine Amputation unvermeidlich. Regenerationsmediziner vom Berlin-Brandenburg Centrum für Regenerative Therapien (BCRT) versuchen, mithilfe von Stammzellen die Durchblutung in den Beinen ihrer Patienten wieder anzukurbeln. In einer klinischen Studie Mit Stammzellen aus der Plazenta wollen Berliner Forscher Gefäßinfarkte behandeln. erproben die Mediziner dazu einen neuen Weg: Sie setzen auf körperfremde Stammzellen, die aus dem Mutterkuchen (Plazenta) gewonnen wurden. Die Zellpräparate liefert das israelische Biotechnologie-Unternehmen Pluristem. Es hat ein Verfahren entwickelt, mit dem sich aus dem Mutterkuchen von jungen Müttern mesenchymale Stammzellen gewinnen und vermehren lassen. Den heilsamen Effekt von PlazentaStammzellen nach Gefäßinfarkten haben die Forscher aus Berlin bereits in Tierversuchen belegt. Injizierten sie Nagern die PlazentaStammzellen in den Beinmuskel, so sprossen in der Nähe des unterversorgten Gewebes winzige Blutgefäße aus. Erste Studien bei Testanwendungen an Patienten zeigten bereits ermutigende Ergebnisse der Stammzelltherapie. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „Translationszentren in der Regenerativen Medizin“: Berlin-Brandenburg Centrum für Regenerative Therapien (BCRT) HERZ: ScHwacHE PuMPEn anKuRBEln Hochschule Aachen Herzklappen, die ausschließlich aus körpereigenem Gewebe bestehen und mitwachsen. Die Forscher entnehmen von einem Patienten Zellen aus einem Blutgefäß oder aus der Nabelschnur und lassen diese in einer Art Gussform aus dem Stützprotein Fibrin wachsen, welches aus dem Blut des Herzkranken gewonnen wird. Nach und nach verdrängen die Zellen ihr Stützkorsett, bis das Ersatzteil nach vier bis sechs Wochen fertig ist. In einem Bioreaktor werden die biologischen Ersatzklappen dann einem Leistungstest unterzogen. Vor allem Kinder mit angeborenen Herzklappenfehlern sollen von der Entwicklung profitieren, denn das Gewebe aus dem Labor wächst im Körper mit. Die Forscher haben ihre mitwachsenden Zucht-Herzklappen bereits erfolgreich an Schafen getestet. Axel Haverich und seine Mitarbeiter an der Medizinischen Hochschule in Hannover setzen ebenfalls auf Herzklappen, die aus körpereigenen Zellen gezüchtet werden. Dazu wird zunächst eine menschliche Herzklappe aus einem Spenderorgan von allen Zellen befreit, sodass nur ihr äußeres Gerüst erhalten bleibt. Dieses Gerüst (Matrix) wird dann mit Zellen besiedelt, die aus dem Blut des Empfängers gewonnen und vermehrt wurden. Innerhalb weniger Wochen entsteht so im Bioreaktor eine quasi natürliche Herzklappe, die keinerlei Abstoßungsreaktionen hervorruft und nach der Implantation mitwächst. Herzgewebe für die wirkstoffforschung Als eine der wichtigsten und greifbarsten Anwendungen für im Labor herangezüchtete Herzzellen gilt die Wirkstoff-Forschung. Gerade für Pharmafirmen sind frühzeitige Tests bei der Entwicklung von neuen Herzmedikamenten wichtig, um neue Substanzen auf ihre Wirkung und ihre Nebenwirkungen zu überprüfen. Derzeit greifen Pharmakologen für ihre Tests noch vorwiegend auf tierische Gewebe und Organe zurück. Doch die Biochemie und die Pumpleistung eines Mäuseherzens lässt sich nur sehr eingeschränkt auf den Menschen übertragen. Unter dem Dach eines vom BMBF geförderten Verbundprojekts haben Forscher aus Lübeck, Köln, Frankfurt und Reutlingen untersucht, wie sich menschliches Herzgewebe im Labor kultivieren lässt, damit man es für zuverlässige Wirkstofftests in der Pharmaindustrie einsetzen kann. Während manche Forschergruppen dabei auf Herzschnitte aus Geweberesten, die bei Operationen angefallen sind, gesetzt haben, züchteten Kölner Forscher 29 Bioartifizielles Herzgewebe besteht aus Herzmuskelzellen (grün) und Kollagenfasern (rot gefärbt). aus embryonalen Stammzellen Herzmuskelzellen heran. Bei der Prozedur entstehen Zellklumpen, die sich wie funktionstüchtiges Herzmuskelgewebe verhalten und sich im Gleichtakt zusammenziehen können. Solche zuckenden Mikro-Organe kann man sogar auf kleine Chips mit Mini-Elektroden anbringen, um charakeristische Herzströme abzuleiten. Letztlich sollen die Herzmodelle künftig helfen, die Zahl der Tierversuche zu verringern und die Medikamentenentwicklung schneller, günstiger und vor allem sicherer zu machen. Mithilfe von Zelllinien, die durch künstlich reprogrammierte Körperzellen von Herzkranken hergestellt wurden, sollen außerdem Herzleiden besser im Labor untersucht werden können, um künftig Medikamente maßzuschneidern. Trotz der Erfolge bei Stammzelltherapien und Gewebeherstellung: Der Traum der Mediziner, ein komplettes Herz in der Retorte zu schaffen, wird wohl noch lange unerreicht bleiben. Immerhin wurde bei Mäusen bereits gezeigt, dass man ein schlagendes Herz durch Dezellularisierung und nachträgliche Besiedlung mit Endothel- und Herzmuskelzellen biokünstlich wieder herstellen kann. Die aufwendigen Techniken der Gewebeherstellung werden aber sicherlich nicht den Bedarf an Spenderorganen decken können. Eine weitere mögliche Quelle für Spenderherzen: Schweine. Um Abstoßungen solcher tierischen Organe durch das menschliche Immunsystem zu vermeiden, züchten Nutztiergenetiker bereits gentechnisch veränderte Schweine, die immunologisch verträglichere Organe bilden. Solche Tiere könnten auch künftig Gerüste für mitwachsende Herzklappen liefern. 30 lEBER: REGEnERatIonSKRaFt auSnutZEn Leber: Regenerationskraft ausnutzen Kein inneres organ kann sich so gut regenerieren wie die leber. Deshalb eignet sich das Stoffwechselzentrum des Körpers auch für lebendorganspenden. Doch transplantationsorgane sind knapp. Forscher wollen daher leberzellen aus Stammzellen heranzüchten. auch körperfremde leberzellen werden bereits für den Einsatz in der Zelltherapie erprobt. Gewebeingenieure tüfteln an der biokünstlichen leber, einem dreidimensionalen Medikamenten-testsystem mit Blutgefäßen. Die Leber ist das zentrale Stoffwechselorgan des Körpers und der Hauptort für den Umbau und Abbau von Fremdstoffen. Sie entgiftet den Körper, ist am Hormonhaushalt und der Immunabwehr beteiligt und stellt zahlreiche Substanzen her. Ohne dieses „Zentrallabor“ könnte ein Mensch nur wenige Stunden überleben. Zuständig für die vielen Um- und Abbauprozesse sind die hochspezialisierten Leberzellen, die Hepatozyten. Über die außergewöhnliche Regenerationskraft der Leber waren sich schon die alten Griechen bewusst. Sinnbild ist Prometheus, der der Sage nach zur Strafe an einen Fels gekettet, täglich von Raubvögeln heimgesucht wird, die an seiner ständig nachwachsenden Leber fressen. Tatsächlich zeigt sich die Leber sehr regenerationsfreudig: So Menschliche Lebervorläuferzellen in der Zellkulturschale . ist es möglich, für Lebendspenden einen der beiden Leberlappen zu transplantieren. Beim Spender wächst die Leber in der Folge wieder zur ursprünglichen Größe heran. Dem Empfänger reicht der eingepflanzte Leberlappen aus, um eine funktionstüchtige Leber zu bilden. Bei akutem Leberversagen muss jedoch meist eine komplette Leber verpflanzt werden. Die Zahl solcher verfügbaren Spenderorgane ist allerdings knapp bemessen, es gibt lange Wartelisten. Deshalb suchen Biomediziner nach anderen Behandlungsmöglichkeiten, mit denen sich – gerade in lebensbedrohlichen Krisen – die Funktion der Leber überbrücken lässt. Solche Unterstützungshilfen könnten entweder einzelne Leberzellen sein, die in das entgleiste Organ gespritzt werden. Denkbar ist auch der Einsatz von biokünstlichen Lebersystemen, die wie ein Dialysegerät für die vorübergehende Entgiftung an den Blutkreislauf angeschlossen werden. leberzellen aus Stammzellen gewinnen Da Spenderorgane rar sind, besteht immerzu ein Engpass an Leberzellen (Hepatozyten), die für Therapien oder aber für Medikamententests verwendet werden können. Zusätzliches Problem: In der Kultur lassen sich gesunde Leberzellen nur sehr schwer vermehren und züchten. Regenerationsforscher suchen deshalb nach neuen Wegen, mit denen sich Hepatozyten gewinnen lassen. Hoffnungsträger als Quelle sind auch hier Stammzellen. Forscher in Berlin und Köln experimentieren hierzu mit humanen embryonalen Stammzellen. Diese lassen sich zwar sehr gut vermehren, aber die Forscher arbeiten noch an einem geeigneten Rezept, um diese in voll funktionstüchtige Leberzellen zu verwandeln. Auch Pharma-Unternehmen verfolgen diesen Weg. Sie haben dabei vor allem den Einsatz solcher Zellen in Toxizitätstests im Sinn. Eine Alternative bieten Gewebestammzellen aus der Leber selbst. Problematisch ist hierbei, dass diese adulten Stammzellen wiederum sehr schwierig im Labor zu vermehren sind. Gleichwohl wären sie eine geeignete Quelle für Zelltherapien, da sie sogar vom Patienten selbst gewonnen werden können, und so gefährliche Abstoßungsreaktionen verhindert werden können. Forscher des Translationszentrums für Regenerative Medizin (TRM) in Leipzig und Halle greifen auf menschliche mesenchymale Stammzellen aus dem Blut zurück, um sie zu Leberzellen umzuwandeln. Im Tiermodell lEBER: REGEnERatIonSKRaFt auSnutZEn erlangen sie mittlerweile typische Funktionen von Hepatozyten. Nun sollen diese Leberzellen zur Therapie genetischer Lebererkrankungen in einer ersten klinischen Studie getestet werden. Die Leber und ihr häufigster Zelltyp, die Hepatozyte, zeichnen sich durch ihre besonders große Funktionsvielfalt aus. Keine andere Körperzelle produziert derart viele Eiweiße, kaum eine Zelle meistert so viele unterschiedliche Stoffwechselprozesse auf einmal. Das auf Initiative des BMBF im Jahr 2004 gegründete Kompetenznetzwerk HepatoSys und dessen Weiterführung, das „Netzwerk Virtuelle 31 Leber“, haben sich zum Ziel gesetzt, die komplexen und dynamischen Vorgänge in der Leberzelle und des gesamten Organs mit einem systembiologischen Ansatz zu studieren. Es geht zunächst darum, alle wichtigen physiologischen Vorgänge zu erfassen und zu messen. Mit den Daten werden mathematische Modelle entwickelt, mit deren Hilfe man zum Beispiel die Wirkung von Medikamenten im Computer simulieren kann. Wissenschaftler im Netzwerk Virtuelle Leber, dem seit 2010 bundesweit 70 Forschungsgruppen angehören, haben auch die Regenerationsfähigkeit der Leberzellen im Visier. Offenbar wird sie durch das Zusammenspiel ver- leber-Bioreaktoren: Künstliche Überbrückungshilfe für den notfall Schon seit 1987 werden an der Berliner Charité Leberzell-Bioreaktoren für die Anwendung in der Klinik entwickelt. Die von Medizinern um Katrin Zeilinger geplanten biokünstlichen Lebern sollen dereinst – von außen angeschlossen an den Körperkreislauf – als Unterstützungshilfe dienen, wenn eine Leber ihren Dienst versagt. Die Bioreaktoren basieren dabei auf feinen Röhrchen, sogenannten Hohlfaserkapillaren, die eng miteinander verwoben sind und mit einem Gemisch aus lebenden Leberzellen besiedelt werden. Als Zellquelle dienen nicht-transplantierbare Spenderorgane. Für einen im Notfall außerhalb des Körpers einsetzbaren Bioreaktor benötigen die Forscher etwa 600 Gramm Leberzellen, also etwa ein Drittel der Masse einer Erwachsenenleber. Die Bioreaktorsysteme sind unterschiedlich groß und können sowohl am Patienten als auch im kleinen Maßstab für Wirkstofftests im Labor eingesetzt werden. Die natürliche Umgebung der Leberzellen soll im Bioreaktor so gut wie möglich nachgeahmt werden. So gewährleisten die Kapillarbündel der porösen Hohlfasermembranen eine kontrollierte Nährstoffversorgung, eine Entsorgung von Abbauprodukten sowie den Gasaustausch. Gefährliche Abwehrreaktionen sind offenbar problemlos, da nur das Blutplasma mit den auf der Membran siedelnden Zellen in Berührung kommt. Bisher wurden die Berliner Leberzellbioreaktoren in Pilotstudien erfolgreich getestet. In einem nächsten Schritt sollen Studien mit einer größeren Patientenanzahl folgen. Größ- Der Berliner Bioreaktor besteht aus fein verwebten Hohlfasern, die mit Leberzellen besiedelt werden. tes Manko bleibt die ausreichende Verfügbarkeit von Leberzellen. Da Spenderorgane nur begrenzt genutzt werden können, experimentieren die Charité-Forscher derzeit auch mit adulten Leberstammzellen sowie embryonalen Stammzellen, die in der Zellkultur zu ausgereiften Leberzellen umgewandelt werden sollen. Im Rahmen des EU-Projektes „d-LIVER“ werden die Bioreaktoren ab Herbst 2011 für ihren Einsatz als klinisches Leberunterstützungssystem erprobt. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „Innovation in der Medikamentenentwicklung“: „HepaTox: Nutzung von Leberzellbioreaktoren für Arzneimittelstudien“ (2008 bis 2011) Koordination: Charité-Universitätsmedizin 32 lEBER: REGEnERatIonSKRaFt auSnutZEn schiedener Signalstoffe ermöglicht, die die Leberzellen zur Vermehrung anregen und diesen Prozess auch wieder stoppen, wenn sich die Lebermasse zu ihrer ursprünglichen Größe zurückgebildet hat. Ein Überschuss an Wachstumsfaktoren kann zu entzündlichen Prozessen und Narbenbildung bis hin zu Erkrankungen wie Fibrose oder Leberkrebs führen. Ein mathematisches Modell der wichtigen Signalwege wollen Forscher zum Beispiel nutzen, um zu verstehen, wie die Kommunikation bei der Entstehung von Leberkrebs entgleist. Statt bei einem Leberversagen ganze Organe zu verpflanzen, testen Forscher und Unternehmen derzeit aber auch einen Therapieansatz, bei dem lebende Spenderleber-Zellen gleichsam als Medikament eingesetzt werden sollen. Das BiotechnologieUnternehmen Cytonet in Weinheim stützt sich bei seinem Ansatz zum Beispiel auf Zellen, die aus fremden Spenderlebern gewonnen werden, die sich nicht für Transplantationen eignen. Die lebenden Zellen werden im Labor aufbereitet und können auch in Stickstoff tiefgefroren und aufbewahrt werden. Bei Patienten mit einer lebensbedrohlichen Leberschädigung werden die Zellen über die Pfortader in das Organ gespült und siedeln sich hier an. Die Hoffnung der Biomediziner ist, dass die Ersatzzellen dort direkt ihre Arbeit aufnehmen und die geschwächte Leber in ihrer Funktion solange unterstützen, bis sie sich regeneriert hat und die Entgiftungsaufgaben wieder selbst übernehmen Ein von Fraunhofer-Forschern entworfener Leberbioreaktor wird vom PC gesteuert und erlaubt die Kultivierung von Gewebe, das mit funktionstüchtigen Blutgefäßen durchsetzt ist. kann. Offenbar zeigt die Leber nur geringe Abwehrreaktionen gegenüber körperfremden Zellen. Zunächst muss die unterstützende Leberzellkur aber in klinischen Studien auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet werden. Derzeit überprüft das Unternehmen im Rahmen des BMBF-Spitzenclusters BioRN den Effekt der Leberzell-Behandlung bei Neugeborenen mit einem angeborenen Harnstoffzyklusdefekt. Die leber im labor nachbauen Leberzellen (Hepatozyten) sind sehr komplex aufgebaut, denn sie übernehmen wie Biofabriken eine Vielzahl an Stoffwechselreaktionen. Die Leber ist ein Organ mit komplexen Funktionen, ihre dreidimensionale Struktur folgt jedoch einem relativ klaren Grundschema. Millionen Leberzellen ordnen sich um winzige, verästelte Blutgefäße herum zu sogenannten Leberläppchen an. Forscher wollen sich diesen Aufbau zunutze machen, um mit dem Verfahren des Tissue Engineering eine künstliche aber voll funktionstüchtige Leber im Labor nachzubauen. Dazu konstruieren Zellingenieure verschiedener Forschungsinstitutionen in Deutschland sogenannte Bioreaktoren. Alle Modelle dieser Leberersatzgeräte funktionieren im Prinzip gleich: Eine Pumpe presst Blut durch hauchdünne Röhrchen, die mit Leberzellen umkleidet sind. Eine Hoffnung ist, mit solchen Kunstlebern bei Patienten mit akutem Leberversagen die Funktion des entgleisten Organs außerhalb des Körpers für mehrere lEBER: REGEnERatIonSKRaFt auSnutZEn Tage zu überbrücken, bis eine Lebertransplantation möglich ist. Ein weiteres Anwendungsziel: Die Organsysteme sollen im Labor als Modelle für die Grundlagenforschung und für Wirkstofftests zur Verfügung stehen. Im Körper können sich Leberzellen häufig teilen und regenerieren -– doch im Labor sind sie nur schwierig zu züchten. Sie teilen sich in der Zellkulturschale kaum noch und verlieren bereits nach wenigen Tagen die meisten ihrer Funktionen. Die Gewebeforschung der letzten Jahre hat gezeigt: Man muss die Leberzellen mit anderen Körperzellen zusammenbringen, um mit solchen dreidimensionalen Co-Kulturen die natürliche Umgebung so gut wie möglich nachzuahmen. Das gelingt bei Leberzellen, wenn man sie gemeinsam mit Blutgefäßwandzellen (Endothelzellen) hält. Dieses Wissen ermöglichte auch einen entscheidenden Schritt in Richtung eines ganzen biokünstlichen Organs. Denn die ausreichende Nährstoffversorgung von Zellgewebe ist die große Hürde bei der künstlichen Schaffung komplexer Organe in der Zellkultur. Ein feines Netzwerk von Blutgefäßen verbindet im Körper die Zellen mit dem Blutkreislauf und sorgt für den Gas- und Nährstoffaustausch im Gewebe. Da sich diese feingliedrige Versorgung künstlich nur schwer nachahmen lässt, führt das meist schnell dazu, das die künstlichen Organe im Reagenzglas absterben. Johanna Schanz und Heike Walles vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik (IGB ) in Stuttgart sind bei der Entwicklung eines organähnlichen Lebermodells mit funktionsfähigen Blutgefäßen bereits einige wichtige Schritte vorangekommen. Das Besondere: Die Bioingenieure entfernen zunächst von einem Stück Schweinedünndarm sämtliche tierischen Zellen. Die übriggebliebene Gerüststruktur behält aber noch das „Skelett“ der Blutgefäße bei. Diese Form wird sowohl mit Leberzellen als auch mit Gefäßwandzellen besiedelt. Die Endothelzellen dienen als Barriere zwischen Blut und Gewebe. Das entstandene Blutgefäßsystem gewährleistet dabei die optimale Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff sowie den Abtransport von Toxinen und Abbauprodukten. Das Lebermodell der Stuttgarter Forscher muss in einem speziellen Bioreaktor kultiviert werden. Über Schläuche wird wie bei einem Blutkreislauf Nährlösung durch die Bioreaktor gepumpt. Ein Computer steuert den Druck und die 33 Fließgeschwindigkeit des Nährmediums, um den Blutfluss möglichst naturgetreu zu simulieren. Das dynamische System erlaubt es nun, Lebergewebe über mehrere Wochen zu kultivieren. Und tatsächlich: Die Zellen arbeiten im Lebermodell ähnlich wie im Körper. Sie entgiften, bauen Medikamente ab und Eiweiße auf. Damit haben die Gewebespezialisten in Stuttgart ein Testsystem geschaffen, mit dem Arzneien überprüft und die Anzahl von Tierversuchen verringert werden könnte. Mikrochip als Medikamententestsystem Ein weiteres Testsystem mit dreidimensionalen Leberzellkulturen, allerdings im Mikrometer-Maßstab, haben Forscher um Martin Stelzle vom Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) an der Universität Tübingen im Rahmen des vom BMBF geförderten Verbundprojekts „HepaChip“ entwickelt. Das System basiert auf einem Mikrofluidik-Chip, in dem Leberzellen und die Endothelzellen gemeinsam kultiviert werden. Mithilfe von elektrischen Feldern haben die Forscher die beiden Zelltypen in einer gefäßartigen Struktur angeordnet. Die 3D-Anordnung kommt der natürlichen Situation in der Leber recht nahe. Die Lebermikrochips können über mehrere Tage mit Nährmedium gespült und mit pharmakologischen Substanzen getestet werden. Derzeit untersuchen die Forscher die Zuverlässigkeit ihres Tests. Da sich das System automatisieren lässt, ist der HepaChip aus Sicht der Wissenschaftler gerade für die Pharmaindustrie interessant, etwa wenn es um große Testreihen oder Langzeitexperimente geht. Forscher aus Reutlingen haben einen Leberchip im Mikromaßstab entwickelt, mit dem sich Arzneien testen lassen. 34 KnocHEn unD KnoRPEl: ZuM wacHStuM anREGEn Knochen und Knorpel: Zum Wachstum anregen Knochen kann sich bei kleineren Verletzungen selbst regenerieren, Knorpel lässt sich gut im labor vermehren. Das nachzüchten dieser Gewebe spielt deshalb eine wichtige Rolle für die Regenerative Medizin und hat bereits Einzug in die klinische Praxis gehalten. Doch noch sind die anwendungen auf lokale Schäden begrenzt. Im trend: Stammzellen als Heilungshelfer und Bio-Implantate, die vorübergehend die Knochenbildung vor ort ankurbeln. Fast jeder dritte Erwachsene in Deutschland leidet an einer Arthrose, also einer fortschreitenden Verschleißerkrankung an mindestens einem Gelenk. Bisher wird eine Arthrose mithilfe von Schmerzmitteln gelindert, bei Handlungsbedarf werden Prothesen eingesetzt. Eine regenerative Therapie zielt hingegen darauf ab, die abgenutzten Knorpelstellen auf biotechnologischem Wege wieder aufzubauen. Ähnliches gilt für Knochendefekte, wie sie durch Verletzungen, Tumorerkrankungen oder Knochenschwund (Osteoporose) entstehen. Auch für den Oberkiefer, zum Beispiel zum Eingliedern von Zahnimplantaten, wollen Chirurgen den Knochen möglichst vollständig und stabil wiederherstellen. Forscher aus Berlin arbeiten daran, die Knochenheilung zu verstehen und gezielt mithilfe von Stammzellen anzuregen. Hier ist Knochengewebe zu sehen, das sich im Stadium der Verknöcherung befindet. Knochen haftet das Image der Dauerhaftigkeit an. Doch auch das menschliche Skelett wird ständig umgebaut und runderneuert. Nur 6 bis 12 Monate dauert der Austausch der Knochenzellen im Körper. Am ständigen Umbau der Knochen sind verschiedene Zelltypen beteiligt: Osteoklasten bauen alte Knochensubstanz ab. Ihre Gegenspieler, die Osteoblasten, bauen neue mineralische Substanz aus Kalzium und Phosphat auf. Nach einer Verletzung treten die sogenannten mesenchymalen Stammzellen im Knochenmark in Aktion. Dank dieser vielseitigen Bindegewebsreparaturzellen können Knochen selbst Brüche erstaunlich gut meistern. Es bildet sich an einer Bruchstelle eine Knochennarbe, die Vorläuferzellen aus dem Knochenmark beginnen sich zu teilen und entwickeln sich zu knochenbildenden Osteoblasten. Die Osteoblasten produzieren Bindegewebsfasern und sorgen für die Einlagerung von Mineralsalzen. Wachsen jetzt noch Blutgefäße in die Knochenhaut ein, so ist der Knochen wieder verheilt. Knorpel hingegen besitzt im Körper nur geringe Regenerationsfähigkeiten. Gerade in den Gelenken nutzt sich der Knorpel daher ab, er wird spröde und anfällig für Verletzungen, wie etwa der Meniskus oder die Bandscheiben. Da Knorpel aber nur aus einem einzigem Zelltyp besteht, den Chondrozyten, eignet sich Knorpel für die Gewebenachzüchtung im Labor. Gerade bei Knochen und Knorpel ist die Kunst der Gewebeherstellung, das Tissue Engineering, schon vergleichsweise weit entwickelt. Einige Anwendungen werden entweder in klinischen Studien getestet oder bereits in der Praxis genutzt. Gerade hier zeigt sich die neue Ausrichtung der Medizin weg von der Reparatur mit Prothesen hin zur Regeneration mit Zellgewebekonstrukten. Schon lange wird aber auch an Materialien geforscht, die sich als künstlicher Knochenersatz möglichst verträglich in die defekte Stelle einfügen und die den vielfältigen mechanischen Belastungen standhalten. Der Trend geht hin zum sogenannten biomimetischen Konzept: Also künstliches Gewebe oder Materialen so herzustellen, dass sie die natürlichen Strukturen so gut wie möglich nachahmen. Solche Biokonstrukte sollen sich nicht nur besser und schonender in das umgebende Gewebe eingliedern. Im Idealfall sollen diese Implantate vorübergehend durch Freisetzen von Wachstumsfaktoren die körpereigenen Regenerationskräfte zusätzlich ankurbeln. Dazu nutzen die Forscher verschiedene Mixturen aus Biomaterialien, Signalmolekülen und Zellen. KnocHEn unD KnoRPEl: ZuM wacHStuM anREGEn Knorpel galt lange Zeit als nicht heilbares Gewebe, der künstliche Gelenkersatz mit Prothesen blieb die einzige Wahl für die Ärzte. Erst seit Mitte der 1990er Jahre wurde eine Technik entwickelt, um lokale Knorpeldefekte, wie sie nach Verletzungen entstehen, mithilfe von biokünstlichen Transplantaten zu kurieren, die aus Knorpelzellen der Patienten herangezüchtet werden. Pro Jahr werden in Deutsch- 35 land mittlerweile etwa 2.000 Betroffene mit einer solchen Autologen Chrondrozyten-Transplantation (ACT) behandelt. Einem Patienten werden dazu aus dem Knie winzige Knorpelproben entnommen, aus denen die Chondrozyten isoliert werden. Während die Zellen im Körper recht träge sind, lassen sie sich in der Kulturschale sehr einfach vermehren. Auf einer Stützunterlage können sie innerhalb weni- wie gut ist der Gewebeersatz: Knorpelhersteller prüfen die Qualität ihrer Produkte Bis der im Labor gezüchtete Gewebeersatz in der Praxis breiten Einzug halten wird, gilt es noch einige Hürden zu nehmen: Es braucht überzeugende Nachweise für Wirksamkeit und Nutzen solcher Behandlungen, zudem sollen sie auch aus gesundheitsökonomischer Sicht effizient sein. Doch solche Nachweise sind für die neuartigen, individuellen Therapien meist schwer zu führen, da oft noch keine anerkannten Qualitätsanzeiger etabliert sind. Die neuen Richtlinien der Europäischen Arzneimittelagentur EMA fordern für eine Zulassung von Arzneiprodukten aus menschlichen Zellen umfangreiche Verträglichkeitstests und eine Prüfung der mechanischen Eigenschaften eines Kunstgewebes – und zwar vor, während und nach der Transplantation. Gerade bei Knorpelzellimplantaten ist die biomechanische Belastbarkeit einer der Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Behandlung. Außerdem gibt es großen Bedarf an Biomarkern, also molekularen oder biochemischen Anhaltspunkten, die Ärzten Aussagen über die Reinheit und die Wirkung der Knorpelprodukte erlauben. Hier setzt ein strategischer Dachverbund mit dem Kürzel„NET-B“ an. NET-B umfasst vier Knorpelersatzforschungsprojekte von sieben Forschungseinrichtungen und sieben Unternehmen. Der Verbund wird bis 2012 vom BMBF mit 10 Millionen Euro unterstützt. Ein vom Hersteller Endolab koordiniertes Teilprojekt hat zum Ziel, die Belastbarkeit und die biomechanischen Eigenschaften von Knorpelzelltransplantaten im Labor und im Tiermodell zu testen. Weitere Teilprojekte der Knorpelhersteller Biotissue Technologies und Tetec AG umfassen klinische Studien, Diese künstliche Knorpelgewebe kann wieder in ein krankes Knie eingesetzt werden. Wie sicher und wie belastbar der Knorpelersatz ist, wird in verschiedenen Projekten geprüft. in denen der Einsatz von Knorpelersatzgewebe am Patienten getestet wird. Ein viertes Teilprojekt hat die Überführung von Knorpelzellprodukten in die medizinische Praxis im Visier. So soll ein Prüflabor eingerichtet werden, in dem sich alle nötigen Tests durchführen lassen, die für die Zulassung regenerativer Medizinprodukte notwendig sind. Die Forscher erhoffen sich Erkenntnisse darüber, wie man die Lebensdauer und die Einsatzbereiche von BiotechKnorpel vergrößern kann. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „Regenerationstechnologien“: „Strategischer Dachverbund NET-B-Qualitätsmanagement für die regenerative Knorpeltherapie“ (2009 bis 2012) Partner: u. a. NMI Technologietranfer GmbH, Tetec AG, Biotissue Technologies GmbH, Endolab GmbH 36 KnocHEn unD KnoRPEl: ZuM wacHStuM anREGEn ger Wochen zu neuem Gewebe herangezüchtet werden. Mit solchem Knorpelgewebe können aber bislang nur kleine lokale Defekte passgenau ausgebessert werden. Noch nicht geeignet ist das Verfahren für die hunderttausende Patienten, die unter Gelenkverschleiß, zum Beispiel am Knie, leiden. Doch daran wird in mehreren BMBF-Verbundprojekten geforscht (siehe Kasten S. 35): Die Reutlinger Biotech-Firma Tetec AG und das Naturwissenschaftliche und Medizinische Institut an der Universität Tübingen (NMI) konnten zeigen, dass sich selbst aus einem maroden Gelenk mit einer Arthrose noch vermehrungsfähige Chondrozyten gewinnen und züchten lassen. Alternativ lassen sich die benötigten Knorpelzellen auch aus mesenchymalen Stammzellen aus dem Knochenmark gewinnen, indem man sie in der Petrischale zu knorpelartigen Zellen umwandelt. Noch tüfteln Zellingenieure weltweit an der geeigneten Rezeptur, mit der sich die Stammzellen zuverlässig zu purem Gelenkknorpel heranreifen lassen. Von sich aus entwickeln sich die Stammzellen in der Kulturschale nämlich eher zu Wundheilknorpel, der etwas andere Eigenschaften besitzt. Knorpelproduktion im Körper stimulieren Einen völlig neuen Ansatz für die Herstellung von neuem Knorpel erforschen Gewebe-Ingenieure um Prasad Shastri an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Die Forscher wollen den Körper selbst gezielt dazu anregen, Gelenkknorpel in ausreichender Menge herzustellen. Dazu spritzen sie ein gelartiges Biomaterial unter die Knochenhaut des Schienbeins. Das Gel löst an dieser Stelle offenbar einen Sauerstoffmangel aus, der die Zellen dazu drängt, sich in Knorpelgewebe zu verwandeln. Die Forscher nennen dieses Vorgehen in vivo-Tissue engineering. Der Körper wird hier selbst zum lebendigen Bioreaktor. Den neu entstandenen Knorpel haben die Forscher herausoperiert und bei Kaninchen in defekte Gelenke hineinverpflanzt. Hier fügte sich das Ersatzgewebe gut ein und verkalkte auch nach neun Monaten nicht. Das neue in vivo-Verfahren soll bald auch in ersten klinischen Patientenstudien erprobt werden. Sollte sich die Methode als sicher und zuverlässig erweisen, wäre dies vielleicht eine interessante Option für die Behandlung von größeren Gelenkknorpelschäden. Darüber hinaus wird an der Behandlung von Bandscheibenvorfällen geforscht. Bandscheiben sind die Stoßdämpfer der So sehen Knorpelzellen in der Zellkulturschale aus. Sie können im Labor recht gut herangezüchtet werden. Wirbelsäule. Sie sind wie scheibenförmige Kissen von einem knorpeligen Außenring umfasst und mit einer gelartigen Knorpelmasse gefüllt. Bei einem Bandscheibenvorfall quillt das Gel aus den spröde gewordenen Bandscheiben heraus und quetscht dabei Nerven ein, was zu Lähmungserscheinungen führt. Die gängige Behandlungsmethode ist eine Operation, bei der das ausgetretene Bandscheibenzellen-Gel entfernt wird. Da die Bandscheibe sich nicht selbst regenerieren kann, wird die verbliebene Knorpelmasse dabei also dünner und sie ist weiterem Verschleiß ausgesetzt. Mehrere Biotech-Unternehmen und klinische Forschergruppen haben mittlerweile Verfahren entwickelt, um die Bandscheiben nach einer Operation wieder biologisch aufzubauen. Die Zucht von Bandscheibenknorpelmasse ähnelt der Technik beim Gelenkknorpel: Den Patienten werden nach einem Bandscheibenvorfall zunächst kleine Mengen Bandscheibengewebe entnommen, die Zellen in Kultur aufbereitet und vermehrt. Die Teltower Biotech-Firma Co.don AG hat sich auf die Nachzucht von patienteneigenen Bandscheibenzellen spezialisiert. Einige Monate nach der Entnahme werden die gezüchteten Ersatzzellen in Form eines Gels wieder in die kranke Bandscheibe gespritzt – wie bei einem Nachfüllpack. Dadurch soll die weitere Abnutzung der Bandscheibe verhindert werden. Die Behandlungsmethode ist bereits seit mehreren Jahren auf dem Markt, ihr Nutzen wird derzeit in klinischen Studien überprüft. Erste vorliegende Ergebnisse sind vielversprechend: Im Vergleich zu anderen Behandlungsmethoden führte die Zelltherapie zu Verbesserungen. KnocHEn unD KnoRPEl: ZuM wacHStuM anREGEn Knochenheilung mit Stammzellen Komplexe Knochenbrüche lassen sich nicht einfach durch Kleben oder mit Nägeln reparieren, die notwendige Heilung muss der Knochen selbst erledigen. Doch mit zunehmendem Alter lassen die Regenerationskräfte im Knochen nach. Forscher an mehreren deutschen Universitätskliniken suchen deshalb nach Methoden, um die Knochenheilung auch bei alten Menschen zu beschleunigen. Forscher vom Berlin-Brandenburg Centrum für Regenerative Therapien (BCRT) analysieren dazu im Detail, wie die Knochenheilung in der Natur abläuft. Offenbar gehen während des Alterns wichtige Wachstumsfaktoren verloren. Eine vielversprechende Therapie ist der Einsatz von Stammzellen aus dem Knochen- 37 mark. Diese können die Mediziner während einer Operation vom Patienten gewinnen und anreichern. In die Knochenbruchstelle können die Stammzellen dann schon während des Eingriffs oder aber nach mehrwöchiger Züchtung im Labor gespritzt werden. Die Stammzellen setzen offenbar am Knochenspalt einen Cocktail von Wachstumsfaktoren und anderen Stoffen frei, der die Heilungsprozesse und das Einwachsen von Blutgefäßen fördert. Ein Problem, das die Biomediziner jedoch beschäftigt: Die adulten mesenchymalen Stammzellen der Senioren sind mit ihrem Besitzer mitgealtert und eignen sich nur noch eingeschränkt für die Regeneration. In Dresden, Berlin und Würzburg wird deshalb daran geforscht, wie die Stammzellen älterer Menschen im Labor wieder für die Knochenheilung fit gemacht werden können. Biokünstlicher Knochenersatz – mit Rohstoffen aus dem Meer Wenn Material für einen biologischen Knochenersatz gebraucht wird, so wird dies bislang beim Patienten selbst an einer Körperstelle entnommen und dann verpflanzt. Eine weniger belastende Alternative wäre biotechnologisch gezüchteter Knochen. Damit Knochenzellen erfolgreich im Labor zu einem Gewebe werden können, müssen sie auf einem dreidimensionalen Gerüst aus Biomaterialien wachsen. Das können Alginate, Kollagene, HydroxylapatitKristalle oder Keramiken wie Calciumphosphat sein. Die körperverträglichen Materialen weisen meist feine Poren auf, die wie ein Klettergerüst Dieses Trägergerüst ist aus marinem Kollagen aufgebaut. Es kann mit Knochen- oder Knorpelzellen besiedelt werden. für die Zellen wirken. In einem Bioreaktor werden die Implantate mit Stammzellen besiedelt, die zuvor aus dem Knochenmark des Patienten gewonnen wurden. Zusätzlich werden die Oberflächen der Gerüste mit Wachstumsfaktoren beschichtet. Das entstandene Implantat soll im Körper wie eine Leitschiene auf die Umgebung wirken: Im umliegenden Gewebe wird die Regeneration angeregt, und die Knochenmasse wächst nach und nach in das Implantat ein, während die Leitstruktur nach einiger Zeit abgebaut wird. In einem vom BMBF geförderten Projekt testen Forscher aus Dresden, Freiberg und Lübeck Kollagene aus Meereslebewesen auf ihre Eignung als verträgliches und vielseitiges Gerüstmaterial. Für die Herstellung von Knochen gewinnen die Forscher Kollagen vom Typ-I aus Fischhäuten, für die Knorpelzucht mit dem Kollagen Typ-II nutzen sie marine Quallen. Durch die Kombination dieser Materialien wollen die Zellingenieure Verbundteile aus Knorpelknochen produzieren. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „Zellbasierte regenerative Medzin“: „Regeneration mit zellspezifischen Matrices (RECEM)“ (2009-2012) Partner: TU Dresden, Universität Lübeck, Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen 38 nERVEn unD GEHIRn: REGEnERatIonSPotEntIal auSlotEn Nerven und Gehirn: Regenerationspotenzial ausloten Schlaganfälle oder neurodegenerative leiden sind deswegen so folgenschwer, weil das zerstörte Gehirngewebe kaum zur Regeneration fähig ist. Spenderzellen aus dem labor sollen helfen, die zerstörten Regionen wieder zu ersetzen. Forscher wollen Stammzellen im Gehirn besser verstehen und sie gezielt zur Vermehrung anregen. Darüber hinaus sollen biokünstliche Materialien bei lähmungen dazu beitragen, dass nervenfasern wieder wachsen. Reprogrammierte Patienten-Zellen sollen künftig für die Erforschung und Behandlung eine Schlüsselrolle spielen. Schwannsche Zellen sind wichtige Stützzellen im Nervensystem. Deshalb sind sie für die Regenerative Medizin bedeutsam. Der demographische Wandel bringt es mit sich: Immer mehr Menschen werden immer älter, damit steigt auch die Zahl neurodegenerativer Erkrankungen wie etwa Alzheimer oder Parkinson. Bei diesen schleichenden, bislang unheilbaren Leiden kommt es zu massivem Nervenzellsterben im Gehirn, was zu Bewegungsstörungen und geistigen Beeinträchtigungen führt. Nach Ansicht von Gesundheitsforschern werden bis 2040 die neurodegenerativen Leiden nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und noch vor Krebs die zweithäufigste Todesursache sein. Einmal abgestorben, so dachten Wissenschaftler bis vor wenigen Jahren, sind Nervenzellen für immer verloren. Auch Verletzungen des Rückenmarks galten lange Zeit als unheilbar. Doch aktuelle Fortschritte in der Neuro- und Stammzellbiologie machen Hoffnung: Sie zeigen nicht nur das mögliche Potenzial von Zellersatzbehandlungen. Es gibt offenbar auch einige Regionen im Gehirn, in denen Stammzellen sitzen, die dafür sorgen, dass ein Leben lang neue Nervenzellen gebildet werden. Dieser Fund hat den Blick auf das Gehirn verändert und eröffnet Regenerationsmedizinern auch völlig neue Therapieansätze. Zellverluste bei Parkinson ersetzen Morbus Parkinson gehört zu den häufigsten neurodegenerativen Leiden, etwa 300.000 Menschen sind in Deutschland betroffen. Bei Parkinson-Patienten stirbt insbesondere eine bestimmte Gruppe von Nervenzellen im Mittelhirn ab, die den Botenstoff Dopamin herstellt. Durch den Dopaminmangel treten das typische Muskelzittern und Lähmungen auf, die zur vollständigen Bewegungslosigkeit führen können. Medikamente oder aber Verfahren wie die tiefe Hirnstimulation mittels eingepflanzter Elektroden werden heute allenfalls zur Linderung der Symptome eingesetzt, sie können das Fortschreiten der Erkrankung aber nicht stoppen. Da nur ein Zelltyp, die Dopamin-produzierenden Nervenzellen, betroffen ist, gilt Parkinson als Kandidat für eine Zellersatztherapie. Bereits seit mehr als 20 Jahren testen Neuroforscher, ob ins Gehirn transplantierte Ersatzzellen die Funktion des Dopamin-Produzenten übernehmen können. Für diese Eingriffe verwenden Mediziner vor allem Stammzellen, die von abgetriebenen Föten gewonnen werden. In klinischen Studien zeigte ein Teil der Patienten nach dieser Behandlung spürbare Verbesserungen. Allerdings belegt die bisherige Studienlage den Nutzen der Therapie noch nicht klar genug. Eine große internationale klinische Transplantationsstudie im Rahmen einer EU-Förderung unter Beteiligung von Freiburger Forschern testet derzeit die Sicherheit und Effektivität einer technisch verfeinerten Form dieser Therapie. Langfristig möchten die Mediziner aber weg von den fetalen Stammzellen. Andere Quellen für dopaminerge Nervenzellen könnten embryonale Stammzellen sein. Hier testen deutsche Forscher, wie die Arbeits- nERVEn unD GEHIRn: REGEnERatIonSPotEntIal auSlotEn gruppe von Oliver Brüstle an der Universität Bonn, mit welchen Rezepten sich die Stammzellen im Reagenzglas zuverlässig und sicher zu dopaminergen Nervenzellen züchten lassen. Im Tierversuch funktioniert die Zelltherapie bereits. Allerdings ist die Arbeit mit menschlichen embryonalen Stammzellen ethisch wie immunologisch ebenfalls problematisch. Deshalb erfahren die neuen Möglichkeiten zur künstlichen Reprogrammierung von Körperzellen (vgl. S. 7ff.) derzeit große Aufmerksamkeit. 39 Da sich mit dieser Technik aus Körperzellen eines Patienten neuronale Ersatzzellen züchten lassen, könnte dieser Methode künftig eine Schlüsselrolle zukommen. Letztlich befinden sich aber all diese Ansätze noch in einer experimentellen Phase. Während Parkinson eine schleichende Erkrankung ist, trifft ein Schlaganfall viele Betroffene aus heiterem Himmel. Hier kommt es zu einer Durchblutungsstörung im Gehirn, in der Folge sterben Durchtrennte nervenfasern mit leitschienen wieder zusammenführen Werden bei einer schweren Verletzung Nervenstränge durchtrennt, so treten häufig Lähmungen und andere Behinderungen auf. Nervenfasern können im Körper zwar wieder auswachsen, doch oft fehlt ihnen über längere Strecken die Orientierung und sie sprießen verloren umher. Chirurgen entnehmen deshalb meist einen einigermaßen entbehrlichen Nerv aus dem Bein des Patienten, um die durchtrennten Nervenstränge mit diesem Ersatzteil zu überbrücken, so dass sie wieder zusammenfinden. Doch diese körpereigenen Transplantate sind nur sehr begrenzt verfügbar, noch dazu kann es bei solchen Eingriffen zu Nebenwirkungen kommen. Mediziner um Ahmet Bozkurt vom Universitätsklinikum der Rheinisch-Technischen Hochschule (RWTH) Aachen entwickeln zusammen mit der BiotechnologieFirma Matricel in Herzogenrath sogenannte In ein Kollagen-Gel werden Kanäle hineingefräst. Durch diese Leitstrukturen können sich Nervenfasern hindurchtasten. biokünstliche Nervenleitschienen. Nach einem patentierten Verfahren werden in ein KollagenGel mittels wachsender Eiskristalle feinste Hohlräume gefräst. Die entstandenen inneren Leitröhrchen werden anschließend mit patienteneigenen Schwann-Zellen – den natürlichen Hüll-und Stützzellen im Nerven – besiedelt. Diese Zellen lagern sich an und locken durch abgesonderte Wachstumsfaktoren die wachsenden Nervenfasern an. Danach umschließen sie die einsprießenden Axone wie ein Strumpf und formen die sogenannte Myelinschicht. Die bisherigen Studien haben gezeigt, dass die SchwannZellen als Lotsen offenbar der Schlüssel für eine erfolgreiche künstliche Nervenleitscheine sind. Die Forscher haben ihre „Biohybride“ im Tierversuch getestet. Dazu werden die Brücken-Konstrukte in Ratten mit durchtrennten Beinnerven implantiert. Nach mehreren Wochen zeigte sich, dass ein effektives Aussprossen der Nervenfasern in die Leitstruktur erfolgt und dass die regenerierenden Nervenfasern den Muskel auch tatsächlich erreichen und zum Zusammenziehen anregen können. Nun soll die Strategie klinisch bei Patienten erprobt werden. Projekt in den BMBF-Förderinitiativen „BioChancePlus“ und „KMU-innovativ“: „Rekonstruktion peripherer Nervendefekte durch schwannzellbesiedelte Kollagenmatrices mit definierter Röhrenstruktur“ (2008 bis 2010), „Klinische Interventionsstrategie zur überbrückenden Behandlung akuter und chronischer peripherer Nervendefekte bei Patienten“ (2011-2014) Partner: Matricel GmbH 40 unterversorgte oder durch Blutergüsse gequetschte Hirnregionen ab. Gleich mehrere Nervenzelltypen sind von diesem Untergang betroffen. Die Folge sind Lähmungen und geistige Beeinträchtigungen. Regenerative Therapien zielen beim Schlaganfall weniger auf den Ersatz der untergegangenen Zellen ab. Stattdessen sollen eingepflanzte Stammzellen die Selbstreparatur-Mechanismen im Gehirn ankurbeln. Solche Ansätze befinden sich aber noch in einer frühen experimentellen Testphase: Neurochirurgen des International Neuroscience Institute (INI) in Hannover erproben derzeit in einer klinischen Pilotstudie eine Stammzelltherapie nach dem „Teebeutelkonzept“ : Dabei wird Schlaganfallpatienten ein kleiner Behälter mit gentechnisch veränderten Stammzellen aus dem Knochenmark in das Gehirn eingesetzt. Wie eine kleine Arzneimittelfabrik sondern die Stammzellen wachstumsfördernde und entzündungshemmende Eiweiße ab. Da die körperfremden Stammzellen mit einem Alginat umkapselt sind, werden sie vom Immunsystem des Patienten nicht abgestoßen. Nach zwei Wochen wird der Stammzellbeutel bei einer FolgeOperation wieder entfernt. Erste Ergebnisse aus der Pilotstudie stimmen die Forscher optimistisch, dass die im Tierversuch belegte Wirkung auch beim Menschen so eintreten könnte. Stammzellen reifen in der Kulturschale zu den verschiedenen Komponenten des Nervensystems aus, hier zum Beispiel zu Oligodendrozyten. nERVEn unD GEHIRn: REGEnERatIonSPotEntIal auSlotEn Das Nervensystem eines Erwachsenen bringt zwar nur im geringen Umfang neue Zellen hervor, allerdings können die Fortsätze der Nervenzellen (die Axone) wachsen. Die manchmal meterlangen Ausläufer leiten wie Kupferkabel elektrische Signale von den Zellen des Rückenmarks hin zu den Muskeln. Wird eine Nervenfaser durchtrennt, so schiebt die betroffene Nervenzelle einen beweglichen Wachstumskegel vor, der sich täglich einen Millimeter weiter in die Umgebung vortastet und das abgetrennte Pendant des Nervenstrangs wieder zu fassen versucht. Meist gelingt dieser Anschluss aber nicht mehr, weil die Lücke zu groß ist oder wucherndes Narbengewebe den Weg versperrt. Künstliche Straßen für wachsende nerven Chirurgen helfen bislang dem gerichteten Wachstum auf die Sprünge, indem sie einen Nervenstrang an anderer Stelle des Körpers entnehmen und als Lückenfüller einbauen. Künstliche Nervenleitschienen sollen diese Behandlung ersetzen (siehe Kasten S. 39). Neben den Aachener Forschern testen auch Wissenschaftler vom Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI) in Reutlingen diesen Ansatz. Deren biokünstliche Implantate sollen den Aufbau eines Nervenstrangs so gut wie möglich nachahmen: Sie bestehen aus KollagenHohlröhren, die mit einem Geflecht aus feinsten Polymerfilamenten gefüllt sind und sich nach einer bestimmten Zeit abbauen. Diese Strukturen werden zusätzlich mit patienteneigenen Schwann-Zellen besiedelt, damit die Nervenfasern angelockt werden. Zugesetzte Wachstumsfaktoren sollen zudem Blutgefäße sprießen lassen, um die Nährstoffversorgung des nachwachsenden Nervenstrangs zu gewährleisten. Wissenschaftler würden Nervenleitschienen gerne auch bei Rückenmarksverletzungen einsetzen, doch die Situation ist hier ungleich schwieriger: Bei einer Querschnittslähmung, wie sie weltweit 30 000 Patienten pro Jahr erleiden, kommt es zur Quetschung von Nervensträngen im Rückenmark. Die Folge: An der verletzten Stelle bilden sich Narben, die die aussprossenden Nervenfortsätze nicht passieren können. Hinzu haben Forscher entdeckt, dass im Rückenmark wie auch im Gehirn bei Verletzungen körpereigene Eiweiße freigesetzt werden, die die Regeneration hemmen und die Axone in ihrem Wachstum bremsen. Könnte man solche Hemmstoffe gezielt blockieren, so die Idee, nERVEn unD GEHIRn: REGEnERatIonSPotEntIal auSlotEn dann müssten Nervenschäden wieder heilen. Tübinger Forscher versuchen deshalb, ihren Nervenleitschienen einen Hemmstoffblocker zuzusetzen. Züricher Forscher um Martin Schwab haben eine Antikörpertherapie entwickelt, die die molekularen Bremsklötze aushebeln kann. Einen anderen Ansatz wählt das biopharmazeutische Unternehmen SCT Spinal Cord Therapeutics GmbH aus Düsseldorf. Es testet derzeit ein Medikament, das gezielt die Narbenbildung nach einer Rückenmarksverletzung unterbindet. Stammzellen im Gehirn gezielt nutzen Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Neurowissenschaften in den letzten Jahren brachte ein Dogma ins Wanken. Noch bis vor wenigen Jahren galt es als unumstößlich: Einmal abgestorbene Nervenzellen sind verloren und können beim Erwachsenen nicht von selbst ersetzt werden. Doch dann entdeckten Forscher zwei Regionen im Gehirn, in denen auch beim Menschen zeitlebens neue Nervenzellen gebildet werden. Diese Areale sind der für das Gedächtnis wichtige Hippocampus und der Riechkolben. Hier sitzen neuronale Stammzellen, die sich teilen und neue Nervenzellen hervorbringen und sich anschließend in das Netzwerk des Gehirns integrieren können. Diese sogenannte adulte Neurogenese hilft also dabei, das erwachsene Gehirn zu regenerieren. Die Entwicklungsbiologin Magdalena Götz vom Helmholtz-Zentrum in München ist seit vielen Jahren den Geheimnissen der Neubildung von Nervenzellen im erwachsenen Gehirn auf der Spur. So konnte die Forscherin zeigen, dass sich sogenannte Gliazellen, denen lange Zeit bloß eine Stütz- und Ernährungsfunktion im Gehirn zugeschrieben wurde, in bestimmten Fällen teilen können und dabei Nervenzellen hervorbringen. Gliazellen sind also die neuronalen Stammzellen des Gehirns. Für ihre Forschungen wurde Götz im Jahr 2007 mit dem renommierten Leibniz-Preis ausgezeichnet. Gliazellen befinden sich zwar überall im Gehirn, doch in den meisten Regionen haben sie die Fähigkeit verloren, Neuronen zu bilden. Bei Mäusen hat das Forscherteam um Götz jedoch beobachtet, dass die Gliazellen nach Verletzungen im Gehirn wieder damit beginnen, sich zu teilen und zu Stammzellen zu werden. Die Münchner Forscher suchen nun nach speziellen Regulatormolekülen, mit denen sich die Neurogenese möglichst in allen Teilen des Gehirns stimulieren lässt. 41 Neurowissenschaftler haben beobachtet, dass gerade bei neurodegenerativen Erkrankungen die Neubildung von Nervenzellen gestört ist. Sie erhoffen sich durch die Erforschung dieses Prozesses bei Erwachsenen deshalb nicht nur ein besseres Verständnis über die Entstehung dieser Krankheiten. Die Hoffnung ist es, den krankhaften Prozessen entgegenzuwirken, indem man die Neubildung von Nervenzellen gezielt fördert. Eine von einigen Forscher verfolgte Strategie käme sogar ohne einen chirurgischen Eingriff aus: Hierbei soll die Neurogenese im Gehirn mithilfe bestimmter Wirkstoffe gezielt von außen angekurbelt werden. Die Neurobiologen suchen so etwas wie einen Dünger für die Hirnzellen. Solch ein Startsignal für das Nachwachsen von Nervenzellen könnte auch durch körperliche und geistige Aktivität ausgelöst werden. Dieser Hypothese gehen Forscher um Gerd Kempermann vom Forschungszentrum für Regenerative Therapien in Dresden (CRTD) nach. Um die Neurogenese im Hippocampus zu untersuchen, lassen sie Mäuse ein forderndes Training absolvieren. Dann testen sie, wann und wie neurale Stammzellen im Gehirn aktiv werden – und zwar im Vergleich zu Mäusen ohne Bewegung. Auch wenn ein möglicher Einsatz von neuralen Stammzellen in der klinischen Praxis noch lange erprobt werden muss: für die Erforschung von neurodegenerativen Erkrankungen können diese Zellen schon heute wertvolle Dienste leisten. Für Leiden wie Parkinson, Alzheimer oder Multiple Sklerose gibt es zwar Tiermodelle, sie spiegeln den Verlauf der schleichenden Erkrankungen aber nur sehr unzureichend wider. Durch die neuen Techniken der Zellreprogrammierung haben sich jedoch ganz neue Möglichkeiten aufgetan. Wandelt man die künstlich erzeugten Stammzellen im Labor zu Nervenzellen um, so kann man diese Gewebe nutzen, um potenzielle Wirkstoffe und Krankheitsmechanismen daran zu untersuchen. 42 nEuE tEStS: GEwEBE alS ERSatZ ZuM tIERVERSucH Neue Tests: Gewebe als Ersatz zum Tierversuch um Medikamente und chemikalien auf nebenwirkungen zu testen, sind tierversuche bislang unverzichtbar. Doch sie liefern mitunter keine hinreichend zuverlässigen Ergebnisse. Künstlich gezüchtete menschliche Gewebe oder organe sollen belastende tierexperimente reduzieren helfen und gleichzeitig die arzneitests sicherer und aussagekräftiger machen. Um die Sicherheit von Chemikalien, Kosmetika, Pflanzenschutzmitteln und Arzneimitteln für den Verbraucher zu gewährleisten, müssen die Inhaltsstoffe auf unerwünschte Wirkungen getestet werden, bevor es eine Zulassung für den Markt gibt. Bislang werden solche Tests vor allem auf der Basis von Tierversuchen durchgeführt. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) wurden 2010 in Deutschland rund 2,9 Millionen Wirbeltiere für Tierversuche und andere wissenschaftliche Zwecke eingesetzt. Die Tendenz ist in den letzten Jahren wieder ansteigend, was unter anderem am verstärkten Einsatz transgener Tiere in der biomedizinischen Grundlagenforschung liegt. Die Erforschung oder Entwicklung von Produkten, Geräten oder Verfahren für Human-, Zahn- oder Veterinärmedizin sind ebenfalls mit für die steigenden Zahlen verantwortlich. Neue EU-Verordnungen, wie etwa die Chemikalien-Richtlinie REACH, werden den Bedarf nach Ansicht von Experten noch weiter drastisch ansteigen lassen (vgl. Kasten S. 43). Dennoch gibt es Regelungen, um derartige Tests mit Tieren bestmöglich zu vermeiden. Wo immer es zuverlässige und zugelassene Alternativen für Tests gibt, müssen sie anstelle der Tierversuche angewendet werden. Das wird auch in der neuen Tierversuchsrichtlinie der EU betont, die im September 2010 verabschiedet wurde. Das BMBF unterstützt mit der Förderinitiative „Ersatzmethoden zum Tierversuch“ seit vielen Jahren die Suche nach derartigen Test-Alternativen. In den vergangenen 30 Jahren sind mehr als 120 Millionen Euro in 400 Forschungsprojekte geflossen. Heute sind weltweit rund 40 Testmethoden im Sinne des 3R-Konzepts (s. u.) als behördlich anerkannte Prüfmethoden auf dem Markt. Als Alternative eignen sich neben Computersimulationen vor allem Zellkulturen aus dem Labor. Ziel ist es, die Funktion von menschlichen Organen wie der Haut oder der Leber möglichst naturgetreu in Form von komplexen dreidimensionalen Zell- und Gewebekulturen nachzuahmen und damit die Tests zuverlässiger und aussagekräftiger zu machen. Zellkulturtests mit Prüfsiegel Wissenschaftlich überprüft werden Alternativen zum Tierversuch bei der Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch (ZEBET). Sie ist eine staatliche Forschungseinrichtung, die am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Berlin angesiedelt ist und legt bei der Prüfung das 3R-Konzept zugrunde. Darunter sind alle wissenschaftlichen Methoden zu verstehen, die mindestens eine der drei Anforderungen erfüllen: • durch die anwendung der Methode werden tierversuche ersetzt (Replacement) • die Zahl der Versuchstiere wird reduziert (Reduction) • das leiden und die Schmerzen der Versuchstiere werden vermindert (Refinement) Mithilfe von künstlichen menschlichen Hautmodellen lassen sich Substanzen auf unerwünschte Nebenwirkungen testen. nEuE tEStS: GEwEBE alS ERSatZ ZuM tIERVERSucH Schwerpunkt der ZEBET-Arbeit ist die Bewertung der alternativen Tests. Tierversuchsfreie Prüfmethoden werden auf ihre Tauglichkeit als akzeptables und zuverlässiges Verfahren hin überprüft. Ist ein neuer Test akzeptiert, muss noch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zustimmen. Erst wenn die OECD als internationale Organisation eine alternative Prüfmethode in Form einer Richtlinie anerkennt, ist sichergestellt, dass „validierte“ 43 Testverfahren auch in gesetzlich vorgeschriebenen Studien eingesetzt und von zuständigen Behörden weltweit anerkannt werden. Neben ihrer Prüfungsarbeit forschen die Wissenschaftler am ZEBET aber auch an eigenen Alternativen. Eines der Projekte dreht sich darum, dass Embryonen im Mutterleib besonders empfindlich auf Arzneistoffe und Industriechemikalien reagieren. Seit dem Contergan-Skandal muss des- Eu-Richtlinie REacH: tausende alt-chemikalien auf dem Prüfstand Hinter dem Kürzel REACH verbirgt sich die 2007 in Kraft getretene EU-Chemikalienverordnung „Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals“. Sie sieht vor, dass rund 30.000 Chemikalien, die vor 1981 auf den Markt gekommen sind, nachträglich auf ihre Giftigkeit geprüft werden sollen. Bis 2019 wird dies voraussichtlich einen enormen Anstieg an Tierversuchen nach sich ziehen. Allerdings schreibt die REACH-Verordnung auch ausdrücklich die Verwendung und die Suche nach alternativen Testmethoden vor. Neben den damit verbundenen ethischen Bedenken sind die herkömmlichen Tierversuche enorm teuer und zeitaufwendig. Die durch REACH entstehenden Zusatzkosten werden auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Der Bedarf an verlässlichen Alternativmethoden ist also groß. Einen weiteren Impuls zu alternativen Methoden aus dem Zelllabor liefert die 7. Kosmetik-Richtlinie. Sie verbietet seit dem 11. März 2009 den Gebrauch von Versuchstieren für Haut-Irritationstests mit Kosmetikprodukten. An Tieren getestete Kosmetikinhaltsstoffe werden also nicht mehr in Europa zugelassen und können nicht mehr vertrieben werden. Stattdessen soll an künstlichem Hautersatz getestet werden. Zudem gilt auch ein Vermarktungsverbot für alle Hygieneartikel aus dem nichteuropäischen Ausland, für deren Prüfung Tests mit Tieren durchgeführt wurden. Die Regelung erhöht den Druck auf die Kosmetikhersteller, nach Alternativen zu suchen. Hautreizungen, die Hautdurchdringung und die Auswirkung von Licht auf die Giftigkeit kosmetischer Inhaltsstoffe lassen sich mithilfe von Zellkulturen schon jetzt zum Teil zu- Die Chemikalienverordnung REACH erhöht den Druck auf Unternehmen, nach Alternativen zum Tierversuch zu suchen. verlässiger testen als durch Tierversuche. So können für Verträglichkeitsprüfungen an Haut und Auge mittlerweile rekonstruierte Hautmodelle anstatt Kaninchenaugen verwendet werden. Trotz solcher Erfolge gibt es noch jede Menge zu tun. Die EU-Kommission hat deshalb 2009 gemeinsam mit der europäischen Kosmetikindustrie ein neues Förderprogramm aufgelegt, für das 50 Millionen Euro für Forschungsvorhaben zur Verfügung stehen. Auch das BMBF fördert die Entwicklung von Ersatzmethoden im Tierversuch – in einem weltweit einmaligen Umfang. Innerhalb der vergangenen 30 Jahre sind mit bislang rund 120 Millionen Euro insgesamt 400 Forschungsprojekte finanziert worden. Dies wird auch in Zukunft weiter fortgesetzt. Mehr Informationen: www.ptj.de/alternativmethoden-tier 44 nEuE tEStS: GEwEBE alS ERSatZ ZuM tIERVERSucH halb jedes Medikament vor der Zulassung darauf geprüft werden, ob es Embryonen schädigen kann. Zwar lassen sich die Versuche mit schwangeren Tieren nicht vollständig ersetzen, am ZEBET werden jedoch vielversprechende Alternativen entwickelt, die Hinweise liefern sollen, ob bestimmte Wirkstoffe die Entwicklung des Nervensystems von Embryonen im Mutterleib beeinträchtigen können. Die sogenannte Entwicklungsneurotoxizität gehört zu den schwerwiegendsten Nebenwirkungen, die eine Chemikalie oder ein Arzneimittel auslösen kann. Die Prüfung erfolgt traditionell im Tierversuch, zumeist an Ratten. Für den Test an nur einer Substanz sind bisher bis zu 140 Muttertiere und 1.000 Jungtiere nötig, zugleich sind die Versuche extrem zeit- und kostenintensiv. Aus Sicht der ZEBET-Forscher bieten embryonale Stammzellen von Mäusen, die im Labor beliebig vermehrt werden können, eine gute Alternative. Die Idee: In der Zellkultur reifen die Stammzellen zu bestimmten Nervenzellen aus und werden dabei mit den zu prüfenden Stoffen behandelt. So zeigt sich, ob die Substanzen die Entwicklung der Nervenzellen schädigen. Die Forscher lassen aus den Stammzellen der Maus auch Herzmuskelzellen heranwachsen, die in der Petrischale regelmäßig schlagen. Stören die Substanzen die Ausbildung oder die Funktion dieser Mini-Herzgewebe, dann wird Alarm ausgelöst. Die ZEBET-Stammzelltests können damit für eine direkte Schädigung eines Embryogewebes Aussagen liefern. Ein Testsystem, das auf humanen embryonale Stammzellen basiert, haben Forscher um Thomas Eschenhagen entwickelt. Die Hamburger Forscher differenzieren die humanen Zellen im Labor zu herzmuskelähnlichem Gewebe, das sich besonders flexibel in Wirkstofftests einsetzen lässt. Neben derartigen Zellkulturtests gibt es auch Forschungs- Krebsforschung in 3D: tumorkugeln für bessere wirkstofftests Wirkstoffe für Krebstherapien werden herkömmlicherweise an Zellkulturen getestet, in denen Krebszellen in einer Schicht am Boden der Petrischale wachsen. Das spiegelt die natürliche Situation aber nur unzureichend wider, schließlich wuchern Tumore im Körper dreidimensional. Herkömmliche Wirkstofftests liefern deshalb wenig aussagekräftige Hinweise über die tatsächliche Schlagkraft einer Substanz. Unterstützt vom BMBF hat das 2006 von Barbara Mayer und Ilona Funke gegründete Münchner An kugeligen Mikrotumoren lassen sich zuverlässigere Aussagen gewinnen, wie wirksam Medikamente Krebszellen bekämpfen. Biotechnologie-Unternehmen Spherotec ein Verfahren entwickelt, bei dem sich Krebszellen in der Petrischale zu kleinen Kugeln organisieren, die sogenannten Sphäroide. Solche Sphäroide imitieren die Natur eines Tumors deutlich besser als bisherige Zellkulturen. Mit diesem Verfahren lässt sich rasch und unkompliziert an Hunderten von Mikrotumoren gleichzeitig testen, ob eine neue Substanz auch tatsächlich in das Tumorgewebe eindringt und dort seine Wirkung entfaltet. Das Sphäroidmodell ist auf zahlreiche Tumorarten anwendbar. Das Unternehmen hat einen Test entwickelt, mit dessen Hilfe man für einen Patienten vorab testen kann, welche Krebstherapie individuell am effektivsten wirkt. Das Diagnostikverfahren wird bereits bei Patienten mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung eingesetzt und aktuell in klinischen Studien erprobt. Projekt in der BMBF-Förderinitiative „MedSys“: „Systembiologie-basiertes Verfahren für die Entwicklung von präklinischen Leitstrukturen unter Benutzung eines in-vivo-nahen Sphäroid-Testsystems – Spher4Sys“ (2010-2013) Partner: Spherotec GmbH nEuE tEStS: GEwEBE alS ERSatZ ZuM tIERVERSucH bemühungen, organähnliche Gewebekulturen für Testzwecke voranzutreiben. Große Fortschritte sind dabei bereits bei künstlichen Hautmodellen erzielt worden. So sind mittlerweile eine ganze Reihe menschlicher Hautmodelle auf dem Markt erhältlich, von denen bisher von der OECD vier für die Prüfung ätzender Eigenschaften und drei für die Prüfung reizender Eigenschaften anerkannt worden sind. Alle diese Hautmodelle werden in Kunststoffplatten mit kleinen Kämmerchen geliefert, jedes Kämmerchen enthält Kunststoffmembran am Boden und darauf etwa einen Quadratzentimeter gezüchtete Vollhaut oder Oberhaut (Epidermis). Für Tests auf Hautreaktionen verabreichen Wissenschaftler den zu testenden Stoff auf die verhornte Oberhaut des Modells und behandeln es anschließend das gesamte Gewebe mit einem gelben Farbstoff, der sich in Gegenwart von lebenden Zellen blau färbt. So lässt sich unmittelbar erkennen, in welchem Maße die Zellen des Gewebes durch die Testsubstanz gestört wurde. Unabhängige Prüfungen haben gezeigt, dass der Test für den Menschen genauere Vorhersagen liefert als etwa die herkömmlichen Hautverträglichkeitstests an geschorenen Kaninchen. organe auf dem Mikrochip Trotz dieser Erfolge sind Forscher in den Zelllabors auch weiterhin damit beschäftigt, organähnliche Gewebekulturen immer weiter zu verbessern und die natürliche Situation bei Menschen immer besser zu simulieren. Darüber hinaus werden für die künstliche „Haut von der Stange“ vollautomatische Produktionsanlagen entwickelt (siehe Kapitel Haut), denn die Industrie wünscht sich für Arzneitests und für die Suche nach neuen Wirkstoffen vor allem Or- An Elektroden des Fraunhofer-FIT-Mikrofluidikchips sind Herzmuskelzellen angewachsen. Mit diesem System lassen sich Arzneien testen. 45 Embryonale Stammzellen entwickeln sich mit der passenden Rezeptur zu Zellen des Nervensystems (Astrozyten). An ihnen lässt sich überprüfen, ob Stoffe schädlich für die Gehirnentwicklung sind. ganmodelle, die in großer Stückzahl eingesetzt und auch bei Bedarf lange Zeit gelagert werden können. Dreidimensionale Gewebekulturen sind derzeit aber nicht nur für die Haut, sondern für nahezu alle menschlichen Organe in Arbeit. Insbesondere für Stoffwechselorgane wie die Leber und Niere sind die Forscher schon bedeutende Schritte vorangekommen. Eine zentrale Herausforderung ist dabei die gemeinsame Kultur verschiedener Zelltypen und die gleichmäßige Nährstoff- und Sauerstoffversorgung der Gewebeverbände in den Bioreaktoren (siehe Kapitel Leber). Ein Trend geht hin zur Miniaturisierung von Zellkulturen. Biotechnologen um Roland Lauster und Uwe Marx von der Technischen Universität Berlin entwickeln zum Beispiel einen Multi-Organ-Bioreaktor im Chipformat. Hierzu züchten sie in winzigen Kammern verschiedenartige Zellverbände im Mikromaßstab heran. Die winzigen Organe bestehen aus wenigen Zelltypen, die aber für sich bereits eine funktionelle Einheit bilden. Den Forschern ist es bereits gelungen, mehrere Organmodelle auf einem solchen Mikrochip miteinander zu kombinieren. Versorgt werden die Kammern durch ein Mikrofluidiksystem. Nach und nach sollen andere Organsysteme den Chip ergänzen, das Fernziel der Forscher ist es, möglichst den gesamten menschlichen Organismus als modulare Ansammlung von Zellmodellen auf einen Mikrochip zu packen. Die Multi-Organ-Chips wollen die Forscher zur Marktreife bringen, um daran Wirkstoffe zu testen. Diesen Kommerzialisierungsansatz fördert das BMBF im Rahmen der Gründungsoffensive GO-Bio mit knapp 3 Millionen Euro. 46 tRanSlatIon: DER ScHwIERIGE wEG In DIE PRaxIS Translation: Der schwierige Weg in die Praxis Der weg vom labor in die Klinik ist in der Regenerativen Medizin eine besonders große Herausforderung, denn die therapien werden auf den einzelnen Patienten zugeschnitten. translationszentren helfen dabei, die Entwicklung von Regenerationstechnologien von der Forschung zur Marktreife voranzutreiben. neben mehreren Dutzend spezialisierten unternehmen sind sie die Motoren der Regenerativen Medizin in Deutschland. Die Regenerative Medizin ist noch eine sehr junge Forschungsdisziplin, weshalb die meisten Akteure darauf konzentriert sind, die wissenschaftliche Basis für künftige Therapien zu legen. Seit Mitte der 2000er Jahre hat dabei ein spürbarer Aufwind eingesetzt: Nicht zuletzt durch einen Technologiesprung, etwa bei Stammzellen und Biomaterialien, sowie verstärkten finanziellen Impulsen der öffentlichen Forschungsförderorganisationen. Während viele Behandlungsansätze noch im Entwicklungsstadium stecken, kommen einige Anwendungen in der Regenerativen Medizin bereits heute Patienten zugute – beispielsweise als Gewebeersatz für Haut oder Knieknorpel. Dennoch ist die Translation, also die Umsetzung von erfolgversprechenden Forschungsergebnissen in gut anwendbare klinische Produkte und Verfahren, in der Regenerativen Medizin eine besonders komplexe Angelegenheit. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Anzahl an Produkten der Regenerativen Medizin noch vergleichsweise gering. Das Problem: Behandlungsformen wie Zelltherapien oder Gewebekonstrukte sind in der Regel auf den einzelnen Patienten ausgerichtet. Das macht jede Behandlung einzigartig und erfordert den Einsatz von viel Zeit, Personal und Hightech. Zudem gilt: Gleiche Zellen von verschiedenen Personen verhalten sich nicht immer gleich, Empfänger reagieren manchmal auf das gleiche Produkt unterschiedlich. Das erschwert die Beurteilung des Nutzens einer Behandlung. Außerdem sind die Zulassungs- und Prüfverfahren für die komplexen Produkte zeitaufwendig und teuer: Schließlich enthalten Präparate oft einen Mix aus lebenden Zellen, biologisch aktiven Wirkstoffen und nicht-biologischen Materialien. Sie alle müssen für sich auf ihre Sicherheit und mögliche Nebenwirkungen hin überprüft werden. Kleine unternehmen als Innovationsmotoren Nicht zuletzt aufgrund dieser Herausforderungen ist die Unternehmenslandschaft in Deutschland bis heute recht überschaubar. Das war auch das Ergebnis einer Bestandsaufnahme, die die Unternehmensberatung Capgemini im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2006 durchgeführt hat. Demnach gibt es mehr als 60 Unternehmen in Deutschland, die auf die Regenerative Medizin spezialisiert sind. Die meisten sind jedoch klein und erzielen vergleichsweise geringe Umsätze. Das Gros der Unternehmen verteilt sich auf die Branchen Medizintechnik (60 Prozent) und Biotechnologie (40 Prozent). Noch sehr gering, aber ansteigend ist der Anteil an Pharmaunternehmen, die im Gebiet der Regenerativen Medizin tätig sind (3 Prozent). Traditionell gibt es in Deutschland bedeutende Expertisen im Bereich Tissue Engineering und Zellkultur-Technologien. Bei den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten dominieren Ansätze für Knochen- und Knorpelersatz, für Hautersatz und für Herz- und Lebererkrankungen. Auch wenn es bislang nur wenige spezialisierte Firmen im Bereich der Regenerativen Medizin gibt, wird der Markt hoch eingeschätzt. Die CapgeminiStudie spricht von rund einer Milliarde Euro pro Jahr, die allein für das Gebiet Herz in Deutschland erwirtschaftet werden könnten, bei Hautersatzprodukten und Zelltherapien bei Leber haben die Autoren das unmittelbare Marktpotenzial auf 150 Millionen Euro geschätzt. Weltweit wurden allein 2008 mit gezüchteten Geweben knapp 1,5 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Die Studie zeigte aber tRanSlatIon: DER ScHwIERIGE wEG In DIE PRaxIS auch: Deutschland nimmt in der Forschung im internationalen Vergleich eine Spitzenposition ein. Zentren der Technologieentwicklung sind vor allem öffentliche Forschungseinrichtungen wie Hochschulen und Universitätskliniken, aus denen die meisten kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) als Ausgründungen entstanden sind. 47 sogenannte Translationszentren für Regenerative Medizin geschaffen werden. Sowohl das BMBF als auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) griffen dies auf und begannen – mit Unterstützung durch die jeweiligen Bundesländer – mit dem Aufbau solcher Zentren. Folgende Standorte werden mit mehr als 70 Millionen Euro vom BMBF gefördert: Fünf translationsstandorte bundesweit Hemmnisse wurden in der damaligen Studie insbesondere bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen der Regenerationstechnolgien in Produkte und Therapien gesehen. Weiterer Handlungsbedarf wurde bei der Erstattungspraxis durch die Krankenkassen und den geltenden Zulassungsverfahren für medizinische Produkte sowie den Anforderungen an klinische Studien identifiziert. Die Studie empfahl, die interdisziplinäre Zusammenarbeit voranzutreiben und Akteure aus Kliniken, Biotechnologie-Unternehmen und Behörden besser zu vernetzen. Dazu sollten • Berlin-Brandenburg centrum für Regenerative therapien (BcRt), seit 2006 • translationszentrum für Regenerative therapien (tRM) in leipzig, seit 2006 • Referenz-und translationszentrum für kardiale Stammzelltherapie (Rtc) in Rostock, seit 2008 translationszentrum für Regenerative Medizin (tRM) leipzig Seit Ende 2006 gibt es das Translationszentrum für Regenerative Medizin (TRM) in Leipzig, das gemeinsam durch das BMBF, das Land Sachsen und die Universität Leipzig gefördert wird. Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten hier zusammen, um neue diagnostische und therapeutische Konzepte für die Regenerative Medizin zu entwickeln und zielgerichtet in die klinische Praxis zu überführen. Forschungspartner des TRM Leipzig sind neben den Universitäten Leipzig und Halle-Wittenberg, dem Leipziger Universitätsklinikum und dem Herzzentrum Leipzig das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik sowie das Leibniz-Institut für Oberflächenmodifizierung und eine Reihe von Biotech-Unternehmen. Inhaltlich beschäftigt sich das Zentrum mit folgenden Bereichen: Tissue Engineering und Materialwissenschaft, Zelltherapien für Reparatur und Ersatz, Regulatormoleküle und Verabreichungssysteme, Bildgebung und Modellierung von Regeneration. Damit werden schwerpunktmäßig alle Bereiche von der (Stammzell)-Forschung, über das Bioengineering bis hin zur klinischen Anwendung adressiert. Darüber hinaus werden die Forscher von drei Serviceeinheiten beim Qualitätsmanagement, der Bildverabeitung und der Mikrochirurgie unterstützt. Um den Translationsprozess zügig und effizient zu gestalten, wurde ein Meilenstein-Konzept (Drei-Tore-System) entwickelt, das den Entwicklungsprozess aller Forschergruppen des TRM strukturiert. Dazu wurde ein professionelles TranslationsManagement geschaffen. Mehr Informationen: www.trm.uni-leipzig.de 48 tRanSlatIon: DER ScHwIERIGE wEG In DIE PRaxIS Die DFG fördert zwei Forschungszentren: • center for Regenerative therapies Dresden (cRtD), seit 2006 • Exzellenzcluster „From Regenerative Biology to Reconstructive therapy“ (REBIRtH) an der Medizinischen Hochschule Hannover, seit 2006 Die Translationszentren bündeln die Kompetenzen aus akademischen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen und haben sich zu wichtigen Motoren in der Entwicklung regenerativer Therapien entwickelt. Alle Zentren kooperieren eng mit den jeweiligen Universitätskliniken und Forschungseinrichtungen. So ist es möglich, neue Therapien über verhältnismäßig kurze Wege in Patientenstudien zu testen. Gleichzeitig wurden in den Zentren eigene Abteilungen geschaffen, die sich um die Bewertung, die Entwicklung und die Kommerzialisierung von regenerativen Therapien kümmern. Die Zentren sollen so zu Keimzellen für Firmenausgründungen und zu Partnern für innovationsstarke Unternehmen werden. Ziel ist es, den breiten Einsatz neuer Therapien nachhaltig und in gesundheitsökonomisch sinnvollem Umfang voranzutreiben. Das BMBF unterstützt neben den Translationszentren bundesweit noch weitere Netzwerke und Standorte, die die Regenerative Medizin in die Anwendung bringen wollen. Dazu zählen: Berlin-Brandenburg centrum für Regenerative therapien (BcRt) Das Berlin-Brandenburg Centrum für Regenerative Therapien (BCRT) ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Charité-Universitätsmedizin und der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Es wurde 2006 gegründet und ist in einem eigenen Bau des Virchow-Klinikums auf dem Charité-Campus untergebracht. Hier arbeiten 26 neu eingerichtete Forschergruppen, davon 12 Junior-Gruppen. Neben der Charité- Universitätsmedizin sind am Zentrum insbesondere das Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (MDC) in Berlin-Buch und das Helmholtz-Zentrum Geesthacht in Teltow beteiligt. Hinzu kommen Partner aus zahlreichen Forschungseinrichtungen und Hochschulen in Berlin und Brandenburg, das Pharmaunternehmen Bayer Healthcare sowie eine Reihe von Biotechnologie-Unternehmen. Finanziell wird das BCRT vom BMBF, von den Ländern Berlin und Brandenburg, der Charité und der Helmholtz- Gemeinschaft getragen. Im BCRT konzentrieren sich die Forscher auf anwendungsorientierte Projekte in vier medizinischen Bereichen: das Immunsystem, das kardiovaskuläre System, das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System des menschlichen Körpers. Bei ihrer Arbeit werden die Forscher von Plattformen zur biomedizinischen Grundlagenforschung, den Bioingenieurwissenschaften, Biomaterialwissenschaften und den Translationstechnologien unterstützt. Für die Ausbildung von Nachwuchsforschern wurde im Rahmen der Exzellenzinitative die Graduiertenschule „Berlin Brandenburg School for Regenerative Medicines“ aufgebaut, die ein dreijähriges Doktoranden-Programm anbietet. Um die Translation von Forschungsergebnissen in die klinische Praxis voranzutreiben, werden am BCRT neue therapeutische Konzepte in besonders frühen Phasen auf ihre Markttauglichkeit hin überprüft. Dazu wurden im BCRT eigene Abteilungen geschaffen, die sich um die klinische Entwicklung und die Kommerzialisierung neuer regenerativer Therapien kümmern. Am BCRT ist das Europäische Stammzellregister hESCreg angesiedelt, das von der Europäischen Kommission finanziert wird (vgl. S. 11). Mehr Informationen: www.b-crt.de tRanSlatIon: DER ScHwIERIGE wEG In DIE PRaxIS – die Gesundheitsregion „REGiNA“ (Regenerative Medizin in der Neckar-Alb Region) ging 2009 als Gewinner des BMBF-Wettbewerbs „Gesundheitsregionen der Zukunft“ hervor und wird bis 213 mit 7,5 Millionen Euro gefördert. REGiNA bündelt 16 Teilprojekte und 30 Partner aus Forschung, Referenz- und translationszentrum für kardiale Stammzelltherapie (Rtc) Am Referenz-und Translationszentrum für kardiale Stammzelltherapie (RTC) in Rostock werden neue Behandlungsmethoden mit Stammzellen für Herzkrankheiten erforscht und angewandt. Das RTC wurde im Herbst 2008 ausgehend von der Klinik für Herzchirurgie der Universität Rostock gegründet. Finanziell wird das RTC vom BMBF, vom Land Mecklenburg-Vorpommern und von der Industrie unterstützt. Das Ziel der Forscher ist es, mithilfe patienteneigener Stammzellen eine langfristige Heilung des geschädigten Herzens möglich zu machen. Im Jahr 2009 startete das RTC eine multizentrische klinische Studie der Phase III, die für die Zulassung der in Rostock entwickelten kardialen Stammzelltherapie entscheidend sein wird. Das RTC begleitet den komplexen Prozess von der Grundlagenforschung und frühen Entwicklung bis hin zur Zulassung und Anwendung von adulten Stammzellen als standardisierte und qualitätsgesicherte Therapie. Die am Zentrum entwickelten Verfahren sollen zukünftig für weitere Projekte auf dem Gebiet der Stammzellforschung als Referenz dienen. Zu den weiteren Aufgaben des RTC gehört es, die Zulassung der Therapie vorzubereiten, Fragen der Erstattung zu klären, zukünftige Anwender zu schulen sowie Ärzte, Patienten und die Öffentlichkeit zu informieren. Mehr Informationen: www.cardiac-stemcell-therapy.com 49 Klinik und regionalen Unternehmen, um regenerationsmedizinische Produkte und Behandlungsmethoden zu erforschen und pilotartig in die Gesundheitsversorgung einzuführen. (Mehr Informationen: www.info-rm.de) – die HI-STEM gGmbH, die 2008 mit Mitteln der privaten Dietmar-Hopp-Stiftung und des Deutschen Krebsforschungszentrums DKFZ in Heidelberg gegründet wurde. HI-STEM bündelt die Aktivitäten von Heidelberger Kliniken und Forschungseinrichtungen zur Erforschung von Krebsstammzellen. HI-STEM ist ein zentraler Partner des Spitzenclusters „Zellbasierte und Molekulare Medizin“ in der Biotech-Region Rhein-Neckar (BioRN), der 2008 den mit 40 Millionen Euro dotierten Spitzencluster- Wettbewerb des BMBF gewonnen hat. HI-STEM erhält aus diesem Topf rund 6 Millionen Euro. (Mehr Informationen: www.hi-stem.de). – das Centrum für Angewandte Regenerative Entwicklungstechnologien, kurz CARE. Dieses neue Institut entsteht auf Initiative des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin in Münster und hat die Nutzung der Reprogrammierungstechnologien zum Ziel. Aufbauend auf iPS-Zellen soll ein Untersuchungssystem in der Kulturschale entwickelt werden, an dem Wirkstoffkandidaten untersucht und Verträglichkeitstests durchgeführt werden können. CARE soll durch eine Anschubfinanzierung vom Land Nordrhein-Westfalen und vom Bund unterstützt werden. Um die Umsetzung regenerativer Therapien voranzutreiben, soll auch die internationale Zusammenarbeit der jeweiligen weltweit führenden Experten und Translationszentren gefördert werden. Dazu hat das BMBF bilaterale Abkommen mit Forschungsfördereinrichtungen in den USA im Bereich der Regenerativen Medizin geschlossen. Seit Oktober 2009 existiert ein Memorandum of Understanding mit dem California Institute for Regenerative Medicine (CIRM), der größten Fördereinrichtung für Stammzellstudien weltweit. Die Vereinbarung ermöglicht die Teilnahme deutscher Forscher oder Forschungseinrichtungen an Ausschreibungen des CIRM im Rahmen amerikanischdeutscher Kooperationen. (vgl. Kasten S. 50) Bevor regenerative Verfahren und Produkte aus dem Labor erfolgreich im Markt genutzt werden können, müssen sie durch Zulassungsbehörden 50 genehmigt werden. Die Zulassung der auf neuen Forschungsergebnissen basierenden regenerativen Therapien ist ohnehin schon komplex. Bis vor wenigen Jahren wurde sie zusätzlich durch einen regulatorischen Flickenteppich erschwert: In jedem EU-Land galten unterschiedliche Bestimmungen für die Zulassung. Im Jahr 2007 verständigte sich die Europäische Union auf ein harmonisiertes Zulassungsverfahren, um die europaweite Vermarktung von Produkten der Regenerativen Medizin zu erleichtern. Seit Januar 2009 gelten diese einheitlichen Voraussetzungen für die Zulassung von Arzneimitteln für neuartige Therapien. Sie sind in der EU-Verordnung 1394/2007/EG über die „Advanced Therapy Medicinal Products“ (ATMP) zusammengefasst. Zur Arzneimittelgruppe der „Neuartigen Therapien“ gehören demnach alle Produkte, die lebende Zellen oder Gewebe enthalten. Dazu zählen Zelltherapien (Zelltherapeutika), Produkte für den Einsatz in Gentherapien (Gentherapeutika) und biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte (Tissue Engineering Products). Klare Regeln für den europäischen Markt Die ATMP-Verordnung beschreibt die besonderen Voraussetzungen, die die Hersteller von diesen Präparaten zusätzlich zu den bestehenden Anforderungen für konventionelle Arzneimittel erfüllen müssen. Unter anderem muss der Herstellungsprozess gesondert beschrieben werden. Weiterhin werden von den Herstellern Nachuntersuchungen an behandelten Patienten gefordert, die die Sicherheit und Wirksamkeit der ATMPs prüfen. Darüber hinaus muss die Rückverfolgbarkeit aller Ausgangsstoffe für die Herstellung der Produkte gewährleistet sein. Generell werden ATMPs künftig zentral von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) in London bewertet. Dafür wurde ein beratender Ausschuss für neuartige Therapien gegründet (Committee for Advanced Therapies, CAT), der von einem Vertreter aus Deutschland geleitet wird. Diese Expertenrunde berät das Entscheidungsgremium der EMA, das Commitee for Medical Products for Human Use, bei der Zulassung der „neuartigen Therapien“. Im Zuge der 15. Novelle des Arzneimittelgesetzes (AMG) wurden die Inhalte der neuen EU-Verordnung im Sommer 2009 auch in Deutschland umgesetzt. Durch die Einstufung von ATMP als Arzneimittel wurden zwar klare Regeln und Qualitätsstandards in der EU und dazu ein neuer, vergrößerter Markt für die Wettbewerber geschaffen. tRanSlatIon: DER ScHwIERIGE wEG In DIE PRaxIS Deutsch-Kalifornische Zusammenarbeit In einem Forschungsfeld wie der Regenerativen Medizin ist der Austausch mit Kollegen auf der ganzen Welt ganz besonders wichtig. Vor diesem Hintergrund hat das BMBF im Jahr 2009 ein „Memorandum of Understanding“ mit dem California Institute for Regenerative Medicine (CIRM) unterzeichnet, einer der größten und renommiertesten Stammzellfördereinrichtung der Welt. Diese Vereinbarung ermöglicht es deutschen Forschern, sich gemeinsam mit kalifornischen Kollegen an Ausschreibungen des CIRM im Bereich der Regenerativen Medizin zu beteiligen. Umgekehrt ist es amerikanischen Forschern und Forschungseinrichtungen möglich, an deutschen Forschungsvorhaben im Rahmen deutsch-amerikanischer Kooperationen teilzunehmen. Ziel ist es, Methoden und Verfahren weiterzuentwickeln, diese wissenschaftlich zu bewerten und dadurch das therapeutische Potenzial neuartiger Behandlungsmethoden vermehrt auszuschöpfen. Seit 2010 sind bereits sieben zukunftsweisende transatlantische Forschungskooperationen bestätigt worden. Das entspricht einem BMBFFördervolumen von sieben Millionen Euro. Mehr Informationen: www.ptj.de/bmbf-cirm Doch kommen auf die spezialisierten Unternehmen neue Herausforderungen zu. Von Anfang an sorgte sich die EU bei der Harmonisierung der Zulassung besonders um die Auswirkungen auf kleinere und mittlere Unternehmen (KMU), die angesichts der zentralen Vorgehensweise höhere Kosten und Aufwand in Kauf nehmen müssen. So müssen KMUs durch eine Ausnahmeregelung derzeit nur zehn Prozent der Gebühren für die wissenschaftliche Beratung durch die Behörden und nur die Hälfte der Zulassungskosten bezahlen, die insgesamt bei rund 230.000 Euro liegen. Zudem gilt bis Ende 2011 eine Übergangsfrist für somatische Zelltherapeutika und Gentherapeutika sowie bis 2012 eine Übergangsfrist für Gewebeersatz-Produkte. Innerhalb dieser Frist können Produkte, die zum Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung schon auf dem Markt tRanSlatIon: DER ScHwIERIGE wEG In DIE PRaxIS waren, nachträglich zugelassen werden, ohne dass zusätzliche Kosten für die Unternehmen entstehen. Kleinere Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, die Daten über ihre Produkte schon in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses einzureichen und bewerten zu lassen. So sollen spätere und damit teurere Beanstandungen und Korrekturen vermieden werden. Klinische Studien als große Herausforderung Dennoch ist das Feld der Regenerativen Medizin für KMU ein vergleichsweise schwieriges Feld. Die Aufwendungen für die klinische Entwicklung sind hoch und das Risiko, ob eine Therapie tatsächlich in der klinischen Praxis nutzbar ist, nicht immer im Vorfeld abzuschätzen. Zudem fehlen Langzeiterfahrungen über das Kosten-Nutzen-Verhältnis von regenerativen Therapien, die sich immer auch gegenüber herkömmlichen Behandlungsverfahren beweisen müssen. Die Frage, ob regenerative Therapien tatsächlich wirken und wie gut sie dem jeweiligen Patienten helfen, ist oft nicht so einfach 51 zu beantworten. Was die Nutzenbewertung so komplex macht: Gängige Kriterien für klinische Studien lassen sich in diesem Feld kaum anwenden – beispielsweise der Ansatz, dass weder Arzt noch Patient wissen, ob sie die Therapie oder ein Placebo verwenden. Diese Vorgehensweise – von Fachleuten als doppel-verblindete placebokontrollierte klinische Studie bezeichnet – lässt sich mit Pillen und Spritzen einfacher durchführen, als in der Regenerativen Medizin mit ihren auf den einzelnen Patienten angepassten Zelltherapien, die Probenentnahmen vom Patienten und Produktionsmöglichkeiten vor Ort in der Klinik erfordern. Darüber hinaus fehlt oft ein standardisierter Herstellungsprozess für diese Art von individuellen Produkten bzw. eine methodisch abgesicherte Qualitätssicherung der Produkte. Um die Entwicklung entsprechend valider Methoden für klinische Studien voranzutreiben und und die Bewertung des Nutzens von regenerativen Therapien zu verbessern, hat das BMBF Mitte 2008 die Förderinitiative „Richtlinien zur Förderung der Entwicklung und Validierung von Methoden Exzellenzcluster REBIRtH (From Regenerative Biology to Reconstructive therapy) Hannover Der von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) koordinierte Exzellenzcluster REBIRTH wurde 2006 im Rahmen der Exzellenzinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gegründet und hierüber basisfinanziert. Beteiligt sind insgesamt sieben Forschungseinrichtugen: Neben der MHH die Tierärztliche Hochschule Hannover, die Leibniz Universität Hannover, das HelmholtzZentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, das Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM), das Institut für Nutztiergenetik Mariensee (Friedrich-Loeffler-Institut FLI) und das Max- Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster. Ein wichtiger Bestandteil des Clusters ist zudem das 2008 eröffnete Hans-Borst-Zentrum für Herz-und Stammzellforschung (HBZ), dessen Neubau mit 13,5 Millionen Euro durch private Mittel der Braukmann-WittenbergHerzstiftung finanziert wurde. Die insgesamt 40 Forscherteams am REBIRTH beschäftigen sich u.a. mit den Mechanismen der Reprogrammierung von Körperzellen zur Gewinnung von Stammzellen sowie mit Zelltherapien und Gewebekonstrukten in regenerativen Therapien. Dabei werden Expertisen aus den Ingenieurwissenschaften, der Chemie, der Photonik und der Nanotechnologie interdisziplinär integriert. Im Rahmen von REBIRTH ist 2007 auch das Doktoranden-Programm „Regenerative Sciences“ gestartet, das zur Graduiertenschule „Hannover Biomedical Research School“ gehört. Mehr Informationen: www.rebirth-hannover.de 52 tRanSlatIon: DER ScHwIERIGE wEG In DIE PRaxIS und Verfahren der Regenerationstechnologien für den Einsatz in der Medizin“ gestartet. Auf dieser Grundlage werden überwiegend industriegeführte Verbundprojekte unterstützt, um Defizite bei der Bewertung von in der Entwicklung bereits fortgeschrittener Produkte und Therapieverfahren auf dem Feld der Regenerationstechnologien zu identifizieren und zu beseitigen. Insgesamt stehen dafür 15 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung. Trotz der Schwierigkeiten in der Translation wird der regenerativen Medizin ein großes Potenzial bescheinigt. Als besonders aussichtsreiche Anwendung werden von Experten zunächst nicht Therapien, sondern der sogenannte Testmarkt gesehen (vgl. S. 42ff.). Gemeint sind stammzellbasierte in vitro-Testverfahren, mit denen Wirkstoffkandidaten auf Verträglichkeit und Toxizität geprüft werden können. Für diesen Anwendungsbereich interessieren sich inzwischen auch die großen Pharmakonzerne und Laborzulieferer. Zellbasierte Tests im Industriemaßstab sollen die Suche nach neuen Medikamenten nicht nur effizienter und sicherer machen, sondern auch Tierversuche reduzieren helfen. Um den Wachstumsbereich weiter voranzutreiben, haben deshalb bereits mehrere Pharmakonzerne Kooperationen mit spezialisierten Biotech-Unternehmen und Forschungseinrichtungen geschlossen. In einer Überblickstudie hatte die Fachgesellschaft Dechema im Jahr 2009 bundesweit 67 Forschergruppen identifiziert, die organähnliche Zellkultursysteme für die Medikamententestung entwickeln: 4 davon an Universitätskliniken, 19 in Universitäten, 17 in Forschungsinstituten und 27 in Unternehmen. Eines dieser Unternehmen ist die Biotech-Firma Axiogenesis AG aus Köln, die stammzellbasierte Analysesysteme entwickelt und diese vor allem für den Einsatz in der chemischen, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie bereitstellt. Fokus hierbei ist einerseits der Nachweis von toxischen Wirkungen sowie andererseits die Entwicklung von Screeningsystemen zur Identifizierung von neuartigen Therapiekonzepten. Die Technologie bietet außerdem die Möglichkeit, bereits in frühen Phasen der Wirkstoffentwicklung Aussagen über den Einfluss von Präparaten beim Menschen zu treffen. center for Regenerative therapies Dresden (cRtD) Das Center for Regenerative Therapies Dresden (CRTD) wurde 2006 im Rahmen der Exzellenzinitiative als Forschungszentrum der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gegründet und hierüber basisfinanziert. Das CRTD ist als Exzellenzcluster der TU Dresden ein interdisziplinäres Netzwerk, zu dem auch das Max-Planck-Institut für Molekulare Zellbiologie und Genetik, das Max-Bergmann-Zentrum für Biomaterialien und die Kliniken des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus gehören. Involviert sind auch 18 Unternehmen. Darüber hinaus ist am CRTD ein Sonderforschungsbereich der DFG zur Stammzellforschung angesiedelt. Inhaltlich fokussieren sich die 15 Forschergruppen am CRTD auf fünf Bereiche: Hämatologie und Immunologie, Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen, Knochen-/ Knorpelersatz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Den Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit bildet die Stammzellforschung sowie die Arbeit mit den Modellorganismen Maus, Zebrafisch und dem mexikanischen Schwanzlurch Axolotl. Die Umsetzung der Ergebnisse in die Klinik war in einigen Fällen bereits erfolgreich. Neben Behandlungen von Leukämie-Patienten mit hämatopoetischen Stammzellen gibt es Pilotstudien zur Regeneration von Knochendefekten. In der Nachwuchs-Ausbildung beteiligt sich das CRTD an der „Dresden International School for Biomedicine and Bioengineering“ (DIGS-BB). 2011 wurde ein CRTD-Neubau bezogen, der 48,6 Millionen Euro gekostet hat. Das Geld wurde vom Bund, dem Freistaat Sachsen sowie der EU zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen: www.crt-dresden.de tRanSlatIon: DER ScHwIERIGE wEG In DIE PRaxIS 53 Fördermaßnahmen im Überblick Seit den 90er Jahren unterstützt das BMBF Forscherinnen und Forscher in der Regenerativen Medizin mit diversen Förderinitiativen. Dies wird auch im aktuellen Rahmenprogramm Gesundheitsforschung, das Anfang 2011 gestartet ist, fortgesetzt. Weitere relevante Förderinitativen sind dem Rahmenprogramm Bioökonomie zugeordnet. Im unten stehenden Kasten finden Sie eine Übersicht aktueller Förderinitiativen. Eingebettet in die beiden Rahmenprogramme sind zwei Strategieprozesse, in denen die Regenerative Medizin auch eine Rolle spielt. Beim Strategieprozess „Nächste Generation biotechnologischer Verfahren - Biotechnologie 2020+“ steht die Weitentwicklung biotechnologischer Verfahren in den nächsten 20 bis 30 Jahren im Fokus. (Mehr Informationen: www.biotechnologie2020plus.de). Beim Strategieprozess „Innovationen in der Medizintechnik“ wiederum soll eine mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) sowie Experten aus Industrie, Wissenschaft und Gesundheitswesen abgestimmte Innovationspolitik für dieses Feld erarbeitet werden. (Mehr Informationen: www.bmbf.de/de/17337.php) Fördermaßnahmen in der Regenerativen Medizin Laufende Förderinitiativen des Bundesministerium für Bildung und Forschung, die für Forscherinnen und Forscher in der Regenerativen Medizin relevant sind. • Regenerative technologien • Gewinnung pluri- bzw. multipotenter Stammzellen • Zellbasierte, regenerative Medizin • translationszentren in der Regenerativen Medizin • Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung • Dialogplattform „Deutsches Stammzellnetzwerk“ • Deutsch-Kalifornische Zusammenarbeit in der Regenerativen Medizin (cIRM-BMBF) • EurotransBio ERa-nEt • Kompetenznetze in der Medizin • Spitzencluster-wettbewerb • Gesundheitsregionen der Zukunft • Innovation in der Medikamentenentwicklung • Innovative therapien • KMu-innovativ: Biotechnologie – Biochance • KMu-innovativ: Medizintechnik • alternativen zum tierversuch • Ethische, rechtliche und soziale aspekte der modernen lebenswissenschaften und der Biotechnologie Weitere Informationen zu den aufgeführten Förderinitiativen und Ansprechpartner finden Sie beim Projektträger Jülich (PtJ) und beim Projektträger im DLR. Mehr Informationen finden Sie hier: www.gesundheitsforschung-bmbf.de www.ptj.de www.biotechnologie.de www.bmbf.de/de/1237.php www.bmbf.de/de/1084.php www.bmbf.de/de/10781.php 54 GloSSaR Glossar adulte Stammzellen Gewebespezifische Stammzellen, die wie Reparateure in einem Organ für Nachschub an neuen Zellen sorgen. Sie können nur die Zelltypen des Organs liefern, aus dem sie selbst stammen. Sie sind daher multipotent. endogene Regeneration Hierbei werden Zellen genutzt und stimuliert, die sich im Körper befinden und die in der Lage sind, Selbstregenerationsprozesse einzuleiten. Dies können Stammzellen, aber auch gewebsspezifische Vorläuferzellen und Immunzellen sein. allogene Zellen von fremden Organismen stammende Zellen Gentherapie Experimentelle Therapieform, bei der Gendefekte in den Zellen von Patienten mittels eingeschleuster Erbsubstanz behoben werden. Als Genfähren werden meist spezielle Viren eingesetzt. autologe Zellen körpereigene Zellen Blastozyste Sehr frühes Embryo-Stadium, das aus etwa 200 Zellen besteht und die Form einer Hohlkugel hat. Enthält die innere Zellmasse, aus der embryonale Stammzellen gewonnen werden. bioartifiziell Ein Produkt, das aus einem künstlichen Material in Kombination mit lebenden Zellen besteht. biohybrid So werden Konstrukte bezeichnet, in denen sowohl synthetische als auch biologische Molekülbausteine oder Zellen miteinander kombiniert werden. Biomaterial Werkstoff, der bei einer medizinischen Behandlung im Körper unmittelbar mit Gewebe in Kontakt kommt. Bioreaktor Behälter, in dem Zellen oder Gewebe kultiviert wird. Differenzierung Vorgang, der aus einer unspezialisierten Vorläuferzelle eine definierte Körperzelle werden lässt. Damit ist immer eine strukturelle und funktionelle Veränderung der Zelle verbunden. Embryo So wird der sich entwickelnde Organismus ab der befruchteten Eizelle bis zum Fötus bezeichnet. Embryonale Stammzellen (ES-Zellen) Zellen, die aus der inneren Masse der Blastozyste gewonnen werden. Sie sind selbsterneuernd und können sich in alle Körperzelltypen außer Plazentagewebe entwickeln. Sie sind pluripotent. Gewebe Zellverbände aus differenzierten Zellen, die gemeinsam eine Funktion im Körper übernehmen. Hautmodell Hautmodelle sind kleine Hautstückchen, die biotechnologisch aus menschlichen Zellen hergestellt werden, die zuvor bei einer Biopsie entnommen wurden. Sie kommen in erster Linie als in vitro-Testsysteme zum Einsatz. induzierte, pluripotente Stammzellen (iPS) Künstlich erzeugte Stammzellen, die von einem spezialisierten in einen pluripotenten Zustand zurückversetzt werden. Eine ausdifferenzierte Zelle (etwa eine Hautzelle) wird mithilfe bestimmter Faktoren in einen Zustand zurückprogrammiert, der dem embryonaler Stammzellen ähnelt. in situ im Gewebe in vivo im lebendigen Organismus in vitro im Laborgefäß in vitro-Fertilisation Künstliche Befruchtung einer Eizelle mit Spermien in der Petrischale. Kerntransfer Eine Technik, bei der einer zuvor entkernten Eizelle ein Zellkern aus einer Spenderzelle eingepflanzt wird. Die Empfänger-Eizelle trägt danach nahezu dieselbe genetische Information wie die Spenderzelle. GloSSaR mesenchymale Stammzellen Gehören zu den adulten Stammzellen und kommen vor allem im Knochenmark vor. Können sich in viele verschiedene Zelltypen des Bindegewebes entwickeln, wie Knochen, Knorpel und Fett. multipotent So nennt man Zellen, die sich in mehrere verschiedene Zelltypen entwickeln können. Sie sind aber in ihrem Entwicklungspotenzial eingeschränkt und können nur die notwendigen Zelltypen eines bestimmten Organs/Gewebes bilden. pluripotent So nennt man Zellen mit uneingeschränktem Entwicklungspotenzial. Aus ihnen können alle Zelltypen eines Organismus hervorgehen. REACH Chemikalienverordnung der Europäischen Union, die im Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für die Registrierung („registration“), Bewertung („evaluation“) und Zulassung („authorisation“) von Chemikalien. Insbesondere müssen nun auch Altchemikalien auf ihre Gefährlichkeit für Umwelt und Gesundheit eingehend geprüft werden. Regenerative Medizin Behandlungsstrategie, die auf die Wiederherstellung funktionsgestörter Zellen, Gewebe und Organe abzielt. Möglich ist das durch den Einsatz von biologischem Ersatzgewebe oder die Stimulation körpereigener Regenerations- und Reparaturprozesse. Stammzellen Sind nicht spezialisierte Körperzellen, die einerseits nach Teilung neue Stammzellen hervorbringen und andererseits Tochterzellen bilden, die zu spezialisierten Zellen ausreifen können. Es werden embryonale und adulte Stammzellen unterschieden. Darüber hinaus gibt es die iPS-Zellen. Stammzellnische Ein spezieller anatomischer Bereich in Organen und Geweben, in dem die Stammzelle ihre unveränderten Eigenschaften beibehält. 55 Tissue Engineering Englischer Begriff für Gewebezüchtung. Darunter werden Kultivierungstechniken verstanden, deren Ziel es ist, Zellen in bioartifiziellen Stoffen zu züchten. Somit sollen letztlich biologisch funktionelle Gewebe entstehen, zum Beispiel für eine Transplantation oder für Testzwecke. totipotent So bezeichnet man Stammzellen mit dem größtmöglichen Entwicklungspotenzial. Eingebettet in eine Gebärmutter kann aus ihnen ein kompletter Organismus hervorgehen. Bei Menschen und Säugetieren sind das Embryo-Zellen bis zum AchtzellStadium. Translationszentrum Forschungszentrum, an dem Wissenschafler verschiedener Disziplinen anwendungsorientierte Ansätze verfolgen, um ihre Ergebnisse rasch in die (klinische) Praxis zu bringen. Vorläuferzellen Zellen, die noch nicht alle funktionellen Eigenschaften von ausgereiften Körperzellen besitzen. Diese Zellen sind in der Lage, sich zu vermehren, können sich aber auch abhängig vom Grad ihrer Reife in unterschiedliche Arten von Körperzellen entwickeln. Xenotransplantat Transplantat aus tierischen Zellen, das beim Menschen eingesetzt wird. Zelllinie Zellen eines bestimmten Typs, die in der Kulturschale heranwachsen und sich unendlich vermehren lassen. Zellkultur Züchten von Zellen in Kulturgefäßen mit Wachstumsmedium. Zelltherapie Behandlung, bei der Stammzellen oder von solchen abgeleitete Zellen genutzt werden, um beschädigte Zellen oder Gewebe eines Patienten zu ersetzen oder zu reparieren. 56 W GloSSaR wEItERE PuBlIKatIonEn DES BMBF Weitere Publikationen des BMBF Weiterführende Informationen zur Biotechnologie im Publikationsangebot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Kostenlose Bestellmöglichkeit unter www.bmbf.de (Service/ Publikationen). Bundesbeirat Forschung und Innovation 2012 Bundesbericht Forschung und Innovation 2012 Bonn, Berlin 2012 Forschung Rahmenprogramm Gesundheitsforschung Rahmenprogramm Gesundheitsforschung der Bundesregierung Bonn, Berlin 2010 nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030 Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030 Unser Weg zu einer bio-basierten Wirtschaft DZG DEUTSCHE ZENTREN Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung Gebündelte Erforschung von Volkskrankheiten Unser Weg zu einer bio-basierten Wirtschaft (Langfassung) Bonn, Berlin 2010 Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung Gebündelte Erforschung von Volkskrankheiten; Bonn, Berlin 2011 Biotechnologie in Deutschland Biotechnologie in Deutschland 25 Jahre Unternehmensgründungen 25 Jahre Unternehmensgründungen; Bonn, Berlin 2010 57 58 wEItERE PuBlIKatIonEn DES BMBF Mensch-technik-Kooperationen Mensch-Technik-Kooperation auf dem Weg ins Jahr 2020 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen in der Biotechnologie KMU-innovativ: Biotechnologie – BioChance Eine Handreichung für Antragsteller Auf dem Weg ins Jahr 2020; Bonn, Berlin 2010 Förderung kleiner und mittelständischer unternehmen in der Biotechnologie KMU-Innovativ: Biotechnologie – BioChance Eine Handreichung für Antragsteller; Bonn, Berlin 2011 Bildung und Forschung in Zahlen 2011 Bildung und Forschung in Zahlen 2011 Ausgewählte Fakten aus dem Daten-Portal des BMBF Ausgewählte Fakten aus dem Daten-Portal des BMBF, Bonn,Berlin 2011 Ernährungsforschung Ernährungsforschung Gesünder essen mit funktionellen Lebensmitteln Gesünder essen mit funktionellen Lebensmitteln; Bonn, Berlin 2010 Der Schlaganfall Der Schlaganfall Forschung – Diagnose – Therapie Forschung – Diagnose – Therapie; Bonn, Berlin 2012 Der Schwindel Der Schwindel Forschung – Diagnose – Therapie Forschung – Diagnose – Therapie; Bonn, Berlin 2011 Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unentgeltlich abgegeben. Sie ist nicht zum gewerblichen Vertrieb bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen/Wahlwerbern oder Wahlhelferinnen/ Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Bundestags-, Landtagsund Kommunalwahlen sowie für Wahlen zum Europäischen Parlament. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift der Empfängerin/dem Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.