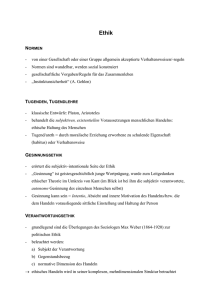Determinismus, Freiheit, Handlung
Werbung

Modul BWET Ethik in den Wirtschaftswissenschaften Textsammlung zur Vorlesung Prof. Dr. Gerhard Minnameier Wintersemester 2011/2012 Goethe-Universität Frankfurt am Main Fachbereich 02 Wirtschaftswissenschaften Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaften Inhaltsverzeichnis Michael Quante Dimensionen der Ethik 3 Peter Fischer Determinismus, Freiheit, Handlung 14 Christof Rapp Aristoteles zur Einführung - Ethik 28 Otfried Höffe Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 41 Otfried Höffe Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 67 Anhang: Aristoteles Nikomachische Ethik (Auszug) 90 3 Michael Quante Einführung Ethik in die © 2003 by Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt ISBN 3-534-15464-9 Allgemeine Michael Quante, Dimensionen der Ethik 4 Dimensionen der Ethik In diesem Kapitel wird in die philosophische Ethik eingeleitet, indem ihr Inhalt grob umrissen wird. Dies geschieht durch die Unterscheidung der drei ethischen Grundfragen sowie durch die Bestimmung des Verhältnisses der philosophischen Ethik zum alltäglichen Ethikverständnis einerseits und zu anderen philosophischen Disziplinen andererseits. Außerdem werden drei Ebenen der philosophischen Ethik und zwei Perspektiven unterschieden. 1. Einleitung Ethik ist gegenwärtig in aller Munde. Sie füllt Feuilletons, Talk-Shows und gelehrte Abhandlungen, ruft Ethik-Kommissionen und Ethik-Beiräte hervor. Die drängenden Probleme der Zeit - sei es die wieder aktuelle Frage nach gerechten oder zumindest gerechtfertigten Kriegen, seien es die vielfältigen Probleme der Medizin und Biotechnologien bringen einen tiefgreifenden ethischen Orientierungsbedarf mit sich. Ethik scheint etwas für Experten zu sein, eine schwierige Sache, bei der zu befürchten steht, dass sie trotz ihrer Komplexität nicht in der Lage ist, die anstehenden Probleme in den Griff zu bekommen. Ethik scheint daher mit schwierigen Fällen oder extremen Problemen befasst zu sein. Sie scheint sowohl von ihrem Gegenstand wie auch von ihrer Methodik her eine Spezialdisziplin zu sein, die uns zwar alle mehr oder weniger direkt betrifft, aber doch an Experten delegiert wird. Ethik ist jedoch auch alltäglich. Jeder von uns reagiert mit Empörung auf manches, was ihm angetan wird, oder auf Berichte darüber, was anderen widerfahren ist. Wir loben den selbstlosen Einsatz für eine gute Sache genauso wie die umsichtige Sorge für Freunde oder Verwandte. Die meisten von uns fragen sich gelegentlich, ob sie ihrem Leben diese oder jene Wendung geben, ob sie dies tun oder jenes lassen sollten. Manchmal fragen wir uns, ob wir das Richtige getan haben, ob wir in der Lage sind, unsere Entscheidungen und Handlungen vor uns selbst und vor allem auch vor anderen zu begründen. Wir verlangen von anderen, dass sie uns gerecht behandeln, dass sie die Regeln der Höflichkeit einhalten und uns Respekt entgegenbringen. Geschieht dies nicht, fordern wir die Einhaltung der entsprechenden Regeln und Verhaltensnormen ein, durch die uns eine angemessene Behandlung zuteil werden kann. Wir verstehen, wenn andere unser Verhalten als ethisch falsch oder ungerecht kritisieren. Zumeist versuchen wir dann, entweder eine Rechtfertigung oder zumindest eine Entschuldigung vorzubringen. Oder wir sehen, wenn auch vielleicht nur insgeheim, ein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Aber nicht nur Handeln gegenüber anderen bewerten wir auf diese Weise. Wir kritisieren auch, wenn jemand sein Talent verschwendet, mit seiner Gesundheit oder seiner beruflichen Zukunft verantwortungslos umgeht. Zumeist verstehen wir auch sehr gut, wenn andere unsere eigene Lebensführung unter dieser Perspektive kritisieren. Man kann Rauchern vorhalten, dass sie die Gesundheit anderer schädigen. Man kann Rasern im Straßenverkehr vorhalten, dass sie andere gefährden. Man wird ihnen aber auch dann, wenn sie nur sich selbst schaden oder sich selbst leichtsinnig gefährden, Vorwürfe machen. Wir sind, mit anderen Worten, Sender und Empfänger ethischer Bewertungen wie Lob und Tadel; wir sind Subjekte und Objekte ethischer Einstellungen. Ethik ist, so betrachtet, etwas Alltägliches und Vertrautes: eine, nein, unsere Lebensform. Und dennoch: Kommt es Michael Quante, Dimensionen der Ethik 5 zur Frage nach der Möglichkeit von Ethik, dann sind viele skeptisch. Gerade die Betrachtung der Früchte, die der eingangs erwähnte Ethikboom mit sich bringt, nährt diese Skepsis. Ethische Orientierung in diesen Zeiten ist schwer, die Begründung ethischer Ansprüche scheint vielen sogar unmöglich zu sein. Mit dieser Einführung soll ein Überblick über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten der philosophischen Ethik gegeben werden. Die Gründe für die weit verbreitete Skepsis gegenüber der Ethik sollen ermittelt und, soweit möglich, entkräftet werden. Natürlich kann eine philosophische Einführung nicht alle Fragen beantworten. Vermutlich wird sie sogar im Endeffekt mehr Fragen aufwerfen, als sie zu beantworten vermag. Aber sie kann helfen, das eigene Denken über die wichtigsten Probleme zu klären, die wichtigsten theoretischen Weichenstellungen kennen zu lernen und die Fragen in der richtigen Weise zu stellen. Sie kann Orientierung bieten und eine Plattform, von der aus man dann gezielt weiter fragen und forschen kann. 2. Grundfragen der philosophischen Ethik a) Die erste Grundfrage: Was soll ich tun? Ethik begegnet uns in unserem Alltag auf vielfältige Weise. Nahezu jeder stößt in den Medien gelegentlich auf Diskussionen um Embryonenforschung, Sterbehilfe oder Tier- und Umweltschutz. Die schwierige und schmerzhafte Auseinandersetzung um Gewalt als Mittel der Politik ist sicherlich in den letzten Jahren an niemandem vollständig vorbeigegangen. In einer schwierigen Entscheidungssituation fragt uns eine Freundin um Rat: Den Partner und die Kinder verlassen, um beruflich Karriere machen oder sich selbst verwirklichen zu können? Eine Schwangerschaft beenden, weil das heranwachsende Kind vermutlich am Down-Syndrom leiden wird? Aber auch wir stehen in vielfältigen Entscheidungssituationen: Sollen wir Urlaub in einem Land machen, in dem die Menschenrechte massiv missachtet werden? Ist es vertretbar, ein Produkt zu kaufen, von dem wir wissen, dass es in einem Land der Dritten Welt durch Kinderarbeit hergestellt worden ist? Beschleicht uns nicht gelegentlich das Gefühl, wir sollten auf ein Stück unseres Lebensstandards verzichten und einen Teil unseres Geldes für humanitäre Zwecke spenden? Die eine oder der andere fragt sich möglicherweise, ob es nicht angebrachter wäre, sich politisch zu engagieren anstatt die eigene Zeit für diverse Freizeitaktivitäten zu verwenden. Sollte ich nicht mal wieder meine Oma im Altersheim besuchen, anstatt in das Konzert zu gehen, auf das ich mich schon so lange gefreut habe? Vermutlich würde der Besuch bei der alten Dame eher anstrengend und nicht sehr unterhaltsam. Das Konzert dagegen würde mir auf vielfältige Weise Spaß und Gewinn bringen. Aber dennoch: Sollte ich nicht trotzdem meiner Oma die Freude machen und sie wieder einmal besuchen? Fragen dieser Art sind durchaus nicht ungewöhnlich. Vielmehr sind wir von ihnen ständig umgeben. Sie lassen sich auf eine allgemeine Formel bringen, die zugleich die erste Grundfrage der philosophischen Ethik ist: (F 1) Wie soll ich handeln? Bei dieser Frage handelt es sich um eine normative Frage. Sie zielt nicht auf theoretische Wahrheit im Sinne der Ermittlung von Tatsachen, sondern auf normative Geltung. Und sie Michael Quante, Dimensionen der Ethik 6 zielt nicht auf theoretisches Wissen, sondern auf praktische Umsetzung. Wer danach fragt, wie er handeln soll, der möchte nicht einfach nur eine theoretische Überzeugung erwerben, wie dies für denjenigen gilt, der wissen möchte, ob Wale Fische oder Säugetiere sind. Natürlich kann man auch Wissensfragen in praktischer Absicht stellen, zum Beispiel, wenn Tina wissen möchte, ob das Rathaus Mittwochs nachmittags geöffnet hat. Aber die Antwort auf diese Wissensfrage ist unabhängig davon, ob sie damit für sich Handlungskonsequenzen verbindet. Dies ist bei der Frage „Wie soll ich handeln?“ nicht so. Es handelt sich um eine praktische Frage danach, welche Handlung die richtige ist. Damit sind die ersten Charakteristika der philosophischen Ethik benannt. Sie gehört zur praktischen Philosophie und zielt auf normative Geltung. Die philosophische Ethik, so könnte man es schlagwortartig formulieren, hat die Aufgabe, uns im Handeln zu orientieren. Aber unsere vorläufige Gegenstandsbestimmung ist damit noch nicht zufriedenstellend abgeschlossen. Die Anschlussfrage ist vielmehr, im Hinblick worauf ich so oder so handeln sollte. Anders gesagt: Zu fragen ist, um welche Art von Normativität, um welche Art von Geltung es geht. Wenn Peter eine Partie Schach spielt, dann könnte er sich fragen: Welchen Zug soll ich ausführen? Welcher Zug ist richtig? Auf diese Frage gibt es zwei verschiedene Antworten, die auf unterschiedlichen Ebenen liegen. Stellen wir uns vor, wir hätten es mit dem Schachspieler Andreas zu tun, der gerade erst die Regeln dieses Spiels erlernt hat und sich noch nicht sicher ist. Wenn Andreas fragt, ob der von ihm erwogene Zug richtig ist, dann könnte diese Frage so gemeint sein: Ist dieser Zug regelgerecht? Vermutlich wird dies so sein, und seine Gegenspielerin Barbara wird bestätigen können, dass der von Andreas geplante Zug richtig im Sinne von „regelkonform“ ist. Aber ist es auch der richtige Zug? Vielleicht sieht die erfahrene Schachspielerin Barbara mit einem Blick, dass der von Andreas geplante Zug innerhalb weniger Züge dazu führt, dass er die Partie verliert. Außerdem sieht sie, dass Andreas einen alternativen Zug machen könnte, durch den er die Partie offen halten könnte. Es geht an dieser Stelle nicht darum, ob Barbara in irgendeinem Sinne verpflichtet ist, Andreas darauf hinzuweisen, dass der von ihm geplante Zug nicht richtig bzw. nicht gut ist Normalerweise ist ein Schachspieler nicht darauf verpflichtet, seinem Spielpartner Tipps zu geben. Aber normalerweise fragt dieser auch nicht. Ob eine solche Verpflichtung vorliegt, lässt sich ohne weitere Auskünfte über die konkrete Situation nicht entscheiden. Wir können uns auch, um dieses Problem auszublenden, vorstellen, dass Andreas sich selbst fragt, ob der von ihm geplante Zug der richtige ist. Wichtig ist nur, dass die zweite Bedeutung seiner Frage sichtbar wird. Sie lässt sich so umschreiben: Ist dieser Zug geeignet, das Ziel oder den Sinn des Schachspielens zu realisieren? Ermöglicht er es, die Partie zu gewinnen? Oder ist er zumindest dazu geeignet, nicht auf die Verliererstraße zu gelangen? Offensichtlich lässt sich die erste Grundfrage der philosophischen Ethik nicht auf diese Weise verstehen. Wer sagt, dass es falsch ist, unter Alkoholeinfluss ein Auto zu steuern, der möchte damit normalerweise nicht zum Ausdruck bringen, dass ein solches Verhalten gegen die Spielregeln, in diesem Falle die Straßenverkehrsordnung, verstößt. Es lassen sich zwar Kontexte denken, in denen diese Bemerkung auch so gemeint sein kann: etwa in einem rechtswissenschaftlichen Seminar oder in der Fahrschule. Vermutlich wird die Aussage auch nicht als Hinweis darauf gedacht sein, dass alkoholisiertes Autofahren dem Sinn oder Ziel des Autofahrens widerspricht. In aller Regel wird sie als Hinweis darauf gemeint sein, dass ein solches Verhalten ethisch inakzeptabel, weil fahrlässig ist. Wer die Frage „Wie soll ich handeln?“ in ethischer Absicht stellt, der fragt danach, ob seine Handlung im Hinblick auf das ethisch Richtige oder das ethisch Gute angemessen ist. Als Michael Quante, Dimensionen der Ethik 7 Definition der philosophischen Ethik taugt diese Antwort nicht, weil sie zirkulär ist. Deshalb ist sie auch nicht wirklich informativ. Es kann vielmehr als eine der Hauptaufgaben der philosophischen Ethik angesehen werden, auf die Frage nach dem ethisch Richtigen und Guten inhaltlich konkrete Antworten zu geben. Solche Antworten können jedoch höchstens am Ende, keinesfalls aber am Anfang einer Einführung stehen. Vermutlich wird diese Frage auch am Ende nicht wirklich umfassend und befriedigend beantwortet worden sein. Wichtig sind unsere jetzigen Vorüberlegungen jedoch aus zwei Gründen. Zum einen lassen sie sichtbar werden, dass man die zentralen Begriffe der Ethik wie „sollen“, „richtig“ oder „gut“ näher analysieren muss, da sie offensichtlich auch in einem nichtethischen Sinne gebraucht werden können. Dies wird uns im nächsten Kapitel beschäftigen. Zum anderen zeigt sich schon hier eine der zentralen Aufgaben der philosophischen Ethik: die Formulierung konkreter Antworten auf die Frage nach dem ethisch guten oder richtigen Handeln. b) Die zweite Grundfrage: Warum ist diese Handlung richtig? Ethik ist in unserem Leben nicht nur deshalb alltäglich, weil wir uns häufig die Frage danach stellen, wie wir handeln sollen. Vermutlich genauso oft sind wir mit der Überlegung konfrontiert, warum denn die Handlung A und nicht die Handlung B die ethisch richtige ist. Wir suchen dann nicht nur eine Antwort auf die erste Grundfrage der Ethik, sondern auch nach einer Begründung für diese Antwort. Häufig taucht die Frage nach der Begründung in Situationen auf, in denen wir unser Tun vor anderen rechtfertigen oder eben zumindest begründen müssen. Gelegentlich stellt sie sich auch, wenn wir um Rat gebeten werden oder anderen von uns aus Ratschläge geben. Unsere ethische Einstellung prägt unser Zusammenleben. Daher erheben wir gegenseitig ethische Ansprüche, verlangen danach, dass andere sich ethisch korrekt verhalten. In diesem Kontext erhebt sich schon im Alltag die Frage nach der Begründung. Wir können die Begründungsfrage deshalb als zweite Grundfrage der philosophischen Ethik ansehen: (F 2) Warum ist Handlung A ethisch richtig (gut) bzw. falsch (schlecht)? Anders als die erste zielt diese zweite Grundfrage nicht darauf ab, die Handlung zu ermitteln, die zu tun ist. Sondern sie fragt nach den Merkmalen, aufgrund derer sich die ermittelte Antwort als die richtige erweist. Im Kontext der Ethik fragt man also auch nach den Merkmalen oder Kriterien des ethisch Guten bzw. Richtigen. In radikalisierter Form kann sich die Begründungsfrage wegbewegen von der einzelnen Handlung A. Sie richtet sich dann auf das ethische Handeln im Ganzen. Die Frage lautet nun: Wieso soll ich überhaupt ethisch handeln? Welchen Grund soll es dafür geben, dass ich meine egoistischen Interessen zugunsten der Bedürfnisse anderer zurückstelle? (Ich verwende hier zum einen den Begriff des Interesses in einem allgemeinen Sinn, der individuelle Bedürfnisse, Wünsche und Ideale gleichermaßen umfassen soll. Zum anderen benutze ich den Begriff „egoistisch“ an dieser Stelle in einem wertneutralen Sinne: egoistisch heißt also nicht zwangsläufig ethisch falsch oder schlecht). Es sind jedoch gerade diese Fälle, in denen die egoistischen Interessen mit dem ethisch Gebotenen kollidieren, durch welche die zweite Grundfrage der philosophischen Ethik in ihrer radikalisierten Form aufgeworfen wird. Sie lautet dann: (F 2*) Warum soll ich ethisch handeln? Michael Quante, Dimensionen der Ethik 8 Nun wird die Begründungsfrage in ihrer auf ethisches Handeln überhaupt ausgerichteten radikalisierten Form zwar hauptsächlich durch die Fälle aufgeworfen, in denen egoistische Interessen und ethische Ansprüche in Konflikt geraten. Das sollte aber nicht zu Fehlschlüssen verleiten. Zum einen folgt daraus nicht, dass ethisch gebotenes Handeln per definitionem im Widerspruch zur Erfüllung egoistischer Interessen stehen muss. Viele unserer egoistischen Interessen lassen sich in ethisch akzeptabler Weise befriedigen. Zum anderen wird eine ethisch angemessene Handlung nicht schon dadurch entwertet, dass sie auch der Befriedigung egoistischer Interessen dient. Die Freude und Befriedigung, die Christa dabei empfindet, dem bedürftigen Dieter die dringend benötigte Knochenmarkspende zu geben, entwertet ihre Handlung nicht automatisch als ethisch schlecht. Trotzdem gehört es zu den charakteristischen Merkmalen des ethisch Gebotenen, dass uns eine Verpflichtung oder ein Sollen auferlegt zu sein scheint, welches sich dadurch bemerkbar macht, dass es gegen unsere egoistischen Interessen steht, zu deren Befriedigung wir mehr oder weniger unmittelbar motiviert sind. Wie schon bei der ersten Grundfrage (F 1) ist es auch mit Bezug auf die zweite Grundfrage von entscheidender Bedeutung, verschiedene Fragen und Stoßrichtungen dieser Fragen zu unterscheiden. Mit der oben vorgenommenen Differenzierung in die zwei Begründungsfragen (F 2) und (F 2*) haben wir dazu einen ersten wichtigen Schritt unternommen. Es ist aber nicht nur wichtig, zwischen der ethischen Begründung für eine bestimmte Handlung und der ethischen Begründung für den ethischen Standpunkt zu unterscheiden. Zu differenzieren ist auch zwischen der Begründungsfrage im Sinne der Ermittlung rationaler Argumente auf der einen und dem Motivationsproblern auf der anderen Seite. Hier ergibt sich ein ganzes Spektrum von Möglichkeiten, die es zu unterscheiden gilt. So kann Erika, die durchaus gewillt ist, das ethisch Richtige zu tun, nach einer Begründung dafür fragen, dass Handlung A und nicht Handlung B die ethisch richtige ist. Ferdinand dagegen fragt danach, weshalb er die ethisch richtige Handlung A, z. B. seine Oma zu besuchen, ausführen sollte, anstatt die seine egoistischen Interessen erfüllende Handlung B, ins Konzert zu gehen, zu realisieren. Wo Erika nach einem sachlichen ethischen Grund fragt, die eine Handlung der anderen vorzuziehen, möchte Ferdinand ein Argument hören, welches ihm klar macht, weshalb er motiviert sein sollte, ethisch zu handeln. Während Erika und Ferdinand sich beide als Mitglieder der ethischen Gemeinschaft begreifen lassen, die nur unterschiedlich motiviert sind, gibt es in der Literatur der philosophischen Ethik auch eine Figur, nennen wir sie Greta, die man als Amoralisten bezeichnet. Bei Greta handelt es sich um eine rationale Person, die nicht bereit ist, sich nach dem ethischen Sollen auszurichten. Anders als Ferdinand, der nach einem Grund fragt, den ethischen Gesichtspunkt ausschlaggebend werden zu lassen, weigert sich Greta, den ethischen Standpunkt auch nur einzunehmen. Gelegentlich wird der Amoralist als ein Wesen beschrieben, welches diesen Standpunkt überhaupt nicht einnehmen kann, also mit einer Art ethischer Blindheit geschlagen ist. Zumeist handelt es sich jedoch um eine Person, die keinen Grund sieht, an der ethischen Lebensform teilzunehmen. Lassen wir den pathologischen Amoralisten unberücksichtigt, da er uns zur Frage führen würde, ob es ein rationales menschliches Lebewesen ohne jeglichen Sinn für ethische Ansprüche überhaupt geben kann. Unterstellen wir also, dass „Rationalität“ und „Amoralität“ verträglich sind. Gegenüber Greta stellt sich dann die Begründungsfrage „Warum ethisch sein?“ in ihrer radikalsten Form. Kann es eine Begründung der Ethik geben, die rationale Wesen, die vollkommen außerhalb dieser ethischen Lebensform stehen, aufgrund ihrer Rationalität davon überzeugt, an dieser Lebensform teilzunehmen? Man kann die ersten beiden, von Erika und Ferdinand geforderten Begründungen als interne Begründungsansätze kennzeichnen, weil sie nach der Michael Quante, Dimensionen der Ethik 9 normativen Geltung fragen, die sich innerhalb der ethischen Lebensform ergibt. Demgegenüber handelt es sich bei der hypothetischen Auseinandersetzung mit Greta um den Versuch einer externen Begründung, da man nach einem Argument für die ethische Lebensform sucht, welches selbst nicht bereits ein Teil der Ethik ist. c) Die dritte Grundfrage: Was bedeuten unsere ethischen Begriffe? Die Begründungsfrage stellt sich in ihren beiden Formen als zweite Grundfrage der philosophischen Ethik bereits in unserer alltäglichen ethischen Praxis. Die philosophische Ethik geht diesen Begründungsproblemen in systematisierender Weise nach und ist bestrebt, ethische Begründungen in ihrer immanenten Struktur transparent zu machen, die dabei verwendeten Grundbegriffe zu analysieren sowie die spezifische Natur ethischer Ansprüche und Begründungen zu verstehen. Obwohl es also zwischen unserer alltäglichen ethischen Praxis und der philosophischen Ethik keine scharfe Trennung gibt, weil beide mit der Beantwortung von Fragen und der Begründung von Antworten im Hinblick auf ethische Geltung zu tun haben, zeichnet sich die philosophische Ethik dadurch aus, dass sie eine Theorie ist. Dies hindert die philosophische Ethik zwar nicht daran, auch materiale Antworten auf die erste und die zweite Grundfrage zu geben. Sie verlangt aber über die im Alltag übliche Praxis hinaus eine systematische Durchdringung und Analyse dieser Praxis. Vermutlich wird die philosophische Ethik dabei in weiten Teilen rekonstruktiv und interpretierend vorgehen können. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die philosophische Ethik sich verändernd auf unsere alltägliche Ethik und unser ethisches Selbstverständnis auswirkt. Wenn dem so ist, sollte dies dem kritischen Reflexionspotenzial geschuldet sein, wodurch sich die philosophische Ethik von unserem alltäglichen ethischen Verständnis unterscheidet. Philosophische Ethik sollte sich dadurch auszeichnen und darin bewähren, dass sie unsere Praxis rational begründet und uns damit in die Lage versetzt, unsere eigene ethische Praxis besser zu verstehen und besser zu begründen. Wir können damit eine dritte Grundfrage der philosophischen Ethik formulieren, die auf diesen systematisierenden Aspekt abhebt: (F 3) Wie sind die ethischen Grundbegriffe beschaffen und wie funktionieren ethische Begründungen? Die philosophische Ethik ist eine alte Disziplin, so alt wie die Philosophie selbst. Solange Menschen Philosophie getrieben haben, solange haben sie die Phänomene des Erkennens und Handelns, des Wissens und Wollens philosophisch zum Thema gemacht. Es ist daher kein Wunder, dass im Laufe der mehr als zwei Jahrtausende, in denen es die abendländische Philosophie gibt, verschiedene und auch konkurrierende philosophische Ethiken entstanden sind. Sie alle nehmen von Erfahrungen aus unserer ethischen Alltagspraxis ihren Anfang, sind dann aber eingebettet in weitere philosophische und sonstige Annahmen, die von den jeweiligen Philosophen für wahr oder richtig gehalten werden. Im Laufe dieser Einführung werden wir die Haupttypen der philosophischen Ethik kennen lernen, die in der geschichtlichen Entwicklung der Philosophie hervorgebracht worden sind. Sie werden uns als mögliche und konkurrierende Antworten auf die entscheidenden systematischen Fragen, die sich auf dem Gebiet der philosophischen Ethik ergeben, nach und nach begegnen. Bevor wir uns jedoch diesem systematischen Gedankengang widmen können, müssen erst noch einige Vorabklärungen erfolgen. Michael Quante, Dimensionen der Ethik 10 3. Zwei zentrale Unterscheidungen Man bringt, so lautet ein bekanntes und durchaus zutreffendes Bonmot, zwei Philosophen eher dazu, gemeinsam eine Zahnbürste zu benutzen, als dazu, die gleiche Begrifflichkeit zu verwenden. Damit verbunden werden in den unterschiedlichen philosophischen Theorien voneinander abweichende Differenzierungs- und Einteilungsvorschläge gemacht. Viele sind ineinander übersetzbar und werfen daher keine prinzipiellen Probleme auf. Andere dagegen haben inhaltliche Konsequenzen und können deshalb nur in Verbindung mit den materialen Aussagen der jeweiligen philosophischen Ethik betrachtet werden. Besonders misslich ist mit Bezug auf unseren Gegenstand zudem, dass manche der zentralen Begriffe der philosophischen Ethik auch in der Alltagssprache verwendet werden, dort aber eine andere Bedeutung haben. Da es aussichtslos ist, eine Terminologie zu finden, die mit allen anderen, die im Gebrauch sind, in Einklang gebracht werden kann, besteht unsere einzige Möglichkeit darin, eine Begrifflichkeit festzulegen und sie konsequent zu verwenden. Wo immer dies im Laufe dieser Einführung notwendig wird, werden wir solche Festlegungen vornehmen. Zwei Unterscheidungen sind für unsere Überlegungen von Beginn an zentral; es handelt sich erstens um eine Ebenen- und zweitens um eine Perspektivenunterscheidung. a) Die drei Ebenen der philosophischen Ethik Auch wenn über das genaue Verhältnis der Ebenen zueinander gestritten wird, hat sich die Unterscheidung dreier Ebenen eingebürgert. Man unterscheidet - die deskriptive Ethik - die normative Ethik - die Metaethik voneinander. Notwendig wird diese Unterscheidung, weil sich auf diesen drei Ebenen verschiedene Typen von Aussagen finden. Beschreibt beispielsweise ein Historiker, welche Sitten im Römischen Reich galten, dann stellt er selbst keine normativen Behauptungen auf. Wer feststellt, dass es in einer Gesellschaft verboten ist, Schweinefleisch zu essen, der formuliert eine empirische Aussage, behauptet aber selbst nicht, dass man kein Schweinefleisch essen sollte. Gleiches gilt, wenn jemand behauptet, dass der Suizid nach christlicher Vorstellung eine Todsünde darstellt. Oder wenn darauf hingewiesen wird, dass die Freiheit von Forschung und Lehre in der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich geschützt ist. In keinem dieser Fälle liegt eine normative Aussage vor. Empirische Untersuchungen dieser Art werden in der Literatur zumeist deskriptive Ethik genannt. Aussagen aus diesem Bereich spielen in der philosophischen Ethik zwar auch eine Rolle. Aber im Grunde handelt es sich hierbei erstens nicht um eine philosophische, sondern eben um eine empirische Disziplin (z. B. die Ethnologie, die Soziologie oder die Geschichtswissenschaft). Zweitens geht es auf dieser Ebene nicht um normative Fragen, Behauptungen oder Begründungen. Ich möchte daher für diese Ebene den Begriff der Ethik gar nicht verwenden, weil die eingangs dieses Kapitels formulierten Grundfragen hier keine Rolle spielen. Michael Quante, Dimensionen der Ethik 11 Auf der Grundlage der bisherigen Charakterisierung von Ethik ist klar, dass die Charakterisierung „normative Ethik“ genauso redundant ist wie die Charakterisierung „unverheirateter Junggeselle“. Ethik hat es per definitionem mit normativen Aussagen zu tun. Sie stellt normative Behauptungen auf, analysiert normative Behauptungen, die wir in unserer alltäglichen ethischen Praxis formulieren oder die in anderen Ethiktheorien aufgestellt werden, und fragt nach den Begründungen für diese Behauptungen (einen Grenzfall stellt hier der ethische Nonkognitivismus dar, mit dem wir uns im dritten Kapitel ausführlich beschäftigen werden). Die Unterscheidung zwischen „deskriptiv“ und „normativ“ ist jedoch auf jeden Fall sinnvoll zur Charakterisierung von Aussagen. Denn natürlich können deskriptive Aussagen auch in der philosophischen Ethik vorkommen. Deshalb wird von nun an stets von Ethik im Sinne einer philosophischen normativen Ethik die Rede sein. Während die Unterscheidung von deskriptiver und normativer Ethik, im Unterschied zur Unterscheidung zwischen normativen und deskriptiven Aussagen, im weiteren Verlauf unserer Überlegungen damit keine Rolle mehr spielt, werde ich gelegentlich den qualifizierenden Zusatz „philosophische“ Ethik weiter verwenden. Dies dient zum einen der Abgrenzung zur alltäglichen Ethik, d. h. zur Betonung des systematisierenden und reflexiven Charakters der philosophischen Ethik als einer normativen Theorie. Zum anderen soll diese Kennzeichnung auch hervorheben, dass es um eine Ethik geht, die eine philosophische Begründung, im Gegensatz etwa zu einer theologischen Begründung, anstrebt. Wenn im Folgenden also der Begriff der Ethik ohne weiteren qualifizierenden Zusatz verwendet wird, dann ist stets die normative Disziplin der philosophischen Ethik gemeint. Als drittes muss man eine besondere Art von Behauptungen kennzeichnen, in denen Aussagen über die Grundbegriffe und die Begründungsformen der Ethik gemacht werden. Diese Aussagen formulieren auf der einen Seite keine normativen Forderungen, beschreiben auf der anderen Seite jedoch auch keine faktischen Normensysteme. Vielmehr handelt es sich bei diesen Aussagen, die man zur Metaethik zählt, um sprachphilosophische und methodologische Aussagen, die ihrerseits mit weitergehenden philosophischen Annahmen aus anderen Disziplinen der Philosophie verbunden sind. Wenn man z. B. über die sprachliche Analyse der verschiedenen Verwendungsweisen von „gut“ oder „richtig“ versucht, der Eigenheit des Ethischen auf die Spur zu kommen, dann betreibt man genauso eine Untersuchung wie dann, wenn man die spezifische Form ethischer Untersuchungen ermitteln möchte. Gleiches gilt, wenn man versucht, den sprachlichen Charakter einer normativen ethischen Aussage philosophisch zu bestimmen. Nehmen wir die Aussage „Es ist ethisch falsch, einen unschuldigen Menschen gegen seinen Willen zu töten“. Es gibt einen metaethischen Streit darüber, ob es sich hierbei wirklich um eine behauptende Aussage handelt, mit welcher der Anspruch auf Wahrheit erhoben wird. In dieser Auseinandersetzung haben manche Philosophen die These vertreten, dass es sich bei dieser Aussage nur der Oberflächenstruktur nach um eine Behauptung handelt. In Wirklichkeit müsse man diesen Sprechakt als eine Empfehlung, als Ausdruck eines Gefühls oder als Imperativ verstehen. Ich möchte auf diese Diskussion, die uns im dritten Kapitel noch ausführlich beschäftigen wird, jetzt nicht näher eingehen. Aber sie verdeutlicht zweierlei: Erstens können sich aus Antworten auf metaethische Fragen weit reichende inhaltliche Konsequenzen ergeben. Denn ganz offensichtlich lassen sich ethische Aussagen nur dann begründen, wenn mit ihnen Wahrheitsansprüche erhoben werden. Zweitens sind diese metaethischen Aussagen selbst weder normative Aussagen noch bloße Beschreibungen faktisch akzeptierter Normensysteme. Metaethische Aussagen sind daher aufgrund ihres Aussagetyps von ethischen Aussagen zu unterscheiden. Dies sollte uns jedoch nicht zu der Annahme verführen, die Ebenen der Michael Quante, Dimensionen der Ethik 12 Ethik und der Metaethik wären vollkommen unabhängig voneinander. Es ist zwar richtig, dass bestimmte metaethische Annahmen einen Philosophen nicht zwangsläufig auf einen bestimmten Typ philosophischer Ethik festlegen. Viele metaethische Befunde lassen sich in unterschiedliche Ethiktypen integrieren. Andererseits legen metaethische Annahmen einen allgemeinen Rahmen für die philosophische Ethik fest, sodass die Metaethik gegenüber der philosophischen Ethik nicht vollkommen neutral ist. Die Metaethik hat Auswirkungen auf die Beantwortung der materialen Fragen der philosophischen Ethik. Die Abhängigkeit gilt dabei, und das wird zumeist zu wenig beachtet, auch in die andere Richtung. Es kann nicht sein, dass ein metaethischer Analysevorschlag, der mit den materialen Überzeugungen der (philosophischen) Ethik unverträglich ist, in jedem Fall als verbindlicher Rahmen angesehen werden muss. Ein Widerspruch zwischen Ethik und Metaethik muss nicht automatisch zugunsten der Metaethik aufgelöst werden. Dies würde nur gelten, wenn metaethische Aussagen den gleichen Status hätten wie logische Aussagen. Da die Metaethik aber, anders als die Logik, inhaltlich nicht neutral ist, muss im Konfliktfall jeweils überlegt werden, auf welcher Ebene Korrekturen vorzunehmen sind. Weil die philosophische Ethik, anders als die alltägliche Ethik, den Anspruch einer Systematisierung und theoretischen Durchdringung hat, kann sie auf die Metaethik nicht verzichten. Deshalb wurde vorhin die Frage nach der Beschaffenheit unserer ethischen Grundbegriffe und Begründungen als dritte Grundfrage der philosophischen Ethik angeführt. Es wird sich im weiteren Verlauf unserer Überlegungen zeigen, dass es zu einem großen Teil divergierende metaethische Überzeugungen sind, aufgrund derer sich die unterschiedlichen philosophischen Theorien voneinander unterscheiden. Vor allem im zwanzigsten Jahrhundert haben die metaethischen Auseinandersetzungen die Hauptrolle gespielt bei der Ausdifferenzierung unterschiedlicher philosophischer Ethiken. b) Zwei Perspektiven Damit kommen wir zur Unterscheidung zweier Perspektiven, die für unsere weiteren Überlegungen relevant werden wird. Es handelt sich um die Unterscheidung zwischen einer internen und einer externen Perspektive auf die Ethik. Leider wird die Intern-ExternUnterscheidung ebenfalls in verschiedenen Bedeutungen verwendet. Oben war bereits in Bezug auf das Begründungsproblem von einer externen Begründung im Sinne einer Begründung der Ethik ohne Rückgriff auf ethische Begriffe oder ethische Annahmen die Rede. Ganz generell kann man zwischen einer internen und einer externen Perspektive auf die Ethik als einer Lebensform unterscheiden. Eine interne Perspektive wird immer dann eingenommen, wenn einzelne Handlungen oder ethische Aussagen unter Rückgriff auf andere ethische Annahmen begründet oder gerechtfertigt werden. Diese Perspektive löst sich nur dann auf, wenn man für die gesamte ethische Begrifflichkeit auf der Ebene der Metaethik eine naturalistische Analyse vorschlägt. Ob sich eine solche naturalistische Konzeption plausibel machen lässt, wird später zu erörtern sein. Eine externe Perspektive beruht demgegenüber darauf, eine Erklärung oder Begründung ethischer Einstellungen, Handlungen oder sozialer Praktiken zu geben, die selbst nicht mehr im Rahmen der Ethik formuliert wird. Auch diese Charakterisierung gilt nur unter der Voraussetzung, dass sich die ethische Begrifflichkeit nicht naturalisieren lässt. Prominente Beispiele für eine solche externe Perspektive sind zum einen ideologiekritische Entlarvungsargumente des Typs: Ein ethischer Diskurs ist nur die Verschleierung der wahren ökonomischen Interessen. Ethische Argumente und Begründungen sind, selbst Michael Quante, Dimensionen der Ethik 13 wenn die Individuen daran glauben, nicht wahr, weil die eigentliche Motivation durch die ökonomischen Interessen bestimmt wird. Zum anderen stellt die evolutionäre Ethik - zumindest in einer Lesart - ein Musterbeispiel für die externe Perspektive dar. Hier werden die ethischen Einstellungen und Überzeugungen sowie die ethische soziale Praxis als evolutionäre Strategie gedeutet. Die Ethik als individuelle Verhaltensweise oder als kollektive Strategie ist deshalb sinnvoll und begründbar, weil sie insgesamt der Verbreitung der eigenen Gene oder der Arterhaltung dienen. Eine dritte Ethikkonzeption, in der unsere Unterscheidung von interner und externer Perspektive hinfällig wird, beruht auf der Annahme, dass sich ethische Anforderungen explizieren lassen in Begriffen einer moralfreien Rationalität, die auf das Eigeninteresse des Handelnden ausgerichtet ist. In einer solchen Konzeption gibt es eine Reduktion des Ethischen auf ethikfreie aufgeklärte Rationalität, sodass sich die Grundfragen der Ethik in einer Begrifflichkeit beantworten lassen, die selbst nicht Teil der Ethik ist. Zwar stellt diese Konzeption keinen ethischen Naturalismus dar, weil sich der Begriff der Rationalität nicht naturwissenschaftlich fassen lässt. Zugleich steckt in dem Reduktionsprogramm jedoch die Vorstellung, die Ethik insgesamt in der externen Perspektive zu erfassen. Wir können an dieser Stelle über den Sinn und Unsinn dieser Ansätze nicht diskutieren. Vielleicht sind die ersten beiden Forschungsprojekte unplausibel, vielleicht lassen sich auf diese Weise aber auch bedeutsame Einsichten gewinnen. Wichtig ist für den Augenblick nur, dass es sich bei ihnen klarerweise um eine externe Perspektive handelt. Dies wird schon daran deutlich, dass sie die erste Grundfrage der philosophischen Ethik gar nicht behandeln können. Wer wissen möchte, ob die Handlung A oder die Handlung B ethisch richtig ist, dem helfen ideologiekritische oder evolutionsbiologische Erklärungen seiner ethischen Grundeinstellung nicht weiter. Sie können höchstens dazu führen, dass der Betreffende aufhört, seine Frage zu stellen. Wer danach fragt, welche Handlung ethisch richtig ist, und wer nach einer ethischen Begründung fragt, der setzt klarerweise die interne Perspektive voraus und erwartet damit auch eine Antwort innerhalb der Ethik, keine Erklärung für die Ethik von außen. Die externe Perspektive auf die Ethik als ganze ist damit ungeeignet, die konkreten Grundfragen der Ethik zu beantworten. Dies gilt für den dritten Weg einer Reduktion des Ethischen auf das aufgeklärte Eigeninteresse nicht in dieser Form, weil hier ja eine Übersetzung unserer ethischen Begrifflichkeit in eine andere normative Begrifflichkeit vorgeschlagen wird. Da wir von unserem Vorverständnis aus jedoch zwischen unserem Eigeninteresse und den Anforderungen der Ethik an uns einen Unterschied machen, ist die Antwort dieser Ethikkonzeption auf die ersten beiden Grundfragen der Ethik zumindest überraschend. Weil die Diskussion der Konzeption des aufgeklärten Eigeninteresses und des ethischen Naturalismus noch aussteht, bleibt an dieser Stelle dreierlei festzuhalten. Erstens ist die Unterscheidung zwischen einer internen und einer externen Perspektive heuristischer Natur, da sie sich nur dann sinnvoll aufrecht erhalten lässt, wenn die diversen Reduktionsstrategien, in denen unsere ethische Begrifflichkeit auf etwas Außerethisches zurückgeführt wird, mit guten Gründen zurückgewiesen werden können. Daraus ergibt sich zweitens, dass die argumentative Inanspruchnahme dieser Unterscheidung zwischen einer internen und einer externen Perspektive inhaltlich keine neutrale Differenzierung ist (sie ist damit ein Beispiel für die inhaltliche Bedeutsamkeit metaethischer Überlegungen). Schließlich ist diese heuri-stische Unterscheidung drittens dadurch gerechtfertigt, dass sie eine Differenz artikuliert, die wir in unserem alltäglichen ethischen Selbstverständnis in der Regel voraussetzen. [...] [S. 9-20] 14 Peter Fischer Einführung in die Ethik Wilhelm Fink Verlag München © 2003 Wilhelm Fink Verlag GmbH & Co.KG ISBN 3-7705-3856-0 Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 15 Determinismus, Freiheit, Handlung Im ersten Kapitel hatten wir die Moral als jene Interessenvermittlung bestimmt, die sich am Glück eines jeden Menschen orientiert, um so das Glück aller zu ermöglichen. Eine solche Lebens- und Verhaltensweise ist dem Menschen von Natur weder vorbestimmt noch verschlossen. Die anthropologische Bestimmung der Offenheit des Menschen zur Selbstbestimmung seines Wesen, die Weltoffenheit1 des Menschen, verweist uns auf eine Voraussetzung unserer Überlegungen, die wir bisher nicht expliziert haben. Zentral waren bisher der Begriff des Glücks, auch wenn wir diesen noch nicht näher bestimmten, und die Deutung der Rede vom Glück aller. Bei der impliziten Voraussetzung handelt es sich um die Freiheit. Wenn wir nämlich sagen, daß wir wählen können, ob wir diesem oder jenem Motiv folgen, daß wir uns mit Gründen gegen unsere eigenen unmittelbaren Neigungen entscheiden können und daß uns die Möglichkeit der Selbstbestimmung offensteht, dann denken wir uns offensichtlich als frei. Zunächst sehen wir darin sicher einen Unterschied zu den Aktionen der Tiere. Ihr Verhalten gilt uns als determiniert durch das genetische Programm, durch Instinkte und Schlüsselreize. Zwar neigen wir dazu, höheren Tieren mit steigender Lernfähigkeit auch eine gewisse Entscheidungskompetenz zuzuschreiben, aber es ist keineswegs sicher, ob es sich bei den erlernten Verhaltensweisen um mehr als um bloße Konditionierungen handelt. Jedenfalls scheinen die Aktionen der Menschen und vielleicht jene hochentwickelter Tiere die einzigen Bereiche zu sein, in denen die Annahme der Freiheit eine Rolle spielt.2 Ansonsten setzen wir dagegen voraus, daß jedes Geschehen verursacht ist. Danach gilt ein Geschehen als eine mit Notwendigkeit eintretende Wirkung eines anderen Geschehens, welches somit als Ursache gedacht wird. Wenn wir diese Idee der Kausalität auf alle Bereiche unserer Wirklichkeit anwenden, dann beziehen wir den Standpunkt des Determinismus. Läßt sich dieser Standpunkt auch einnehmen, wenn wir menschliche Aktionen betrachten und verstehen wollen? Und wenn ja, müssen wir dann nicht unsere Voraussetzung der Freiheit aufgeben? Könnten wir aber ohne diese Voraussetzung überhaupt sinnvoll von Moral sprechen? Dies sind einige der Fragen, die das philosophische Problem von Freiheit und Determinismus umreißen, das uns jetzt beschäftigen wird. Versuchen wir zunächst, uns den Standpunkt des Determinismus weiter zu verdeutlichen. Der zeitgenössische englische Philosoph Ted Honderich stellt ein ausgearbeitetes Konzept des Determinismus vor. Er nennt es das Konzept der »kausalen Bedingungskomplexe«3. Honderich erläutert es anhand eines alltäglichen Beispiels: das Entzünden eines Streichholzes. Was ist die Ursache dafür, daß das Streichholz brennt? Vielleicht würden wir zunächst sagen: das Anreiben des Streichholzes. Nun könnten wir aber ein Streichholz anreiben, das dann trotzdem nicht brennt. Das Anreiben allein ist also nicht hinreichend. Einen kausalen Bedingungskomplex will Honderich nun verstanden wissen als Menge jener und nur jener Bedingungen, die hinreichend sind, damit die Wirkung hervorgebracht wird. Nehmen wir einmal an, der kausale Bedingungskomplex würde in unserem Beispiel die folgenden Elemente enthalten: das Streichholz, die Reibefläche, das Vorhandensein von Sauerstoff und das Anreiben. Wenn nun diese Bedingungen erfüllt sind, dann verursachen sie mit Notwendigkeit das Brennen des Streichholzes. Dies besagt das Konzept. Wenn das Streichholz dann trotzdem nicht brennt, wird das Konzept nicht in Frage gestellt, sondern übernimmt eine heuristische, d. h. eine unsere Nachforschung anleitende, Funktion bei der Fehlersuche. Entweder würden wir annehmen, daß eine der vier elementaren Bedingungen doch nicht Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 16 erfüllt war, es z. B. gar kein Streichholz war, sondern nur eine Streich-holzattrappe, oder wir kämen zu dem Schluß, daß unsere Liste der Bedingungen nicht vollständig ist. Als fünfte Bedingung würden wir dann vielleicht die Forderung, daß das Streichholz trocken sein muß, mit auf die Liste setzen.4 Das Konzept der kausalen Bedingungskomplexe ist also nicht davon abhängig, daß wir immer alle Elemente eines Bedingungskomplexes auch tatsächlich kennen müssen. Es bewährt sich auch bei der Suche nach diesen Elementen. Honderich ist es wichtig zu betonen, daß es für sein Konzept keineswegs hinreichend für die Behauptung eines kausalen Zusammenhanges ist, wenn zwischen zwei Ereignissen eine »bleibende Verknüpfung« besteht. Der Wechsel zwischen Tag und Nacht ist für die Menschen eine bleibende Verknüpfung, aber weder ist die Nacht die Ursache, der kausale Bedingungskomplex, für den Tag, noch verhält es sich umgekehrt. Vielmehr werden beide durch einen Komplex verursacht, zu dem etwa das Sonnenlicht, die Stellung der Erde zur Sonne und das Nichtvorhandensein anderer relevanter Lichtquellen gehören. Ist dieser Komplex von Bedingungen erfüllt, dann vollzieht sich mit Notwendigkeit der Wechsel von Tag und Nacht. Aber nur weil es Nacht war, muß es nicht auch Tag werden, nämlich dann nicht, wenn mindestens eine der zum kausalen Bedingungskomplex gehörenden Bedin-gungen nicht erfüllt ist.5 Der Determinismus besagt nun, daß ein jedes Ereignis durch einen bestimmten kausalen Bedingungskomplex hervorgebracht wird, dessen Elemente wiederum jeweils durch einen Bedingungskomplex verursacht sind und so fort. Honderich drückt diese für den Determinismus konstitutive Behauptung so aus: »Hinzu kommt, daß der kausale Bedingungskomplex für eine Wirkung in der Regel aus Teilen besteht, die ihrerseits Wirkungen sind. Dementsprechend ist dieser ganze Bedingungskomplex die Wirkung eines früheren Bedingungskomplexes, der womöglich vor langer Zeit gegeben war. Demnach hat der frühere Bedingungskomplex auch die abschließende Wirkung notwendig herbeigeführt. Dieses Faktum bezüglich der Wirkungen, also bezüglich der sogenannten Kausalketten, ist für den Determinismus von ausschlaggebender Bedeutung.« 6 Läßt sich dieses Konzept der Bedingungskomplexe und der Kausalketten nun auch auf die Aktionen der Menschen übertragen? Und was meinen wir überhaupt mit dem Ausdruck Aktionen der Menschen? Betrachten wir zwei unterschiedliche Fälle. Jemand stolpert, stößt dabei gegen eine Vase, die herunterfällt und zerbricht. Und der andere Fall: Jemand ruft: »Ich hasse Dich«, und greift nach einer Vase, wirft sie in die Richtung des Angesprochenen, den er glücklicherweise verfehlt. Aber die Vase geht letztlich auch zu Bruch. Im ersten Fall würden wir wohl von einem Unfall, schlimmstenfalls von Fahrlässigkeit sprechen. Dennoch schreiben wir den angerichteten Schaden der in das Geschehen involvierten Person zu. Wenn die Vase nicht dem Unglücksraben selbst gehört, kann ihr Eigentümer Schadenersatz fordern. Es könnte dann freilich immer noch einen Streit um die Klärung der näheren Umstände geben, so etwa um ein mögliches Mitverschulden des Eigentümers, der vielleicht etwas getan hat, weshalb der andere stolpern mußte. Auch könnte die Versicherung des Pechvogels sich weigern, den Schaden zu bezahlen, weil sie ihrem Klienten grobe Fahrlässigkeit vorwirft. Dennoch ist dieser Fall hinreichend verschieden vom zweiten Fall: Hier würden wir nicht von einem Unfall sprechen, sondern von einer Handlung, wenn auch vielleicht von einer Handlung im Affekt oder aus Leidenschaft. Zu der Rede von einem Unfall scheint das Konzept der Bedingungskomplexe recht gut zu passen: Es ermöglicht, die Zuschreibung der Schadenverursachung zu begründen, indem die involvierte Person als unverzichtbares Element jenes Bedingungskomplexes erkannt wird, Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 17 der zur Zerstörung der Vase führte. Zugleich ermöglicht dieses Konzept, danach zu fragen, durch welchen Bedingungskomplex das Stolpern der Person verursacht wurde, was für die Feststellung eines möglichen Mitverschuldens des Eigentümers wichtig ist. Paßt aber das deterministische Konzept auch zu der Rede von Handlungen? Sind Handlungen Wirkungen? Sind Handlungen Glieder einer Kausalkette? Wie denken wir Handlungen? Nun, für gewöhnlich wissen wir recht gut, ob wir ein bestimmtes Geschehen als eine Handlung bezeichnen sollen oder nicht. Wir verstehen es, den Begriff der Handlung oder den synonymen der Tätigkeit für bestimmte Unterscheidungen zu gebrauchen. In diesem Sinne schreibt Ludwig Wittgenstein: »Von der Bewegung meines Armes, z. B., würde ich nicht sagen, sie komme, wenn sie komme, etc. Und hier ist das Gebiet, in welchem wir sinnvoll sagen, daß uns etwas nicht einfach geschieht, sondern daß wir es tun. ›Ich brauche nicht abzuwarten, bis mein Arm sich heben wird, - ich kann ihn heben.‹ Und hier setze ich die Bewegung meines Arms etwa dem entgegen, daß sich das heftige Klopfen meines Herzens legen wird.«7 So oder so ähnlich hätte wohl jedermann auf die Bitte, er möge erläutern, was er mit dem Begriff der Handlung meine, geantwortet. Aus dieser Antwort lassen sich einige wesentliche Merkmale der Handlung herauslesen: Erstens ist Handeln etwas, was wir für gewöhnlich einer Person, also einem seiner selbst bewußten Wesen, zuschreiben. Hierauf verweist das Personalpronomen »ich«. Zweitens fungiert diese Person als Subjekt und ist nicht bloß als Objekt in ein Geschehen involviert. Dies verdeutlicht die Gegenüberstellung von »uns etwas geschieht« und »wir es tun«. Drittens ist Handeln etwas, was, zumindest der Möglichkeit nach, in der Macht des Subjekts steht: das Bewirken von etwas, wovon ein Subjekt sich als mögliche Ursache weiß oder zu wissen glaubt und das es daher als Wirkung voraussehen kann. Dafür steht die Wendung »ich kann ihn [meinen Arm] heben«. An anderer Stelle notiert Wittgenstein bezüglich der Antizipation: »Man könnte also sagen: die willkürliche Bewegung sei durch die Abwesenheit des Staunens charakterisiert.«8 Viertens bedeutet Handeln, den Zeitpunkt des Beginns eines - ganz allgemein gesagt Ereignisses festzulegen, einen Anfang in der Zeit zu setzen. Wittgenstein drückt dies durch die Formulierung »ich brauche nicht abzuwarten« aus. Betrachten wir zunächst den dritten Punkt etwas genauer. Offensichtlich spielen beim Handeln Fragen der Kausalität, der hinreichenden Bedingungen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen oder auch zu verhindern, durchaus eine wichtige Rolle. Für dieses Element einer Handlung wollen wir den Begriff der Operation einführen. Mit dem Begriff der Operation erfassen wir sozusagen den technischen Aspekt der Handlung: Wir müssen wissen oder zumindest zu wissen glauben, wie wir vorhandene Bedingungen nutzen können, welche Mittel für das Erzielen oder für das Verhindern welchen Effekts geeignet sind und was wir selbst können müssen, um Bedingungen zu nutzen, Mittel herzustellen und zu hand-haben. Handlungen werden also durch Operationen, einschließlich entsprechender Mittel, realisiert. Die Rede von Operationen bzw. Mitteln setzt voraus, daß die handelnde Person eine bestimmte antizipierte Wirkung herbeiführen will, sich diese also zu ihrem Zweck macht. Denn die Kenntnis des Zwecks entscheidet darüber, ob etwas überhaupt als Operation bzw. Mittel in Frage kommt. Für ein und denselben Zweck können verschiedene Operationen gleich oder unterschiedlich gut geeignet sein. Andererseits kann dieselbe Operation zur Realisierung verschiedener Zwecke eingesetzt werden. Damit stellt sich die Frage nach der Identität Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 18 der Handlung: Ist es dieselbe Handlung, wenn dieselben Operationen für verschie-dene Zwecke eingesetzt werden oder wenn derselbe Zweck, aber mit verschiedenen Operationen erreicht werden soll? Denken wir die Handlungsidentität als Identität der Operationen oder als Identität der Zwecke? Nehmen wir ein drastisches Beispiel: Jack the Ripper mag an seinen Opfern, von deren Tötung abgesehen, dieselben Operationen ausführen, die auch ein Chirurg bzw. Pathologe ausführt, dennoch würden wir nicht sagen, daß alle dieselben Handlungen oder Handlungsweisen ausführen. Offensichtlich wird hier die Handlungsidentität mit dem Zweck gesetzt. Wir können also auch dann von verschiedenen Handlungsweisen sprechen, wenn die Operationen dieselben sind. Wir könnten aber niemals von derselben Handlungsweise reden, wenn die Zwecke verschiedene wären, gleichgültig, wie es dabei um die Operationen bestellt sei. Im Hinblick auf die Bestimmung der Handlungsidentität läßt sich also folgendes sagen: Die Verschiedenheit der Zwecke ist notwendige und hinreichende Bedingung für die Verschiedenheit von Handlungsweisen; die Verschiedenheit der Operationen dagegen ist eine hinreichende, aber keine notwendige Bedingung für die Verschiedenheit von Handlungsweisen. Allerdings bleibt hier noch das Problem der sogenannten Handlungsfolgen. Denn realisierte Zwecke können ihrerseits zu Ursachen weiterer Wirkungen werden. Gehören solche Folgen zur Handlung? Eine scharfe Abgrenzung läßt sich hier kaum angeben. Aber von manchen Folgen werden wir sagen, daß sie der Handelnde voraussehen muß oder billigerweise voraussehen kann. Wenn er sich trotzdem für die Handlung entscheidet, dann will er offensichtlich diese Folgen auch herbeiführen oder nimmt zumindest das Risiko in Kauf, daß sie eintreten werden. Solche Folgen, um die der Handelnde billigerweise wissen kann, würden wir also mit zur Handlung rechnen; sie gehören sozusagen mit zum Zweck der Handlung. Wir sprechen nicht nur davon, daß wir Handlungen ausführen, sondern auch davon, daß wir Handlungen unterlassen. Letzteres soll nicht einfach heißen, daß jemand eben nicht handelt, sondern es bedeutet, daß er sich bewußt dafür entscheidet, nicht zu handeln. Die Unterlassung ist also die Negation der Ausführung einer bestimmten Handlung oder die bestimmte Negation einer Handlungsausführung. Wer es in diesem Sinne unterläßt, eine Handlung auszuführen, der will, oder nimmt es zumindest bewußt in Kauf, daß ein bestimmter, von ihm vorausgesehener Verlauf nicht abgeändert oder gar abgebrochen wird. Ein so konzipierter Begriff der Unterlassung wird nicht dem Begriff der Handlung entgegen-gesetzt, sondern bezeichnet einen der beiden einander ausschließenden Modi der Handlung: eben die Unterlassung im Gegensatz zur Ausführung. Was eine Unterlassung zur Handlung macht, ist in erster Linie der Entschluß in der Situation der Entscheidung: Vieles, was wir tun könnten, tun wir nicht, obwohl wir uns nicht zur Unterlassung entschlossen haben. Aber wenn wir erst einmal vor der Entscheidung stehen, ob wir etwas tun oder nicht tun, werden wir am Ende einen Entschluß gefaßt haben, egal wie wir uns entscheiden. In der Situation der Entscheidung sind wir also zum Entschluß und damit zur Handlung, entweder als Ausführung oder als Unterlassung, verurteilt. Versuchen wir unsere Überlegungen zu einem Handlungsbegriff zusammenzufassen. Die Wahl des Beginns der Handlung, die Wahl der Operationen bzw. der Mittel und die Setzung des Zwecks sind alles Elemente, von denen wir sagen können, daß sich in ihnen die Absicht der Person ausdrückt. Unter Berücksichtigung der beiden Handlungsmodi können wir daher sagen: Eine Handlung ist entweder die absichtliche Ausführung oder die absichtliche Unterlassung von zweckgerichteten Operationen durch mindestens eine Person. Unter diese Definition fallen weder das Stolpern aus unserem Beispiel, noch das Klopfen des Herzens, von dem Wittgenstein spricht: Solche Aktivitäten bezeichnen wir als Widerfahrnisse bzw. als vegetative Prozesse. Wenn es allerdings jemandem durch Yoga oder durch autogenes Trai-ning Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 19 gelingt, das Klopfen seines Herzens willkürlich zu beeinflussen, dann müssen diese Veränderungen als Operationen und, unter Einbeziehung ihres Zwecks, als Handlungen gelten. Was ergibt sich nun für das Verhältnis von Handlung und Determinismus? Daß die kausalen Bedingungskomplexe für den technischen Aspekt der Handlungen, also für Opera-tionen und Mittel, bedeutsam sind, ist leicht einzusehen. Aber wie ist es mit der Handlung als solcher? Kann die Handlung eine Wirkung sein? Nach unserem Handlungsbegriff nicht. Denn wir hatten ja gesagt, daß es eine freie Entscheidung der Person sei, ob sie mit der Handlung beginnt oder nicht. Die Person legt den Beginn ihrer Handlung nach Belieben fest. Wenn die Handlung aber eine Wirkung wäre, dann müßten wir mit Wittgenstein sagen, daß »sie komme, wenn sie komme«. Wir müßten zunächst abwarten und würden dann staunen, wenn sie endlich beginnt. Sind Handlungen Glieder einer Kausalkette? Nun, wenn Handlungen keine Wirkungen sind, dann können sie auch keine Zwischen- oder Endglieder einer solchen Kette sein. Aufgrund ihrer operativen Macht könnten Handlungen danach nur als erste Glieder jeweils den Beginn einer solchen Kette markieren. Insofern wäre eine jede Handlung zugleich eine erste Ursache. Mit jeder Handlung käme etwas Neues in die Welt, wofür es vorher keine Notwendigkeit im Sinne des Determinismus gab. Nun könnten uns freilich Zweifel daran kommen, ob wir wirklich frei sind. Die Erziehung, das Milieu oder die aktuellen Umstände einer Handlung werden oft bemüht, um ihr Zustandekommen zu erklären. Auch innere Dispositionen eines Menschen werden als Ursachen seines Handelns benannt. Ist es vielleicht nur eine Illusion, ein Vorurteil, wenn wir uns als frei denken, wenn wir glauben, frei zu entscheiden? Der Philosoph Rüdiger Bittner vertritt offensichtlich diesen Standpunkt. Er schreibt: »Wir bestimmen nicht unser Tun, wir beherrschen es nicht, wir wählen es nicht. Freilich sind wir ihm darum nicht ausgeliefert. Da ist niemand, der ihm ausgeliefert oder überlegen sein könnte. Wir tun Dinge, wie Bäume Blätter treiben. Gewiß, manches, was wir tun, ist gedankenlos, unaufmerksam oder überlegt, umsichtig. Manches ist vernünftig, manches nicht. Aber es ist all dies nicht dadurch, daß es einem Eingesehenen, es heiße Regel, Gesetz oder Bild, folgt oder nicht folgt. Es ist dies dadurch, daß es zusammen mit Umständen und früherem Tun Muster zeigt, die unter diesen Bezeichnungen klassifiziert werden.«9 Was könnten wir darauf erwidern? Zunächst würden wir sicher auf den eklatanten Widerspruch dieser Position zu unserem üblichen Selbstverständnis verweisen: Wer würde schon von sich sagen, er schreibe Texte, halte Vorlesungen, gehe ins Kino oder spende Geld, wie ein Baum Blätter treibt? Ebenso ungewöhnlich wäre es für uns zu sagen, daß Lügen, Betrügen, Rauben und Morden Geschehnisse seien, wie das Knospen und Verwelken der Blätter eines Baumes. Vom Sollen könnte vielleicht noch in der Gegenwart oder mit Blick auf die Zukunft die Rede sein, nämlich in der Meinung, daß die Äußerungen der Gebote oder der Verbote als Elemente eines kausalen Bedingungskomplexes wirksam werden. Aber zu sagen, daß jemand ein Tun in der Vergangenheit hätte ausführen bzw. unterlassen sollen, wäre eine Rede ohne Sinn. Wir könnten zwar einschätzen, daß ein anderes Tun bessere Wirkungen für uns gehabt hätte, müßten aber immer anerkennen, daß genau die eingetretenen Wirkungen mit Notwendigkeit eintreten mußten. Das Gefühl der Reue, insofern es darauf beruht, daß jemand meint, er hätte anderes tun sollen und tun können, müßten wir streichen. Wir könnten nur mit den Resultaten unseres Tuns unzufrieden sein, aber dieses niemals bereuen, denn wir hatten ja keine Wahl. Die Veränderung unseres Selbstverständnisses wäre so radikal, so tiefgreifend, daß wir in einer anderen Welt leben würden. Rüdiger Bittner ist sich dieser Konsequenzen durchaus bewußt, wenn er schreibt: »Am Ende mag sich diese Welt auch dadurch von der unseren unterscheiden, daß Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 20 wir anderes tun, eben weil wir so denken. Nicht daß wir uns, diesen Gedanken folgend, zu einem Tun bestimmen. Die Erfahrung zeigt nur, daß manches Tun im Umkreis mancher Gedanken nicht gedeiht. So mögen wir unter den beschriebenen Bedingungen aufhören, einander zu richten. Gutes und Schlimmes geschieht uns, nicht Böses. Wir freuen uns, wir klagen, aber wir loben und tadeln nicht. Wir sind ohne Schuld. So unterscheidet sich diese Welt doch wohl beträchtlich von der unseren. Aber so ungewohnt ein Leben in ihr wäre, unverständlich ist es nicht. Unverständlich ist die Meinung, deren Fortbestehen uns von ihm trennt.« 10 Ist dieses andere Leben tatsächlich nicht unverständlich? Welche Bedeutsamkeit hätte es für uns, zwischen Gutem und Schlechtem zu unterscheiden? Könnten wir in der anderen Welt noch sagen, wir wollen dafür Sorge tragen, daß Gutes geschieht? Was sollte dies heißen? Es könnte nicht heißen, daß wir Gutes tun wollen. Denn wir könnten uns nicht entscheiden. Es würde gelten: Entweder sind oder werden wir eine Ursache, die Gutes bewirkt, oder wir sind oder werden keine solche Ursache. Wir könnten es nicht ändern, denn das hieße ja, daß wir die Ursache unserer selbst wären. Das aber würde gerade die Position des Determinismus aufheben. Es würde nämlich bedeuten, daß wir zur Selbstbestimmung, also zur Freiheit, fähig wären. Und was sollten die Worte ›ich‹ und ›wir‹ eigentlich in dieser anderen Welt bedeuten? Bittner selbst schreibt ja: »Da ist niemand, der ihm [nämlich: »unserem Tun«] ausgeliefert oder überlegen sein könnte.« Dann wäre es aber auch nicht ›unser‹ Tun, sondern wir wären nur Teil eines Geschehens. Der Gebrauch des Wortes ›ich‹ wäre keine Weise des Selbstbezuges mehr, weil unklar sein würde, was das Selbst sein soll. Jeder wäre eine Wirkung, die in verschiedenen kausalen Bedingungskomplexen als Element verschiedener Ursachen fungiert. Und daß dies geschieht, wäre nicht von uns, verstanden als selbstbezügliche Wesen, abhängig. Die Rede von einer Ich-Identität hätte sich damit erledigt. Wer Ich sagt, sagt auch Freiheit, oder er gebraucht das Wort Ich in einer unüblichen und insofern unverständlichen Weise. Andererseits ist Bittners Welt verständlich, wenn wir den Determinismus als gültig voraussetzen. Und dies tun wir, wenn es uns um wissenschaftliche Erkenntnis, um Forschungsstrategien und um die Bestimmung des Technischen im Handeln geht. Von dieser Position aus müssen die Rede von der Freiheit und der ihr entsprechende Handlungsbegriff als unverständlich erscheinen. Wer von Freiheit spricht, scheint dann an Geister zu glauben, an Wesen, die sich der Naturnotwendigkeit entziehen. Der Apologet der Freiheit, könnte der Determinist sagen, sehe Gespenster. Das Determinismus-Problem hat damit die Form eines Streits zwischen verschiedenen Perspektiven angenommen. Aus der Perspektive unseres lebensweltlichen Selbstverständnisses, insbesondere in praktischer Hinsicht, also wenn es darum geht, daß wir uns entscheiden, daß wir etwas wollen, daß wir handeln, setzen wir uns als frei, als fähig zur Selbstbestimmung voraus. Aus der Perspektive der theoretischen Aneignung der Welt, in Wissenschaft, Forschung und Technik, setzen wir dagegen voraus, daß es notwendige Zusammenhänge gibt - alles andere erschiene uns als Aberglaube. Läßt sich nun eine der beiden Voraussetzungen beweisen, so daß die je andere Seite für immer schweigen müßte? Versuchen wir es zunächst mit der Freiheit. Können wir die Freiheit, die Selbstbestimmung, beweisen? Können wir sie so beweisen, daß der Theoretiker dem Praktiker zustimmen muß? Dazu bedürfte es eines theoretischen bzw. empirischen Beweises der Freiheit. Denken wir uns also ein Experiment aus. Die Person A fordert neun Personen aus ihrem Bekanntenkreis auf, eine geheime Liste mit Tätigkeiten zu erstellen. Alle diese Tätigkeiten sollen etwas ungewöhnlich sein: sich am Gummiseil in die Tiefe stürzen, eine Sahnetorte Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 21 aufessen und dergleichen Unfug mehr. Es sollen also Tätigkeiten sein, die nicht jeder ausführt und die einige Überwindung kosten, wenngleich es nicht gänzlich unwahrscheinlich oder gar unmöglich sein soll, daß die Person A diese Tätigkeiten ausführt. Extreme Lebensgefahr soll ausgeschlossen sein. Dann sollen die anderen im Geheimen abstimmen, welche Tätigkeiten die Person A tun wird, wenn man ihr die Liste vorlegt. Weil es eine ungerade Anzahl an Personen ist und Stimmenthaltungen ausgeschlossen sind, werden die Personen also für jede Tätigkeit eine eindeutige Prognose nach dem Mehrheits-prinzip abgeben. Aber die Person A hat, weil sie ja ihre Freiheit beweisen will, beschlossen, unabhängig von den Tätigkeiten, die auf der Liste stehen werden, nach einer Regel vorzugehen. Diese Regel könnte lauten: Alle Tätigkeiten unterlassen, oder: Alle Tätigkeiten ausführen, oder: Jede zweite Tätigkeit ausführen, die anderen unterlassen. Die Person A meint also, daß ihre Entscheidungen völlig unabhängig davon sind, was auf der Liste stehen wird, unabhängig davon, welche Emotionen - wie Furcht, Ekel, Unwohlsein - der Gedanke an die Tätigkeiten und erst recht ihre Ausführung auch erwecken mag. Sie folgt ausschließlich ihrer Regel und damit ihrer Selbstbestimmung. Daß Prognosen der anderen Personen nicht zutreffen, kann der Determinist damit erklären, daß diese die kausalen Bedingungskomplexe eben nicht durchschaut haben. Aber wie ist es mit der Selbstbestimmung durch eine bestimmte Regel? Nun, auch hier kann der Determinist sagen, es sei eine Wirkung, daß gerade diese Regel von der Person A gewählt worden war. Und wenn sich die Person A bei einer Neuauflage des Experiments für eine andere Regel entscheidet? Ebenso, würde der Determinist sagen, auch diese angebliche Entscheidung ist nur eine notwendig eintretende Wirkung. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen - einen theoretischen oder empirischen Beweis der Freiheit, den auch der Determinist akzeptieren muß, können wir nicht führen. Aber kann denn der Determinist seine Position beweisen? Für die Wahl der Regel durch die Person A dürfte dies schon kaum möglich sein. Freilich wird der Determinist sagen, das liege nur am noch zu geringen Wissen über die menschliche Psyche. Und er wird auf Fälle verweisen, in denen kausale Erklärungen experimentell immer wieder bestätigt werden. Aber auch wenn wir dies akzeptieren, ist es kein Beweis des Determinismus. Für diesen ist wichtig, was Honderich sagt: Jede Wirkung geht mit Notwendigkeit aus einem Bedingungskomplex hervor, dessen Elemente gleichfalls Wirkungen sind und so fort. Das heißt aber, daß keine kausale Erklärung vollständig sein kann. Denn die jüngste Wirkung verdankt die Notwendigkeit ihres Eintretens allen Bedingungskomplexen ihrer Kausalkette. Nicht nur daß wir als Menschen nur über begrenzte Kapazitäten verfügen, um eine solche Kausalkette zurückzuverfolgen. Schlimmer noch: Wir geraten in einen Regressus ad infinitum. Nach dem Konzept der Kausalketten müssen wir nämlich unterstellen, daß jede unendlich weit in die Vergangenheit reicht. Daher ist es auch begrifflich ausgeschlossen, eine vollständige Kausal-erklärung zu geben. Aber genau das müßte der Determinismus tun, um seine Gültigkeit zu beweisen. Der Streit zwischen Freiheit und Determinismus endet also hinsichtlich ihrer Beweisbarkeit mit einem Remis: Keine Position kann ihre Gültigkeit zweifelsfrei beweisen. Und eben weil keine wissenschaftliche Entscheidung möglich ist, ist das Determinismus-Problem auch ein echtes philosophisches Problem, nicht nur eine Frage, auf die sich die Antwort schon noch finden wird. Wie wollen wir nun mit diesem Ergebnis umgehen? Es ist offensichtlich angebracht, auf ontologisierende Redeweisen zu verzichten. Zu sagen: Personen sind frei, oder: alles ist durch kausale Bedingungskomplexe determiniert, sind unbeweisbare Sätze. Allerdings können wir sagen, daß wir in der wissenschaftlichen Forschung dem Determinismus als einem heuristischen Prinzip folgen und daß sich dieses Prinzip bewährt. Ebenso könnten wir sagen, daß wir uns in praktischer Hinsicht frei und mithin als handelnde Wesen denken. Und auch die- Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 22 ses Denken muß sich bewähren: im Alltag, in der praktischen Philosophie, speziell in der Ethik. Beide Prinzipien, die Freiheit und der Determinismus, sind sozusagen gerechtfertigt, als Voraussetzungen bestimmter Praktiken. Wenn wir Wissenschaft treiben, dürfen wir nicht an Gespenster oder Wunder oder sonstige Ereignisse, die sich der Naturnotwendigkeit entziehen, glauben. Wenn wir aber Menschen als Personen und ihre Aktivitäten als Entscheidungen und Handlungen verstehen und beurteilen wollen, dann müssen wir Freiheit voraussetzen. Wir können nicht erkennen, ob es Freiheit oder universelle Notwendigkeit im Sinne des Determinismus gibt, aber wir konstruieren mit Hilfe solcher Prinzipien unsere Welt. In diesem Sinne schreibt Immanuel Kant: »Alle Menschen denken sich dem Willen nach als frei. Daher kommen alle Urteile über Handlungen als solche, die hätten geschehen sollen, ob sie gleich nicht geschehen sind. Gleichwohl ist diese Freiheit kein Erfahrungsbegriff, und kann es auch nicht sein [...]. Daher ist Freiheit nur eine Idee der Vernunft, deren objektive Realität an sich zweifelhaft ist [ ...].«11 Den Determinismus dagegen können wir als einen jener Grundsätze verstehen, die fordern, in der Erforschung einer Reihe des Bedingten nicht etwas Unbedingtes anzu-nehmen, sondern immer weiter nach Bedingungen zu fragen. So können wir außer nach kausalen Bedingungskomplexen z. B. auch nach immer kleineren Teilchen forschen oder nicht nur nach der Ursache, sondern auch nach Zeit und Raum vor dem Urknall, der ja von manchen Kosmologen als Beginn unseres Universums postuliert wird, fragen. Über derartige Grundsätze, wovon der Determinismus eine Variante darstellt, schreibt Kant: »Der Grundsatz der Vernunft also ist eigentlich nur eine Regel, welche in der Reihe der Bedingungen gegebener Erscheinungen einen Regressus gebietet, dem es niemals erlaubt ist, bei einem Schlechthinunbedingten stehen zu bleiben. Er ist also [...] ein Grundsatz der größtmöglichen Fortsetzung und Erweiterung der Erfahrung, [...] also ein Principium der Vernunft, welches, als Regel, postuliert, was von uns im Regressus geschehen soll, und nicht antizipiert, was im Objekte vor allem Regressus an sich gegeben ist. Daher nenne ich es ein regulatives Prinzip der Vernunft, da hingegen der Grundsatz der absoluten Totalität der Reihe der Bedingungen, als im Objekte (den Erscheinungen) an sich selbst gegeben, ein konstitutives kosmologisches Prinzip sein würde [...].«12 Auch wenn wir Kants Argumentation, die im Detail durch die Spezifik seiner Erkenntnistheorie geprägt ist, nicht nachvollzogen haben, können wir doch sagen, daß wir zum gleichen Ergebnis gelangen wie er. Diese Parallele zeigt sich noch in anderer Hinsicht. Kant schreibt nämlich: »In Ansehung dieses empirischen Charakters gibt es keine Freiheit, und nach diesem können wir doch allein den Menschen betrachten, wenn wir lediglich beobachten, und, wie es in der Anthropologie geschieht, von seinen Handlungen die bewegenden Ursachen physiologisch erforschen wollen.«13 Den »empirischen Charakter«, von dem Kant hier spricht, können wir als das Sein der Menschen als Lebewesen und in sozialen Zusammenhängen verstehen. Dieses Sein, dieser »Charakter«, bildet die verschiedenen Gegenstände der Humanwissenschaften, z. B. der Soziologie, der Psychologie, der von Kant erwähnten empirischen Anthropologie, der Medizin und vielleicht noch anderer Disziplinen. Insofern diese lediglich »beobachten«, wie Kant sagt, d. h. insofern sie empirische Forschung und entsprechende Theoriebildung betreiben, sollen auch sie dem Determinismus als Erkenntnisprinzip folgen. Sie sollen also durchaus nach kausalen Erklärungen suchen. Für Forschungen ist es weder nötig, noch als Forschungsmaxime geboten, den Menschen als frei zu denken. Vom Handeln muß Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 23 also dort gar nicht die Rede sein. Da es aber z. B. in der Soziologie oder der Psychologie dennoch um menschliche Aktivitäten geht, wollen wir in diesen Fällen vom Verhalten sprechen. Die Soziologie gelangt vielleicht nicht bis zu strengen Kausalerklärungen des Verhaltens, aber doch wenigstens zu statistischen Korrelationen zwischen bestimmten Bedingungen und dem Verhalten der Menschen bestimmter Gruppen. Die Einstellung in den empirischen Humanwissenschaften ist also ihrer Art nach eher naturwissenschaftlich als moralphilosophisch. Daß es für die Forschung, sozusagen für die Logik dieser Forschungen, nicht nötig ist, den Menschen als frei, also als handelnde Person, vorauszusetzen, kann natürlich nicht heißen, daß der Forscher diese moralische Einstellung unberücksichtigt lassen darf, wenn er an wirklichen Menschen forscht, etwa im Falle psychologischer Experimente oder medizinischer Versuche. Freiheit und Handlung im moralphilosophischen Sinne sind zwar keine Begriffe, die in diesen Theorien vorkommen sollen, die aber sofort ihr Recht verlangen, wenn der Forscher in ein praktisches Verhältnis zu wirklichen Menschen tritt. Wir haben nun begrifflich die Handlung vom Widerfahrnis, von vegetativen Prozessen und vom Verhalten unterschieden und Operationen als Elemente der Handlung bestimmt. Dennoch könnten wir nun fragen, ob und wie wir unseren Handlungsbegriff überhaupt anwenden können. Erinnern wir uns an das Beispiel mit der Vase. Es war uns völlig plau-sibel, im Falle des Stolperns von einem Widerfahrnis und im Falle des wütenden Werfens der Vase von einer Handlung zu sprechen. Aber woher wollen wir das wissen? Diese Frage mutet im ersten Moment, und nicht ganz zu unrecht, absurd an. Im gewissen Sinne sehen wir, was eine Handlung ist und was nicht. Bestimmte Körperbewegungen, eine bestimmte Mimik und Gestik, Laute und erst recht Sätze haben für uns immer schon die Bedeutung, daß da jemand handelt und ihm nicht bloß etwas widerfährt. Wir wissen dies, weil wir so sozialisiert sind. Die Erfahrung, nicht im Sinne der methodisch gewonnen Erfahrung der empirischen Wissenschaften, sondern die Erfahrung im Umgang miteinander, hat uns dies gelehrt. Freilich kann es auch Fälle geben, in denen wir uns nicht sicher sind. Bleiben wir bei unserem Beispiel: Ist die Person wirklich gestolpert oder hat sie das Stolpern nur vorge-täuscht, um nicht der mutwilligen Zerstörung der Vase beschuldigt zu werden, was aber tatsächlich ihre Absicht war? Wer über mehr oder bessere Erfahrung verfügt, wird in solchen Fällen sicherer urteilen können. Es ist mit dem Handlungsverstehen in diesen Fällen so, wie mit dem Verstehen von Empfindungsausdrücken, etwa wenn wir nicht sicher sind, ob jemand Schmerzen nur vortäuscht. Was Ludwig Wittgenstein mit Bezug auf das Ausdrucksverstehen ausführt, gilt daher auch für das Handlungsverstehen. Er schreibt: »Gibt es über die Echtheit des Gefühlsausdrucks ein ›fachmännisches‹ Urteil? - Es gibt auch da Menschen mit ›besserem‹ und Menschen mit ›schlechterem‹ Urteil. Aus dem Urteil des besseren Menschenkenners werden, im allgemeinen, richtigere Prognosen hervorgehen. Kann man Menschenkenntnis lernen? Ja; Mancher kann sie lernen. Aber nicht durch einen Lehrkurs, sondern durch ›Erfahrung‹. - Kann ein Andrer dabei sein Lehrer sein? Gewiß. Er gibt ihm von Zeit zu Zeit den richtigen Wink. - So schaut hier das ›Lernen‹ und das ›Lehren‹ aus. - Was man erlernt, ist keine Technik; man lernt richtige Urteile. Es gibt auch Regeln, aber sie bilden kein System, und nur der Erfahrene kann sie richtig anwenden. Unähnlich den Rechenregeln.«14 Wittgenstein verdeutlicht, daß mit dem Wort Erfahrung in diesem Zusammenhang gerade nicht empirische Forschung, sondern Menschenkenntnis gemeint ist. Zumindest in der Anwendung einiger ihrer Begriffe ist Philosophie eben auch Menschenkenntnis. In manchen Fällen können wir daher nicht einfach sehen, ob jemand ein Widerfahrnis vortäuscht, aber eigentlich handelt, oder vielleicht eine bestimmte Handlung vortäuscht, aber ganz andere Absichten verfolgt und also eine andere Handlung ausführt. Hier müssen wir auf unsere Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 24 Menschenkenntnis bauen und können Indizien anführen, verbleiben aber im Bereich des Räsonierens, gelangen nicht zur Erkenntnis im wissenschaftlichen Sinne. Wittgenstein drückt dies so aus: »Ich bin mir sicher, daß er sich nicht verstellt; aber ein Dritter ist’s nicht. Kann ich ihn immer überzeugen? Und wenn nicht, macht er dann einen Denk- oder Beobachtungsfehler? ›Du verstehst ja nichts!‹ so sagt man, wenn Einer anzweifelt, was wir als echt erkennen, - aber wir können nichts beweisen.« 15 In diesen Streitfällen interpretieren wir also, und deshalb können wir dann Handlungen als Interpretationskonstrukte auffassen. Dies ist aber der sekundäre Fall, der nur möglich ist, weil wir normaler Weise wissen, was als Handlung oder auch als Empfindungsausdruck gilt. Daß ein bestimmtes Verhalten entweder als Handlung oder als Widerfahrnis aufgefaßt wird, muß bereits ein Umstand von kultureller Gültigkeit sein, damit Täuschung, Zweifel und Interpretation überhaupt möglich werden. Nachdem wir nun den Status von Handlungen sowohl begrifflich als auch im Hinblick auf die Anwendung, den Gebrauch des Begriffs geklärt haben, wollen wir noch einige Differenzierungen vornehmen, die in der ethischen Diskussion von Wichtigkeit sind. Wir wollen drei Handlungstypen unterscheiden, wozu wir auch den Begriff der Freiheit präzisieren müssen. Unseren Fall des mit der Vase werfenden Wüterichs hatten wir bereits als Handlung im Affekt charakterisiert. Um eine Handlung kann es dem Begriff nach nur dann gehen, wenn wir Absichtlichkeit unterstellen. Und in der Tat würden wir sagen, daß er die Absicht hatte, mit der Vase sein Gegenüber zu treffen. Seine Freiheit bestand also auf jeden Fall darin, eine bestimmte Absicht zu fassen und sich zur Handlung zu entschließen. Diese Freiheit, oder diese Aspekte der Freiheit, wollen wir Handlungsfreiheit nennen. Was heißt es nun, wenn wir von einer Handlung im Affekt reden? Die gerade bestimmte Handlungsfreiheit darf davon nicht berührt sein, denn sonst könnten wir begrifflich gar nicht mehr von einer Handlung reden. Dies ist z. B. der Fall, wenn jemand unter dem Einfluß starker Drogen steht. Seine Aktivitäten würden wir ihm dann nicht mehr als Handlungen zurechnen. Als Handlung zurechnen würden wir aber den Fakt, daß er Drogen genommen hat. Wenn er aber unwissent-lich oder gegen seinen Willen durch andere unter Drogen gesetzt wurde, ist er sozusagen als verantwortliches Handlungssubjekt ganz aus der Sache raus: Ihm kann bei der ganzen Angelegenheit keine Handlungsfreiheit zugeschrieben werden. Bei der Handlung im Affekt ist dies nicht der Fall. Dennoch soll die Klassifikation im Affekt auf eine Einschränkung der Freiheit aufmerksam machen. Denn wenn jemand im Affekt handelt, wird er quasi von seiner Erregung übermannt. Eingeschränkt wird dadurch seine Fähigkeit zur Überlegung, zur Deliberation. Er überlegt nicht, welches Mittel er einsetzt, sondern ergreift das nächst-liegende. Zum Glück war es bloß eine Vase und keine Axt. Aber das ist nicht die einzige Art der Überlegung, die hier defizitär bleibt. Die handelnde Person könnte nämlich auch ihren Handlungszweck in Frage stellen. Ein erreichbares Ziel wird erst dann zu einem Zweck, wenn ihm durch das Handlungssubjekt ein Wert zugeschrieben wird. Der Handelnde könnte sich also fragen: Ist es wirklich von Wert, für mich oder im moralischen Sinne, wenn ich mein Gegenüber mit der Vase treffe? Diese Überlegung könnte ihn dazu bringen, daß er sich ein mögliches Ziel nicht zum Zweck macht. Jenen Wert, der ein Ziel für ein Subjekt zu einem Zweck werden läßt, den es tatsächlich verfolgt, können wir das Motiv der Handlung nennen. Motive sind also handlungsrelevante Werte. Die Handlung im Affekt ermangelt also auch der Überlegung im Hinblick auf das Motiv. Fassen wir zusammen: Eine Handlung im Affekt ist eine Handlung, weil wir Handlungs- 25 Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung freiheit, also Absichtlichkeit und Entschluß unterstellen. Sie ist eine defizitäre Handlung, weil die Deliberationsfreiheit in zweifacher Hinsicht, nämlich hinsichtlich der Überlegung zur Wahl der Mittel und zur Motivbildung, eingeschränkt ist. Nun war in unserem Beispiel der Satz gefallen: »Ich hasse Dich«. Während die Wut als Affekt wohl so schnell vergeht, wie sie kommt, kann Haß eine echte Leidenschaft sein. Jemand kann ausdauernd hassen. Es kann zur Passion werden. Der Haß kann also vor dem affektiven Ausbruch bestanden haben und auch danach erhalten bleiben. Jemand, der aus Leidenschaft handelt, muß nicht im Affekt handeln. Leidenschaften können erfinderisch, ja raffiniert machen. Jemand, der aus Leidenschaft handelt, kann es sich sehr wohl überlegen, welche Mittel er einsetzen will, welche er für die geeignetsten hält. Die Deliberationsfreiheit bezüglich der Wahl der Mittel und Operationen ist mit dem Handeln aus Leidenschaft durchaus verträglich. Als Defizit bleibt hier nur die Überlegung zur Motivbildung. Daß alles, was z. B. dem Haß Genugtuung verschafft, ein wertvolles Handlungsziel ist und deshalb als Zweck gesetzt wird, gilt dem leidenschaftlich Handelnden für ausgemacht. Es wird nicht in Frage gestellt. Dies anzuzweifeln hieße, die Leidenschaft aufzugeben. Der dritte und in dieser Einteilung (vgl. Abbildung) letzte Handlungstyp ist folglich jener, bei dem sich die Deliberationsfreiheit auch auf die Motivbildung erstreckt. Wer so handelt, ist bereit, alle Aspekte seines Handelns zu rechtfertigen und ist dementsprechend auch Argumenten zugänglich, die diese Aspekte in Frage stellen. Ein solches Handeln wollen wir Handeln mit Gründen oder nach Regeln nennen, wobei wir eben unterstellen, daß die Gründe oder Regeln alle Handlungsaspekte reflektieren. Welcher Art die Gründe und Regeln sind, ob es sich dabei um moralische oder andere handelt, spielt aber hier noch keine Rolle. Wichtig ist nur, daß das Handlungssubjekt nicht durch Affekte oder Leidenschaften in seiner Deliberationsfreiheit eingeschränkt ist. Handlungsfreiheit Absichtlichkeit und Entschluß Handeln: im Affekt aus Leidenschaft nach Regeln x x x Deliberationsfreiheit: Überlegungen zur Optimierung der Motivbildung Mittel – x x Arten menschlichen Handelns nach Graden fortschreitender Freiheit – – x Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 26 Es könnte eingewandt werden, daß auch jemand, der mit Gründen oder nach einer Regel handelt, dies auf leidenschaftliche Weise tun könne, nämlich dann, wenn er sich mit ganzer Kraft und aller Konsequenz bei der Ausführung seiner Handlungen einsetzt. Das ist zwar in gewisser Weise richtig, aber es entspricht eben nicht der hier gegeben Bestimmung des Begriffs der Leidenschaft. In einem solchen Fall sollten wir daher besser von Engagement reden. Engagement erlaubt vollständige Deliberationsfreiheit und daher auch das Ende des Engagements mit Gründen. Der Begriff der Leidenschaft soll aber den Fällen vorbehalten bleiben, bei denen kein Nachdenken über Motive und Zwecke stattfindet und entsprechende Argumente sozusagen abgeblockt werden. Freilich kann Engagement in Leidenschaft umschlagen. Zum Abschluß unseres Nachdenkens über Determinismus, Freiheit und Handlung soll noch ein Begriff der Freiheit erwähnt werden, der sich von unserem Begriff der Freiheit, der im wesentlichen Selbstbestimmung bedeutet, unterscheidet. Dieser alternative Begriff besagt: Freiheit ist die Möglichkeit oder die Fähigkeit, Hindernisse überwinden, also etwas ungehindert realisieren zu können.16 Die Fähigkeit, Hindernisse überwinden zu können, betrifft aber in unserer Terminologie die Operationen. Denn Hindernisse lassen sich dann und um so besser überwinden, wenn bestimmte Operationen möglichst perfekt beherrscht werden und möglichst geeignete Instrumente zur Verfügung stehen. Daher soll hier die Fähigkeit, Hindernisse überwinden zu können, als Macht - wir könnten auch sagen: als operative Macht definiert werden, aber nicht als Freiheit. Allerdings könnte jemand sagen, daß Affekt und Leidenschaft doch offensichtlich Hindernisse seien, die unsere Freiheit, nämlich unsere Deliberationsfreiheit, einschränken. Also sei Deliberationsfreiheit doch die Überwindung von Hindernissen. Aber das, was Affekt und Leidenschaft einschränken, ist unsere Selbstbestimmung durch Überlegung. Der Begriff der Freiheit als Selbstbestimmung ist hier also schon vorausgesetzt. Nur unter dieser Voraussetzung können wir sinnvoll vom Beherrschen der Affekte und vom Meistern der Leidenschaften sprechen. Mit den Operationen, die hierzu nötig sind, bezieht sich das Subjekt auf sich selbst. Solche Selbsttechniken gehören zur Askese, insofern wir darunter jene Disziplin verstehen, die zum Handeln mit Gründen oder nach Regeln nötig ist. Die asketische Seite des Handelns wird in neueren Handlungstheorien leider oft unterschlagen. Die Selbsttechniken, die ein Bestandteil der Handlungen sind und daher den Begriff der Freiheit als Selbstbestimmung voraussetzen, geben einen Fingerzeig auf die Genese der Prinzipien der Freiheit und des Determinismus. Indem ein Subjekt sich disziplinierend auf sich selbst bezieht, setzt es sich als frei. Die Selbsttechniken sind aber nur notwendige, keine hinreichenden Bedingungen des Handelns. Zu den hinreichenden Bedingungen gehört auch das Wissen um die gegenstandsbezogenen Manipulationen. Je mehr sich das Handeln vom magischen Weltbild emanzipiert und die Menschen ihren eigenen Werkzeuggebrauch reflektieren, desto konsequenter konstruieren sie die Welt nach Zusammenhängen des Bewirkens. Die Einsicht, etwas bewirken zu können, wird zum Prinzip der Welterschließung und avanciert schließlich zum objektiven Prinzip der Welt. Ernst Cassirer drückt dies so aus: »Der Kausalbegriff gehört zu jenen Urformen der Synthesis, durch welche allein es möglich ist, den Vorstellungen einen Gegenstand zu geben: er ist als Bedingung der Möglichkeit der Erfahrung Bedingung der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung. Von einer solchen ins Objektive gewandten und das Reich der Objekte erst aufbauenden und ermöglichenden Kausalität weiß die mythisch-magische Welt noch nichts. […] Das Werkzeug erst und sein regelmäßiger Gebrauch durchbricht prinzipiell die Schranke dieser Vorstellungsart. In ihm kündigt sich die Götterdämmerung der magisch-mythischen Welt an. Denn hier erst tritt der Peter Fischer, Determinismus, Freiheit, Handlung 27 Gedanke der Kausalität aus der Begrenztheit der ›inneren Erfahrung‹, aus der Gebundenheit an das subjektive Willensgefühl heraus. Er wird zu einem Band, das rein gegenständliche Bestimmungen miteinander verknüpft und zwischen ihnen eine feste Regel der Abhängigkeit setzt.«17 Das menschliche Handeln und seine Reflexion erweisen sich als der Ursprung aller Konstruktionen nach den Prinzipien der Freiheit und des Determinismus. Anmerkungen 1 Vgl. Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der Welt. Wiesbaden 1986, S. 39f. 2 Wesen aus den Bereichen der Religion, des Mythos und der Phantasie wollen wir außer acht lassen. 3 Ted Honderich: Wie frei sind wir? Das Determinismus-Problem. Übersetzt von Joachim Schulte. Stuttgart 1995, S. 17. 4 Vgl. ebenda, S. 15f. 5 Vgl. ebenda, S. 19f. 6 Ebenda, S. 21f. 7 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 1. Teil, § 612. Frankfurt/M. 1984, Werkausgabe Bd. 1, S. 464f. 8 Ebenda, 1. Teil, § 628, vgl. auch § 629. A. a. O., S. 469. 9 Rüdiger Bittner: Handlungen und Wirkungen. In: Gerold Prauss (Hg.): Handlungstheorie und Transzendentalphilosophie. Frankfurt/M. 1986, S. 25. Wir können Bittner zugestehen, daß wir unser Tun nicht immer und selten vollständig beherrschen. Aber allein das stellt unser Selbstverständnis als Handlungssubjekte nicht prinzipiell in Frage. 10 Ebenda. 11 I. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 114f. 12 I. Kant: Kritik der reinen Vernunft, B 536f, A 508f. 13 Ebenda, B 578. Anthropologie, wie Kant den Terminus hier benutzt, muß als Gesamtheit aller Natur- und Sozialwissenschaften vom Menschen interpretiert werden. »Physiologisch« meint dann »natürlich« oder »naturgesetzlich« im Sinne dieser Wissenschaften - also von (bio-)mechanisch bis soziologisch. Vgl. z. B.: I. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, BA 63, wo die »empirische Seelenlehre« als Teil der »Naturlehre« aufgefaßt wird. 14 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, 2. Teil, XI; in: Werkausgabe, Frankfurt/M. 101995, Bd. 1, S. 574f. 15 Ebenda, S. 574. 16 Vgl. z. B. Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates. Herausgegeben und eingeleitet von Iring Fetscher. Übersetzt von Walter Euchner. Frankfurt/M. 1984, S. 163ff. (21. Kapitel). 17 Ernst Cassirer: Form und Technik. In: Peter Fischer (Hg.): Technikphilosophie. Von der Antike bis zur Gegenwart. Leipzig 1996, S. 184. 13 [S. 32-55] 28 Christof Rapp Aristoteles zur Einführung Junius Verlag Hamburg © 2001 Junius Verlag GmbH ISBN 3-88506-346-8 Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 29 Ethik Praktische Philosophie Aristoteles gliedert die Bereiche, in denen der Mensch überhaupt Wissen erlangen kann, in theoretische, praktische und herstellende Disziplinen (Met. 1025b 25f.). Der Unterschied zwischen theoretischen Disziplinen einerseits und praktischen sowie herstellenden andererseits besteht darin, dass Erstere ausschließlich auf Erkenntnis der Wahrheit aus sind, während es bei den Letzteren nicht allein darum geht zu erkennen, wie die Welt ist, sondern auch darum, verändernd auf sie einzuwirken. Herstellende Disziplinen tun dies, indem sie untersuchen, unter welchen Bedingungen bestimmte Produkte auf gute Weise realisiert sind, und dann die Herstellung entsprechender Produkte anleiten. Auch praktische Disziplinen zielen auf eine Veränderung der Wirklichkeit ab, jedoch auf solche Veränderungen, die aus unseren Handlungen und Entscheidungen resultieren. Handlungen aber haben nach der aristotelischen Terminologie kein selbstständiges und vom Vollzug der Handlung ablösbares Produkt zum Ziel, so wie die Dichtkunst die fertige Tragödie und die Schuhmacherkunst den bequemen Schuh zum Ziel haben (EN l140a 1 ff.). Bei Handlungen geht es vielmehr um das Gelingen, also um ein Ziel, das im Vollzug der Handlungen selbst liegt. »Gelingen der Handlung« wiederum heißt bei Aristoteles, dass das, was man tut, zu einem guten und glücklichen Leben beiträgt. Der »praktische« Teil der Philosophie hat es daher allgemein mit menschlichen Handlungen und dem guten Leben zu tun. Aristoteles behandelt die praktische Philosophie in mehreren Schriften; die wichtigsten Werke sind die Nikomachische Ethik und die Eudemische Ethik. In den letzten Jahren neigt die Forschung zu der Ansicht, dass die Eudemische Ethik, die bislang weniger Beachtung gefunden hat als die Nikomachische Ethik, als die ältere der beiden Schriften anzusehen ist. Nach der überlieferten Form haben die beiden Ethiken insgesamt drei Bücher gemeinsam (EN V = EE IV; EN VI = EE V; EN VII = EE VI), womit gewisse Brüche im Gedankengang und in der Terminologie verbunden sind. Die Authentizität einer weiteren ethischen Schrift mit dem Titel Magna Moralia wird inzwischen überwiegend bezweifelt. Zur praktischen Philosophie gehört auch die Politik, die das Wesen einer Polis diskutiert und eine ausführliche Verfassungslehre entfaltet. Daran schließen sich Der Staat der Athener,1 ein Bruchstück aus einer umfassenden Sammlung griechischer Verfassungen, und die Ökonomik als Teil der Politik an. Praktische Philosophie umfasst neben der Ethik die politische Philosophie sowie als Teil der Ethik die Handlungstheorie. Etwas verwirrend ist, dass Aristoteles als gemeinsamen Oberbegriff für Ethik und Politik den Ausdruck »hê politikê – die politische Wissenschaft« gewählt hat (EN 1094a 27, Rhet. 1356a 27). Diese Wortwahl führt leicht zu Missverständnissen wie demjenigen, dass für Aristoteles das Politische den Vorrang vor der individuellen Ethik genießen würde; tatsächlich aber rührt die Bezeichnung von der Vorstellung her, dass der wahre Staatsmann (griech.: politikos) jemand sei, der die Menschen besser machen könne (vgl. Platon, Gorgias 503b, 516e) und dazu über eine ethischmoralische Kompetenz verfügen müsse. Daher ist der weite Begriff der »politikê« der den gesamten Bereich der praktischen Philosophie umfasst, vom engeren Begriff der Politik im Sinne der Staats- und Verfassungslehre strikt zu unterscheiden. Den Nutzen der praktischen Philosophie kann man leicht sehen: In der praktischen Philosophie geht es um das gute Leben: jeder versucht, eher ein gutes als ein schlechtes Leben zu verwirklichen. Dieses Ziel wird man mit größerer Zuverlässigkeit erreichen, wenn Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 30 man zuvor eine gewisse Kenntnis davon erworben hat, wie das gute Leben beschaffen sein muss. Es verhält sich, so Aristoteles, ähnlich wie beim Bogenschützen, der sein Ziel vor Augen haben muss, um es treffen zu können (EN 1094a 23f.). Der praktischen Philosophie kommt es nicht auf die Erkenntnis allein, sondern auf das Handeln bzw. das Gelingen des Handelns an (EN 1095a 5 f.). Allerdings ergibt sich gegen das Projekt eines auf das Handeln und das gute Leben gerichteten Teils der Philosophie auch ein gewichtiger Einwand: Eine solche Disziplin muss sich mit der Frage auseinander setzen, welche Dinge als gut, gerecht usw. gelten. Darüber bestehen jedoch bekanntermaßen Meinungsverschiedenheiten; und es kommt auch vor, dass sich Dinge, die für den einen gut und nützlich sind, für den anderen schädlich auswirken. Man könnte demnach einwenden, dass solche Fragen nur auf wechselhaften Konventionen beruhen und dass eine Wissenschaft von solchen Dingen ausgeschlossen ist. Aristoteles macht sich diesen Einwand selbst und räumt ihn folgendermaßen aus: Erstens ist es durchaus richtig, dass ethische Fragen nicht mit derselben Exaktheit behandelt werden können wie etwa die der Geometrie; es wäre aber auch völlig unangebracht, einen derartigen Exaktheitsgrad von der Ethik zu verlangen und sie dann als unzureichend zu verwerfen, weil sie ihn nicht erfüllen kann. Vielmehr hat man es hierbei mit einem Bereich zu tun, in dem Ausnahmen immer möglich sind. Zum Beispiel gilt normalerweise der Reichtum als ein Gut, es gibt allerdings auch immer wieder Fälle, in denen jemand durch seinen Reichtum zu Schaden kommt (EN 1094b 18 f.). Praktische Philosophie zielt daher gar nicht auf strikt allgemeine und notwendige Aussagen; was von ihr zu erwarten ist, sind Sätze, die in der Regel (hôs epi to poly) wahr sind. Dass es die praktische Philosophie mit Aussagen zu tun hat, die nur in der Regel gelten, ist ein Merkmal, das die Möglichkeit echter Wissenschaft keineswegs ausschließt (Met. 1027a 20 f.). Sätze, die in der Regel gelten, sind für Aristoteles nicht nur Ausdruck einer statistischen Wahrscheinlichkeit, sondern sind am ehesten mit den notwendigen Sätzen verwandt, obwohl sie anders als diese den Vorbehalt möglicher Ausnahmen enthalten. Daher kann der Bereich, der es mit In-der-Regel-Sätzen zu tun hat, durchaus Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung sein (An. post. 87b 20ff.). Zweitens kann praktische Philosophie natürlich nicht bestimmen, was für den Einzelnen in einer konkreten Situation das Richtige ist; solche konkreten Fragen sind für Aristoteles Sache einer besonderen Art von Tugend, der so genannten praktischen Vernünftigkeit (phronêsis). Die praktische Philosophie kann hierüber nur skizzenhaft handeln (EN 1098a 20ff.); diese grobe Skizze in Anbetracht bestimmter Gegebenheiten auszufüllen ist dann Sache des Handelnden, nicht des Philosophen. Drittens kann der Gegenstand der praktischen Philosophie nicht wie die Lehrsätze der Geometrie gelehrt werden; die Vermittlung solcher Überlegungen setzt vielmehr voraus, dass der Hörer schon eine gewisse Erfahrung mit Handlungen in der Wirklichkeit des Lebens hat (EN 1095a 3). Wer nicht von Kind auf gelernt hat, was es heißt, gut oder schlecht zu handeln, kann dies auch nicht in einer Ethikvorlesung lernen. Das heißt, dass praktische Philosophie immer an eine bestehende Praxis anknüpfen muss. Überhaupt ist die philosophische Ethik nur für jemanden nützlich, der bereits daran gewöhnt ist, sein Leben nach den Ergebnissen vernünftiger Überlegungen auszurichten und bei seinen Handlungen nicht nur Begierden und emotionalen Impulsen zu folgen. Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 31 Glück als das höchste Gut Was die Menschen bewusst und absichtlich tun, das tun sie, so Aristoteles, um einer Sache willen, die ihnen als gut erscheint. Was gut ist, wird erstrebt, und so ist das Streben nach dem Guten oder den Gütern der eigentliche Antrieb für das Tun der Menschen. Daher beruht Aristoteles' Ethik auf einer allgemeinen Theorie des Strebens und der Güter. Das gute Leben bzw. das Glück (eudaimonia) nimmt in dieser Theorie die Rolle des höchsten Gutes bzw. des höchsten Strebensziels ein. Was ein Gut ist, lässt sich am einfachsten durch eine dreigeteilte Güterliste veranschaulichen, die zwischen äufleren Gütern, inneren Gütern des Körpers und inneren Güter der Seele unterscheidet (Pol. 1323a 24ff.). Zu den äußeren Gütern gehören u.a. Reichtum, Freundschaften, gute Herkunft, gute Nachkommen, Ehre, günstiges Geschick, zu den inneren Gütern des Körpers gehören Gesundheit, Schönheit, Stärke, athletische Fähigkeiten, und als innere Güter der Seele gelten die verschiedenen Tugenden (Rhet. I 5). Definiert wird ein Gut als das, wonach alle streben oder was um seiner selbst willen gewählt wird oder um dessentwillen man andere Dinge wählt (EN 1094a 2f., Rhet. 1362a 21 ff.). Alles, was man absichtlich tut, tut man, weil man ein bestimmtes Gut erstrebt und zu erlangen sucht. Güter sind demnach die Strebensziele aller absichtlichen Handlungen. Ein solches Ziel kann von der betreffenden Aktivität verschieden sein, so wie das fertige Haus das vom Bauen zu unterscheidende Ziel des Bauens ist, oder in der Aktivität selbst liegen, so wie das gute Leben zwar ein Ziel, jedoch nicht wie ein Produkt vom Vollzug des Lebens abtrennbar ist. Viele der Strebensziele sind Glieder einer hierarchisch geordneten Reihe: Man lernt etwas um einer Prüfung willen, man absolviert die Prüfung um einer bestimmten beruflichen Qualifikation willen, man übt den Beruf um des Lebensunterhalts willen aus. Ließe sich nun die Reihe solcher Strebensziele ins Unendliche fortsetzen, dann wäre das Streben leer und nutzlos (EN 1094a 21); also, schließt Aristoteles, müssen solche Reihen durch ein oberstes Ziel abgeschlossen werden, das um seiner selbst und nicht um einer anderen Sache willen gewählt wird. Nun gelangt Aristoteles von der Prämisse, dass keine dieser Güterreihen ohne Endziel bleiben darf, zu der Konklusion, dass es genau ein höchstes Endziel für alle möglichen Strebenshierarchien geben muss. Damit begeht er einen Fehlschluss, denn verschiedene hierarchisch geordnete Güterreihen würden auch dann noch abgeschlossen sein, wenn jede dieser Reihen über ein eigenes höchstes Ziel verfügte. – Trotz dieses logischen Fehlers ist Aristoteles' Argument keineswegs abwegig, denn wenn man davon ausgeht, dass schon aus Gründen der begrenzten Zeit und Ressourcen verschiedene Strebens- und Güterreihen in einem Leben koordiniert werden müssen, dann setzt eine solche, nach Gründen erfolgende Koordination verschiedener Strebensziele einen einheitlichen Maßstab voraus, und einen solchen liefert nach Aristoteles unsere Vorstellung vom einen höchsten Gut, dem guten Leben. Bevor aber das höchste Ziel mit dem guten Leben bzw. dem Glück identifiziert werden kann, bestimmt Aristoteles formale Kriterien, die ein höchstes Gut oder Ziel erfüllen muss (EN 1097a 25 ff.): 1. Es gibt Dinge, die nur um anderer Ziele willen gewählt werden (wie eine Medizin), und Dinge, die sowohl um ihrer selbst als auch um anderer Ziele willen gewählt werden (wie Lust und Tugend). Das höchste Gut oder Ziel jedoch wird nur um seiner selbst und niemals um einer anderen Sache willen gewählt. 2. Das höchste Gut wird nicht dadurch vergrößert, dass ein anderes Gut hinzugezählt wird. Diese Kriterien werden nach allgemeiner Erwartung von der »eudaimonia« erfüllt: 1. Güter wie Gesundheit, Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 32 Freundschaft, Wohlstand erstrebt man um eines guten Lebens willen, aber nicht umgekehrt das gute Leben um solcher Güter willen. 2. Es wäre abwegig zu sagen, dass das gute Leben zu einem größeren Gut würde, wenn ein anderes Gut, das sonst um des guten Lebens willen gewählt wird, hinzukommt: Wer insgesamt ein gutes Leben hat, der wird nicht noch glücklicher, wenn z.B. noch 100 Drachmen oder eine Flasche Wein zu seinem Glück hinzukämen. Formal ist daher klar, dass das im Leben erreichbare Glück das höchste Gut und letzte Strebensziel darstellt.2 Allerdings ist die Frage kontrovers, worin das Glück besteht, und nicht alle Auffassungen über den konkreten Inhalt des guten Lebens erfüllen die formalen Kriterien eines höchsten Guts. So kann ein Leben, das ausschließlich auf die Anhäufung von Reichtum gerichtet ist, nicht nach dem gesuchten höchsten Gut streben, denn Reichtum ist immer das Mittel zum Zweck des Erwerbs anderer Dinge, und was um anderer Dinge willen da ist, kann nicht das höchste Gut sein (EN 1096 a 5 ff.). Das für den Menschen gute Leben Worin besteht für den Menschen das gute oder glückliche Leben? Wenn es sich dabei um das höchste Strebensziel handelt, auf das mittelbar oder unmittelbar alle Handlungen eines Menschen ausgerichtet sind, dann ist klar, dass sich die philosophische Ethik an erster Stelle um eine Bestimmung der menschlichen, »eudaimonia« bemühen muss. Wie aber kann man allgemein das für den Menschen gute Leben bestimmen, wenn es doch unter den Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Glück gibt? Aristoteles versucht diese Schwierigkeit zu umgehen, indem er erstens eine nur umrisshafte Bestimmung des menschlichen Glücks gibt, diese Bestimmung zweitens auf Merkmale gründet, die allen Menschen gemeinsam sind, und drittens auch innerhalb dieser Bestimmung einen gewissen Spielraum für unterschiedliche individuelle Fähigkeiten lässt. Entscheidend für die Bestimmung des menschlichen Glücks ist das so genannte ErgonArgument, das sich bei Aristoteles in mehreren Versionen findet (EE 1218b 32ff., NE 1097b 22ff., 1106 a 15 ff.). Das Wort »ergon« bezeichnet die spezifische Funktion, Aufgabe oder Leistung einer Sache. Was mit Blick auf eine jede Sache gut ist, hängt von ihrer besonderen Funktion oder Leistung ab, so wie über das Gutsein des Messers seine Fähigkeit zu schneiden und über das Gutsein des Auges seine Fähigkeit zu sehen entscheidet. Eine jede Sache ist in einem guten Zustand, wenn sie ihr spezifisches »ergon« auf gute Weise verwirklicht. Hat nun ein jedes Ding eine spezifische Leistung oder Fähigkeit, dann muss es auch möglich sein, ein solches »ergon« für den Menschen allgemein zu bestimmen. Und wenn sich der gute Zustand einer jeden Sache aus ihrem »ergon« bestimmen lässt, muss auch das für den Menschen gute Leben, seine »eudaimonia«, auf diese Weise bestimmt werden können. Worin besteht die spezifische Fähigkeit des Menschen? Um diese Frage zu beantworten, greift Aristoteles auf die verschiedenen Fähigkeiten der menschlichen Seele zurück. Zunächst verfügt der Mensch bzw. die menschliche Seele über die lebenserhaltenden Fähigkeiten der Ernährung und des Wachstums. Ist dies auch die spezifische Leistung des Menschen, sein »ergon«? Nein, denn die genannten Fähigkeiten kommen auch allen anderen Lebewesen und Pflanzen zu. Wie steht es dann mit der Sinneswahrnehmung? Auch sie ist nicht das spezifische »ergon« des Menschen, denn sie findet sich auch bei den übrigen Lebewesen. Somit bleibt nur noch eine Fähigkeit: die Fähigkeit des Menschen, zu denken und zu überlegen, seine Vernunft (logos). Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 33 In der menschlichen Seele gibt es zwei verschiedene Teile oder Funktionen, die mit der Vernunft zu tun haben. Einerseits ist da der Teil, der selbst vernünftig ist bzw. Vernunft besitzt; er ist das »oberste« Seelenvermögen, insofern er die Impulse der restlichen Seelenteile soweit wie möglich zu kontrollieren versucht. Andererseits gibt es auch noch einen Teil der Seele, der zwar nicht selbst vernünftig ist, jedoch auf die Vernunft zu hören und ihr zu gehorchen vermag. Gemeint ist damit offenbar der für die Emotionen und bestimmte nichtrationale Begierden zuständige Seelenteil. Er kann dem vernünftigen Seelenteil »gehorchen«, insofern er seine Impulse den »Anordnungen« der Vernunft entsprechend zurücknehmen kann. – Spezifisch für den Menschen ist also seine Vernunftfähigkeit, und diese liegt auf zwei unterschiedliche Weisen vor: Der Mensch besitzt erstens Vernunft, und zweitens verfügt er über Emotionen und Begierden, die sich von der Vernunft leiten lassen. Die Aussage, dass der Mensch als einziges Wesen über Vernunft verfügt, ist richtig, aber noch nicht hinreichend genau, denn es macht einen wichtigen Unterschied, ob man etwas nur besitzt oder auch gebraucht. Bei Aristoteles wird dies zu der bekannten Unterscheidung von Möglichkeit bzw. Potenzialität (dynamis) einerseits und Wirklichkeit, Aktualität, Aktivität (energeia) andererseits ausgebaut. Weil der Mensch auch während des Schlafs Vernunft besitzt, sie allerdings nicht ausübt, kommt es für das Ergon-Argument darauf an, den aktualen Vollzug des Vernunftvermögens gegenüber dem bloßen Besitz zu betonen: Das gesuchte »ergon« des Menschen ist daher die Aktivität des vernünftigen und des auf die Vernunft hörenden Teils der Seele. Jede Aktivität kann besser oder schlechter ausgeführt werden. Der gute Zustand einer Sache ist dann gegeben, wenn sie ihre spezifische Aktivität auf gute Weise ausübt. Für diese Vortrefflichkeit einer jeden Sache verwenden die Griechen den Ausdruck »aretê«, der zugleich die Tugend bzw. die Tugenden im Sinne von Tapferkeit, Besonnenheit usw. bezeichnet. Ein Kitharaspieler z.B. erreicht seine »aretê« als Kitharaspieler dann, wenn er seine spezifische Leistung, das Spielen der Kithara, auf gute Weise vollbringt. Entsprechend kann man die »aretê« des Menschen als Menschen dadurch beschreiben, dass er die ihm eigentümliche Leistung, also die vernünftige Aktivität der Seele, nicht nur irgendwie, sondern auf gute Weise ausübt. – Schließlich spricht man von einem »glücklichen« oder »guten« Leben nicht mit Blick auf zeitlich beschränkte Episoden oder ein zeitweiliges Glücksgefühl, sondern mit Blick auf ein ganzes Menschenleben. Daher muss man zu den bisher genannten Merkmalen ein Stabilitätskriterium hinzufügen: Die gemäß der »aretê« erfolgende Aktivität der vernünftigen Seelenteile muss konstant sein und das ganze Leben prägen (EN 1098a 18 f.). Damit sind alle Momente eingeführt, die Aristoteles für die Bestimmung des menschlichen Glücks braucht: »Das für den Menschen Gute ist die Aktivität (energeia) der Seele gemäß der Vortrefflichkeit (aretê) bzw., wenn es mehrere Arten der Vortrefflichkeit (aretê) gibt, gemäß der besten und vollkommenen – und dies während eines kompletten Lebens« (EN 1098a 16 ff.). Der Hinweis auf eine vollkommenere Art von »aretê« bezieht sich offenbar auf den Seelenteil, der selbst Vernunft besitzt. Die Mehrdeutigkeit des Worts »aretê« als »Vortrefflichkeit/Bestzustand« einerseits und »Tugend« andererseits ist gewollt. Wenn die vernünftigen Teile der Seele auf vortreffliche Weise aktiv sind, dann verfügt der betreffende Mensch über »aretê«, und das bedeutet zugleich, dass er über Tugend oder Tugenden verfügt. Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 34 Philosophischer und populärer Glücksbegriff Aristoteles' Bestimmung der »eudaimonia« hat auf den ersten Blick vielleicht nicht allzu viel mit populären Vorstellungen vom Glück zu tun; in diesen dürften vielmehr das Angenehme, das Lustvolle und der Besitz äußerer Güter eine wichtige Rolle spielen (Rhet. 1360b 14ff.). Aristoteles meint, dass seine Bestimmung des Glücks diese Momente durchaus integrieren kann. Dass Lust zum glücklichen Leben gehört, wird von ihm nie infrage gestellt, jedoch soll dieser Aspekt vor allem durch die Arten von Lust erfüllt werden, die der Tugendhafte aus der tugendhaften Betätigung entnimmt (EN 1099a 7 ff.); so wie der Pferdefreund Lust aus dem Umgang mit Pferden schöpft, wird auch der Freund der Tugend Lust an seinen tugendhaften Handlungen haben. Den äußeren Gütern werden zwei verschiedene, aber jeweils untergeordnete Funktionen zugewiesen. In der ersten Funktion sind sie Werkzeuge oder Hilfsmittel der Tugenden (EN 1099a 32ff.); wer z.B. nichts zu verschenken hat, kann auch nicht die Tugend der Großzügigkeit ausüben. Die zweite Funktion setzt die Unterscheidung zwischen Glück und uneingeschränktem Glück voraus: Wer bestimmter Güter bzw. jeglichen Besitzes entbehrt, kann auch nicht uneingeschränkt glücklich sein (EN 1099b 2 ff.). Eine weitere Spannung zu populären Vorstellungen deutet sich dadurch an, dass im populären Tugendbegriff solche Tugenden besondere Wertschätzung genießen, die dem Wohl des anderen bei gleichzeitiger Aufopferung des Eigeninteresses dienen (Rhet. 1366b 3 ff.), wodurch sich ein Konflikt zwischen dem eigenen Glücksstreben und der Ausübung altruistischer Tugenden abzeichnet. Doch Aristoteles sieht diesen Konflikt auf der Ebene philosophischer Ethik als entschärft an. Erstens nämlich ist das Streben nach wohlverstandener »eudaimonia« als ein langfristiges und reflektiertes Interesse strikt von einer kurzfristigen Vorteilsnahme auf Kosten anderer zu unterscheiden; zweitens erkennt der philosophisch reflektierte Begriff der »eudaimonia« an, dass bis zu einem gewissen Grad das Wohl des Einzelnen vom Wohl der Gemeinschaft und insbesondere einiger ihm nahe stehender Personen nicht zu trennen ist; drittens gelten die als Vortrefflichkeit (aretê) der menschlichen Seele verstandenen Tugenden nicht nur als Instrument zur Beförderung des eigenen oder fremden Wohlergehens, sondern auch als an sich selbst erstrebenswerte, konstitutive Bestandteile der »eudaimonia«. Vortrefflichkeit des Verstandes Glück besteht in der Betätigung der Seele gemäß ihrer Vortrefflichkeit. Der Vernunft besitzende Teil der Seele weist eine solche Vortrefflichkeit auf, wenn er bestimmte intellektuelle Fähigkeiten praktiziert; dies sind die so genannten dianoetischen Tugenden (aretai). Im sechsten Buch der Nikornachischen Ethik nennt Aristoteles als solche Tugenden das Wissen (epistême), die Weisheit (sophia), den Geist/die Einsicht (nous) sowie die Kunst (technê) und die praktische Vernünftigkeit (phronêsis). Während sich die letzten beiden Vermögen auf die veränderliche Welt richten, haben es Wissen, Weisheit und Geist mit dem Unveränderlichen und Notwendigen zu tun. Von besonderer Bedeutung für das praktische Leben ist dabei die Tugend der »phronêsis«. Sie ist das für das gute Handeln verantwortliche Vermögen und scheint von Aristoteles als die intellektuelle Fähigkeit betrachtet zu werden, die man braucht, um Einzelentscheidungen so zu treffen, dass sie der »eudaimonia« zugute kommen. Sie ist die Fähigkeit, das Nützliche und Gute abzuwägen, aber nicht mit Blick auf Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 35 einen partikularen Nutzen, sondern mit Blick auf das Leben im Ganzen (EN 1140a 25 ff.). Um im Sinne der »phronêsis« vernünftig zu sein, genügt es nicht, dass man über Allgemeinwissen verfügt, man muss vielmehr das Einzelne kennen, d.h., man muss Erfahrungen3 mit ähnlichen Handlungsumständen selbst gemacht (EN 1141b 14 ff.) und ähnliche Entscheidungen selbst oder mithilfe der Gesetze oder des Erziehers getroffen haben. Die praktische Vernünftigkeit bezieht sich auf die Wahl der Wege, die zu einem durch Tugend vorgegebenen Ziel führen (EN 1144a 7ff.). Weil »phronêsis« daher in gewisser Weise für die Wahl der Mittel zu gegebenen Zwecken zuständig ist, wird sie oft mit einer instrumentellen Vernünftigkeit verglichen, die im Deutschen als »Klugheit« bezeichnet wird. Im Gegensatz zur Klugheit jedoch, die die Mittel zu beliebigen Zwecken auszusuchen versteht, ist die »phronêsis« den verfolgten Zielen gegenüber keineswegs neutral, sie bezieht sich stets auf die Mittel zu tugendhaften Zielen und zum guten Leben (EN 1144 a 23 ff.).4 Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass in Aristoteles' praktischer Philosophie die Rede von »Mitteln und Wegen zu einem Ziel« nicht unbedingt ein Mittel meint, das ein davon verschiedenes Ziel herbeiführt, sondern auch etwas meinen kann, was man insofern »im Hinblick auf ein Ziel« wählt, als es selbst das Ziel, nämlich das gute Leben, zu konstituieren hilft5; und dies scheint besonders für die Art von Mitteln zu gelten, die durch die »phronêsis« gewählt werden. Tugenden als Vortrefflichkeiten des Charakters Der auf die Vernunft hörende Teil der Seele, der Charakter, befindet sich dann im Zustand der Vortrefflichkeit und weist die Tugenden des Charakters auf, wenn er sich so verhält, wie es die Vernunft befehlen würde (EN 1103b 31 ff.), und das heißt, dass er sich richtig verhält. Weil sich die Charaktertugenden aber auf Leidenschaften (Emotionen und Begierden) beziehen und weil man in solchen Dingen das Richtige in zweierlei Weise, nämlich durch ein Zuviel und ein Zuwenig, verfehlen kann, meint Aristoteles, die Tugenden des Charakters allgemein dadurch charakterisieren zu können, dass sie eine Haltung der richtigen Mitte mit Bezug auf Leidenschaften darstellen. Im Einzelnen skizziert er in der Nikomachischen Ethik II 1-6 die Tugenden wie folgt: Die Tugenden des Charakters – auch »ethische« Tugenden genannt – haben etwas mit Emotionen und Begierden zu tun, so wie z.B. die Tugend der Tapferkeit eine Art des Umgangs mit Furcht vor gefährlichen Situationen darstellt. Selbst stellen sie allerdings keine Leidenschaften (pathê) dar, weil diese unfreiwillig auftreten und somit auch nicht zum Gegenstand von Lob und Tadel gemacht werden können; Tugenden und ihre Gegenteile, die Laster, sind aber das Ziel von Lob und Tadel. Wenn sie nicht selbst Leidenschaften sind, dann sind ethische Tugenden die Einstellungen oder Haltungen (hexis) zu unseren Leidenschaften, d.h., sie sind relativ beständige Dispositionen unseres Charakters (EN II IV). Während der Begriff des Charakters oft so gedeutet wird, dass es sich um die angeborenen, natürlichen Wesenszüge eines Menschen handelt, betont Aristoteles, dass Tugenden nicht von Natur aus bestehen, sondern durch Gewöhnung erworben werden, wobei der Mensch von Natur aus in der Lage ist, sie zu erwerben (EN 1103 a 18 ff.). Werden dianoetische Tugenden vor allem durch Belehrung ausgebildet, so erwirbt man ethische Tugenden durch Erziehung und Gewöhnung. (EN 1103a 26 ff.)6 Das sollte aber nicht im Sinne einer Abrichtung zu automatisch vollzogenen Verhaltensmustern verstanden werden. Vielmehr wird man tugendhaft, indem man zuvor tugendhaft handelt – und zwar indem man zuerst von Erziehern dazu angehalten wird und sich dann freiwillig für Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 36 entsprechende Handlungen entscheidet (EN 1103b 6 ff.). Von einer Tugend wird man nur dann sprechen, wenn sich jemand »sicher und ohne Wanken« für eine tugendhafte Handlungsweise entscheidet – und dies nicht aufgrund äußerlicher Gründe, wie z. B. der Furcht vor Bestrafung, sondern um der tugendhaften Handlung selbst willen (EN 1105a 28 ff.). Der Faktor der Gewöhnung bedeutet daher keineswegs, dass tugendhafte Handlungen ohne Überlegung und gleichsam automatisch ausgeführt werden müssten, im Gegenteil stellt nur die bewusste freie Entscheidung für tugendhafte Handlungen ein Indiz für entsprechende Einstellungen oder Charaktereigenschaften dar. Warum legt Aristoteles überhaupt so viel Wert auf den Aspekt der Gewöhnung? Stellen wir uns zwei Personen A und B vor, die beide die Möglichkeit hätten, sich einem ausschweifenden Vergnügen hinzugeben, die dies aber beide am Ende nicht tun. A verzichtet nur ungern und der Verzicht tut ihr weh, während B gar nicht ernsthaft in Versuchung war, so dass für sie der Verzicht auch nicht schmerzhaft ist. Person A unterscheidet sich von einer lasterhaften Person dadurch, dass sie sich am Ende im Sinne der Tugend entscheidet; sie verfügt jedoch nicht über die tugendhafte Eigenschaft der Besonnenheit, weil sie sich zu der lasterhaften Alternative hingezogen fühlt und nur durch Selbstbeherrschung der schlechten Handlungsweise widersteht. Person B dagegen fühlt sich zu lasterhaften Handlungen nicht einmal hingezogen, weil sie über eine allgemeine Einstellung zugunsten der Tugend verfügt und daher das Tugendhafte ohne Schmerz und sogar mit Freude tut. Allgemein sind Lust und Schmerz Indizien für die Charaktereigenschaften einer Person; deshalb sind auch tugendhafte Charakterzüge daran zu erkennen, dass man die tugendhaften Handlungen gern und mit Lust vollzieht (EN 1104b 3 ff.). Dies unterscheidet den Tugendhaften vom dem, der nur durch Selbstbeherrschung richtig handelt. Um aber einen der Tugend entsprechenden Charakterzug auszubilden und dadurch Freude an der Tugend zu empfinden, genügen nicht einzelne Handlungen, sondern muss man sich an das tugendhafte Handeln gewöhnt haben. Und nur wenn man daran gewöhnt ist und tugendhafte Handlungen gern tut, kann die Tugend als konstitutiver Teil des eigenen Glücks verstanden werden. Das wichtigste theoretische Moment für die Bestimmung der ethischen Tugend ist jedoch die Idee, dass Tugend immer eine Mitte (mesotês) zwischen zwei lasterhaften Extremen sei.7 Wie gesagt, stellen die Charaktertugenden eine Haltung gegenüber den Leidenschaften dar; Leidenschaften haben Einfluss auf unsere Handlungen und können diese unüberlegt und falsch machen. Die Lehre von der Tugend als einer »mesotês« zielt nun freilich gerade nicht darauf ab, dass man einen möglichst leidenschaftslosen Zustand erreichen sollte, sondern dass man die Leidenschaften auf die richtige Weise haben soll, wobei »auf die richtige Weise« so ausgelegt wird, dass man von jedem Emotionstyp weder zu viel noch zu wenig haben soll (EN II 6). Am besten ist dieses Verhältnis an der Tugend der Tapferkeit zu veranschaulichen: Sie ist die Mitte zwischen zu viel Furcht (Feigheit) und zu wenig Furcht (Tollkühnheit). Im ersten Fall empfindet man Furcht, obwohl eine Situation objektiv nicht bedrohlich ist, oder man empfindet gemessen an der Bedrohung unangemessen starke Furcht und handelt entsprechend. Ebenso falsch wäre es aber, wenn man überhaupt keine Furcht kennen oder auf keine Furcht reagieren würde, denn oft zeigt Furcht auch eine reale Bedrohung an. Wer daher keine Furcht empfindet, obwohl er einer realen Bedrohung ausgesetzt ist, wird »tollkühn« handeln, ohne Maß dafür, ob es sich lohnt, eine Gefahr einzugehen. Wer dagegen tapfer ist, hat weder zu wenig noch zu viel Furcht, sondern wird so viel Furcht empfinden, wie es unter den gegebenen Umständen richtig ist, und wird entsprechend handeln. Diese allgemeine Formel zur Bestimmung der charakterlichen Vortrefflichkeit darf nicht Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 37 darüber hinwegtäuschen, dass es im Einzelfall sehr schwierig sein kann zu bestimmen, welches das angemessene Maß an Furcht, Zorn, Begierde usw. ist und welches die entsprechend richtige Handlungsweise darstellt (EN 1106b 31 ff.). Um nicht den Eindruck zu erwecken, die hier gemeinte Mitte sei eine arithmetisch errechenbare Größe, sagt Aristoteles, es gehe jeweils um »die Mitte für uns«, um das für den Einzelfall Angemessene (EN 1106a 29 ff.). Aristoteles benutzt die Mesotês-Formel, um zu zeigen, inwiefern traditionell anerkannte Tugenden wie Tapferkeit, Besonnenheit, Gerechtigkeit, Freigebigkeit, Großmut, Sanftmut usw. als richtige Einstellungen und somit als Vortrefflichkeiten gelten können. Weil das Mesotês-Schema auf alle möglichen Affekt- und Lebensbereiche angewandt werden kann, ergeben sich bei diesem Verfahren bisweilen auch Haltungen der richtigen Mitte, die bisher noch unter keiner der herkömmlichen Tugendbezeichnungen bekannt sind. Trotzdem setzt er das Schema weit mehr zur Rechtfertigung schon bekannter als zur Einführung neuer Tugenden ein. Bei der Einzelanalyse verschiedener Emotionsbereiche zeigt sich auch, dass das Mesotês-Schema nicht immer gleichermaßen gut passt. So ist z. B. die Besonnenheit die richtige Einstellung im Vergleich mit einem Übermaß an Begierden; Aristoteles räumt aber ein, dass das andere Extrem, ein Zuwenig an Begierden, so gut wie nie vorkommt. Gerechtigkeit und Freundschaft In der griechischen Moralphilosophie spielt traditionell die Tugend der Gerechtigkeit eine herausragende Rolle, und auch Aristoteles widmet ihr das ganze fünfte Buch der Nikomachischen Ethik. Der besonderen Rolle der Gerechtigkeit trägt er mit folgender Unterscheidung Rechnung: Einerseits ist die Gerechtigkeit als Einzeltugend eine Charaktertugend unter anderen, andererseits gibt es die allgemeine Gerechtigkeit (EN V 3), von der Aristoteles sagt, sie sei die Gesamtheit der Tugenden, wenn diese nicht nur für den Einzelnen, sondern auch auf andere Menschen angewandt wird. In diesem letzteren Sinn handeln wir gerecht, sobald wir irgendeine der Tugenden zum Nutzen der anderen oder der Gemeinschaft einsetzen. Gerechtigkeit im Sinne der Einzeltugend ist auf Güter bzw. den Tausch und die Verteilung von Gütern bezogen. Bei den verschiedenen Ausprägungen dieser Tugend orientiert sich Aristoteles stets am Begriff des Gleichen. Dieses Gleiche versucht er bisweilen an die Mesotês-Struktur anderer Tugenden heranzuführen, etwa indem er sagt, das Gleiche sei die Mitte zwischen dem zu Großen und dem zu Kleinen (EN 1132a 29f.). Auch versucht er wie bei den anderen Tugenden, die Gerechtigkeit einer bestimmten Begierde, nämlich dem Zuviel-haben-Wollen, gegenüberzustellen. Weil ein hierzu entgegengesetztes Extrem allerdings fehlt, bleibt die Einordnung in die allgemeine Mesotês-Struktur schwierig. Theoretisch interessanter und historisch einflussreicher ist daher die Unterscheidung verschiedener Formen von (Einzel-)Gerechtigkeit. Die austeilende Gerechtigkeit (iustitia distributiva) regelt die Zuteilung von Gütern in der Gemeinschaft. In diesem Sinne ist es gerecht, wenn jeder seiner »Würdigkeit« entsprechend beteiligt wird; natürlich lässt sich darüber streiten, wonach diese Würdigkeit bemessen werden soll (EN 1131a 25ff.) In der Herrschaft der Reichen wird man den eingebrachten Reichtum zum Maßstab nehmen, in der Herrschaft der Besten die eingebrachte Kompetenz usw. In jedem Fall wird die austeilende Gerechtigkeit nach der so genannten geometrischen Proportionalität (EN V 6) berechnet: Angenommen, die Würdigkeit bzw. das Verdienst von A steht zum Verdienst von B im Verhältnis 3:1, dann muss A gegenüber B im Verhältnis 3:1 Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 38 an den Gütern beteiligt werden. Die ausgleichende Gerechtigkeit dagegen berücksichtigt keine Würdigkeit. Nimmt einer dem anderen 100 Drachmen weg, dann ist es gerecht, wenn dieser 100 Drachmen zurückbekommt – ungeachtet der Verdienste des Diebs und des Bestohlenen; daher wird hierfür nur die arithmetische Gleichheit, nicht die Proportionalität der austeilenden Gerechtigkeit benötigt. Bei der ausgleichenden Gerechtigkeit ist zwischen der austauschenden Gerechtigkeit (iustitia commutativa) und der wiederherstellenden Gerechtigkeit (iustitia correctiva) zu unterscheiden. Erstere regelt die freiwilligen Tauschund Geschäftsbeziehungen, Letztere ist für den Ausgleich zuständig, wenn jemandem gegen seinen Willen Schaden entstanden ist. Somit umfasst die »iustitia correctiva« weite Bereiche des heutigen Zivil- und Strafrechts. Auch die »iustitia commutativa« spielt in der Gemeinschaft eine wichtige Rolle: Weil der auf Kooperation angewiesene Einzelne ein Bedürfnis nach den Produkten des anderen hat, wird getauscht, ohne Tausch gäbe es keine Gemeinschaft (EN 1133b 6ff.), und ohne gerechte Regelung des Tausches könnten diese Geschäftsbeziehungen keinen Bestand haben. Gemeinschaften werden aber nicht nur durch Gerechtigkeit, sondern auch durch Freundschaft zusammengehalten (EN 1155a 23); im Unterschied zur Gerechtigkeit sei Freundschaft nicht nur notwendig, sondern auch schön. Außerdem sei unbestritten, dass keiner ohne Freunde leben möchte. Diese Wertschätzung der Freundschaft schlägt sich darin nieder, dass die Nikomachische Ethik zwei vollständige Bücher über die Freundschaft enthält (EN VIII ff.). Zur Freundschaft gehört zunächst die wechselseitige Zuneigung. Die freundschaftliche Zuneigung besteht in einer Art von Wohlgesinntheit, und dies heiflt wiederum, dass man dem Freund dasjenige wünscht, was man selbst für gut hält, und zwar um des Freundes willen (EN 1155b 31). Aristoteles unterscheidet verschiedene Arten von Freundschaft: Freundschaft unter Bürgern, asymmetrische Freundschaften zwischen älteren und Jüngeren, Männern und Frauen, Freundschaft um der Lust und um des Nutzens willen. Am höchsten schätzt er die um des Guten willen bestehende Freundschaft: die Freundschaft der Tugendhaften. Bei dieser Form der Freundschaft liebt man indirekt das, was für einen selbst gut ist, weil der zum Freund gewordene Tugendhafte für denjenigen ein Gut ist, dessen Freund er wurde (EN 1157b 33). Das beste Leben Das glückliche Leben muss lustvoll sein, aber damit kann nicht die Lust der Bedürfnisbefriedigung gemeint sein, weil ein solches Leben nicht die Merkmale eines höchsten Guts aufweist. Der vorletzte Schritt vor der Bestimmung des besten Lebens muss daher in einer Auseinandersetzung mit der Lust bestehen. Aristoteles' Beschäftigung mit diesem Thema liegt in gleich zwei Versionen vor (A-Version: EN VII 12-15, B-Version: X 15)8 Offenbar erfolgte in Platons Akademie eine kritische Auseinandersetzung mit dem Hedonismus, also mit der Auffassung, die Lust sei ein Gut oder das höchste Gut. Aristoteles nun kritisiert die antihedonistischen Argumente solcher akademischer Philosophen und zeigt, dass die Lust durchaus ein Gut sein kann, sofern man nur den richtigen Begriff von Lust zugrunde legt. Platon hatte Lust als »Wiederherstellung eines naturgemäßen Zustands« definiert; diese Definition wird von Aristoteles abgelehnt, weil sie – falls überhaupt – nur für eine bestimmte Art der Lustempfindung brauchbar ist, nämlich für diejenige Lust, die mit der Befriedigung von Bedürfnissen verbunden ist und auch genau dann endet, wenn das Bedürfnis befriedigt ist (demnach wäre der Übergang etwa vom Hunger zur Sättigung die Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 39 von Platon definierte Wiederherstellung eines natürlichen Zustands). Ist das gute Leben aber eine Praxis oder Aktivität (energeia) und keine Herstellung, dann kann auch die für das gute Leben typische Lustempfindung nicht als ein Prozess (kinêsis) beschrieben werden, der durch die Befriedigung eines Bedürfnisses abgeschlossen wird. Aristoteles bestimmt daher die Lust in der A-Version als eine ungehinderte Aktivität und in der B-Version als die Vollendung einer Aktivität. Mit diesem theoretischen Hintergrund wird es einfach sein zu erklären, dass die Aktivität der Seele gemäß ihrer Vortrefflichkeit – wodurch das glückliche Leben definiert wurde – zugleich lustvoll sei. Ist dies klar, so kann die Bestimmung der besten und der zweitbesten Lebensform geradlinig aus der Definition des glücklichen Lebens hergeleitet werden (EN X 6-9): Wenn das glückliche Leben in einer Aktivität der Seele gemäß der Vortrefflichkeit besteht – und zwar, wenn es mehrere Arten der »aretê« gibt, gemäß der besten und vollkommenen (EN 1098a 16 ff.) –, dann besteht das vollkommene Glück in der vortrefflichen Betätigung des höchsten menschlichen Seelenteils, nämlich der Vernunft. Eine solche Betätigung beschreibt, was man unter der »theoretischen« oder »kontemplativen Lebensform« versteht.9 »Theoretisch« meint, dass man sich den theoretischen – im Unterschied zu den praktischen – Disziplinen widmet, und das heißt, dass man Philosophie, vor allem Erste Philosophie (einschließlich der Theologie) sowie Astronomie, Mathematik usw. betreibt. Warum soll die theoretische Lebensform das höchste Glück des Menschen darstellen? 1. Theorie ist die Betätigung des vernünftigen Seelenteils, dieser ist aber das Beste und das Anleitende im Menschen. Die Gegenstände der Theorie sind das Beste im Bereich der Erkenntnis. 2. Denken ist die Tätigkeit, die wir am besten und am ehesten anhaltend betreiben können; bei anderen Dingen ermüden wir früher. 3. Die Betätigung der dianoetischen Tugend der Weisheit ist (im oben beschriebenen Sinn) mit Lust verbunden. 4. Autarkie trifft in höchstem Maße auf den Theoretiker zu – dies auch im Vergleich mit anderen Tugendhaften, denn der Gerechte etwa braucht Menschen und Güter, mit denen er gerecht verfahren kann. 5. Weil die Theorie keinen weiteren Zweck zu erfüllen hat, wird sie am ehesten um ihrer selbst willen erstrebt, was als ein Merkmal des höchsten Guts gilt. 6. Die Theorie bedeutet Muße, (fast) alles andere aber tut man um der Muße willen. Die theoretische oder kontemplative Lebensform verspricht also das vollendete Glück; allerdings formuliert Aristoteles hier eine wichtige Einschränkung: Ein solches Leben sei höher, als es dem Menschen als Menschen zukommt. Denn so könne er nicht leben, sofern er Mensch ist, sondern nur sofern er etwas Göttliches in sich habe (EN 1177b 26 ff.): Zwar soll man versuchen, nach dem Besten in uns zu leben (EN 1177b 33f.), und dies würde die theoretische Lebensform bedeuten, jedoch müsse auch der glückliche Mensch in äußeren Verhältnissen leben, weil er der Nahrung bedarf und überhaupt körperliche Bedürfnisse hat (EN 1178b 33ff.). Was genau Aristoteles mit dieser Einschränkung sagen möchte, ist nicht wirklich klar; jedenfalls dient sie ihm dazu, auch noch die zweitbeste Lebensform, durch die der Mensch glücklich leben kann, einzuführen. Vielleicht meint er, dass dieses Leben für alle die geeignet ist, die das vollendete Glück nicht erreichen können, oder vielleicht, dass auch die Theoretiker – weil sie als Menschen ein körperlich-emotionales Leben haben – eine Mischung von bester und zweitbester Lebensform erstreben sollten. Das zweitbeste Leben (EN X 8) nennt Aristoteles die »politische« Lebensform, weil sie in der Betätigung der Charaktertugenden besteht, die vor allem für den Umgang mit anderen geeignet sind. Anders gesagt, geht es um ein Leben nach denjenigen Tugenden, die es mit unseren Emotionen und daher mit dem Ganzen aus Leib und Seele zu tun haben. Auch ein solches Leben entspricht der allgemeinen Definition der »eudaimonia«, jedoch wird hierbei nicht die beste Tugend in uns in den Vordergrund gestellt, sondern die Tugend des auf die Christof Rapp, Aristoteles zur Einführung – Ethik 40 Vernunft hörenden Seelenteils. Ein Leben nach dieser Tugend stellt immerhin das »menschliche« Glück (EN 1178a 20 ff.) sicher. Anmerkungen 1 Vgl. P.J.Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, 2. Aufl., Oxford 1985; M. Dreher, Aristoteles, Der Staat der Athener, Stuttgart 1993. 2 In der Forschung umstritten ist, ob das höchste Gut im Sinne eines dominanten oder eines inklusiven Ziels ist. Während nach der dominanten Deutung das Glück deshalb das höchste Strebensziel ist, weil es in einer Aktivität besteht, die mehr als alle anderen Aktivitäten erstrebenswert ist, wird das Glück nach der inklusiven Deutung deswegen mehr als alles andere erstrebt, weil es alle an sich erstrebenswerten Güter in sich vereint. Vgl. A. Kenny, Happiness, in: Proceedings of the Aristotelian Society 66, 1965/66, S. 93-102; J.L. Ackrill, Aristotle on Eudaimonia, in: Proceedings of the British Academy 60, 1974, S. 339359; P. Stemmer, Aristoteles‘ Glücksbegriff in der Nikomachischen Ethik, in: Phronesis 37, 1992, S. 85-110; G. Lawrence, Nonaggregatability, Inclusiveness, and the Theory of Focal Value, in: Phronesis 42, 1997, S. 32-76. 3 Zum Zusammenhang von phronêsis und Erfahrung vgl.: R. Elm, Klugheit und Erfahrung bei Aristoteles, Paderborn 1996. 4 Vgl. P. Aubenque, La prudence chez Aristote, Paris 1963; skeptisch gegenüber den angeblichen Leistungen der phronêsis: Th. Ebert, Phronesis, in: O. Höffe, Aristoteles. Die Nikomachische Ethik, Berlin 1995, S. 165-186. 5 Vgl. D. Wiggins, Deliberation and Practical Reason, in: A.O. Rorty (Hg.), Essays on Aristotle’s Ethics, Berkeley/Los Angeles/London 1980, S. 221-240. 6 Vgl. M.F. Burnyeat, Aristotle on Learning to Be Goodm in: A.O. Rorty (Hg.), Essays on Aristotle’s Ethics, a.a.O., S. 69-92. 7 Vgl. U. Wolf, Über den Sinn der Aristotelischen Mesoteslehre, in: O. Höffe, Aristoteles. Die Nikomachische Ethik, a.a.O., S. 83-108; R. Bosley/R.A. Shiner/J.D. Sisson (Hg.), Aristotle. Virtue and the Mean, in: Apeiron 28/4, Edmonton 1995. 8 Vgl. F. Ricken, Der Lustbegriff in der Nikomachischen Ethik des Aristoteles, Göttingen 1976; ders. Wert und Wesen der Lust, in: O. Höffe, Aristoteles. Die Nikomachische Ethik, a.a.O., S. 207-228; J.C.B. Gosling/C.C.W.Taylor, The Greeks on Pleasure, Oxford 1982. 9 Vgl A.J.P. Kenny, Aristotle on the Perfect Life, Oxford 1992. 41 Otfried Höffe (Hrsg.) Einführung sche Ethik in die utilitaristi- Klassische und zeitgenössische Texte Francke Verlag Tübingen 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage © 1992 A. Francke Verlag GmbH Tübingen ISBN 3-7720-1690-1 Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 42 Einleitung I. Grundmerkmale des Utilitarismus Schon zu ihrem Überleben braucht jede Gesellschaft Normen (»Was sollen wir tun?«) und Handlungsziele (»Wie sollen wir leben?«), die allgemein anerkannt sind. Noch in einem höheren Maße sind sie erforderlich, wenn es über den bloßen Fortbestand der Gesellschaft hinaus um Lebensverhältnisse geht, die sich unter die Ansprüche von Humanität, von Frei-heit und Gerechtigkeit stellen. Dies gilt für traditionsbewußte Agrarkulturen ebenso wie für jene aufgeklärte Industriegesellschaften, in denen sich die ehemals einheitlichen und festen Verhaltensmaßstäbe aufgelöst haben und immer zahlreichere Gruppen mit eigenen Interessen, Glaubensüberzeugungen und Handlungsweisen hervorgetreten sind. Zwar ist es weder notwendig noch wünschenswert, daß die Verbindlichkeiten in ihrer Gesamtheit für alle Gruppen, Verbände, Altersklassen und Subkulturen unterschiedslos gültig sind. Zu Recht erkennen die westlichen Industriegesellschaften den Prozeß an, aus dem sie hervor-gegangen sind, demzufolge viele der Normen und Handlungsziele Freiräumen überlassen werden können, die - durch gruppenspezifische Moden, Konventionen, Bekenntnisse und Weltanschauungen ausgefüllt - Reibungen und Frustrationen vermindern sowie ein breites Spektrum der Selbstverwirklichung eröffnen. Aber auch in den pluralistisch gewordenen Gesellschaften sind elementare Regeln des Zusammenlebens erforderlich, Regeln, die sich gegen eine ausschließlich gruppenrelative Gültigkeit wenden und allgemeine Verbindlichkeit beanspruchen. Gerade wegen der Mannigfaltigkeit der Gruppen und ihrer Formen von Selbstverwirklichung braucht es Normen, die den Ausgleich konkurrierender Gruppen und Lebensformen bestimmen und die als notwendige Voraussetzung von Selbstentfaltung und von Kommunikation dem pluralisierbaren Bereich entzogen sind. Dazu gehören Grundnormen, die (wie etwa das Tötungsverbot) jedes Zusammenleben - sei es innerhalb der Gruppen, sei es zwischen ihnen - möglich machen. Dazu zählen Grund- und Persön-lichkeitsrechte, die jedem einzelnen einen unantastbaren Freiraum der Selbstentfaltung zubilligen, sowie Rahmennormen, die eine unbegrenzte Rivalität der Gruppen und Bekenntnisse verhindern. Schließlich braucht es Verbindlichkeiten, die - in der Situation öffentlich relevanter Konflikte innerhalb der Staaten sowie zwischen ihnen - trotz der pluralistischen Ausgangslage eine humane und gerechte Lösung befördern. Zu den nicht so zahlreichen Versuchen, verbindliche Normen mit wissenschaftlichen Mitteln zu begründen, das heißt zumindest ohne eine letzte Berufung auf politische und religiöse Autoritäten oder auf das von alters her Gewohnte und Bewährte, gehört die utilitaristische Ethik. Die deutsche Diskussion hat allerdings die Problemstellung des Utilitarismus und seinen Lösungsansatz stark vernachlässigt.1 Meist ohne die entsprechende philosophische Theorie wirklich zu kennen, hat man dem Ausdruck »utilitaristisch« einen negativen Beigeschmack gegeben; gelegentlich übt der Ausdruck geradezu eine denunziatorische Funktion aus. Diese Situation hat mannigfaltige Gründe. Während Kant jede eudämonistische Ethik radikal ablehnt, während Marx und Engels dem Utilitarismus eine »exploitation de l’homme par l’homme« vorwerfen und Nietzsche für ihn nur spöttische Randbemerkungen übrig hat,2 während N. Hartmann in seiner ehemals einflußreichen Ethik eine heftige, aber oberflächliche Kritik übt3 und die Vertreter der kritischen Theorie zweckrationale Überlegungen überhaupt bloßstellen, ist der Utilitarismus in der englischsprachigen Welt seit Jeremy Bentham (1748-1832) und John Stuart Mill (l8061873) nach und nach zu einer der wichtigsten moralphilosophischen Positionen aufgerückt. Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 43 Darüber hinaus ist er für die Entwicklung eines bedeutenden Forschungszweiges der Nationalökonomie, der Wohlfahrtsökonomie,4 sowie für eine Vielzahl von sozialen und politischen Reformen - nicht nur in den anglo-amerikanischen Ländern - mitverantwortlich. Um eine Verständigungsmöglichkeit mit der englischsprachigen Debatte zu gewinnen, vor allem aber um ein Angebot zur rationalen Normenbegründung zu prüfen, empfiehlt sich die Rezeption und kritische Auseinandersetzung mit dem Utilitarismus. Im Laufe seiner Entwicklung hat sich der Utilitarismus in eine beinahe verwirrende Zahl von Positionen und Unterpositionen ausdifferenziert. So kann man heute den negativen vom positiven, den subjektiven vom objektiven, den hedonistischen vom idealen Utilitarismus und vor allem den Handlungs- vom Regelutilitarismus unterscheiden. Die utilitaristische Ethik ist längst nicht mehr eine einzige, in sich homogene Theorie. Auch wenn die inneren Kontroversen zu keinem abschließenden Konsens geführt haben, läßt sich ein Kern herausdestillieren, der den wichtigsten Varianten gemeinsam ist. Als erstes zählt die Grundfrage: »Was ist moralisch verbindlich, und wie kann man es rational begründen?« Durch sie hebt sich der Utilitarismus schon thematisch sowohl von den Ethiken ab, die sich - wie ein großer Teil der zeitgenössischen analytischen Ethik - auf eine moralphilosophische Analyse zweiter Ordnung konzentriert und die Bedeutung ethischen Vokabulars (»richtig«, »gut« ...) oder die formale Logik von Imperativen und Sollenssätzen erörtert. Noch weniger geht es dem Utilitarismus um die Fragen empirischer Sozialwissenschaften, die das tatsächliche Verhalten und die faktischen moralischen Vorstellungen, sei es von einzelnen, sei es von Gruppen, untersuchen. Der Utilitarismus stellt vielmehr ein Kriterium auf, nach dem sich Entscheidungen, Handlungen, Normen und Institutionen als moralisch richtig oder falsch sollen beurteilen lassen. Er ist eine moralphilosophische Analyse erster Ordnung: eine normative Ethik im Sinne einer Theorie der Ziele und Prinzipien moralisch richtigen Handelns. Den Ausgangspunkt bildet die wohlvertraute Situation, daß wir verschiedene Handlungsmöglichkeiten sehen, nicht wissen, welche wir ergreifen sollen, und dann ein Kriterium suchen, nach dem wir die rechte Wahl treffen können; der Utilitarismus rekonstruiert die moralisch richtige Handlung als Resultat einer rationalen Wahl zwischen alternativen Möglichkeiten. Dabei besteht sein Kriterium der Rationalität aus vier Elementen oder Teilkriterien bzw. Teilprinzipien: 1. Im Unterschied zur sogenannten deontologischen Ethik5 sollen Handlungen bzw. Handlungsregeln (Normen) nicht für sich selbst oder aus ihren Eigenschaften heraus als richtig oder falsch beurteilt werden; ihre Richtigkeit bestimmt sich vielmehr von den Folgen her. 2. Gemessen werden die Folgen an ihrem Nutzen (lat. utilitas, daher die Bezeichnung Utilitarismus). - 3. Entscheidend ist aber nicht der Nutzen für beliebige Ziele, Werte oder Zwecke der Utilitarismus impliziert keinen Wertnihilismus (N. Hartmann) -, sondern der Nutzen für das, was in sich gut ist. Zwar kann die Begründung des in sich Guten eigenen philosophischen Überlegungen, denen einer ethischen Werttheorie, überlassen bleiben. So kann man als höchsten Wert etwa Vitalität, soziale Anerkennung, Schönheit, Erkenntnis oder eine Verbindung dieser und anderer Sinnbestimmungen auffassen; und diese Verschie-denheit benennt den Grund, warum der Utilitarismus keine homogene Position bleiben, sich vielmehr in eine große Theoriefamilie verzweigen wird. Sofern man jedoch Bentham und Mill als den klassischen Vertretern folgt, enthält der Utilitarismus selbst eine wert-theoretische Position. Als höchster Wert gilt die Erfüllung der menschlichen Bedürfnisse und Interessen: das menschliche Glück; Ziel ist die maximale Bedürfnis- und Interessen-befriedigung bzw. die minimale Frustration. Deshalb gilt das als sittlich geboten, was am meisten Lust (griech. hedone) bereitet (»positiver Utilitarismus«) oder aber Unlust vermeidet (»negativer Utilitaris- Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 44 mus«). Genauer: Kriterium der Beurteilung der Folgen einer Handlung ist ihr Gratifikationswert: das Maß an Lust, das die Handlung hervorruft, vermindert um das mit ihr verbundene Maß an Unlust. - 4. Es kommt nicht auf den Gratifikationswert für den Handelnden allein an; das würde nur einen rationalen Egoismus begründen, dem der Utilita-rismus deutlich widerspricht. Ausschlaggebend ist auch nicht das Wohlergehen bestimmter Gruppen, Klassen oder Schichten, sondern das aller von der Handlung Betroffenen. Der Utilitarismus ist eine normative Ethik im Sinne einer Sozialpragmatik; er verpflichtet das menschliche Handeln auf das allgemeine Wohlergehen und sucht diese Verpflichtung soweit wie möglich wissenschaftlich einzuholen. Die vier Teilkriterien: Das Folgen- (Konsequenzen-) und das Nutzen- (Utilitäts-)Prinzip, das hedonistische und das universalistische Prinzip lassen sich in das eine utilitaristische Prinzip, das Prinzip der Nützlichkeit, zusammenfassen: »Diejenige Handlung bzw. Handlungsregel ist moralisch richtig, deren Folgen für das Wohlergehen aller Betroffenen optimal sind«; oder als (utilitaristische) Maxime formuliert: »Handle so, daß die Folgen deiner Handlung bzw. Handlungsregel für das Wohlergehen aller Betroffenen optimal sind.«. Der Utilitarismus nimmt gegenüber den faktischen Verhaltensweisen nicht den Standpunkt eines unbeteiligten und interesselosen Zuschauers ein. Die gängigen Vorstellungen von moralisch richtigem Handeln sollen nicht etwa bloß verstanden und widerspruchsfrei rekonstruiert werden; gesucht ist eine kritische Handlungsorientierung, die mit Hilfe einer möglichst wissenschaftlichen Begründung von Normen vorgenommen wird. In der Diskussion um die Relevanz einer wissenschaftlichen Philosophie kann man idealtypisch zwei Positionen unterscheiden. Auf der einen Seite verweist eine szientifischpositivistisch orientierte Richtung (z. B. Ayer; vgl. Anm. 21) moralische Wertungen und Entscheidungen in den Bereich des Nichtrationalen. Auf der anderen Seite erhebt die praktische Philosophie im Zuge ihrer Rehabilitierung den Anspruch auf normativ-kritische Kompetenz für die Gesellschaft.6 Zwischen beiden Positionen geht der Utilitarismus einen mittleren Weg, demzufolge die rationale Reflexion für die Bestimmung von Normen nicht allein zuständig ist; für diese Aufgabe bedeutungslos oder ungeeignet ist sie jedoch auch nicht. Nach der utilitaristischen Ethik gewinnt man, was moralisch verbindlich ist, nicht auf rein rationalem Weg, etwa durch Deduktion aus ersten Prinzipien; für eine Normen-begründung sind ganz wesentlich empirische Kenntnisse erforderlich: Kenntnisse über die Folgen einer Handlung und deren Bedeutung für das Wohlergehen der Betroffenen; die entsprechenden Resultate der psychologischen und sozialwissenschaftlichen Forschung sind in das Verfahren der Normenbegründung zu integrieren. Unter dem Mangel, der jede normativ-kritische Theorie kompromittieren müßte, dem grundsätzlichen Mangel an Realitätsbezug, leidet der Utilitarismus nicht. In der angeführten Formulierung ist das utilitaristische Prinzip noch in mehrfacher Hinsicht ungenau: Geht es um die tatsächlichen, um die intendierten oder um die zu erwartenden Folgen? - Läßt sich das Leid der einen durch ein größeres Maß an Freude der anderen aufwiegen? - Wie rechtfertigt man nicht bloß bestimmte Normen, sondern auch das Kriterium der Normen: das utilitaristische Prinzip? - Im Laufe seiner Entwicklung hat der Utilitarismus derartige Fragen aufgegriffen. Anhand der wichtigsten Texte und Beiträge der klassischen wie der zeitgenössischen Diskussion werden einige Lösungsvorschläge vorgestellt. II. Der klassische Utilitarismus: Bentham, Mill, Sidgwick Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 45 Die einzelnen Elemente für sich genommen findet man schon lange vor den klassischen Paradigmata der utilitaristischen Ethik, den Schriften von Bentham und J. S. Mill. Der Hedonismus läßt sich bis in die antike Ethik eines Aristipp (435-360 v. Chr.) und eines Epikur (341-270 v. Chr.) zurückverfolgen; bei ihnen tritt er jedoch eher in einer egoistischen als in einer universalistischen Interpretation auf. Der Universalismus geht auf das christliche Denken zurück, in dem aber der Hedonismus abgelehnt wird. Das Konsequenzen- und das Utilitäts-Prinzip schließlich erscheinen in einer hochentwickelten Form bei Hobbes (1588-1679); seine Neubegründung von Moral, Recht und Staat baut jedoch auf einem aufgeklärten Egoismus auf.7 Die den Utilitarismus im eigentlichen Sinn begründende Verbindung aller vier Elemente taucht erst beim Hobbes-Kritiker Bischof Cumberland (1631-1718), dann in den Schriften Humes (1711-1776), in der theologisch beeinflußten Ethik von Gay (1699-1745) und Tukker (1705-1774), in einer von Bentham inspirierten Schrift von Priestley (1733-1804) sowie bei Helvetius (1715-1771) und Beccaria (1738-1794) auf.8 Die erste ausdrückliche und systematische Exposition des Utilitarismus findet sich allerdings nicht vor Jeremy Benthams Einführung in die Prinzipien von Moral und Gesetzgebung (jeweils in geringer Auflage veröffentlicht 1780 und 1789). In den einleitenden vier Kapiteln läßt Bentham seine psychologische Grundvorstellung anklingen und formuliert das Prinzip der Nützlichkeit; er erörtert das Problem der Beweisbarkeit des Prinzips und diskutiert Prinzipien, die mit dem des Utilitarismus konkurrieren; er weist auf vier Quellen von Freude und Schmerz hin und skizziert schließlich einen operativen Maßstab, den hedonistischen Kalkül bzw. Nutzenkalkül, der es erlauben soll, alle erdenklichen Empfindungen von Freude und Leid, selbst die heterogener Natur, gegeneinander aufzurechnen und eine Gesamtbilanz des menschlichen Glücks aufzustellen. Durch das Kalkulationsinteresse nimmt der Utilitaris-mus die Züge einer Erfolgsethik an, freilich nicht in dem moralisch fragwürdigen Sinn, daß der Erfolg hinsichtlich beliebiger Ziele und Zwecke gesucht werde. Von Belang ist, wie gesagt, der Nutzen für das in sich oder schlechthin Gute. Ursprünglich ist die Schrift als Einleitung zu einem großen rechtsphilosophischen Werk gedacht, das in zehn Teilen die Prinzipien aller Zweige der Gesetzgebung,9 des Finanzwesens und der politischen Ökonomie sowie den Plan eines der Form nach vollständigen Gesetzbuches enthalten soll.10 Doch während der Abfassung entwickelt sich die Einleitung zu einer eigenen umfangreichen Schrift. Der ursprüngliche Kontext mag die Ungeduld erklären, mit der Bentham zu Beginn die für eine wissenschaftliche Gesetzgebung und rationale Gesellschaftsreform unerläßliche ethische Grundlage abhandelt. Noch mehr dürfte aber gelten, daß Bentham von der Wahrheit des Utilitarismus und dessen Fähigkeit, das gesamte staatliche Wirken im Bereich der Administration, der Gesetzgebung und des Strafsystems normativ zu begründen, zu sehr überzeugt ist, als daß er den Utilitarismus in einer sorgfältigen Form entfalten und die alternativen Vorstellungen einer mehr als flüchtigen Kritik unterziehen würde. Trotzdem hat das Werk einen gewaltigen Erfolg; genauer: nicht die Schrift selber ist so erfolgreich, wohl aber ihr Gedankengut, sobald es durch Etienne Dumonts Ausgabe (in französischer Sprache, 1802) bekannt wird. Danach verbreitet sich utilitaristisches Gedan-kengut rasch in Großbritannien, den Vereinigten Staaten und vor allem auf dem europäischen Festland. Die Überzeugungskraft, die sich mit Benthams Schrift verbindet, ist verständlich; denn in jedem der vier Teilprinzipien, die im utilitaristischen Moralprinzip zusammenlaufen, spiegelt sich eine für die Aufklärungsepoche charakteristische Einstellung bzw. Problemlage wider: Der Utilitarismus kann in einer Zeit politisch und philosophisch wirksam werden, in der die Auskünfte der Religion, der Metaphysik oder einfach die der Tradition zu einem über- Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 46 individuellen Sinnzusammenhang ihre generelle Anerkennung verlieren. In dieser auch heute noch zutreffenden Situation schlägt er für die Moral eine Bestimmung vor, die ohne Rückgriff auf die fragwürdig gewordenen Autoritäten auskommt und zugleich mit einem allgemeinen Grundzug des Menschen übereinstimmt: mit dem Streben nach Glück.11 Daß das Glück nun hedonistisch definiert wird, reflektiert den säkularen Charakter der Moderne; mindestens jener Teil der Moral, auf deren Anerkennung alle Menschen verpflichtet sein sollen, kann nicht mehr von einem Jenseits, er muß von den diesseitigen Bedürfnissen und Interessen bestimmt werden; er müßte allerdings auch offen sein für Hoffnungen und Sehnsüchte. Dazu kommt, gleichsam als Erweiterung und Korrektur des Hedonismus, eine humanitäre Intention. Mit ihr wird, was manche leichtfertige Kritik an der Aufklärung unterschlägt, das christliche Gebot der Nächstenliebe in säkularisierter Form aufbewahrt. Im dritten, dem Folgenprinzip, läßt sich die Erfahrungsoffenheit der Zeit erkennen und die Bereitschaft, durch Erfahrung sich korrigieren zu lassen; die Ethik ist gegenüber veränderten Lebensverhältnissen flexibel. Schließlich greift der Utilitarismus auf eine Tendenz zurück, die für die Neuzeit insgesamt charakteristisch ist, auf die Suche nach rationaler Verfügung. Seine Forderung, eine am Wohlergehen der Betroffenen orientierte, zudem wissenschaftliche Politik einzurichten, sein Versuch, ein gegen Dogmatismen und Ideologien abgeschirmtes und gegen politische Privilegien kritisches Kalkulationsverfahren zu entwer-fen, ist ohne Zweifel ein intellektuell wie emotional höchst ansprechendes Unternehmen. Durch das Zusammenspiel der vier Elemente erscheint das Leitziel menschlichen Handelns, das Glück, endlich einer empirisch-analytischen Überprüfung unterworfen zu sein. Doch schon der erste, enthusiastisch formulierte Absatz führt den Utilitarismus der Benthamschen Form in eine Schwierigkeit. Auf der Suche nach einer Moralphilosophie, die den Ansprüchen der Wissenschaftlichkeit genügt, die von der Mathematik und den Naturwissenschaften erhoben werden, glaubte der Verfasser auf eine über jeden Zweifel erhabene anthropologische Grundkonstante gestoßen zu sein. Der Mensch, so Bentham, steht unter dem Diktat von Freude und Schmerz, die ihm sowohl bestimmen, wie er handeln soll, als auch wie er handeln wird. Hier wird der Hedonismus in methodisch doppelter Funktion eingeführt: als normatives Element, als Teilkriterium des moralisch Richtigen, sowie als deskriptives Element, als Grundstruktur der menschlichen Motivation. Zugleich wird implizit die These vertreten, beide Funktionen des Hedonismus seien miteinander vereinbar. Der deskriptive Hedonismus begründet jedoch einen psychologischen Egoismus - Freude und Schmerz als einzige Triebfedern menschlichen Handelns -, während das utilitaristische Prinzip die Beförderung des Glücks aller Betroffenen fordert; die egoistische Motivationsstruktur stellt sich gegen die altruistische Norm. Der Mensch, so hat es den Anschein, befindet sich in der »tragischen« Situation, zu einem Handeln aufgefordert zu sein, das er aufgrund seiner Motivationsstruktur prinzipiell nicht vollbringen kann. Indessen ist Benthams Aussage nur dann inkonsistent, wenn das persönliche und das allgemeine Wohlergehen miteinander im Widerspruch stehen. Das ist aber weder logisch notwendig noch sachlich unstrittig. Für die gegenteilige Annahme einer Kongruenz von persönlichem und allgemeinem Wohlergehen sind zwei Argumentationsstrategien denkbar, der Nachweis einer natürlichen und der einer künstlichen Kongruenz; die Interessen-harmonie gilt entweder als gegeben oder als herzustellen, wobei die erste Möglichkeit selbst zwei Wege eröffnet: 1.a) Nach der frühliberalen Nationalökonomie - etwa nach dem um eine Generation älteren Adam Smith (1723-1790) - entsteht der größte (wirtschaftliche) Nutzen dadurch, daß jeder nur den größten eigenen Vorteil sucht; der freie Markt gilt deshalb als die optimale Verkehrsform (vgl. schon früher Mandevilles [1714] These von der Entstehung des öffent-lichen Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 47 Wohlergehens aus privaten Lastern12). 1.b) Auch wenn ein Handeln gemäß der liberalistischen Theorie das allgemeine Wohlergehen im wirtschaftlichen Raum und noch mehr in anderen Bereichen nicht sicherstellen sollte, bleibt eine natürliche Interessenharmonie denkbar. Kurzfristig mögen nämlich allgemeines und persönliches Wohlergehen auseinanderfallen; wegen der vielfältigen Abhängigkeiten der Menschen untereinander realisiert man aber langfristig sein eigenes Glück nur dann, wenn man das allgemeine Glück anstrebt. 2. Schon weil nicht jeder stets aus einem aufgeklärten Selbstinteresse heraus handelt und seine kurzfristigen Interessen den langfristigen opfert, darf man sich nicht auf die naturwüchsige Entwicklung der Gesellschaft verlassen. Es bedarf vielmehr eines wirksamen Systems von (religiösen, sozialen und/oder rechtlichen, gesetzgeberischen und administrativen) Sanktionen, die die Konflikte zwischen kurz- und langfristigem Wohlergehen lösen und die langfristige Interessenharmonie auch kurz- und mittelfristig sicherstellen. Das ist in den Grundzügen Benthams Lösung. Mit dem hedonistischen Kalkül will er das Instrumentarium bereitstellen, das derjenigen Politik die rationale Bestimmung des erforderlichen Sanktionensystems ermöglicht, die an einer Planung - an einem Überschauen der Zusammenhänge und einem Berechnen der Folgen - interessiert ist. Selbst wenn man die inneren Schwierigkeiten des Kalküls noch nicht berücksichtigt, bleiben gegen diese Lösung mindestens zwei Einwände bestehen. Zum einen muß es jeman-den geben, der die Kongruenz herstellt: einen Gesetzgeber, bei dem sich die Frage wiederholt, wer ihn dazu bringe, stets von seinem kurzfristigen Vorteil abzusehen und sich um die Kongruenz zu kümmern. (Unter dem Einfluß von James Mill hat Bentham deshalb später die Forderung nach einer demokratischen Kontrolle der Regierung durch allgemeine, gleiche, geheime, regelmäßige und häufige Wahlen anerkannt.) Zum anderen ist es nicht notwendig, die Kongruenz ausschließlich von einem Sanktionensystem abhängig zu machen; sie läßt sich mindestens zum Teil auf einer angemessenen Erziehung (zu Rationalität, Solida-rität usf.) gründen. Dann könnte das allgemeine Wohlergehen von den Handelnden mehr aus ihnen selbst heraus (autonom) als durch öffentliche Strafandrohungen (heteronom) verfolgt werden. Bentham nimmt die Gegenpositionen zum Utilitarismus nicht hinreichend ernst. Unter dem Titel »Prinzip der Askese« kritisiert er vor allem eine eher satirische Version christlicher Moral, nach deren Maxime (»handle so, daß es den Betroffenen Leid bringt«) es auf Erden binnen kurzem zur Hölle kommt. Der kritische Impuls gegen solche Ansätze, die wir als dogmatisch oder intuitionistisch bezeichnen würden, erscheint unter dem globalen Titel »Prinzip von Sympathie und Antipathie«, auch »Prinzip der Launen« genannt (»handle so, wie du es augenblicklich für richtig hältst« ). In der Tat: Wer die Äußerungen des Gewissens, des gemeinen Menschenverstandes oder die des moralischen Gefühls nicht nur als praktische Orientierungshilfe, sondern auch zur systematisch letzten Auskunft über moralische Verbindlichkeit erklärt, verfälscht nicht nur subjektive und zudem schwankende Gefühlsäußerungen zu einer unfehlbaren Legitimationsinstanz. Er erhebt auch die Prinzipienlosigkeit zum Prinzip, so daß eine Argumentation, die intersubjektive Gültigkeit beab-sichtigt, von vornherein unmöglich ist. Skeptisch ist Bentham ferner gegen die Annahme ewiger und unveränderlicher Naturrechte - indem er darunter einen Kanon willkürlicher oder nichtssagender, gleichwohl a priori gültiger Normen versteht.13 Die Polemik gegen absolute Wahrheiten und unfehlbare Beurteilungsinstanzen persönlicher, politischer oder theoretischer Natur führt der Verfasser ausdrücklich von seinem gesellschaftskritischen Interesse aus. Ein Denken, so lautet das ideologische Argument, das sich auf intuitiv plausible Instanzen beruft, kann als Vorwand für Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse mißbraucht werden; der Rückgriff auf Instanzen, die jeder Kritik entzogen sind, Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 48 sei in offener oder versteckter Form ein willfähriges Instrument der Unterdrückung.14 Das geeignete Mittel, Handlungen bzw. Handlungsregeln rational zu überprüfen, sieht Bentham im hedonistischen Kalkül. Nach diesem Grundelement einer rationalen Wahl - zugleich einem frühen Beitrag zur Wohlfahrtsökonomie - wird der Gratifikationswert einer Handlung zunächst für jeden der Betroffenen einzeln errechnet. Bentham führt sechs Kriterien zur Bestimmung des individuellen Gratifikationswertes an: die Intensität der aus der Handlung zu erwartenden Gratifikation bzw. Frustration; die Dauer und den Grad der Gewißheit, mit der man die Gratifikation erwartet; die Nähe des Eintreffens; schließlich das, was er die Folgenträchtigkeit und Reinheit nennt, d.h. die Chance, daß einer Gratifikation sekundäre Gratifikationen bzw. Frustrationen folgen. Addiert man die individuellen Gratifikationswerte für jeden der Betroffenen, so erhält man nach Bentham mathematisch gleicherweise einfach wie exakt den kollektiven Gratifikationswert, den Gesamtnutzen, den eine Handlung für alle Betroffenen hat. Rational im Sinne des utilitaristischen Prinzips ist nur die Wahl jener Handlung, deren kollektiver Gratifikationswert größer (oder zumindest nicht kleiner) ist als der jeder anderen gegebenen Handlungsmöglichkeit. Entwickelt wird der hedonistische Kalkül im spätfeudalen und frühkapitalistischen England. Angesichts der damals bestehenden Konzentration von Macht und Reichtum in den Händen einer dünnen Schicht Privilegierter enthält die in das Kalkül übersetzte demokratische Maxime, jeden ohne Unterschied gleich zu berücksichtigen, Benthams Diktum »everybody to count for one, and nobody to count for more than one«, eine geradezu revolutionäre Gesellschaftskritik. Bentham und die sich an ihn anschließende politische Gruppe, die »Philosophical Radicals«, können auch stolz darauf sein, eine Reihe von bemerkenswerten sozialen und politischen Reformen mitverantwortet zu haben. Der nur allzu berechtigte gesellschaftskritische Impuls verbindet sich im Kalkül allerdings mit der denn doch naiven Vorstellung, die nötigen sozialen und politischen Reformen quantitativ exakt bestimmen zu können. Bei einer kritischen Betrachtung des Kalküls fällt auf, daß schon eine präzise Bestimmung des Begriffs »Betroffener« fehlt: Wie soll man die direkt Betroffenen im Verhältnis zu den indirekt Betroffenen, wie die nachfolgenden Generationen im Vergleich zur gegenwärtigen Generation bewerten? Eine grundlegende Schwierigkeit besteht in dem stillschweigend angesetzten Postulat der Meßbarkeit und Vergleichbarkeit aller Gratifikationen. Das von Bentham vorgeschlagene Verfahren der Addition und Subtraktion von Gratifikationswerten setzt nämlich eine gemeinsame Maßeinheit von Freude und Schmerz voraus; ohne ihre Hilfe lassen sich die Gratifikationswerte nicht numerisch angeben und ohne eine numerische Angabe überhaupt nicht addieren oder subtrahieren. Die Annahme einer solchen Maßeinheit muß aber selbst in dem einfachsten, dem wirtschaftlichen Bereich als hoffnungslos realitäts-fremd gelten. Ferner setzt der Kalkül voraus, daß die Basis der Kalkulation, die Bedürfnisse und Interessen der Betroffenen, schon jeweils hinreichend genau bekannt ist. Wie die Basis bestimmt werden soll, wird im Verlauf der Darstellung des Kalküls nicht deutlich. In dem wirtschaftswissenschaftlichen Essay In Defense of Usury (1787) glaubt Bentham, jeder könne seine eigenen Interessen am besten selbst beurteilen. Tatsächlich können die eigenen Urteile über die Interessen durch kognitive, emotionale und soziale Täuschungen vielfach gebrochen und verzerrt sein. Ohne komplizierte Prozesse des Verstehens, Beurteilens und auch der Kritik der eigenen Interessen - eine Aufgabe, die für Bentham gar nicht in den Blick kommt - läßt sich die Basis der Kalkulation nicht angemessen bestimmen. Überdies ist es kaum sinnvoll, auf alle Interessen in gleicher Weise einzugehen. Denn dann müßte man unsoziale Interessen: die exzentrischen und fanatischen Intentionen sowie die Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 49 verschiedenen Formen von Neid, Eitelkeit und Herrschsucht, von Aggression, Destruktion und Sadismus, mit gleichem Gewicht berücksichtigen wie die sozial indifferenten; und die sozial engagierten Interessen, Notleidenden zu helfen oder Andersdenkende zu tolerieren, bekämen auch nur dasselbe Gewicht. Sicher ist es nicht leicht, in jedem Fall genau anzugeben, welche Interessen überhaupt und welche von einem bestimmten Grad der Intensität an als unsozial gelten müssen und sich deshalb für eine Berücksichtigung im Kalkulationsprozeß disqualifizieren. Aber gleichwie die Bedürfnisse und Interessen noch des näheren als sozial akzeptabel bestimmt werden können: nicht die Bedürfnisse und Interessen als solche, sondern nur die sozial nicht disqualifizierten sind »kalkulationswürdig« - wenigstens solange wie man über der Kalkulation nicht ihren Sinn, das allgemeine Wohler-gehen, vergißt. Der Begriff des Wohlergehens bzw. Glücks ist nicht rein empirisch; ohne kritische Unterscheidungen wie die zwischen artikuliertem und tatsächlichem Interesse, zwischen vermeintlichem und wohlverstandenem, zwischen naturwüchsig vorhandenem und sozial akzeptablem Interesse ist eine rationale Bestimmung des menschlichen Glücks nicht möglich.15 Die erste Schrift, die sich ausschließlich mit der utilitaristischen Ethik befaßt, ist John Stuart Mills Essay Utilitarismus. Der Verfasser glaubt, das Titelwort in einer Novelle von John Galt The Annals of the Parish entdeckt zu haben; tatsächlich verwendet es schon Bentham, in einem Brief an Dumont aus dem Jahre 1809, dort allerdings ironisch. Mills geistreiches Plädoyer wendet sich nicht nur an den gelehrten Fachkollegen, sondern auch an eine weitere sittlich-politisch interessierte und philosophisch gebildete Öffentlichkeit. Die Abhandlung ist im Unterschied zu Benthams trockenem, oft schwerfälligen Beitrag schon literarisch bemerkenswert. Sie unternimmt - nach einem auch bei Bentham anklingenden Topos (Bentham, Kap. I, 1) - den Versuch, mit dem beklagenswerten Zustand der Moralphilosophie Schluß zu machen und sie durch Aufstellung des utilitaristischen Prinzips endlich auf den Pfad der Wissenschaft zu führen. Trotz der Kritik, die das Werk in einigen Punkten erfährt, gehört es im 19. Jahrhundert zu den einflußreichsten, allerorten gelesenen moralphilosophischen Schriften. (Da das Werk in einer älteren und in einer neuen deutschen Übersetzung leicht greifbar ist,16 werden in diese Sammlung nur zwei verhältnismäßig kurze Auszüge aufgenommen.) Mill nimmt nicht bloß eine Vielzahl von Gegenargumenten auf, um sie im einzelnen zu entkräften; er weicht vom »orthodoxen« Utilitarismus Benthams auch in verschiedenen Punkten ab. Die bedeutsamste Veränderung findet sich in einem nicht mehr quantitativen, sondern qualitativen Hedonismus. Mit ihm tritt Mill dem früh erhobenen Vorwurf entgegen, der Utilitarismus sei eine Ethik des Genußmenschen. In der Tat: Nach Benthams berühmtprovokatorischem Aphorismus »quantity of pleasure being equal, pushpin [ein anspruchsloses Kinderspiel. O.H.] is as good as poetry« zählen die qualitativen Unterschiede zwischen den verschiedenen Anlässen und Arten von Freude nicht als solche. Überdies denkt man beim Ausdruck »pleasure« (Lust, Freude) zuerst an körperliche Freuden (des Essens und Trinkens, der Sexualität, des Ausspannens), Freuden, die sich ohne besondere Anstrengung und Erziehung bei jedermann einstellen und für die eine intensive, aber vergleichsweise kurzlebige Gratifikation charakteristisch ist. Sieht man nur diese Freuden als Kriterium moralisch richtigen Handelns an und hält Freude aus intellektuellen, kreativen oder sozialen Tätigkeiten für unwichtig, so ist es zum Vorwurf nicht mehr weit, der Utilitarismus sei nur eine Ethik für Genußmenschen. Gegen dieses schon in Bezug auf Bentham vulgarisierte Verständnis des hedonistischen Elementes stellt Mill den drastischen Satz, es sei besser, ein unzufriedener Mensch zu sein als ein zufriedenes Schwein. Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 50 Mill macht zu Recht auf verschiedene Qualitäten von Lust aufmerksam und wehrt vor allem den Eindruck ab, der Utilitarismus ergreife gegen wissenschaftliche, künstlerische und humanitäre Beschäftigungen Partei, indem er unter Glück das verstehe, was die Mehrheit der Menschen sich im allgemeinen wünsche. Seit der Antike steht der Hedonismus im Kreuzfeuer der Kritik. Einem großen Teil der entsprechenden Einwände entgeht Mill, indem er keinen Hedonismus momentaner Wunschbefriedigung vertritt, sondern einen Hedonismus wohlinformierter Präferenzen. Problematisch ist jedoch die Übernahme des traditionellen dualistischen Schemas »körperliche-geistige Freuden« und die Bewertung der beiden Arten als niedrigere und höhere. Wie Bentham so bemerkt auch Mill, daß man die Überlegenheit der geistigen Freude quantitativ, nämlich durch ein höheres Maß an Dauer und Sicherheit sowie ein geringeres Maß an »Kosten« erweisen kann. Zusätzlich will er aber eine nicht-quantitative Bewertung einführen, die mit dem Begriff der inneren Natur des Menschen arbeitet. Bei geistigen Freuden, so läßt Mill sich interpretieren, ist man in einem höheren Maß Mensch als bei sinnlichen Freuden. Diese These setzt eine bestimmte Anthropologie voraus, die Mill nicht entfaltet. Zudem ist nicht einsichtig, wie sie mit dem von Mill selbst bestätigten hedonistischen Prinzip konform gehen soll, daß allein Freude und die Abwesenheit von Schmerz in sich wertvoll seien. Es ist ferner zu bedenken, daß sich Mill auf die entschiedene Vorliebe derjenigen bezieht, die mit beiden Arten von Freude Erfahrung haben, für eine vergleichende Bewertung also kompetent sind, und annimmt, daß diese die geistigen Freuden stärker, vielleicht sogar unvergleichlich stärker erstreben als die sinnlichen Freuden. Hier geht Mill also selbst von einer Vergleichbarkeit aus, die sich quantitativ als »mehr oder weniger stark erstrebt« interpretieren läßt; auch wenn die Bewertung der verschiedenen Freuden nicht mehr mit dem übermäßig vereinfachten Instrumentarium von Benthams hedonistischen Kalkül auskommen mag, steht im Hintergrund ein quantitativer Begriff. Am stärksten wurde in Mills Essay der Abschnitt kritisiert, der den sogenannten »Beweis« des utilitaristischen Prinzips entwickelt. Mill lehnt zunächst die Vorstellung eines direkten Beweises ab; wenn man unter Beweis in einem engeren Verständnis die Ableitung aus schlechthin ersten Sätzen versteht und solche Sätze Prinzipien nennt, dann sind Prinzipien worauf schon Bentham aufmerksam gemacht hat (Kap. I, 11) - per definitionem nicht beweisbar. Da Mill das utilitaristische Prinzip für jenes schlechthin höchste Ziel hält, aus dem alle anderen Ziele menschlichen Handelns abzuleiten sind, ist es nur konsequent, daß er die Vorstellung ablehnt, das Prinzip könne selbst wiederum aus einem höheren Ziel abge-leitet und in diesem Sinn direkt bewiesen werden. Gleichwohl hält er eine rationale Stützung des Prinzips für möglich. Was er als Argumentation vorbringt, läßt sich jedoch genau in der Form formulieren, die er in seinem anfänglichen beweistheoretischen Hinweis ablehnt, nämlich als Ableitung im Sinne einer Deduktion. Die entwickelte Argumentation erweist sich als fehlerhaft, und zwar in ihren beiden Schritten: Zunächst wird aus dem Prinzip eines psychologischen Hedonismus: »Freude bzw. Glück sind das einzige, was Menschen um ihrer selbst willen erstreben« das Prinzip eines subjektivethischen Hedonismus abgeleitet: »Woran ein jeder Freude hat, das ist für ihn auch gut«. (Dabei bleibt der methodische Status der Prämisse unklar; denn der psychologische Hedonismus erscheint zum einen als empirische, zum anderen als analytische Wahrheit.) Dann wird aus der vorgeblichen Konklusion das Prinzip eines objektiv-ethischen Hedo-nismus abgeleitet: »Das allgemeine Glück ist für alle gut«. Das erste Argument folgt dem empiristischen Fehlschluß: »Was tatsächlich erstrebt wird, das ist auch erstrebenswert«. Das zweite Argument setzt das für individuelle Klugheitserwägungen zutreffende Kriterium, das persönliche Glück, mit dem für moralisches Handeln gültigen sozialen Kriterium, dem allge-meinen Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 51 Glück, gleich. Tatsächlich folgt aus der angenommenen Prämisse nur, daß für jeden irgendein Teil des allgemeinen Glücks bzw. daß jeder Teil des allgemeinen Glücks für irgend jemanden gut ist. Es gibt indessen andere Wege, um das utilitaristische Prinzip rational zu stützen. Dabei muß man zwei Probleme unterscheiden. Vorausgesetzt, man hält das utilitaristische Prinzip schon für die angemessene Formulierung des Moralprinzips, dann lautet die Frage: »Warum soll ich überhaupt moralisch handeln?« Darauf kann man mit Klugheitserwägungen der Art antworten: Aufgrund der emotionalen und politischen Abhängigkeit der Menschen untereinander richtet sich ein rationales Streben auf das allgemeine Wohlergehen. Hier erscheint das moralische Handeln als Weg zum eigenen langfristigen Vorteil, je nach dem näheren Argument als Mittel gegen Schuldgefühle, Rache oder soziale Desintegration oder aber, positiv, als Weg zum eigenen Wohl. Gegen eine solche Legitimationsstrategie kann man jedoch einwenden, daß sie den Grund von moralischer Verpflichtung zu eng interpretiert. Die andere Frage richtet sich auf die Angemessenheit des utilitaristischen Prinzips. Hier könnte man auf der einen Seite empirisch nachweisen wollen, daß die meisten der bekannten Verhaltenskodizes genau das verbieten, was auch durch utilitaristische Überlegungen disqualifiziert werde: Töten, Lügen, das Brechen von Versprechen usf.; und daß die Kodizes darüber hinaus gutheißen, was auch der Utilitarismus verlange: eine Förderung des Wohlergehens der Mitmenschen. Auf der anderen Seite könnte man mit Bentham (Kap. I, 13) zu zeigen versuchen, daß jede argumentative Ablehnung des utilitaristischen Prinzips sich gerade solcher Argumente bediene, die nur unter Annahme des Prinzips selbst letztlich triftig sind; man könnte den Opponenten also in einen Selbstwiderspruch führen und damit a contrario zeigen wollen, zum Utilitarismus gebe es keine echte Alternative. Nähere Überlegungen stoßen aber für beide Legitimationsstrategien auf kaum überwindbare Schwierigkeiten. Namentlich mißlingt, was aus gutem Grund Mill im letzten und umfangreichsten Kapitel seiner Schrift versucht; selbst mit einer so elementaren Moralforderung wie der der Gerechtigkeit erweist sich der Utilitarismus als unverträglich.17 Mills Schrift leitet eine Zeit intensiver Diskussionen ein; innerhalb weniger Jahre erschienen drei gewichtige Auseinandersetzungen mit dem Utilitarismus. Während Grote in An Examination of the Utilitarian Pbilosophy (1870) eine maßvolle Kritik durchführt und Bradley, der zu seiner Zeit berühmteste Vertreter der idealistischen Philosophie, im dritten Kapitel der Ethical Studies (1876) eine vernichtende Kritik vornimmt, findet man in der systema-tischen Abhandlung von Grotes Schüler Sidgwick Die Methoden der Ethik (1874) eine kritische Fortentwicklung. Mit dem sehr sorgfältig argumentierenden Werk, der wohl differenzier-testen Darstellung der klassischen utilitaristischen Ethik, hält diese Einzug in die Universitätsphilosophie. Sidgwick verknüpft die normative Ethik des Utilitarismus mit der Metaethik eines qualifizierten Intuitionismus. Das Moralprinzip folgt nach ihm weder aus dem Begriff der Moral, noch wird es aus der Erfahrung gewonnen, vielmehr liegt es schon aller moralischen Erfahrung voraus. Es gilt also nicht als analytisch, auch nicht als empirisch (synthetisch a posteriori), sondern als synthetisch a priori wahr. Die für das Moralprinzip eigentümliche Form der Erkenntnis soll in einer moralischen Intuition bestehen, für die vier Kriterien aufgestellt werden: sie muß selbstevident sein und sich in klarer und präziser Form darstellen lassen; sie darf anderen grundlegenden Wahrheiten nicht widersprechen und muß unter den Fachleuten allgemeine Zustimmung finden. (Hier ist Sidgwick nach Rawls’ eigener Einschätzung neben Aristoteles einer der Vorläufer der Methode des »Überlegungs-gleichgewichts«, des »reflective equilibrium«.18) Nun gibt es nach Sidgwicks Ansicht zwei grundlegende und auch rational Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 52 einsichtige Prinzipien menschlichen Handelns: außer dem Moralprinzip das Prinzip des rationalen Selbstinteresses. Den einzigen Weg, beide mitein-ander rivalisierenden Prinzipien zu versöhnen, erblickt er in der Annahme eines göttlichen Herrschers, der jeden belohne, der das Moralprinzip befolge, und jeden strafe, der von ihm abweiche. Das Moralprinzip zu befolgen, liegt dann im rationalen Selbstinteresse; dem sittlichen Handeln werden jedoch Triebfedern unterlegt (Angst vor göttlicher Strafe), die den strengen Begriff der Sittlichkeit, die ein Handeln aufgrund freier Anerkennung untergraben. Am Utilitarismus Benthams und Mills nimmt Sidgwick einige nachhaltige Veränderungen vor. So hält er vom Standpunkt einer empirischen Psychologie aus die Freude nicht für das einzige Ziel menschlichen Strebens. Auch erkennt er einige der Schwierigkeiten, mit denen das hedonistische Kalkül beim empirischen Vergleich von Freude und Leid konfrontiert ist. Darüber hinaus meint er - in Vorwegnahme zeitgenössischer Kritik am Utilitarismus -,19 daß zur moralischen Verpflichtung nicht nur das Wohlergehen aller Betroffenen, sondern auch eine gerechte Verteilung gehöre. Auf die ideologie- und gesellschaftskritische Funktion des Utilitarismus ist schon hingewiesen worden. Der in diesem Band abgedruckte Abschnitt von Sidgwick unterzieht diesen Aspekt einer historischen und systematischen Untersuchung. Bei Bentham und Mill galt der Utilitarismus als das wissenschaftliche Instrumentarium für eine radikale Gesellschaftskritik. Im Vergleich dazu ist Sidgwick, der akademische Philosoph, konservativer; das kritische Potential will er nur mit Vorsicht einsetzen. Diese Differenz rührt primär weder aus einer unterschiedlichen Formulierung des Moralprinzips noch aus gewandelten Gesellschaftsverhältnissen und auch nicht daher, daß Sidgwick das kritische Potential herunterspielt. Vielmehr hat sich gegenüber Bentham und Mill der Bezugspunkt verändert; das utilitaristische Prinzip ist nicht mehr der Prüfstein für die zeitgenössischen politischen und sozialen Verhältnisse, sondern für das moralische Bewußtsein des gemeinen Menschenverstandes (common sense). Es ist dieses Bewußtsein, das gegenüber der historischen Wirklichkeit als durchaus kritische Instanz auftritt; denn nicht alles, was im allgemeinen als moralisch geboten gilt, wird im persönlichen wie im öffentlichen Leben auch tatsächlich praktiziert. Daher widerspricht es nicht Benthams und Mills Intentionen, wenn Sidgwick bei der Erörterung wichtiger Beispiele moralischer Verpflichtung (wie der Gebote, die Wahrheit zu sagen, Mäßigkeit und Selbstbeherrschung zu üben) eine weitgehende Koinzidenz von Utilitarismus und gemeinem Menschenverstand aufweist. Die Koinzidenz trifft aber nicht etwa auf die im Alltag praktizierte Moral zu; weit davon entfernt, in diesem Sinn eine Alltagsmoral zu restituieren, bezieht sich Sidgwick - so wie schon Sokrates, später Rousseau und Kant - auf das genuin moralische Bewußtsein. Ihm gegenüber erhält der Utilitarismus die Aufgabe einer praktischen Selbstreflexion, die dem gewöhnlichen moralischen Bewußtsein Klarheit über sich selbst verschafft, um es im allgemeinen zu unterstützen und es zugleich in manchen Einzelheiten zu verbessern. Wenn Sidgwick nachdrücklich betont, daß die entsprechenden Verbesserungen in das moralische Bewußtsein nur schrittweise einzuführen seien, wird allerdings auch deutlich, daß die Min-derung des kritischen Potentials nicht aus der veränderten Problemstellung allein, sondern ebenso aus einer veränderten sittlich-politischen Haltung stammt. Überdies verzichtet Sidgwick darauf, mit Hilfe des von ihm verbesserten Utilitarismus die sozialen und politischen Institutionen seiner Zeit zu prüfen und gegebenenfalls als moralisch falsch zu verurteilen. Das eher analytische Interesse an einer systematischen Rekonstruktion der Moral des allgemeinen Menschenverstandes tritt vor das Interesse an einer wissenschaftlich angeleiteten Gesellschaftskritik. Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 53 III. Regelutilitarismus kontra Handlungsutilitarismus In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ist die englischsprachige EthikDiskussion dem Utilitarismus gegenüber nicht so positiv eingestellt. Auf der einen Seite kritisiert man ihn, weil er - was Sidgwicks Einschätzung widerspricht - allseits anerkannten sittlichen Überzeugungen nicht gerecht werde. Er könne, so lautet der Einwand, nicht angemessen erklären, warum man moralisch verpflichtet sei, Versprechen zu halten, Schul-den zurückzuzahlen, die Wahrheit zu sagen, Unschuldige freizusprechen, vor allem nicht, warum diese Verpflichtungen unbedingt und nicht nur für die Fälle gültig seien, in denen das Handeln gemäß diesen Verpflichtungen ein größeres allgemeines Wohlergehen verspreche.20 Auf der anderen Seite erscheint unter dem Einfluß des logischen Positivismus die normative Ethik überhaupt als wissenschaftlich illegitim.21 Selbst dort, wo diese Haltung nicht eingenommen wird, treten die metaethischen Probleme in den Vordergrund. Die Frage nach dem Prüfstein für moralische Verbindlichkeit wird durch Untersuchungen über die sprachliche Form und den logischen Status moralischer Aussagen zurückgedrängt, die Kontroversen zwischen Utilitaristen und Nichtutilitaristen durch die Streitfrage abgelöst, ob sich der Bereich des Moralischen überhaupt durch Erkennbarkeit und intersubjektive Gültigkeit, so die kognitivistischen Theorien, oder durch bloß subjektiv gültige Meinungen auszeichne, so die nichtkognitivistischen Theorien. Seit den fünfziger Jahren belebt sich die Utilitarismus-Diskussion neu und erreicht bald einen abermaligen Höhepunkt. Die frühere Kritik wird im wesentlichen anerkannt, zugleich wird die Strategie aufgegeben, sich gegen jede Form von Utilitarismus zu wenden. Man sucht vielmehr eine Erneuerung des Utilitarismus auf dem Weg einer immanenten Verbesserung. Dabei treten zwei Problemkreise der klassischen Diskussion zunächst in den Hintergrund: die Schwierigkeiten des hedonistischen Kalküls und die der werttheoretischen Grundlage, derzufolge das höchste, allein in sich wertvolle Ziel in einer maximalen Bedürfnis- und Interessenbefriedigung zu sehen sei. Die Frage, worin denn das wahrhaft Gute liege, um dessentwillen letztlich alle Handlungen auszuführen seien, sowie die mit der hedonistischen Antwort verbundenen Schwierigkeiten entfallen somit. Die entsprechende Diskussion zeigt auch relativ wenig Interesse an der Frage, ob es im Prinzip der Nützlichkeit um ein Urteil geht, das aus einer unmittelbaren sittlichen Einsicht stammt, ob es sich um den Ausdruck von Gefühlen oder um eine analytische Wahrheit handelt. Sie orientiert sich an den fundamentalen sittlichen Überzeugungen des alltäglichen Bewußtseins und sucht, in sie Rationalität und Kohärenz zu bringen. Die Philosophie beansprucht für sich keine eigenständige sittliche Kompetenz, aus der heraus souverän zu entscheiden wäre, was als moralisch richtig oder falsch zu gelten habe. Von dem Erkenntnisideal der empirisch-analytischen Wissenschaften inspiriert (und in Weiterent-wicklung von Sidgwick), bezieht sich die utilitaristische Ethik auf das gewöhnliche sittliche Bewußtsein als ihrem empirischen Datum, ohne es jedoch mit allen seinen Vorurteilen, Unstimmigkeiten und Realitätsschwächen zu akzeptieren. Das gewöhnliche sittliche Bewußt-sein hat nicht den Wert einer unfehlbaren Entscheidungsinstanz, sondern ist der empirische Bezugspunkt der Theorie und zugleich der Gegenstand für ihre Aufklärungsarbeit. In dieser Methode verbindet sich ein höheres Maß an Wissenschaftlichkeit mit einem gewissen Verlust an jenem gesellschaftskritischen Potential, das für Bentham und Mill charakteristisch war. Um den in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts erhobenen Einwänden zu begegnen, wird vorgeschlagen, den Utilitätstest nicht auf einzelne Handlungen, sondern auf Arten, Klassen Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 54 oder Regeln von Handlungen anzuwenden. Es soll nicht mehr gefragt werden, ob dieses oder jenes individuelle Nichteinhalten eines Versprechens oder Verurteilen eines Unschuldigen gute Folgen hat, sondern ob die Regel, Versprechen nicht zu halten, Unschuldige zu verurteilen, zu guten oder schlechten Konsequenzen führt. Falls die Konsequenzen der Regel, unter die die Handlung fällt, schlecht sind, gilt die Handlung selbst als moralisch falsch, auch wenn die Konsequenzen der individuellen Handlung gut sein sollten. Die Neufassung des Utilitarismus - für die einen eine Weiterentwicklung, für die anderen nur eine pointiertere Formulierung der schon von Bentham und Mill vertretenen Position ist zwar weitgehend, aber nicht überall auf Zustimmung gestoßen. In einem mit viel Scharfsinn durchgeführten Prozeß von Formulierung, Kritik, Gegenkritik und Neuformu-lierung schälen sich zwei kontroverse Positionen heraus. Sie werden von Smart zunächst als extremer und eingeschränkter Utilitarismus bezeichnet; seit Brandt22 heißen sie Handlungs- und Regelutilitarismus. Sowohl im Handlungsutilitarismus wie im Regelutilitarismus ist das höchste Kriterium für moralische Verbindlichkeit, das allgemeine Wohlergehen, der Prüfstein für die moralische Richtigkeit einer Handlung. Der Beurteilungsprozeß ist im ersten Fall jedoch einstufig, im anderen Fall zweistufig. Nach dem Handlungsutilitarismus ist jene Handlung moralisch richtig, deren Folgen zu einem Maximum an allgemeinem Wohlergehen führen; nach dem Regelutilitarismus ist es jene Handlung, die mit solchen Handlungsregeln konform geht, die, als Regeln befolgt, das Maximum an Wohlergehen befördern (»Was wäre, wenn jeder so handelte?«). Die Auseinandersetzung hat eine Flut von Beiträgen provoziert,23 von denen in diesem Band vier der wichtigsten übersetzt sind: Urmsons regelutilitaristisch orientierte NeuInterpretation Mills; Rawls’ Analyse der Differenz von Handlungs- und Regelutilitarismus, Smarts Verteidigung des Handlungsutilitarismus und die Entwicklung der vielleicht differenziertesten Form des Regelutilitarismus bei Brandt. Die Beiträge dokumentieren exemplarisch den kooperativen Prozeß der immanenten Verfeinerung und Verbesserung der utilitaristischen Position. Zugleich geben sie einen Einblick in die Subtilität, mit der heute in der englischsprachigen Welt Moralphilosophie betrieben wird. (Auf die nach Mitte der 70er Jahre geführte Debatte verweist die Bibliographie, Abschnitt VII.) Urmson beklagt sich einleitend über den desolaten Zustand der Mill-Interpretation und behauptet, daß gerade die gegen Mills Ethik vorgebrachten Einwände angesichts des tatsäch-lichen Textes wert- und bedeutungslos seien. Auf zwei Kritiken, die seiner Ansicht nach Fehlinterpretationen darstellen, geht er genauer ein. Er bezieht sie jedoch weder auf Mills qualitativen Hedonismus noch auf dessen Beweis des utilitaristischen Prinzips, so daß seine Gegenkritik die oben formulierten Einwände gegen Mill nicht entkräftet. Die einen, so schreibt Urmson, beschuldigen Mill des ethischen Naturalismus, das heißt: sie werfen ihm vor, daß er den grundsätzlichen Unterschied zwischen dem, was sein soll, und dem, was ist, zwischen dem normativen und dem deskriptiven Bereich, unterschlage, indem er die (moralische) Richtigkeit als Funktion der natürlichen Handlungsfolgen definiere. Diesem in der englischen Ethik-Diskussion seit Moores Principia Ethica (1903) erhobenen gravierenden Vorwurf hält Urmson zu Recht entgegen, daß Mill gar keine Definition, sondern ein Kriterium der moralischen Richtigkeit suche. Es wäre jedoch zu prüfen, ob die Definition und das Kriterium von Richtigkeit voneinander wirklich so weit unabhängig sind, daß die so grundlegende naturalistische oder nichtnaturalistische Eigenschaft des Kriteriums nicht auf die Definition von Richtigkeit zurückschlägt. Jedenfalls wäre Urmsons Gegeneinwand überzeugender, wenn er das Kriterium selbst als nicht-naturalistisch erwiese. Urmson hält sich bei der ersten Fehlinterpretation nicht lange auf. Er interessiert sich mehr Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 55 für die andere seines Erachtens falsche Behauptung, nach Mill sei der entscheidende Test für die Richtigkeit zugleich der unmittelbare. In der genauen Formulierung dieser »orthodoxen« und der einer verbesserten Interpretation führt er die für die zeitgenössische Diskussion so fundamentale Unterscheidung von Handlungs- und Regelutilitarismus ein. Anhand einer Vielzahl von Stellen aus Mills Utilitarismus-Schrift und einiger aus seiner Abhandlung On Liberty zeigt Urmson, daß Mill - ganz im Gegensatz zu den geläufigen Interpretationen - das utilitaristische Prinzip nicht als unmittelbares Kriterium verstanden habe, daß er vielmehr ein zweistufiges Prüfverfahren voraussetze, also einen Regelutilitarismus vertrete. Nach Bekanntwerden dieser Neuinterpretation sind mit ihrer Hilfe noch andere Passagen gefunden worden, die Urmsons Interpretation stützen.24 Trotzdem muß man die Einschränkung äußern, daß Mill den Regelutilitarismus nicht so klar und konsistent vertreten hat, wie es Urmson glaubt; dies schon deshalb nicht, weil er zwischen den beiden Arten des Utilitarismus als solchen gar nicht unterschieden hat. Noch weniger ist freilich sicher, daß Bentham ein Handlungsutilitarist war, wie Smart später behauptet (im Text dieses Bandes, Abschn. I [1]). Urmson beruft sich in seiner Neuinterpretation unter anderem darauf, daß Mill von Handlungstendenzen spricht und daß man von Tendenzen - im Unterschied zum tatsächlichen Resultat - nur dann sinnvoll reden kann, wenn man nicht eine einzelne Handlung, sondern eine Klasse von Handlungen meint. Überprüft man mit diesem Argument Benthams Texte, so finden sich auch bei ihm Stellen, die auf einen Regelutilitarismus schließen lassen; auch er definiert das utilitaristische Prinzip mit Bezug auf die Tendenz von Handlungen (Kap. I, 2); selbst im hedonistischen Kalkül sollen nicht die Handlungen, sondern ihre Tendenzen bewertet werden (Kap. IV, 4). Urmsons Teilargument, Mills Rede von Handlungstendenzen spreche für eine regelutilitaristische Position, kann jedoch nicht voll überzeugen. Mit der »Tendenz« (tendency: Richtung, Neigung) einer Handlung kann man auch ihr zu erwartendes Resultat (im Unterschied zum tatsächlichen Resultat) oder den wahrscheinlichen Gratifikationswert des zu erwartenden Resultats meinen. Der Ausdruck Tendenz könnte also - in Übereinstimung mit der zeitgenössischen wahrscheinlichkeitstheoretisch bestimmten Entscheidungstheorie - nur darauf aufmerksam machen, daß eine Handlung in der Regel weder nach ihrem Resultat noch nach dem Wert des Resultates für die Betroffenen mit Sicherheit vorherzubestimmen ist. Dann aber wäre er durchaus auch auf eine einzelne Handlung und nicht notwendig auf eine Klasse von Handlungen zu beziehen. Für Urmson ist es selbstverständlich, daß angesichts der Alternative »Handlungs- oder Regelutilitarismus« dem Regelutilitarismus der Vorzug gebührt. Er begründet daher die sachliche Richtigkeit dieser Auffassung nur mit zwei knappen Hinweisen und konzentriert sich im übrigen darauf, die textliche Richtigkeit seiner regelutilitaristischen Mill-Interpretation zu erweisen. Rawls dagegen interessiert sich gerade für die Notwendigkeit der Unterscheidung und für die Richtigkeit des Regelutilitarismus. Anhand von zwei Beispielen, die häufig gegen den Utilitarismus ins Feld geführt werden, anhand der Institution der staatl-ichen Kriminalstrafe und der Verpflichtung, Versprechen zu halten, erläutert er die Bedeu-tung der genannten Unterscheidung, um dann einen Regelutilitarismus zu begründen, der gegen viele der traditionellen Einwände gefeit ist. (In späteren Jahren hat sich Rawls jedoch vom Utilitarismus scharf abgesetzt und eine Theorie der Gerechtigkeit im Sinne von Fairneß entwickelt, die den vertragstheoretischen Ansatz von Locke, Rousseau und Kant mit den Mitteln der modernen Entscheidungstheorie zu rekonstruieren sucht.25) Die Frage nach der ethischen Rechtfertigung der Kriminalstrafe führt immer wieder zu heftigen sowohl wissenschaftlichen wie politischen Kontroversen. Rawls unternimmt es, Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 56 zwei der wichtigsten, einander gewöhnlich befehdenden Theorien zu vermitteln, die utilitaristische, das ist die Generalpräventionstheorie (Abschreckungstheorie), und die Vergeltungstheorie. Er unterscheidet zwei Probleme: 1. Warum soll es überhaupt die Institution der Strafe geben? 2. Wen soll man wie hoch bestrafen? Beiden Problemen ordnet er ein eigenes Amt (das des Gesetzgebers und das des Richters) zu und zeigt, daß es im ersten Fall um die Rechtfertigung einer Institution, im zweiten Fall um die Rechtfertigung einer einzelnen Handlung geht, die unter die Institution fällt. Der Utilitarismus rechtfertigt die fundamentale Frage, warum es überhaupt staatliche Kriminalfragen gibt, und überläßt die Rechtfertigung dessen, daß man nicht willkürlich, sondern nur Schuldige nach Maßgabe ihres Vergehens bestrafen soll, der Vergeltungstheorie und ihrem Prinzip der distributiven (ausgleichenden) Gerechtigkeit. Rawls läßt jene Theorie unberücksichtigt, die in Deutschland seit dem Strafrechtler Franz von Liszt (1851-1919) immer mehr in den Vordergrund des Interesses gerückt und erst in jüngster Zeit wieder als Hauptgegner der Theorie der Generalprävention aufgetreten ist: die Resozialisierungstheorie. Nach ihr hat das staatliche Strafen die Aufgabe, den Straffälligen in die Gesellschaft wieder einzugliedern. In einer entsprechend weiter ausgreifenden und differenzierten Theorie könnte man auch diese Position berücksichtigen und dann behaup-ten, daß die Generalprävention die generelle Strafandrohung, die Vergeltungstheorie die richtige Strafzumessung und die Resozialisierungstheorie den angemessenen Strafvollzug legitimiere. Zu den Einwänden gegen den Utilitarismus, die schon Urmson zitiert, gehört das Argument, Versprechen seien nicht nur zu halten, wenn günstige Folgen zu erwarten sind. Rawls erkennt dies an, versucht jedoch zu zeigen, daß es keinen Einwand gegenüber dem Regelutilitarismus darstellt. Er unterstreicht, daß es zum Wesen der Institution Versprechen gehört, eine Verpflichtung einzugehen und damit für einen bestimmten Bereich sein Recht auf utilitaristische (oder auch Klugheits-) Überlegungen aufzugeben. Ganz in Überein-stimmung mit dem gewöhnlichen sittlichen Bewußtsein muß man ein Versprechen nicht deshalb halten, weil es gute Folgen hat, sondern weil man es gegeben hat. Utilitaristisch sind allerdings die Überlegungen bei der Frage, ob das Versprechen eine moralisch legitime Institution bzw. Regel ist oder nicht. Auch im Handlungsutilitarismus haben moralische Regeln eine systematische Bedeutung. Solange man daher nicht zwischen zwei verschiedenen Begriffen von Regeln unterscheidet, wird der Streitpunkt zwischen den beiden utilitaristischen Positionen nicht deutlich. Aufgrund der Ähnlichkeit vieler Handlungssituationen und deren utilitaristischer Beurteilung erwirbt man, so lautet die handlungsutilitaristische Position, eine kumulative Erfahrung, die sich in Faustregeln niederschlägt. Faustregeln haben die Bedeutung von Orientierungshilfen; dort, wo eine individuelle und genaue Bewertung der Handlungsfolgen zu langwierig, zu kompliziert oder durch Parteinahme gefährdet ist, sind sie Führer und Hilfe; sie sind jedoch nicht Gebote, nicht einmal Empfehlungen, nur nachträgliche Verallgemeinerungen von Erfahrungen. Man ist jederzeit moralisch dazu berechtigt, die Bewertung so weit wie möglich persönlich und individuell durchzuführen und bei Resultaten, die von den Faustregeln abweichen, der eigenen Bewertung zu folgen. Eine Handlung ist moralisch richtig, weil sie das Wohlergehen der Betroffenen fördert, und nicht, weil sie einer Faustregel entspricht. Im Handlungsutilitarismus liegt der logische Vorrang beim Einzelfall, im Regelutilitarismus dagegen bei der Regel. Angebliche Ausnahmen stellen hier keine Abweichungen, wohl aber eine weitere Qualifikation oder Spezifikation der Regel dar. Durch Regeln werden bestimmte Institutionen oder Formen menschlichen Handelns definiert, womit nicht frühere Erfahrungen verallgemeinert, wohl aber Rahmenbedingungen für künftige Erfahrungen gesetzt werden. Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 57 Die Institutionen, so Rawls, sind erforderlich, um der Verwirrung zu begegnen, die dann entsteht, wenn jeder einzelne sein Handeln direkt utilitaristisch bestimmt. Institutionen ermöglichen, das Handeln der anderen abzusehen und sein eigenes damit zu koordinieren; ohne Handlungsregeln sei ein vernünftiges gesellschaftliches Zusammenleben nicht denkbar. Dieses Argument beweist allerdings in einer Hinsicht zuwenig und in einer anderen Hinsicht zuviel. Auf der einen Seite rechtfertigt es jede Handlungsregel, die eine Orientierung im sozialen Umfeld erlaubt; sie fordert lediglich geregelte Lebensverhältnisse statt ungeregelter, nicht auch gerecht und human geregelte Verhältnisse statt ungerechter und inhumaner. Auf der anderen Seite hat Rawls selbst das Versprechen als eine Institution anerkannt, nach der man eine bestimmte Verpflichtung eingeht und auf utilitaristische Erwägungen verzichtet. Die Verbindlichkeit, ein Versprechen zu halten, besteht schon deshalb, weil man es abgegeben und sich damit eine Verpflichtung auferlegt hat; sie entsteht nicht erst dann, wenn man darüber hinaus zeigen kann, daß die Institution Versprechen überhaupt eine utilitaristisch gesehen legitime Institution ist. Gerade die Position, die nach Urmson zu unhaltbaren Konsequenzen führt und der nach Rawls nur sekundäre Bedeutung zukommt, wird von Smart verteidigt: der Handlungsutilitarismus. Smart geht sogar zum »Gegenangriff« über und beschuldigt den Regelutilitarismus eines abergläubischen Regelfetischismus; er entspreche dem, was ein unreflektierter Engländer des zwanzigsten Jahrhunderts über Moral denke, stelle für eine rationale Überlegung jedoch eine Ungeheuerlichkeit dar. Den genauen Streitpunkt zwischen beiden Formen des Utilitarismus erläutert Smart anhand von zwei Interpretationen des Universalisierungsprinzips. Das in jüngster Zeit viel-fach diskutierte Prinzip ist in erster Annäherung durch die Frage bezeichnet: »Was wäre, wenn jeder so handelte?« Es läßt eine kausale und eine hypothetische Interpretation zu.26 Nach der dem Handlungsutilitarismus entsprechenden kausalen Interpretation sind bei der Bewertung einer Handlung ihre tatsächlich zu erwartenden, und zwar nicht lediglich ihre unmittelbaren Vor- und Nachteile zu berücksichtigen, vielmehr ebenso ihre Nebenfolgen, vor allem auch ihre negativen sozialen Sekundäreffekte (das schlechte Beispiel eines Verspre-chensbruchs färbt ab, und dgl.). Nach der dem Regelutilitarismus entsprechenden hypothetischen Interpretation dagegen geht es nicht um die zu erwartenden wirklichen Folgen und Nebenfolgen, sondern um die Folgen, die sich gemäß der - im allgemeinen nicht zutreffenden - Annahme »Was wäre, falls jeder so handelte« einstellen. Smart zeigt nun auf, wozu es der im Handlungsutilitarismus anerkannten Faustregeln bedarf, erklärt sich mit Urmsons MillInterpretation weitgehend einverstanden (nur eine Stelle versteht er anders) und erläutert schließlich seine Ablehnung des Regelutilitarismus, indem er drei Anwendungs-beispiele diskutiert. Smart sieht, daß er sich mit seiner handlungsutilitaristischen Ansicht in eklatanten Widerspruch zum gewöhnlichen sittlichen Bewußtsein stellt, hält dies aber für notwendig. Wie es die täglich zu lesenden populären Vorstellungen über die Bestrafung von Kapitalverbrechen oder über die internationale Politik dokumentierten, sei das gewöhnliche sittliche Bewußtsein von abergläubischen, moralisch schlechten und logisch konfusen Elementen durchsetzt, so daß es sich als Kriterium disqualifiziere. So gesehen hat Smart ohne Zweifel recht. Er berücksichtigt jedoch nicht, daß es seinen Gegnern nicht um die tatsächlichen Aussagen des angeblich gesunden Menschenverstandes geht, sondern um die des aufgeklärten sittlichen Bewußtseins, eines Bewußtseins also, das von falschen empirischen Annahmen, von Widersprüchlichkeiten und Beurteilungsschwächen freigesetzt ist. Gewiß beruft man sich oft zu rasch auf ein aufgeklärtes sittliches Bewußtsein, ohne ein intersubjektiv gültiges Verfahren Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 58 des Aufklärens zu entwerfen und es angesichts konkreter Beispiele von Aufklärungsmängeln zu erproben. Daß der im Regelutilitarismus erhobene Vorrang der Regel dem tatsächlichen sittlichen Bewußtsein entspricht, mag unbestritten sein; ob es aber in diesem Punkt auch ein aufgeklärtes Bewußtsein ist, das müßte noch erwiesen werden. Hier liegt die Schwierigkeit jeder empirisch-analytisch orientierten normativen Ethik: sie muß sich auf die Aussagen des gewöhnlichen sittlichen Bewußtseins beziehen, ohne sie in dem Sinne als vorgegebene Tatsachen behandeln zu können, wie es den naturwissenschaftlichen Theorien gegenüber ihren Beobachtungsdaten erlaubt ist. Auch Smart muß sich auf das sittliche Bewußtsein berufen; er beruft sich jedoch auf sein eigenes und angeblich auf das seines Lesers, ohne zu klären, warum sie diese Auszeichnung verdienen und worin sie begründet ist: ob in einem höheren moralischen oder einem höheren Erkenntnisanspruch. Letztlich muß er es bei der bloßen Behauptung bewenden lassen, der Handlungsutilitarismus stelle die adäquatere moralphilosophische Position dar. Folgerichtig hat er später eine nichtkognitivistische Metaethik vertreten und auf den Versuch, den Handlungsutilitarismus durch Gründe abzusichern, verzichtet.27 Die Form des Regelutilitarismus, die Brandt entfaltet, verdankt sich einer intimen Kenntnis der vorangegangenen englischsprachigen Ethik-Diskussion: nicht nur der Kontroversen im Bereich des Utilitarismus, sondern auch der metaethischen Forschung und der analytischen Kant-Rezeption. Insbesondere ist Brandt der durch Urrnson neu aufgeschlossenen Theorie Mills sowie einem Vortrag von Mabbot28 verpflichtet. Mit Brandt erreicht die UtilitarismusDiskussion jenes für feine Differenzierungen sensibilisierte Problembewußtsein, von dem jede wissenschaftlich ernstzunehmende Weiterentwicklung oder Kritik des Utilitarismus ausgehen muß. Der Aufsatz beginnt mit einer allgemeinen Definition des Utilitarismus, stellt ein differenziertes Kriterium zur Beurteilung normativer Theorien bereit und trägt dann drei Argumente vor, die zugunsten einer jeden utilitaristischen Ethik sprechen: Erstens werde die moralische Richtigkeit von Handlungen im Utilitarismus ausschließlich auf der Grundlage von Beobachtungen und wissenschaftlichen Verfahren bestimmt; die utilitaristische Theorie zeichne sich zweitens durch Einfachheit und drittens dadurch aus, daß sie sowohl unter Berufung auf den Uneigennutz als auch das Selbstinteresse der Menschen gerechtfertigt werden könne. Das letzte Argument kann indessen in Brandts knapper Formulierung nicht ganz überzeugen. Für die Rechtfertigung des utilitaristischen Prinzips gegenüber jemandem, der allein vom Selbstinteresse bestimmt ist, setzt Brandt nämlich voraus, daß man von der besonderen Situation abstrahiert, in der sich ein konkreter Mensch befindet, das heißt von seiner natürlichen Begabung, seinem gesellschaftlichen Status usf. Damit wird aber die Situation aufgehoben, in der ein Egoismus, die Haltung, die jeweiligen konkreten Verhältnisse für sein eigenes Interesse auszubeuten, wirksam werden kann; die Rechtfertigung geschieht also von vornherein gegenüber jemandem, der nicht mehr auf einem strikt egoistischen Standpunkt steht. Im übrigen wird durch den Versuch, das utilitaristische Prinzip auch unter Berufung auf den Eigennutz der Menschen zu rechtfertigen, die fundamentale sittliche Aufgabe unterschlagen, den natürlichen Hang zur Selbstliebe zu überwinden. Im Mittelpunkt von Brandts Beitrag steht jedoch weniger ein Plädoyer für den Utilitarismus überhaupt als die fortschreitende Präzisierung einer bestimmten Form von Regelutilitarismus. Zunächst setzt der Verfasser sich gegen jeden Handlungsutilitarismus ab; die Überlegenheit des Regelutilitarismus erscheint so selbstverständlich, daß wenige Hin-weise hierzu genügen. (Smarts Verteidigung des Handlungsutilitarismus wirkt aus dieser Sicht wie eine rasch vergessene Episode.) Brandt geht dann dazu über, »ideale« Formen des Regelutilitaris- Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 59 mus gegen solche Formen zu verteidigen, die sich nicht auf die optimal möglichen, sondern auf die in der Gesellschaft tatsächlich anerkannten Regeln beziehen. Im Hin-blick auf diese Formen des Regelutilitarismus muß man allerdings fragen, inwieweit es ihnen noch um eine strikte Orientierung am Wohlergehen der Betroffenen, also überhaupt um einen Utilitarismus geht, ferner inwieweit die in diesem Band abgedruckten Beiträge von Urmson und Rawls tatsächlich diese von Brandt kritisierten Formen des Regelutilitarismus vertreten. In einem dritten Schritt wendet sich Brandt gegen eine bestimmte Spielart des idealen Regelutilitarismus, den sogenannten negativen idealen Regelutilitarismus, um schließlich - nach einigen weiteren Schritten der Differenzierung - seine eigene Position vorzustellen: die Theorie des »idealen Moralkodex«. Ihrem Kern nach besteht sie aus der These, daß eine Handlung dann und nur dann moralisch richtig ist, wenn sie nicht von dem für die Gesellschaft idealen Moralkodex verboten ist. Dabei gilt jener Moralkodex als ideal, dessen Geltung in einer Gesellschaft ebenso viel Gutes pro Person hervorbringen würde, wie die Geltung irgendeines anderen Moralkodex. Seine zunächst nur summarisch formulierte Theorie verdeutlicht Brandt im Zusammenhang einzelner Probleme. Von Belang für die Utilitarismus-Diskussion wie für die normative Ethik überhaupt ist vor allem die Unterscheidung von Regeln eines Moralkodex und Regeln gesellschaftlicher Institutionen. Die Frage nach der Bewertung des relativen Nutzens eines moralischen Kodex wird dagegen nur knapp behandelt; das durch Bentham entwickelte, durch die moderne Wohlfahrtsökonomie verbesserte Instrumentarium des hedonistischen Kalküls samt den angedeuteten Schwierigkeiten (s.o.) wird an dieser Stelle nicht zufriedenstellend erörtert. Ein idealer Moralkodex scheint einem Kanon absoluter Werte analog zu sein und deshalb denselben gewichtigen Einwänden ausgesetzt zu sein wie die materiale Wertethik eines M. Scheler und eines N. Hartmann.29 Er beinhaltet, so möchte man meinen, ein System übergeschichtlich gültiger Normen, das die soziokulturellen Besonderheiten einer Gesellschaft und Epoche und damit das tatsächliche Wohlergehen geschichtlich bestimmter Menschen außer acht läßt. Indessen entgeht Brandt solchen Schwierigkeiten, indem er den Moralkodex nicht absolut, sondern ausschließlich relativ, nämlich in Bezug auf die jeweilige Gesellschaft, ihre Situation und die in ihr lebenden Menschen definiert, und nur dadurch ist seine Theorie überhaupt eine utilitaristische. Darüber hinaus wird durch die ausdrückliche Abgrenzung des Moralkodex von den Institutionen einer Gesellschaft der Tendenz entgegengesteuert, den Anwendungsbereich einer normativen Ethik exzessiv auszuweiten und ihr die Aufgabe zuzumuten, für alle Bereiche und Aspekte menschlichen Handelns zuständig zu sein; Brandt konzentriert sich bewußt auf die Rechtfertigung von Grund- und Rahmennormen. IV. Grenzen des Utilitarismus Das gesellschaftskritische Potential des Utilitarismus ist auch heute noch keineswegs erschöpft. Zu den Betroffenen, deren Wohlergehen maximiert werden soll, gehören beispielsweise in der internationalen Perspektive die armen Länder; deshalb hält der Utilitarismus eine Weltwirtschaftsordnung für moralisch verwerflich, die das Wohlergehen dieser Länder Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 60 nicht hinreichend befördert. Zu den Betroffenen gehören ebenso die künftigen Generationen, weshalb der Utilitarismus sich sowohl gegen eine zu hohe Staats-erschuldung wendet als auch gegen jene »nichtfinanziellen Schulden«, die wir unseren Kindern und Kindeskindern durch eine rücksichtslose Ausnutzung der natürlichen Ressourcen aufbürden. Nicht zuletzt berücksichtigt der Utilitarismus alle Lebewesen, die Freude und Schmerz empfinden können, verteidigt daher einen nicht bloß anthropozentrischen Tierschutz. Der nur allzu berechtigte gesellschaftskritische Impuls des Utilitarismus verbindet sich jedoch, wie gesagt, im Nutzenkalkül mit der Vorstellung, die nötigen Reformen ließen sich quantitativ exakt bestimmen. Näher betrachtet erweist sich diese Vorstellung - und dieselbe Ansicht anderer Philosophen der Aufklärung - als naiv. Eine Nutzenkalkulation ist zwar namentlich dort hilfreich, wo es um einen geringeren Aufwand oder größeren Ertrag geht; der Utilitarismus ist deshalb auch eine der Quellen, aus denen sich in den Wirtschaftswissenschaften ein so bedeutender Forschungszweig entwickelt wie die Wohlfahrtsökonomie und Sozialwahltheorie. Vertreten wird die Nutzenkalkulation aber gegenüber einem speziellen Ziel, dem Wohlergehen; und hier wirft die Kalkulation nicht überwindbare Schwierigkeiten auf. Sie beginnen damit, daß, wie gesagt, eine genaue Bestimmung des Begriffs »Betroffener« fehlt und man nicht weiß, wie man die direkt Betroffenen mit den indirekt Betroffenen und wie die gegenwärtige Generation mit den nachfolgenden Genera-tionen vergleichen soll. Weiterhin läßt sich bei vielen Handlungsalternativen ihr Nutzen nicht annähernd quantitativ bestimmen. Daraus folgt die Gefahr, daß wir Zwecke, deren Mittel und Wege gar nicht oder nicht so leicht quantifizierbar sind, vernachlässigen und uns stattdessen auf die doch sekundären Probleme konzentrieren, auf die Fragen des Billiger, Schneller, Größer usw. Gerade in den für das persönliche und das politische Leben entscheidenden, in den gleichsam existentiellen Fällen ist der Nutzenkalkül bestenfalls so etwas wie eine regulative Idee. Er fordert nämlich auf, bei alternativen Optionen die Vor- und Nachteile sorgfältig zu überlegen und gegeneinander abzuwägen; eine Methode aber, um die Nutzenabwägung erfolgssicher durchzuführen, gibt er nicht an die Hand. Deshalb enthält die Rede von Nutzenkalkulation etwas von Augenwischerei; sie unterstellt, daß wir genaue Daten haben und sie in bezug auf das Wohlergehen der Betroffenen annähernd verläßlich verrechnen können. Wenn man sich aber überlegt, welcherart Entscheidungen eine grundlegende Bedeutung haben: im persönlichen Leben etwa die Wahl einer Berufsrichtung oder eines Lebenspartners, und im öffentlichen Bereich: Entscheidungen über die Grundstruktur des Bildungswesens oder der Strafrechtspflege, so sind die entsprechenden Daten nicht im entferntesten vorhanden. Außerdem setzt der Nutzenkalkül voraus, daß wir den Nutzen, den verschiedene Dinge fürs Wohlergehen haben, vergleichen können: zunächst in bezug auf ein und dieselbe Person, dann im Verhältnis der verschiedenen Personen zueinander. Diese Probleme des intrapersonalen und interpersonalen Nutzenvergleichs haben die Wissenschaften zwar seit langem beschäftigt und zu einer Fülle teils ingeniöser Vorschläge geführt; die Mannigfaltigkeit der Vorschläge täuscht aber nicht darüber hinweg, daß die Probleme bis heute befriedigend noch nicht gelöst sind. Ein weiteres Bedenken richtet sich gegen das Folgenprinzip, freilich nicht dagegen, daß in der Moral Folgenüberlegungen überhaupt eine Rolle spielen; kritikwürdig ist erst deren Reichweite. Dem Utilitarismus als einer teleologischen Ethik pflegt man nämlich eine Ethik entgegenzusetzen, die, weil sie nicht teleologisch sei, deontologisch genannt wird; als ihr Hauptvertreter gilt Kant. Nun spielen in dessen Ethik, was man gern übersieht, Folgenüberlegungen ebenfalls eine Rolle. Erlaubt sind sie aber nur hinsichtlich handlungs-interner Folgen, das sind Folgen, die zum Begriff der entsprechenden Handlung hinzugehören. Nach Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 61 Kants Moralkriterium, dem kategorischen Imperativ, soll man sich die handlungs-internen Folgen als ein allgemeines Gesetz denken können. Das sei beispielsweise bei einem unehrlichen Versprechen nicht der Fall, weil es als Versprechen Glaubwürdigkeit intendiere; durch die Unehrlichkeit laufe es aber genau dieser Intention zuwider; und als allgemeines Gesetz gedacht habe das unehrliche Versprechen den Verlust der Glaubwürdigkeit zur Folge. Da auch eine deontologische Ethik Folgenüberlegungen zuläßt, kann man vom Utilitarismus in einem spezifischen Sinn erst dort sprechen, wo zusätzlich zu den handlungsinternen auch handlungsexterne Folgen berücksichtigt werden. Der Utilitarismus, und zwar der moralisch plausible Regelutilitarismus, könnte sich mit Kant daraufhin einigen, daß der Zweck eines Versprechens in der Glaubwürdigkeit liegt und daß die Unehrlichkeit genau diesem Zweck zuwiderläuft. Über die Art des Wissens, mit dem man von diesem Wider-spruch Kenntnis nimmt, sind sich jedoch Kant und der Utilitarismus uneinig. Nach dem Regelutilitarismus (»Was wäre, wenn jeder so handelte?«) ist es ein empirisches, nach Kant ein vorempirisches Wissen. Nach Kant ist die Angewiesenheit des Versprechens auf Vertrauen deshalb ein vorempirisches Wissen, weil es zum Begriff (zur Bedeutungsregel) des Versprechens gehört – »Versprechen« heißt nichts anderes als »Vertrauen-schaffen durch sein bloßes Wort«. Folglich weiß man auch vorempirisch, daß in einem unehrlichen Versprechen zwei einander widersprechende Zwecke verfolgt werden; während mit dem Versprechen Glaubwürdigkeit gesucht wird, wird mit der Unehrlichkeit die Glaubwürdigkeit aufs Spiel gesetzt. Dem Utilitarismus ist ohne Zweifel insoweit Recht zu geben, als empirische Kenntnisse bei der Anwendung von moralischen Normen eine Rolle spielen. Aber im Grundlagenstreit zwischen Kant und dem Utilitarismus geht es nicht um die Anwendung, sondern um die Begründung moralischer Pflichten. Und hier, das zeigt das Beispiel des unehrlichen Versprechens, ist es keineswegs ausgemacht, daß die »empirische« Theorie des Utilitarismus tatsächlich der »rationalistischen« Theorie Kants überlegen ist. Die schon in der Aufklärungsphilosophie einander entgegenstehenden Positionen des Empirismus und des Rationalismus bleiben mindestens in der Ethik bis heute in Konkurrenz. Die Grenzen, an die der Utilitarismus stößt, sind in diesem Band nicht durch die zwei ersten Kritikformen, sondern nur durch einen dritten Kritiktyp gegenwärtig. Der Anspruch des zeitgenössischen Utilitarismus, unsere gewöhnlichen Moralvorstellungen rational und kohärent zu rekonstruieren, ist nicht vereinbar mit unseren Gerechtigkeitsvorstellungen. Insbesondere gibt es Prinzipien der distributiven Gerechtigkeit, Prinzipien der Verteilung von öffentlichen Gütern, von Rechten und Pflichten, von Vor- und Nachteilen gemeinsamer Handlungen, die uns als moralisch richtig einleuchten und die zugleich mit dem Prinzip der Nützlichkeit in Konflikt stehen. Wenn von zwei möglichen Handlungen, die den gleichen kollektiven Gesamtnutzen hervorbringen, die eine den Nutzen auf eine kleine Zahl von Personen, die andere ihn auf viele oder alle verteilt, so sind utilitaristisch gesehen beide Handlungen gleichwertig. Nach unseren Gerechtigkeitsüberzeugungen würden wir dagegen die eine als ungerecht verurteilen und nur die andere als gerecht hervorheben. Wenn Benthams hedonistischer Kalkül jeden ohne Unterschied berücksichtigt, so ist damit nicht mehr als eine Minimalbedingung für Gerechtigkeit benannt. Das Ziel, der maximale Gesamtnutzen aller Betroffenen, läßt sich sehr wohl mit der rechtlichen und/oder ökonomischen Unterdrückung von Minderheiten oder einzelnen Personen vereinbaren. Eine Sklaven- oder eine Feudalgesellschaft und auch ein Polizei- oder ein Militärstaat wären nicht nur erlaubt, sondern sogar sittlich geboten, sofern sie nur so organisiert sind, daß sie zwar extreme Eingriffe in den Freiheitsraum einzelner Bürger, überdies extreme ökonomische und so- Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 62 ziale Ungleichheiten mit sich führen, gleichwohl (mit Bentham) einen maximalen Gesamtoder (mit Brandt) einen maximalen Pro-Kopf-Nutzen garantieren. Nach unserem sittlichen Bewußtsein fordert aber die Idee der Gerechtigkeit für jede einzelne Person eine Unverletzlichkeit, die selbst durch das maximale Wohlergehen aller anderen nicht beiseite gesetzt werden darf. Aus diesem Grund hat Sidgwick das Prinzip der Fairneß als Korrektiv-Prinzip zum Utilitarismus eingeführt und hat Rawls sein anfängliches Wohlwollen gegenüber dem Utilitarismus zurückgenommen, um eine Theorie der Gerechtigkeit zu entwickeln, deren Grundbegriff gerade die Fairneß ist. Für sich allein genommen, ohne die Gerechtigkeit als Korrektiv, stellt der Utilitarismus eine Art von Kollektivegoismus dar, dem eine Unterdrückung oder Benachteiligung von Minderheiten, selbst eine Verletzung unveräußerlicher Menschenrechte erlaubt ist - sofern sie sich mit einer größeren Besserstellung der Mehrheit verbindet und die kollektive Glücksbilanz verbessert. Der Handlungsutilitarismus erlaubt es sogar, in Krisensituationen einen Unschuldigen zu töten, falls dadurch das soziale Wohlergehen befördert werde. Der Gegensatz von Utilitarismus und dem Prinzip der Gerechtigkeit bzw. der Fairneß ist aber keineswegs so kraß, wie er zunächst erscheint. Nur in einer oberflächlichen Überlegung sind Nützlichkeitserwägungen von Verteilungsproblemen gänzlich unabhängig. Eine solche Überlegung geht zum Beispiel davon aus, daß es 100 Einheiten von Freude gibt, die auf 100 Personen verteilt werden sollen, wobei viele Verteilungsmodi existieren, die alle zu demselben kollektiven Gesamtnutzen führen. Sicherlich ist es für den kollektiven Gesamtnutzen gleichgültig, ob man jeder Person eine Einheit, jeder zehnten zehn Einheiten oder einer Person alle 100 Einheiten von Freude und den anderen 99 Personen nichts zukommen läßt. Jedoch kommen nicht die Einheiten von Freude selbst zur Verteilung, sondern Dinge, die Freude machen, zum Beispiel bestimmte Konsumgüter. Wenn man nun 100 Äpfel auf 100 Personen verteilen soll, so ist der kollektive Gesamtnutzen sehr wohl davon abhängig, ob man jedem einen Apfel, jedem zehnten zehn oder einem alle 100 Äpfel gibt. Denn nach dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens - einer Folge der begrenzten Kapazität von Bedürfnissen und Interessen - wird das Verspeisen des ersten Apfels mehr Freude machen als das des dritten oder vierten; und entsprechend dem Hunger, Obstmangel etc. wird der fünfte, zehnte oder zwanzigste Apfel zur Qual. Der Gegensatz von Utilitarismus und Gerechtigkeit mildert sich also bei näherer Betrachtung ab. Unter bestimmten empirischen Annahmen, namentlich dem Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, folgt aus dem Utilitarismus sogar eine strenge Gleich-behandlung (jedem dieselbe Menge, also genau einen Apfel). Bestehen bleibt jedoch, daß nach dem Utilitarismus das Leid der einen gegen das Wohlergehen der anderen verrechnet werden darf, ohne daß man den Beteiligten einen Ausgleich anbieten müßte. So kehrt bei Gerechtigkeit und kollektivem Wohlergehen der Utilitarismus die Rangfolgen um, die wir für moralisch richtig halten. Während der Utilitarismus aber nur Entscheidungen gleichen Kollektivwohls, also wohlfahrtsindifferente Alternativen, für Gerechtigkeitserwägungen freigibt, erscheint uns die genaue Umkehrung als eher richtig: nur Entscheidungen, die gleicherweise gerecht sind, also gerechtigkeitsindifferente Alternativen, zusätzlich dem Kriterium des maximalen kollektiven Wohls zu überlassen. Utilitaristen halten sich gern zugute, daß sie einem moralischen Rigorismus entgehen, der gewisse moralische Verbindlichkeiten als unter allen Umständen gültig erklärt. Im Fall der Gerechtigkeit und der Menschenrechte scheint aber der sonst gern verfemte moralische Rigorismus uns allein sachgemäß zu sein. Wer einen Unschuldigen tötet, begeht aus welchen Gründen auch immer er handelt -, ein eklatantes Unrecht. Wie der Streitpunkt zwischen dem Nützlichkeits- und dem Fairneß-Prinzip genauer aussieht, das sucht Lyons gegen Schluß seiner Monographie Forms and Limits of Utilitarianism zu Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 63 zeigen. Vorher hat er mehrere Formen des Utilitarismus unterschieden und ihr Verhältnis zueinander einer gründlichen Untersuchung unterzogen. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, daß die verschiedenen Formen des Regelutilitarismus, die doch die Schwierigkeiten des Handlungsutilitarismus überwinden sollten, entweder keine bedeutsamen Unterschiede zum Handlungsutilitarismus aufweisen (die These der extensionalen Äquivalenz) oder daß sie, falls sie sich vom Handlungsutilitarismus abheben, die Position des Utilitarismus nicht zufriedenstellend verbessern. Da Lyons sein Buch vor Brandts Beitrag schrieb, bezieht sich seine Utilitarismus-Kritik noch nicht auf Brandts Position und die ihr zugrundeliegende Unterscheidung von institutionellen Regeln und Regeln eines Moralkodex. In seiner Analyse nennt Lyons vier Arten von Fairneß-Problemen, untersucht anhand knapper Anwendungsbeispiele ihr Verhältnis zum Utilitarismus und kommt zu dem Schluß, daß das Fairneß-Prinzip auf Überlegungen beruht, die elementarer sind als die utilitaristischen. Die Fairneß-Problematik hat es mit dem fundamentalen Gegensatz von sozialem zu unsozialem Verhalten zu tun; fair sein heißt, sich als verantwortliches Mitglied einer Sozietät, heißt, sich überhaupt als soziales Wesen zu verhalten. Das Prinzip Fairneß benennt eine gewichtige Einschränkung; das vom Utilitarismus formulierte Moralprinzip ist weder das einzige noch das prioritäre Kriterium für das moralisch Richtige und Falsche; der Utilitarismus ist, selbst im Rahmen einer normativen Ethik, keine zureichende moralphilosophische Position. Der Utilitarismus stößt aber nicht nur wegen der Gerechtigkeit an Grenzen. Schwierigkeiten hat er auch mit der Unter-scheidung von (moralischen) Rechtspflichten, deren Anerkennung die Menschen einander schulden, und bloß verdienstlichen Pflichten, den Tugendpflichten. So ist es eine Rechtspflicht, Leib und Leben, die Ehre oder das Eigentum der Mitmenschen zu achten, dagegen in vielen Fällen nur eine Tugendpflicht, sich um das Wohlergehen der Mitmenschen zu bekümmern. Der Unterschied, der innerhalb der Moral besteht zwischen dem Geschuldeten und dem verdienstvollen Mehr, geht im Utilitarismus verloren. Außerdem können wir Handlungen wie Selbstmord, Lügen oder auch das Brechen von Versprechen nicht allein unter dem Aspekt des kollektiven Wohlergehens, sondern auch unter dem der persönlichen Vollkommenheit auf ihre sittliche Richtigkeit hin untersuchen, ohne daß wir uns damit von vornherein in einen Widerspruch zu den durchschnittlichen sittlichen Überzeugungen stellen. Selbst wenn wir als Moralprinzip lediglich die utilitaristische Maxime anerkennen, gibt es die folgende Schwierigkeit. In den jeweiligen Entscheidungen, namentlich denen des Gesetzgebers, wird nicht direkt das Glück gewählt, sondern eine Globallage von Nutzenmöglichkeiten; diese muß jeder - sei es ein Individuum, sei es eine Gruppe - selber, im Laufe des Lebens zudem immer wieder neu, sehen, ergreifen und in persönliche Befriedigung umsetzen. Daraus folgt nicht, politische Entscheidungen oder soziale Strukturen seien gegenüber dem persönlichen Glück belanglos, jedoch können - und sollen sie das Glück der Betroffenen nicht »herstellen« . Sie befinden nur über mögliche Hindernisse und Barrieren; sie stellen die Voraussetzungen für ein lebenswertes Leben sicher; sie schaffen die Spielräume, in denen Identitätsbildung, affektive Bindungen, Identifikationen und persön-liche Interaktionen möglich sind; sie stellen Aktionsfelder für Selbstverwirklichung und Kommunikation bereit; mithin schaffen sie ein Potential oder eine Chance für Glück, aber nicht seine Aktualität. Gültig ist diese Einsicht unabhängig von einem substantiellen Glücksbegriff. Ob man nämlich das Glück in persönlichen Beziehungen der Achtung, der Solidarität, der Freund-schaft oder der Liebe sucht, ob man es aus anspruchsvollen Tätigkeiten in wissenschaftlicher For- Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 64 schung, in Kunst, Kontemplation oder öffentlichen Ämtern erwartet - es kommt darauf an, die entsprechenden Beziehungen oder Tätigkeiten zu realisieren und im Vollzug die Erfüllung seiner Glückserwartungen zu erfahren; glücklich wird man im eigenen Vollzug des Lebens. Die Regeln eines Moralkodex und auch die von sozialen und politischen Institu-tionen können nicht das Glück selbst sicherstellen, sondern allenfalls seine limitierenden Bedingungen und Voraussetzungen. Zum Ziel nehmen können sie sich das allgemeine Wohlergehen nicht direkt, sondern nur in dieser indirekten Form. Die verschiedenen Beiträge dieses Sammelbandes lassen das Gewicht, einige auch Grenzen des Utilitarismus deutlich werden. Der Utilitarismus greift nicht alle Probleme auf, die in den Umkreis einer philosophisch zureichenden Ethik gehören; vor allem metaethische Untersuchungen und transzendentale Begründungsversuche sprengen den utilitaristischen Grundansatz; so erweist er sich schon thematisch und methodisch gesehen als unvollständig. Der Utilitarismus ist Moralphilosophie nur im Sinne einer normativen Ethik, die zudem moralische Verbindlichkeiten nicht auch vom Gesichtspunkt der eigenen Vollkommenheit her rechtfertigt, sondern sich allein auf den sozialen Aspekt konzentriert; er ist genauer eine normative Ethik im Sinne einer Sozialpragmatik. Selbst als Sozialpragmatik betrachtet, kann er aber nicht voll überzeugen. Weder ist Benthams Versuch gelungen, das Prinzip der Nützlichkeit mit Hilfe eines hedonistischen Kalküls rational verfügbar zu machen, noch führt die immanente Verbesserung des Utilitarismus zum Regelutilitarismus zu einem Moralprinzip, das alle relevanten moralischen Pflichten legitimiert. Durch solche Einschränkungen wird die grundsätzliche Intention des Utilitarismus aber nicht diskreditiert: die Verpflichtung der Normen und Ziele menschlichen Handelns auf das Wohlergehen der Betroffenen; gerechtfertigt ist kein globales Verwerfen, wohl eine tiefgreifende Modifikation. Nennen wir das Resultat einen kritischen Utilitarismus; im Verhältnis zur klassischen und zeitgenössischen Diskussion müßte er sich durch mindestens drei Veränderungen auszeichnen: 1. Das im Nützlichkeitsprinzip gebotene allgemeine Wohlergehen ist ein regulatives, nicht ein operatives Ziel; das heißt, es ist ein normatives Leitziel, an dem sich menschliches Handeln ausrichten soll, ohne daß das Ziel schon aus sich heraus zu sagen vermag, welche Handlungen für den jeweiligen Lebensbereich und seine wechselnden Umstände genau folgen. Auch die Übersetzung des utilitaristischen Prinzips in einen hedonistischen Kalkül schafft kein zufriedenstellendes, präzises Verfahren. Der Versuch, das allgemeine Wohl-ergehen ausschließlich oder primär durch eine quantitativ exakte Kalkulation des individuellen wie des kollektiven Nutzens zu bestimmen, mißlingt, und zwar aus grundsätzlichen Überlegungen. Ohne Prozesse der Selbstbesinnung und der Selbstklärung, ohne eine Kritik aus Eigeninteresse wie aus sozialem Engagement stößt man nur auf die vermeintlichen statt auf die wohlverstandenen, auf die naturwüchsig vorhandenen statt auf die sozial akzeptablen Interessen. Wenn man aber jene zur Grundlage der Kalkulation macht, so wird das verfehlt, worum es eigentlich gehen sollte, das persönliche und das kollektive Wohlergehen. 2. Durch ein Handeln, das den moralischen Verbindlichkeiten genügt, wird nicht das allgemeine Wohlergehen selbst befördert; es werden allenfalls die limitierenden Bedingungen und Voraussetzungen geschaffen, die die Chance zu einem glücklichen Leben bieten. Das allgemeine Wohlergehen ist in indirekter, nicht in direkter Intention das sinnvolle Ziel moralischen Handelns. 3. Auch in indirekter Intention bezeichnet das allgemeine Wohlergehen nicht das schlechthin adäquate Moralprinzip. Die eigene Vollkommenheit kann ebenfalls ein Kriterium tatsächlicher moralischer Verbindlichkeiten sein, und unter rein sozialen Gesichtspunkten ist es vor allem, worauf das Prinzip Fairneß verweist: die Idee der Gerechtigkeit. Angemessener ist Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 65 es deshalb, von einem umfassenderen normativen Leitprinzip auszugehen, das die Prinzipien der Nützlichkeit, der eigenen Vollkommenheit und der Gerechtigkeit integrieren kann, beispielsweise von der Idee der Humanität. Von einem solchen umfassenderen Prinzip aus würden die partielle Gültigkeit und auch die Grenzen der anderen Prinzipien verständlich. Eine Sozialpragmatik, die sich diesen drei Elementen verpflichtet weiß und das allgemeine Glück als regulatives, nicht operatives, als indirektes, nicht als direktes Kriterium betrachtet und eine Idee der Humanität als Forum der Kritik anerkennt, würde die Überzeugungskraft des Utilitarismus verstärken. Anmerkungen 1 Relativ ausgewogene Auseinandersetzungen finden sich jedoch bei W. Dilthey, System der Ethik, in: Gesammelte Schriften, Bd. X, Stuttgart-Göttingen 1958, Abschnitt 1, und bei M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Bern 51966, 187-189; neuere Untersuchungen: G. Patzig, Die Begründbarkeit moralischer Forderungen, in: ders., Ethik ohne Metaphysik, Göttingen 1971, 32-61; N. Hoerster, Utilitaristische Ethik und Verallgemeinerung, Freiburg-München 1971. - Die Bemerkung gilt der Debatte bis in die 70er Jahre; inzwischen hat der Utilitarismus mehr Beachtung, auch mehr Anhänger gefunden. 2 K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie, MEW III, Berlin 1969, 394; F. Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, Nr. 225; vgl. Götzen-Dämmerung, Sprüche und Pfeile, Nr. 12. 3 Ethik, Berlin 31949, Kap. 9-10. 4 Vgl. A. Bohnen, Die utilitaristische Ethik als Grundlage der modernen Wohlfahrtsökonomie, Göttingen 1964. 5 Von griech. to deon: das Nötige, Schickliche. Als Hauptvertreter gelten W.D. Ross, The Right and the Good, Oxford 1930, und vor allem Kant; zum Verhältnis zu Kant vgl. aber Abschn. IV dieser Einleitung. 6 Nach M. Riedel, in: ders. (Hg.), Rehabilitierung der praktischen Philosophie, Bd. I, Freiburg 1972, 10. 7 Deshalb ist Hobbes - im Unterschied zu Rawls (vgl. seinen Beitrag in diesem Band, Anmerkung 1) - nicht unter die Utilitaristen zu zählen. 8 Siehe die Bibliographie zu diesem Band, Abschnitt III. 9 Nach dem im Vorwort erwähnten ehrgeizigen Plan sollten das bürgerliche und das Strafrecht, das Zivil- und das Strafprozeßrecht, das Belohnungswesen, das Öffentliche Recht, das der gesetzgebenden Körperschaften und das internationale Recht behandelt werden. 10 Vgl. Benthams Vorwort. 11 Schon Aristoteles ging davon aus, daß alle, sowohl die Gebildeten als auch die Menge, nach Glück streben. Über das, was das Glück sei, beginne allerdings der Streit: Nikomachische Ethik, Buch I, Kap. 2, 1095a 14ff. 12 So der Untertitel der berühmten Schrift: Die Bienenfabel oder Private Laster, öffentliche Vorteile (Frankfurt/M. 1968). 13 Bentham kritisiert das Naturrecht in der Form, wie er es bei Blackstone im Anschluß an Justinian vertreten sieht. Danach ließe sich die Rechtslehre auf drei Vorschriften reduzieren: We should live honestly, hurt nobody, render to everybody his due. Darin liegt jedoch eine sehr krude Auffassung von Naturrecht; vgl. W. Röd, Rationalistisches Naturrecht und praktische Philosophie der Neuzeit, in: Riedel, a.a.O., 269-295; F. Böckle, E.-W. Böckenförde (Hg.), Naturrecht in der Kritik, Mainz 1973; O.Höffe, Politische Gerechtigkeit, Frankfurt/ M. 1987, Kap. 4. Otfried Höffe, Einführung in die utilitaristische Ethik – Einleitung 14 66 Darin stimmt der Benthamsche Utilitarismus mit dem kritischen Rationalismus von Popper und Albert, mit dem Transsubjektivitätsmodell der sogenannten Erlanger Schule, mit Rawls’ Gerechtigkeitstheorie und mit Apels und Habermas’ Diskursmodell überein, daß vorgefundene, positiv gesetzte oder auch nur vorgeschlagene Verhaltensregeln ausdrücklich für eine rationale Überprüfung offengehalten werden. 15 Vgl. O. Höffe, Strategien der Humanität. Zur Ethik öffentlicher Entscheidungsprozesse, Freiburg und München 1975 (Taschenbuch: Frankfurt/M. 1985), Kap. 4.3. 16 Vgl. Bibliographie, Abschnitt IV. 17 Vgl. O. Höffe, Kategorische Rechtsprinzipien, Frankfurt/M. 1990, Kap. 6. 18 Nach A Theory of Justice (s. Anm. 25), 5126. 19 Vgl. in diesem Band den Beitrag von Lyons und inzwischen natürlich Rawls’ Gerechtigkeitstheorie. 20 Die nachhaltigste Kritik bei W.D. Ross, The Right and the Good, Oxford 1930, bes. chap. 2. 21 Zum Beispiel A.J. Ayer, Sprache, Wahrheit und Logik, Stuttgart 1970 (engl. Ausgabe: London 1936), Kap. VI: Kritik der Ethik und Theologie. 22 Ethical Theory. The Problems of Normative and Critical Ethics, Englewood Cliffs, N.J. 1959, chap. 15. 23 Vgl. Bibliographie, Abschnitt Vl. 24 Zum Beispiel ‚Essay on Bentham’, in: M. Warnock (Hg.), J.S. Mill, Utilitarianism, Cleveland/Ohio 71970, 78-125. Vgl. auch den Beitrug von Rawls in diesem Band, Anm. 2. 25 Justice as Fairness, in: The Philosophical Review 57, 1958, 164-194 (dt. in: John Rawls. Gerechtigkeit als Fairneß, hg. v. O. Höffe, Freiburg-München 1977); A Theory of Justice, Oxford 1972 (dt. Eine Theorie der Gerechtigkei Frankfurt/M. 1975). - Zur Kantlnterpretation hinsichtlich der beiden Beispiele vgl. O.H., Kategorische Rechtsprinzipien, Frankfurt/M. 1990, Kap. 7-8. 26 Die Unterscheidung ist von A.K. Stout übernommen: But Suppose Everybody did the Same, in: The Australian Journal of Philosophy 32, 1954, 1-29. 27 J.J. Smart, B. Williams, Utilitarianism - For and Against, Cambridge 1973, 4f. 28 J.D. Mabhot, Moral Rules, in: Proceedings of the British Academy 39, 1953, 97-118. 29 M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Bern-München 5 1966; N. Hartmann, Ethik, Berlin 31949. [S. 7-51] 67 Otfried Höffe Immanuel Kant Beck’sche Reihe Denker 506 Verlag C.H. BECK München 5, durchgesehene Auflage. 2000 © C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München 1983 ISBN 3 406 08506 7 Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 68 Die Kritik der praktischen Vernunft Die Veränderung philosophischen Denkens, die wir Kant verdanken, erfaßt nicht nur die Welt des Erkennens, sondern auch die des Handelns. Die Sonderstellung, die beim Erkennen der Wissenschaft zukommt, gebührt beim Handeln der Moral oder Sittlichkeit; wie im Bereich des Theoretischen die Wissenschaft, so erhebt im Bereich des Praktischen die Sittlichkeit den Anspruch auf allgemeine und objektive Gültigkeit. Kants Umgestaltung der praktischen Philosophie findet deshalb als Neubegründung der Sittlichkeit (Moral) statt. Vor Kant wurde der Ursprung der Sittlichkeit in der Ordnung der Natur oder der Gemeinschaft, im Verlangen nach Glück, im Willen Gottes oder im moralischen Gefühl gesucht. Kant zeigt, daß auf diese Weise der Anspruch der Sittlichkeit auf objektive Gültigkeit nicht gedacht werden kann. Wie im Feld des Theoretischen, so wird auch im Praktischen die Objektivität nur durch das Subjekt selbst möglich; der Ursprung der Moral liegt in der Autonomie, der Selbstgesetzgebung des Willens. Da die Autonomie gleichbedeutend mit Freiheit ist, erhält der Schlüsselbegriff der Neuzeit, die Freiheit, durch Kant ein philosophisches Fundament. Kants Neubegründung der Sittlichkeit hat bis heute mehr als einen bloß geschichtlichen Wert. In der gegenwärtigen Auseinandersetzung um die Rechtfertigung sittlicher (moralischer) Normen wird Kant als systematischer Gesprächspartner in Anspruch genommen, und dies geschieht zu Recht. Denn Kant erfüllt die beiden Voraussetzungen eines anregenden Gesprächspartners. Erstens stimmt er mit jenen Minimalbedingungen überein, die die zeitgenössische normative Ethik in der Regel anerkennt. Wie die Vertreter der utilitaristischen Ethik und des Prinzips der Verallgemeinerung (Hare, Singer), wie ferner Rawls und Kohlberg, Apel, Habermas und die konstruktivistische Ethik („Erlanger Schule“), so stellt sich auch Kant in einen Gegensatz zum Relativismus, Skeptizismus und Dogmatismus in der Ethik. Auch Kant geht davon aus, daß moralisches Urteilen und Handeln nicht die Sache eines persönlichen Gefühls oder einer willkürlichen Entscheidung und auch nicht eine Frage der gesellschaftlich-kulturellen Herkunft, des Taktes oder der eingespielten Konvention sind. Vielmehr sieht er das menschliche Handeln unter letzte Verbindlichkeiten gestellt, für deren Einhalten man von anderen, aber auch von sich selbst zur Verantwortung gezogen wird. Das Handeln ist der Gegenstand einer zwar eigentümlichen, gleichwohl rationalen Argumentation. Weiterhin stellt Kant die Argumentation auf die Grundlage eines höchsten Prinzips der Moral. Die Kontroverse mit Kant beginnt erst dort, wo sich die zeitgenössische Ethik selbst nicht mehr einig ist, nämlich in der genauen Bestimmung des Moralprinzips. Und hier erfüllt Kant die zweite Voraussetzung eines anregenden Gesprächspartners. Zu der in weiten Teilen der internationalen Diskussion vorherrschenden utilitaristischen Theorie stellt seine Ethik der Autonomie und des kategorischen Imperativs das systematisch bedeutendste Gegenmodell dar, ein Gegenmodell, das nicht erst durch sein hohes Reflexionsniveau, sondern schon durch die weit elaborierte Begrifflichkeit mit ihren Unterscheidungen von Recht und Moral, von empirisch bedingtem und reinem Willen, von Legalität und Moralität, von technischen, pragmatischen und sittlichen Verbindlichkeiten, von oberstem und höchstem Gut kaum ihresgleichen kennt. So sind Kants Hauptschriften zur Ethik bis heute nicht nur eine historische Darstellung, sondern auch eine sachliche Auseinandersetzung wert. Die besondere Bedeutung Kants in der gegenwärtigen Ethik-Diskussion hat allerdings ihren Preis. Nicht bloß in jenem Kant-Verständnis, das zum allgemeinen Bildungsgut geronnen ist, sondern auch von Philosophen wird Kants Ethik oft nur bruchstückhaft rezipiert, Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 69 und selbst die Bruchstücke werden durch gravierende Mißverständnisse verzerrt. Seit Schiller und Benjamin Constant wird Kant Rigorismus vorgeworfen, seit Hegel immer wieder behauptet, im Unterschied zu Aristoteles fehle ihm ein Begriff der Praxis; Kants praktische Vernunft sei nur eine theoretische Vernunft, die sich in den Dienst praktischer Absichten stelle; überdies gründe Kants Ethik auf einer fragwürdigen Zweiweltenlehre, die die moralische Welt von der empirischen trenne, deshalb die Einheit des Handelns nicht mehr verstehen könne. Ebenfalls seit Hegel werden Kant ein bloß subjektives, zudem ungeschichtliches Sollen vorgeworfen und die „substantielle Sittlichkeit“, wiederum ein Aristotelisches Element, und die Geschichtlichkeit entgegengehalten. Max Scheler hat Kant der Gesinnungsethik geziehen und unter Berufung auf Nietzsche und Husserl jenen Vorwurf des Formalismus erhoben, der durch Nicolai Hartmann wirkungsvoll bekräftigt worden ist. Nicht zuletzt gilt Kants Pflichtethik als mitverantwortlich für „preußischen Gehorsam“. Ein Großteil dieser Vorwürfe verblaßt, sobald man sich auf Kants Argumentationsgang einläßt und in ihm eine kritische Selbstreflexion der Praxis sieht. (Andere Vorwürfe sind vielleicht eher berechtigt; sie führen jedenfalls zur Bewegung des Deutschen Idealismus.) In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und in der Kritik der praktischen Vernunft will Kant nur das offenlegen, was im Bewußtsein des moralisch Handelnden immer schon, wenn auch undeutlich, enthalten ist (GMS, IV 389, 397 u. a.). Kant führt die Selbstreflexion der moralischen Praxis mit der ihm eigenen Strenge durch, wobei er auch nach der kritischen Wende seine Gedanken weiterbildet und ihre Darstellung nicht immer zur letzten Klarheit bringt. Bei Kant stößt die moralische Selbstreflexion der Praxis auf ihr erstes Prinzip, den kategorischen Imperativ und die Autonomie des Willens. Mit der bloßen Prinzipienreflexion gibt sich aber Kant nicht zufrieden. Im Gegensatz zum Formalismus-Vorwurf sucht er in der Metaphysik der Sitten auch die Verbindlichkeiten auf, die sich mit Hilfe der Autonomie und des kategorischen Imperativs als moralisch ausweisen lassen. Dabei kommt genau das zur Sprache, was viele nur bei Aristoteles oder Hegel zu finden glauben: die substantielle Sittlichkeit. Zugleich fehlt bei Kant jene Tendenz von Hegel über Marx bis zur Kritischen Theorie, nach der die personale „Substanz“ der Sittlichkeit gegenüber der gesellschaftlichen Substanz vernachlässigt wird. Wie Aristoteles’ praktische Philosophie in die Ethik und die Politik zerfällt, so hat auch Kants Metaphysik der Sitten zwei Teile. Während die Rechtslehre die Befestigung der Sittlichkeit in den Institutionen mensch-lichen Zusammenlebens, besonders in Recht und Staat, untersucht, behandelt die Tugendlehre die Befestigung im handelnden Subjekt, in den charakterlichen Grundhaltungen, den Tugenden. Die schon zum philosophiegeschichtlichen Gemeinplatz gewordenen Gegen-überstellungen: „Aristoteles versus Kant“ und „Kant oder Hegel“, bedürfen dringend einer Korrektur. Sogar das Prinzip Glück (Eudaimonie), das seit Aristoteles die abendländische Ethik beherrscht hat, wird in Kants Ethik der Autonomie nicht rundum verworfen, sondern erhält als höchstes Gut im Rahmen der Postulatenlehre einen festen Platz. Weiterhin finden wir bei Kant ausführliche Überlegungen zur Geschichtsphilosophie, die aber ebenso wie die Postulatenlehre nicht mehr auf die Frage: „Was soll ich tun?“, sondern auf die andere: „Was darf ich hoffen?“ antworten. Eine umfassende Beurteilung der praktischen Philosophie Kants müßte auch Schriften berücksichtigen wie die Anthropologie in pragmatischer Hinsicht oder die Vorlesung über Pädagogik, in der Kant den Erziehungsprozeß als eine Art Brücke zwischen Natur und Moral, zwischen dem empirischen und dem intelligiblen Charakter des Menschen interpretiert. Selbst Lebensklugheit und Lebenskunst haben einen Platz im Kantischen Denken, doch rücken sie gemäß dem Prinzip der Autonomie vom Mittelpunkt weit weg; ihr Ort liegt seit Kant an der Peripherie der philosophischen Ethik. Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 70 Kants Neubegründung der Ethik folgt aus einer kritischen Prüfung der praktischen Vernunft. Die praktische Vernunft ist keine andere als die theoretische; es gibt nur eine Vernunft, die entweder praktisch oder theoretisch verwendet wird. Allgemein meint Vernunft das Vermögen, den Bereich der Sinne, der Natur zu übersteigen. Das Übersteigen der Sinne beim Erkennen ist der theoretische Gebrauch, beim Handeln der praktische Gebrauch der Vernunft. Mit der Trennung von theoretischem und praktischem Gebrauch der Vernunft erkennt Kant Humes Unterscheidung von beschreibenden (deskriptiven) und vorschreibenden (präskriptiven) Sätzen an. Die praktische Vernunft, wie es bei Kant kürzer heißt, bedeutet die Fähigkeit, sein Handeln unabhängig von sinnlichen Bestim-mungsgründen, den Trieben, Bedürfnissen und Leidenschaften, den Empfindungen des Angenehmen und Unangenehmen, zu wählen. Kant hebt nicht den moralischen Zeigefinger, sondern spricht nüchtern eine kognitive, keine normative Sprache. Im Gegensatz zu einem vorschnellen Moralisieren beginnt er mit einem moralneutralen Phänomen, dem Vermögen, nicht nach den vorgegebenen Gesetzen der Natur zu handeln, sondern sich selbst Gesetze, z. B. Zweck-Mittel-Beziehungen, vorzustellen, die vorgestellten Gesetze als Prinzipien anzuerkennen und ihnen gemäß zu handeln. Das Vermögen, nach der Vorstellung von Gesetzen zu handeln, heißt auch Wille, so daß die praktische Vernunft nichts anderes als das Vermögen zu wollen ist (vgl. GMS, IV 412). Der Wille ist nichts Irrationales, keine „dunkle Kraft aus der verborgenen Tiefe“, sondern etwas Rationales, die Vernunft in bezug auf das Handeln. Durch den Willen unterscheidet sich ein Vernunftwesen wie der Mensch von bloßen Naturwesen wie Tieren, die nur nach naturgegebenen, nicht auch nach vorgestellten Gesetzen handeln. Gelegentlich verstehen wir zwar den Ausdruck „Willen“ weiter und meinen jeden von innen kommenden Drang im Unterschied zu einem Zwang von außen. Dann haben auch bloße Naturwesen einen Willen, sofern sie ihren eigenen Trieben und Bedürfnissen folgen. Aber Kant versteht mit guten Gründen den Ausdruck strenger. Denn bei bloßen Naturwesen haben die Triebe und Bedürfnisse die Bedeutung von Gesetzmäßigkeiten, nach denen mit Notwendigkeit gehandelt wird. Da ihr innerer Drang ein innerer Zwang ist, haben bloße Naturwesen höchstens in einem metaphorischen Sinn einen Willen. Sie folgen zwar eigenen Handlungsimpulsen, aber trotzdem nicht einem eigenen Willen, sondern dem „Willen der Natur“. Erst die Fähigkeit, nach selbst vorgestellten Gesetzen zu handeln, begründet einen eigenen Willen. Der Wille bezeichnet die Fähigkeit, die naturwüchsigen Impulse zwar nicht auszulöschen, aber sich von ihnen zu distanzieren und sie als letzten Bestimmungsgrund zu suspendieren. Wie im Bereich des Theoretischen, so trifft Kant auch im Praktischen eine methodisch scharfe Unterscheidung zwischen einem von sinnlichen Bestimmungsgründen abhängigen und einem davon unabhängigen Willen, das heißt zwischen der empirisch bedingten und der reinen praktischen Vernunft. Während die empirisch bedingte praktische Vernunft ihre Bestimmung von außen erhält, von Trieben und Bedürfnissen, Gewohnheiten und Leidenschaften, ist die reine praktische Vernunft von allen empirischen Bedingungen unabhängig und ganz auf sich gestellt. Kant behauptet nun, „daß alle sittlichen Begriffe völlig a priori in der Vernunft ihren Sitz und Ursprung haben“ (GMS, IV 411), mithin die Sittlichkeit im strengen Sinn des Ausdrucks nur als reine praktische Vernunft verstanden werden kann. Deshalb findet im Bereich des Praktischen gegenüber dem des Theoretischen eine Umkehrung des Beweiszieles statt. Beim Erkennen weist Kant die Anmaßungen der reinen, beim Handeln die der ernpirisch bedingten Vernunft zurück; Kant verwirft den Anspruch des sittlichen Empirismus, man könne nur aufgrund empirischer Bestimmungsgründe handeln, so daß selbst die Prinzipien der Moral Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 71 von der Erfahrung abhängig wären. Des näheren stellt sich Kant in seiner Begründung der Ethik vier Grundaufgaben: Er bestimmt den Begriff der Sittlichkeit (1.), wendet ihn auf die Situation endlicher Vernunftwesen an, was zum kategorischen Imperativ führt (2.), entdeckt den Ursprung der Sittlichkeit in der Autonomie des Willens (3.) und sucht mit dem Faktum der Vernunft die Wirklichkeit der Sittlichkeit zu beweisen (4.), womit er nach dem ethischen Empirismus auch den ethischen Skeptizismus als grundsätzlich überwunden ansieht. Dazu tritt die Postulatenlehre, die schon in die Religionsphilosophie weist. 1. Sittlichkeit als Moralität Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten beginnt ohne umständliche Einleitungsworte. Gleich der erste Satz stellt die bis heute provokative Behauptung auf: ohne Einschränkung gut ist allein ein guter Wille. An dieser Behauptung ist nicht erst die ausdrückliche These von Bedeutung. Wichtig sind schon die zugrundeliegende Frage, was denn ohne Einschränkung gut sei, und die in der Frage versteckte Behauptung, „sittlich gut“ heiße „ohne Einschränkung gut“. In dieser Behauptung wird der Begriff des sittlich Guten definiert. So geht Kant in der Grundlegung nicht, wie in der Regel angenommen, von den Begriffen des guten Willens und der Pflicht aus. Er beginnt mit einer allerdings versteckten Begriffsbestimmung, also einer meta-ethischen, nicht einer normativ-ethischen Aussage. Durch sie wird der Begriff des Sittlichen bestimmt und von allen anderen Begriffen des Guten abgehoben. Eine gründliche Verteidigung oder Kritik der Kantischen Ethik muß hier ansetzen. Nach Kants Erläuterung (GMS, IV 393f.) ist das, was ohne Einschränkung gut ist, in keiner Weise relativ, sondern schlechthin oder absolut gut. Die Sittlichkeit kann deshalb nicht die funktionale (technische, strategische oder pragmatische) Tauglichkeit von Handlungen oder von Gegenständen, Zuständen, Ereignissen und Fähigkeiten für vorgegebene Absichten bezeichnen, auch nicht bloß die Übereinstimmung mit Brauch und Sitte oder den Rechtsverbindlichkeiten einer Gesellschaft. Denn in all diesen Fällen ist das Gutsein durch günstige Voraussetzungen oder Umstände bedingt. Das schlechthin Gute ist aber von seinem Begriff her ohne jede einschränkende Bedingung, also unbedingt, es ist an sich und ohne weitere Absicht gut. Der Begriff des uneingeschränkt Guten erscheint als die notwendige und zureichende Bedingung, um die Frage nach dem Guten zu vollenden. Der Begriff ist notwendig, sagt Kant, da alles eingeschränkt Gute für sich genommen doppelköpfig ist; sind die Bedingungen, insbesondere die Absichten gut, ist auch das Bedingte gut, sonst aber schlecht. Also ist das unbedingt Gute die Voraussetzung dafür, daß das bedingt Gute überhaupt gut ist. Andererseits ist der Begriff zureichend, um die Frage nach dem Guten zu vollenden, denn das uneingeschränkte Gute läßt sich grundsätzlich nicht mehr überbieten. Kants Begriff des schlechthin Guten, der an den ontologischen Begriff des allervollkommensten Wesens erinnert, ist nicht von sich aus auf bestimmte Aspekte des Handelns beschränkt. Die normative Idee eines uneingeschränkt Guten ist nicht nur für die personale, sondern auch für die institutionelle Seite menschlicher Praxis, insbesondere für Recht und Staat gültig. Weil wir bei der Praxis diese zwei Gesichtspunkte unterscheiden können, gibt es auch zwei Grundformen der Sittlichkeit, auf der einen Seite die Moralität als die Sittlichkeit einer Person, auf der anderen Seite den Vernunftbegriff von Recht, die politische Gerechtigkeit als die Sittlichkeit im Zusammenleben der Personen. Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 72 Obwohl die Idee der Sittlichkeit auch die Rechts- und Staatsordnung betrifft, bezieht sich Kant in der Grundlegung und in der Kritik der praktischen Vernunft vor allem auf die personale Seite. Durch diese Einseitigkeit leistet er dem Mißverständnis Vorschub, die Rechtslehre werde entweder von der kritischen Neubegründung der Ethik abgekoppelt oder aber von der personalen Sittlichkeit, der Moralität, her betrachtet. Die erste Interpretation fällt in die vorkritische Rechtslehre zurück, die zweite in eine philosophisch und politisch bedenkliche Moralisierung des Rechts. Die Beschränkung der Sittlichkeit auf die personale Seite der Praxis nimmt die Grundlegung von Beginn an vor. Als schlechthin gut sieht sie allein den guten Willen an, und als mögliche Konkurrenten zieht sie nur persönliche Gegebenheiten in Betracht wie Talente des Geistes, Eigenschaften des Temperaments, Glücksgaben und Charaktereigenschaften. Alle Konkurrenten, zeigt Kant, sind nicht schlechthin gut, vielmehr zweischneidig; sie lassen ebenso einen guten und wünschenswerten wie einen schädlichen und bösen Gebrauch zu. Dagegen ist es der Wille, der als guter oder schlechter darüber entscheidet, welche der beiden Richtungen der Gebrauch nimmt. Folglich sind die Alternativen nur bedingt gut, und die Bedingung für ihr Gutsein liegt im guten Willen, der seinerseits nicht aufgrund höherer Bedingungen, vielmehr an sich gut ist. Im Gegensatz zur überlieferten Moralphilosophie besteht das schlechthin Gute nicht in einem höchsten Gegenstand des Willens (vgl. KpV, V 64), etwa mit Aristoteles im Glück, sondern im guten Willen selbst. Worin der gute Wille besteht, entwickelt Kant mit Hilfe des Pflichtbegriffs. Allerdings haben „Pflicht“ und „guter Wille“ nicht denselben Begriffsumfang. Denn der gute Wille enthält den Pflichtbegriff nur unter dem Vorbehalt von „gewissen subjectiven Einschränkungen und Hindernissen“ (GMS, IV 397). Die Pflicht ist die Sittlichkeit in der Form des Gebots, der Aufforderung, des Imperativs. Diese imperativische Form macht nur für jene Subjekte einen Sinn, deren Wille nicht von vornherein und mit Notwendigkeit gut ist. Sie ist gegenstandslos bei reinen Vernunftwesen, deren Wille wie bei Gott von Natur aus stets und ausschließlich gut ist (vgl. KpV, V 72, 82). Von Pflicht kann man nur dort reden, wo es neben einem vernünftigen Begehren noch konkurrierende Antriebe der naturwüchsigen Neigungen, wo es neben dem guten noch ein schlechtes oder böses Wollen gibt. Dieser Umstand trifft für jedes Vernunftwesen zu, das auch von sinnlichen Bestimmungsgründen abhängig ist. Ein solches nichtreines oder endliches Vernunftwesen ist der Mensch. Soweit Kant die Sittlichkeit mit Hilfe des Pflichtbegriffs erläutert, verfolgt er das Interesse, den Menschen als moralisches Wesen zu begreifen. Nun gibt es drei Möglichkeiten, die sittliche Pflicht zu erfüllen. Erstens kann man die Pflicht befolgen und doch letztlich vom Selbstinteresse bestimmt sein; das trifft für den Geschäftsmann zu, der aus Angst, seine Kunden zu verlieren, auch unerfahrene Käufer ehrlich bedient. Zweitens kann man pflichtgemäß und zugleich mit einer unmittelbaren Neigung zur Pflicht handeln, beispielsweise einem Notleidenden aus Sympathie helfen. Schließlich kann man die Pflicht rein „aus Pflicht“ anerkennen. Der gute Wille liegt nicht schon dort vor, wo man die sittliche Pflicht aufgrund irgendwelcher Bestimmungsgründe tut; die Sittlichkeit einer Person besteht nicht in bloßer Pflichtgemäßheit, die Kant Legalität nennt. Denn die bloße Pflichtgemäßheit (sittliche Richtigkeit) einer Handlung hängt von den Bestimmungsgründen ab, aus denen man die Pflicht befolgt, ist also bedingt, nicht unbedingt gut. Das (metaethische) Kriterium der Sittlichkeit, das uneingeschränkte Gutsein, wird erst dort erfüllt, wo das sittlich Richtige aus keinem anderen Grund ausgeführt wird, als weil es sittlich richtig ist, dort also, wo die Pflicht selbst gewollt ist und als solche erfüllt wird. Nur in diesen Fällen spricht Kant von Moralität. Da die Moralität nicht in der bloßen Übereinstimmung mit der Pflicht besteht, darf sie Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 73 nicht auf der Ebene des beobachtbaren Verhaltens oder ihrer Regeln angesiedelt werden. Im Unterschied zur Legalität kann die Moralität nicht an der Handlung selbst, sondern nur an ihrem Bestimmungsgrund, dem Wollen, festgestellt werden. Trotzdem versuchen viele Philosophen, die Sittlichkeit bloß in Begriffen von Normen, Werten oder von Verfahrensvorschriften zur Konfliktlösung zu begreifen. Dies gilt für die Wertethik, den Utilitarismus und das zeitgenössische Prinzip der Verallgemeinerung, es trifft für die Kommunikationsethiken von Apel, Habermas, der Erlanger Schule und vor allem für verhaltenstheoretische und soziologische Ethikbegründungen zu. Doch können all diese Versuche keine Moraltheorien als Theorien des schlechthin Guten in bezug auf das handelnde Subjekt sein. Sie führen bestenfalls zum sittlich Richtigen, nicht zum sittlich Guten; sie begründen Legalität, nicht Moralität. Zur Kritik Kants und indirekten Rechtfertigung der eigenen Theorie wird gern eingewandt, eine Ethik der Moralität und des guten Willens verkürze die Sittlichkeit auf die reine Subjektivität der guten Gesinnung. In diesem Vorwurf der „Gesinnungsethik“ steckt eine doppelte Kritik. Erstens, so wird behauptet, begünstige Kant eine Welt tatenloser Innerlichkeit, die gegen jede Verwirklichung, den Erfolg in der realen Welt, gleichgültig sei und - so Marx in der Deutschen Ideologie (Teil III, 1,6) - „vollständig der Ohnmacht, Gedrücktheit und Misere der deutschen Bürger“ entspreche. Zweitens soll allzuleicht jedes Tun und Lassen als gut und richtig gelten; im Sinne des oft kritisierten, aber wohl fehlgedeuteten Augustinus-Wortes „dilige et quod vis fac“ (liebe und tu’, was du willst) berufe sich die Gesinnung nur auf das gute Gewissen und entbehre jedes objektiven Maßstabes. So beliebt der Einwand der Gesinnungsethik sein mag - ihm liegt ein Mißverständnis der Kantischen Ethik zugrunde. Nach Kant besteht das Wollen nicht etwa in einem bloßen Wunsch, sondern in der Aufbietung aller Mittel - soweit sie in unserer Gewalt sind (GMS, IV 394). Der Wille ist keineswegs gleichgültig gegen seine Äußerung in der gesellschaftlichen und politischen Welt; er ist kein Jenseits zur Wirklichkeit, vielmehr ihr letzter Bestimmungsgrund - soweit der Grund im Subjekt selbst liegt. Gewiß kann die Äußerung des Willens wegen körperlicher, geistiger, wirtschaftlicher und anderer Mängel hinter dem Gewollten zurückbleiben; zum Beispiel mag eine Hilfeleistung unverschuldet zu spät oder zu schwach kommen. Doch kann der Mensch dieser Gefahr nie entgehen. Sein Tun und Lassen spielt sich in einem Kräftefeld ab, das von natürlichen und gesellschaftlichen Bedingungen abhängt und nicht durch den Willen des Handelnden allein bestimmt, von ihm nicht einmal voll überschaut wird. Weil sich die Sittlichkeit nur auf den Verantwortungsraum des Subjekts, auf das ihm Mögliche, bezieht, kann das nackte Resultat, der objektiv beobachtbare Erfolg, kein Gradmesser der Moralität sein. Die personale Sittlichkeit läßt sich nicht an der Handlung als solcher, sondern nur am zugrundeliegenden Willen ausmachen. Eine zur „bloßen Gesinnungsethik“ alternative Moralphilosophie, die im tatsächlichen Erfolg den entscheidenden Maßstab sieht, betrachtet den Menschen für Bedingungen als vollverantwortlich, die er gar nicht voll verantworten kann. In Verkennung der Grundsituation des Menschen bringt sie keine Verbesserung, sondern ist dort, wo sie konsequent angewandt wird, in einem fundamentalen Sinn inhuman. Andererseits übersieht die Kritik, daß für Kant die Legalität keine Alternative zur Moralität, vielmehr ihre notwendige Bedingung ist. Im Gegensatz zu Max Schelers Gegenüberstellung von Gesinnungs- und Erfolgsethik (Scheler, Teil I, Kap. III) und zu Max Webers Trennung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik (Gesammelte politische Schriften, 3551 ff.) geht es Kant bei der Unterscheidung von Moralität und Legalität nicht um zwei sich gegenseitig ausschließende Grundeinstellungen. Die Moralität steht nicht in Konkurrenz zur Legalität, enthält vielmehr eine Verschärfung der Bedingungen. Im moralischen Handeln wird erstens Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 74 das sittlich Richtige getan, die Pflicht erfüllt und zweitens die Pflichterfüllung zum Bestimmungsgrund gemacht. So fällt die Moralität nicht hinter die Legalität zurück, bringt vielmehr eine Steigerung und Überbietung. Schließlich stellt Kant für die Moralität ein objektives Kriterium auf, den kategorischen Imperativ, mehr noch: die strenge Objektivität ist selbst das Kriterium. Mithin läßt sich bei Kant der Vorwurf einer maßstabslosen Innerlichkeit des rein persönlichen Gewissens nicht halten. 2. Der kategorische Imperativ Der kategorische Imperativ gehört zu den bekanntesten, aber auch gründlich verfälschten Elementen im Denken Kants. Selbst in der philosophischen Diskussion wird er nicht selten bis zur Karikatur entstellt. So behauptet Frankena (Analytische Ethik, ²1975, 52), Maximen wie: sein linkes Schuhband zuerst zuzubinden oder im Dunkeln zu pfeifen, wenn man allein ist, seien nach dem kategorischen Imperativ eine sittliche Pflicht. Andere betrachten den kategorischen Imperativ als Test für die Pflichtgemäßheit, also Legalität, nicht Moralität des Handelns. Wieder andere werfen Kant eine souveräne Nichtachtung aller Folgen pflichtmäßigen Handeln für das Glück der Beteiligten, also eine Gleichgültigkeit gegen das Wohl der Menschen vor. Schließlich hält man den kategorischen Imperativ nicht als reines Vernunftgebot, sondern nur als empirisch-pragmatisches Prinzip für überzeugend (Hoerster). Der Begriff des kategorischen Imperativs Mit dem kategorischen Imperativ stellt Kant ein höchstes Beurteilungskriterium für die Moralität und, bei entsprechender Umformulierung, für die gesamte Sittlichkeit auf. Über der Maßstabsfunktion darf man aber nicht übersehen, daß der kategorische Imperativ kein sittlich neutrales Angebot macht. Er zeigt nicht unparteiisch, worin die sittlichen Verbindlichkeiten bestehen, um es dem Handelnden großzügig zu überlassen, ob er solche Verbindlichkeiten anerkennen will oder lieber nicht. Als Imperativ ist er ein Sollen; er fordert uns auf, in einer bestimmten Weise zu handeln; und diese Aufforderung, das besagt der Zusatz des Kategorischen, ist die einzige, die ohne jede Einschränkung gültig ist. Die Formel des kategorischen Imperativs beginnt deshalb mit einem bedingungslosen „handle ...!“. Nur in zweiter Linie sagt der kategorische Imperativ, worin das sittliche Handeln liegt, nämlich in verallgemeinerungfähigen Maximen. An erster Stelle fordert er uns auf, überhaupt sittlich zu handeln. In seiner kürzesten Form könnte er deshalb heißen: „Handle sittlich!“ Der kategorische Imperativ folgt unmittelbar aus dem Begriff der Sittlichkeit als des schlechthin Guten, deshalb „kategorisch“ - bezogen auf endliche Vernunftwesen, deshalb „Imperativ“. Genauer - und darin liegt die unhintergehbare Einsicht Kants - ist der kategorische Imperativ nichts anderes als der Begriff der Sittlichkeit unter den Bedingungen endlicher Vernunftwesen. Im kategorischen Imperativ wendet Kant seine metaethische Grundthese auf Wesen vom Typ des Menschen an. Da bedürftige Vernunftwesen wie die Menschen nicht von allein und notwendigerweise sittlich handeln, nimmt die Sittlichkeit für sie den Charakter eines Sollens, nicht eines Seins, an. Unbeschadet der Möglichkeit, sich sekundär zu Charakterhaltungen und einer normativen Lebenswelt zu befestigen, hat die Sittlichkeit primär einen Imperativ-Charakter. Das beweist die auch von Aristoteles und Hegel nicht zu leugnende Tatsache, daß nicht jeder Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 75 Charakter und jede institutionelle Lebenswelt unbesehen sittlich sind. Freilich darf man den Imperativ-Charakter nicht zu eng verstehen und auf ausdrückliche Gebote und Verbote festlegen. Der Imperativ-Charakter kann sich auch verstecken, wie beispielsweise bei den biblischen Gleichnissen, wo er allenfalls im Zusatz erscheint: „Geh hin und tu’ desgleichen!“. Auch dort, wo die Ethik bewußt auf Gebote und Verbote verzichtet und ohne jeden moralischen Zeigefinger Beispiele und Vorbilder entwickelt oder - wie in der hermeneutischen Ethik - auf die in unserer Welt schon verwirklichte sittliche Substanz aufmerksam macht, geht es doch um Verhaltensweisen und Lebensformen, die als die sittlich richtigen gelten, ohne daß sie die Bedeutung von Naturgesetzen haben, die ausnahmslos und notwendigerweise anerkannt werden. Überdies meint Kant, wenn er von Sollen oder Imperativ spricht, mehr als irgendeine Aufforderung. Den willkürlichen Befehl einer überlegenen Macht schließt er von vornherein aus. Die Aufforderungen, ein Fenster zu schließen oder nicht mehr zu rauchen, sind im Sinne Kants nur dann Imperative, wenn im Hintergrund ein Zweck steht, etwa die Gesund-heit, der die geforderte Handlung als geboten oder verboten erscheinen läßt. Auf die praktische Grundfrage des Menschen: „Was soll ich tun?“ antworten Imperative nicht mit einem äußeren oder inneren Zwang, sondern mit Gründen der Vernunft, freilich mit Gründen, die der Handelnde nicht notwendig anerkennt (GMS, IV 413). Selbst nichtsittliche Imperative sind praktische Notwendigkeiten, d. h. Verbindlichkeiten des Handelns, die für jedermann gelten und sich vom Angenehmen unterscheiden, das sich bloß subjektiven Empfindungen verdankt (ebd.). Kant zeigt, daß die Grundfrage, was ich tun soll, in dreierlei Weise verstanden werden kann. Daher gibt es drei verschiedene Klassen von Antworten, die ebensoviele Klassen von Vernunftgründen enthalten. Die heute gesuchte Lehre praktischen Argumentierens ist nach Kant dreiteilig. Die drei Teile (Klassen) stehen nicht nebeneinander, sondern bauen aufeinander auf. Sie bedeuten drei Stufen der praktischen Vernunft; man könnte auch sagen: der Rationalität des Handelns. Und zwar unterscheiden sich die drei Vernunft- oder Rationalitätsstufen nicht durch die Strenge, sondern durch die Reichweite der Vernunft. Die strenge Notwendigkeit, die aller Vernunft zukommt, ist im Fall der beiden ersten Stufen, den hypothetischen Imperativen, in eine nichtnotwendige Voraussetzung eingebunden. Auf der dritten Stufe, dem kategorischen oder moralischen Imperativ, sind alle einschränkenden Voraussetzungen ausgeschlossen. Der kategorische Imperativ bzw. die Moralität sind nichts Irrationales. Im Gegenteil findet die Idee der praktischen Vernunft oder Rationalität des Handelns hier ihre grundsätzliche Vollendung. Die erste Stufe, die technischen Imperative der Geschicklichkeit, gebieten die notwendigen Mittel zu einer beliebigen Absicht; wer beispielsweise reich werden will, muß sich um weit mehr Einnahmen als Ausgaben bemühen. Die zweite Stufe, die pragmatischen Imperative der Klugheit, schreiben Handlungen vor, die die tatsächliche Absicht bedürftiger Vernunftwesen, das Glück, befördern; hierunter fallen Diätvorschriften, die der Gesundheit dienen. Den beiden ersten Rationalitätsstufen ist gemeinsam, daß ihre objektive Verbindlichkeit zwar uneingeschränkt gegeben, die entsprechende Handlung aber nur unter dem Vorbehalt subjektiver Absichten geboten ist. Zwar muß jeder, der reich werden möchte, mehr Einnahmen als Ausgaben suchen. Aber daraus folgt noch lange nicht, daß man auf mehr Einnahmen achten soll. Dieses Gebot besteht erst, wenn man sich tatsächlich vornimmt, reich zu werden; dieser Vorsatz ist aber nicht notwendig. Die beiden ersten Stufen sind hypothetische Imperative, deren Gültigkeit unter einer einschränkenden Voraussetzung steht: „Wenn ich x möchte, dann muß ich y tun“. Dabei ist der hypothetische Charakter von der grammatischen Form unabhängig. Der kategorische Befehl: Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 76 „Rauche nicht zu viel!“ ist doch ein hypothetischer Imperativ, weil vom Interesse an der Gesundheit bedingt, während der hypothetische Satz „Wenn Du jemanden in Not siehst, so hilf ihm!“ einen kategorischen Imperativ enthält; denn der Vordersatz („Wenn ... siehst“) schränkt die Gültigkeit des Hilfsgebots nicht ein, sondern beschreibt nur die Situation, in der das Gebot zum Tragen kommt. Dem Kriterium des uneingeschränkten Guten folgend, sind sittliche Verbindlichkeiten ohne jeden Vorbehalt gültig; sie bilden die dritte und nicht mehr überbietbare Rationalitätsstufe einer voraussetzungslosen, eben kategorischen Verbindlichkeit. Weil ein Imperativ dieser Stufe ohne jede Einschränkung verpflichtet, gilt er schlechthin allgemein: ausnahmslos und notwendig. Daher kann die strenge Allgemeinheit als Erkennungszeichen und Maßstab der Sittlichkeit gelten. Der aus der Aristoteles- und Hegel-Tradition kommende Vorwurf, Kant habe keinen Begriff von Praxis, läßt sich hier entkräften. Zwar verwendet Kant den Ausdruck „Praxis“ nur sparsam; er hat aber trotzdem eine differenzierte Vorstellung der Sache. Außer der Strukturanalyse der Handlung mit Hilfe des Willensbegriffs und der Unterscheidung von personaler und politischer Praxis (Tugend und Recht) und innerhalb der personalen Praxis von Legalität und Moralität verstecken sich in Kants Ethik drei Grundformen der Praxis: sie entsprechen den drei Formen der Imperative. Während das technische Handeln beliebigen Zwecken und das pragmatische Handeln dem natürlichen Verlangen nach Glück dient, erhebt sich das sittliche Handeln über alle Funktionalisierung hinaus. Die bisher entwickelten Elemente definieren zwar den kategorischen Imperativ; die objektive Verbindlichkeit und ihre nichtnotwendige Befolgung entsprechen dem Imperativ, und die strenge Allgemeinheit beweist seinen kategorischen Charakter. Trotzdem führen sie noch nicht zu Kants genauer Formulierung in der Grundlegung. Dazu fehlt noch die Einschränkung der Grundlegung auf den Bereich der personalen im Unterschied zur politischen Praxis. Das dazu fehlende Moment steckt im Begriff der Maxime, so daß der kategorische Imperativ in seiner Grundform lautet: „handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde.“ (GMS, IV 421). Neben der Grundform kennt Kant „drei Arten, das Princip der Sittlichkeit vorzustellen“ (IV 436); sie betreffen die Form, die Materie und die vollständige Bestimmung der Maximen. Da das Dasein der Dinge nach allgemeinen Gesetzen den formalen Begriff der Natur ausmacht, lautet der kategorische Imperativ auch: „handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.“ (IV 421) Die zweite, „materiale“ Vorstellungsart geht von der vernünftigen Natur als Zweck an sich selbst aus: „Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.“ (IV 429) Nach der dritten, vollständigen Vorstellung sollen „alle Maximen aus eigener Gesetzgebung zu einem möglichen Reiche der Zwecke, als einem Reiche der Natur, zusammenstimmen“ (IV 436). Der kategorische Imperativ ist als Maßstab der Sittlichkeit nicht unangefochten. Im englischen Sprachraum ist seit Jeremy Bentham (1748-1832) und John Stuart Mill (1806-1873) der Utilitarismus die einflußreichste ethische Position; in Deutschland wird in jüngster Zeit der Diskurs als Moralkriterium verfochten. Beide, der Utilitarismus und die Diskursethik, setzen jedoch voraus, daß das gesuchte Moralkriterium nicht nur unter einschränkenden Bedingungen, sondern grundsätzlich verbindlich ist. Damit liegt ihnen der kategorische Imperativ als Begriff und letzter Maßstab, mithin als das eigentliche Moralkriterium zugrunde. So abstrakt der kategorische Imperativ klingen mag - er bedeutet die Höchstform aller Verbindlichkeit, die Vollendungsstufe der praktischen Rationalität. Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 77 Maximen Der kategorische Imperativ bezieht sich nicht auf beliebige, etwa auch moralisch belanglose Regeln, sondern allein auf Maximen. Unter Maximen versteht Kant subjektive Grundsätze des Handelns (schon KrV, B 840), die eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten und mehrere praktische Regeln unter sich haben (KpV, § 1; vgl. GMS, IV 420f.). (1) Als subjektive Grundsätze sind sie von Individuum zu Individuum verschieden. (2) Als Willensbestimmungen bezeichnen sie nicht Ordnungsschemata, die ein objektiver Beobachter dem Handelnden unterstellt; es sind Prinzipien, die der Akteur selbst als die eigenen anerkennt. (3) Als Grundsätze, die mehrere Regeln unter sich haben, beinhalten Maximen die Art und Weise, wie man sein Leben als ganzes führt - bezogen auf bestimmte Grundaspekte des Lebens und Zusammenlebens, wie etwa Hilfsbedürftigkeit, Lebensüberdruß oder Beleidigungen. Durch den Bezug auf gewisse Lebensbereiche und Situationstypen unterscheiden sich Maximen von einer noch höheren Allgemeinheitsstufe, den Lebens-formen (bioi) des Aristoteles oder den Existenzweisen von Kierkegaard. Maximen sind Grundhaltungen, die einer Vielzahl, auch Vielfalt konkreter Absichten und Handlungen ihre gemeinsame Richtung geben. Einer Maxime folgt, wer nach dem Vorsatz lebt, rücksichtsvoll oder aber rücksichtslos zu sein, auf Beleidigungen rachsüchtig oder großmütig zu antworten, sich in Notsituationen hilfsbereit oder aber gleichgültig zu verhalten. Die Maximen stellen für einen ganzen Lebensbereich, etwa für alle Arten von Notsituationen, das leitende Beurteilungsprinzip auf, die Hilfsbereitschaft oder Gleichgültigkeit. In den Handlungsregeln, die unter eine Maxime fallen, wird dagegen das Beurteilungsprinzip mit regelmäßig wiederkehrenden Situationsarten innerhalb des allgemeinen Lebensbereichs vermittelt. Solche praktischen Regeln, etwa bei liegengebliebenen Fahrzeugen anzuhalten, haben es mit den wechselnden Bedingungen des Lebens zu tun. Je nach der Situation und den Fähigkeiten des Handelnden fallen die praktischen Regeln verschieden aus, auch wenn sie derselben Maxime folgen; so wird der hilfsbereite Nichtschwimmer einem Ertrinkenden anders helfen als der geübte Schwimmer. Trotz gleichbleibender Beurteilungsprinzipien muß es deshalb unterschiedliche Regeln (Normen) der Hilfsbereitschaft oder der Gleichgültigkeit, der Rücksichtslosigkeit oder der Rücksichtnahme, der Rache oder der Großmut geben. Deshalb ist nicht die weit verbreitete Regel- oder Normenethik, vielmehr eine Maximenethik die angemessene Form der Moralphilosophie. Da sich Kant im Rahmen der praktischen Vernunftkritik mehr für die Zurückweisung des ethischen Empirismus und Skeptizismus interessiert, hat er die Bedeutung einer Maximenethik leider nicht selbst herausgestellt und hinreichend geklärt. Eine nähere Überlegung zeigt jedoch ihre vierfache Überlegenheit über eine Regel- oder Normenethik. 1. Weil die allgemeinen Willensgrundsätze von den wechselnden Umständen des Handelns absehen, wird mit den Maximen aus der konkreten Handlung das normative Grundmuster herauspräpariert. Damit wird der normative Bestimmungsgrund als solcher ohne die Ablenkung durch die wechselnden Situationsfaktoren erkennbar. Man sieht, wieso menschliches Handeln verschieden sein und doch eine gemeinsame Qualität, die des Sittlichen oder des Nichtsittlichen, haben kann, ohne einem ethischen Relativismus auf der einen oder einem starren Regeldogmatismus auf der anderen Seite das Wort zu reden. Die Maxime bedeutet genau jenes Einheitsmoment, das gegen den Relativismus spricht, und die Notwendigkeit, die Maxime mit den Besonderheiten der jeweiligen Situation zu vermitteln, das andere Moment, das sich gegen einen Normendogmatismus wendet. Die Maximen geben nur den allgemeinen Grundriß an; zur konkreten Handlung ist darüber hinaus eine „Kontextualisierung“, sind produktive Interpretations- und Beurteilungsprozesse erforderlich. Es ist Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 78 die sittlich-praktische Urteilskraft, die diese Beurteilung nach Maßgabe der Maximen vornimmt. 2. Da es sich bei den Maximen um allgemeine Lebensgrundsätze handelt, wird durch sie die Biographie eines Menschen nicht in eine bald unübersehbare Mannigfaltigkeit von Regeln, noch weniger in unendlich viele Einzelhandlungen aufgesplittert. Durch Maximen werden die Teile eines Lebens zu einheitlichen Sinnzusammenhängen verbunden, Sinnzusammenhängen, bei denen der kategorische Imperativ prüft, ob sie moralisch sind oder nicht. Während das „Einimpfen“ praktischer Regeln die Erziehung in die Nähe einer Dressur rückt, ermöglicht die Ausrichtung an normativen Leitprinzipien, eben Maximen, eine vernünftige Selbstbestimmung mit dem notwendigen Freiraum für Unterschiede in Temperament, Fähigkeiten, in gesellschaftlich-kulturellen Randbedingungen sowie den Situationen, in denen man sich vorfindet. 3. Weil die Maximen von den wechselnden Randbedingungen der Person und der Gesellschaft absehen, kommt in ihnen der Charakter eines Menschen zum Ausdruck. Nicht die Normen im Sinne konkreter Handlungsregeln, sondern erst die Maximen sind jene Lebensgrundsätze, nach denen man die moralische Beurteilung eines Menschen (im Unterschied zu seiner körperlichen, geistigen, seelischen Beurteilung) vornehmen kann, um ihn als rachsüchtig oder aber als großmütig, als rücksichtslos oder aber als rücksichtsvoll, als eigensüchtig, rechtschaffen usw. zu qualifizieren. Deshalb sind weit mehr die Maximen als die Normen der angemessene Gegenstand für Fragen der moralischen Identität und, damit zusammenhängend, für Fragen der moralischen Erziehung und Beurteilung von Menschen. 4. Für die Maximenethik spricht schließlich der Umstand, daß erst sie fähig ist, für die Sittlichkeit als Moralität den höchsten Maßstab abzugeben. Denn nur dort, wo man die letzten selbstgesetzten Grundsätze prüft, läßt sich feststellen, ob das Handeln bloß pflichtgemäß, also legal, oder aus Pflicht, also moralisch, geschieht. Verallgemeinerung Die Allgemeinheit, die in jeder Maxime steckt, ist eine subjektive (relative) Allgemeinheit, nicht die objektive (absolute oder strenge) Allgemeinheit, die schlechthin für jedes Vernunftwesen Gültigkeit hat. Der zweite Gesichtspunkt im kategorischen Imperativ, die Verallgemeinerung, prüft, ob der in einer Maxime gesetzte subjektive Lebenshorizont auch als objektiver Lebenshorizont, als vernünftige Einheit einer Gemeinschaft von Personen, gedacht und gewollt werden kann. Aus der bunten Vielfalt subjektiver Grundsätze (Maximen) werden die moralischen von den nichtmoralischen ausgesondert, und der Handelnde ist aufgefordert, nur den moralischen Maximen zu folgen. Nach einem beliebten Vorwurf soll Kants Ethik gegen das tatsächliche Wohlergehen konkreter Menschen gleichgültig und deshalb dem Utilitarismus unterlegen sein, der die Sittlichkeit in Begriffen allgemeinen Wohlergehens definiert. Auf den ersten Blick erscheint der Vorwurf nur allzu berechtigt. Denn Kants Gedankenexperiment der Verallgemeinerung schließt Folgenüberlegungen und deren Beurteilung im Licht des Wohlergehens nachdrücklich aus. Trotzdem erweist sich der Vorwurf bei näherer Betrachtung als unberechtigt. Ausgeschlossen sind die Folgenüberlegungen aus der Begründung, nicht aber aus der Anwendung sittlicher Maximen auf konkretes Handeln; hier sind sie nicht nur erlaubt, sondern meist unabdingbar. Nicht im Gegensatz, sondern ganz in Übereinstimmung mit dem Utilitarismus hält Kant die Beförderung des Wohlergehens anderer für sittlich geboten; und die Befolgung des Gebots setzt voraus, daß man sich im Licht des Wohlergehens der Mitmen- Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 79 schen die Konsequenzen seines Tuns und Lassens genau überlegt. Während aber der Utilitarismus das Leitprinzip für die Folgenüberlegungen, das Wohlergehen anderer, nicht mehr philosophisch begründet, stellt Kant dafür den kategorischen Imperativ mit dem rationalen Test der Verallgemeinerung bereit. Darüber hinaus hält Kant das Wohlergehen anderer nicht für die einzige Pflicht. Schließlich behandelt Kant eine Frage, die der Utilitarismus nicht aufwirft, nämlich unter welchen apriorischen Bedingungen ein Subjekt überhaupt zur Sittlichkeit fähig ist. Die Antwort liegt in der Autonomie des Willens. So erscheint die utilitaristische Ethik von Kant her gesehen nicht einfach als falsch, doch als sittlich und philosophisch ergänzungsbedürftig, weniger als Gegenmodell zu Kant, eher als nicht hinreichend gründliche, als zu kurz greifende ethische Reflexion. Beispiele In der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten führt Kant das Verfahren der Verallgemeinerung anhand von vier Beispielen vor. Obwohl es sich nur um Beispiele handelt, kommen doch die beiden Hauptgesichtspunkte von Kants System aller moralischen Verpflichtungen zur Sprache. Erstens kennt Kant nicht nur Verbindlichkeiten gegen andere, sondern auch gegen sich selbst. Die Moral läßt sich nicht auf eine Sozialmoral verkürzen, die Gesamtheit der Tugenden nicht in einer einzigen Tugend, der (personalen) Gerechtigkeit zusammenfassen. Damit kritisiert Kant Aristoteles, stimmt dagegen mit stoischen und christlichen Vorstel-lungen überein. Als Prinzip aller Verbindlichkeiten gegen sich selbst nennt Kant die eigene Vollkommenheit: die Kultur der intellektuellen, emotionalen und physischen Fähigkeit sowie die Kultur der Moralität (TL, VI 386f.), als Prinzip der Sozialverpflichtungen die fremde Glückseligkeit (VI 387 f). Zweitens folgt Kant der Tradition und unterscheidet die „vollkommenen“ Pflichten, die keinen Spielraum, von den „unvollkommenen“ Pflichten, die einen gewissen Spielraum des Verhaltens lassen. Freilich schränkt der Spielraum nicht die Gültigkeit der Pflicht, etwa der allgemeinen Nächstenliebe, ein. Er läßt nur zu, angesichts begrenzter Möglichkeiten einen Anwendungsbereich zugunsten eines anderen, etwa der Eltern oder Kinder, zu relativieren. Die Verbindung beider Einteilungen ergibt insgesamt vier Klassen von Pflichten, zu denen Kant in der Grundlegung jeweils ein negatives Beispiel, das Beispiel einer nicht verallgemeinerungsfähigen Maxime, diskutiert (IV 397 ff., 421 ff., 429ff.). Moralische Pflichten vollkommene unvollkommene Pflichten Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft Pflichten gegen sich selbst Selbstmordverbot Pflichten gegen andere Verbot des falschen Versprechens 80 Verbot der Nichtentwicklung eigener Fähigkeiten Verbot der Gleichgültigkeit gegen fremde Not Die Prüfung der Verallgemeinerbarkeit hat zwei Formen. Die erste und strengere Form betrifft die vollkommenen Pflichten und überlegt, ob sich eine Maxime als allgemeines Gesetz widerspruchsfrei denken läßt. Auf einen Widerspruch stößt man nach Kant beispielsweise, wenn man die Maxime, sich aus Lebensüberdruß zu töten, zu einem allgemeinen Gesetz macht. Kant geht davon aus, daß die Unlustempfindungen für das Leben (im biologischen Sinn) die Bestimmung haben, „zur Beförderung des Lebens anzutreiben“ (GMS, IV 422). Die Unlustempfindungen zeigen nämlich einen Mangel an, als Hunger etwa einen Energiemangel, und treiben zur Überwindung des Mangels an, hier: zum Essen. Nun ist der Lebensüberdruß eine Form von Unlustempfindung. Dann aber hat der Selbstmord aus Lebensüberdruß, sofern er als allgemeines Gesetz gedacht wird, zur Folge, daß dieselbe Empfindung für zwei widersprüchliche Aufgaben bestimmt ist, für die Beförderung und die Zerstörung des Lebens (ebd.). Die zweite und schwächere Form des Gedankenexperiments der Verallgemeinerung prüft, ob man die Maxime als allgemeines Gesetz widerspruchslos wollen kann. Das genaue Verständnis dieses Kriteriums „Nichtwollenkönnen“ bereitet keine geringen Schwierigkeiten. Macht Kant, wie Wolff und Hoerster behaupten, die dogmatische Voraussetzung, gewisse menschliche Zwecke, beispielsweise die Kultur: die Entwicklung von Anlagen und Talenten, seien naturnotwendig? Denkt Kant an einen Widerspruch von der Art: „niemand kann wollen, etwas gegen seinen Willen zu tun“? Wer Kant ernst nimmt, muß den Widerspruch in seinem Begriff des Willens und, dem gleichbedeutend, der praktischen Vernunft suchen. Nach Kant besteht der Wille oder die praktische Vernunft in der Fähigkeit, nicht nach Gesetzen, sondern nach der Vorstellung von Gesetzen, das heißt nach objektiven Vernunftgründen zu handeln. Ob die Vernunftgründe technischer, pragmatischer oder kategorischer Natur sind, bleibt sich gleich. In jedem Fall hat man die Fähigkeit, nach Vernunftgründen zu handeln, nur dann, wenn man sich nicht auf die subjektiven Empfindungen des Angenehmen festlegt. Genau dies ist aber in Kants erstem Beispiel des Nichtwollenkönnens, der Kulturunwilligkeit, der Fall. Zwar läßt sich eine Welt wider-spruchslos denken, in der das menschliche Leben „bloß auf Müßiggang, Ergötzlichkeit, Fortpflanzung, mit einem Wort auf Genuß“ abgestellt ist (GMS, IV 423). Aber als Vernunft-wesen kann man ein solches Leben nicht wollen; denn ein praktisches Vernunftwesen sein oder einen Willen haben heißt, die bloß subjektive Welt des Angenehmen als letzten Bestimmungsgrund des Handelns überschreiten. Die im kategorischen Imperativ geforderte Verallgemeinerung darf man nicht mit zeitgenössischen Prinzipien der Verallgemeinerung verwechseln, wie sie etwa von Hare und anders von Singer vertreten werden. Denn zum einen wird das zeitgenössische Prinzip direkt auf Handlungen bezogen, so daß der Sinn einer Maximenethik verlorengeht. Zum anderen sind Folgeüberlegungen nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten. Der Unterschied zwischen der empirisch-sozialpragmatischen Interpretation der Verallgemeinerung bei Singer und der rein Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 81 rationalen Überlegung des kategorischen Imperativs läßt sich am Beispiel des falschen Versprechens erläutern. Dabei kommt es Kant nicht, wie häufig unterstellt, darauf an, daß ein Versprechen unter allen Umständen eingehalten werden muß. Weder ist ein Kind unsittlich, wenn es, ohne zu wissen, etwas verspricht, das seine Mittel und Fähigkeiten übersteigt, noch ein Erwachsener, der sein Versprechen aufgrund höherer Gewalt brechen muß. Es geht bei Kant nicht um den objektiv beobachtbaren Ereignisablauf, daß ein Versprechen erst gegeben und dann gehalten oder gebrochen wird, sondern um einen subjektiven Grundsatz der Willensbestimmung, die Ehrlichkeit, nämlich um die Frage, ob jemand, der sich in Not befindet, ein Versprechen abgeben darf, das er bewußt nicht halten will (GMS, IV 402, 422). Das falsche Versprechen wird ebenso wie das berühmte Beispiel der Unterschlagung eines Depositums (KpV, V 27) als ein Fall von Lüge und Betrug untersucht. Nach der empirisch-sozialpragmatischen Interpretation ist das Versprechen eine sozial verbindliche Handlungsregel, eine Institution. Solche Institutionen definieren Vorteile und Verpflichtungen, sie schaffen Erwartungen und ermöglichen eine Abstimmung des eigenen Handels mit dem anderer, folglich ein geregeltes Zusammenleben. Das Brechen von Versprechen, so sagt man, untergräbt die Glaubwürdigkeit der Institution, und im Fall, daß jeder sein Versprechen bricht, gibt es keinen mehr, der einem Versprechen traut. So sterben bei einer Verallgemeinerung des Nichteinhaltens von Versprechen die Institution des Versprechens und mit ihr eine Möglichkeit zum vernünftigen Miteinanderleben dahin. Diese Überlegung ist richtig, trifft aber nicht das genaue Problem. Denn empirischpragmatisch betrachtet ist es gleichgültig, woher der allgemeine Vertrauensschwund kommt: ob aus fehlender Aufrichtigkeit oder daher, daß man aufgrund unvorhergesehener Schwierigkeiten ein Versprechen trotz bester Absicht oft nicht halten kann. Während der zweite Grund nicht moralisch verwerflich ist, interessiert sich der kategorische Imperativ allein für den moralischen Gesichtspunkt, für die dem falschen Versprechen zugrundeliegende Maxime der Unehrlichkeit. In der pragmatischen Interpretation taucht kein logischer Widerspruch auf. Denn eine Welt, in der man - aufgrund enttäuschter Erwartungen - keinem Versprechen und im Extremfall überhaupt keiner Rede mehr traut, mag wenig wünschenswert sein; undenkbar ist sie nicht. Auf den logischen Widerspruch stößt man erst, wenn man sich auf Kants rationale Intention einläßt und nicht mehr auf die (widrigen oder wünschenswerten) Folgen, sondern allein auf die Maxime selbst achtet: Was bedeutet ein bewußt falsches, ein unehrliches Versprechen? Wer ein Versprechen abgibt, legt sich gegenüber anderen eine Verpflichtung auf und verzichtet, das Einhalten von egoistischen oder utilitaristischen Klugheitsüberlegungen abhängig zu machen. Als eine Selbstverpflichtung ist das Versprechen unabhängig davon, ob es von Dummheit oder Gerissenheit, Verantwortung oder Verantwortungslosigkeit zeugt, das Versprechen abgegeben zu haben, auch unabhängig davon, ob die Institution des Versprechens überhaupt moralisch vertretbar ist oder eher wie gewisse Glücksspiele geächtet werden sollte. Wenn ein Versprechen eine Selbstverpflichtung meint, dann bedeutet ein bewußt falsches Versprechen, daß man eine Verpflichtung eingeht und doch nicht übernimmt. Einem Versprechen, das man im Wissen und der Absicht abgibt, es nicht zu halten, liegt eine in sich widersprüchliche Maxime zugrunde. Das bewußt falsche Versprechen kann nicht als ein allgemeines Gesetz gedacht werden, entpuppt sich daher als moralisch verwerflich. Weil der kategorische Imperativ die strengste Form der Verallgemeinerung beinhaltet, hat man Kant sittlichen Rigorismus vorgeworfen, nach dem Maximen wie nicht zu lügen unter allen Umständen zu befolgen sind. In der Tat hat Kant in dem berühmten Disput mit dem französischen Schriftsteller und Politiker Benjamin Constant behauptet, auch bei denen habe Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 82 man kein Recht zur Lüge, die jemanden ungerecht verfolgen (Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen, 1797). Trotzdem vertritt Kant hier keinen fragwürdigen Rigorismus. Wie schon der Titel der Schrift anzeigt, geht es um ein Rechtsproblem, während das moralische Problem (die Tugendpflicht zur Ehrlichkeit) ausgeklammert wird (VIII 426, Anm.). Constant hatte die Frage aufgeworfen, ob jemand unter allen Umständen einen Rechtsanspruch auf Wahrhaftigkeit habe; daher der zugespitzte Rechtsfall: der Fragende hat Mordabsichten, der Gefragte will seinem Freund helfen. Constant behauptet, dieser Fall zeige, daß eine unbedingte Gültigkeit der Wahrhaftigkeitspflicht jede Gesellschaft unmöglich mache. Nach Kant trifft das genaue Gegenteil zu: es ist der Rechtsanspruch auf Lüge, der jede Gesellschaft unmöglich macht. Denn die Wahrhaftigkeit ist der Grund aller Verträge; Verträge werden sinnlos, wenn sie unter dem Vorbehalt stehen, daß die Vertragspartner von ihrem „Recht auf Lüge“ Gebrauch machen. Sinnlos werden nicht nur die konkreten Verträge im Rahmen einer bestehenden Rechts- und Staatsordnung. Auch jener Urvertrag verliert seinen Sinn, der ein menschliches Zusammenleben nach Vernunftprinzipien, der eine gerechte Rechtsordnung konstituiert. Andererseits müssen wir auch nach Kant einen „Lügner aus Menschenliebe“ nicht rechtlich verurteilen. Kant spricht nämlich von einem Notrecht (IV 235 f.), nach dem es Fälle gibt, die zwar nicht unsträflich, aber unstrafbar sind. Im übrigen räumen auch die fortschrittlichsten Strafprozeßordnungen den Zeugen, die einem Angeklagten sehr nahe stehen und bei denen das Gericht fürchten muß, belogen zu werden, kein Recht auf Lüge, wohl aber ein Recht auf Zeugnisverweigerung ein. Nun kann man von dem Disput zwischen Kant und Constant abweichen und die Wahrhaftigkeit als Tugend-, nicht als Rechtspflicht diskutierten. Dann ist nach dem kategorischen Imperativ ein betrügerisches Leben zweifelsohne unerlaubt und ein ehrliches Leben geboten. Zur Maxime der Ehrlichkeit gehört aber nicht notwendigerweise, daß man jedem zu jeder Zeit die „volle Wahrheit“ sagt; Todkranken oder kleinen Kindern darf man vielleicht manches verschweigen, ohne deshalb lügen zu dürfen (vgl. XXVII 138f., 448). Trotzdem ist nicht ausgeschlossen - was Kant allerdings nicht zuläßt -, daß eine Situation mehrdeutig ist, verschiedene Pflichten gleichzeitig angesprochen sind und ihre Forderungen in unterschiedliche Richtungen weisen. Die Möglichkeit einer Mehrdeutigkeit der Situation ist zuerst kein ethisches, sondern ein handlungstheoretisches Problem, hat allerdings eine bedeutende ethische Konsequenz, die Kant vielleicht zu Unrecht bestreitet, nämlich daß es eine echte Pflichtenkollision geben kann (vgl. aber TL, VI 426). Wenn in einer gewissen Lage die Pflicht zur Ehrlichkeit der Pflicht zu helfen offensichtlich widerspricht - und ein offensichtlicher Widerspruch liegt weit seltener vor, als wir gerne annehmen -, dann ist eine konkrete Abwägung beider Pflichten erforderlich. Dabei kann man nach höheren, formaleren Grundsätzen suchen, an denen sich die abwägende Beurteilung orientiert. Aber diese höheren Grundsätze müssen wiederum moralisch sein und dürfen sich nicht auf persönliche Vorteile oder Sympathiegefühle berufen. Andernfalls dürfte man lügen, wenn man selbst oder ein Freund in Gefahr ist, und würde ehrlich bleiben, wenn es um einen Feind oder Fremden geht. Der höhere Grundsatz, der über den Konflikt zwischen dem Ehrlichkeits- und dem Hilfsgebot entscheidet, muß als moralischer Grundsatz schlechthin richtig, er muß im strengen Sinn allgemein gültig sein. Insofern bleibt er eine Maxime, die sich im Gedankenexperiment der Verallgemeinerung als kategorisch verbindlich ausweist. 3. Die Autonomie des Willens Der kategorische Imperativ wird häufig als Moralprinzip betrachtet. Dieses Verständnis ist irreführend, da in der Ethik und für Kant die Prinzipienfrage eine doppelte Bedeutung hat. Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 83 Auf der einen Seite sind der Begriff und höchste Maßstab allen sittlichen Handelns gesucht, auf der anderen Seite geht es um den letzten Grund dafür, gemäß dem Begriff und Maßstab handeln zu können. Auf die erste Frage antwortet Kant mit dem kategorischen Imperativ, auf die zweite mit der Selbstgesetzgebung, der Autonomie des Willens; die Bedingung der Möglichkeit, moralisch zu handeln, das Prinzip der moralischen Subjektivität (Personalität), liegt in der Fähigkeit, sich nach selbstgesetzten Grundsätzen zu bestimmen. Beide Gesichtspunkte hängen miteinander zusammen. Der kategorische Imperativ nennt den Begriff und das Gesetz, unter denen der autonome Wille steht; die Autonomie ermöglicht es, die Forderungen des kategorischen Imperativs zu erfüllen. Die Idee der Selbstgesetzgebung geht auf Rousseau zurück, der im Contrat Social (I 8) sagt, der Gehorsam gegen das selbstgegebene Gesetz sei Freiheit. Aber erst Kant entdeckt in dem von Rousseau mehr beiläufig erwähnten Gedanken das Grundprinzip der gesamten Ethik und liefert seine Begründung. Die in der gegenwärtigen Ethik oft vernachlässigte Frage nach der Grundstruktur des moralischen Willens beantwortet Kant in zwei Schritten. In der Kritik der praktischen Vernunft scheidet er zuerst alle Maximen aus, die einem nichtsittlichen Willen entspringen, und nennt ihr allgemeines Prinzip, die Fremdbestimmung (Heteronomie) (§§ 2-3). Dann entwickelt er für den verbleibenden Rest den positiven Gehalt, die Autonomie (§§ 4-8). Diese zweiteilige Argumentation ist in einem engeren Sinn transzendental; sie untersucht die apriorische Bedingung, die die Moralität möglich macht. Die vorausgesetzten Überlegungen zum schlechthin Guten und zum kategorischen Imperativ sowie die Lehre vom Vernunftfaktum (s. u. Kap. 4) sind dagegen notwendige Bestandteile der praktischen Vernunftkritik, aber nicht im strengen Verständnis transzendentaler Natur. Kant argumentiert mit den Begriffen von Materie und Form des Begehrungsvermögens. Unter die Materie fallen alle Gegenstände, Zustände oder Tätigkeiten, deren Wirklichkeit begehrt wird, weil ihr Erreichen Lust verspricht. Dabei beziehen sich Begehren und Lust nicht nur auf den Bereich des Sinnlichen: des Essens, Trinkens, der Sexualität, des Ausspannens. Auch die geistigen Freuden, die intellektuellen, kreativen oder sozialen Tätig-keiten entspringen, rechnen dazu. Deshalb wird eine Unterscheidung für die Begründung der Ethik unerheblich, die für die vorkantische Ethik und später für den Utilitarismus eines J. S. Mill wichtig ist, die Unterscheidung zwischen niederen (sinnlichen) und höheren (geistigen) Freuden (KpV, § 3, Anm. 1). Denn in beiden Fällen ist man von der Annehmlichkeit bestimmt, die man aus dem entsprechenden Tun erwartet. Alles Handeln, das durch die Erwartung von Lust und die Vermeidung von Unlust (Schmerz, Frustration) geleitet wird, kommt für den Willen von außen, den Sinnen, und nicht der (praktischen) Vernunft; es ist jederzeit empirisch. Nur aus Erfahrung kann man wissen, was man begehrt und ob das Erreichen des Begehrten: das Essen und Trinken, die Gesundheit, der Reichtum, die wissenschaftliche, künstlerische oder sportliche Tätigkeit, mit Lust oder Unlust verbunden sind. Die entsprechenden Erfahrungen sind bestenfalls generell, niemals universell gültig. Also können materiale Bestimmungsgründe keine praktischen Gesetze abgeben, für die die strenge Allgemeinheit erforderlich ist. Das Prinzip, das allen materialen Bestimmungsgründen gemeinsam ist, liegt im eigenen Vorteil: in der Selbstliebe oder eigenen Glückseligkeit. Zwar sagt Kant ausdrücklich, daß jedes endliche (bedürftige) Vernunftwesen mit Notwendigkeit nach Glück verlangt. Denn wegen der Bedürfnisnatur ist das Glück, verstanden als Zufriedenheit mit dem ganzen Dasein, kein ursprünglicher Besitz, sondern eine Aufgabe, der sich keiner entziehen kann (KpV, § 3, Anm. II). Die Einsicht Kants in die Bedeutung des Glücks macht verständlich, warum immer wieder Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 84 das Glück als Prinzip sittlichen Handelns behauptet wird. Kant nennt aber auch den genauen Grund, warum - Kants Bestimmung des Glücks vorausgesetzt - die Theorien falsch sind, die die Sittlichkeit an dieses Prinzip binden. Weil die Sittlichkeit unbedingt und streng allgemein gültig ist, das Glück als Zufriedenheit mit dem ganzen Dasein aber von der (individuellen, sozialen und gattungsmäßigen) Konstitution des Subjekts, von seinen Neigungen, Trieben und Bedürfnissen, von seinen Interessen, Sehnsüchten und Hoffnungen sowie von den Möglichkeiten abhängt, die die natürliche und soziale Welt bieten, kurz: weil das Glück nach seinen Inhalten vielfältig empirisch bedingt ist, taugt es nicht zum allgemeinen Gesetz und kann nicht den Bestimmungsgrund der Sittlichkeit abgeben. Zu den wichtigsten philosophischen Versuchen, das Glück als Prinzip des menschlichen Handelns zu begründen, gehört wohl die Nikomachische Ethik des Aristoteles. Ob auch sie durch Kants Kritik getroffen wird, ist fraglich. Aristoteles versteht nämlich das Glück nicht als subjektive Zufriedenheit, sondern als schlechthin höchstes Ziel, über das hinaus kein anderes Ziel mehr gedacht werden kann. So erhält es eher die Bedeutung des höchsten Gutes, das auch Kant im Rahmen der Postulatenlehre anerkennt. Doch denkt Kant den Begriff des höchsten Guts im Rahmen einer Willensethik, Aristoteles dagegen in einer Strebensethik. Da nach Kant selbst geistige Interessen unter die materiellen Bestimmungsgründe fallen, diese aber nicht moralisch sind, muß man sich fragen, ob nicht das gesamte Feld möglicher Bestimmungsgründe ausgeschritten ist, somit für die Sittlichkeit kein Platz mehr bleibt. Im zweiten Begründungsschritt zeigt Kant, daß nach Ausschluß aller Materie immer noch die Form, aber auch nur die Form der Maximen übrig bleibt. Also liegt in der gesetzgebenden Form von Maximen der einzige Bestimmungsgrund eines sittlichen Willens (KpV, § 4). Wie muß der Wille beschaffen sein, der durch die gesetzgebende Form allein bestimmt ist? Die bloße Gesetzesform ist kein möglicher Gegenstand der Sinne, fällt deshalb nicht unter die Erscheinungen und ihr Prinzip der Kausalität. Die bloße Gesetzesform entspricht einem Vermögen, das alle Erscheinungen und ihr Kausalitätsprinzip transzendiert. Die Unabhängigkeit von aller Kausalität hat Kant schon in der Kritik der reinen Vernunft als transzendentale Freiheit bestimmt. Somit hat die Moralität ihren Ursprung in der Freiheit im strengsten, das ist transzendentalen Sinn. Der in der ersten Kritik gebildete Begriff der transzendentalen Freiheit, die Unabhängigkeit von aller Natur, entpuppt sich in der Ethik als die praktische (moralische) Freiheit, als die Selbstbestimmung. Der von aller Kausalität und Fremdbestimmung freie Wille gibt sich selbst sein Gesetz. Folglich liegt das Prinzip aller moralischen Gesetze in der Autonomie, der Selbstgesetzlichkeit des Willens. Negativ meint die Autonomie die Unabhängigkeit von materialen Bestimmungsgründen, positiv die Selbstbestimmung oder eigene Gesetzgebung (KpV, § 8). Mit der Begründung des Handelns aus der Autonomie erhalten die Rationalität und Verantwortlichkeit der Praxis eine neue Schärfe und Radikalität. Nicht wer in letzter Instanz von der Macht der Triebe und Leidenschaften, der Gefühle von Sympathie und Antipathie oder den herrschenden Gewohnheiten bestimmt wird, auch nicht wer zu vorgegebenen Zielen stets die besten Mittel sucht, handelt schlechthin rational. Im strengsten, dem moralischen Sinn des Begriffs ist nur der verantwortlich, der Lebensgrundsätzen folgt, die dem autonomen, nicht heteronomen Willen entspringen. Zwar richtet sich der Anspruch der Moralität an ein Wesen, das weder seine sinnliche Natur noch seine geschichtlich-gesellschaftliche Herkunft ablegen kann. Der Mensch bleibt immer ein Bedürfnis-, Geschichts- und Gesellschaftswesen. Deshalb hat die Moralität für ihn grundsätzlich imperativische Bedeutung; sie ist eine kategorische Aufforderung, deren Befolgung sich kein Mensch für immer sicher sein kann. Moralität als Autonomie heißt, sich seine Bedürfnisse und gesellschaftlichen Abhängigkeiten eingestehen, sie sogar bejahen und sie doch nicht als letzten Bestimmungsgrund Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 85 des Lebens zuzulassen. Autonomie bedeutet, mehr als ein bloßes Bedürfnis- und Gesellschaftswesen zu sein und in dem Mehr - hier liegt Kants Provokation - zu seinem eigentlichen Selbst zu finden, dem moralischen Wesen, der reinen praktischen Vernunft. Zum Mehr gehört nicht ein Abstreifen des Weniger. Das autonome Handeln endlicher Vernunftwesen dokumentiert sich nicht in der Unabhängigkeit von allen Bedingtheiten persönlicher, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Natur. Denn beiseitelegen kann man die mannigfaltigen Bedingungen ohnehin nicht. In der Meinung mancher Existenzphilosophen, der Mensch müsse aus dem Nichts neu anfangen, wenn er frei sein wolle, wird das Kantische Prinzip der Freiheit mißverstanden. Das Prinzip fordert den Menschen nicht auf, Vitalität, Sensibilität und soziale Orientierungen zugunsten einer dann leeren Rationalität zum Verschwinden zu bringen, als ob sich eine „lautere“ Moralität grundsätzlich auf der Seite von Lebensflucht, Traditions- und Geschichtslosigkeit, auf die Seite der Kritik gewachsener Lebensformen oder des Rückzugs aus Gesellschaft und Politik schlagen müßte. Falsch ist auch die Vorstellung, Kants Idee der Autonomie und überhaupt der Moralität führe zu einer Übermoralisierung, nach der man jeden Handgriff auf seine Moralität hin zu befragen habe. Darin liegt gerade der Sinn einer Maximenethik, daß sie das Moralprinzip nicht direkt auf Einzelhandlungen, nicht einmal auf Handlungsregeln, sondern auf gewachsene und bewährte Lebensgrundsätze bezieht, die Bewährung der Grundsätze aber nicht technischen und pragmatischen Überlegungen allein überläßt. Unrichtig ist schließlich die Ansicht, nach dem Prinzip der Autonomie dürfe man zu moralischen Handlungen keine natürliche Neigung haben. Schillers berühmtes Wort: „Gerne dien ich den Freunden, doch tue ich es leider mit Neigung / Und so wurmt es mir oft, daß ich nicht tugendhaft bin“ läßt schon Kants Überzeugung außer acht, daß „eine Neigung zum Pflichtmäßigen (z. B. zur Wohlthätigkeit) ... die Wirksamkeit der moralischen Maximen sehr erleichtern“ kann (KpV, V 118). Nicht derjenige lebt heteronom, der auch seinen Freunden hilft, wohl derjenige, der nur ihnen dient und gegen die Not aller anderen gleichgültig bleibt. Autonom handelt dagegen, wer auch dort an den Maximen der Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit usw. festhält, wo nicht schon die natürliche Neigung oder das gesellschaftlich Übliche dazu auffordern. Mit dem Prinzip der Autonomie stellt Kant die philosophische Ethik auf ein neues Fundament (vgl. KpV, V 40). Der Grund der Sittlichkeit liegt weder in der wohlwollenden Selbstliebe (Rousseau) noch in einem moralischen Gefühl (moral sense: Hutcheson, auch Shaftesbury und Hume). Im Rahmen der Pflicht zur eigenen Vollkommenheit soll man zwar das Wohlwollen und moralische Gefühl kultivieren (vgl. TL, VI 386f.), aber beide drücken lediglich eine faktische, zudem zufällige Befindlichkeit des Subjekts aus; sie sind nicht streng allgemeingültig. Rousseau und die Moralsense-Philosophen bleiben einem sublimen Empirismus verhaftet. Noch weniger gründet die Sittlichkeit in einem physischen Gefühl (Epikur, den Kant jedoch nicht für moralisch „so niedrig gesinnt“ hält, wie oft angenommen wird: KpV, V 115). Selbst die Vollkommenheit der Dinge (Stoiker, Wolff) oder der Wille Gottes (Crusius, theologische Moralisten) können moralische Verpflichtungen nicht in letzter Instanz rechtfertigen. Eine Maxime ist für Kant nicht deshalb vernünftig, weil sie Gott in souveräner Macht gebietet, sondern Gott gebietet sie, weil sie und er selbst vernünftig sind. Auch wenn es empirisch gesehen manchmal umgekehrt sein mag, systematisch betrachtet folgt die Moralität nicht aus dem Glauben, sondern geht ihm voran. 4. Das Faktum der Vernunft Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 86 Die drei Theoriestücke: die Idee des schlechthin Guten, der kategorische Imperativ und das Prinzip der Autonomie, sind notwendige, aber nicht zureichende Elemente einer philosophischen Ethik. Ohne den Nachweis, daß es den gemeinsamen Gegenstand der drei Theoriestücke, die Sittlichkeit, wirklich gibt, erreicht Kant nicht sein Ziel, die Überwindung des ethischen Skeptizismus. Dieser läßt sich erst dann widerlegen, wenn die Sittlichkeit nicht letztlich auf persönlichen, gruppenspezifischen, epochalen oder gattungsspezifischen Täuschungen beruht, sondern sich als tatsächlich vorhanden, als ein „Faktum“ erweist. Trotz der zentralen Bedeutung hat Kant diese Frage nach der Wirklichkeit des Sittlichen mehr beiläufig aufgegriffen. Das Mißverhältnis von sachlicher Bedeutung und tatsächlicher Behandlung ist mit daran schuld, daß Kants Antwort, das Faktum der Vernunft, Probleme aufwirft, die bis heute keine allseits überzeugende Lösung gefunden haben. Das Faktum der Vernunft findet Kant nur im Bereich des Praktischen, nicht auch des Theoretischen. Während die theoretische Vernunft immer an eine mögliche Erfahrung gebunden ist, kommt im Bereich des Handelns, und nur hier, reine Vernunft vor. Mit dem Stichwort „Faktum der (reinen praktischen) Vernunft“ will Kant darauf hinweisen, daß es Moralität tatsächlich gibt. Die Lehre vom Vernunftfaktum soll bestätigen, daß Kants Ethik keine weltfremde Theorie eines abstrakten Sollens, sondern eine Selbstreflexion praktischer Vernunft und ihrer Vollendung in der Dimension des Moralischen ist. Im Vernunftfaktum zeigt sich die paradoxe Situation der Kantischen, vielleicht sogar jeder Ethik: Reflektiert wird auf das, was im moralischen Bewußtsein (oder moralischen Reden usw.) immer schon gegeben ist, also auf ein Faktum, ein Ist, und doch soll die Reflexion zu einem Moralprinzip, dem Grund und Maßstab des Sollens, führen. Der Anschein des Paradoxen mildert sich ab, sobald man auf die Eigenart des Faktums achtet. Es ist keine empirische Gegebenheit, sondern die Tatsache der Vernunft im Praktischen, zudem eine Tatsache, die nicht grundsätzlich, sondern nur im Fall endlicher Vernunftwesen Sollenscharakter hat. Als Faktum der Vernunft bezeichnet Kant nicht das Gesetz der Moralität, das Sittengesetz, selbst, sondern das Bewußtsein des Sittengesetzes (KpV, § 7, V 31). Kant spricht von einem Faktum, weil er das Bewußtsein des Sittengesetzes für eine Tatsache, für etwas Wirkliches, nicht für etwas Fiktives, bloß Angenommenes hält. Es handelt sich, sagt Kant, um die unbestreitbare (apodiktisch gewisse) Tatsache, daß es ein moralisches Bewußtsein, das Bewußtsein einer unbedingten Verpflichtung, gibt. Durch das Bewußtsein unbedingter Verbindlichkeiten kündigt sich die Vernunft „als ursprünglich gesetzgebend (sic volo, sic jubeo)“ an (ebd.). Angesichts der immer wieder neuen, der alltäglichen, der einzelwissenschaftlichen und der philosophisch-prinzipiellen Zweifel an der Möglichkeit der Sittlichkeit soll mit dem Faktum der Vernunft die objektive Realität der Sittlichkeit nach- und alle Skepsis zurückgewiesen werden. Das Faktum der Vernunft belegt nach Kant, daß die Ethik nicht nur negativ, als grundsätzliche Destruktion, sondern auch positiv, als normative Theorie der Moral möglich ist. Nur dann, wenn das moralische Bewußtsein keine schiere Selbsttäuschung ist, verlieren normative Ethiken den Charakter einer vielleicht scharfsinnigen, aber weltfremden Gedankenkonstruktion und tragen dazu bei, die Grundsituation des Menschen zu verstehen. Kant hält das Faktum der Vernunft für unleugbar. Zur Begründung sagt er, man brauche nur das Urteil zu zergliedern, das die Menschen über die Gesetzmäßigkeit ihrer Handlungen fällen. Das Faktum der Vernunft soll sich also in bestimmten Urteilen dokumentieren, und zwar in jenen Urteilen, in denen wir unabhängig von einer konkurrierenden Neigung, letztlich dem eigenen Glück, die sittlich richtige Handlung aussprechen. In der Anmerkung zu § 6 gibt Kant ein Beispiel. Kant fragt, ob jemand, der unter Androhung der unverzögerten Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 87 Todesstrafe aufgefordert wird, ein falsches Zeugnis wider einen ehrlichen Mann abzulegen, es doch für möglich halte, trotz einer auch noch so großen Liebe zum Leben diese Neigung zu überwinden und das falsche Zeugnis zu verweigern. Die Antwort auf diese Frage lautet zweifelsohne: ja. Auch wenn ein bewußt falsches Zeugnis wider einen ehrlichen Mann unter besonderen Umständen verständlich sein mag, selbst wenn wir es erwarten, weil wir mit einem Übergewicht der Selbstliebe rechnen, so beurteilen wir trotzdem das falsche Zeugnis als ein moralisches Unrecht. Um eine solche Beurteilung verstehen zu können, muß man Kant zufolge auf den Begriff des Sittengesetzes oder des kategorischen Imperatives zurückgreifen, nämlich auf den Begriff einer unbedingten, von einer auch noch so krassen Bedrohung des eigenen Glücks unabhängig gültigen Gesetzgebung. Da wir tatsächlich das bewußt falsche Zeugnis verurteilen, sieht Kant im Bereich des Praktischen die von allem Empirischen, hier: von aller Neigung unabhängige, die reine Vernunft als real erwiesen. Die reine praktische Vernunft, die Moralität, erscheint nicht länger als ein lebensfremdes Sollen, sondern als eine Wirklichkeit, die wir immer schon anerkennen. Weil uns allen Urteile vertraut sind, in denen wir zu einem Handeln aufgefordert werden, das unseren Neigungen widerspricht, müssen wir nach Kant nicht lange suchen, um reine Vernunft zu entdecken. Noch weniger gilt die reine Vernunft, die Sittlichkeit, als eine Erfindung von Moralisten. Das Vernunftfaktum, sagt Kant, ist längst im Wesen aller Menschen einverleibt (KpV, V 105); es ist „mit der gröbsten und leserlichsten Schrift in der Seele des Menschen geschrieben“ (Gemeinspruch, VIII 287). Aus Gründen der nachkantischen Moralkritik, vielleicht auch wegen der Erfahrungen mit der Inhumanität unseres Jahrhunderts wird aber mancher seine Skepsis nicht restlos aufgeben. Da die reine praktische Vernunft in der Freiheit des Willens besteht, ist die These vom Vernunftfaktum der dritte Schritt in Kants Lehre der Freiheit: (1) Im Antinomienkapitel der ersten Kritik hat Kant nachgewiesen, daß der Begriff der transzendentalen Freiheit denkmöglich ist; (2) das Prinzip der Autonomie aus der zweiten Kritik zeigt, daß die transzendentale Freiheit ein negativer Begriff ist, der positiv gesehen die moralische Freiheit beinhaltet; (3) das Faktum der Vernunft beweist, daß die transzendentale und moralische Freiheit wirklich ist. Weitere Elemente des Kantischen Freiheitsdenkens kommen in der Rechtsphilosophie, der Geschichts- und der Religionsphilosophie sowie der Kritik der Urteilskraft. Die Freiheit ist ein Leitbegriff, der die gesamte Philosophie Kants bestimmt. Kants Überlegungen zum Faktum der Vernunft haben neben der sachlichen eine methodische Bedeutung. Sie machen indirekt darauf aufmerksam, daß eine angemessene philosophische Ethik eine methodisch komplexe Aufgabe darstellt. In einem ersten methodischen Schritt, der konstruktiven Begriffsanalyse, kommt es darauf an, einen angemessenen Begriff der Sittlichkeit zu bilden und ihn gemäß Kant als das uneingeschränkte Gute zu denken. In einem zweiten Schritt ist der Begriff des uneingeschränkt Guten auf die Situation endlicher Vernunftwesen anzuwenden, was im Begriff des kategorischen Imperativs geschieht. Der dritte, transzendentalreduktive Schritt führt zur Willensfreiheit als Prinzip der sittlichen Subjektivität. Schließlich weist ein vierter, in einem weiteren Sinn induktivhermeneutischer Schritt nach, daß die bisherige Argumentation eine Wirklichkeit und keine Fiktion behandelt. Dabei kann man aus der menschlichen Lebenswelt ein moralisches Phänomen wie die Überzeugung herausgreifen, auch unter Todesandrohung auf eine ehrliche Zeugnisaussage verpflichtet zu sein (die im weiteren Sinn „induktive Seite“). Darüber hinaus muß das moralische Phänomen „auf den Begriff gebracht“ und als „Pflicht kontra Neigung“ oder als „Bewußtsein einer unbedingten Verpflichtung“ gedeutet werden (die in einem weiteren Sinn „hermeneutische“ Seite). Aus der methodischen Komplexität folgt, daß nur ein relativ kleiner Teil der Kantischen Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 88 Ethik im engeren Sinn transzendental ist, ferner daß im Gegensatz zu dem längst unfruchtbaren Konfessionsstreit um die einzig wahre Methode in der Ethik („Sprachanalyse oder Hermeneutik“, „Transzendentalphilosophie oder Dialektik“ usw.) die philosophische Begründung der Sittlichkeit eine mehrschichtige Aufgabe darstellt, die durch eine Methode allein nicht gelöst werden kann. Zu den gegenwärtig wichtigsten Argumenten, die traditionelle Ethik zu kritisieren, gehört der auf den britischen Moralphilosophen G. E. Moore (Principia Ethica, 1903) zurückgehende naturalistische Fehlschluß. Auch Kant wird er vorgeworfen (Ilting). Mit dem Argument des naturalistischen Fehlschlusses verwirft Moore alle naturalistischen und metaphysischen Ethiken, um an ihre Stelle die eigene Position des ethischen Intuitionismus zu setzen. Danach ist „gut“ ein schlechthin einfacher, deshalb undefinierbarer Gegenstand. Genaugenommen liegt der angebliche Fehlschluß nicht darin, daß „gut“ durch natürliche oder metaphysische „Eigenschaften“ definiert wird, sondern daß verschiedenes - „gut“ auf der einen und die Eigenschaften auf der anderen Seite - als eines identifiziert wird. Es ist daher besser, von einem „Identifikationsfehler/fehlschluß“ zu sprechen. Ob dieser Fehler tatsächlich vorliegt, läßt sich nicht, wie die Rede von einem naturalistischen Fehlschluß nahelegt, rein logisch, sondern nur durch ethische Sachdiskussion entscheiden; diese hat Moore erst ansatzweise entwickelt. Auf Kants Ethik angewandt betrifft der angebliche Fehlschluß nicht das Faktum der Vernunft, sondern die grundlegende Definition des sittlich Guten. Für sie gilt, daß die Grundlegung zwar mit einer Begriffsbestimmung von „sittlich gut“ als „uneingeschränkt“ gut beginnt. Aber dabei wird nicht die Gattung des Guten, sondern die spezifische Differenz des sittlich Guten definiert; insoweit befindet sich Kant nicht im Widerspruch mit Moore. Wenn man Kant beim Faktum der Vernunft einen logischen Fehler vorwerfen will, so scheint der auf Hume zurückgehende Sein-Sollen-Fehlschluß geeigneter zu sein (Treatise on Human Nature, 1739-40, Buch III, Teil 1, Abschn. 1). Danach lassen sich aus bloßen Seins(Tatsachen-) Aussagen oder deskriptiven (beschreibenden) Sätzen keine Sollensaussagen oder präskriptiven (vorschreibenden) Sätze ableiten. Weil Kant von einem Faktum der Vernunft spricht, könnte man meinen, er begehe diesen Fehlschluß. Doch zeigt eine nähere Betrachtung, daß Kants Ethik eher einen differenzierten Vorschlag enthält, wie man die SeinSollens-Problematik lösen könnte. Erstens unterscheidet Kant zwischen dem Bereich der theoretischen und der praktischen Vernunft; während die theoretische Vernunft das, was ist, untersucht: die Gesetze der Natur, betrifft die praktische Vernunft von vornherein das, was wir tun sollen: die technischen, pragmatischen und kategorischen Imperative, die Gesetze der Freiheit. Zweitens hebt Kant innerhalb der praktischen Vernunft die empirisch bedingte von der reinen ab, definiert das sittlich Gute in Begriffen reiner Vernunft, so daß es aus einer nichtmoralischen Erfahrung als grundsätzlich unableitbar gilt. Drittens meint das Vernunftfaktum keine empirische Tatsache, sondern die moralische Selbsterfahrung des praktischen Vernunftwesens; als moralische Erfahrung dokumentiert sie sich nicht in empirisch beobachtbaren Handlungen, sondern in moralischen Urteilen über Handlungen. Viertens leitet Kant aus dem Vernunftfaktum keine Sollensaussagen ab; argumentations-logisch betrachtet folgt der kategorische Imperativ nicht aus dem Vernunftfaktum, sondern aus dem Begriff des uneingeschränkt Guten, bezogen auf die Situation endlicher Vernunftwesen. Schon in der Kritik der reinen Vernunft hat Kant festgestellt, daß „in Ansehung der sittlichen Gesetze“ die „Erfahrung (leider!) die Mutter des Scheins“ ist, weshalb es „höchst verwerflich“ sei, „die Gesetze über das, was ich thun soll, von demjenigen herzunehmen, oder dadurch einschränken zu wollen, was gethan wird“ (KrV, B 375). Deshalb ist es notwendig, den Bereich des Seins (der Natur) zu verlassen und die Sittlichkeit im Unterschied zum Utilitarismus, zur Verhaltensforschung, auch zu sozialwissenschaftlichen und anthropo-logischen Otfried Höffe, Immanuel Kant – Die Kritik der praktischen Vernunft 89 Ansätzen nicht in empirischen, sondern in erfahrungsunabhängigen, also apriorischen Begriffen zu definieren. So läßt sich eine der Hauptaufgaben der gegenwärtigen Ethikdiskussion vielleicht durch eine kritische Rückbesinnung auf Kant lösen. Wer die Idee der Sittlichkeit als des uneingeschränkt Guten kreativ fortbildet und an ihr doppeltes Prinzip, den kategorischen Imperativ und die Autonomie, anknüpft, hat gute Chancen, die Probleme des Naturalismus und des Sein-Sollens-Fehlschlusses zu überwinden. [S. 170-207] 90 Anhang Aristoteles Nikomachische Ethik Ins Deutsche übertragen von Adolf Lasson. © 1909 by Eugen Diederichs Jena Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 91 1. Die Stufenleiter der Zwecke und der höchste Zweck Alle künstlerische und alle wissenschaftliche Tätigkeit, ebenso wie alles praktische Verhalten und jeder erwählte Beruf hat nach allgemeiner Annahme zum Ziele irgendein zu erlangendes Gut. Man hat darum das Gute treffend als dasjenige bezeichnet, was das Ziel alles Strebens bildet. Indessen, es liegt die Einsicht nahe, daß zwischen Ziel und Ziel ein Unterschied besteht. Das Ziel liegt das eine Mal in der Tätigkeit selbst, das andere Mal noch neben der Tätigkeit in irgendeinem durch sie hervorzubringenden Gegenstand. Wo aber neben der Betätigung noch solch ein weiteres erstrebt wird, da ist das hervorzubringende Werk der Natur der Sache nach von höherem Werte als die Tätigkeit selbst. Wie es nun eine Vielheit von Handlungsweisen, von künstlerischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten gibt, so ergibt sich demgemäß auch eine Vielheit von zu erstrebenden Zielen. So ist das Ziel der ärztlichen Kunst die Gesundheit, dasjenige der Schiffsbaukunst das fertige Fahrzeug, das der Kriegskunst der Sieg und das der Haushaltungskunst der Reichtum. Wo nun mehrere Tätigkeiten in den Dienst eines einheitlichen umfassenderen Gebietes gestellt sind, wie die Anfertigung der Zügel und der sonstigen Hilfsmittel für Berittene der Reitkunst, die Reitkunst selbst aber und alle Arten militärischer Übungen dem Gebiete der Kriegskunst, und in ganz gleicher Weise wieder andere Tätigkeiten dem Gebiete anderer Künste zugehören: da ist das Ziel der herrschenden Kunst jedesmal dem der ihr untergeordneten Fächer gegenüber das höhere und bedeutsamere; denn um jenes willen werden auch die letzteren betrieben. In diesem Betracht macht es dann keinen Unterschied, ob das Ziel für die Betätigung die Tätigkeit selbst bildet, oder neben ihr noch etwas anderes, wie es in den angeführten Gebieten der Tätigkeit wirklich der Fall ist. Gibt es nun unter den Objekten, auf die sich die Betätigung richtet, ein Ziel, das man um seiner selbst willen anstrebt, während man das übrige um jenes willen begehrt; ist es also so, daß man nicht alles um eines anderen willen erstrebt, / denn damit würde man zum Fortgang ins Unendliche kommen und es würde mithin alles Streben eitel und sinnlos werden /: so würde offenbar dieses um seiner selbst willen Begehrte das Gute, ja das höchste Gut bedeuten. Müßte darum nicht auch die Kenntnis desselben für die Lebensführung von ausschlaggebender Bedeutung sein, und wir, den Schützen gleich, die ein festes Ziel vor Augen haben, dadurch in höherem Grade befähigt werden, das zu treffen, was uns not ist? Ist dem aber so, so gilt es den Versuch, wenigstens im Umriß darzulegen, was dieses Gut selber seinem Wesen nach ist und unter welche Wissenschaft oder Fertigkeit es einzuordnen ist. Es liegt nahe anzunehmen, daß es die dem Range nach höchste und im höchsten Grade zur Herrschaft berechtigte Wissenschaft sein wird, wohin sie gehört. Als solche aber stellt sich die Wissenschaft vom Staate dar. Denn sie ist es, welche darüber zu bestimmen hat, was für Wissenschaften man in der Staatsgemeinschaft betreiben, welche von ihnen jeder einzelne und bis wie weit er sie sich aneignen soll. Ebenso sehen wir, daß gerade die Fertigkeiten, die man am höchsten schätzt, in ihr Gebiet fallen: so die Künste des Krieges, des Haushalts, der Beredsamkeit. Indem also die Wissenschaft vom Staate die andern praktischen Wissenschaften in ihren Dienst zieht und weiter gesetzlich festsetzt, was man zu tun, was man zu lassen hat, so umfaßt das Ziel, nach dem sie strebt, die Ziele der anderen Tätigkeiten mit, und mithin wird ihr Ziel dasjenige sein, was das eigentümliche Gut für den Menschen bezeichnet. Denn mag dieses auch für den einzelnen und für das Staatsganze dasselbe sein, so kommt es doch in dem Ziele, das der Staat anstrebt, umfassender und vollständiger zur Erscheinung, sowohl wo es sich um das Erlangen, wie wo es sich um das Bewahren handelt. Denn erfreulich ist es gewiß auch, wenn das Ziel bloß für den einzelnen Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 92 erreicht wird; schöner aber und göttlicher ist es, das Ziel für ganze Völker und Staaten zu verfolgen. Das nun aber gerade ist es, wonach unsere Wissenschaft strebt; denn sie handelt vom staatlichen Leben der Menschen. 2. Form und Abzweckung der Behandlung des Gegenstandes Was die Behandlung des Gegenstandes anbetrifft, so muß man sich zufrieden geben, wenn die Genauigkeit jedesmal nur so weit getrieben wird, wie der vorliegende Gegenstand es zuläßt. Man darf nicht in allen Disziplinen ein gleiches Maß von Strenge anstreben, sowenig wie man es bei allen gewerblichen Arbeiten dürfte. Das Sittliche und Gerechte, die Gegenstände also, mit denen sich die Wissenschaft vom staatlichen Leben beschäftigt, gibt zu einer großen Verschiedenheit auseinandergehender Auffassungen Anlaß, so sehr, daß man wohl der Ansicht begegnet, als beruhe das alles auf bloßer Menschensatzung und nicht auf der Natur der Dinge. Ebensolche Meinungsverschiedenheit herrscht aber auch über die Güter der Menschen, schon deshalb, weil sie doch vielen auch zum Schaden ausgeschlagen sind. Denn schon so mancher ist durch den Reichtum, andere sind durch kühnen Mut ins Verderben gestürzt worden. Man muß also schon für lieb nehmen, wenn bei der Behandlung derartiger Gegenstände und der Ableitung aus derartigem Material die Wahrheit auch nur in gröberem Umriß zum Ausdruck gelangt, und wenn bei der Erörterung dessen, was in der Regel gilt und bei dem Ausgehen von ebensolchen Gründen auch die daraus gezogenen Schlüsse den gleichen Charakter tragen. Und in demselben Sinne muß man denn auch jede einzelne Ausführung von dieser Art aufnehmen. Denn es ist ein Kennzeichen eines gebildeten Geistes, auf jedem einzelnen Gebiete nur dasjenige Maß von Strenge zu fordern, das die eigentümliche Natur des Gegenstandes zuläßt. Es ist nahezu dasselbe: einem Mathematiker Gehör schenken, der an die Gefühle appelliert, und von einem Redner verlangen, daß er seine Sätze in strenger Form beweise. Jeder hat ein sicheres Urteil auf dem Gebiete, wo er zu Hause ist, und über das dahin Einschlagende ist er als Richter zu hören. Über jegliches im besonderen also urteilt am besten der gebildete Fachmann, allgemein aber und ohne Einschränkung derjenige, der eine universelle Bildung besitzt. Darum sind junge Leute nicht die geeigneten Zuhörer bei Vorlesungen über das staatliche Leben. Sie haben noch keine Erfahrung über die im Leben vorkommenden praktischen Fragen; auf Grund dieser aber und betreffs dieser wird die Untersuchung geführt. Indem sie ferner geneigt sind, sich von ihren Affekten bestimmen zu lassen, bleiben die Vorlesungen für sie unfruchtbar und nutzlos; denn das Ziel derselben ist doch nicht bloße Kenntnis, sondern praktische Betätigung. Dabei macht es keinen Unterschied, daß einer jung ist bloß an Jahren oder unreif seiner Innerlichkeit nach. Denn nicht an der Zeit liegt die Unzulänglichkeit, sondern daran, daß man sich von Sympathien und Antipathien leiten läßt und alles einzelne in ihrem Lichte betrachtet. Leuten von dieser Art helfen alle Kenntnisse ebensowenig wie denen, denen es an Selbstbeherrschung mangelt. Dagegen kann denen, die ihr Begehren vernünftig regeln und danach auch handeln, die Wissenschaft von diesen Dingen allerdings zu großem Nutzen gereichen. Dies mag als Vorbemerkung dienen, um zu zeigen, wer der rechte Hörer, welches die rechte Weise der Auffassung, und was eigentlich unser Vorhaben ist. Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 93 3. Verschiedene Auffassungen vom Zweck des Lebens Wir kommen nunmehr auf unseren Ausgangspunkt zurück. Wenn doch jede Wissenschaft wie jedes praktische Vorhaben irgendein Gut zum Ziele hat, so fragt es sich: was ist es für ein Ziel, das wir als das im Staatsleben angestrebte bezeichnen, und welches ist das oberste unter allen durch ein praktisches Verhalten zu erlangenden Gütern? In dem Namen, den sie ihm geben, stimmen die meisten Menschen so ziemlich überein. Sowohl die Masse wie die vornehmeren Geister bezeichnen es als die Glückseligkeit, die Eudämonie, und sie denken sich dabei, glückselig sein sei dasselbe wie ein erfreuliches Leben führen und es gut haben. Dagegen über die Frage nach dem Wesen der Glückseligkeit gehen die Meinungen weit auseinander, und die große Masse urteilt darüber ganz anders als die höher Gebildeten. Die einen denken an das Handgreifliche und vor Augen Liegende, wie Vergnügen, Reichtum oder hohe Stellung, andere an ganz anderes; zuweilen wechselt auch die Ansicht darüber bei einem und demselben. Ist einer krank, so stellt er sich die Gesundheit, leidet er Not, den Reichtum als das höchste vor. Im Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit staunen manche Leute diejenigen an, die in hohen Worten ihnen Unverständliches reden. Von manchen wurde die Ansicht vertreten, es gebe neben der Vielheit der realen Güter noch ein anderes, ein Gutes an sich, das für jene alle den Grund abgebe, durch den sie gut wären. Alle diese verschiedenen Ansichten zu prüfen würde selbstverständlich ein überaus unfruchtbares Geschäft sein; es reicht völlig aus, nur die gangbarsten oder diejenigen, die noch am meisten für sich haben, zu berücksichtigen. Dabei dürfen wir nicht außer acht lassen, daß ein Unterschied besteht zwischen den Verfahrungsweisen, die von den Prinzipien aus, und denen, die zu den Prinzipien hin leiten. Schon Plato erwog diesen Punkt ernstlich und untersuchte, ob der Weg, den man einschlage, von den Prinzipien ausgehe oder zu den Prinzipien hinführe, gleichsam wie die Bewegung in der Rennbahn von den Kampfrichtern zum Ziele oder in umgekehrter Richtung geht. Ausgehen nun muß man von solchem was bekannt ist; bekannt aber kann etwas sein in doppeltem Sinn: es ist etwas entweder uns bekannt oder es ist schlechthin bekannt. Wir müssen natürlich ausgehen von dem, was uns bekannt ist. Deshalb ist es erforderlich, daß einer, der den Vortrag über das Sittliche und das Gerechte, überhaupt über die das staatliche Leben betreffenden Themata mit Erfolg hören will, ein Maß von sittlicher Charakterbildung bereits mitbringe. Denn den Ausgangspunkt bildet die Tatsache, und wenn diese ausreichend festgestellt ist, so wird das Bedürfnis der Begründung sich gar nicht erst geltend machen. Ein so Vorgebildeter aber ist im Besitz der Prinzipien oder eignet sie sich doch mit Leichtigkeit an. Der aber, von dem keines von beiden gilt, mag sich des Hesiodos Worte gesagt sein lassen: Der ist der allerbeste, der selber alles durchdenket; Doch ist wacher auch der, der richtigem Rate sich anschließt. Aber wer selbst nicht bedenkt und was er von andern vernommen Auch nicht zu Herzen sich nimmt, ist ein ganz unnützer Geselle. Wir kehren nunmehr zurück zu dem, wovon wir abgeschweift sind. Unter dem Guten und der Glückseligkeit versteht im Anschluß an die tägliche Erfahrung der große Haufe und die Leute von niedrigster Gesinnung die Lustempfindung, und zwar wie man annehmen möchte, nicht ohne Grund. Sie haben deshalb ihr Genüge an einem auf den Genuß gerichteten Leben. Denn es gibt drei am meisten hervorstechende Arten der Lebensführung: die eben genannte, dann das Leben in den Geschäften und drittens das der reinen Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 94 Betrachtung gewidmete Leben. Der große Haufe bietet das Schauspiel, wie man mit ausgesprochenem Knechtssinn sich ein Leben nach der Art des lieben Viehs zurecht macht; und der Standpunkt erringt sich Ansehen, weil manche unter den Mächtigen der Erde Gesinnungen wie die eines Sardanapal teilen. Die vornehmeren Geister, die zugleich auf das Praktische gerichtet sind, streben nach Ehre; denn diese ist es doch eigentlich, die das Ziel des in den Geschäften aufgehenden Lebens bildet. Indessen, auch dieses ist augenscheinlich zu äußerlich, um für das Lebensziel, dem wir nachforschen, gelten zu dürfen. Dort hängt das Ziel, wie man meinen möchte, mehr von denen ab, die die Ehre erweisen, als von dem, der sie empfängt; unter dem höchsten Gute aber stellen wir uns ein solches vor, das dem Subjekte innerlich und unentreißbar zugehört. Außerdem macht es ganz den Eindruck, als jage man der Ehre deshalb nach, um den Glauben an seine eigene Tüchtigkeit besser nähren zu können; wenigstens ist die Ehre, die man begehrt, die von seiten der Einsichtigen und derer, denen man näher bekannt ist, und das auf Grund bewiesener Tüchtigkeit. Offenbar also, daß nach Ansicht dieser Leute die Tüchtigkeit doch den höheren Wert hat selbst der Ehre gegenüber. Da könnte nun einer wohl zu der Ansicht kommen, das wirkliche Ziel des Lebens in den Geschäften sei vielmehr diese Tüchtigkeit. Indessen auch diese erweist sich als hinter dem Ideal zurückbleibend. Denn man könnte es sich immerhin als möglich vorstellen, daß jemand, der im Besitze der Tüchtigkeit ist, sein Leben verschlafe oder doch nie im Leben von ihr Gebrauch mache, und daß es ihm außerdem recht schlecht ergehe und er das schwerste Leid zu erdulden habe. Wer aber ein Leben von dieser Art führt, den wird niemand glücklich preisen, es sei denn aus bloßer Rechthaberei, die hartnäckig auf ihrem Satz besteht. Doch genug davon, über den Gegenstand ist in der populären Literatur ausreichend verhandelt worden. Die dritte Lebensrichtung ist die der reinen Betrachtung gewidmete; über sie werden wir weiterhin handeln. Das Leben dagegen zum Erwerb von Geld und Gut ist ein Leben unter dem Zwange, und Reichtum ist sicherlich nicht das Gut, das uns bei unserer Untersuchung vorschwebt. Denn er ist bloßes Mittel, und wertvoll nur für anderes. Deshalb möchte man statt seiner eher die oben genannten Zwecke dafür nehmen; denn sie werden um ihrer selbst willen hochgehalten. Doch offenbar sind es auch diese nicht; gleichwohl ist man mit Ausführungen gegen sie verschwenderisch genug umgegangen. Wir wollen uns dabei nicht länger aufhalten. Förderlicher wird es doch wohl sein, jetzt das Gute in jener Bedeutung der Allgemeinheit ins Auge zu fassen und sorgsam zu erwägen, was man darunter zu verstehen hat, mag auch einer solchen Untersuchung manches in uns widerstreben, weil es teure und verehrte Männer sind, die die Ideenlehre aufgestellt haben. Indessen, man wird uns darin zustimmen, daß es doch wohl das Richtigere und Pflichtmäßige ist, wo es gilt für die Wahrheit einzutreten, auch die eigenen Sätze aufzugeben, und das erst recht, wenn man ein Philosoph ist. Denn wenn uns gleich beides lieb und wert ist, so ist es doch heilige Pflicht, der Wahrheit vor allem die Ehre zu geben. Die Denker, welche jene Lehre aufgestellt haben, haben Ideen nicht angenommen für diejenigen Dinge, bei denen sie eine bestimmte Reihenfolge des Vorangehenden und des Nachfolgenden aufstellten; das ist der Grund, weshalb sie auch für die Zahlen keine Idee gesetzt haben. Der Begriff des Guten nun kommt vor unter den Kategorien der Substanz, der Qualität und der Relation; das was an sich, was Substanz ist, ist aber seiner Natur nach ein Vorangehendes gegenüber dem Relativen; denn dieses hat die Bedeutung eines Nebenschößlings und einer Bestimmung an dem selbständig Seienden. Schon aus diesem Grunde könnte es keine gemeinsame Idee des Guten über allem einzelnen Guten geben. Nun spricht man aber weiter vom Guten in ebenso vielen Bedeutungen wie man vom Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 95 Seienden spricht. Es wird etwas als gut bezeichnet im Sinne des substantiell Seienden wie Gott und die Vernunft, im Sinne der Qualität wie wertvolle Eigenschaften, im Sinne der Quantität wie das Maßvolle, im Sinne der Relation wie das Nützliche, im Sinne der Zeit wie der rechte Augenblick, im Sinne des Ortes wie ein gesunder Aufenthalt, und so weiter. Auch daraus geht hervor, daß das Gute nicht als ein Gemeinsames, Allgemeines und Eines gefaßt werden kann. Denn dann würde es nicht unter sämtlichen Kategorien, sondern nur unter einer einzigen aufgeführt werden. Da es nun ferner für das Gebiet einer einzelnen Idee auch jedesmal eine einzelne Wissenschaft gibt, so müßte es auch für alles was gut heißt eine einheitliche Wissenschaft geben. Es gibt aber viele Wissenschaften, die vom Guten handeln. Von dem, was einer einzigen Kategorie angehört, wie vom rechten Augenblick, handelt mit Bezug auf den Krieg die Strategik, auf die Krankheit die Medizin; das rechte Maß aber bestimmt, wo es sich um die Ernährung handelt, die Medizin, und wo um anstrengende Übungen, die Gymnastik. Andererseits könnte man fragen, was die Platoniker denn eigentlich mit dem Worte »an sich« bezeichnen wollen, das sie jedesmal zu dem Ausdruck hinzufügen. Ist doch in dem »Menschen-an-sich« und dem Menschen ohne Zusatz der Begriff des Menschen einer und derselbe. Denn sofern es beidemale »Mensch« heißt, unterscheiden sich beide durch gar nichts, und wenn das hier gilt, so gilt es auch für die Bezeichnung als Gutes. Wenn aber damit gemeint ist, daß etwas ein Ewiges sei, so wird es auch dadurch nicht in höherem Maße zu einem Guten; gerade wie etwas was lange dauert deshalb noch nicht in höherem Grade ein Weißes ist, als das was nur einen Tag dauert. Größere Berechtigung möchte man deshalb der Art zuschreiben, wie die Pythagoreer die Sache aufgefaßt haben, indem sie das Eins in die eine der beiden Reihen von Gegensätzen einordneten und zwar in dieselbe, wo auch das Gute steht, und ihnen scheint sich in der Tat auch Speusippos angeschlossen zu haben. Indessen, dafür wird sich ein andermal der Platz finden. Dagegen stellt sich dem eben von uns Ausgeführten ein Einwurf insofern entgegen, als man erwidert: die Aussagen der Platoniker seien ja gar nicht von allem gemeint was gut ist, sondern es werde nur alles das als zu einer Art gehörig zusammengefaßt, was man um seiner selbst willen anstrebt und werthält; das aber was diese Dinge hervorbringt oder ihrer Erhaltung dient oder was das Gegenteil von ihnen verhütet, werde eben nur aus diesem Grunde und also in anderem Sinne gut genannt. Daraus würde denn hervorgehen, daß man vom Guten in doppelter Bedeutung spricht, einerseits als von dem Guten an sich, andererseits als von dem was zu diesem dient. Wir wollen also das an sich Gute und das bloß zum an sich Guten Behilfliche auseinanderhalten und untersuchen, ob denn auch nur jenes unter eine einzige Idee fällt. Wie beschaffen also müßte wohl dasjenige sein, was man als Gutes-an-sich anerkennen soll? Sind es etwa die Gegenstände, die man auch als für sich allein bestehende anstrebt, wie das Verständigsein, das Sehen, oder wie manche Arten der Lust und wie Ehrenstellen? Denn wenn man diese auch als Mittel für ein anderes anstrebt, so wird man sie doch zu dem rechnen dürfen, was an sich gut ist. Oder gehört dahin wirklich nichts anderes als die Idee des Guten? Dann würde sich ein Artbegriff ohne jeden Inhalt ergeben. Zählen dagegen auch die vorher genannten Dinge zu dem Guten-an-sich, so wird man verpflichtet sein, den Begriff des Guten in Ihnen allen als denselbigen so aufzuzeigen, wie die weiße Farbe im Schnee und im Bleiweiß dieselbe ist. Bei der Ehre, der Einsicht und der Lust aber ist der Begriff gerade insofern jedesmal ein ganz anderer und verschiedener, als sie Gutes vorstellen sollen. Mithin ist das Gute nicht ein alledem Gemeinsames und unter einer einheitlichen Idee Befaßtes. Aber in welchem Sinne wird denn nun das Wort »gut« gebraucht? Es sieht doch nicht so aus, als stände durch bloßen Zufall das gleiche Wort für ganz verschiedene Dinge. Wird es Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 96 deshalb gebraucht, weil das Verschiedene, das darunter befaßt wird, aus einer gemeinsamen Quelle abstammt? oder weil alles dahin Gehörige auf ein gemeinsames Ziel abzweckt? oder sollte das Wort vielmehr auf Grund einer bloßen Analogie gebraucht werden? etwa wie das was im Leibe das Sehvermögen ist, im Geiste die Vernunft und in einem anderen Substrat wieder etwas anderes bedeutet? Indessen, das werden wir an dieser Stelle wohl auf sich beruhen lassen müssen; denn in aller Strenge darauf einzugehen würde in einem anderen Zweige der Philosophie mehr an seinem Platze sein. Und ebenso steht es auch mit der Idee des Guten. Denn gesetzt auch, es gäbe ein einheitliches Gutes, was gemeinsam von allem einzelnen Guten ausgesagt würde oder als ein abgesondertes an und für sich existierte, so würde es offenbar kein Gegenstand sein, auf den ein menschliches Handeln gerichtet wäre und den ein Mensch sich aneignen könnte. Was wir aber hier zu ermitteln suchen, ist ja gerade ein solches, was diese Bedingungen erfüllen soll. Nun könnte einer auf den Gedanken kommen, es sei doch eigentlich herrlicher, jene Idee des Guten zu kennen gerade im Dienste desjenigen Guten, was ein möglicher Gegenstand des Aneignens und des Handelns für den Menschen ist. Denn indem wir jene Idee wie eine Art von Vorbild vor Augen haben, würden wir eher auch das zu erkennen imstande sein, was das Gute für uns ist, und wenn wir es nur erst erkannt haben, würden wir uns seiner auch bemächtigen. Eine gewisse einleuchtende Kraft ist diesem Gedankengange nicht abzusprechen; dagegen scheint er zu der Realität der verschiedenen Wissenschaften nicht recht zu stimmen. Denn sie alle trachten nach einem Gute und streben die Befriedigung eines Bedürfnisses an; aber von der Erkenntnis jenes Guten-an-sich sehen sie dabei völlig ab. Und doch ist schwerlich anzunehmen, daß sämtliche Bearbeiter der verschiedenen Fächer übereingekommen sein sollten, ein Hilfsmittel von dieser Bedeutung zu ignorieren und sich auch nicht einmal danach umzutun. Andererseits würde man in Verlegenheit geraten, wenn man angeben sollte, was für eine Förderung für sein Gewerbe einem Weber oder Zimmermann dadurch zufließen sollte, daß er eben dieses Gute-an-sich kennt, oder wie ein Arzt noch mehr Arzt oder ein Stratege noch mehr Stratege dadurch soll werden können, daß er die Idee selber geschaut hat. Es ist doch klar, daß der Arzt nicht einmal die Gesundheit an sich in diesem Sinne ins Auge faßt, sondern die Gesundheit eines Menschen, und eigentlich noch mehr die Gesundheit dieses bestimmten Patienten; denn der, den er kuriert, ist ein Individuum. / Damit können wir nun wohl den Gegenstand fallen lassen. 4. Kennzeichen und Erreichbarkeit der Eudämonie Wir kommen wieder auf die Frage nach dem Gute, das den Gegenstand unserer Untersuchung bildet, und nach seinem Wesen zurück. In jedem einzelnen Gebiete der Tätigkeit, in jedem einzelnen Fach stellt sich das Gute mit anderen Zügen dar, als ein anderes in der Medizin, ein anderes in der Kriegskunst und wieder ein anderes in den sonstigen Fächern. Was ist es nun, was für jedes einzelne Fach etwas als das durch dasselbe zu erreichende Gut charakterisiert? Ist nicht das Gut jedesmal das, um dessen willen man das übrige betreibt? Dies wäre also in der Medizin die Gesundheit, in der Kriegskunst der Sieg, in der Baukunst das Gebäude, in anderen Fächern etwas anderes, insgesamt aber für jedes Gebiet der Tätigkeit und des praktischen Berufs wäre es das Endziel. Denn dieses ist es, um dessen willen man jedesmal das übrige betreibt. Gäbe es also ein einheitliches Endziel für sämtliche Arten der Tätigkeit, so würde dies das aller Tätigkeit vorschwebende Gut sein, und gäbe es eine Vielheit solcher Endziele, so würden es diese vielen sein. So wären wir denn mit Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 97 unserer Ausführung in stetigem Fortgang wieder bei demselben Punkte angelangt wie vorher. Indessen, wir müssen versuchen dieses Resultat genauer durchzubilden. Wenn doch die Ziele der Tätigkeiten sich als eine Vielheit darstellen, wir aber das eine, z.B. Reichtum, ein Musikinstrument, ein Werkzeug überhaupt, um eines anderen willen erstreben, so ergibt sich augenscheinlich, daß nicht alle diese Ziele abschließende Ziele bedeuten. Das Höchste und Beste aber trägt offenbar den Charakter des Abschließenden. Gesetzt also, nur eines davon wäre ein abschließendes Ziel, so würde dieses eben das sein, das uns bei unserer Untersuchung vorschwebt, und bildete es eine Vielheit, dann würde dasjenige unter ihnen, das diesen abschließenden Charakter im höchsten Grade an sich trägt, das gesuchte sein. In höherem Grade abschließend aber nennen wir dasjenige, das um seiner selbst willen anzustreben ist, im Gegensätze zu dem, das um eines anderen willen angestrebt wird, und ebenso das was niemals um eines anderen willen begehrt wird, im Gegensatze zu dem, was sowohl um seiner selbst willen, als um eines anderen willen zu begehren ist. Und so wäre denn schlechthin abschließend das, was immer an und für sich und niemals um eines anderen willen zu begehren ist. Diesen Anforderungen nun entspricht nach allgemeiner Ansicht am meisten die Glückseligkeit, die »Eudämonie«. Denn sie begehrt man immer um ihrer selbst und niemals um eines anderen willen. Dagegen Ehre, Lust, Einsicht, wie jede wertvolle Eigenschaft begehren wir zwar auch um ihrer selbst willen; denn auch wenn wir sonst nichts davon hätten, würden wir uns doch jedes einzelne davon zu besitzen wünschen; wir wünschen sie aber zugleich um der Glückseligkeit willen, in dem Gedanken, daß wir vermittelst ihrer zur Glückseligkeit gelangen werden. Die Glückseligkeit dagegen begehrt niemand um jener Dinge willen oder überhaupt um anderer Dinge willen. Das gleiche Resultat ergibt sich augenscheinlich, wenn wir uns nach dem umtun, was für sich allein ein volles Genüge zu verschaffen vermag. Denn das abschließend höchste Gut muß wie jeder einsieht die Eigenschaft haben, für sich allein zu genügen; damit meinen wir nicht, daß etwas nur dem einen volles Genüge verschafft, der etwa ein Einsiedlerleben führt, sondern wir denken dabei auch an Eltern und Kinder, an die Frau und überhaupt an die Freunde und Mitbürger; denn der Mensch ist durch seine Natur auf die Gemeinschaft mit anderen angelegt. Allerdings, eine Grenze muß man wohl dabei ziehen. Denn wenn man das Verhältnis immer weiter ausdehnt auf die Vorfahren der Vorfahren, auf die Nachkommen der Nachkommen und die Freunde der Freunde, so gerät man damit ins Unendliche. Doch davon soll an späterer Stelle wieder gehandelt werden. Die Eigenschaft volles Genüge zu gewähren schreiben wir demjenigen Gute zu das für sich allein das Leben zu einem begehrenswerten macht, zu einem Leben, dem nichts mangelt. Für ein solches Gut sieht man die Glückseligkeit an; man hält sie zugleich für das Begehrenswerteste von allem, und das nicht so, daß sie nur einen Posten in der Summe neben anderen ausmachte. Bildete sie so nur einen Posten, so würde sie offenbar, wenn auch nur das geringste der Güter noch zu ihr hinzukäme, noch mehr zu begehren sein. Denn kommt noch etwas hinzu, so ergibt sich ein Zuwachs an Größe; von zwei Gütern ist aber jedesmal das größere mehr zu begehren. So erweist sich denn offenbar die Glückseligkeit als abschließend und selbstgenügend, und darum als das Endziel für alle Gebiete menschlicher Tätigkeit. Darüber nun, daß die Glückseligkeit als das höchste Gut zu bezeichnen ist, herrscht wohl anerkanntermaßen volle Übereinstimmung; was gefordert wird, ist dies, daß mit noch größerer Deutlichkeit aufgezeigt werde, worin sie besteht. Dies wird am ehesten so geschehen können, daß man in Betracht zieht, was des Menschen eigentliche Bestimmung Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 98 bildet. Wie man nämlich bei einem Musiker, einem Bildhauer und bei jedem, der irgendeine Kunst treibt, und weiter überhaupt bei allen, die eine Aufgabe und einen praktischen Beruf haben, das Gute und Billigenswerte in der vollbrachten Leistung findet, so wird wohl auch beim Menschen als solchem derselbe Maßstab anzulegen sein, vorausgesetzt, daß auch bei ihm von einer Aufgabe und einer Leistung die Rede sein kann. Ist es nun wohl eine vernünftige Annahme, daß zwar der Zimmermann und der Schuster ihre bestimmten Aufgaben und Funktionen haben, der Mensch als solcher aber nicht, und daß er zum Müßiggang geschaffen sei? Oder wenn doch offenbar das Auge, die Hand, der Fuß, überhaupt jedes einzelne Glied seine besondere Funktion hat, sollte man nicht ebenso auch für den Menschen eine bestimmte Aufgabe annehmen neben allen diesen Funktionen seiner Glieder? Und welche könnte es nun wohl sein? Das Leben hat der Mensch augenscheinlich mit den Pflanzen gemein; was wir suchen, ist aber gerade das dem Menschen unterscheidend Eigentümliche. Von dem vegetativen Leben der Ernährung und des Wachstums muß man mithin dabei absehen. Daran würde sich dann zunächst etwa das Sinnesleben anschließen; doch auch dieses teilt der Mensch offenbar mit dem Roß, dem Rind und den Tieren überhaupt. So bleibt denn als für den Menschen allein kennzeichnend nur das tätige Leben des vernünftigen Seelenteils übrig, und dies teils als zum Gehorsam gegen Vernunftgründe befähigt, teils mit Vernunft ausgestattet und Gedanken bildend. Wenn man nun auch von diesem letzteren in zwiefacher Bedeutung spricht als von dem bloßen Vermögen und von der Wirksamkeit des Vermögens, so handelt es sich an dieser Stelle offenbar um das Aktuelle, die tätige Übung der Vernunftanlage. Denn die Wirksamkeit gilt allgemein der bloßen Anlage gegenüber als das höhere. Bedenken wir nun folgendes. Die Aufgabe des Menschen ist die Vernunftgründen gemäße oder doch wenigstens solchen Gründen nicht verschlossene geistige Betätigung; die Aufgabe eines beliebigen Menschen aber verstehen wir als der Art nach identisch mit der eines durch Tüchtigkeit hervorragenden Menschen. So ist z.B. die Aufgabe des Zitherspielers dieselbe wie die eines Zithervirtuosen. Das gleiche gilt ohne Ausnahme für jedes Gebiet menschlicher Tätigkeit; es kommt immer nur zur Leistung überhaupt die Qualifikation im Sinne hervorragender Tüchtigkeit hinzu. Die Aufgabe des Zitherspielers ist das Zitherspiel, und die des hervorragenden Zitherspielers ist auch das Zitherspiel, aber dies als besonders gelungenes. Ist dem nun so, so ergibt sich folgendes. Wir verstehen als Aufgabe des Menschen eine gewisse Art der Lebensführung, und zwar die von Vernunftgründen geleitete geistige Betätigung und Handlungsweise, und als die Aufgabe des hervorragend Tüchtigen wieder eben dies, aber im Sinne einer trefflichen und hervorragenden Leistung. Besteht nun die treffliche Leistung darin, daß sie im Sinne jedesmal der eigentümlichen Gaben und Vorzüge vollbracht wird, so wird das höchste Gut für den Menschen die im Sinne wertvoller Beschaffenheit geübte geistige Betätigung sein, und gibt es eine Mehrheit von solchen wertvollen Beschaffenheiten, so wird es die geistige Betätigung im Sinne der höchsten und vollkommensten unter allen diesen wertvollen Eigenschaften sein, dies aber ein ganzes Leben von normaler Dauer hindurch. Denn eine Schwalbe macht keinen Frühling, und auch nicht ein Tag. So macht denn auch ein Tag und eine kurze Zeit nicht den seligen noch den glücklichen Menschen. Dies nun mag als ungefährer Umriß des Begriffes des höchsten Gutes gelten. Es ist zweckmäßig, den Begriff zunächst in grober Untermalung zu entwerfen und sich die genauere Durchführung für später vorzubehalten. Man darf sich dann der Meinung hingeben, daß jedermann die Sache weiterzuführen und die richtig gezeichneten Umrisse im Detail auszuführen vermag, und daß auch die Zeit bei einer solchen Aufgabe als Erfinderin oder Mitarbeiterin an die Hand geht. In der Tat hat sich der Aufschwung der Künste und Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 99 Wissenschaften in dieser Weise vollzogen; denn was noch mangelt zu ergänzen ist jeder aufgefordert. Zugleich aber müssen wir im Gedächtnis behalten, was wir vorher ausgeführt haben: wir dürfen nicht die gleiche Genauigkeit auf allen Gebieten anstreben, sondern in jedem einzelnen Fall der Natur des vorliegenden Materials gemäß die Strenge nur so weit treiben, wie es der besonderen Disziplin angemessen ist. So bemüht sich um den rechten Winkel der Zimmermann wieder Mathematiker, und doch beide in sehr verschiedener Weise. Der eine begnügt sich bei dem, was für seine Arbeit dienlich ist, der andere sucht das Wesen und die genaue Beschaffenheit zu erfassen. Denn das eben ist sein Fach, sich nach der reinen Wahrheit umzusehen. In derselben Weise muß man auch bei anderen Objekten verfahren, damit nicht die Hauptsache von dem Beiwerk überwuchert werde. Nicht einmal die Frage nach der Begründung darf man auf allen Gebieten gleichmäßig aufwerfen. Bei manchen Gegenständen ist schon genug damit geleistet, wenn nur der tatsächliche Bestand richtig aufgezeigt worden ist, so auch was die Prinzipien als Ausgangspunkt und Anfang anbetrifft. Die Tatsache ist das Erste und der Ausgangspunkt. Die Prinzipien werden teils auf dem Wege der Induktion, teils auf dem der Anschauung, teils vermittels einer Art von eingewöhntem Takt ergriffen, die einen auf diese, die anderen auf andere Weise. Da muß man nun versuchen, zu ihnen jedesmal auf dem Wege zu gelangen, der ihrer Natur entspricht, und dann alle Mühe darauf verwenden, sie richtig zu bestimmen; denn sie sind für das Abgeleitete von ausschlaggebender Bedeutung. Der Anfang ist nach dem Sprichwort mehr als die Hälfte des ganzen Werkes, und schon vermittels des Prinzips, von dem man ausgeht, tritt manches von dem in den Gesichtskreis, was man zu erkunden sucht. Wenn wir das Prinzip bestimmen wollen, so dürfen wir uns nicht auf unser Ergebnis und auf seine Begründung beschränken; wir werden gut tun, auch das zu berücksichtigen, was darüber im Munde der Leute ist. Denn mit der Wahrheit stehen alle Tatsachen im Einklang, mit dem Irrtum aber gerät die Wirklichkeit alsobald in Widerstreit. Man teilt die Güter in drei Klassen ein: in die äußeren Güter, die Güter der Seele und die des Leibes, und nennt die, welche der Seele zugehören, Güter im eigentlichsten und höchsten Sinne; die Betätigungsweisen und Wirksamkeiten der seelischen Vermögen aber rechnet man zu dem, was der Seele zugehört. Insofern darf man, was dieser altüberlieferten und von den Denkern einmütig geteilten Auffassung entspricht, zutreffend bemerkt finden, und zutreffend ist es auch, wenn als der Endzweck gewisse Betätigungsweisen und Wirksamkeiten bezeichnet werden; denn so kommt der Endzweck in die Klasse der geistigen, nicht der äußeren Güter zu stehen. Auch das stimmt zu unserer Auffassung, daß der, dem die Eudämonie eignet, ein erfreuliches Leben führt und es gut hat; denn als ein Leben im rechten Sinne und als subjektives Wohlbefinden ist die Eudämonie wohl von je aufgefaßt worden. Aber auch alles das, was man als Bestandteil der Eudämonie verlangt, ist augenscheinlich in unserer Bestimmung des Begriffes mit enthalten. Die einen fassen sie als Trefflichkeit überhaupt auf, die anderen heben Einsicht, wieder andere hohe geistige Bildung als herrschenden Zug hervor; diese Eigenschaften oder eine von ihnen denkt man sich in Verbindung mit der Lustempfindung oder doch nicht ohne sie, und manche wieder ziehen auch die äußeren Glücksumstände mit hinein. Einige dieser Bestimmungen stammen aus alten und weit verbreiteten Ansichten, andere wieder werden von wenigen, aber hervorragenden Autoritäten vertreten. Da ist es doch wohl anzunehmen, daß niemand von ihnen in allen Punkten irrt, sondern daß sie wenigstens in einem Punkte oder auch in den meisten recht behalten werden. Wenn man die Eudämonie als Trefflichkeit eines Menschen überhaupt oder doch als eine Seite derselben bezeichnet, so ist unsere Begriffsbestimmung ganz damit einverstanden; Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 100 denn es gehört ja dazu auch die solcher Trefflichkeit entsprechende Betätigung. Allerdings macht es einen nicht unbedeutenden Unterschied, ob man das Höchste und Beste in den bloßen Besitz oder in die tätige Bewährung setzt, also in eine innere Fertigkeit oder in die äußere Ausübung. Denn wo bloß die Fertigkeit vorhanden ist, da ist es doch immer möglich, daß sie nichts Gutes wirklich zustande bringt; so, wenn einer im Schlafe liegt oder sonst auf andere Weise untätig bleibt. Das nun ist völlig ausgeschlossen, sobald man in den Begriff die wirkliche Betätigung gleich mit hineinzieht. Denn da ergibt sich die Ausübung als notwendiges Zubehör, und zwar eine Ausübung im rechten Sinn. Wie man in Olympia nicht die schönsten und stärksten bekränzt, sondern diejenigen, die wirklich in den Wettkampf eintreten, / denn unter diesen befinden sich die, die den Sieg erringen, / so werden auch in dem praktischen Leben diejenigen des Guten und Schönen teilhaftig, die im rechten Sinne tätig sind. Ihr Leben ist denn auch schon an sich ein Leben voll innerer Befriedigung. Denn Freude ist ein seelischer Affekt, und jeder hat seine Freude an dem, wofür er Zuneigung hegt. Wer Pferde liebt, freut sich an Pferden, und wer Schauspiele liebt, an Schauspielen. Auf dieselbe Weise hat der Freund der Gerechtigkeit seine Freude am Gerechten, und überhaupt der Freund des Guten und Rechten an dem, was guter und rechter Gesinnung entspricht. Allerdings, was dem großen Haufen als vergnüglich gilt, das liegt miteinander im Streite, weil das nicht seiner Natur nach geeignet ist, Freude zu gewähren; denen dagegen, die das Edle lieben, macht dasjenige Freude, was seiner Natur nach erfreulich ist. Dahin nun gehört die Tätigkeit im Sinne des Guten und Rechten, und diese ist deshalb zugleich an sich erfreulich und den so Gesinnten erfreulich. Darum bedarf auch ihre Lebensführung keiner weiteren Quelle des Lustgefühls wie eines äußerlichen Anhängsels; vielmehr trägt es seine Freude in sich. Von unserem Satze gilt dann auch die Umkehrung. Wer nicht an edler Betätigung seine Freude hat der ist auch kein edelgesinnter Mensch. Niemand wird denjenigen gerecht nennen, der sich nicht am gerechten Handeln, noch hochgesinnt den, der sich nicht an hochsinnigen Handlungen freut. Und das gleiche gilt auch von allem sonstigen. Ist dem aber so, dann gewähren auch die von edler Gesinnung zeugenden Betätigungen an und für sich Befriedigung. Ebenso sind aber auch die Handlungen, und zwar jede im höchsten Sinne, gut und edel dann, falls ein edelgesinnter Mensch über sie das richtige Urteil hat; das hat er aber, wie wir oben bemerkt haben. Es ist also die Eudämonie, wie das Beste und Herrlichste, so auch zugleich das Lustvollste; das läßt sich nicht so voneinander trennen, wie es in der bekannten Delischen Inschrift geschieht: Wie das Gerechteste auch das Schönste, das Beste Gesundheit, So ist das Süßeste dies, wird einem das, was er liebt. Denn in den edelsten Arten der Betätigung findet sich das alles beisammen, und diese, oder falls eine von ihnen die alleredelste ist, diese eine verstehen wir unter der Eudämonie. Gleichwohl sieht man ein, daß sie, wie wir schon bemerkt haben, auch der äußeren Güter nicht wohl entbehren kann. Denn wo man nicht mit den nötigen Mitteln ausgestattet ist, ist es unmöglich oder doch nicht leicht, edle Handlungen zu vollbringen. Es gibt so vielerlei, zu dessen Bewerkstelligung man der Freunde, des Reichtums und des politischen Einflusses gleichsam als Werkzeuges bedarf. Manche Güter sind überdies derart, daß beim Mangel derselben das Glück doch nur ein getrübtes bleibt, wie edle Abkunft, wohlgeratene Kinder, stattliches Aussehen. Denn ein Mensch, der überaus häßlich von Gestalt, von niederer Herkunft oder im Leben vereinsamt und kinderlos wäre, besäße nicht das volle Glück; noch weniger allerdings würde es einer besitzen, wenn seine Kinder mißraten, seine Freunde wertlos, oder wenn sie zwar brav, aber ihm durch den Tod entrissen wären. Also wie wir Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 101 vorher gesagt haben, es scheint doch, daß auch solche äußeren Glücksumstände mit dazu gehören. Darum stellen denn auch manche das äußere Wohlergehen, wie andere die Trefflichkeit des Wesens mit der Eudämonie auf gleiche Linie. Daraus entspringt dann weiter die schwierige Frage, ob sie etwas ist, was durch Lernen, durch Gewöhnung oder sonst irgendwie durch Übung erworben werden kann, oder ob sie einem nach göttlichem Ratschluß oder auch durch bloßen Zufall zuteil wird. Wenn es nun auch sonst irgend etwas gibt, was den Menschen als Gabe der Götter zufällt, so wird die Annahme nahe liegen, daß auch die Eudämonie eine göttliche Gabe sei, und zwar eine solche im höchsten Sinne, je mehr sie unter allem was ein Mensch haben kann das Wertvollste ist. Indessen, diese Frage möchte doch wohl ihren eigentlicheren Platz in einer anderen Untersuchung haben; soviel ist jedenfalls klar, daß die Eudämonie, auch wenn sie nicht von den Göttern gesandt sein sollte, sondern durch Tüchtigkeit und auf dem Wege des Lernens und Übens errungen wird, zu dem gehört, was am meisten göttlichen Wesens ist. Denn der Kampfpreis und der Endzweck sittlicher Vollkommenheit erweist sich augenscheinlich als das Höchste, als etwas Göttliches und Seliges. Doch wird es zugleich einem jeden erreichbar sein müssen, als etwas, was die Möglichkeit bietet, allen denen, die nicht zu rechter Seelenverfassung von vornherein verdorben sind, auf dem Wege des Lernens und der Übung zuzufallen. Wenn es aber etwas Schöneres ist, zur Eudämonie auf diesem Wege statt durch bloßen Zufall zu gelangen, so ist auch anzunehmen, daß es wohl auf jenem Wege geschehen wird. Ist doch das was aus den Händen der Natur hervorgeht darauf angelegt, soweit als irgend möglich die höchste Vollkommenheit zu erreichen; und das gleiche ist auch bei dem der Fall, was des Menschen Kunst, wie bei dem was jede andere Ursache und am meisten was die erhabenste der Ursachen hervorbringt. Gerade das Größte und Herrlichste aber dem Zufall zuzuschreiben würde über alles Maß gedankenlos sein. Aber schon aus dem Begriff der Sache läßt sich die Antwort auf unsere Frage entnehmen. Wir haben die Eudämonie als eine bestimmte Form geistiger Wirksamkeit, der inneren Trefflichkeit entsprechend, bezeichnet. Von den übrigen Gütern nun sind die einen notwendig damit verbunden, die anderen von Natur bestimmt, ihr nach Art von Werkzeugen förderlich und hilfreich zu sein. Dies stimmt nun auch vortrefflich zu dem, was wir gleich im Eingang bemerkt haben. Wir haben dort das Ziel der Staatsgemeinschaft als das höchste hingestellt; diese aber betreibt dies als ihre bedeutsamste Aufgabe, die Staatsangehörigen mit gewissen Beschaffenheiten auszurüsten, also sie tüchtig und zu löblicher Lebensführung geeignet zu machen. Daß bei einem Rinde, einem Pferde oder sonst einem Tier von Eudämonie nicht die Rede sein kann, ist selbstverständlich; denn keines von ihnen bietet die Möglichkeit, zu solcher geistigen Wirksamkeit angeleitet zu werden. Aus dem gleichen Grunde kommt Eudämonie auch einem Kinde nicht zu. Kinder sind ihrer Altersstufe wegen noch nicht zu solcher Betätigung befähigt, und wenn man sie glücklich preist, so geschieht es in Hinsicht auf die Hoffnung, die sie für die Zukunft gewähren. Denn wie gesagt, es gehört dazu vollendete Innerlichkeit und ein vollendetes Leben. Im Leben aber begegnen uns zahlreiche Veränderungen und Wechsel jeder Art, und wer jetzt im schönsten Glückszustande blüht, kann möglicherweise im Alter von den furchtbarsten Schicksalsschlägen betroffen werden, wie sie in den Sagen vom trojanischen Kriege vom König Priamus berichtet werden. Wer aber solchen Glückswechsel erfahren und ein jammervolles Ende gefunden hat, dem schreibt niemand Eudämonie zu. Soll man nun auch sonst keinen Menschen glücklich preisen, solange er noch lebt? Muß man wirklich wie Solon meint erst das Ende abwarten? Gesetzt also auch, man müsse diesen Satz gelten lassen: wäre jemand dann wirklich glücklich, wenn er gestorben ist? Oder ist dies nicht vielmehr eine völlig widersinnige Ansicht, abgesehen von allem anderen schon aus dem Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 102 Grunde, weil wir die Eudämonie in einer Art von Wirksamkeit finden? Schreiben wir aber dem Gestorbenen keine Eudämonie zu, und ist es auch gar nicht das, was Solon hat sagen wollen, sondern vielmehr nur dies, daß man einen Menschen erst dann als einen, der nunmehr aus dem Bereiche des Übels und des Mißgeschickes entronnen ist, mit Sicherheit glücklich preisen kann, so gibt doch auch das wieder Anlaß zu einem Streit der Ansichten. Man möchte doch eher meinen, daß es für den Verstorbenen Schlimmes und Gutes gibt, wenn es doch dergleichen auch für den Lebenden gibt, ohne daß dieser es gewahr wird, wie Ehre und Schande, wie der Kinder und überhaupt der Nachkommen Wohlergehen und Mißgeschicke. Indessen ein Bedenken findet sich auch dabei. Wer bis zum hohen Alter ein glückliches Leben geführt und einen dem entsprechenden Tod gefunden hat, den können doch immer noch in seinen Nachkommen viele wechselnde Geschicke betreffen; es können die einen brav sein und ein ihrem Verdienst entsprechendes Lebenslos ziehen, während die anderen dazu das Gegenteil bilden. Offenbar ist auch die Möglichkeit gegeben, daß sie sich nach der Größe des Abstandes von den Vorfahren mannigfach verschieden verhalten. Nun wäre es doch eine seltsame Vorstellung, daß auch der Verstorbene ihre wechselnden Geschicke mit ihnen erlebte und danach bald glücklich, bald elend würde, und ebenso seltsam die Vorstellung, daß das Geschick der Nachkommen die Vorfahren gar nicht, auch nicht zeitweise, berühren sollte. Aber wir müssen zu unserer ursprünglichen Fragestellung zurückkehren; denn auf das, was wir jetzt zu ermitteln suchen, kann sich die Antwort vielleicht mit jener zusammen ergeben. Muß man das Ende abwarten und darf man jeden erst dann glücklich preisen, nicht wie einen der jetzt glücklich ist, sondern der es dereinst war: wie will man dabei den Widersinn vermeiden, wenn zu der Zeit wo einer wirklich glücklich ist, die Aussage, daß er es sei, nicht wahr sein soll, weil man den Lebenden wegen der möglichen Glückswechsel nicht glücklich preisen darf, oder auch deshalb, weil man sich die Eudämonie als etwas vorstellt, was dauert und in keiner Weise den Wechsel zuläßt, die Schicksale aber bei einer und derselben Person immer wieder einen Kreislauf durchmachen? Denn das ist ausgemacht: wenn wir uns nach dem Wandel der Geschicke richten, so werden wir einen und denselben Menschen wiederholt glücklich und nachher wieder elend nennen, und damit aus dem Glücklichen eine Art von Chamäleon oder ein Bild auf tönernen Füßen machen. Oder ist es nicht vielmehr völlig unstatthaft, sein Urteil nach dem Wandel der Geschicke einzurichten? Liegt doch das Wohl oder Wehe eines Menschen gar nicht in diesen: sondern wenn auch das menschliche Leben ihrer zwar bedarf, wie wir ausgeführt haben, so bleibt doch das Entscheidende die Handlungsweise, für die Eudämonie die der edlen Gesinnung, und für das Gegenteil die der entgegengesetzten Gesinnung entsprechende. Für unsere Auffassung nun zeugt auch das eben erörterte Bedenken. Denn nichts in den menschlichen Dingen besitzt eine solche Zuverlässigkeit wie die Äußerungen des sittlichen Charakters; man darf sie für noch dauerhafter halten als selbst die Erkenntnisse. Unter jenen selbst aber sind die am höchsten stehenden auch die dauerhafteren, weil das ganze Leben des Glücklichen in ihnen am tiefsten und am anhaltendsten aufgeht. Das darf man denn auch als den Grund ansehen, daß für sie niemals ein Vergessen eintreten kann. Ein glück-licher Mensch wird deshalb eben das besitzen, was wir für die Eudämonie in Anspruch nehmen; er wird, was er ist, sein ganzes Leben hindurch bleiben. Denn er wird immer oder doch vor allem anderen im Handeln wie im Denken die sittliche Anforderung vor Augen haben; die Geschicke aber, die ihn treffen, wird er auf das edelste tragen, in jedem Sinne, an jedem Orte wohlbedacht, in rechter Wahrheit ein wackerer Mann, fest gegründet und ohne Makel. Wenn nun das Geschick vielerlei nach Größe oder Geringfügigkeit seiner Bedeutung sehr Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 103 Verschiedenes mit sich bringt, so übt offenbar das Geringfügige, sei es ein Glücksfall, sei es das Gegenteil, keine besondere Einwirkung auf sein Leben; dagegen wird das nach Inhalt und Anzahl Beträchtliche, was ihm begegnet, sofern es erfreulich ist, sein Lebensglück noch vermehren. Denn es selbst hat von Natur die Bestimmung, zum Schmucke des Lebens zu dienen, und es gestattet eine Verwertung zu edlen und wackeren Handlungen. Sofern aber etwas von umgekehrter Bedeutung begegnet, schwächt und trübt es wohl den Glückszustand, indem es Kummer bereitet und für mancherlei Wirksamkeiten ein Hemmnis bildet; gleichwohl strahlt auch durch solche Bedrängnis noch der Adel der Seele hindurch, wo einer zahlreiche schwere Schicksalsschläge mit Gelassenheit trägt, nicht aus Unempfindlichkeit, sondern vermöge eines edlen und hochgestimmten Gemütes. Ist aber, wie wir nachgewiesen haben, das für das Leben Entscheidende die Äußerung in Handlungen, so kann kein Beglückter jemals elend werden; denn es kann ihm nie geschehen, daß er etwas täte, was häßlich und seiner unwürdig wäre. Denn dem in Wahrheit tüchtigen und besonnenen Manne trauen wir es zu, daß er jedes Geschick mit edler Haltung trägt und in jeder gegebenen Lage jedesmal das tut, was das Verdienstlichste ist, geradeso wie ein tüchtiger General das ihm anvertraute Heer zum Kriegszweck aufs angemessenste verwendet, oder wie ein Schuhmacher aus dem Leder das ihm zu Gebote steht, Schuhzeug von möglichster Vollendung bereitet, oder wie die anderen Gewerbtätigen, die es jeder in seinem Fache ebenso machen. Ist dem aber so, so kann der Glückliche zwar niemals elend werden; aber allerdings kann er auch kein Beglückter bleiben, wenn ihn ein Geschick wie das des Priamus träfe. Ist er doch nicht unstät noch von wandelbarem Sinne. Er wird nicht leicht aus dem Besitze der Eudämonie vertrieben werden können, auch nicht durch Unglücksfälle von beliebiger Art, die ihn treffen, sondern höchstens nur durch eine lange Reihe von sehr schweren Unglücksfällen. Und andererseits wird er nicht in kurzer Zeit aus solchem Unglück wieder zur Eudämonie gelangen, sondern wenn überhaupt, dann erst nach langem und beträchtlichem Zeitverlauf, wenn er während desselben bedeutsamer und herrlicher Gaben teilhaftig geworden ist. Was hindert also, denjenigen glücklich zu nennen, der in vollkommen edler Gesinnung tätig und mit äußeren Gütern hinlänglich ausgestattet ist, und das nicht während einer beliebigen Dauer, sondern in einem ganzen vollen Leben? Oder muß man noch hinzufügen, daß er in diesem Zustande auch künftig weiterleben und ein dem entsprechendes Lebensende finden muß, weil uns doch das Zukünftige nicht durchschaubar ist, und wir unter der Eudämonie den letzten Gipfel und das in jeder Beziehung durchaus Vollkommene verstehen? Ist dem nun so, so werden wir diejenigen unter den Lebenden als Beglückte bezeichnen, die das oben Bezeichnete jetzt besitzen und künftig besitzen werden, als Beglückte aber allerdings so weit, wie Menschen beglückt sein können. / Damit mag die Erörterung dieses Gegenstandes abgeschlossen sein. Daß aber das Geschick der Nachkommenschaft und befreundeter Menschen im allgemeinen zur Eudämonie nicht das geringste beitragen sollte, das ist offenbar eine überaus herzlose und der unter Menschen herrschenden Empfindungsweise zuwiderlaufende Ansicht. Die Geschicke, die die Menschen betreffen können, sind so zahlreich und zeigen so sehr alle möglichen Unterschiede; sie berühren zudem die Menschen so mannigfach, teils näher, teils weniger nahe, daß es umständlich und undurchführbar erscheint, jeden einzelnen Fall für sich besonders ins Auge zu fassen, und man es als ausreichend ansehen darf, einige allgemeine Betrachtungen darüber nur im Umriß mitzuteilen. Wenn, wie es für die eigenen unglücklichen Erlebnisse gilt, die einen für den Lebensgang von Gewicht und Bedeutung sind, die anderen leichter genommen werden können, und das gleiche auch für die Erlebnisse aller uns nahestehenden Menschen gilt; wenn ferner der Unterschied, den es macht, ob Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 104 ein Leid, es sei welches es wolle, jemanden während seiner Lebzeiten oder nach seinem Tode trifft, viel größer ist als der Unterschied, den es in einer Tragödie ausmacht, ob Freveltaten und furchtbare Geschicke der Handlung vorausliegen oder während derselben sich vollziehen: so muß man auch diesen Unterschied mit in Betracht ziehen, und vielleicht ist es in noch höherem Grade erforderlich, die Frage in betreff der Abgeschiedenen zu untersuchen, ob sie denn überhaupt noch von irgend etwas Erfreulichem oder dem Gegenteil wirklich berührt werden. Wenigstens möchte man nach dem, was wir eben bemerkt haben, annehmen, daß, gesetzt selbst es gelangte irgend etwas derartiges, es sei nun etwas Gutes oder das Gegenteil, bis an sie heran, es doch entweder an sich oder mit Bezug auf sie immer nur von schwacher und geringfügiger Wirkung bleiben wird, und wenn das nicht, daß es doch keinenfalls eine solche Größe und Beschaffenheit besitzen wird, um entweder diejenigen, die es nicht sind, glücklich machen, oder denjenigen, die es sind, ihren Glückszustand entreißen zu können. Es ist also wohl anzunehmen, daß das günstige Schicksal der ihnen nahestehenden Menschen ebensowohl wie das Mißgeschick derselben die Abgeschiedenen zwar irgendwie berühren, aber sie doch nur in der Weise und mit der Bedeutung berühren wird, daß sie weder aus glücklichen nicht-glückliche zu machen, noch sonst eine ähnliche Wirkung zu üben imstande sind. Nachdem wir diesen Gegenstand erledigt haben, wollen wir die Frage ins Auge fassen, ob die Eudämonie in die Reihe der bloß schätzbaren Dinge oder vielmehr in die der Dinge von unbedingtem Werte zu stellen ist. Zunächst, das eine ist klar, daß sie kein Zustand bloßen Vermögens ist; zugleich aber leuchtet ein, daß alles bloß Schätzbare deshalb geschätzt wird, weil es gewisse Eigenschaften hat und zu anderem in gewissen Beziehungen steht. So schätzt man den Gerechten, den Mutigen, überhaupt den Tüchtigen und die entsprechende Beschaffenheit wegen der von ihnen ausgehenden Wirkungsweisen und Leistungen; wir schätzen den Starken, den Behenden und so auch jeden sonst deshalb, weil er eine gewisse Eigenschaft von Natur besitzt und dadurch zu guten und wertvollen Leistungen irgendwie geeignet ist. Man ersieht das schon aus den Lobpreisungen, die den Göttern dargebracht werden. Hier erscheint es lächerlich, wenn man sie auf unser Niveau herunterziehen wollte; und das kommt daher, weil Lobpreisungen, wie wir gezeigt haben, ihre Begründung in der Wirksamkeit für etwas anderes finden. Begründet sich aber die Lobpreisung auf solche Leistung, so ist offenbar, daß das was dem Herrlichsten gebührt, nicht eine Lobeserhebung von dieser Art, sondern etwas Größeres und Erhabeneres ist, und das wird ihm denn auch wirklich erwiesen. Denn die Götter preisen wir selig und glücklich, und unter den Menschen ebenso diejenigen, die am meisten gottähnlich sind. Das gleiche gilt in Bezug auf die Güter. Die Seligkeit schätzt man nicht wie etwa das Gerechte, sondern man preist sie als etwas Gottähnlicheres und Erhabeneres. In diesem Sinne ist auch Eudoxos, wie man wohl sagen darf, als geschickter Anwalt für die Lustempfindung als des höchsten Preises wert eingetreten. Denn daß sie so wenig mit Lobeserhebungen bedacht wird, während sie doch zu den Gütern gehört, das, meinte er, zeige gerade an, daß sie etwas besseres sei als das, was sich Lob gewinnt. Von solcher Art nun sei Gott und das Gute, und nach diesem werde auch alles andere beurteilt. Denn Lobpreisung kommt hohen Vorzügen zu; durch diese wird man in den Stand gesetzt, edle Handlungen zu vollbringen; die Lobeserhebungen aber gelten den Leistungen, ebensowohl denen des Leibes wie denen der Seele. Indessen, darüber in genauere Einzelheiten einzugehen, ist wohl mehr die Sache derjenigen, die sich fachmäßig mit der Ausarbeitung von Lobreden abgeben. Uns wird aus dem Ausgeführten klar geworden sein, daß die Eudämonie zu den Dingen gehört, die unbedingten und uneingeschränkten Wert haben. Daß sie dazu gehört, wird schon dadurch Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 105 wahrscheinlich, daß sie Prinzip des Handelns ist; denn sie ist es, die jedermann in allem seinem Handeln als Ziel im Auge hat. Was aber Prinzip und Grund der Güter ist, das gilt uns als etwas unbedingt Wertvolles und Göttliches. 5. Die Trefflichkeit des Menschen Die Eudämonie ist die innerer Trefflichkeit entsprechende geistige Wirksamkeit. Wir haben also zunächst diese innere Trefflichkeit zu betrachten; dadurch werden wir dann auch wohl das Wesen der Eudämonie besser verstehen lernen. Auch der Staatsmann, der es im wahren Sinne ist, hat sich von je um sie vielleicht mehr als um alles andere bekümmert; denn seine Absicht ist gerade die, in den Staatsangehörigen Tüchtigkeit und Gehorsam gegen die Gesetze groß zu ziehen. Ein Muster dafür haben wir an den Gesetzgebern der Kreter und Lakedämonier und an denen, die etwa sonst das gleiche Ziel verfolgt haben. Wenn aber dieser Gesichtspunkt dem Gebiete der Wissenschaft vom Staate angehört, so entspricht offenbar die Erörterung, zu der wir nun übergehen, dem, was wir von Anfang an als unser Vorhaben bezeichnet haben. Es ist klar, daß was wir zu betrachten haben, die innere Trefflichkeit als die eines Menschen ist; haben wir doch auch das Gute als das für den Menschen Gute und die Eudämonie als die dem Menschen zukommende zu ermitteln gesucht. Unter der Trefflichkeit eines Menschen aber verstehen wir nicht eine Beschaffenheit des Leibes, sondern des Geistes, und so fassen wir auch die Eudämonie als eine geistige Betätigung. Ist dem aber so, so muß der Staatsmann offenbar bis zu einem gewissen Grade eine Kenntnis von der Natur des Geistes besitzen, gerade wie der Arzt, der die Augen kurieren will, auch den ganzen Leib kennen muß; ja, das Bedürfnis solchen Wissens ist bei jenem in demselben Verhältnis noch dringlicher, als die Staatskunst an innerem Wert und Bedeutung die Heilkunst überragt. Wissenschaftlich gebildete Ärzte geben sich in der Tat um die Kenntnis des Leibes die erdenklichste Mühe. So muß denn auch der Staatsmann das Wesen des Geistes erwägen, und zwar muß er solche Erwägung anstellen um der ihm gestellten Aufgabe willen und soweit als es für das was er anstrebt, hinreichend ist. Denn in die Einzelheiten noch genauer einzugehen, würde doch wohl größere Mühe in Anspruch nehmen als die Aufgabe erfordert. Darüber findet man auch in der geläufigen Literatur mancherlei ausreichend behandelt, und man wird gut tun, davon Gebrauch zu machen. Da heißt es unter anderm, daß in der Seele der eine Teil ohne Denkvermögen, der andere mit Denkvermögen ausgestattet ist. Die Frage aber, ob diese beiden von einander getrennt sind wie die leiblichen Organe und alles sonstige was nach Teilen gesondert ist, oder ob es nur der Auffassung nach zweierlei, seiner Natur nach aber ebenso untrennbar beisammen ist wie am Kreisbogen das Konvexe und das Konkave, das braucht uns bei unserem jetzigen Vorhaben nicht weiter zu beschäftigen. Der nicht mit Denkvermögen ausgestattete Seelenteil gleicht teils dem, was uns mit den Pflanzen gemein ist / dahin gehört das, was der Ernährung und dem Wachstum zugrunde liegt; denn ein solches seelisches Vermögen muß man doch wohl allen Wesen zuschreiben, die Nahrung aufnehmen, auch dem Embryo, und ganz ebenso den ausgewachsenen Geschöpfen; jedenfalls hat solche Annahme mehr für sich, als daß es ein anderes sein sollte. Die angemessene Beschaffenheit dieses Seelenteils ist, wie sich daraus ergibt, dem Menschen mit anderen Wesen gemeinsam und nicht spezifisch menschlich. Dieser Seelenteil und dieses Vermögen übt augenscheinlich seine Wirksamkeit am meisten im Zustande des Schlafes; wer Anhang: Aristoteles, Nikomachische Ethik (Auszug) 106 aber gut oder schlecht ist, das zeigt sich im Schlaf am wenigsten. Daher der Ausspruch, daß der Beglückte vom Elenden sich während der einen Hälfte des Lebens gar nicht unterscheidet; ein ganznatürliches Ergebnis. Denn der Schlaf ist ein Zustand der Untätigkeit der Seele gerade in der Beziehung, wonach sie tüchtig oder untüchtig genannt wird, allerdings mit der Einschränkung, daß in geringen Spuren immerhin manche Regungen bis an die Seele gelangen, so daß infolgedessen auch die Traumvorstellungen edelgesinnter Menschen lauterer sind als die beliebiger Persönlichkeiten. Doch genug davon. Von der vegetativen Seite dürfen wir absehen, da sie ihrer Natur nach an dem, was an der wertvollen Beschaffenheit das spezifisch Menschliche ausmacht, nicht beteiligt ist. Nun gibt es aber noch eine andere Seite der Seele, die den Eindruck macht ohne Denkvermögen zu sein, während sie zu demselben doch irgendwie in Beziehung steht. An einem enthaltsamen und einem unenthaltsamen Menschen ist es das Denkvermögen und der damit begabte Seelenteil, was wir schätzen: denn dieser liefert den Antrieb im rechten Sinne und in der Richtung auf das Edelste. Dann aber ist offenbar bei jenen beiden in ihrer Natur außerdem Denkvermögen noch etwas anderes wirksam, was diesem Vermögen widerstreitet und sich ihm entgegenstellt. Denn wie gelähmte leibliche Glieder, wenn die Absicht ist, sie nach rechts zu bewegen, sich ungeschickterweise gerade entgegengesetzt nach links wenden, so geht es auch in der Seele zu: die Antriebe gehen bei den Unenthaltsamen in die dem Gedanken entgegengesetzte Richtung. Nur nehmen wir beim Leibe die Ablenkung äußerlich wahr, bei der Seele nicht. So wird denn auch wohl in der Seele nicht minder als dort außer dem Denkvermögen noch etwas anderes anzunehmen sein, was sich ihm entgegenstellt und ihm widerstrebt. In welchem Sinne dies Element ein anderes ist, das geht uns hier nichts an. Doch steht offenbar auch dieses, wie oben bemerkt, zum Denkvermögen irgendwie in Beziehung. Beim Enthaltsamen wenigstens gehorcht es der Herrschaft der Vernunft, und vielleicht ist es bei einem besonnenen und einem willensstarken Menschen derselben noch willfähriger. Denn hier steht es mit dem Denkvermögen in vollem Einklang. Offenbar ist nun auch dieses Nicht-denkende in der Seele ein gedoppeltes. Denn das vegetative Element hat mit dem Denkvermögen keinerlei Gemeinschaft; dagegen steht das Begehrungs- und überhaupt das Willensvermögen zu demselben insofern in Beziehung, als es ihm unterwürfig und gehorsam zu sein vermag. So sagen wir ja auch, daß man zu seinem Vater und zu befreundeten Personen ein gedankenmäßiges »rationelles« Verhältnis innehält, das Wort natürlich nicht in dem Sinne genommen, wie es in der Mathematik gebraucht wird. Daß der nicht-denkende Seelenteil irgendwie von dem Denkvermögen sich überreden läßt, das zeigt schon der Gebrauch, den man von der Ermahnung wie von allen Arten des Tadels und der Anfeuerung macht. Gilt aber die Aussage, daß auch dieser Seelenteil ein Denkvermögen hat, dann ergibt sich, daß auch der denkende Seelenteil ein gedoppelter ist, denkend teils eigentlich und an und für sich, teils in dem Sinne wie ein Vermögen seinem Vater zu gehorchen ein denkendes Vermögen ist. Darin liegt nun auch der Einteilungsgrund für die Beschaffenheiten eines Menschen, die seine Trefflichkeit ausmachen. Wir weisen sie teils dem Intellekt, teils dem Willen zu, jene als dianoëtische, diese als ethische: Wissenschaft, Verstand und Einsicht als dianoëtische, Edelmut und Besonnenheit als ethische Beschaffenheiten. Sprechen wir vom ethischen Charakter, so sagen wir nicht, daß jemand wissenschaftlich gebildet oder verständig, sondern etwa, daß er sanftmütig oder besonnen ist. Aber unsere Hochachtung gewähren wir auch dem wissenschaftlich Gebildeten auf Grund dieser seiner geistigen Verfassung; diejenigen Arten geistiger Verfassung aber, die der Hochachtung würdig sind, bezeichnen wir als Trefflichkeiten und Vorzüge. [S. 1-26]